
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

H. Aulmann, Deckel einer Steinzeugkanne aus Grenzhausen, Museum zu Mettlach.
National in ihrem tiefsten Wesen ist die Steinzeugkunst des Westerwaldes. In unserm ganzen Vaterlande treffen wir keine Töpfergegend, die eine derart eigenartige und blühende Kunst erstehen ließ, wie in den waldigen Bergen, die zwischen Lahn und Sieg auf dem rechten Rheinufer sich ausbreiten. Nur die alten Erzeugnisse aus Köln und Raeren, die im innigsten Zusammenhang mit ihnen stehen, sind auf gleiche Höhe gelangt.
Es ist einzig und allein das Material selbst, das die Möglichkeit zu solcher Entwicklung in sich trug. Und so, wie Gold und Edelstein schon ihrem innersten Wesen nach höher zu schätzen sind als unedle Stoffe, so steht das Steinzeug, das Porzellan des Mittelalters und der Renaissance, an Adel und natürlichem Wert hoch über den schwachen, erdigen Produkten der Töpferei, der Majolika, der Fayence. Nicht umsonst hat man seit Jahrhunderten die Waren des Westerwaldes »steinern« genannt, man erkannte scharf und deutlich das Besondere dieser hochgebrannten Kunstprodukte, die hart, dicht, versintert, klingend wie Naturgesteine sich darbieten, mit milden Naturfarben und zartem Glanz.
Die Steinzeugtone aber, die aus den frühesten geologischen Epochen stammen, findet man nur in besonderen Gegenden, wo die alten Schichtungen der Erdbildung erhalten geblieben sind. Nur dort konnte sich, gleichsam aus dem Boden heraus, in organischer Entwicklung eine wahrhaft »bodenständige« Keramik entwickeln.
So ist Höhr im Westerwald das uralte keltische »Horle«, dessen Name bereits auf Ton und Kannen hindeutet. Als die Römer über den Rhein drangen und ihren Grenzwall zogen, da schufen sie, ihrer eigenen Heimat entnommen, blühende Töpfereien und Ziegeleien – ohne zu ahnen, daß tief in den Waldbergen eine bescheidene Industrie herrschte, die den Keim zu späterer hoher Kultur in sich trug. Wir finden in den Gräbern der germanischen Edelinge und Herzöge große, mächtige Urnen, roh und kraftvoll, adelig in Stoff und Form. Steinklingend schon manche, in langsamer, Jahrhunderte währender Entwicklung höheren Formen und Dekoren entgegenreifend – ein Abbild der gesamten germanischen Kulturentwicklung.
Schon damals haben die feingebildeten Römer von dem Naturvolk gelernt: hie und da, dem limes entlang, brannten sie Töpfe, in deren Resten wir heute kopfschüttelnd echtes Steinzeug erkennen, mit zarter Salzglasur bedeckt! Aber die Hauptmasse der Töpferei blieb germanisch, sie paßte nicht zur Überkultur und zur Zierform der Fremden. Ganz allmählich bildete sie sich aus, und erst mit dem sinkenden Mittelalter gab es eine deutsche Steinzeugkunst, die ihren Siegeszug in die nordische Kulturwelt antreten konnte.
Aus dem lebhafteren Verkehr, wie er in den Städten sich entwickelte, entstammte das Bedürfnis nach schöneren Formen, das Suchen nach Dekoren und Zierat. So erwuchs zuerst an der Nordgrenze des Westerwaldes, in der alten Abteistadt Siegburg, aus der uralten Töpferei für Gebrauchsgeschirre schon im 14. und 15. Jahrhundert ein eigenartiges Steinzeugkunstgewerbe, das fast keine romanischen Einflüsse spüren läßt.
Zur selben Zeit begann rheinaufwärts im Unterwesterwald eine Steinzeugindustrie aufzublühen, die berufen war, die Siegburger abzulösen und weiterzuführen. Das eigentliche kunstlose Töpfergewerbe war daselbst ebenfalls uralt, seit Jahrhunderten eingesessen. Auch hier brannten die Euler steinerne Gefäße mit zarter Salzglasur, meist feurig braune Krüge und Töpfe. Dabei war das Gewerbe ländlich, nicht zentralisiert in einer Stadt. Eine ganze Reihe von Orten ist zu nennen, welche zum Teil – und das ist das Wichtigste! – auch heute noch hohe Bedeutung in der kunstkeramischen Industrie besitzen, und zwar in neuester Zeit mehr denn je: Höhr, Grenzhausen, auch Grenzau, Hillscheidt sind die bedeutendsten. Den ersten Anstoß, das Gewerbe auf künstlerische Höhe zu bringen, gaben kluge Meister aus Raeren links des Rheines, das um die Mitte und das Ende des 16. Jahrhunderts ein so prachtvolles Kunststeinzeug schuf, daß selbst die Siegburger Arbeiten zum Teil in den Schatten gestellt wurden. Raerener Meister, deren Nachkommen heute noch im Unterwesterwalde wirken, wie die Mennicken und Kalb, wanderten gegen Ende des Jahrhunderts nach Grenzhausen und Grenzau aus und brachten Ideen und neue Techniken. Vor allem lernten die Westerwälder von ihnen das graue Steinzeug, verziert mit blanken blauen Schmalten (Kobaltglasuren) zu brennen, das in Raeren neben dem leuchtenden Rotbraun fabriziert worden war. Und nun zog auch aus Siegburg der Meister Knütgen aus nach Höhr, wo ebenfalls heute noch seine Nachkommen leben und wirken. Weshalb kamen all die Fremden in die stille, unbekannte Provinz? Wir mögen uns vorstellen, daß ihnen die Welt, besonders die Welt der Zunft zu enge wurde. Die alten Schriften deuten an, daß Knütgen in Pön genommen ward, also von Zunft wegen Strafe dulden mußte. Vielleicht auch wurden sie gerufen von den Landesherrn, die Ausschau hielten nach guten Meistern, um ihren Provinzen eine blühende Kunstindustrie zu schenken.
Und tüchtige Meister waren es, die eingewandert waren. Nicht umsonst wurden sie mit Privilegien ausgestattet, und wie eine Katastrophe scheint ihr Wegzug aus der Heimat gewirkt zu haben: Keine 20 Jahre dauerte es, daß die Siegburger Industrie von der höchsten Blüte jäh zum kläglichsten Verfall heruntersank. Es ist ein tragischer Sturz gewesen, den die Töpfer der alten Abteistadt erlitten; und die Kriegsstürme, die dann zu Anfang und Mitte des 17. Jahrhunderts die Gaue des deutschen Landes durchtobten, rissen den stolzen Bau der Siegburger Töpferindustrie vollends zu Boden. Das Gewerbe wurde unheilbar, von Grund auf vernichtet, die letzten Töpfer flohen vor den Schweden in die schützenden Wälder des Unterwesterwaldes – und bis heute ist die Siegburger Steinzeugkunst nicht wieder erstanden!
Auch die Kölner und Raerener Kunsttöpfereien verschwanden, und in den stillen Waldtälern des Unterwesterwaldes blühte nun eine neue Kunst empor, die sich wiederum völlig eigenartig entwickelte und vor allem den ganzen Prunk der Hoch- und Spätrenaissance und des Barocks prachtvoll zum Ausdruck bringt.
Von den Raerener Meistern hatten die Westerwälder die lebhafte Dekoration des rauchig gebrannten grauen Steinzeugs mit leuchtenden blauen Glasuren übernommen und arbeiteten sie zu prächtigen Wirkungen aus. Auch die zarten intimen Reize des weißgrauen Siegburger Scherbens, den sie anfangs von Knütgen übernommen hatten, mußten bald diesem kräftig gerauchten Grau und dem Leuchtblau weichen. Bald schufen sie eine noch schönere Schmalte, indem sie die Gläser mit Braunstein tief violett färbten, eine Technik, die mit vielen Brennschwierigkeiten zu kämpfen hat. Wettstreit und Ehrgeiz waren groß. Die eingewanderten Meister hatten lange ein Privileg auf die neueren Techniken und Dekore, und die Westerwälder mußten in langen Streitigkeiten durch Bittschriften und Bittgänge sich das Recht erkämpfen, den Graubrand und die Schmalten ebenfalls anwenden zu dürfen.
So entstand also im Westerwald, im »Kannenbäckerland«, zu Ende des 16. und das ganze 17. Jahrhundert hindurch, sogar während der wilden dreißig Kriegsjahre das berühmte »altdeutsche« Steinzeug der Renaissance. Wir freuen uns heute noch der prächtigen Formen dieser Krüge und »Krausen«, wie die reich verzierten Stücke genannt wurden, wir bewundern ihren feinen architektonischen Aufbau, die kräftige harmonische Wirkung der reichen Ornamente. Sei es, daß Wappen aufgelegt, Zierformen eingestempelt oder Ornamente eingeritzt wurden, stets ist alles aus einem Guß, von stiller, wuchtiger Größe. Von besonderer Eleganz waren die Schnabelkannen zum Eingießen des Weines; die Flach- und Ringkrüge (aus der Feldflaschenform entstanden) wurden zu den reichsten und prächtigsten Ziergefäßen ausgearbeitet; von figürlichen Friesen finden wir auf Krügen und Kannen wieder, wie in Siegburg, vielfach epische und biblische Motive liebevoll ausgestaltet; Flaschen und Maßkrüge, Kannenkrüge mit herrlichen Stern- und Rosettenverzierungen, Bauchkrüge und Blumenvasen, Tafelaufsätze und Fruchtschalen, Schreibzeuge und Sandstreuer, aber auch hervorragend schöne Blumenkübel und Gartenständer, sowie Dachspitzen – kurz alle erdenklichen Gegenstände und alle erdenklichen Formen und Ornamente schufen die unermüdlichen und geschickten Euler. Auch als das Barock sich aus der Renaissance entwickelte, wurde der bewegliche Geist der Westerwälder Künstler von der Zeitströmung befruchtet; immer reicher und phantasievoller werden Formen, Ornamente und Henkelansätze, sogar ganz eigenartige, materialechte Steinfiguren entstanden damals, die in Form und Auffassung älteren Figuren aus Porzellanmanufakturen oft nicht unähnlich sind.
Wie schon die unendliche Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse andeutet, haben wir es hier im 17. Jahrhundert mit einem äußerst blühenden Kunstgewerbe zu tun, das nicht nur in der Güte, sondern auch in der Masse seiner Fabrikate seinesgleichen sucht. Zur Zeit, als der Dreißigjährige Krieg seinem Ende zuging, dürfte seine höchste Blüte zu verzeichnen sein. Den modernen Menschen berührt diese Tatsache eigenartig: aber wir dürfen uns jene wilde Zeit nicht als einen zusammenhängenden Kriegszug vorstellen! Gerade die Berge und Täler des Kannenbäckerlandes, darinnen wir heute noch meilenweit durch die Wälder streifen können, blieben ziemlich verschont, wenn auch die Burg Grenzau einer streifenden Schwedenschar zum Opfer fiel. Die Kannenbäckerei hatte damals solche Bedeutung, daß sämtliche Meister all der verschiedenen Dörfer, von den Landesherren – Trier, Wied, Isenburg, Sayn, Metternich – unterstützt, eine mächtige gemeinsame Zunft gründeten, die von sieben Meistern geleitet wurde. Ein Kartell, ein »Trust« im kleinen. Die Zahl der selbständigen Meister soll darin auf 600 angestiegen sein – etwa das Sechsfache von all denen, die heute im Unterwesterwald tätig sind, selbst wenn Krugbäcker und Kannenbäcker kunstloser Betriebe dazu gezählt werden.
Natürlich trug die massenhafte Ausbreitung der erstmals von wenigen gediegenen Meistern geübten Kunst bald zum Verfalle bei, den wir in bedenklichen Ausartungen des Barockstils, in gequälten, auffallenden Plastiken wahrnehmen; die schöne Kunst der Flächengliederung und der farbigen Flächenornamente ging verloren. Aber wie ein gesunder innerer Kampf gegen diesen Verfall mutet es an, daß in einzelnen Werkstätten, und besonders in dem stillen einsamen kleinen Grenzau in dieser Zeit wunderschöne Ritz-Ornamente geschaffen wurden von einer so bewußten und so betonten Einfachheit und Eigenart, daß man von einer Sezession sprechen könnte. Oft gar nicht mehr an Renaissance oder gar Barock erinnernd entstanden einfache Krüge und Kannen, deren Hauptreiz der Künstler in farbige Flächenornamente zu legen suchte. Es ist begreiflich, daß Zierformen, die mit der Hand eingeritzt werden, schöner, frischer und eigenartiger wirken als die mehr oder minder konventionellen Beläge, die aus den vielbenutzten Hohlformen hervorgingen. Frisch und lebendig, die Farben von höchster Leuchtkraft, besonders oft ein herrliches Violett und auch Blau auf der grauen Salzglasur tragend, präsentieren sich noch heute diese Stücke, die künstlerisch an die feinste Prunkware der Renaissance heranreichen. –
Im Laufe des 18. Jahrhunderts aber starb die Kunst des Kannenbäckerlandes. Wohl mag die Majolika, die Fayence, dann auch das Porzellan, die nun immermehr hochkamen, unsere herrliche deutsche Steinzeugware verdrängt haben, aber auch die Kannenbäcker selbst legten durch ihr Zuviel die Axt an die Wurzel ihrer blühenden Industrie. Wie in Dornröschenschlaf versank das ganze reiche Kunstleben – Einmachtöpfe, Wasserkrüge wurden wieder das einzige Fabrikat. Traumhaft regte sich manchmal ein höheres Streben; einzelne Geschirre, Krüge, Kannen zeugten hin und wieder von verborgenem Leben.
Bis im deutschen Volke dann im vergangenen Jahrhundert das Sehnen und Drängen nach nationaler Einheit entstand und im ruhmreichen Kaiserfrieden der Traum Wahrheit geworden war. Da: reich, lebendig, farbenprächtig, in erstaunlich kurzer Frist erstand auch die alte deutsche Steinzeugkunst wieder im Westerwalde. Museen und Burgen öffneten ihre Pforten, die alten Formen und Ornamente erstanden zu neuem Leben. Viel wäre zu künden von den Strömungen und Kämpfen, die seitdem schaffen und wirken. Wie von jeher die Kunst des Westerwaldes in enger Berührung stand mit dem gesamten Kunstleben der Nation, so fühlen wir auch heute in unsern stillen Waldtälern deutlich den Pulsschlag aller technischen und künstlerischen Neu-Strömungen im Blute unseres deutschen Volkes.
So wohltätig das Erwachen des Alten, des »Antiken«, wie der Kannenbäcker sagt, gewesen ist – durch das technische Raffinement der Vervielfältigung und die daraus resultierende Massenproduktion mit bunten Farben, unscharfen Dekorationen, dicken Steingutglasuren und all dem – wurden die Nachahmungen bald den Prachtwerken der Väter möglichst unähnlich. Und mit vollem Rechte und wahrhaft erlösend setzte die Moderne ein, im engen Bunde mit moderner wissenschaftlicher Erforschung des Materials und der Feuertätigkeit der Glasurschmelzen. Trotz manches Extravaganten hat die Moderne mit dieser liebevollen und warmherzigen Vertiefung in Material und Technik gesiegt. Und erst jetzt entdecken wir neu die Schönheiten des Alten, seit wir nicht mehr als schwächliche Nachahmer, sondern als eigene schaffende Künstler uns mitfühlend ihm nähern. So ist die Moderne im Kannenbäckerland heute dem wahrhaft Antiken verwandt, wesensähnlich geworden, und Künstler wie Chemiker reichen den alten Meistern verständnisvoll die Hand.
Daß bedeutende Kulturwerte hier zu schaffen sind, erkannte auch der Staat: Seit 45 Jahren wirkt in Höhr still und geräuschlos die Keramische Fachschule, die dem Besucher wohl manches Fesselnde zeigen mag und in den letzten Zeiten sogar vom Ausland dankbar als Bildungsstätte gepriesen wird. Sie hat vielen Anteil an dem siegreichen Durchdringen moderner Strömungen, aber auch das Eigenstreben mancher Fabrikanten bewegt sich auf schöpferischen Bahnen. Heute arbeiten die bedeutendsten Künstler Hand in Hand mit der Industrie des Kannenbäckerlandes, die in der ganzen Kulturwelt wieder hohe Bedeutung gewonnen hat und – wenn wir die einfachen Gebrauchswaren mit heranziehen – in Höhr, Grenzhausen, Baumbach, Ransbach, Mogendorf, Hillscheidt zusammen etwa 3000 Personen lohnende und dankbare Beschäftigung gibt.
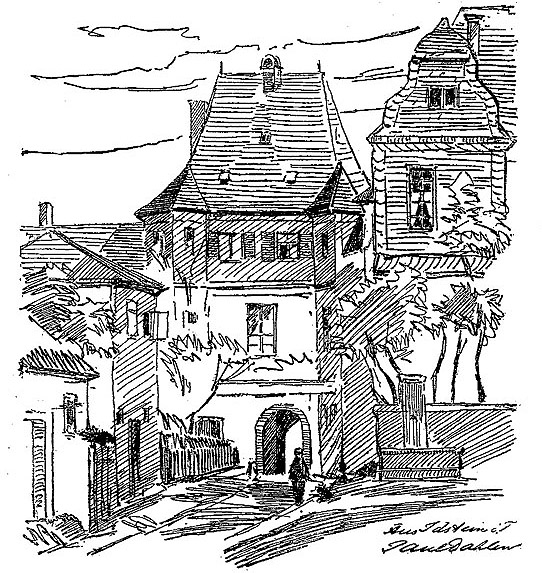
P. Dahlen. Aus Idstein i. T.

R. Biringer, Feldbergweg mit Altkönig.
Ihrer gibt es fast unendlich viele im Nassauer Land, und zu den Ringwällen, die sich geschlossen um die Berge ziehen, gesellen sich noch die Abschnittswälle, die nur hervorragende Teile eines Bergmassivs oder -rückens gegen das nähere Hinterland abschließen. Von diesen wird von vielen begangen und doch von wenigen gekannt die Wehr des Loreleiplateaus, ein anderer wurde schon in anderem Zusammenhang genannt, der Fichtenkopf von Neuhäusel. Von den Ringwällen sind die gewaltigsten im Taunus der Altkönig und unweit davon die Heidetränktalsperre, beide zusammen ein System, wenig nördlich der Lahn der Dünsberg bei Gießen, im oberen Dilltal der Heunstein, im Westerwald die Dornburg. Dazwischen reihen sich viele kleinere ein. In ihrer Gesamtheit besäumen sie z. T. die Ränder der Gebirgsmassive, so daß man ganz von selbst auf die Frage kommt, ob sie nicht einmal in Beziehung zueinander standen. Andere beherrschen im Binnengebiet wichtige Straßen wie die Alteburg bei Niederems, der Almerskopf bei Selbenhausen oder die Burg bei Rittershausen.
Fragt man einen Einwohner aus der Nachbarschaft eines Ringwalles nach dem Berg, so erzählt er gewiß allerhand Sagen, die über ihn im Umlauf sind. Da sollen Geister umgehen um die Mitternachtstunde oder Schätze vergraben sein, und zuweilen will sogar einer den Zugang dazu wissen. Oder man kann durch Pflücken einer gewissen Blume zu bestimmter Stunde des Schlüssels zur Schatzkammer habhaft werden. Die Fragen der Forschung freilich sind nüchterner und auch praktischer zu lösen: durch den Spaten. Er gibt uns über die Bauart der Wälle Aufschluß, und die mißachteten Scherben und andere Funde nennen uns Leute und Zeit, die die Berge befestigt haben. Mühselig allerdings und kostspielig sind solche Grabungen und ausgiebig nur für ein kundiges Auge.
Durchschneidet man einen Wall, so zeigt es sich bald, daß darin noch ein Stumpen Mauer steckt; die Masse davor und dahinter ist ihr Schutt. Mörtellos, nicht einmal mit Lehm, sondern trocken waren die Steine aufgesetzt. Halt gaben ihnen Holzgerüste, bei denen Anker gegenständige Pfosten durch die Mauer hindurch verbanden. Waren Steine in der Nähe wenig vorhanden, so wurden nur außen und innen Stirnmauern von 2-3 Fuß Dicke errichtet und der Hohlraum dazwischen mit Erde angefüllt. Manchmal sind die Verschalungen auch nur aus Holz gewesen, oder man hat überhaupt nur die Außenseite senkrecht befestigt und dahinter einen Wall aufgeschüttet. So wechselt das Bild von Fall zu Fall. Aus der Masse des Schuttes läßt sich die Höhe der Mauer annähernd bestimmen, wenn sich ihre Dicke hat feststellen lassen. Beide Maße sind bisweilen gewaltig: so ist eine Mauer des Altkönigs 6,50 Meter stark, eine andere des gleichen Berges 4,5 Meter hoch.
Vor den Mauern ist – besonders in germanischer Zeit – die Böschung künstlich versteilert worden. An ihrem Fuß liegt meist ein Graben, dessen Aushub für die Mauer verwertet wurde. Die Torstellen, vor denen die Gräben unterbrochen sind, sind naturgemäß verstärkt, da sie an sich schwache Stellen des Beringes bildeten.
Im ganzen gesehen müssen die so befestigten Berge einen ganz gewaltigen Eindruck gemacht haben. Für uns erhebt sich nur die Frage: Sind diese Burgen dauernd bewohnte befestigte Städte gewesen oder nur Fliehburgen, in die man sich im Falle der Not mit Hab und Gut, mit Kind und Kegel flüchtete, bis der Feind das Land wieder verlassen? Nur in ganz besonders günstigen, seltenen Fällen war für größere Mengen Menschen und Vieh hinreichend Quellwasser für längeren Aufenthalt vorhanden. Vielleicht ist die Dornburg mit ihrer dreiviertel Quadratkilometer großen Siedelungsfläche und ihren Quellen als dauernde Niederlassung anzusprechen. Auch der Fichtenkopf bei Neuhäusel ist lange bewohnt gewesen. Im allgemeinen aber sind die Wasserverhältnisse der Berge so dürftig, daß auch die künstlich angelegten Tagwasserbehälter nicht abhelfen konnten. Die mühsame Führung mancher Mauern steilste Hänge hinab nach einer Quelle läßt uns die Qual des Durstes spüren, der die Verteidiger bedrängte. So ist es von vornherein wahrscheinlich, daß man nur in Kriegszeit bei wirklicher Gefahr die Bergfesten bezog. Dafür spricht auch der Befund innerhalb der Wälle. Denn wohl treten Scherben fast überall zu Tag, und man sieht, daß einmal größere Menschenmassen da gehaust haben, aber andererseits ist die Menge der Funde nicht so, daß sie auf lange Dauer menschlichen Aufenthaltes schließen ließe. In ruhigen Zeiten bebauten die Leute eben in den umliegenden Tälern ihre Felder.
Das Bild, das hier von den Ringburgen in großen Zügen entworfen ist, hat im Nassauer Land für die Anlagen aller Zeiten allgemeinere Geltung. Im einzelnen muß natürlich vor allem die Zeitstellung der Befestigungen gewonnen werden. Es kann allein durch die Funde auf Grund ausgedehnter Grabung geschehen. Bisher ist mit ganz geringen Ausnahmen noch kein Ringwall älter als keltisch datiert. Freilich harren noch viele eingehender Untersuchung, und ein endgültiges Urteil wird noch lange nicht möglich sein. Aber aus ein paar gelegentlichen Einzelfunden, z.B. auf dem Dünsberg, die Befestigung in die Bronzezeit zurückzuführen, geht denn doch nicht an.
An anderer Stelle dieses Buches ist die frühgallische Anlage auf der »Burg« von Rittershausen schon genannt worden. Die Germanen haben sie nicht mehr benutzt, da die Front dieses Ringwalles offensichtlich nach Norden wies, ihre Gegner, die Römer, aber von Süden kamen. Auf der Goldgrube im Taunus und dem Altkönig sind keltische Funde gemacht worden. Die Annahme, daß hier Befestigungen erst dieses Volkes, dann der Germanen gewesen seien, hat also etwas für sich. Doch müssen eingehendere Grabungen erst diese Frage klären. Sicher ist nur, daß der letzte Ausbau dieser Berge durch die Germanen vollzogen wurde.
Neben den rein keltischen und gemischtzeitlichen Ringwällen stehen – anscheinend weitaus in der Mehrzahl – die rein germanischen. Der Dünsberg bei Gießen muß eine der Hauptburgen dieses Volkes gewesen sein, von Bedeutung auch der Heunstein bei Dillenburg. Beide, auch der Almerskopf bei Merenberg, sind erst in den Kämpfen gegen die Römer entstanden. Der Heunstein ließ sogar mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die Bauschichten der augusteischen Feldzüge, die mit der Schlacht im Teutoburger Walde ihre Wendung zuungunsten der Römer nahmen, und des domitianischen Chattenkrieges scheiden.
Die Ringburgen dieser Zeit führen uns also in die Frühzeit deutscher Geschichte hinein, deren Ereignisse den modernsten nicht unähnlich waren, und diese Riesenbefestigungen mit ihrer planvollen Anlage und ihren gewaltigen Pionierarbeiten lassen uns ihren Erbauern große Achtung abgewinnen. Welche Ordnung und Zucht muß innerhalb des Volkes, das sie erbaute – hier handelt es sich im wesentlichen um die Chatten – geherrscht haben, um allein die Leute zu solchen Arbeiten zusammenzuhalten. Bedenken wir weiter, daß alle die Burgen des Westerwaldes und Taunus in dieser Zeit als eine große Wehr des Landes zu betrachten sind, so erhellt, daß dieses Volk ein außerordentlich straffes Staatsgefüge besessen haben muß, von dem man aus anderen Quellen nur wenig weiß.
So sind die Ringwälle mit die wertvollsten Zeugnisse nicht nur unserer engeren Heimat, sondern überhaupt deutscher Frühzeit, und wir haben alle Veranlassung, sie unseren Nachfahren zu erhalten, daß nicht eine spätere Zeit, die wieder mehr Sinn für unsere Vergangenheit hat als die Gegenwart, Steine auf uns werfen wird.