
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die von der Schweiz nach den Niederlanden gerichtete Linie des Rheins teilt sich da, wo der Main in sie mündet und stark genug daherfließt, um den Rhein auf eine kurze Strecke in seinen Weg zu zwingen, gabelförmig. Die eine dieser beiden nach Norden weisenden Senken setzt sich im Strom selber fort, die andre weist nach Hamburg. Sie ist eine der großen Schnellzugsstrecken. In der ganzen Welt gibt es keine Linie, die bei ihrer verhältnismäßigen Kürze von einer so dichten Reihe von Hochschulen besetzt wäre; ein untrüglicheres Zeichen gesteigerten Lebens ist kaum zu denken; an ihr liegen, mit Basel beginnend, die Universitäten und Hohen Schulen von Freiburg, Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim und Darmstadt, dann Frankfurt, Gießen, Marburg, Göttingen, Braunschweig, Hannover und Hamburg. An der Stelle aber, wo Rhein und Main einander begegnen, liegt der seit altgeschichtlicher Zeit bedeutende Landstrich der fränkischen Erde mit Frankfurt selber in der Mitte. Diese einst Freie Reichsstadt bewahrte ihre alte stadtstaatliche Selbständigkeit bis zur Annexion durch Preußen; ihre ehrwürdigen Hoheitsrechte waren wie die von Köln ein letzter Überrest mittelalterlich selbständigen Städtewesens im Rheintal, das einmal im rheinischen Städtebund seinen Weg zu einer kräftigen demokratischen Staatsform gesucht hatte. Die Politik des freien Frankfurt, dem es an kriegerischen Neigungen durchaus gebrach, ist immer ein wenig die des hausväterlichen, klugen, welterfahrenen Kaufmanns gewesen.
Niemals seit den Söhnen Karls des Großen war Frankfurt der Sitz oder das Eigentum einer der zahlreichen deutschen Dynastien, dennoch sah diese Stadt mehr politisches Getriebe in ihren Mauern als irgendeine des innern Europas. Sie hat den Dreißigjährigen und den Siebenjährigen Krieg überdauert, ohne zerstört zu werden. Frankfurt war, was es als Verkehrsstadt und als Hauptstadt eines großen Wirtschaftsgebietes noch heute ist, schon vor einem Jahrtausend. Der Dom und der Römer zu Frankfurt waren der Schauplatz glanzvoller Kaiserkrönungen, wichtiger Reichstage, großer politischer Zusammenkünfte. Das Mainufer mit seinen Speichern, Kranen und Gewölben war Jahrhunderte hindurch der berühmte Ort der Frankfurter Messe, die zweimal jährlich die Handelsleute aus allen Enden Europas versammelte. Aus Franken und Sachsen, aus den Niederlanden wie aus der Schweiz sowie aus dem Elsaß und Lothringen brachten Planwagen und Lastschiffe die Gütermengen nach Frankfurt und führten sie nach Ende der Messe in neuer Verteilung nach allen Richtungen der Windrose, nach England, Italien, Böhmen und Polen davon. Mitten in dem bunten Treiben dieser Gütermesse lagen die Gewölbe und Stände der Buchhändler und Drucker. Schon wenige Jahrzehnte nach Erfindung der Buchdruckerkunst stand Frankfurt an der Spitze des europäischen Buchhandels. Peter Schöffer, Christian Egenolff, Siegmund Feyerabend, Andreas Wechel, Matthias Merian, das sind nur wenige aus den Namen jener großartigen Zeit. Das erste Volksbuch mit der Sage vom Doktor Faust erschien in Frankfurt um 1587, und noch im 17. Jahrhundert war die Büchererzeugung der Mainstadt mit ihren zahllosen Auflagen gelehrter Folianten und volkstümlichen Streit- und Flugschriften unermeßlich. Von seiner vielseitigen und überragenden Bedeutung für das Buchgewerbe ist Frankfurt in den spätern Jahrhunderten herabgestiegen; heute zeigen seine stark beschäftigten graphischen Gewerbe, denen eine Anzahl bedeutender Buchverlage zugehört, einen Wiederaufstieg. Einige der großen, neuzeitlichen, über die Welt bekannten Schriftgießereien des heutigen Frankfurt gehen übrigens in ihrer Wurzel noch bis in das mittelalterliche Frankfurt zurück, das den Druckern bis nach Holland und Italien seine schöngeschnittenen Bleibuchstaben lieferte.
Man wird sich daran gewöhnen müssen, das ganze Stromgebiet des Rheins von Rotterdam bis an den Bodensee als eine natürliche Einheit zu erkennen. So wie die einzelnen Landschaften dieses Gebiets durch den Strom, der sie verbindet, zur Großlandschaft zusammenwachsen, so wachsen aber auch ihre wirtschaftlichen Einzelgebiete langsam zur größern Einheit zusammen. Am dichtesten besiedelt und vom größten Schwergewicht ist der Bereich der auf Kohle und Eisen gegründeten Industrien, der sich von Westfalen über den Rhein bis an die Mündung der Schelde erstreckt. Die jüngste dieser Einheiten wächst am Oberrhein empor, sie reicht von Basel bis zum östlichen Zipfel des Bodensees; ihre kommende Bedeutung stützt sich auf die Wasserkraftwerke dieses Oberrheins mit seinen neuen elektrochemischen Industrien. In der Mitte aber liegt das mittelrheinische Wirtschaftsgebiet mit seinen Ausläufern an Main und Neckar. Es umfaßt die Ufer des Rheins von Biebrich-Wiesbaden bis Ludwighafen, es umfaßt die Mainebene von Mainz bis Hanau und den Neckar aus dem Winkel von Mannheim heraus bis Heidelberg. Diese von Flußschiffahrt und Eisenbahnen belebte Fläche ist das Gebiet eines gewaltigen Umschlaghandels und hochentwickelter fertigverarbeitender Industrien, deren wissenschaftliche Grundlagen vor allem Chemie und Mechanik sind. Und in der Mitte jener noch jungen Industriegründungen am untern Mainlauf, die sich von Gustavsburg über Rüsselsheim und Höchst bis Offenbach mit seinen hundertfünfzig Lederwarenfabriken und bis zur Goldschmiedestadt Hanau fortsetzen, liegt Frankfurt, die Fabrikstadt. Die Industrieviertel dehnen sich an den Flanken der alten Stadt mainaufwärts bis zur Mainkur, mainabwärts bis nach Griesheim und Höchst; sie umfassen jene chemischen Werke, deren Farben in den Kleidern der ganzen Welt bis in die Tiefen Chinas und Südamerikas hineinleuchten. Frankfurt hat seine eignen Industrien spät gegründet; es hat den Weg zur Industrie zuerst über die bankmäßige Industriebeteiligung seiner Geldinstitute beschritten. Es hielt vor allem seine alte Bedeutung als Handelsstadt aufrecht und fand erst durch die sich immer weiter ausbreitenden, zu einem wahren Weltnetz ausgesponnenen Beziehungen seines Metallhandels den Weg zu den Werkstätten selber. Dasselbe Frankfurt, das vor hundert Jahren noch die Stadt der weltgebietenden Börse und der wichtigsten Bankhäuser des europäischen Festlandes war, kehrte nun zu seinem Boden zurück und wurde zum Standort wichtiger Industrien. So ist es Handels- und Arbeitsstadt zugleich geworden; seine berühmten Oberbürgermeister, Miquel und Adickes, haben früh die Bedeutung des Mainweges zwischen Rhein und Donau erkannt und allen Einfluß der Stadt aufgewandt, um den Ausbau des Mains zur modernen Schiffahrtsstraße zu fördern; sie haben durch die Anlage des Westhafens und des noch vor dem Kriege vollendeten Osthafens die beträchtliche Entwicklung vorweggenommen, die unser Zeitalter der binneneuropäischen Kanalpolitik einleitet. Die Namen der Rothschild, Bethmann, Passavant, de Neufville gehören heute zum Teil schon dem alten historischen Frankfurt an, mögen auch einzelne von ihnen noch in gesunden Zweigen fortleben. Neben der ansehnlichen Zahl seiner alten und jüngern Privatbanken sind jetzt auch alle die Großbanken Deutschlands mit dem unpersönlichen steinernen Stil ihrer Paläste an den Straßenzügen des modernen Frankfurt vertreten; die großen Konzerne des Metallhandels ordnen sich um die von Wilhelm Merton gegründete Metallgesellschaft, um die Veer-Sondheimer-Gruppe, um Adler jun. Die Fahrradwerke, Telephonfabriken, Apparatebauanstalten bauen ihre Arbeitsorganismen auf Metall und Mechanik; ihr Zeichen ist die Drehbank. Wie am westlichen Ende der Stadt, so entstanden auf dem neu geebneten Gelände des Osthafens Mühlen, Fabriken, Kontorhäuser und Lager. Dieses von breiten, proletarischen Stadtgürteln eingeschlossene, von den Dämpfen seiner Fabrikschornsteine umzogene Frankfurt mit seinen fast zum Gürtel gewordenen Bahnanlagen und seinen zahlreichen Bahnhöfen, die den siebenundzwanziggeleisigen Hauptbahnhof entlasten, vollzieht an sich selbst immerfort den Umschwung in einen Hamburg verwandten Charakter. Unzerstörbar in seinem sachlichen Ausdruck, tritt diese Stadt in die Reihe jener neuen Städte mit alten Namen, die am Bande des Rheins ihren modernen Zusammenhang immer deutlicher spüren: zu Rotterdam, Köln und Basel.
Das Rheintal war einst der Weg der Mittelmeerkultur in den Norden, es war die Wiege der germanisch-romanischen Zivilisation, der Grundlage des europäischen Lebens. An dieser großen, nordsüdlich gerichteten Kulturstraße tat Frankfurt als Ort der Messe und des Bücherhandels seinen unvergeßlichen Dienst; als Bank- und Wechselplatz fand es seinen Vorteil in der Mitte zwischen den wichtigsten Plätzen Europas und im Wechsel der Epochen. Europäische Veränderungen haben begonnen, die Bedeutung des Rheintals zu ändern. Das Rheintal wird heute als eine der wichtigsten Verbindungen des Weltmeeres mit dem Binnenlande verstanden, und auch in dieser noch nicht abgeschlossenen Umstellung, die allen Strömen, Hafenorten und Binnenplätzen Europas einen neuen Stil gibt, findet Frankfurt ohne weiteres seinen Platz. Im Absterben der alten Messe, im Verfall des alten Römischen Reiches Deutscher Nation, im Aufstieg des kapitalistischen Zeitalters, in den Rückwirkungen des Weltkrieges hatte diese alte Stadt ihre Nöte wie alle, aber ihr Lebenswille blieb ungebrochen, sie erwies sich als wandelbar genug, um weltbürgerlich zu sein wie die großen Dichter und Maler, die die innern Kräfte des Bodens dieser Stadt verkörperten. Frankfurt verdankte der Geschicklichkeit, dem Einfluß und der Fürsprache seiner bedeutenden Kaufleute und Bankherren die politische Freiheit bis in unsre Zeit hinein und seinen oft etwas gravitätisch zur Schau getragenen Wohlstand. Etwas von jener Großzügigkeit drückt sich in dem alten Sprichwort aus, daß Frankfurt gewohnt sei, vierspännig zu fahren.
Die Einsicht in die unzerstörbaren Möglichkeiten des Ortes und die Forderungen des Handeltreibens brachten unmittelbar nach dem Kriege die Frankfurter Messe in neuen Formen zum Entstehen. Dieses Wiedererstehen der Messe rechtfertigt das Erinnern an die alte, die einst aus dem juristischen Vorzug des kaiserlichen Privilegs neben dem geographischen ihre Gewinne zog. Die werkbundmäßigen, künstlerisch strengen Gebäude der Messe, ihre Plätze und Hallen, auf Turmhäuser und Säulengänge eingerichtet, beginnen dem Gesicht der Stadt einen neuen Zug einzufügen. Das Geheimnis in diesem Gesicht des heutigen Frankfurt ist der Wettstreit der schwarzen und der weißen Kohle. Frankfurt liegt auch hier auf der Linie der Übergänge. Bis zum Main herab wirkt die wirtschaftliche Nähe des niederrheinischen Kohlengebiets, aber auch die im Süden Deutschlands erschlossenen Wasserkräfte senden ihre Ausstrahlungen bis hierher, man erinnert sich des klassischen Versuchs der Frankfurter Elektrizitätsausstellung von 1890, die Energie der Stromschnellen bei Lauffen bis nach Frankfurt zu führen. Die neue Frankfurter Messe ist gewiß von der alten so verschieden wie die Neuzeit selber vom Mittelalter; aber ihre Bedeutung ist dieselbe. In der systematischen Anlage ihrer Einzelgebiete, in der technischen und architektonischen Einkleidung des Ganzen, im Ausstreuen ihrer Vertretungen über die Welt, in der Schaffung fester Arbeitsgemeinschaften mit Hamburg und mit den Handelsorganisationen des Auslandes hat sie manches Vorbildliche geschaffen, sie ist zu einem der Pioniere des kämpfenden deutschen Wirtschaftslebens geworden; welches wird ihre Rolle in der jetzt anbrechenden Epoche der Ausbeutung Deutschlands durch das amerikanische Weltkapital sein?
Neues nationales Leben kündet sich im Westen des Reiches an, begleitet von neuen internationalen Beziehungen. Die stürmische Industrieentwicklung der neunziger Jahre schien auch Frankfurt mit der Gefahr zu bedrohen, eine Allerweltsgroßstadt zu werden. Wuchtigen Neubauten, brutalen Durchbrüchen fiel manches kostbare und unersetzliche Baudenkmal einer reichen Vergangenheit ohne innere Nötigung zum Opfer. Diese chaotische Entwicklung hat aufgehört. Frankfurt bewahrte im jähen Auf und Nieder der Wirtschaftskurve seine Bedeutung als einer der großen Brennpunkte der europäischen Wirtschaft; es verlor trotz allem nicht seine Eigenart, es vertieft sie eher. Man sehe nur, was eine Handvoll tatkräftiger Männer in wenigen Jahren aus dem einst verachteten, von gänzlicher Verunstaltung bedrohten Kern der innern Stadt gemacht haben: eine Augenfreude, ein Gewoge wie von bunten Schiffen und Barken um den roten Sandsteinfels des Domes, dessen schöner Turm mit der gedrungen ästigen Spitze hoch in die Schluchten niederschaut. Daneben eine Fundgrube künstlerischer und kunstgeschichtlicher Entdeckungen.
Frankfurt, die Großstadt, hat den Vorzug eines organischen Wachstums, den ihr das räumige und leicht gewellte Gelände der Ebene vor den Höhen des Taunus gewährt. Man kann in dieser Stadt nur die drei Straßenzüge großstädtisch nennen, die an der laut umbrandeten Hauptwache zusammenstoßen. Alles übrige trägt das Gepräge einer gemächlichen, fast passiven Lebensentwicklung. Die Kontorgebäude dieser Handelsstadt liegen nicht in einer lärmenden City, ihre Fabriken nicht in stinkenden, vernachlässigten Vororten. Die meisten ihrer Arbeitsstellen liegen an ruhigen Straßen und im Grünen. Ihre Bevölkerung erneuert sich stetig aus den dörflichen und kleinstädtischen Bevölkerungen der benachbarten Landschaften, aber in ihrem ganzen Ausdruck, bis in den der Sprache hinein, ist sie einheitlich. Das kommt daher, daß Taunus, Odenwald, Rhön und Spessart, die Frankfurt in der Weite umkränzen, ihrer Staatlichkeit nach zwar preußisch, hessisch und bayrisch sind, aber alle diese Gebiete denselben Typus des fränkischen Menschen hervorbringen, der ja mit dem Typus des abwärtigen Rheinlands am nächsten verwandt ist. Über diesen breiten, bodenständigen Massen des Alt- und Neufrankfurtertums und in sie hineingewoben ist die kosmopolitische Schicht der Besitzenden und Eingeweihten, deren Aufmerksamkeit auf die Sachen des Geldes und der Fernbeziehungen ebenso unerschütterlich ist wie auf ihre Bereitschaft, sich in Neuyork und London wie auf dem eignen Boden zu bewegen.

R. Biringer, Nied.
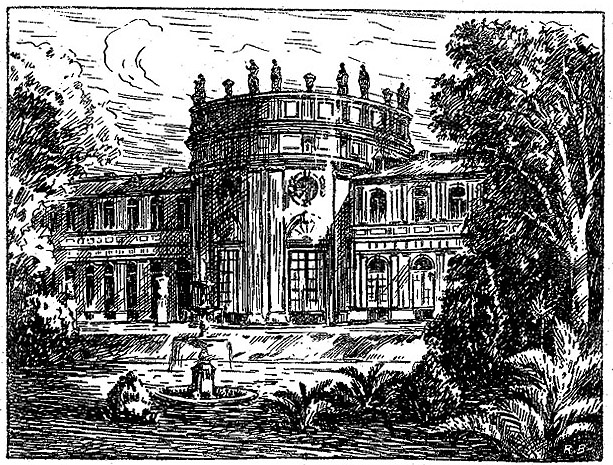
R. Biringer, Schloß Biebrich.
Wie dem Lande, das den Namen Nassau trägt, ein beherrschender Mittelpunkt in der Gestaltung seiner Oberfläche fehlt und diese zum mindesten zweigipflig angeordnet erscheint, so mangelt auch dem Menschentum, das sich unter jenem Namen gesammelt hat, von Anfang seines staatlichen Werdens an der beherrschende und überragende Zentralpunkt, nach dem sich die staatliche Entwicklung hin orientieren könnte. Dezentralisation war daher das natürliche, Zentralisation das künstliche Entwicklungselement in der nassauischen Geschichte; das Widerspiel dieser beiden Kräfte aber wurde weder durch die sich führend durchsetzende Macht eines Mannes oder eines Territoriums, noch durch die zu einer Einheit strebende Zwangsläufigkeit eines durchschlagenden kulturellen oder wirtschaftlichen Prozesses zum Ausgleich gebracht. Die dynastischen und territorialen Belange richteten durch Teilungen und Absonderungen vielmehr stets neue Grenzen auf, die dann sich verhärtende Eigenbrötelei und ihre sorgsam gepflegte oder gewohnheitsmäßig gehegte Überlieferung ständig eifersüchtiger und eigenwilliger bewachte. Die großen Persönlichkeiten aber, an denen die nassauischen Länder durchaus nicht arm waren, fanden entweder in dem Umfang des kleinstaatlichen Betriebes und angesichts der beschränkten Mittel ihrer Heimat nicht die notwendige Auswirkung ihrer Arbeitsenergie, oder sie trugen diese, da ihr der enge Raum des eignen Staatslebens keine dem Persönlichkeitswert entsprechende Aufgaben zu stellen vermochte, über die Grenzen des Nassauerlandes hinaus in den Dienst größerer Staaten. Es mag als Tragik gewertet und gedeutet werden, daß der große Nassauer zu keiner Zeit Gelegenheit oder Verständnis für ein großes Nassau fand oder suchte. Der oranische »Schweiger« stand auf dem Boden eines fremden Staatsgeschickes, als er den Weg des Ruhmes ging, der Westerwälder Melander erlebte die Bestimmung seines Daseins im Kampf weltgeschichtlicher europäischer Gegensätze, der große Stein aber kannte in seiner nationalgeschichtlichen Majestät »nur ein Vaterland: das ist Deutschland«. Ohne Beispiel ist das Bewußtsein des Moritz von Oranien, daß ein Westerwälder sein: »ein doppelter Deutscher sein« heiße. Und dabei beweist gerade auch dieses Wort des Heimatstolzes, daß die Heimat zwar innerhalb der nassauischen Lande, nicht aber innerhalb eines solchen Staates gesucht und geliebt war.
So haben Land und Staat und politische Persönlichkeiten Nassau nicht zu einer Einheit formen können, und ebensowenig das Heimatgefühl der vielen. Da es aber nicht zu einer solchen Formung kam, deshalb waren alle jene Gegensätze und Unstimmigkeiten der nationalgeschichtlichen Entwicklung auf nassauischem Boden und innerhalb der nassauischen Territorienentwicklung besonders ausgebildet. In Kleinformen, die aber verhältnismäßig nicht geringere Wirkungen hatten, verliefen, in engeren Kreisen und mit schwächeren Energien sich bekämpfend, die alten Gegenkräfte der deutschen Geschichte. Aber deshalb war der religiös-konfessionelle Widerspruch nicht leichter zu lösen, weil er auf nassauischer Erde zum Ausdruck gelangte; darum der absolutistische Gedanke nicht weniger anspruchsvoll, weil er auf Schlössern nassauischen Landes gehegt wurde; deswegen der revolutionäre Trotz nicht berechtigter, weil rheingauische Bauern oder Idsteiner Bürger ihm zuneigten. Im Ausmaß seiner Verhältnisse nahm Nassau an all jenen gesamtdeutschen Gegensätzen der Geschichte unseres Menschentums teil, und, wie es dadurch dauernd Teilhaber, nur selten Nutznießer der großdeutschen Schicksalsgemeinschaft blieb, so trug es auch die Lasten dieser Tatsache in ihren Leiden und Kämpfen, Wirrnissen und Ohnmächten der Uneinigkeit doppelt! Ja, auf dem kleinen Boden, um den und auf dem hier die Gegensätze ausgetragen werden mußten, war der Streit hitziger und der Zweck kleinlicher. Dabei aber konnte sich kein Grundsatz und seine Erscheinung mit ihren beschränkten Mitteln in derartig einseitiger Gewalt und siegreich durchsetzen, daß nun etwa aus den Gegensätzen eine erzwungene oder gewünschte Einheit entsprossen wäre: auch der Kampf der Widerstände hat nicht das einheitlich-einige Nassau durch Blut und Eisen oder Vertrag und Vernunft geschaffen. Die schließliche Vereinheitlichung der nassauischen Territorien erfolgte keineswegs aus dem organischen staatsgeschichtlichen Wachstum oder der Vernunft politischer Notwendigkeiten, sondern durch den Zufall dynastischer Vererbung oder den Zwang auswärtiger Machtfaktoren, und deren Interesse war Anreiz der Geschehnisse. So ist in der Tat, formalgeschichtlich betrachtet, der spätere Staat Nassau nur ein künstliches Gebilde gewesen, eine Organisation, kein Organon.
Sollen wir Nassauer deshalb die Augen niederschlagen, Schuldige aus Unkraft? Es ist ein Trost, daß Sinn und Wert unserer Geschichte sich nicht in formalpolitischen Erwägungen erschöpften, daß ihr Wesensgehalt nicht erstarb, als sie in die größere Entwicklung des Staates aufging, der ihren äußerlichen Abschluß auf immer vollzog, indem er ihre innere Kraft zu steigern als Aufgabe übernahm. Der politische Gehalt, den die nassauische Geschichte birgt, ist deshalb mit Nassaus Aufgehen in Preußen nicht überwunden, weil er nicht allein an den negativen, sondern sogar in ganz augenfälligem Grade auch an den positiven Ideen und Tatsachen, Hoffnungen und Notwendigkeiten teilnahm, die sowohl den Weg als auch die Vollendung des größten Gedankens der gesamtdeutschen Geschichte bestimmten, den eines nationalen Zusammenschlusses.
Durch die Kleinstaaterei in dem Umkreis nassauischen Volkstums erwachte hier früh, wenn auch unter der Decke der Theorien, der Wunsch nach festerem Zusammenhalt. Die Schikanen der Zollpolitik, die Beengungen durch dynastische Einstellung und herrschaftliche Selbstherrlichkeit, die Fesseln des »cuius regio – eius religio«-Zwanges und alle die ungezählten täglichen Erfahrungen der bunten Zerfahrenheit des Volkes in ständischer, gesellschaftlicher und politischer Hinsicht – die sich kreuzenden Belange mehrerer Dutzend Regierungen, die gesamtherrschaftlichen Verwirrungen von der Ganerbenburg bis zur drei- und vierherrischen Landeshoheit mit ihren vielseitigen und mehrstelligen Ansprüchen an die Untertanen: alles dies ließ auf dem Mosaikboden der Herrschaften den Wunsch nach einer Herrschaft entstehen. Da man sie aber in den Grenzen des »Ländchens« nirgends fand, suchte man sie schon früh jenseits der Pfähle – ohne sie deshalb auszureißen – im Vaterland. Der Reichsgedanke hat so in Nassau eine starke, nicht genug gewürdigte Wurzel: von der Theorie des Freiherrn von Kruse und Gagerns bis zu dem Tatwillen des Holzappeler Grafen und des Nassauer Freiherrn, von dem Sehnen des Dichters bis zum begründenden Beweis W. Hrch. Riehls. Gerade weil die Kleinstaaterei ihre Unvollkommenheit so deutlich hier zur Schau trug, daß ihr Jammer, wie bei Ems, von einer einzigen Lahnbrücke zu beschauen war, drängte sich die politische Hoffnung auf Großformen, letztlich zum Reichsgedanken wenigstens in die Überzeugung der besten Nassauer. Und ferner: niemals hat trotz großer Macht in der nassauischen Geschichte der Gedanke der Staatsautorität den der Volksbedrängung ausgelöst. Wie schon das System der Leibeigenschaft gerade auf dem heimatlichen Boden oft durchbrochen war, hat sich früh im Gefolge volkseigentümlicher Sinnesart und fortschreitender Allgemeinkultur das Verlangen der Freiheit mit der Notwendigkeit der Regierung in vorwiegend freundlichem Ausgleich in den kleinen Herrschaftsbezirken gepaart. Von dem volkstümlichen Verhältnis zwischen Fürst und Volk zur Zeit des patriarchalischen Absolutismus bis zur Tatsache der ersten neuzeitlichen Verfassung in Deutschland ist Nassau den politischen Radikalismen aus dem Wege gegangen. Daher sind denn auch die Kräfte der politischen Energie in Strömungen und Gestaltungen allgemeingeschichtlicher Art in der Heimat in erfreulicher Besonnenheit zur Auswirkung gelangt, vom Bauernkrieg bis zum Tollen Jahr – ja bis heute. Doch weiter: Der Übergangscharakter des Landes bedingte den Zwang, wohl auch den Willen zu immer mehr sich entwickelndem Verständnis der Gegenseitigkeit aller politischen Handlungen – im Schlechten wie im Guten. So sind denn die Versuche des Verstehens im Nassauischen nicht alle geworden, von den materialistischen Erbverbrüderungen der Hausinteressen bis zu Gagerns Versöhnungsreise 1848 auf dem Boden einer ethischen, einer Idealpolitik; von dem Aufnehmen und Weitergeben in der heimatlichen Literatur bis zu den Ausgleichen in unserer Baukunst alter und neuer Zeit. Verstehen aber heißt politisch nichts weniger als Kampf für das Recht. In keiner Landesgeschichte spielt er, wenn auch in kleinen, oft kleinlichen Dingen, eine größere Rolle als in der unsrigen. Und schließlich: Heute ist gewiß die Form unserer Heimatgeschichte zerbrochen, aber ihre Mission ist noch lange nicht erfüllt.
Aus dem Wesen und den Kräften, den Lehren und Wirkungen der heimischen Vergangenheit sind mehr als Schattenbilder schönen oder unschönen Gewesenen in die Geschichte der Jetztzeit mitgewandert. Die Frucht der nassauischen Geschichte ist vielmehr im Rahmen der preußischen Staats- und der gesamtdeutschen Reichsgeschichte eine überaus lebendige, realpolitische Kraft und gegenwärtige Notwendigkeit geworden.
Der Gedanke des Ausgleichs, die Idee der Freiheit, die Tatsache der Großformen und die Notwendigkeit, neben der Reichs- die innere Volkseinheit zu schaffen, schöpfen auch im Umfang größerer Deutschheit als sie das Nassauerland je erreichen konnte, belebende Erfahrungen aus unserer Heimatgeschichte mit ihren vergangenen Ereignissen und Gestalten.
Doch den politisch-historischen Wert erhält der Nassauer und sein Land, dessen hoher Kultur ein Großstaat die Macht gab, erneut zu werden und zu wirken, heute vorwiegend durch zwei nüchterne Tatsachen: Nassau ist mit seinen rheinischen Brüdern der nationaldeutsche Hüter der westlichen Grenzmark, und Nassau ist mit seinen rheinischen Brüdern der Vorposten Preußens am Strom der Gefahr und Entscheidung. – Beide Aufgaben erfüllt aber unser Heimatland in folgerichtiger Fortentwicklung seiner eigenen Geschichte, deren reifster Sinn und Wert durch jene politisch erhöht, bereichert und vertieft wurde. Wenn Nietzsche mit wahrer Symbolik es ausspricht, daß auf den Gefällten das Leben stehe, so ist das nassauische »Stirb« in wesenhaftem Sinne heute zu einem »Werde« geworden für die unvergängliche Wertung und Bedeutung des heimatgeschichtlichen Mikrokosmos in dem Makrokosmos der vaterländischen Politik.
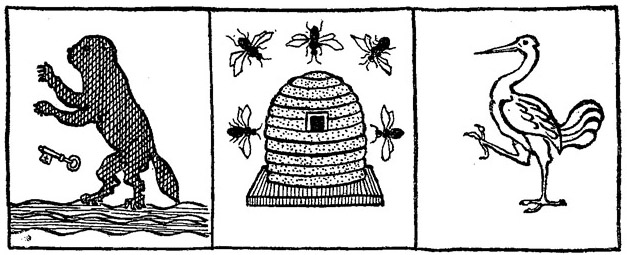
Ria Volland, Nassauische Städtewappen: Biebrich, Rastätten, Beilstein.
Die Landnahme Nassaus durch seine Bewohner geschah nicht in geographisch einheitlicher Form. Ganz allmählich wurde die gesamte Landfläche in den Kreis menschlicher Belange und Kulturarbeit gezogen, und es vergingen lange Zeiträume, die wir in die Grenzen der letzten fünf Jahrtausende vor Christi Geburt zu bannen versuchen, bevor auf der nassauischen Heimaterde langsam vordringende Seßhaftigkeit die schwärmenden Wanderzüge ablösten, bis Siedlungen ethnologisch bestimmbarer Völker die Grundlage zu einem politischen Dasein in Rasse- und Gesellschaftsformen legten. Und wieder mußte ein Jahrtausend über unsere Zeitrechnung hinaus vergehen, bis dieses Dasein zur Bildung politisch-staatlicher Körper sich fortentwickelt hatte.
Dem Gesamtgebiet der Heimat gab erst die Frankenzeit, besonders seit der freiwilligen Angliederung der Chatten an die fränkische Volksgruppe, mit der politischen und kulturellen Erschließung eine staatliche Zugehörigkeit und Struktur. Sie erst überwand zudem ältere landschaftliche Begrenzungen in Sondergebieten. Auch die erste durchgreifende Grenze fiel, die seit der späten Hallstattzeit vom Neuwieder Becken bis zur Mainmündung quer über das Gebirge zog, die Kelten-Germanengrenze, die sich seit der jüngsten La-Tène-Zeit an jener Zäsur gebildet hatte. Ebenso fiel auch die Römerscheide des Limes, die eine gallisch-römisch-germanische Mischbevölkerung des Westens von einer östlichen Germanenrasse getrennt hatte. Diese gewann jedoch nicht etwa in den alten Völkerschlachten der Usipeter, Tenkterer, Ubier, Mattiaken und Chatten ihre politische Struktur und Zukunftsbasis. Das heimatliche Geschick der Frühgeschichte gestaltete sich in dem Kampf um Land und Macht, den Alemannen und Frankreich während der Stammeszeit auf nassauischem Boden führten. Das Land fiel den Franken zu. In deren Gauverfassung gewann Ur-Nassau eine erste politische, in der Synodalverfassung eine erste kirchliche Organisation. In dem Ausgang der Karolingerzeit aber erblühte unsrer Heimat das glückliche Los einer erneuten Betonung ihres nationaldeutschen Wesens seit dem Untergang der Römerherrschaft; in den Teilungen der universalen Monarchie blieb sie eingebettet in das Ostreich. Ihr Boden wurde abermals in den Machtkreis des deutschen Gedankens gerückt, wie in den Zeiten, da der Alemannenhäuptling Makrian gegen die Römer gekämpft hatte, da der Frankenherzog Mallobaudes an der Lahn die fränkische Einung vorbereitet und der Zusammenschluß der Ripuarier und Chatten eine stammes- und landschaftsfeste Einheit begründet hatten. Ein halbes Dutzend Gaue hatten inzwischen im Verein mit Klöstern (Bleidenstadt, Gemünden) und Kirchen (Dietkirchen) den Grund fränkischer Zivilisation gelegt, königliche Guts- und Waldbezirke (Nassau, Königssondergau, Sporkenwald), Ringe und Schanzen aus keltischer (Altkönig) und germanischer (Heunstein) Zeit, römische Kastelle (Niederberg, Ems, Salburg) und kaiserliche Pfalzen (Frankfurt) hatten einen Weg der Entwicklung gewiesen, der zur staatlichen und zur deutschen Grundlegung nassauischen Menschentums geführt hatte. Das Ausstrahlungsgebiet um den Limes, die römische und christliche Kulturkraft aber hatten die Anfänge der vorgeschichtlichen Zeiten ausgewertet, und am Ende der Karolingerzeit stand Nassaus Boden in weiträumiger Wirtschaftsnutzung, und seine Menschen waren den Kultureinflüssen erschlossen, ohne ihnen erlegen zu sein. Hatte Einhard zwar noch über »die arge Finsternis und den schlimmen Nebel des von Wolken umlagerten Waldgebirges« zu klagen, so pflegte der Rheingau schon Reb- und Obstgärten. Während das Christentum in Südnassau seit dem 4. Jahrhundert einzog, mußte Gregor III. noch die Lahn- und Westerwaldbewohner vermahnen, daß sie »die Wahrsager und Losdeuter, die Totenopfer, die Weissagungen in Hainen und an Quellen und ... die gotteslästerlichen Gebräuche« von sich wiesen. Bald aber lassen uns doch Legenden (St. Goar, Lubentius, Ferrutius) und der programmatische Name des Rhabanus Maurus wissen, daß der christliche Gedanke über solche kultischen Formen gesiegt hatte, wie sie sich während der Römerzeit im Mithrasdienst und den sogenannten Jupitersäulen (Schierstein) gebildet hatten.
In geistiger und materieller Kultur, in Volkstum und Staatsstruktur hat die Frankenzeit zwar unserm nassauischen Heimatland keine Selbständigkeit gegeben, dafür aber die Bindung an ein reichbegnadetes Universalreich und die Vertiefung in nationalgeschichtliche Bedeutung. Wo einst Makrians Krieger zogen, da gingen nun Einhards »Translationes« der Heiligengebeine vor sich. Und während unser Boden in vorgeschichtlicher Zeit durch die Rassenwanderungen in einen ost-westlichen Austausch gestellt war, während Tacitus von den Mattiaken schreiben konnte, daß sie »nach Wohnsitz und Gebiet auf ihrem Ufer drüben, in Gesinnung und Neigung aber bei den Römern« seien, war Nassau insgesamt am Ausgang der Frankenzeit so stark der nationalhistorischen Zukunft verbunden, daß es auf dem Boden der fortab geschichtsbildenden Idee des Föderalismus der alten deutschen Kaiserzeit den ersten Herrscher stellen konnte. So trug es gleich am Anfang der deutschen Reichsgeschichte trotz der Einstellung in die damalige partikularistische Form der deutschen Innenpolitik seinerseits zum mindesten den tatsächlichen Versuch bei, diese Tragik Deutschlands, die in dem Territorialgedanken sich aussprach, durch Überwindung der Sonderungen in einer nationalen Krongewalt zu bannen. Deren Träger war nicht unwürdig, aus dem Heimat- in den Reichsgedanken hinauszuwachsen. Aus dem Niederlahngau entsprossen, begriff Konrad I. die politische Wende des deutschen Schicksals und setzte seine ganze Kraft an die Aufgabe einer neuen Grundlegung. Zwischen dem zentralistischen Universalreich der fränkischen Vergangenheit und dem förderalistischen Nationalstaat der deutschen Zukunft steht, abschließend und aufbauend, eine nassauische Persönlichkeit. Als dieser König aber im »Weilburger Testament« die Unmöglichkeit seiner erhofften Ziele edel und groß zu einem Verzicht seines Geschlechtes auf die Krone gestaltete, und »das Heil des Staates in des Sachsen Hand« legte, begaben sich die Konradiner zugleich auch der Führung im Nassauerlande. Bis zum Ende des 12. Jahrhunderts bildete sich dort kein beherrschendes Geschlecht; das Land aber zerfetzte politische Zugehörigkeit in eine Unzahl weltlicher und geistlicher Kleinherrschaften. Wohl hören wir von Männern von historischer Bedeutung, von Konrad Kurzibolds Andernacher Siegestat für die Ottonenmonarchie, vom Tode Hermanns von Salm im Dienste gegenköniglicher Rebellion gegen die Salier vor Limburgs Toren, auch von wilder Kriegszerstörung des Westerwaldes nach Heinrichs V. Niederlage gegen Köln. Wohl zeigte die große Reichsfeier Friedrichs I. vom Jahre 1184, die einen dynastischen Ehrentag auf nassauischen Boden verlegte, auf der Walstätte bei Erbenheim alle ritterlich-höfischen Kultur- und Kunstformen des deutschen Geisteslebens in nie gesehener Entfaltung – ein wahrhaft »kaiserlicher Wonnemond«. Die innere Struktur Nassaus aber war gelockerter als je zuvor. Da sammelte das Grafengeschlecht, das sich nach der um 1124 gebauten Burg Nassau nannte, allmählich so viel politische Macht auf diesem Boden der Zerrissenheit, daß seine Hausgeschichte zum Grundgerüst der Landesgeschichte sich ausgestalten konnte. Auf ihr wuchs der geographische Begriff Nassau in langsamer Entwicklung zu einem Staatsbegriff heran. Doch kaum war das Haus der Nassauer Grafen in eine führende Stelle emporgerückt, da hemmte sich in beispiellos zahlreichen Splitterungen seine politische Energie, und der Dezentralisation des Landgebietes gesellte sich die Verzweigung der wichtigsten weltlichen Herrschaft der geschichtlichen Zukunft; den mehr als zwei Dutzend Staaten auf nassauischem Boden standen mehr als ein Dutzend Linien der Hausgeschichte zur Seite. Nassau wurde ein Beispiel kleinförmiger Politika.

Während aber so die Engräumigkeit des Landes und seine Kleinstaaterei verhinderten, daß eine nassauische Gesamtgeschichte entstand und als solche reichspolitische Bedeutung gewann, spiegelte sich zuweilen im nassauischen Geschick Deutschlands Schicksal und sandte mehr als einmal Nassau bedeutende Köpfe und große Männer in die Volks- und Staatsgeschichte der Deutschen hinaus. Seit 1200 stellten die Herren von Eppstein dem Mainzer Erzstift eine Reihe bekannter Erzbischöfe. Ihnen taten es in geistlichen Würden die Nassauer, die Kronberger, die von Greifenklau, Sayn, Westerburg auf verschiedenen Erzstühlen während des Mittelalters nach. 1292 aber bestieg der Nassauer Graf Adolf den Königsthron, und war auch seine Herrschaft eine erfolglose, so urteilt über die Persönlichkeit des Mannes das Volkslied nicht unrichtig:
»Ich muis den rinen koninc clagen, want an eme wart erslagen
Ein christen koninc, ein grewe wert,
Ein rechte ritterschafte flucht ...«
In derselben Zeit der königlichen Tragik aber erwarb nassauische Bürgerehre hohes Lob und weiten Ruf in dem Frankfurter Stadtrecht, das eine gesellschaftlich freilich noch beschränkte soziale Fürsorge pflegt: »Wie es Gewohnheit in unserer Stadt ist, so sollen wir den Bürger unterstützen und Unrecht von ihm abwehren.« Mittelalterliche Literatur und Kunst aber fand auch im Nassauischen ihre Sänger und Meister, der Minnesänger Reinhard von Westerburg und die Kirchenbauten von Limburg, Eberbach und Marienstatt sind des Zeuge. In der Limburger Chronik aber entstand gar eine der wichtigsten Geschichtsquellen und eine Volkskunde obendrein.
Die Zeiten Karls IV. jedoch stellten unsre Heimat wieder in den Blickpunkt der großen Reichsgeschicke. Auf nassauischem Boden löste sich das Gegenkönigtum Günthers von Schwarzburg in ein Nichts auf, in der Mainzer Bistumsfehde wurde fast der gesamte nassauische Kleinadel in politisch-kirchliche Parteiungen verstrickt. Die Raubritter, an deren Spitze Philipp von Isenburg stand, leerten auf die Dauer die »reichen Pfeffersäcke« und Tuchtruhen der Limburger so wenig aus, wie die Ritterverbände der »Sterner« und »Löwen« die aufblühenden Städte bezwangen, ward »auch damals beraubet und geschindet alles Land«. Vielmehr hatte das 13. und 14. Jahrhundert im Nassauischen eine starke Vermehrung der Bevölkerung gesehen, und eine große Zahl von Stadterhebungen von Herborn (1251) bis Usingen (1466) erfolgte als Ausdruck größerer wirtschaftlicher Bedeutung heimatlicher Siedlungen, die seit dem 12. Jahrhundert bereits in stärkerem Maße in den Hochstufen des Gebirges, in die Wälder und Heiden vorgedrungen waren. Zugleich hatten die Bodenschätze und Quellen Nassaus das Wirtschafts- und Verkehrsleben bereichert; Bergordnungen und Baderegeln reden eine deutliche Sprache. Ihnen aber schließen sich Zunftregeln als Zeugnisse gesteigerten Gewerbefleißes und Arbeitswillens, zugleich als Beweise großformigerer Ständegliederung bürgerlichen Gepräges an. Die Siegener Bergordnung, der Herborner Weberzunftbrief, die Wiesbadener und Emser Baderegeln mögen wenigstens beispielhaft hier genannt sein. Die Beilsteiner Gerichtsordnung ist zugleich ein durchaus nicht einsamer Zeuge hoher und verantwortungsvoller Rechtsprechung, und auch die heilige Feme fand in einem Sayner Grafen einen nassauischen Statthalter der »Heymlichen Westvälischen Gericht«.
Inzwischen aber hatte die Geschichte des Hauses Nassau, das seit 1255 in die walramische und die ottonische Linie gespalten war, den Weg von einem »Neun-Burgen-Besitz« zu einer stattlichen Landeshoheit zurückgelegt, die walramischen Erben besonders im Taunus, die ottonischen vorwiegend im Westerwald. In dem Walramer Gerlach erstand ein treuer Anhänger Heinrichs VII., Adolf I. von Nassau-Idstein setzte das Haus in verwandtschaftliche Beziehung zu den Hohenzollern, ein weiterer Adolf kämpfte 100 Jahre später mit den Isenburgern um den Mainzer Bischofsstuhl. Die ottonische Linie, seit 1328 in einen dillenburgischen und einen hadamarischen Zweig zerfallend, aber hatte in Raufereien und Fehden ihren Landbesitz vermehrt, bis ihr in Johann I. der Begründer einer bedeutenden politischen Macht erstand. Er vereitelte die Machtgelüste der Hessen im Lahntal und auf dem Westerwald: der Norden unsrer Heimat war für Nassau gerettet.
Seit 1522 nun brach durch den Einzug der Reformation ins Nassauerland eine neue Quelle politischer Entzweiung, aber geistiger Kraft in unsrer Heimat auf. Dem Rheingauer Bauernaufruhr, den städtischen Unruhen in Frankfurt, Limburg und St. Goarshausen folgten unbedeutendere Bewegungen unter der heimischen Ritterschaft derer von Kronberg, der Brömser von Rüdesheim, der Hillin von Lorch u. a. m. In Hartmut von Kronberg dagegen erstand dem absterbenden Rittertum ein ebenso glänzender wie geistvoller Vertreter höfischer Zucht und humanistischer Bildung. Seit 1523 predigte der Weilburger Hofprediger evangelisch, und 15 Jahre später wünschte Martin Luther dem Lande »viel frucht ynn dem Evangelio zu vieler leute trost und heil«. Im Schmalkaldener Krieg mußte Nassau neben den Segnungen neuer religiöser Belebung freilich auch die Opfer brennenden Konfessionseifers erfahren: Wiesbaden brannte in dessen lohender Glut, und das Interim brachte Unruhe und Elend auch in unsere Heimat.
Den größten und geschichtlich bedeutsamsten Anteil aber an der evangelischen Bewegung nahmen nassauische Persönlichkeiten. Wilhelm, der Befreier der Niederlande, war »von Nassawe ... von teutschem Blut«, und Moriz von Oranien fand gar den stolzen Mut, den Westerwälder als einen »doppelten Deutschen« anzusprechen. Damit aber war nassauisches Menschentum über die Heimat hinausgewachsen ins Weltgeschichtliche, Dillenburg gar hieß der »Nabel der Welt«. Wie mächtig hatte die geistig-seelische Erneuerung in nassauischen Herzen gezündet. Als jedoch der Dreißigjährige Krieg den furchtbaren Schlußstrich unter den Eifer der Religionskämpfe zog, da war auch das Nassauerland in tiefe Not und eine Rückwärtsbewegung geraten, die Bevölkerungsdichte, Wohn- und Wirtschaftszustände gleichermaßen betraf, eine Erscheinung, die in dem Bericht des Miehlener Pfarrers Plebanus noch heute uns ihre Schmerzensstimme entgegentönen läßt. Die spanischen Truppenmärsche, die Schlacht bei Höchst, die Zerstörung Wiesbadens, aber auch der Brand aller nassauischen Kirchen, die Vernichtung der Ortsakten, die Zunahme der Wüstungen, der Ausgang vieler Siedlungen sind Folgen des Krieges von einer solchen geschichtlichen Wirkung, daß man das schicksalerpreßte Dankeswort verstehen kann, mit dem ein nassauischer Beamter einen Wiesbadener Amtsbrief schloß: »Gott dem Höchsten sey lob, preyß, Ehr und Dank gesagt, daß wier diesen Freudentag erlebt haben.« Während des Krieges aber war auch persönliches Schicksal in Ingrimm und Seelennot erstanden, nirgends eindrucksvoller als in der dramatischsten Gestalt Nassaus, Peter Melander, in dessen Brust Glaubenstreue und Vaterlandsliebe einen tragischen Kampf kämpften. Das Land selbst aber bot in seinem Staatengemisch ein Beispiel für das Ergebnis des gesamtdeutschen Friedens: aller Streit hatte den Toleranzgedanken fördern müssen, und gerade in Nassau ist religiöse Duldung geübt worden, nachdem sich die Konfessionen in Hadamar, Dillenburg und im Katzenelnbogischen ihre staatlichen Zentren geschaffen hatten.
Die Not des Landes fand verständnisvolle Hilfe bei guten Fürsten. Neusiedler wurden privilegiert, die Untertanen geschont. Noch in der Zeit höchster Blüte des Absolutismus beweist das Testament Johanns von Nassau-Idstein ein beispielloses soziales und echt patriarchalisches Gefühl für edle Regierungsweise: »mann muß der justitiae undt nicht fraudi helfen ... und seinen staat also anstellen, daß er nicht höher fliegt, als seine Federn zulassen.« Ein schlichtes Bild für eine besonnene Staatskunst, deren Same reift. Die innerstaatlichen Verhältnisse der nassauischen Territorien zu fördern, aber war um so schwerer, als auch unsere Heimat in dem nunmehr das 17. und 18. Jahrhundert durchziehenden Streit zwischen Bourbon und Habsburg als Grenzmark Opfer und Zweifel, Angst und Pein solcher peripherischer Gebiete tragen mußte. Bei Dausenau wurde der Franzoseneinfall zur Wegesprengung des nassauischen Hinterlandes, Sonnenberg und die Rheinburgen fielen in Trümmer, Homburg wurde französisch. Bei Rauenthal aber wurde mit den Welschen »Rheingauer Deutsch« geredet: Ludwigs XIV. pénétration militaire hatte in dem Deutschtum der Nassauer denselben unbesieglichen Feind gefunden, wie später trotz aller einzelnen dankbar angenommenen Fortschritte die pénétration pacifique nach den Gewalttaten der Revolutionsheere. Standen doch auch genug nassauische Herren im Dienste der Reichsarmee gegen die französischen Eindringlinge. Doch bevor die Revolution ihre Heere und ihre Emigranten ins Nassauische schickte, die weniger segensreiche Gäste unsrer Heimat wurden als die freudig aufgenommenen und dankbaren Hugenotten gewesen waren, gingen die Stürme des Siebenjährigen Krieges auch über den Westerwald: die Ruinen des Dillenburger Schlosses zeugen von ihrem harten Wehen, und die Taten der Marodeure waren lange unvergessen in der geängsteten Bevölkerung an Dill und Sieg und Lahn.
Doch neben dem Tritt des Kriegers war der Pestreiter durch die nassauischen Lande geritten und mähte die Menschen in Stadt und Dorf. Ein Ort wie Ems wurde damals ganz aufgegeben; an der Lahn fand der Jesuitenhelfer, der »Pestmann« Lämmermann kaum einen Hof ohne Kranke. Und nach dieser Seuche raste der Menschen Aberwitz durchs Land, und die hohe Zeit der Hexenbrände entfachte auch in Nassau Scheiterhaufen und führte Zucht und Sitte, Glück und Wohlstand, Gewissen und Religion in die Irre.
Darnach ergriff die Wucht der französischen politischen Geschichtswende zeitweilig Besitz von unsrer Heimat. Wie die revolutionäre, so hat die napoleonische Propaganda fremder politischer Theorie auf Nassaus Boden Eingang in Deutschland gesucht. Vergebens zogen die Heere Jourdans, Klebers, Marceaus, Hoches über nassauische Erde, vergebens gliederte Napoleon den von ihm erschaffenen nassauischen Rheinbundstaat des neuen Herzogtums in das System seines Programms, durch eine Militärdiktatur auf dem rechten Rheinufer » dépayser l'esprit allemand«. Mochten auch die Dynastien durch Säkularisation und Mediatisierung nach dem Zusammenbruch des Reichsgebäudes unter Napoleons Willen Vorteile für Haus und Land suchen und ihre Truppen in fremdem Solde kämpfen, im nassauischen Volke erwuchs nationale Ehre zur Rache. Ja, der vertriebene Nassauer Stein wurde Seele und Kraft der deutschen Befreiung. Am Rhein aber öffnete Blücher auf nassauischem Boden das Tor, den deutschen Freiheitswillen »in Frankreich hinein« zu tragen. Bei Waterloo jedoch statteten die Nassauer der französischen Fremdherrschaft wackeren »Dank« ab – »General Kruse war ein tapferer Held ...«. Der Herzog von Nassau aber hatte nach dem Volkslied »Geld und Brot für seine Soldaten«. Er hatte mehr für seine Untertanen: im Heimatlande des bedeutendsten großdeutschen Staatsmannes war von dessen Geist ein unauslöschbarer Funke zum Glimmen gekommen, die erste ständische Verfassung der neuen Zeit entstand in Nassau. Sie bewies einer besonnenen Obrigkeit schönes Ziel, »Bürgerglück und Wohlstand auf sicheren Grundlagen dauerhaft zu befestigen«. Freilich blieben auch im nassauischen Herzogtum die Strömungen einer Reaktion nicht aus, aber eine durchweg fortschrittliche politische Haltung, eine vorbildliche kulturelle und anerkennenswerte Fürsorge der Regierung ließ die Explosion des »Tollen Jahres« in unserer Heimat nicht die Spannung zerstörender Gewalt erreichen. Auch die inneren geistigen Gegensätze erreichten selten den Grad der trennenden Tat, besonders nicht im kirchlichen Leben: »Der Katholizismus muß sich vom Protestantismus und dagegen dieser wieder vom ersten ergänzen lassen, wenn die religiöse Erbauung gewinnen soll«, schrieb 1814 der katholische Pfarrer zu Gebertshayn. Derselbe Geist lag der Gründung des Bistums Limburg, der Feier der evangelischen Union, der Simultanschule zugrunde. Er spricht noch aus der Weiherede des Emser katholischen Pfarrers 1864, daß im Nassauischen »der Ausfluß der Religion gegenseitige Achtung und Liebe und Versöhnlichkeit sei«. Dem Geiste der Duldung aber gesellte sich die Kraft der Arbeit.
Das herzogliche Regiment schuf seit 1816 eine natürliche Abrundung des Landes durch Einbeziehung der Niedergrafschaft Katzenelnbogen, so daß das Herzogtum Nassau seitdem 85½ Quadratmeilen umfaßte und über 300 000 Einwohner zählte. Herzog Wilhelm regelte die Landesverwaltung durch die Ämter- und Gemeindeordnung, die Armenpflegeordnung, durch neue Steuergesetzgebung, durch die Organisation des Kirchen-, Schul- und Gesundheitswesens. Unter ihm wurde, dank der Mithilfe der Minister von Marschall und von Ibell, Nassau zu einem Staate von klassischem Muster und wohlgepflegtem Staatsgebiet. Doch wuchs seine politische Energie über die Landesbelange auch jetzt in großdeutsche Geschichte hinaus. Das »Ländchen« entzog sich nicht nur nicht den Problemen der deutschen Frage, der schleswigischen Nöte, der innerstaatlichen Reformen – bei mehr als einer Gelegenheit fanden seine Staatsmänner die Kraft zum Handeln, und ihre Richtschnur war das Steinsche Bekenntnis »Ich habe nur ein Vaterland – Deutschland!«, das von der Tätigkeit Kruses auf dem Rastatter Kongreß, über Gagerns großdeutsche Sinnbildtaten bis zum Fürstenkongreß hin das Leitmotiv der besten Nassauer gewesen ist. Dem Herzog Wilhelm folgte Adolf. Er schuf die allgemeine Wehrpflichtordnung und gab unter Umbildung zugleich der Zentralbehörden eine neue Verfassung, die die Einheit des Staates bekräftigte und die Grundrechte seiner Bürger gewährleistete. Der Beitritt zum Zollverein verknüpfte das Herzogtum der gesamtdeutschen Entwicklung.
So war Nassau zu einem einheitlichen staatlichen Raume, zu einer inneren Kulturgemeinschaft, zu einem neuzeitlichen Herrschaftsgebiet bis zum Jahre seines politischen Unterganges emporgeblüht. Unsere Heimat hatte in den Möglichkeiten ihrer Begrenzungen eine Vollendung erreicht, als ihr ausgelebtes Geschick der Notwendigkeit eines größeren vaterländischen Gedankens, der preußischen Idee, eingegliedert wurde, die bald mit durch sein Gebiet und Wesen zur Reichsidee erweitert wurde. Herzog Adolf hat selbst das schöne Wort gesprochen: »Dynastien erlöschen, die Völker leben fort!« So auch Nassau in Preußen, im Reich und im Deutschtum von den ersten Taten seiner Söhne für das große Vaterland im 70er Krieg bis zu den jüngsten Tagen, da auch Nassau Glied und Zeuge einer treuen »Wacht am Rhein« bildet.