
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Ach, das ist ja der gewisse Rattenfänger ...«
Der alte Benedix hätte nicht geglaubt, wie lang die Umwege zur Unsterblichkeit sind. Eines seiner blonden Lustspiele kam irgendwie nach Paris und machte dort die Bekanntschaft der Offenbachschen Textdichter. Man gefiel einander und aus dem Atelier Meilhac und Halévy ging in neuer Aufmachung »Réveillon« hervor (Das Souper um Mitternacht). Die Regie half durch realistische Nuancen nach – u. a. ließ sie warme, noch rauchende Speisen auftragen – und das neue Pariser Vaudeville wanderte in erster Erfolgsblüte nach Wien.
Direktor Steiner kaufte das Stück für das Theater an der Wien, konnte sich jedoch zur Aufführung nicht entschließen. Es steckte zu tief im Pariser Lokalkolorit. Gleich zu Anfang erklärt das Stubenmädchen Pernette, sie wolle »faire la réveillon avec mon amoureux«. Wie das übersetzen? Dem Wiener Theaterpublikum war der Ausdruck »réveillon«, der Tumult am Weihnachtsabend, absolut fremd und darauf beruhten die Verwicklungen des Stücks. So bietet Steiner das Buch Direktor Jauner vom Carltheater an, das damals Vaudevilles pflegte; aber Jauner wird mit dem Verleger Lewy nicht fertig. Das Buch kommt wieder zu Steiner und in einem gesegneten Augenblick schlägt Lewy ihm vor, daraus ein Libretto für Johann Strauß zu machen. Steiner ging darauf ein und betraute sogleich Haffner und Genée mit der Sache.
Haffner stammte aus Königsberg (geb. 1804) und war eine tragische Figur unter den Wiener Stückeschreibern. Um 45 Gulden Monatsgage und ein Benefiz mußte er dem Direktor Carl jährlich 12 Komödien liefern. Er starb zwei Jahre nach der Aufführung der Fledermaus (1876) in tiefster Armut in Wien, welcher Stadt er für immer fremd geblieben war. Von zahlreichen Gläubigern verfolgt, schrieb er vier Tage vor seinem Ende ein Gedicht, das Lortzingisch anmutet:
Mein Herz war gut, mein Herz war treu,
Fragt Freunde, Weib und Kinder,
Doch macht das Unglück menschenscheu,
Verstockt wie arme Sünder.
Fremd jedem Bunde und Verein,
Fremd und verlassen und allein,
Ist wohl auch fremd geblieben,
Was ich mit Blut geschrieben.
Gerade ihn hatte das Geschick als Mitarbeiter am Buch eines noblen Vergnügens ausersehen.
Auch der andere Librettist, Richard Genée, dessen Name hier zum erstenmal auftaucht und der Strauß so lange begleiten sollte, ist ein Fremder gewesen und fast alle Wiener Librettisten waren es.
Genée, zwei Jahre älter als Johann Strauß, Westpreuße (geb. 1823 in Danzig, gest. 1895), besaß die Doppelbegabung des Musikers und Schriftstellers. Seine Nanon (»Anna, zu dir ist mein liebster Gang«) machte ihn berühmt, das Werk erlebte in Berlin 300 Aufführungen und ging nach Amerika. Genée, beim Theater aufgewachsen, schrieb mit 32 Jahren Opern (Polyphem, Geiger von Tyrol), war dann (1863) Kapellmeister am Prager Landestheater, wo er (1868) Lohengrin und Tannhäuser auswendig dirigierte, kommt ans Theater an der Wien, komponiert mit Flotow »Am Runenstein«, bearbeitet 1872 Offenbachs Theaterprinzessin mit F. Zell (Camillo Walzel) für Wien und gerät allmählich in den Librettistenberuf. In Nanon wurde er sein eigener Textdichter. Sonst arbeitete er für Suppé, Millöcker und Strauß: er schrieb die Verse, F. Zell, der aus der französischen Schule kam und Burgtheaterlustspiele gemacht hatte, den Dialog. In der Heranholung der Stoffe war Genée ziemlich unbedenklich, mein und dein wurde großzügig verteilt. Der berühmte »Bettelstudent«, unter welchem Namen Peter v. Winter und Schenk schon 100 Jahre früher Liederspiele schrieben, stammt aus einem Dutzend Quellen. »Nanon« aus »Jeanne, Jeannette, Jeannetton«, einer Pariser Operette (1876); »Fatinitza« aus Scribe-Aubers »Circassienne« (1861); was den Dichter aber nicht anfocht. Gegen unangenehme Forschung wehrte er sich schlagfertig:
»Ist das nun strafbar, bitt' ich?
Schöne Geister begegnen sich!«
Genée ging an die Operettisierung von Réveillon mit seinem Doppelgeschick – wie weit Haffners Anteil reiche, läßt sich nicht genau sagen –, Genées Anteil war jedenfalls der größere, ja er beriet Strauß auch später in der Anordnung der Musikstücke. Bei Meilhac und Halévy spielt sich der 1. Akt ungefähr so ab: Fanny, die Frau des reichen Gaillardin, trifft in dem Badeort Pincornet les bœufs den Kapellmeister Alfred, den sie vier Jahre nicht gesehen hat und der sie durch seine Geige – er spielt eine Kavatine aus der Favoritin – zu betören sucht. Durch das Stubenmädchen Pernette erzwingt er den Eintritt bei Fanny, deren Mann Gaillardin eben verhaftet werden soll. Er bedrängt sie mit Liebesversicherungen, sie hört Geräusch, er sucht aus seinen und den Kleidern ihres Mannes eine Strickleiter zu drehen und durchs Fenster zu entkommen, wird aber als »Herr Gaillardin« von Tourillon, dem Gefängnisdirektor, verhaftet.
Ähnlich spielt sich auch die Sache bei Benedix (»Das Gefängnis«) ab, allerdings viel braver und gesitteter, ja prüde bis zur Tantenhaftigkeit.
Der Privatgelehrte Hagen, ein Kindergemüt, hat einen Kollegen, Professor Kiesling, beleidigt und soll dafür acht Tage sitzen. Seinen letzten abendlichen Spaziergang benutzt der leichtsinnige, verschuldete Baron Wallbeck, dessen Wahlspruch merkwürdig wienerisch klingt (»Nicht genießen heißt nicht leben!«), dazu, Mathilde, die Frau des Doktor Hagen – o Gott! – zu verführen. Aber ihre vestalisch-erhabene Tugendhaftigkeit rührt ihn derart, daß er ihr Ritter wird und sich für ihren Mann halten läßt, als Friedheim, der Gefängnisinspektor, kommt, um Hagen zu verhaften. Das Weitere nimmt einen kleinstädtischen Verlauf und endet nach mannigfachen Verwechslungen mit einer Heirat des Barons. Von einem Rummel oder Souper mit Damen keine Spur.
Tragisch wendet das gleiche Motiv Bernard Shaw im ersten Akt seines »Teufelskerl« an. Dick sitzt bei der schönen Pfarrersgattin Anderson, die ihm aus Mitleid – draußen ist ein Hundewetter – den Rock ihres abwesenden Mannes umwirft. Die eindringenden englischen Soldaten verhaften den falschen Pfarrer als Rebellen, der zum Tode verurteilt wird. So verschiedenartige Dienste leistet ein und derselbe fruchtbare Gedanke verschiedenen dramatischen Temperamenten.
Meilhac und Halévy gaben der Vorstellung »Gefängnis« einen glanzvollen Kontrast durch das grandiose Souper, das Fürst Yermontoff seinen Gästen gibt: den Theaterdamen Métella, Toto, Adèle, dem Herrn Gaillardin, der sich als Marquis Valangoujar, und dem Gefängnisdirektor Tourillon, der sich als Comte de Villebouzin einführt. Das lustigste Theater lebt – vor und nach Réveillon – von Personen, die nicht sind, wofür sie gehalten werden; trotzdem haben die beiden Autoren nicht alle heiteren Möglichkeiten ihres Stoffes ausgeschöpft: vielmehr blieb dies Haffner und Genée vorbehalten.
Der Zusammenhang zwischen erstem und zweitem Akt von Réveillon ist nur durch Gaillardin und Tourillon sowie Alfred gegeben, der Kapellmeister des Fürsten Yermontoff ist und ein ungarisches Kostüm trägt. Man beachte dieses ungarische Kostüm. Fanny erscheint bei Yermontoff gar nicht. Aber der Operettendichter konnte nicht die erste Sängerin einen ganzen Akt hindurch und zwar den zweiten, den Hauptakt, ausschalten. Sie mußte auf die Bühne, mußte am Souper Yermontoffs teilnehmen. Und wer die Librettistenpsyche kennt, weiß, daß sie fuchshaft alle Einzelheiten belauert, die eine Weiterführung ergeben können. So wurde das ungarische Kostüm Alfred weggenommen und – Fanny gegeben, der zimperlichen Frau Gaillardins; so kam sie als ungarische Gräfin maskiert in die Villa Yermontoff. Dort war natürlich nicht bloß ein Souper, bei dem vom Theater geplaudert wurde, sondern ein Maskenball. Und damit auch die zweite Sängerin, Pernette, das Stubenmädchen, beschäftigt sei, mußte auch sie auf den Ball, ebenfalls maskiert und zwar in Weiterspinnung des Kostümgedankens: in der Toilette ihrer Herrin Fanny Gaillardin. Haffner und Genée nahmen einige Charakteränderungen vor: aus der larmoyanten Fanny wurde die witzige Rosalinde, aus dem Bauernmädel Pernette das pikante Wiener Stubenmädchen Adele, aus Gaillardin wurde Gabriel von Eisenstein, aus Yermontoff Orlofsky, aus dem Geiger Alfred, der in seiner Steifheit nicht zu brauchen war, der tenorsingende Alfred und so kam aus einer Regiebemerkung über ein Kostüm ein neues musikalisches Lustspiel hervor, dessen Mitte der große Ballakt wurde.
Um Rosalinde auf den Ball zu bringen, mußte eine neue Person als Träger einer neuen Intrige erfunden werden: Dr. Falk, Eisensteins Freund. Beide besuchten einmal einen Maskenball, Eisenstein als Schmetterling, Falk als Fledermaus; Eisenstein, der Falk trunken machte, lud ihn auf dem Heimweg unter einem Baum in seinem Kostüm ab und gab ihn dem öffentlichen Spott preis. Dafür rächt sich nun die »Fledermaus« und sorgt, daß Rosalinde zu Orlofsky kommt und Eisenstein sich in seine eigne Frau verliebt. Die etwas schief benannte Komödie müßte demnach eigentlich heißen: »Die Rache der Fledermaus«.
Die Librettisten benutzten auch Einzelheiten: wie das Spiel mit der verführerischen Uhr, dem Madeira oder im dritten Akt die stummen Szenen des Gerichtsdieners Leopold, dem sie den unsterblichen Namen Frosch verliehen. Benutzten auch die Aufklärungen: der Gefängnisdirektor und Eisenstein lassen ihre Maske fallen, es gibt plötzlich zwei Eisensteine, einen, der schon sitzt (das ist Alfred), und den andern (der sitzen soll), der aber schaudernd erfährt, was zu Hause ... bei Frau Rosalinde ... geschehen sein mag – in Grillparzerischem Pathos rollen seine Trochäen:
»Ja ich bins, den Ihr betrogen,
Ja ich bins, den Ihr belogen ...!«
Einen Augenblick lang streift die Posse, wie jeder echte Humor es tun muß, das Tragische – dies ist die Sühne für die leichtsinnige Nacht! –, worauf er, durch eine rasche Notlüge Alfreds beruhigt, unter allgemeiner Zustimmung in den Arrest abgeht. So kam Johann Strauß auf Umwegen zu den besten Librettisten seiner Zeit, zu Meilhac und Halévy, den Textdichtern Offenbachs, verbessert durch Richard Genée.
Dabei verfuhr Richard Genée und sein Mitarbeiter sehr musiksinnig und vor allem sehr architektonisch. Das Ganze ist ein großer Festball. Der erste Akt dazu Auftakt: die Vorfreuden, die sich durch das Gegenspiel durchlügen müssen. Der dritte Akt: der Katzenjammer, aus dem sich die Gerechtigkeit erhebt, um die gesellschaftliche Ordnung wiederherzustellen. Und was konnten sie Johann Strauß Willkommeneres bieten als einen Ball? Eine kosmopolitische Soirée, wie er sie in Rußland, in Paris bei Metternichs erlebt hatte? Dieser Prinz Yermontoff, dieser achtzehnjährige Greis, dieser ermüdete Knabe war ja nur Deckfigur für den großen Lebemann, den Fürsten Demidoff, dessen mondäne Exzesse in Paris Tagesgespräch waren. Und schließlich wurde das Ganze ortlos gemacht: Pincornet les bœufs entfiel und es blieb ein Tanz, der sich selbst feierte, eine Verbrüderung und Verschwisterung in Walzertrunkenheiten, worin alle Personen untergehen und der Champagner das Symbol der Gesellschaftsekstase bildet. Das Dialogwort der Métella: »Ein Souper ist ein Haufen von Dummheiten, den champagnertrinkende Menschen aussprechen«, erhielt eine prächtige Erhöhung und das Verdienst der Textdichter besteht darin, dem Komponisten Menschen seiner Klasse, der sozialen Oberschicht gegeben zu haben, wie sie sich in Paris und Wien und Petersburg und Bukarest amüsierte und wie es die Unterschichten gerne miterlebt hätten, die sich auf das Betrachten der erleuchteten Stuckdecken von außen beschränkten.
Sie kamen geistig nicht hoch über den Stoff, versagten sich das ridendo castigare mores, gaben aber ein treues Spiegelbild der zeitgenössischen Gesellschaftsfreuden, einer Heiterkeit, worin die Menschen wie Billardkugeln aneinanderprallen, worin aber auch nicht die geringste nackte Frau, keinerlei aufgeschlagenes Bett mitspielt.
Das Buch der Fledermaus – ein Scherz mit dem Leben der bürgerlichen Welt – blieb ohne die Raumtiefen von Mozarts Figarokomödie, geriet aber nicht unter die Höhe von Rossinis Barbier ... Ein Faschingsbuch, das nur der mit Musik füllen konnte, in dessen Kehle die Musik dazu schon hing und der wie ein Mitspieler nur seine Stimme zu erheben brauchte. –
Wie ein Verliebter wirft sich Strauß darauf. Er verläßt seine Villa in der Hetzendorfer Straße nicht mehr. In sechs Wochen, genauer: in 42 Nächten schreibt er seine Partitur. Das Meisterwerk entsteht um die Jahreswende auf 1874.
Ohne Strauß spräche heut niemand mehr vom Vaudeville »Le Réveillon«, es wäre veraltet wie die meisten Bücher Meilhacs und Halévys; das Rätsel der fortlebenden Fledermaus liegt in der Straußischen Kunst, dauerhafte Musik zu schreiben. Um ihn herum klangen die Siebzigerjahre von Mamsell Angot (»niemals spröde, gar nicht blöde«), von Giroflé-Girofla (»in mir sieht man den Vater«), von Fatinitza, Nanon, Seekadett. Was ist davon geblieben? Hie und da ein Zitat. Das meiste wanderte auf den großen Friedhof der Melodien und nur die »Fische in der Halle«, der blonde Perücken-Chor, der Mann, in dem man den Vater sieht, irrlichterlieren noch durch die Erinnerungen älterer Jahrgänge als fröhliche Schatten. Es war einmal.
Bei Strauß ist alles noch lebendig wie damals. Man kann die Nummern der Fledermaus einzeln durchgehen: nirgends spürt man das Arom der Vergangenheit, nirgends müdes Welken, das um Mitleid bittet, alles blitzende Gegenwart, denn Strauß besaß die Gabe des Genies: die melodische Ausdrucksdauer.
Ob er zur Operette »berufen« sei oder nicht, bildete Streitgegenstand der Kritik vor der Fledermaus, als er's zu beweisen hatte, und nach der Fledermaus, als er es bewiesen hatte. Er war Tanzkomponist. Und dies allein genügte zur »Berufung«, denn schon vor Wagner wußte man, daß der Tanz eine Handlung darstelle: männliche Werbung im Kampf und – meist angenehmen – Sieg über weiblichen Widerstand. Mit diesen Formen konnte der Tanzkomponist dem »Drama« bewegende Kräfte zuführen, – dreht sich doch die Operettenhandlung immer ums erotische Gleichnis. Außerdem verleitete diese Gattung den damit beschäftigten Komponisten vielleicht dazu, einige bauliche Fähigkeiten bei den Finales zu entwickeln, Stimmungen zu halten und Menschen zu beseelen, – was bei der Fledermaus restlos gelang. Das zweite Finale führt in steiler Gipfellinie über die Komödie hinaus in einem Rausch des Daseins.
Dazu kam, daß er Offenbach und das Paris des zweiten Kaiserreichs erlebt hatte. Von jeher kosmopolitisch gestimmt, durch den Vater geistig mit Frankreich verbunden, dessen Sprache die der Wiener Gesellschaft war – er selbst sprach sie –, hat er 1867 und später französischen Musikgeist mit offenem Ohr beobachtet. Viele Nummern der Fledermaus, gleich das erste Allegrothema der Ouvertüre, der auf der Non balancierende Zweivierteltakt, D-dur, sind Auberscher, Adamscher oder Halévyscher Abkunft, verstraußte gallische Grazie.
Offenbachs rhythmische Eigenheiten waren seiner Natur fremd; aber er hat die Cancanrhythmik, wo er sie brauchte, angewendet (1. Finale des Prinzen Methusalem) und auch sonst einiges wie die Zartheit der lyrischen Zeichnung, weniger eigentliche Situationsmusik von Offenbach angenommen. Aber Jean hat Jacques auch einiges gegeben und man darf von einem geistigen Austausch sprechen. Als Offenbach persönlich seine »Tochter des Tambourmajors« im Theater an der Wien dirigierte, beugte sich Strauß bei der Stelle »Ich hab ein Einquartierbillett« mit einer gewissen heiteren Genugtuung zu seiner Frau Jetty und ein Augenzeuge (Julius Korngold) sahs ihm von den Lippen ab, daß er feststellte: Das kommt aus meiner Fledermaus (»Oje, oje, wie rührt mich dies ...!«).
Dann aber ragte Strauß unter vielen deutschsprachigen Bühnenkomponisten durch eine seltene, man möchte sagen: romanische Fähigkeit hervor, wie sie nur Mozart, Rossini, Smetana besaßen: er konnte ein wirkliches Allegro, ein inneres Presto schreiben. Er war Schnellpolka-Komponist und jagte deren sprühenden Geist, nicht angetriebene Langsamkeiten, in die Wiener Operette.
Die Ouvertüre zur Fledermaus ist ein Potpourri-Reigen dreier Gedanken. Der Komponist gleitet von Thema zu Thema über die Unterdominante hinab, besonders einfach ist die Modulation bei der Glockenstelle. Und doch ist sie Repertoirestück sämtlicher Kapellen zwischen Kapstadt und Hammerfest; und nicht grundlos surrt es jedesmal durchs Theater, wenn sie sich entfesselt. Denn es ist eine Kaskade rhythmischer Freuden.
Der Beginn mit den kurzen Akkordrucken des Tutti, der schäumenden Figur der Violinen und Viola gibt schon die Marke des Werks: Champagner-Musik, bei der Enthusiasten die Vision geschwungener Stengelgläser und moussierender Perlen haben mögen.
Das erste Allegrothema ist die Polka aus dem dritten Finale: »Alles, was dir Sorge macht, war ein Scherz, von mir erdacht«, womit der Musik eine geistreich fröhliche Symbolik unterlegt wird. Das auf dem Vorhalt tänzerisch stehen bleibende Zweiviertelthema verleugnet dabei nicht seinen Pariser Ursprung; auch der Stoff selbst mag den Komponisten unbewußt zum französischen Ausdruck gestimmt haben.
Das zweite ist der Walzer des Orlofsky (»Bei rauschender Weise im fröhlichen Kreise«), der berühmte G-dur-Walzer, der erst lauernd die Dominante umspielt, bis er plötzlich vor Wonne stampfend in Frenesie emporschnellt.
Das dritte ist das parodistische Tränenthema Rosalindens: »Oje, oje, wie rührt mich dies!« – Worte, die übrigens von Strauß selbst dem Text hinzugefügt wurden. Die kurze Stretta schäumt rasch zu Ende: erst für sie schreibt Strauß, der Meister nobler Zurückhaltung, kleine und große Trommel und Triangel vor, was die Praxis der Provinzbühnen nicht hinderte, dem Publikum schon in der Einleitung Gran-Cassa-Hiebe zu versetzen. Jedenfalls gibt diese Ouvertüre die Stimmung ihrer Welt so stilvoll wieder wie die der Lustigen Weiber oder der Meistersinger die der ihren.
Von der Mitte des zweiten Akts aus übersieht man die Technik des Werks am besten. Dort begrüßt der Chor das Fest bei Orlofsky mit einer E-dur-Polka (»Ein Souper hier uns winkt«). Aber diese Orlofsky-Stimmung ist hier nicht neu. Man hörte sie schon: sie umklingt im ersten Akt das Geflüster des Falk, der Eisenstein zuredet, die Soirée zu besuchen. Sie betört als leichte rhythmische Lockung schon das Stubenmädchen Adele, während sie den Einladebrief ihrer Schwester liest. Sie entsprang einer Wendung des Textes (Falk: »Wenn die Polka lockend klingt«), ist instrumental, nicht vokal erfunden – die Gesangnoten sind irgendwie eingezwängt – und erlangt eine parodistische Bedeutung im dritten Akt, wo sie (in F-dur) den verkaterten Frank verhöhnt und zwar mit einer obstinaten Fagott-Stimme versehen, die allen Kopfweh-Jammer der Welt in eintönig-stöhnenden c-des-c versammelt. So schwebt die Polka als stimmungtragendes Erinnerungsmotiv durch die Vorgänge, ohne als solches gewollt zu sein.

Strauß ist also keineswegs der hemmungslose Blütenstreuer, der bewußtlose Tänzer; er zeigt eine leichte Spieloperntechnik, die ihm der Stoff selbst anerzogen, wenn man will: diktiert haben mag. Der Bühneninstinkt wuchs mit der Arbeit.

Johann Strauß' Häuschen am »Dreimarkstein« und ...

»Fledermaushaus« in Hietzing
Eine weitere Probe dafür ist das berühmte Melodram im dritten Akt, eine wirklichkeitsnahe Psychologie des Ballmorgens, entsprungen dem eignen Erleben. Ein Herr torkelt, den Zylinder über den Augen, Überrock hochgeknöpft, in sein Bureau. In den gedämpften Violinen (Klarinetten und Oboen unisono) ein langes, langes Gähnen; in den Bratschen verräterische 32tel-Stöße. Die Fagotte sagen dazu: »Mein schönes, großes Vogelhaus ...« – ah: es ist der Gefängnisdirektor Frank! Einmal hat er das Vogelhaus-Motiv sehr entschlossen im Einklang mit der Trompete gesungen: im nüchternen und amtlichen Zustand; ja, als er damals störend eintrat, um Eisenstein zu holen, begleitete ihn schon ein kurzes Melodram, meldete ihn das Streichquartett witzig als den »Vogelhaus-Besitzer«.

Handschrift der ersten Partiturseite der »Fledermaus«
Nun parodiert das Motiv den wackeligen Mann, ein Walzer nimmt ihn in die Arme, schleift ihn herum – in ihrer hohen Lage klingt die Bratsche mit der Flöte wie »benebelt« –: »Ha, welch ein Fest, welche Nacht voll Freud!« Er besinnt sich ... da steht die Wirklichkeit ... das Vogelhaus – Fagotte laufen in ein spitzes Haarweh-Unisono aus – noch ein Verführungswalzer, die Orlofskypolka traumhaft, endlich sanftes Entschlummern auf wiegendem Cellobaß.
Man hat das Melodram ein Gegenstück zur Beckmesser-Szene genannt – vielleicht wurde es sogar durch die Meistersinger angeregt –, aber abgesehen von seiner unpolyphonen Natur, ist es höchstens seiner Stellung wegen – als Eröffnungsszene des dritten Akts – eine Art Seitenstück. Nach der Orlofsky-Orgie des zweiten Aktes stöhnt das graue Elend seinen Monolog: es gab keinen wirksameren Aktbeginn. Bei der Generalprobe hatte die bühnenerfahrene Marie Geistinger einen sehr zweifelhaften Eindruck von dem Melodram: »Ah, das is' fad, wann so lang nix g'redt wird!« Auf welche Äußerung hin Strauß, halb unsicher, halb zuvorkommend, wie er war, die Szene bereits streichen wollte; aber Genées Bühnensinn ließ sich nicht irre machen, er bestand auf der Szene, die schon im gesprochenen Vaudeville wirksam war, und zum Glück blieb sie erhalten.
Strauß, der die Musik in Nummernform komponierte, gibt nicht jeder Person ein rhythmisches Profil; dennoch sind sie lebendig. Der schönsingende Alfred, eigentlich nur eine Stimme, kein »Mann«, wird durch einen spielopernhaften Romanzenton, C-dur, 6/8, charakterisiert; das berühmte Trinklied »Glücklich ist, wer vergißt«, eine Polka-Mazur, vergoldet seinen flachköpfigen Leichtsinn und gibt Alfred den Ton köstlicher Selbstparodie. Der cholerische Eisenstein lebt sich in der impetuosen D-dur-Polka aus, deren Themen in die Luft geschleudert werden wie die Papiere des idiotischen Advokaten Blind. Eine ähnliche Streitszene wie in Dittersdorfs »Doktor und Apotheker«, wo Krautmann in Triolen wütet: »diese können weiter nichts als projectiren, consultiren, referiren, controlliren, condemniren, exequiren ...« – das zungenfertige Presto ist sogar das gleiche: typische Figuren ergeben die gleiche Stilistik.
Das Stubenmädchen Adele führt sich durch ein langes Koloraturgelächter ein (in der Partitur noch um zwei Takte länger als im Klavierauszug), was aber später nicht festgehalten wird, vielleicht weil sie nicht Hauptfigur ist. Diese ist vielmehr Rosalinde, der Liebling des Komponisten. Wenn Eisenstein Abschied nimmt, zerfließt sie in Krokodilstränen einer Mollromanze mit chromatischen Violinvorhalten (as-g). Wenn Frank sie mit Alfred überrascht, spreizt sie sich zu einem marionettenhaften Beleidigtsein, zu der »Was-glauben-Sie-denn«-Entrüstung, die ihre Tugend mit Norma-Gesten verteidigt, während der Liebhaber frech danebensitzt. In einer Violinpolka liegt ihr Weiber-Raffinement und die Darstellerin braucht nur das durchtriebene Linienspiel der Melodie nachzuspielen:

Ein Walzer schließt das Raffinement stilvoll ab. Es ist kein Volksgarten- oder Dommayer-Walzer, sondern der Charakterwalzer einer Dame, die zu Tod gekränkt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt:

Orlofsky, Träger des zweiten Akts, Repräsentant mondänen Zeitvertreibs, exotischer Boulevardbevölkerer, sarmatische Zeitfigur von Turgenjewschem Parfüm, ist so geschildert, wie man eine interessante Reisebekanntschaft im Freundeskreis mit witzigem Behagen schildert.
Im duftigen Vorklang macht die Polka den Mund auf das Orlofsky-Souper wässerig. Nun kommt er selbst und singt ein Couplet von prächtigem Farbenschimmer. Die Harmonie des Zwischenspiels hat einen Stich ins Unterdominantische, das As-dur-Ges-dur klingt wie aus russischer Liturgie herüber. Die Instrumentation verstärkt das Exotische: die Pianissimo-Posaunen, das leise Gezisch des Tamburins, die tiefe, näselnde Oboe (in Unterterz zur Violinmelodie), die kurz einfallenden Trompeten: der Fremde von Distinktion steht da, das madeiraschlürfende Seelchen, das Strauß in den Tagen von Pawlowsk oft genug erlebte.
In wirksamer Akzentuierung des infantilen Verschwendertums haben die Librettisten Orlofsky zur Hosenrolle gemacht und nach dem Couplet läßt Publikumsgespanntheit die Figur nicht mehr los. Leider geht der delikate Glanz des Porträts, das Kolorit des genialen Genrebilds durch den fatalen Gleichmut der Bühnenpraxis meist verloren, kein Kapellmeister müht sich um den Humor der Instrumentation und meist wird das Couplet zitiert, ohne daß man seinen aparten Reiz ahnt:
's ist mal bei uns so Sitte,
Chacun à son goût!
Auch in keiner Instrumentationskunde findet sich ein Wort von diesem Kabinettstück orchestraler Malkunst. Und hier im Genrehaften waltet dasselbe Kunstgefühl, das den Komponisten von Tristan und Isolde bestimmte, sein Drama mit dem Cello zu beginnen. Instinktives Gewichtsempfinden veranlaßt Strauß, auch die Posaunenwucht bis zum Finale zu verschieben, mit den selten hingetupften Triangelblitzern (Champagnerlied) ebenso zu sparen wie mit der Harfe, die die Spitzen einer in Intervallzacken jagenden Melodie vergoldet (»Schnell fliegen die Stunden«). Als Hugo Wolf den Corregidor komponierte, legte er vor sich die Meistersingerpartitur auf den Tisch; ein guter Freund hätte ihm – bisweilen – die Fledermaus dazulegen dürfen ...
Es gibt noch kleine dringliche Reize, die ein bühnenhafter Sinn bereitet. Wenn Frank das Tête-à-tête Rosalindes und Alfreds stört, genügt dem Komponisten ein einziges Es der Kontrabässe, dann ein einziger Hornton: der Nervenschock der Dame ist erwiesen. Dann die feinere Satztechnik, die mehr als sonst Gebrauch von der Imitation der Stimmen macht, und ihr Gegenteil: die technisch unbekümmerte Gewichtlosigkeit der Musik. Der Komödientyp, den Strauß schafft, berührt die Seele flüchtig wie die Tangente des Glücks und entspricht einem unpolyphonen Bewußtsein wie sein Gegenbild, der Rosenkavalier, dem polyphonen.
Aber die Fledermaus wäre nicht Straußisch und kein aus dem Orgiasmus geborenes Meisterwerk, besäße sie das zweite Finale nicht. Nach allem Frohbeschwingten kommt zuletzt der Schwung in die Höhen über Buch und Textdichter hinaus.
In zwei breiten Ansätzen – unterbrochen vom Ballett – gewinnt die Musik die Finalhöhe. Die ersten Impulse gehen vom Allegro con brio aus, das die Personen bereits chorisch zusammenballt: »Die Majestät wird anerkannt rings im Land!« Eine einzelne Stimme erhebt sich dann, zart verzückt wie in Eingebung: »Brüderlein und Schwesterlein wollen wir alle sein!«, zieht die andern Solostimmen an sich; sie schwellen imitatorisch an, stauen sich auf der Dominante und stürzen, sich entladend, in eine Walzerhymne, die in ihrer Art ganz neu ist. In bloßen Urlauten schwelgt eine jauchzende Gesangsmelodie (»Duidu!«), ein verklärtes Jodeln erfüllt die Luft, bis alles bewußte Denken in einer wahren Klangüberschwemmung untergeht.
Nach dem Ballett beginnt unversehens der zweite Teil: ein Tanzwalzer. Thema um Thema entwickelt sich und alle zusammen bilden eine große Walzerpartie von fünf Teilen mit Coda, die Form, die Strauß für den Volksgarten zu schreiben gewohnt war und die er dem Vorgang überwirft wie einen Mantel. Rundete Mozart seine Arien formell, baute Beethoven in den Fidelio Sonatensätze ein, so verwendet Strauß seine persönlichste Form für das Operettenfinale. Der ¾-Takt-Coda folgt eine zweite Coda im Zweiviertelrhythmus; das Tempo wird angefacht, eine Schnellpolka des Orchesters stimmt das Champagnerlied, eine Quint höher, vom Wort entlastet, an: ein Schrei der Lust tönt von der Bühne in die Welt hinaus.
Der Vorhang fällt. Wir müssen ins Gefängnis des Lebens zurück, aus dem uns eben der Dionysiker befreite. Es scheint uns amüsanter, in seiner dicken Luft hängt irgendwo ein Walzer, aus einer Ecke trällert es: »Ha, welche Nacht voll Lust und Freud' ...!«
Strauß hat vielleicht nur noch ein ähnliches Finale geschrieben, das vom Waldmeister. Die dionysische Stimme des Werks wurde indes bei der Uraufführung, 5. April 1874 (Theater an der Wien), kaum gehört. Man hielt für »hübsch«, was korybantisch war, und kaum ahnte jemand, daß die Gattung »Operette«, deren ursprüngliche Aufgabe war, zwischen den Akten einer ernsten Oper ein wenig zu hanswursteln, hier eine vom Leben befreiende letzte Form gefunden und ihren Hörern den Schatz des Lachens mitgegeben habe.
Gleichwohl kann von einem verschleierten Durchfall der Fledermaus, wie meist behauptet wird, keine Rede sein. Zwei Monate nach der Première hatte das Werk 49 Wiedergaben aufzuweisen. Von den 88 Operettenaufführungen, die 1874 im Theater an der Wien stattfanden, entfielen 58 auf die Fledermaus. Nach dem bekannten »Siegeszug« über die Auslandsbühnen wurde sie zur »Operette der Operetten« erhoben, zum Kanon, woran die Lehár-Operette geradeso gemessen wurde wie Strauß an der Lecocq-Operette.
Die Kritik spiegelte die Zeitmeinung wieder und erfüllte ihre Aufgabe durch Absprechen. Immer noch hat ihre leugnende oder zweifelnde Begleitstimme den Künstler, sei er nur groß genug, zum Höheren gestachelt und nie war eine kleine komponierende Eitelkeit vor ihrem Lob sicher.
Hier eine kleine Tafel von Fledermaus-Glossen:
»Der zweite Akt enthält einige Trivialitäten, z. B. die Couplets des russischen Prinzen und das Champagnerlied, welches durchaus nichts Moussierendes und Prickelndes, sondern höchstens eine Verherrlichung von Kleinoschegg bildet ...«
»An erfrischender Originalität der musikalischen Einfälle scheint uns Strauß sein letztes Wort noch immer nicht gesprochen zu haben ...«
»Diese ›Handlung‹ hat Johann Strauß zur Unterlage für seine neueste Komposition genommen, und das beweist, daß der in aller Welt bekannte und in aller Welt gefeierte Künstler entweder sehr bescheiden ist oder
trotz aller Anstrengungen nichts Besseres zu finden wußte.«
»Strauß unterscheidet sich von seinen Operettenkollegen darin, daß er seine Partituren nicht verfertigt, daß er sie dichtet, daß er sie nicht schleudert, sondern sie mit aller jener Sorgfalt ausstattet, die man von einem Kunstwerk erwartet. Wo sich Offenbach mit einem koketten Scherz zufrieden gibt, macht sich Strauß an eine fein instrumentierte Arie, und wie jener mit einem Einfall zufrieden ist, verliert sich dieser in ein reich gegliedertes Finale.«
»Wir wollen seine Operette nicht in den Himmel heben, sondern hübsch auf Erden bleiben, daß der Mann nicht übermütig werde ...«
Hanslick hörte ein »Potpourri aus Walzer- und Polkamotiven« und Speidel mußte das Werk gegen die Eselsohren der Erinnerungshörer verteidigen:
»Und dann dieser G-dur-Walzer mit echten Wiener Akzenten, in welchen der Chor so heiter eingeflochten ist. Bei diesem Walzer hörten wir um uns herum den Namen Offenbach murmeln, mit Anspielungen auf den Walzer in den (gottlob) seligen Rheinnixen. Was aber hat der Walzer von Strauß mit dem Offenbachschen gemein? Höchstens, daß er in den Geigen auf der vierten Saite beginnt, eine alte Walzersitte, die man namentlich bei Lanner findet. Die schlechte Bildung denkt dabei an Reminiszenzen und die gute freut sich dieser Vollblutmusik, in der die stärksten Wiener Pulse schlagen ...«
Ein anderer Kritiker stellte fest, Strauß mache zur Albernheit strohener Textworte goldene Musik. Ein Vorwurf, der sich gegen die adelnde Fähigkeit der Musik richtet und ungewollt zum Lob des Meisters wird. Seinem inneren Musiküberschuß war es gleichgültig, ob er sich bei hohen oder niederen Worten ansetzte. Er vergoldete oder kultivierte jedes Textwort und hat dem deutschen Zitatenschatz gerade durch die Fledermaus eine Reihe von geflügelten Worten zugeführt.
Bei Strauß läßt sich ebenso leicht primäre Instrumentalmelodik feststellen, der das Wort unterschoben wird (Orlofsky-Polka), wie primäre Gesangsmelodik, die dem Wortklang entsprang (»Glücklich ist«). Im ersten Fall überließ er sich der Gesamtstimmung, im zweiten wird er psychologisch gewissenhafter – man beachte nur das Leiern der brieflesenden Adele, das Stottern des Advokaten Blind –, jede Deklamationsform ist bei Strauß Sitte ...
Eine andere Stimme erhebt die Frage, warum Strauß nicht wie Lecocq, der Spätere also nicht wie der Frühere, der Stärkere nicht wie der Schwächere komponiert habe: »Strauß hat nicht den leichten, tändelnden Melodienfluß, wie wir ihn zum Beispiel in ›Angot‹ fanden ...« Wir freuen uns, daß er ihn nicht hatte, denn er bildete den G-dur-Walzer mit der unvergeßlichen Profillinie, der dithyrambischen Kurve:

und nicht die Final-Melodie der Angot, eine Linie, die nur im Anfang Wurf hat, dann aber ins leere Lächeln der Allerweltsgefälligkeit mündet und uns salzlos anmutet; Atelier-Schönheiten der Siebzigerjahre:

Wie jeder Schöpferische hat Strauß fremde Kulturelemente aufgenommen, Verwandtes seinem Wesen verbunden, wobei die Kontrolle der Zeitgenossen die Aufnahme schärfer sah als die geistige Verarbeitung. Damals entzog sich Strauß nicht so streng den Zeitströmungen, fürchtete weniger für seine Originalität als später, wo er sich geradezu ängstlich vor fremden Werken abschloß. Außer dem Auber- und Offenbachton findet sich (etwa im Terzett Nr. 15) noch ein kleinbürgerlicher Lortzington, die Sexten- und Septenjauchzer des Champagnerliedes sind veredelte alpine Jodelmusik, ja man kann, ohne Strauß zu verkleinern oder Lecocq zu überschätzen, in der Fortführung jenes schwächlichen Angot-Walzers den ersten Keim zum Natur-Walzer aus dem »Lustigen Krieg« aufblitzen sehen:

Und hier darf auch eine Legende zerstört werden, die die Nachkritik erfunden hat. Immer wieder taucht neben Johann Strauß – der andere auf: der Mann, dem die Straußischen Einfälle eigentlich einfielen, der seine Werke eigentlich geschrieben habe, der große Genius, der da leuchtet wie die Lampe im Dunkeln und der, will man ihn fassen, zu den Schatten entschwindet.
So wurde hartnäckig behauptet, die Musik zur Fledermaus rühre eigentlich von Josef, nicht von Johann Strauß her. Eduard Kremser, ehemals Chormeister des Wiener Männergesangvereins, habe davon im Freundeskreis ... im Kaffeehaus ... unter Zwinkern gesprochen und heimliche Wissenschaft durchblicken lassen: der »Duktus« der Fledermaus-Melodik sei unverkennbar fremd, abweichend von Johanns persönlicher Schreibweise, wahrscheinlich habe Johann ein bißchen in Josefs Nachlaß, der nach seinem Tod verschwand, hineingespitzt. Der Meister, der ein ganzes Heer von Transskribierern, das ist Bearbeitern, und von meistens uneingestandenen Nachschreibern ein Geschlecht lang in Bewegung setzte, sei also selbst Abschreiber ...
Nach allem, was wir von Josef kennen und wissen, war er gerade das Gegenteil eines Fledermaustemperaments. Dieses Werk konnte nur einer geschrieben haben, der Offenbach in Paris erlebt hatte – das erotische Weltgefühl und die Ekstase dieser Partitur trägt durchaus den leichten, moussierenden, romanischen Duktus: – alles, was dem genialen Josef völlig fremd war. Josef wurde von Richard Wagner belobt, als er in der »Neuen Welt« das Holländerduett in eigener Orchesterbearbeitung aufführte; aber Johann hatte ihm schon nicht die Fähigkeit zugetraut, erfolgreich »für Asien zu schreiben«, als er in Pawlowsk war.
Josefs Nachlaß, worin sich der Entwurf einer Oper befunden haben soll, kam an Johann und Eduard erzählt in seinen Denkwürdigkeiten unter ironischem Getue (S. 48-50), daß er ihn nach Jettys Tod von Johann erhielt und erstaunt war, bloß ein einziges Notenpaket, meistens Skizzen schon gedruckter Sachen, zu finden. Allein durch den Hinweis auf Johanns genial nachlässige Behandlung fremder Manuskripte entwertet er selbst die hämischen Stöße, die er Johann unter dem Tisch versetzt, und hiervon ganz abgesehen: – das innere Gesicht der Fledermausmusik entscheidet für jeden Musiker, ganz gleichgültig, was mit dem Nachlaß Josefs geschah. Die Fledermaus entstand in jenen 42 Nächten in einem entrückten Hetztempo – der Einzige, der Strauß mit seinem praktischen Rat zur Seite stand, war Richard Genée; vielleicht hat er mit ihm Mittelstimmen, Instrumentalfragen besprochen –, aber die Einfälle Johanns hat Genée leider so wenig gehabt wie Josef.
Eher ließ sich beim »Karneval in Rom« eine Beeinflussung durch Josef denken: hier weisen manche Nummern, wenn es einem gesagt worden ist, wenn man sich darauf einstellt und man es so hören will, einen neuen »Duktus« auf, so die berühmte Glockenstelle etwa mit ihrem wachsenden melodischen Höhendrang:
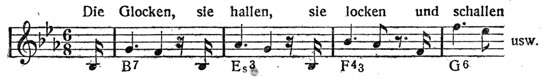
Oder der G-dur-Walzer (»Der Gott, der die Triebe«), der in der Ouvertüre mit Mediantenrucken eingeführt wird und ebenfalls die großen Josefs-Sprünge macht:

Und: warum soll Johann nicht einmal einen josefartigen Einfall gehabt haben? Waren die beiden einander so fremd, hatten sie so gar nichts »Verwandtes«?
Dem Argwohn steht es natürlich frei, aus der vorwiegenden Zweitaktigkeit der Karneval-Partitur Schlüsse zu ziehen – woraus ließen sich keine ziehen? – aber ein Thema wie das chromatisch flüsternde

weist wieder einen so echten »Duktus« auf, daß alles Schnüffeln vergebens scheint.
Vor allem aber entscheidet die Gebärde des Künstlers. Kann man sich Johann Strauß, den Mann, den die Einfälle verfolgten, als Plagiator vorstellen? Strauß, der in Ansehung seiner Originalität von einem peinlichen Ehrgeiz erfüllt war wie Edvard Grieg, soll mit heimlichem Umsehen Josefs Nachlaß geplündert ... daraus Stellen entnommen ... und während der Nacht in seine Partitur geschmuggelt haben ...?! Haltet den Dieb! Man wittert die Lüfte der Ressentiments und nur die Ahnungslosigkeit, die noch immer nicht weiß, welcher Genius Johann Strauß war, der Drang der Unteren, den Oberen ein bißchen zu veruntern, kann dies halbwegs erklären.
Die Legende schrumpft ..., ihren zweiten Teil – die Instrumentierungsfrage der Partituren – werden wir noch behandeln. Erfunden ist sie von der Wiener Neigung zum Scherbengericht, die unmittelbar neben dem Wiener Enthusiasmus und musikalischen Instinkt wohnt. Sang man dem Wiener im Donauwalzer vor: »Wiener, seid froh!« – hundert Stimmen des Unglaubens ertönten sofort: »Oho, wieso ...?«
Wien ging in der Fledermauspflege mutig voran und gelangte schon 1876 zur hundertsten Aufführung; Hamburg hatte dieses Jubiläum freilich bereits früher gefeiert und noch mutiger war Berlin, das bereits die 200. Aufführung erreicht hatte. In Paris erschien das Werk, stark verändert, 1875 nach Indigo und wurde als »La Tzigane« Zugstück des Renaissance-Theaters. Es eroberte die Stadt, von der die Operette des zweiten Kaiserreichs, Europa erobernd, ausgezogen war. In krauser Ironie bog das Schicksal die Endlinie einer Entwicklung in den Ausgangspunkt zurück. Ganz Paris saß bei der Fledermaus. Nur ein Mann blieb fern. Mit Gichtknoten an den Händen lag er in seinem Lehnstuhl, ein Ausgeschalteter, von einer Todeswolke überschattet. Und schrieb unter bohrendem Schmerz, in letzten Hinfälligkeiten an der einen komischen Oper, für die er gelebt, von der er ein Menschenalter geträumt hatte. Das Werk eines Lyrikers, der sein reines Wesen, seine Minne und Mystik zu Ende sang, bevor ihn Doktor Mirakel ins ewige Dunkel holte: Hoffmanns Erzählungen.
Ein zweites Mal erschien die Fledermaus in Paris als »Chauve Souris« nach dem Tod des Meisters: 1905 mit der berühmten Lavallière, in den Kostümen des zweiten Kaiserreichs und in einer fabelhaften Aufmachung. Kapellmeister Bodanzky dirigierte das Werk, das abermals gänzlich umgearbeitet werden mußte. Denn Halévy, einer der Autoren von Réveillon, widersetzte sich der Fledermaus bis ins Eigensinnige, wollte nicht einmal deren Musik anhören und zeigte sich, wohl aus Besorgnis um seinen Schwank, gänzlich unzugänglich, obwohl er mit Meilhac zusammen, von Benedix angeregt, nur Anspruch auf eine Hälfte Unsterblichkeit hatte. Erst nach langwierigen Verhandlungen mit der Witwe des Meisters wurde er vernünftig und gab nach.
1894, als das Werk zwanzig Jahre alt war, wurde es entdeckt. Gustav Mahler führte die Fledermaus im Hamburger Stadttheater (mit Heinrich Bötel, Katharina Klafsky und Fräulein v. Artner) als komische Oper auf. Nicht aus Caprice, nicht aus österreichischer Sentimentalität, sondern um eine der liebenswürdigsten Erscheinungen der heiteren Bühne von operettenhafter Entstellung und schablonenhaftem Abgespieltwerden zu reinigen. Seinem Beispiel folgte – etwas zögernd – die Wiener Hofoper, die die Fledermaus anfänglich nur an Nachmittagen (mit Paula Mark, Ellen Forster, Lola Beeth, den Herren Schrödter, Ritter, Felix, Schittenhelm) aufführte – bis das Werk am 28. Oktober 1894 unter dem Schutz eines Strauß-Jubiläums (50. Gedenktag des Dommayerkonzerts) und unter Widerspruch kritischer Vornehmtuer auch abends erschien, alle »Dennoch«-Argumente« anmutig entkräftete und dem Ruf der Staatsoper bis heute nicht geschadet hat. Seitdem sind die Glanzbesetzungen der Fledermaus bei allen möglichen Gelegenheiten üblich geworden.
*
Strauß zählte achtundvierzig Jahre, als er die Fledermaus schrieb. Er stand auf jenem hohen Punkt, von dem man selbstbewußt nach rückwärts, etwas beklommen nach vorwärts blickt. Man steigt in diesen Jahren die Treppe schon etwas umständlicher hinauf, entschließt sich, das erste silberne Grau im Haarschwarz wegzufärben; wenn man Strauß ist, will und muß man jung bleiben. Er blieb es. An seine zweite Jugend schloß er eine dritte, ein Wunder an Vitalität.
Sein Meisterwerk war geschaffen und die Fledermaus klärt die Frage, ob Strauß Dramatiker der Operette war oder nicht. Wo er seinem Euphorismus, seiner dithyrambischen Philosophie, seinem erotischen Weltgefühl musikalische Symbole geben, wo er mit einem Wort den inneren Musiker singen lassen konnte, dort war ers, war er Meister: der Dramatiker des eigenen Temperaments. Seine Tragik als Wiener Künstler bestand darin, daß er das Straußische Buch ein Leben lang suchte und nur einmal fand: das Buch, in das sein Ich wie in einen anderen Leib einging.
Eine zweite Fledermaus hat er nicht geschrieben.