
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Nachdem wir Ördek Lebewohl gesagt hatten, ritten wir 40 Kilometer nach Südosten. Rechts von unserem Wege war eine kleine hügelige Paßschwelle ganz schwarz von Hunderten von Yaken. Da sie keine Miene zum Fliehen machten, hielten wir sie für zahm und erwarteten jeden Augenblick, ihre Hirten zu erblicken. Doch wie wir näher kamen, zogen die Tiere sich zurück; es waren doch Wildyake, und vorläufig konnte es noch ein paar Tage dauern, ehe wir an das erste Nomadenlager gelangten. Wir sehnten uns danach, dort würden wir uns bedeutend sicherer fühlen.
Auf offenem Terrain, mit freier Aussicht nach allen Seiten, guter Weide, Wasser und vielem Yakdung, wurde das Lager aufgeschlagen. Jetzt waren die drei Pilger allein, und ich mußte gefälligst beim Abladen, Zeltaufschlagen und Brennstoffsammeln helfen. Seit 1886, als ich zweimal beinahe ganz allein durch Persien geritten war, hatte ich derartige grobe Arbeiten nicht verrichten brauchen. Es war mir jedoch höchst interessant, einen Einblick in das tägliche Leben der Karawanenleute tun zu können. Schagdur sollte jetzt der Vornehmste von uns sein; mir durfte keine Spur von Ehrerbietung erzeigt werden, im Gegenteil, ich sollte wie ein Knecht behandelt werden. Russisch durfte nicht gesprochen werden, nur Mongolisch sollte künftig über unsere Lippen kommen. Wir spielten unsere Rollen ausgezeichnet; anfangs wurde es Schagdur freilich sauer, mir zu befehlen, Dung zu sammeln, aber nach ein paar Tagen ging es wie geschmiert.
Nachdem ich meine Arbeit zur Zufriedenheit meiner Vorgesetzten ausgeführt hatte, legte ich mich aufs Ohr, um einen gründlichen, notwendigen Schlaf zu tun. Ich schlief fest bis 8 Uhr, um welche Zeit es schon dunkel um mich herum war, während die beiden anderen die Tiere zusammentrieben. Noch eine Stunde durften diese ganz in der Nähe des Zeltes frei umhergrasen. Dann wurden sie an einem zwischen zwei Pflöcken ausgespannten Seile festgemacht, und jetzt und für die Zukunft folgender Lagerplan festgesetzt. Die Tiere wurden stets an der Leeseite des einen Zelteinganges, der offen blieb, gepflöckt. Sobald es dunkel wurde, mußte das Lagerfeuer ausgelöscht werden, die Kisten, das Küchengeschirr und die Sättel waren dann in das Zelt zu tragen. Jollbars wurde auf der Leeseite der Tiere angebunden; von ihm konnte man also das erste Warnungssignal erwarten. Der zottige Malenki lag angebunden vor der geschlossenen Querseite des Zeltes. Die Nacht wurde in drei Wachen, von 9–12 Uhr, von 12–3 und von 3–6, eingeteilt; gewöhnlich übernahm ich die erste und der Lama die letzte Wache.
Schagdur und der Lama sahen an diesem Abend außergewöhnlich ernst aus; als ich sie fragte, was ihnen fehle, erzählten sie, daß sie während meines Schlafes drei Reiter gesehen, die sich unserem Lager von Süden her genähert, an einem Hügel Halt gemacht und eifrig miteinander beraten hätten, dann aber im Terrain verschwunden seien, um nicht wieder zu erscheinen. Ihr Betragen habe einen außerordentlich verdächtigen Eindruck gemacht; sie warteten augenscheinlich die Nacht ab, um etwas gegen uns zu unternehmen. Wir waren uns darüber klar, daß wir von Spionen und reitenden Späherpatrouillen umgeben waren, aber ob diese aus eigener Machtvollkommenheit oder auf höheren Befehl handelten, konnten wir natürlich nicht wissen.
Schon vor neun Uhr schnarchten meine von den Anstrengungen der ersten Nacht ermüdeten Genossen laut. Ich selbst hatte meine erste Nachtwache und ging auf und ab, bald in der Nähe des Zeltes, bald ein wenig weiter davon entfernt. Das Wachbleiben war keine Kunst, jeden Augenblick konnte man einen Überfall erwarten. Die Minuten vergingen sehr langsam. Jollbars heulte jedesmal vor Freude, wenn ich zu ihm kam, und Malenki wedelte mit dem Schwanze, wenn ich ihn besuchte.
Es hatte während des Tages wiederholt geregnet, und jetzt am Abend überzog sich der Himmel mit rabenschwarzen Wolken, hinter denen helle Blitze zuckten, während der Donner ringsumher krachte. Der Regen peitschte die Erde und stürzte in ganzen Fluten herab, er schmetterte und knallte auf das Zelt, das wie ein Waschlappen zusammenzufallen drohte. Drinnen wurde alles naß, denn ein feiner Sprühregen, der Dusche eines Eau-de-Cologne-Zerstäubers vergleichbar, drang durch den Filz. Die Schlafenden kümmerten sich nicht darum, sie krochen nur besser unter ihre Pelze und sägten ihre Bretter weiter. Die Regentropfen trommelten auf eine Kasserolle, die im Freien stand, die Hunde knurrten dumpf, Pferde und Maulesel aber klatschen mit den Schwänzen, wenn ihnen der Regen die Seiten kitzelt. Ich zündete die Laterne an und setzte mich in die Zelttür, um zu schreiben, aber bei dem geringsten verdächtigen Geräusch mache ich wieder die Runde. O, diese finsteren Nächte, diese endlosen Stunden! Nie werde ich mein einsames Hinundherwandern zwischen Jollbars und Malenki vergessen! Der Mondschein nützte mir nicht viel; die Wolken waren hoffnungslos dicht, doch ist ein schwacher, verschwommener, hellerer Schein wahrnehmbar, in welchem sich die Tiere schwärzer als die Nacht hinter ihnen abzeichnen.
Ein langgezogener, klagender Ton dringt an mein Ohr, kaum vernehmbar vor dem eintönigen Fallen des Regens. Werden die Tibeter anfangen, wie Hyänen zu heulen, gleich der tangutischen Räuberbande, die mich 1896 in der Nähe des Kuku-nor verfolgte! Ich eile mit dem Revolver unter dem Mantel hinaus, bleibe stehen, lausche, warte eine Weile im Regen und höre wieder denselben Laut; doch ach, es ist nur Jollbars, dem das Wetter nicht gefällt. Das nächste Mal ist es ein Donnerschlag in der Ferne oder das unschuldige Klatschen eines Maultieres mit dem Schwanze, was mich unwillkürlich zusammenzucken läßt. Rauchen kann man nicht, alles ist durchnäßt. Die Maulesel schlafen im Stehen, und ihr eintöniges Atmen wirkt einschläfernd. Auch meine Augenlider begannen schwer zu werden, aber ich würde mich selbst wie einen Hund verachtet haben, wenn mich jemand im Schlafe überrascht hätte.
Um 11½ Uhr streifte ich in der Dunkelheit umher, fest entschlossen, erst dann ins Zelt zurückzukehren, wenn die Mitternachtsstunde mir meine Befreiung verkündete. Als meine Wache vorbei war, setzte ich mich neben dem Lichtstumpfe nieder, mein Pelz triefte, und es gluckste, sowie ich mich bewegte. Ich mochte Schagdur nicht wecken, er schlief so fest, und ich hatte mich gerade überredet, seine Wache um eine halbe Stunde zu verkürzen, als die Hunde wütend zu bellen begannen. Der Lama erwachte und eilte mit seinem Gewehre ins Freie, ich löschte die Laterne aus und folgte ihm mit dem Revolver. Wir schlichen uns nach der verdächtigen Seite in Lee; dort war deutlich Pferdegetrappel und in der Ferne Hundegebell zu hören. Tibetische Reiter beobachteten das Lager aus etwa einigen 100 Meter Entfernung. Der Lama mußte wieder nach dem Zelte zurück, und ich ging mit Schagdur, gelegentlich stehen bleibend und lauschend, in Lee weiter. Jetzt hörten wir das Pferdegetrappel sich eilig entfernen; alles wurde ruhig, und die Hunde hörten auf, zu bellen. Nun mußte Schagdur Wache halten, und bei dem eintönigen Geräusche seiner langsamen, langen Schritte schlief ich ein.
Schon um 5 Uhr, als der Lama uns weckte, machten wir uns fertig und brachen auf. Man fühlt sich betäubt und frostig nach einer solchen Nacht, die selbst für einen, der sich im Dunkeln nicht fürchtet, ungemütlich ist. Wir sehnten uns nach der Sonne, aber der Tag blieb düster und trübe, und die Wolken hingen so schwer herab, daß man meinte, sie müßten gerade herunterfallen. Alle Augenblicke entluden sie sich und hingen dann so tief, daß wir das Gefühl hatten, hier sei »die Decke zu niedrig«. Wir reiten immer tiefer in dieses unbekannte Land hinein und sind überzeugt, daß früher oder später etwas Außerordentliches eintreffen muß. Und ebenso gewiß ist es, daß wir bewacht sind, obwohl unsere Verfolger sich nicht zeigen; wahrscheinlich wollen sie eine passende Gelegenheit abwarten.

Auf dem Wege nach Lhasa in strömendem Regen.
In einem Tale lag ein totes Schaf und daneben seine Last, die aus Salz bestand, das in einen Sack eingenäht war. In Tibet wird nämlich neben dem Yak auch das Schaf als Lasttier benutzt. Auf einem dominierenden Passe in einer jetzt vollständig mit Schnee bedeckten Kette konnten wir einem ausgetretenen, viel benutzten Wege folgen, dessen Richtung nach dem Tengri-nor, dem etwa 100 Kilometer nördlich von Lhasa liegenden See, führte.
Auf der 70 Meter breiten Landenge zwischen zwei kleinen Seen wurde das Zelt wieder aufgeschlagen. Nach Verrichtung der gewöhnlichen Arbeiten schliefen zwei von uns; ich hörte den Regen niedergießen und fühlte, wie es vom Zelttuche herabtropfte. Schon um 8 Uhr wurden die Tiere festgemacht; die Luft war ruhig, aber der Regen strömte, als befänden sich über unserem Lager Tausende von Dachrinnen. Es war ja die Regenzeit da, und es mußte also vorschriftsmäßig regnen; wir hatten kein Recht, uns zu beklagen. Vier Stunden muß ich wachen und sitze zeitweilig in der Zelttür, wo es einigermaßen geschützt ist. Es klatscht auf den Packsätteln der Maulesel wie in einer Waschmaschine, und von den Satteldecken rinnt das Wasser in dicken Strahlen herunter. Wenn die Tiere sich schütteln, umgibt sie eine Wolke von sprühenden Tropfen. Manchmal spitzen sie die Ohren, und die Hunde knurren verdrießlich. Malenki läuft frei umher und sucht nach Knochen; hier gab es Reste von tibetischen Mahlzeiten, und der hier liegende Yakdung war schon einmal umgedreht worden, um besser zu trocknen; man beabsichtigte also, wiederzukommen und ihn zu holen.
Nun fangen die Hunde wieder an zu bellen. O, nur ein blinder Lärm! Einer unserer Maulesel hat sich losgemacht und spaziert einen Abhang hinauf. Sein Betragen demoralisierte einen der Kameraden, und ich mußte sie mit großer Mühe wiedereinfangen; während einer halben Stunde hatte ich wenigstens Beschäftigung.
Nach einigen Stunden Schlaf zogen wir am 31. Juli über hügeliges Land nach Südosten. Als ich in meinen Sattel stieg, klatschte es, und nach ein paar neuen Schauern quatschte es auch in meinen Stiefelschäften. Hob ich einen Arm, so klang es ungefähr wie das Ausringen eines Scheuerlappens. Vergebens sehnten wir uns nach der Sonne.
Im Osten zeigt sich ein größerer, gewundener Fluß, aber die Straße, der wir folgen, führt über fünf leichte Pässe. Sie vereinigt sich mit einer anderen, von links kommenden, auf der ganz kürzlich eine Yakherde getrieben worden ist. Nach einer Weile sahen wir auch vor uns in der Ferne eine große Menge schwarzer Punkte, und nachher trat aus dem Halbdunkel eine Schafherde hervor. Am Ufer eines Baches zeigte sich ein Zelt, wohin sich der Lama begab, während wir weiter ritten, Schagdur als Führer voraus und ich, die Tiere antreibend, hinterdrein. Es war eine Karawane von tangutischen Pilgern, die von den Tempeln von Kum-bum, dem Kloster der »zehntausend Bilder« im Westen des Kuku-nor, nach Lhasa zogen. Sie hatten fünfzig Yake, einige Pferde und drei Hunde mit, die von Jollbars und Malenki gehörig zerzaust wurden. Die Pilger verrieten bedenklich viel Interesse an unserer Reise.
Die Schafherde zählte 70 Häupter und wurde von einer alten Frau, die keine Spur von Furcht zeigte, gehütet. Tatsächlich waren wir jetzt so mit Schmutz und Schlamm bespritzt, daß kein Landstreicher sich vor uns mehr zu schämen brauchte. Die Alte verwies uns auf ein in der Nähe liegendes schwarzes Nomadenzelt, in welchem wir die gewünschte Auskunft erhalten würden. Unweit dieses Zeltes lagerten wir.
Kaum war unsere neue Wohnung in Ordnung, so begab sich der Lama nach dem schwarzen Zelte, wo er zwei Frauen und einen jungen Mann fand, – der Herr des Hauses sollte bald nach Hause kommen. Sie entschuldigten sich, daß sie uns des Feiertags wegen Schafe, Milch und Tsamba, das tibetische Nationalgericht, nicht verkaufen könnten, doch wenn wir uns bis morgen gedulden wollten, sollten wir haben, was sie uns geben könnten. Was sie aber armen Mongolen jederzeit geben durften, war ein Sack voll trockenen Yakmistes, mit dem der Lama jetzt angeschleppt kam. Während wir Feuer anzündeten, erschien der Hausherr auf einem Hügel, wo er in angemessener Entfernung stehen blieb und uns in Augenschein nahm. Der Lama ging hin, um ihn zu holen, und ohne Ziererei setzte er sich zu uns auf die nasse Erde ans Feuer.
Dieser unser erster Tibeter mochte etwa 40 Jahre alt sein und hieß Sampo Singi. Sein Gesicht war beinahe schwarz, bartlos und runzelig, das schmutzige, rabenschwarze Haar hing in wirren Strähnen herunter, aus denen das Regenwasser auf den sackartigen Mantel, den er trug, niedertropfte; die Stiefel waren von einst weißem, jetzt aber eher schwarzem Filz, und an seinem Leibgürtel hingen Tabaksbeutel, Pfeife und verschiedene Utensilien, alles von Schmutz starrend. Sampo Singi war, wie fast alle Tibeter, barhäuptig und barfüßig – bis auf die Stiefel. Mit anderen Worten, er trug keine Beinkleider. Es muß sich ohne dieses herrliche Kleidungsstück draußen im Regenwetter recht schön kühl reiten! Unaufhörlich schneuzte er sich mit den Fingern und zwar mit solchem Nachdruck, daß wir glaubten, es gehöre zur Etikette, und anfingen, es ebenso zu machen. Für unsere mongolischen Gefäße zeigte er eine auffallende Neigung, von der wir absichtlich keine Notiz nahmen. Mich beachtete er nicht besonders; ich war ja ebenso schmutzig wie er, seit mir der Regen den letzten Rest von Eleganz gewissenhaft abgewaschen hatte. Schagdur und der Lama pflegten zu schnupfen, und Sampo Singi nahm sich auch eine gründliche Prise, die ein verzweifeltes Niesen hervorrief. Als wir ihn auslachten, genierte ihn dies durchaus nicht, er fragte nur ganz unschuldig, ob wir Pfeffer in unserem Schnupftabak hätten.
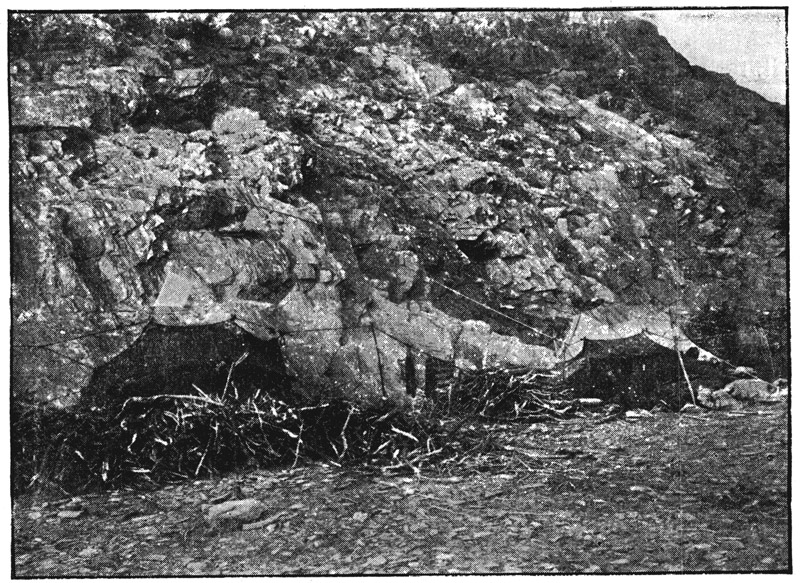
Zelte tibetischer Nomaden.
Plötzlich brüllte mich Schagdur wie ein echter Kosakenhetman an: »Geh und treibe die Pferde ein, Bengel, was hast du hier zu gaffen!« Wie ein Pfeil eilte ich die Böschungen hinauf und sah zu meiner Freude Sampo Singi nach seinem Zelte zurückstiefeln, sonst hätte er kaum umhin können, die Bemerkung zu machen: »Der da hat noch nie in seinem Leben Maulesel eingetrieben.«
Diese Nacht fühlten wir uns bedeutend sicherer als sonst. Seit dem unerwarteten Zusammentreffen mit den Yakjägern waren wir keinen Eingeborenen mehr begegnet, hatten sie aber bösen Geistern gleich um uns herum spuken gefühlt und waren eine Nacht sogar überrumpelt worden. Jetzt hatte uns Sampo Singi versichert, daß es in dieser Gegend keine Räuber gebe, aber für alle Fälle wurde der Wachtdienst wie gewöhnlich verrichtet.
Als ich am 1. August geweckt wurde, regnete es merkwürdigerweise nicht. Unsere Nachbarn, zwei Männer und eine Frau, näherten sich gerade dem Zelte, und schnell wurden die Kleinigkeiten, die möglicherweise einen geheimnisvollen Fremdling hätten verraten können, beiseite gebracht. Sampo Singi führte wieder das Wort und stellte seine Delikatessen der Reihe nach neben unser Feuer. Ah, welch schöne Sachen, jetzt würden wir leben wie die Fürsten! Ein großer glänzender Fettklumpen, ein Napf mit saurer Milch, eine Holzschale mit Käsepulver, eine Kanne Milch, ein »Klumpen« Sahne und ein prachtvolles Schaf – konnten wir uns ein lukullischeres Frühstück wünschen! Das Käsepulver ist ein Bestandteil der Tsamba die im übrigen aus Mehl, Tee, Fett- oder Butterstückchen und manchmal auch einigen Streifen rohen, gedörrten Fleisches besteht. Alles dieses wird in einer Schale gut durcheinandergerührt, in der die schmutzbepanzerten Finger ihre Runde machen. Die saure Milch war das Allerbeste, dick, weiß und säuerlich. Ich bin kein Kostverächter, aber nie hat mir etwas so gut geschmeckt wie diese »Scho«, wie die Tibeter sie nennen; Austern und Champagner sind mit dieser »Scho« verglichen einfach Humbug.
Jetzt sollten die Eßwaren bezahlt werden, und wir zogen einige chinesische Silbermünzen hervor. Sampo Singi war es sichtlich ein Genuß, das kostbare Metall in seiner Hand zu wägen, aber er sagte, er könne nur Geld aus Lhasa annehmen. Solches hatten wir natürlich nicht, zum Glück aber lagen in einer unserer Kisten ein paar Pakete blauer chinesischer Seidenstoffe. Ihr hättet sehen sollen, wie Frau Singis Augen vor freudiger Begierde funkelten. Sie strich mit ihren schwarzen Tatzen über das rauschende Zeug, als wollte sie sich ein Ballkleid daraus schneidern. Im Handumdrehen war der Kauf abgeschlossen.
Außerdem sollte Sampo Singi für die erwiesene Gastfreundschaft das Schaffell behalten. Er machte sich deshalb schnell und flink an das Schlachten, wenn man die barbarische Art, auf die er das Schaf umbrachte, so nennen darf. Drei Beine des Tieres wurden zusammengebunden, um das Maul schnürte er einen Riemen und dann stellte er sich auf die wagerecht auf die Erde gedrückten Hörner, so daß das Schaf wie in einem Schraubstock lag. Darauf steckte er Daumen und Zeigefinger in die Nasenlöcher des gefangenen Tieres, um es durch Ersticken zu töten. Das unglückliche Tier zappelte und strampelte, um sich zu befreien, die Augen traten aus ihren Höhlen, und der Mörder plapperte mit verzweifelter Geschwindigkeit: »Om mani padme hum.« Endlich wurde das Schaf still, und seine Beine fielen schlaff herunter. Sampo Singi richtete sich auf und zerlegte es. Es war peinlich, dieser Szene zuzusehen, aber ich verzog keine Miene, denn Einschreiten wäre Selbstverrat gewesen.
Schließlich frühstückten wir zusammen, und die Hunde wurden nicht vergessen.
Die Frau war ebenso gekleidet wie die Männer; ihr schwarzes, strähniges Haar war in zwei Zöpfe geflochten, außer den Rattenschwänzen und Zotteln, die nach allen Himmelsrichtungen zeigten. Sie trug Filzstiefel mit einfacher Buntstickerei, die seinerzeit recht hübsch gewesen sein mußte. Wie sie es jedoch fertig gebracht hatte, sich das Gesicht so mit Schmutz zu überkrusten, war mir ein Rätsel. Meine feine Haut, die gebührend einzuschmutzen ich vergebens versuchte, wurde vom Regen immer wieder »rein« gewaschen und mußte zweimal täglich geschminkt werden, aber diese tibetische Primadonna wäre nicht sauber geworden, und wenn man ihr Gesicht mit einer Feuerspritze bearbeitet hätte.
Der ehrliche Sampo Singi machte keine Miene, uns noch zum Bleiben zu überreden, sondern wollte uns im Gegenteil möglichst schnell loswerden. Vielleicht hatte er recht! Genug, er war verschwunden, als wir unsern Rückzug über seine Weideplätze antraten. Vielleicht hätte er für seine eigene Gastfreiheit und die ungeheure Aufregung, die unser Einzug in das eigentliche Tibet hervorrief, büßen müssen. Hätte er gewünscht, uns noch einen Tag zu behalten, so würde er uns vor dem Tagemarsche, den wir vor uns hatten, gewiß ernstlich gewarnt haben; statt dessen wünschte er uns eine glückliche Reise und teilte uns mit, daß wir in zwei Tagen an das nächste Nomadenlager gelangen würden.
Im Platzregen ritten wir das Tal des Flusses Gartschu-sängi hinunter. Von einem letzten kleinen Passe aus scheint sich die Landschaft zu erweitern. Berge zeichnen sich nicht vor uns ab, aber man kann vor dem Regen, der den Boden bespült, auch nicht weit sehen. Unsere Sättel lockern sich in der Nässe, unsere Kleider glänzen von Wasser und kleben am Leibe fest, die Mähnen der Pferde triefen. Der Weg führt zwischen verlassenen Lagerplätzen hindurch nach dem rechten Ufer eines mächtigen Flusses, den wir anfangs für einen See hielten, hinunter. Es war der Satschu-sangpo, einer der größten Flüsse Tibets. Das laute Aufschlagen der Regentropfen auf der Wasserfläche wurde bald übertönt von einem dumpfen, kochenden Getöse, wie von heranwälzenden Wassermassen.
Der Fluß teilte sich in 20 Arme, von denen vier kolossal waren. Diese zu durchwaten, erschien mir fast unmöglich. Der Lama, der ein mutiger Kerl war und stets voranritt, setzte jedoch seinen Weg so ruhig fort, als habe er den graubraunen, rauschenden Strom gar nicht gesehen; wir ritten hinterdrein. Ich erwartete jeden Augenblick, ihn in den Wellen verschwinden zu sehen. Von der Tiefe kann man sich bei so schlammigem Wasser natürlich vorher keinen Begriff machen; sie überstieg jedoch ein paarmal einen Meter.
Wir haben uns jetzt durch zehn Arme hindurchgearbeitet und rasten auf einer Schlammbank, wo die Tiefe nur einen Fuß beträgt. Dort stehen wir in der rauschenden Wassermasse, die ungezügelt auf uns los und an uns vorüberbraust; es schwindelt einem vor den Augen, das Wasser scheint still zu stehen, und wir scheinen mit ungeheurer Schnelligkeit flußaufwärts zu stürmen. Von den Ufern sieht man keine Spur, lauter Wasser, wohin man blickt, der Fluß ist nach dem Regen zu kolossalen Dimensionen angeschwollen.
Ohne ein Wort zu sagen, stemmt der Lama seinem Maulesel die Fersen in die Seiten und reitet wieder in die Tiefe hinein. Das Wasser geht dem Maulesel bereits bis an die Schwanzwurzel, und der Reiter zieht die Knie in die Höhe, um wenigstens die Stiefelschäfte über Wasser zu halten. In demselben Augenblick macht der Maulesel, den er führt und der unsere mit Leder überzogenen Kisten trägt, einige bedenkliche Seitensprünge; die Kisten wirken wie Korkkissen, das Tier verliert den Boden unter den Füßen, macht eine halbe Drehung und wird wie der Wind flußabwärts getragen. Es ist verloren! Doch nein, ist es möglich? Es faßt wieder festen Fuß, kommt wieder ins Gleichgewicht und klettert an das Ufer, ohne die Kiste verloren zu haben.
In demselben Augenblick, als der Maulesel von der Strömung ergriffen wurde, schrien wir dem Lama verzweifelt zu, umzukehren. Er hörte aber keinen Ton, das Wasser kochte um ihn herum, und er kroch nur ganz ruhig höher auf den Sattel hinauf, der jetzt ganz und gar unter Wasser war. Ist er denn verrückt, er kann ja nicht schwimmen? In einer Sekunde werfe ich meinen Gürtel ab und schicke mich an, den Pelz zu opfern. Aber siehe da, der Lama zieht sich aus der Affäre; immer mehr wird von dem Rücken des Maulesels sichtbar, und schließlich ist der kleine Priester außer Gefahr.
Der letzte Arm war der schlimmste; seine Breite betrug nur 30 Meter, aber er war tief, schäumend und reißend. Ich war zurückgeblieben, sah die anderen schon am Ufer und lenkte das Pferd gerade nach der Stelle, wo sie Halt gemacht hatten. Es ist ungemütlich, wenn es immer tiefer wird. Ich fühle das Wasser an meinen Stiefelschäften hinaufsteigen; »gluck, gluck« macht es, als die Stiefel sich füllen; jetzt steigt es mir über die Knie, über den Sattel, nur Kopf und Hals des Pferdes sind noch sichtbar. Der Lama und Schagdur schlagen sich auf die Knie, brüllen mir etwas zu und zeigen dahin, wo die Furtschwelle liegt; aber man hört ja nichts weiter als das Getöse der kochenden Wassermassen. So, jetzt ist es Zeit, das Pferd loszulassen! Im Nu befreie ich mich aus den Steigbügeln und werfe den Pelz ab, aber gerade, wie ich abstoßen will, verliert das Pferd den Boden unter den Füßen, beginnt zu schwimmen und treibt dicht am Ufer schnell flußabwärts. Unwillkürlich packe ich seine Mähne und treibe mit, nach zwei Sekunden hat es wieder Grund unter den Füßen und erklettert mit verzweifelter Anstrengung das Ufer.
Satschu-sangpo, jetzt hatten wir dich besiegt! Ich war so naß wie eine ersäufte Katze, aber was machte das, wir waren ja schon vorher pudelnaß vom Regen. Mir zitterten noch eine Weile die Knie, denn eine solche Lage ist unbehaglich, auch wenn man ein noch so guter Schwimmer ist. Meine Stiefel waren rühmenswert wasserdicht. Nachdem wir weiter geritten waren, fiel mir ein, daß es eigentlich unnötig sei, ihren Inhalt mitzuschleppen, ich goß das Wasser also aus, band die Stiefel hinten an den Sattel und ritt barfuß.
Unser Lager trug an diesem Abend ein tragikomisches Aussehen. Kein trockener Faden an der Karawane, mehrere Sachen verdorben, alle Kisten, Kleider und Tiere trieften von Wasser. Nach vielen energischen, aber vergeblichen Versuchen gelang es uns, ein Feuer anzuzünden, das aber qualmte und zischte. Hier entkleidete ich mich vom Kopf bis zu den Zehen, rang meine Lumpen aus und verbrachte den Abend damit, sie notdürftig zu trocknen, – daß sie ganz trockneten, konnte man nicht verlangen, da es noch immer lustig regnete.
Erbarmungslos und grausam senkte sich die Nacht auf die Erde herab, und der Mond warf auch nicht den allerflüchtigsten Blick auf Tibets regenfeuchte Gebirge. Frostig und düster, windig und finster ist es um uns her, unaufhörlich peitscht der Regen die Erde, das Zelttuch flattert, als spielte der Wind mit einem Segel, und bald klingt es wie schleichende Schritte, bald wie in der Nacht heransprengende Reiter. Von zwei Seiten her ertönen Rufe. Sind es die Pilger von Kum-bum? Nein, sie können nicht so hirnverbrannt sein, dem Satschu-sangpo mit ihren Yaken Trotz zu bieten. Man wird beim Nachtwachen nervös und reagiert auf jedes Geräusch. Unsere Wanderung ist kein Geheimnis mehr, wir sind bereits mit den ersten Tibetern zusammengetroffen. Unter wechselnden Zufällen geht unser Weg ungewissen Geschicken entgegen, immer tiefer in dieses geheimnisvolle Land hinein. Ich war der Meinung, daß wir nun, da wir zwei harte Prüfungen, den Räuberanfall und den Satschu-sangpo, glänzend bestanden hatten, auch Lhasa sehen müßten. Es war wie in einem Märchen, in dem der Held durch Feuer und Wasser gehen muß, um seine Braut aus den Krallen des Drachen zu befreien. Aber erschöpft waren wir; ich sehnte mich beinahe danach, festgenommen zu werden, um mich ausschlafen zu können. Meine beiden Kameraden waren Idealmenschen; Muttersöhnchen taugen nicht für solche Abenteuer.
Punkt zwölf rüttle ich Schagdur unbarmherzig wach; er untersucht seine Flinte und kriecht hinaus, und ich werfe mich, ohne mich zu besinnen, in unserem jämmerlichen Neste auf die Erde. Er ist zu schlaftrunken, ich zu schläfrig, um zu reden; ohne ein Wort zu wechseln, tauschen wir nur die Plätze.