
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Aus dem Böhmerwald. – 2. Das Fichtelgebirge. – 3. Eine Sommerfahrt in das Erzgebirge. – 4. Ein Landschaftsbild von der Sächsischen Schweiz. – 5. Grundzüge der Lausitzer Landschaft. – 6. Die Wenden der Oberlausitz. – 7. Das Riesengebirge.
Von Dr. Ferdinand Hochstetter.
Von den Grenzen des Vogtlandes bis nach Oberösterreich hinab, von Nordwest gegen Südost zwischen Böhmen und Bayern die natürliche Grenze bildend, zieht sich an die 230 km lang das dunkle Waldgebirge, von den Alten als Gabreta silva zu den Silvae Hercyniae (Harzwald) gerechnet, von den Böhmen Ceskyles und Sumava genannt, ein Teil der großen Wasserscheide zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. Vom Fichtelgebirge aus gegen Südost steigt der Gebirgswall höher und höher an, im Arber und Rachel bis zu 1460 m, breitet sich da, wo die Quellen der Moldau zusammenfließen, in seinem eigentlichen Zentrum, mehr und mehr aus, und bildet mächtige Gebirgsstöcke an deren rechtem und linkem Ufer, die weit ins Land hinein nach Böhmen und Bayern in unzähligen Berg- und Hügelketten ihre Ausläufer senden. Vom Kubany (1357 m) und Blöckenstein (1380 m) fällt das Gebirge wieder allmählich ab und verläuft bei Friedberg und Hohenfurth, da, wo die Moldau nach langem und trägem Laufe durch weite Torfmoore nun schäumend die Granitmassen der Teufelsmauer durchbricht und ihre südöstliche Richtung plötzlich zu einer nördlichen verändert, in einzelnen Berggruppen mit dem Manhartsberge in Österreich einerseits und mit dem böhmisch-mährischen Grenzgebirge andererseits. Eine tiefe und breite Einbuchtung zwischen Neumark und Eschelkamm, auf der die Wasserscheide bis 400 m herabsinkt, trennt die nördliche Hälfte des Waldgebirges von der viel ausgedehnteren südlichen. Der nördliche Gebirgszug, der sich kaum bis zu 1000 m (Tscherkow 1040 m) erhebt, liegt den böhmischen Bädern Marienbad und Franzensbad nahe, und gewiß hat schon mancher Naturfreund und Besucher dieser Kurorte seine Ausflüge ausgedehnt bis auf den granatreichen Dillenberg, die letzte Kuppe des Böhmerwaldes gegen das Fichtelgebirge, oder bis zur romantischen Burgruine Pfraumberg (böhmisch Primda) bei Hayd, dagegen sich begnügen müssen, das südliche Hauptgebirge mit seinen gewaltigen Hochgipfeln nur in blauer Ferne von der Basaltkuppe des Podhorn bei Marienbad aus zu erblicken. Aber gerade dieser Teil ist der landschaftlich schönste und für den Naturfreund anziehendste. Hier ist noch bis in unsere Tage ein Stück von dem Deutschland erhalten, wie es Tacitus schildert, als ein Land »silvis horrida aut paludibus foeda«. Alles ist Wald und Moor und Feld, kaum da und dort eine armselige Holzhackerkolonie oder ein einzeln stehendes Forsthaus.
a) Der Urwald.
Wer denkt bei dem Worte »Urwald« nicht weit über den Atlantischen Ozean hinweg an die Üppigkeit und Fülle tropischer Himmelsstriche in Südamerika, an die Wildnisse des Orinoko, an v. Humboldts und Burmeisters herrliche Schilderungen! Unser Urwald ist im rauheren Norden düsterer Fichten- und Tannenwald:
Es ist, als wäre diese Gegend früh
Zurückgeblieben hinterm Schritt der Zeit,
Die weiten, stillen Wälder, wo der Mensch,
Des Schöpfers letztes Werk, noch fehlt.
Uhland.
Als sich im Jahre 1849 der böhmische Forstverein versammelt hatte, um Ausflüge zu machen in diese Urwälder, da redete der wackere Forstmeister J… von Winterberg die Forstmänner Böhmens also an: »Meine Herren, Sie betreten im lieben Vaterlande eine Gegend, über deren Berg und Tal massenhafte Forste sich ausbreiten, unberührt von des Menschen Hand, Urbildungen der Schöpfung, wildschön, großartig, staunenerregend, ehrfurchtgebietend, worin die Natur seit Jahrhunderten ungestört waltend die riesenhaftesten Holzkörper bildet und wieder zerstört, dort dieser, hier jener Holzart besonderen Standort anweist, dort wieder mehrere Spezies harmonisch zusammenstellt, immer und überall aber die individuell schwindende Generation durch frisches, auf modernden Leichen keimendes Leben ersetzt. Es sind dies Urwälder, wie wir sie nennen, ein aufgeschlagenes Buch der Natur, lehrreich für jedermann!« Damals hat vielleicht mancher Forstmann am Kubany, bei Tusset, am Blöckenstein, zum ersten Male gesehen, was ein Wald ist, was dagegen – eine Baumpflanzung, ein Forst.
Mir ward der erste große Eindruck einer Böhmerwaldlandschaft, mit ihren riesigen Urwaldstämmen, als ich im Jahre 1853, am südlichsten Teile des Gebirges meine Untersuchungen beginnend, an einem schönen Maiabend in Begleitung eines Jägers von Unter-Wuldau aus zur Schloßruine Wittinghausen hinaufstieg, zu jenem »luftblauen Würfel über dunklem Waldesrücken«, dem klassischen Punkte aus Adalbert Stifters »Hochwald«. Der Weg führt von Unter-Wulda aus zuerst über weite Moorgründe, durch welche die Moldau in unzähligen Krümmungen und Biegungen trägen Laufs sich schlängelt. Man muß fein Obacht geben, daß man nicht zu weit hinaustritt über den betretenen Pfad und versinkt in den »zerrissenen Gründen, aus nichts bestehend, als aus tiefschwarzer Erde, dem dunkeln Totenbette tausendjähriger Vegetation«. Rechts die Waldmassen des Hochfichtel, Blöckensteins, Dreisesselberges, links das St. Thomasgebirge mit der Schloßruine Wittinghausen, dazwischen der Paß, der von Böhmen nach Österreich führt, über den hinweg der merkwürdige Fürstlich Schwarzenbergsche Schwemmkanal die Moldau mit der Donau verbindet. Bald ist man im Walde. Nie genoß ich einen Waldspaziergang so voll. Es war die Ruhe der Luft nach einem Gewitter, alle Bäume dufteten, ein Wohlgeruch überall, eine Stille von allem menschlichen Treiben und Wesen, nur das Rauschen frischer Waldwasser hörte man, oder den eintönigen Notschrei des Rehbocks oder die schrillen Töne einer vorüberstreichenden Waldschnepfe. Wir waren im »Brandl-Wald«, einem Hochwald von Fichten und Tannen mit dunklem Schwarzgrün, untermischt mit dem jungen Frischgrün der Buchen und des Ahorn. Aber wie erstaunte ich, als mein biederer Jägersmann mich vor den Riesenstumpf einer Weißtanne führte und mir den Stamm zeigte, wie er dalag; dabei nahm er andächtig seinen Hut ab. Ja, den Hut ab! Hier stand ein Baum, mit seinen Ästen und Zweigen ein ganzer Wald im Walde, mit seiner Krone ein Wald über dem Walde! Der Sturmwind hatte den 500jährigen Riesen abgerissen und hingeworfen. Schwärzer haben den hohlen Stumpf angezündet, aber jetzt noch starren die schwarzen, verkohlten Reste ehrfurchtgebietend in die Höhe. Ich maß den Durchmesser in Brusthöhe zu 3 m, den Umfang zu 9½ m. Dann erkletterte ich den daliegenden Stamm, ging darüber hin und zählte 72 Schritte. Aber die Krone, die schon früher vom Winde abgerissen worden sein mag, fehlte noch. Rechnet man diese und den stehenden Stumpf dazu, und fünf meiner Schritte zu 4¼ m, so bekommt man eine Gesamthöhe von 61 m, fast die halbe Höhe des Stephansturmes in Wien! Rings um den toten Baumriesen standen nun aber noch eine Menge ebenbürtiger Schwestern in frischem Grün, und des andern Tages maß ich unweit davon im »Schloßwald« einen Umfang in Brusthöhe von ungefähr 7 m, und der begleitende Förster gab mir die gemessene Höhe des noch stehenden Stammes zu 53 m an. Und dazu die Krone, die abgerissen war an der Stelle, wo der Stamm noch 38 cm Durchmesser hat. Der Urwald ist hier der Kultur schon gewichen, um so mehr fallen aber die riesenhaften Ausdehnungen der uralten Stämme, den gewöhnlichen Hochwaldstämmen gegenüber, in die Augen. Die größten bleiben hier stehen, um der kleineren Nachwelt zu zeigen, wie groß die Vorwelt war.
Von der Schloßruine Wittinghausen hat man bei hellem Wetter die großartigste Fernsicht ins Land jenseit der Donau bis zu den Norischen Alpen. Mir hatte der Himmel nur vergönnt, in die Nähe zu schauen, auf das Waldgebirge, das vor mir lag, ein schwermütig düsterer Anblick; denn zerrissen und phantastisch wie Feengestalten schwebten weiße Nebelwolken an den dunkeln Wäldern, und dazwischen wie ein Silberfaden die spiegelnden Wasser der Moldau. Auf ihrem rechten Ufer am Blöckenstein, Dreisesselberg, Tussetberg, den Schillerbergen hin die Waldreviere Salnau, Neuthal, Tusset; auf ihrem linken Ufer die Reviere Schwarzwald, Christianberg, Müllerschlag, Schattawa usw. mit dem großen Steinberg, den schwarzen Steinwänden in Langenberg, dem Kubany, Schreiner, Basum, und weit dahinter die Gegend von Außergefild, Buchwald, Maader, Pürstling, Stubenbach, die waldbedeckten Hochplateaus, über die sich der Lusen und Rachel erheben. Alle diese Gegenden enthalten noch Urwaldstrecken, und keineswegs bloß auf den unzugänglichsten hohen Gipfeln und Gebirgsrücken, sondern bis weit hinab in die Talgründe.
Aber ich muß das, was ich auf den langen Wanderungen gesehen, in ein Bild zusammenfassen. Die Urwälder sind einander hier überall ziemlich gleich: wilder an den Gehängen der Berge, wenn zu dem Gewirr der Vegetation noch das Gewirr der Felsmassen sich gesellt und die Waldbäche schäumend über Baum- und Felstrümmer hinwegstürzen; üppiger in Talgründen und auf niedrigeren Hochflächen, am üppigsten zwischen 600 und 1000 m Meereshöhe, wo neben der Fichte auch die Tanne und Buche noch gedeihen, daher auch im südlichsten, weniger hohen Teil des Gebirges schöner als im eigentlichen Mittelpunkt bei Außergefild, Maader, Stubenbach, wo auf den Hochplateaus von 1200 m nur noch die Fichte übrig bleibt, bis auf den Hochgipfeln auch sie verschwindet und nur krüppeliges Holz, Kniekiefern und isländisches Moos die nackten Felsmassen kümmerlich bekleiden.
Schon aus einiger Entfernung kann man den Urwald an seinen zackigen unregelmäßigen Umrissen leicht von dem wie nach der Schnur gleichmäßig abgeschnittenen kultivierten Hochwald unterscheiden. Besonders ragt die höhere Tanne mit ihrer kuppelförmigen Krone und ihren wagerecht abstehenden Ästen weit über die niedrigeren pyramidenförmigen Wipfel der Fichte hervor, wie ein Wald über dem Walde. Noch charakteristischer erscheint bei einem Blick von oben her der Wipfeldürre, weniger dicht bestockte Urwald als altersgrauer Greis neben dem frischen Grün des festgeschlossenen jungen Hochwaldes. Aber treten wir nun ein in die Wälder selbst!
Wir steigen durch Wiese und Feld einen Abhang hinan. Steine und Felsstücke sind aus beiden zu großen Haufen zusammengelesen, oder zu Mauern am Wege hin übereinander geschichtet. Zur Linken am Saume des Waldes noch ein mit verkohlten, zerstreuten Wurzelstöcken bestandenes Ackerland, zur Rechten ein frischer Holzschlag – das Holz aufgeklaftert, nur einzelne Stämme ragen noch hoch in die Luft; Äste und Zweige haben die Holzhauer zu großen Haufen zusammengeworfen, aus denen dicker Rauch aufwirbelt. Ein wenig betretener »Paschersteig« führt in den Wald, man muß vorsichtig vorwärts schreiten, will man nicht über die durch die Feuchtigkeit geglätteten Wurzeln abglitschen oder tief einsinken im moorig schwammigen Boden. Endlich ist man eingetreten in den Wald und schöpft tief Atem in der erquickend kühlen Luft, wenn draußen die Sonne brannte. Wie man aus dem bunten Treiben in Stadt und Land eintritt in die stillen, ernsten Hallen eines gotischen Doms – nicht anders ist der Eindruck. Da strebt alles ernst und majestätisch in die Höhe; wie die Säulen des Doms, stehen die Säulen des Waldes da, schlank, riesengroß, schweigend, das Auge folgt dem mächtigen Stamme von unten nach oben, die gewaltigen Äste verschlingen sich zu einem dichten, dunkelgrünen Gewölbe, durch das, wie die goldenen Sterne des Gewölbegrundes, das Licht des Himmels in das Halbdunkel hineinstrahlt. Wer fühlte nicht die ganze Romantik eines Waldlebens mit seinem Frieden und seinen Schauern, die ganze Pracht und Feier einer jungfräulichen Wildnis, wenn er längs des Kanals am Blöckenstein oder auf dem »Fürstenweg« am langen Berg bei Ernstbrunn, oder auf dem Reitsteig durch den Tussetwald, oder am Kubany, am Schreiner, am Basum mitten durch die schönsten Urwaldstrecken seinen Weg nimmt, und ihm am heiteren Frühlingsmorgen das Schwarzblatt, die Amsel und unzählige Vögel ihr Lied singen, oder wenn in tiefster Waldesstille die Seele dem stillen Walten der Natur doppelt nahe zu sein glaubt!
Oft ist aber der Eindruck ein ganz anderer. Sturm, Wetter und die Jahrhunderte haben nur Bilder der Zerstörung und Verwirrung übrig gelassen. Die Stämme stehen »schütter«, einzeln und einzeln, dazwischen dichtes Gestrüpp von Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Weidenröschen, ein Gewirr von Felsblöcken, modernden Zweigen, Ästen, Stämmen, Stöcken. Hier steht ein Riesenstamm noch grün, aber der Sturmwind hat ihm die Krone abgerissen, und von den Ästen hängt, wie greises Haar, das Bartmoos in klafterlangen Fäden, die der Wind hin und her wiegt; hier steht ein Stamm längst abgestorben, morsch und faul, ausgedörrt, daß er angezündet wie glühender« Zunder fortglimmt, eine graue, gespenstige Gestalt, die ihre nackten Knochenarme in die Luft reckt. Hier liegt eine Fichte mit der Wurzel ausgerissen, in deren Netzwerk Erdklumpen und Felsstücke hängen, der mächtige Wurzelstock wie eine Mauerruine, und daneben eine breite Grube, dort liegt eine Tanne am Stamm abgerissen; sie vermodert und verfault und auf dem Leichnam keimt üppig junges Leben, eine neue Tannen- und Fichtensaat; und zwischen all dem Gewirr rundliche, von weißen Flechten überzogene Granitblöcke, wie gebleichte Riesenschädel, üppiges Strauchwerk, Farnkraut und Moos, Tod und Stein mit frischem Grün, mit saftigem Leben überwuchernd. Ist man in solchen Wirrwarr einmal hineingeraten, so hat man Mühe und Not, wieder herauszukommen. Die morschen Stämme fallen dumpf krachend unter dem Tritt zusammen, weiche Mooshügel überdecken trügerisch lockeres Haufwerk und Felsklüfte, in die man durchbricht. Aber gewiß wird jeder die großen Eindrücke gern sich zurückrufen, die er empfand, wenn er in solcher Wildnis mühsam emporkletternd über Felstrümmern und Baumleichen, durch fest verwachsenes Gestrüpp langsam vordringend, endlich hervortrat auf die letzte hohe Felsplatte und nun von der Kuppe eines Sternberges, Tussetberges, eines Kubany, Antigels hinwegsah über die ungeheuren, düsteren, schwarzen Waldmassen, aus denen nur da und dort ein blauer Rauch aufsteigt, das Zeichen des Holzhauers, der mit Feuer und Eisen sich Bahn bricht in die uralten Wälder.
Wie aber auch das Bild des Urwaldes sein mag, immer ist es gleich interessant und gibt Gelegenheit zu mancherlei Beobachtungen. Die Humusschicht ist gewöhnlich so mächtig, daß der Same den eigentlichen Boden zum Keimen gar nicht findet. Um so üppiger wächst aber die junge Saat auf den faulenden Wurzelstöcken und den liegenden modernden Stämmen. Es ist ein eigener Anblick, wenn man eine solche Leiche daliegen sieht, und auf ihr der ganzen Länge nach Tausende von jungen Tannen und Fichten im frischesten Grün. Daher auch die merkwürdige Erscheinung, daß die Stämme im Urwald auf 150-200 m hin oft in einer geraden Linie hintereinander stehen, wie aus einer Reihensaat aufgewachsen. Der lange Stamm, auf dem die jungen Pflanzen aufgewachsen, ist längst vermodert, aber die Richtung, in der nun die groß gewordenen Stämme stehen, zeigt noch seine alte Lage. Höchst interessant sind in dieser Beziehung die Aufnahmen, die Forstmeister J. zu Winterberg von größeren Urwaldstrecken machen ließ, auf denen jeder einzelne, liegende und stehende Stamm verzeichnet ist, auf denen daher jene Reihen besonders charakteristisch in die Augen treten. Aus demselben Keimen auf Stöcken oder Stämmen erklärt sich auch die häufige Erscheinung, daß die Stämme auf Stelzen stehen, pandanusartig. Der Baum erreicht mit seinem unteren Stammende den Boden gar nicht, er steht schwebend auf einem Unterbau säulenartiger Wurzeln.
Der König der Urwaldbäume ist die Tanne (Weißtanne). Sie erreicht die riesigsten Maße und ist im Böhmerwald den Urwäldern fast eigentümlich, bildet hier die üppigsten Bestände, während es der Kultur kaum gelingt, sie zu erhalten. Die aufgeforsteten Wälder im Böhmerwald sind daher fast ausschließlich Fichtenwälder. Wenn auch Exemplare, wie die oben beschriebenen im Alter von 400 bis 500 Jahren, von 60 m Höhe und mit 40 cbm Holz bloß im Schaftholz heute große Seltenheiten sind, so trifft man dagegen ganze Bestände von 300-400 Jahren mit 20-40 m hohen Stämmen. Der zweite Hauptbaum ist die Fichte. Sie erreicht zwar nie die Größe der Tanne, kommt aber mit der Tanne in gleichem Alter vor (im Maximum 300-500 Jahre, einzelne Bäume bis 700 Jahre alt) und bildet mit ihr gemischte Bestände. Die Fichtenstämme werden durchschnittlich zu 7-12 cbm geschätzt, erreichen aber in einzelnen Fällen eine Größe von 23 cbm. Der dritte Hauptbaum ist die Buche, im allgemeinen jünger als die Nadelhölzer, meist von 100-250 Jahren; sie bildet häufig das Unterholz, oder ist auch nur einzeln eingesprengt. Ganze Bestände von älteren Bäumen sind in bedeutenderen Ausdehnungen selten.
Die größte Beachtung verdient aber die übereinstimmende Ansicht vieler erfahrener Forstleute im Böhmerwald, daß in langen Perioden von 400-500 Jahren der Nadelholzbestand in den Urwäldern mit Buchenbestand wechselt. Die Ansicht gründet sich auf das verschiedene Wachstumsverhältnis von Laub- und Nadelholz und auf den gegenwärtigen Bestand der Urwälder. Nimmt man für einen ursprünglichen Zustand, für eine erste Periode ein gleichmäßiges Vorhandensein von Buchen und Nadelhölzern an, die ihren Samen ausstreuen, so muß das schneller wüchsige Nadelholz die jungen Buchen überholen. Diese werden unter dem Nadelholzbestande der zweiten Periode ein gedrücktes Unterholz bilden, das erst frei wird in einer dritten Periode, wenn das Geschlecht des Nadelholzes abgestorben. Unter diesen Buchen keimt aber für eine vierte Periode schon wieder eine frische Saat von Nadelholz, die das Absterben der Buchen erwarten muß, bis sie zu Licht und Luft kommt. In der Tat spricht dafür der Charakter vieler Urwaldstrecken, wo die Buche mit den Nadelhölzern nicht in gleichem Alter vorkommt, sondern das jüngere Unterholz bildet, das die alten Tannen und Fichten, schon jetzt großenteils im Absterben begriffen, überleben muß, und dann frei geworden einen geschlossenen Bestand bilden wird. Unter ihm harrt dann die jüngste Nadelholzgeneration, die jetzt schon unter den Buchen keimt, ihrer künftigen Freiwerdung. Freilich aus dem Lagerholz läßt sich für diese Ansicht nichts schließen, da das Buchenholz schon in wenigen Jahren verwest, während das Nadelholz selbst über 100 Jahre sich gesund erhält. Überall in der Natur zeigt sich Wechsel, und warum sollte die Baumwelt nicht auch ihre Dynastien haben, die in ewigem Kampfe miteinander abwechselnd herrschen und beherrscht werden, bis der Herrscher der Erde über sie kommt! Forstmänner mögen dies entscheiden.
Vereinzelt kommen auch vor: Kiefern, verschiedene Arten von Ahorn, die Ulme, Esche, Erle, Schwarzbirke, Salweide und als Seltenheit der Taxusbaum und die Roteibe, nirgends aber im ganzen Gebirge die Eiche. Dem Botaniker geben die Urwälder wohl eine mannigfaltige Ausbeute an Sporenpflanzen, Moosen, Flechten und Farnkräutern, um so weniger aber an Blütenpflanzen. Die Waldwiesen dagegen sind im Juli und August ganz gelb von Arnica montana, der Waldsaum von Impatiens noli me tangere, und auf den Hochgipfeln wird man durch manches schöne Pflänzchen überrascht, das an die Alpen erinnert, wie Soldanella montana, Phyteuma nigrum, Sonchus alpinus, Homogyne alpina, Pyrola uniflora.
b) Das Holz und seine Verwendung.
Auf Glashütten wohl zuerst fanden die massenhaften Holzschätze des Böhmerwaldes Verwendung und Verwertung. Nomadisierend zog man von Revier zu Revier. War rings um den ersten Ansiedelungspunkt der Wald aufgezehrt, so wurde die Hütte wieder an einem neuen Punkte mitten im Walde aufgebaut. Durch die Glasfabrikation wurde daher auch das Gebirge zuerst kolonisiert; denn in die verlassenen Gebäude zog nun der Gebirgsbauer ein, schuf die vom Walde befreiten Strecken in Wiese und Feld um, hielt sich einen kleinen Viehstand und baute Kartoffeln, Hafer, Gerste und Korn. Daher die vielen im Gebirge zerstreut liegenden »Einschichten« und kleinen Walddörfer, deren Namen auf »hütten« enden: Maierhütten, Tobiashütten, Philippshütten, Alt- und Neuhütten usw. Freilich haben sich die Glashütten in den letzten Jahrzehnten aus den eigentlichen Waldgebieten mehr und mehr in die Kohlenbezirke verzogen, da deren Brennmaterial ebenso gut verwendbar ist und sich wesentlich billiger stellt; so besteht seit etwa 30 Jahren in Neusattel bei Elbogen die große Aktiengründung, vormals Friedrich Siemens, die gegen 3000 Arbeiter beschäftigt. Die bedeutendsten Hütten im südlichen Teile des Böhmerwaldes sind derzeit bei Kuschwarda (Eleonorenhain), Hurkenthal und Eisenstein (Elisenthal), während die bei Außergefield und drei oder vier bei Eisenstein gelegene eingegangen sind. Die Eisenindustrie hat bei dem Mangel an Eisenerzen nie geblüht. Im südlichen Teile des Gebirges ist der einzige Hochofen der zu Adolfsthal bei Krumau. In der nördlichen Hälfte des Böhmerwaldes sind dagegen mehrere bei Bischofteinitz, Plan, Tachau usw. Deswegen findet man hier auch mehr Kohlenbrenner, die dem südlichen Teile fast ganz fehlen.
In größerem Maßstabe konnte jedoch der Holzreichtum erst ausgebeutet werden, als durch Anlage von Kanälen, durch Floßbarmachung von Flüssen und Bächen es möglich wurde, die Holzmassen weiter ins Land hinein zu schaffen und teils als Bauholz, teils als Brennholz in holzärmeren Gegenden zu verkaufen, teils in Holzschleifereien in Papiermasse zu verwandeln.
Schon im Jahre 1789 wurde durch den Ingenieur Rosenauer ein großartiges Werk begonnen und teilweise ausgeführt: der von mehr als 20 Gebirgsbächen gespeiste Fürstlich Schwarzenbergsche Schwemmkanal am Blöckenstein, um die ausgedehnten Urwälder zu beiden Seiten des oberen Moldautales zur Benützung zu bringen. Im Jahre 1821 wurde das Werk weiter ins Gebirge hinein fortgesetzt. Wie sie jetzt vollendet ist, führt diese merkwürdige Wasserstraße von 1½ m Tiefe und 2 m Breite 52 km weit vom Lichtwasser, am Fuße des Dreisesselberges in einer Seehöhe von 920 m beginnend, in unzähligen Windungen am ersten Drittel der Berghöhe hin über den Paß bei Aigen hinaus nach Oberösterreich zur großen Mühl, einem direkten Nebenfluß der Donau. Beim Forsthaus zu Hirschhergen geht der Kanal unterirdisch in einem 414 m langen Tunnel durch Granit. Schöne Portale zieren den Ein- und Ausgang. Wenn im Frühjahr Holz geschwemmt wird, ist es ein interessanter Anblick, wie die Holzmassen, sobald sie aus dem »unterirdischen Kanal« hervorkommen, wirbelnd übereinander stürzen auf einer 305 m langen Riefe, mit 26 m Gefäll hinabschießen unter donnerähnlichem Getöse, das weithin durch die Wälder hallt. Mehr als 20 größere und kleinere Bäche, die der Moldau zufließen, werden um diese Zeit aus dem Flußgebiet der Moldau in das der Donau abgeleitet. Die Moldau selbst jedoch ist nicht unmittelbar mit dem Kanale in Verbindung. Ihr Niveau liegt 114 m tiefer. Was auf der Moldau aus dem oberen Gebirge, von der Herrschaft Winterberg herabgeflößt wird und nach Österreich gehen soll, muß beim Holzrechen zu Spitzenberg gelandet und auf der Achse eine Stunde weit zum Kanal nach Neuofen geführt werden. Alljährlich werden so aus den Fürstlich Schwarzenbergschen Waldungen 18-20 000 Klafter Brennholz der Donau zugeführt und gehen auf ihr nach Wien. Wohl mehr als die doppelte Menge geht aber auf der Moldau und auf allen ihren flößbaren Zuflüssen, auf der Flanitz, Wollinka, Wotawa usw. ins Land hinein bis nach Prag. Und immer neue Werke werden in Angriff genommen, um auch die unzugänglichsten Waldstrecken zur Benützung zu bringen. Auf der Herrschaft Winterberg und ebenso auf der Herrschaft Stubenbach wurden Straßen gebaut hoch über die Berge weg, durch die Urwälder des Kubany und Basum und durch die sumpfigen Gegenden bei Maader. Auch ein zweiter Schwemmkanal führt bei Maader an der Widra 15 km lang durch die Wälder der Stubenbacher Herrschaft zum Kislingbach. Große Massen schwimmen auf der Moldau, die von Hohenfurt an für Flöße und kleinere Holzschiffe schiffbar ist, zur Elbe, und auf der Elbe nach Hamburg und weiter nach England.
So hört man denn überall im Gebirge, wo sonst Todesstille herrschte, die Axt anschlagen und die ächzenden Töne der Säge. Lustig wirbeln aus den Wäldern die Rauchsäulen auf von den Feuern der Holzhauer, die Äste, Zweige und dürres Holzwerk verbrennen. Sommers wird das Holz geschlagen, Winters auf der Schneebahn den Bächen und Flüssen zugeführt, und im Frühjahre, wenn der Schnee geht, fängt das Schwemmen und Flößen an. Da ist ein Leben und Treiben an den Wassern und auf den Wassern, dem man gern zuschaut. Das Forstpersonal leitet die Schwemme und führt die Aufsicht. Kinder, Weiber und Männer ziehen hinaus, mit Stangen, mit Rechen, mit Gabeln, um oft mit Lebensgefahr die Rinden und Splitter, die sich lostrennen von den Scheiten, herauszufischen.
Und nun, lieber Leser, denkst du wohl auch daran, wenn dir am rauhen Winterabend das Holz lustig im Ofen prasselt und behagliche Wärme zuströmt, daß du vielleicht ein Stück der schönsten Böhmerwaldtanne verbrennst, die ihren Wipfel in der Bergluft kühlte; oder wenn dir die Kunde zukommt, daß ein stolzer Mastbaum auf dem Atlantischen Ozean oder auf dem Schwarzen Meere Sturm und Wetter standgehalten, daß dies ein Böhmerwaldkindlein ist, das, wenn es reden könnte, dem Seemann, der bewundernd zu ihm hinaufschaut, zurufen würde: ich bin ein Gebirgssohn, von Jugend auf an Wind und Sturm gewöhnt; langsam bin ich aufgewachsen auf Bergeshöhe, die Stürme von Jahrhunderten haben durch meinen Wipfel gebraust, ich habe ihnen standgehalten; darum ist mein Mark so kräftig, meine Faser so zäh!
Nicht unbedeutende Massen von Holz werden aber auch im Gebirge selbst durch verschiedene Industriezweige aufgearbeitet, vor allem zu Zündhölzchen und zu Resonanzholz. Zu Resonanzholz wird nur Fichtenholz mit den feinsten Jahresringen verarbeitet. Bei dem langsamen Wachstume der Bäume in dieser rauhen Gebirgsgegend werden die Jahresringe oft so fein, daß sie mit bloßem Auge sich nicht mehr zählen lassen. Eine Fichte von 40 cm Durchmesser aus dem Revier Philippshütte bei Maader zeigte 375 Jahresringe – ein Höchstmaß des Alters und ein Mindestmaß des Durchmessers, wie es selten vorkommt. Zu Resonanzholz werden nicht bloß frische, stehende Stämme benutzt, sondern vorzugsweise Lagerholz, sogenannte »Rohnen«, weil diese das schönste, reinweiße Holz geben; oft liegt ein solcher Stamm schon 100 Jahre; außen ist er mit Moos bedeckt und etwa auf 7-10 cm hinein vermodert, mächtige Fichten, oft von 75 Jahren, wachsen auf ihm, wie das am Kapellenbach bei Schattawa unweit Kuschwarda der Fall war, und inwendig ist das Holz noch so gesund, daß daraus die besten Resonanzböden gemacht werden können. So lange erhalten sich freilich nur gesunde Stämme, die durch Windriß umgestürzt wurden und durch Nässe und schnelle Moosbedeckung vor zu raschem Verfaulen geschützt waren. Eine eigentümliche Anwendung findet solches Rohnenholz noch zu »Schmalztösen«, weil es das Fett nicht durchschwitzen läßt.
Tausende von armen Gebirgsbewohnern nähren sich durch Verfertigung von Schindeln, Siebrändern, sogenanntem »Zargholz« und Schachtelholz oder »Schusterspänen«, wie die Leute sagen. Aus Buchenholz aber, das nicht geschwemmt werden kann, wird allerlei Wagengerät gemacht, und vornehmlich Holzschuhe. Ganz besonders blüht diese Industrie im »Mistelholz« des Planskers bei Krumau. Dagegen hört das Brennen von Pech, Wagenschmiere, Teer, die schlechteste Verwertung des Holzes, mehr und mehr auf.
c) Filze und Auen.
Filze und Auen, so heißen im Böhmerwald die Torfmoore. Sie sind das Seitenstück zum Urwald, ebenso urwüchsig wie dieser, ja, sie sind selbst Urwald, aber nicht in der großen Welt der Bäume, sondern in der kleinen Welt der Moose.
Wie starrgewordene Wasserbecken liegen sie in den muldenförmigen Einsenkungen der Gebirgsplateaus oder auf den breiten Rücken, welche die höchste Wasserscheide bilden – öde, fahle, gelb- oder braungrüne Flecken in dem Schwarzgrün des Waldes. Oder wie angeschwemmtes Schuttland begleiten sie Flüsse und Bäche, weithin die ganze Talsohle ausfüllend – die einzigen ebenen Flächen, die einzigen Horizontallinien, die sich dem Auge im Gebirge darbieten.
Jene beiden Namen bezeichnen nicht verschiedene Arten von Torfmooren, sondern sind örtliche Bezeichnungen aus dem Munde des Volkes in verschiedenen Gegenden. Im südlichsten Teile des Gebirges bis in die Gegend von Kuschwarda heißen alle Moore »Auen«, z. B. »See-Au«, »Habichau«, »Große Au« usw.; von Kuschwarda an nordwärts aber, mehr in der Mitte des Gebirges, ist der Name »Filz« gebräuchlich, z. B. »Seefilz«, »Judenfilz«, »Zwergbirkenfilz«, »Weitfellerfilz« usw. Charakteristisch ist, daß gerade da, wo der eine Name aufhört und der andere anfängt, eines der größten Torfmoore des Böhmerwaldes, die »Tote Au« bei Humwald an der Moldau, auch »Filzau« heißt, und beide Namen an ihrer Grenze auf diese Weise verbunden sind. In der nördlichen Abteilung des Böhmerwaldes bei Eisendorf und Tachau sagt man weder Filz noch Au, sondern »Lohe«, z. B. »Schleißloh«, »Brenteloh«, »Schwarzloh«. Dagegen ist das Wort »Moos« mit den daraus abgeleiteten »Mösler« (Moosbewohner), »möserig«, wie das in den Alpen gebräuchlich ist, im Böhmerwald nirgends zu finden.
Mehr durch ihre örtliche Lage und äußere Form als durch ihre eigentliche Natur, das ist die Art ihrer Entstehung und Zusammensetzung, unterscheiden sich die Torfmoore längs Flüssen und Bächen von den Hochmooren auf dem Gebirge. Wesentlicher ist die teilweise Verschiedenheit der Vegetation in den niedriger gelegenen Mooren des südlichen Gebirges von den in der Mitte des Gebirges höher gelegenen. Dadurch verbindet sich mit dem Namen »Au« auch von selbst eine etwas andere Vorstellung als mit dem Namen »Filz«.
Den größten Anteil an der Bildung der Torfmoore des Böhmerwaldes haben Moose, und zwar Sphagnum-Arten: Sph. acutifolium mit seinen matt gelbgrünen Blättern, seltener Sph. cymbifolium mit den breiteren rötlichen Blättchen. Aus der durchnäßten, wie ein Schwamm mit Wasser angesogenen Moosdecke wachsen da und dort Andromeda multifolia, Vaccinium oxicoccus (die »Moosbeere«) und Drosera polifolia hervor. Zahlreiche Rasenstöcke mit allerlei Gräsern bilden hervorragende Knoten und bezeichnen dem Wanderer die trockneren und festeren Punkte, wo er den Fuß aufsetzen kann, ohne zu versinken in dem zähen Schlamme. Um diese Rasenstöcke sind auch kleinere Sträucher angesiedelt und Flechten. Und hier gleich begegnen wir dem Unterschiede zwischen Auen und Filzen. In den Mooren südlich von Kuschwarda, in den »Auen«, findet man fast nur Heidekraut, Heidel- und Preiselbeeren, nördlich von Kuschwarda aber auf den »Filzen« ebensowohl an der Moldau bei Ferchenhaid, wie auf den Hochmooren bei Fürstenhut, Außergefild usw., auch die eigentliche Moor-Heidelbeere oder »Trunkelbeere« (Vacc. uliginosum), die »Grünbeere« (Empetrum nigrum), und unter den Flechten Cladonien und Cetraria islandica. Hier erst treten nun auch größere Sträucher auf, die Zwergbirke (Betula nana) und die Zwergkiefer (Pinus pumilio), und geben den Filzen in der Mitte des Gebirges, denen sie nie fehlen und deren Flächen sie mit ihrem grünen, niedrigen, abgerundeten Gebüsche überziehen, den eigentlichen physiognomischen Charakter von Urmooren gegenüber dem Urwald.
Wohl mag der Botaniker noch manche eigenartige Pflanze, manche seltene Flechte, manches schöne Moos auf den weiten Flächen auffinden und ein reiches Verzeichnis von alledem zusammenstellen können, was in den Mooren lebt und webt, keimt und blüht und Frucht bringt. Aber all diese Mannigfaltigkeit macht den Gesamteindruck nicht lebhafter, alle Formen und Farben erscheinen verwandt, alles verwischt und verfilzt sich zu dem unheimlichen Gesamtbilde traurig öder Flächen, zu einem wahren Totenbette der Natur, das alles meidet und flieht, Bäume, Tiere und Menschen. Nur der Sonnenschein lagert sich brütend wie in dicken Schichten über die Flächen; die Phantasie und der Aberglaube des Volkes bevölkert sie des Abends und des Nachts, wenn weiße Nebel daraus aufsteigen und Irrlichter erscheinen, mit Gespenstern und Geistern.
Wollte man all die Moore zusammenrechnen, es würde sich der Flächeninhalt eines nicht unansehnlichen Herrschaftsgutes ergeben. Das ganze obere Moldautal von Unter-Moldau aufwärts bis in die Gegend von Ferchenhaid auf 50 km Länge und durchschnittlich einer halben Stunde Breite ist nur ein großes Moor in den verschiedenen Gegenden mit verschiedenen Namen: »Hutschenau«, »Tote Au« (ein Stück 400 ha groß), »Erlau«, »Gansau«, »Seefilz«. In unzähligen Windungen schlängelt sich die Moldau träge durch und färbt ihr Wasser mit den braunen Säuren des Moores. Wo Flüsse und Bäche einmünden, da ziehen sich die Moore weit hinauf am Lauf der Wasser ins Gebirge, z. B. am Olschbach bei Unter-Moldau, an der kalten Moldau bei Humwald, an der grasigen Moldau bei Eleonorenhain, am Tierbach bei Ferchenhaid. Sogenannte »Brücken« aus quer nebeneinander gelegten Baumstämmen führen an verschiedenen Punkten über die breiten Sümpfe. Mehr einzeln, vom Walde rings abgeschlossen, treten die Torfmoore im Gebirge auf, die »See-Au« am Blöckenstein, die »Fuchsau« bei Andreasberg, am zahlreichsten in der Gegend von Fürstenhut, Buchwald, Außergefild, Maader, Stubenbach unter den verschiedensten Namen: »Kesselfilz«, »Rebhühnerfilz«, »Torffilz«, »Siebenfilz«, »Stangenfilz«, »Rechenfilz«, »Müllner-Schachtfilz«, »Fischerfilz« usf.
Bei vielen dieser Filze kann man ihr Größerwerden von Jahr zu Jahr beobachten; diese Moore breiten sich mehr und mehr in den Wald hinein aus, die Bäume sterben ab und weichen zurück, zuerst Tanne und Buche, zuletzt die Fichte, die in krüppeligem Wuchse oft selbst mitten in den Filzen noch lange aushält. Die Bedingungen für das Torfwachstum scheinen in der Mitte der Moore am günstigsten zu sein. Sie bauchen sich nach der Mitte zu auf, sind hier am mächtigsten. Oft ist man überrascht, wenn man den höchsten Punkt des Torfmoores erreicht hat, vor einem tiefen Wasserbecken zu stehen, wie im Seefilz bei Ferchenhaid und im Großen Seefilz bei Innergefild. Diese Wasserbecken haben häufig weder sichtbaren Zu- noch Abfluß und heißen dann »Seen«; haben sie nur einen sichtbaren Zufluß, so nennt man sie »Trichter«. In dem See bei Ferchenhaid bildet ein abgerissenes Stück Moor eine schwimmende Insel. Alle diese Erscheinungen erinnern sehr an die Aufberstungen der Torfmoore in Irland; die Moore – so wird berichtet – schwellen hier oft an, in der Mitte entstehen Hügel, oft von 10 m Höhe, der Boden bewegt sich und mit donnerähnlichem Getöse brechen gewaltige Schlammströme hervor, die oft fürchterliche Verwüstungen anrichten. Nach dem Ausbruch aber senkt sich die Moorfläche wieder, und in der Mitte entstehen nun häufig runde, tiefe Wasserbecken. Vielleicht verdanken die Moorseen des Böhmerwaldes mit ihren schwimmenden Inseln auch derartigen, wenn auch nicht so gewaltsamen Aufberstungen der Torfmoore ihre Entstehung.
Die Tiefe der Moore beträgt im Höchstmaß 3-6 m, im Mindestmaß 1 m. Den Untergrund bildet meist ein bläulicher, glimmerreicher Ton und Sand, die Zersetzungsprodukte von Gneis und Granit. In der untersten, bis zum Austropfen nassen, rötlichen oder braunschwarzen Torfmasse, die knetbar ist und bildsam wie Ton, liegen gewöhnlich noch gut erhaltene mächtige Baumstämme von Kiefern, Fichten und Tannen. Die begrabenen Wälder geben uns Aufschluß über die Bildung der Moore. Große Windbrüche sind nichts Seltenes im Gebirge. Ganze Waldstrecken werden oft umgeworfen, die Bäume entwurzelt und zerknickt, über den Trümmern wachsen Moose auf, breiten sich immer mehr und mehr aus, und nach Jahren findet man statt des Waldes das Torfmoor. Aber schon die ungeheure Menge abgestorbener Baumstämme, gebrochener und geknickter Äste, welche den Boden des Urwaldes bedecken, kann genügen, um durch die auf dem Pflanzenmoder aufwachsenden Sphagnum-Arten die Walzstrecken in Naßländer, auf denen die Waldbäume nur kümmerlich noch fortwachsen, und endlich in wirkliches Moor zu verwandeln. An Flüssen und Bächen mögen überdies die Wasser selbst Baumstücke in großer Menge zusammengeschwemmt haben. Auf diese Weise sind wahrscheinlich besonders die Moore an der Moldau entstanden. Oft scheinen auch im Wachstum der Moore wieder Stillstände eingetreten zu sein, es wuchsen wieder Waldbäume auf, dann nahm das Moos von neuem überhand und zerstörte wieder den Waldwuchs. Bei Urbarmachung einer Moosstrecke bei Eleonorenhain an der Moldau fand man fünf Schichten von Wurzelstöcken übereinander als Überreste natürlich abgestorbener Geschlechter des Waldwuchses.
Wo sie vorkommen, gelten die Torfmoore im Böhmerwald als ein für die Bodennutzung durchaus verlorenes Stück Land. Bei dem großen Holzreichtum denkt man noch kaum an eine Gewinnung des Torfes als Brennmaterial. Dagegen sucht man durch Anlegung von Abzugskanälen, durch Umgraben und Überschwemmen die Moore teils zu Wald, teils zu Wiese und Feld umzuwandeln. Alljährlich, besonders an der Moldau, wachsen grüne Wiesen und Kartoffelfelder immer weiter hinein in die öden Flächen. Ganze Ortschaften, z. B. Fleißheim, Mayerbach bei Unter-Wuldau, sind solche Moorkolonien. Dabei sinken die Torfmoore durch die Kultivierung infolge der Austrocknung zusammen, und die Fleißheimer Bauern sagen, daß sie, als sie sich an der »Großen Au« niedergelassen, über die Au hin den Kirchturm von Unter-Wuldau nicht mehr sehen konnten, während er gegenwärtig schon über die Hälfte sichtbar ist.
Es fragt sich aber, wie weit man gehen kann und darf in dieser Kultivierung. Denn abgesehen davon, daß bei den immer steigenden Holzpreisen die Verwendung des Torfes schon jetzt zu einer Lebensfrage für die Glashütten des Böhmerwaldes wird, spielen die Torfmoore eine zu große Rolle im Haushalte der Natur, als daß sich ihre Nichtbeachtung nicht rächen würde. Sie wirken bezüglich der Wärme und Feuchtigkeit wie die Wälder, nur kräftiger, eindringlicher. Die Sphagnen haben die Eigenschaft, in kurzer Zeit große Mengen von Wasser einzusaugen und nach allen Richtungen zu den noch nicht gesättigten Teilen zu leiten. Dagegen geben sie in langer Zeit nur sehr wenig Wasser wieder ab. Daher ziehen die Torfmoore wie natürliche Schwämme in wasserreichen Zeiten, im Frühjahre, wenn der Schnee zergeht, oder im Sommer bei starkem Gewitterregen, die überschüssigen Wassermassen an sich und verhüten plötzliche Überschwemmungen. Auf der anderen Seite aber geben sie in Zeiten der Dürre und der Trockenheit von ihrem Reichtum wieder ab. Sie sind recht eigentlich die Wassersammler, die Wasserreservoirs, dasselbe, was die Gletscher für das Hochgebirge sind, die den meisten Flüssen und Bächen ihren Ursprung geben und sorgen, daß es ihnen nie an Wasser gebricht und sie immer gleichen Wasserstand erhalten.
Immerhin mag es daher ein Vorteil sein, daß die Fleißheimer Bauern auf der »Großen Au« Kartoffeln essen und dazu noch am Wuldauer Kirchturm auf die Uhr schauen können; ein Nachteil dagegen ist es, wenn dem »Wenzelmüller« seine Mühle nur die Hälfte des Jahres geht und er die übrige Zeit vor Dürre verschmachtet oder im Frühjahr Gefahr läuft, mitsamt seiner Mühle von den tobenden Fluten des angeschwollenen Gebirgswassers ins Land hinabgerissen zu werden. Vielleicht tritt aber von selbst eine Zeit ein, wo man aufhört, die Moore in Acker- und Wiesenland umzuwandeln, wo es ebensowohl im Interesse des allgemeinen Wohles, wie in dem des Grundbesitzers ist, den Torf als Brennstoff zu verwerten, ihn zu ernten und wieder nachwachsen zu lassen, wie man einen wohlgepflegten Wald ausbeutet, ohne seine gänzliche Erschöpfung herbeizuführen.
Von Dr. Albert Schmidt in Wunsiedel.
Ein Blick auf die Karte Deutschlands läßt leicht erkennen, daß beim Aufbau der deutschen Berge in den nördlich der Alpen gelegenen Gebieten die gebirgsbildenden Kräfte nach zwei Richtungen gewirkt haben. Die eine geht von Nordwest nach Südost und wird die herzynische genannt, während die andere, die sich von Nordost nach Südwest zieht, mit dem Namen der rheinischen oder erzgebirgischen belegt wird. Diese beiden Richtungen halten unsere deutschen Mittelgebirge ein und ihre Massen treffen in einem räumlich kleinen Gebiete zusammen, im Fichtelgebirge. Wer auf dem höchsten Punkte dieses Gebirges, auf dem 1052 m hohen Schneeberggipfel steht und ein Auge hat für den Aufbau der Landschaft, der wird leicht ersehen, daß das, was die Karte im Bilde zeigt, deutlich in der Natur zu beobachten ist; denn von Nordost schieben sich die Kuppen des Thüringer Waldes, welcher der herzynischen Richtung zugehört, immer näher und näher heran und nur eine weite mit jüngeren Diabasgesteinen und paläolithischen Kalken gefüllte Senkung trennt sie von den Höhen des Schneebergzuges, der auch genau die Richtung des Thüringer Waldes einhält. Andererseits gehen fast unmerklich die Berge der Waldsteingruppe an der Nordostseite des Fichtelgebirges und zwar am Kornberge mit ihren Ausläufern in die des Erzgebirges über, sodaß in der Nähe der böhmischen Stadt Asch es nur auf die Ansicht des Beschauers ankommt, ob er die dortigen Berge dem Erzgebirge oder dem Fichtelgebirge zurechnen will. Wer diese Doppelbeteiligung des letzteren erkannt hat, dem wird vieles kein Rätsel mehr sein, was dieses interessanteste aller Mittelgebirge dem Forscher bietet. Es ist natürlich, daß jede der wirkenden Gebirgsmassen ihren Einfluß geltend machen mußte; es wurden die Täler geöffnet, den Flußläufen der Weg gewiesen und vor allem die Gesteinsmassen durch den ungeheuren Druck in zahlreiche Spalten gespalten. So fand das Wasser seine feinen Wege, das hier löste, dort absetzte oder die gelösten Substanzen in Reaktion brachte. Dadurch entstanden die seltenen Mineralien, an denen das Fichtelgebirge so reich ist. Oder es stiegen in lange vergangener Zeit in den gebildeten Spalten mineralbildende Dämpfe auf, und staunend sieht der Forscher auf die schönen und seltenen mineralogischen Funde, welche er hier in und an den Felsen macht. Wir erinnern nur an die schönen Orthoklaskristalle im Granit, an das Auftreten von Gold, Antimon und Zinnstein, vor allem aber an den dem Fichtelgebirge eigenen Speckstein, der bei Wunsiedel in einem Lager, dem einzigen in Europa, vorkommt. Die geschaffenen Täler benützend, fließen die Wasser im Gebirge meist nach den zwei beschriebenen Richtungen, indem sie nahe ihrer Quelle die eine einschlagen, um dann, oft in scharfem Winkel, in die andere umzubiegen. So wird es möglich, daß vom Fichtelgebirge aus vier große deutsche Flüsse nach den vier Himmelsgegenden abfließen, der Main vom Ochsenkopf, die Eger vom Schneeberg, die Nab ebenfalls vom Ochsenkopf, aber von jenseit der Wasserscheide, und die Saale vom Waldstein: eine Tatsache, die nach allen Richtungen zu preisen man im Mittelalter nicht müde wurde.
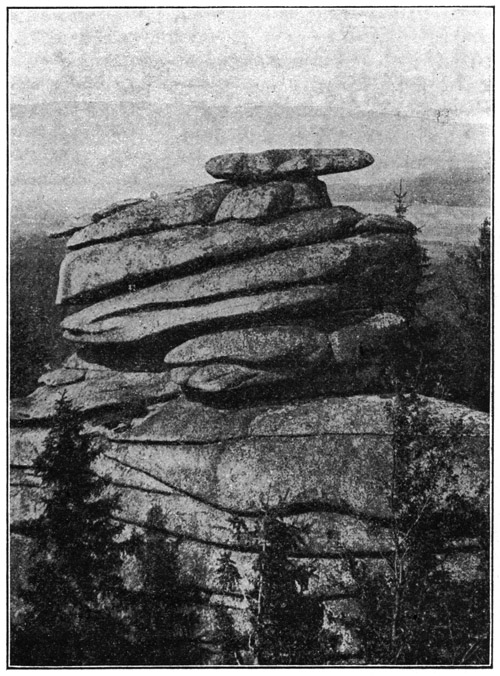
Gipfelbildung im Fichtelgebirge. (Rudolfstein. 866 m.)
So fesselt uns der Aufbau des Fichtelgebirges und seine Beziehungen zu seinen Nachbargebieten ebenso sehr, wie die Bilder der Landschaft, die sich vor uns entrollen, wenn wir dessen Berge durchwandern. Fels und Wald beherrschen die Gegend. Letzterer ein typischer Nadelwald, überzieht dunkel und weit die granitischen Berge und steigt herunter in den Talgrund. Aus ihm ragen die Granittrümmer heraus, wie die Trümmer gestürzter Riesenburgen oder zerfallener gigantischer Mauern. Oft auch deckt der Wald die Felsen, und der Besucher merkt erst, wie auf der unvergleichlichen Luisenburg bei Wunsiedel, wenn er in den Wald eindringt, daß er da vor einer eigenartigen und großartigen Erscheinung steht. Auf der Luisenburg bedecken den Boden Granitfelsen im Umkreise von 6 km, von denen die einzelnen von großer Schönheit sind. Moose und Flechten überziehen sie mit bunter Decke, Farne wuchern in ihren Spalten, und auf schwindelnder Höhe siedeln noch Bäume, deren Wurzel die Felsen umklammern. Das schafft bei dem Zusammenwirken von Wald und Fels schöne Landschaftsbilder. Während der Historiograph des Gebirges, Pachelbel, 1712 den damals Luxburg genannten Berg als eine Wüstenei schilderte, in welcher nur Eulen und Geier leben könnten, haben Wunsiedler Bürger kaum 60 Jahre später verständnisvoll Wege und Stege in die Felsen gebaut, die Höhlen geöffnet, und sentimentale Besucher gruben, vom Weltschmerz befangen, im Anfange des 19. Jahrhunderts Sinn- und Erinnerungssprüche in die Steine. Im Jahre 1805 besuchte Königin Luise von Preußen den Berg, und die Wunsiedler veranstalteten eine Feier ihr zu Ehren und änderten den Namen Luxburg in Luisenburg. Jetzt werden die Wunsiedler Festspiele dort im Freien zwischen den Felsen abgehalten, in denen Gnomen, Ritter und die Königin Luise auftreten. Daß die in geologischer Hinsicht merkwürdigen Erscheinungen auf der Luisenburg schon bald nach Erschließen des Berges die Geister beschäftigte, dafür spricht die Tatsache, daß Humboldt erklärte, daß beim Durchwandern der Felsen ihm klar wurde, was seines Lebens hohe Aufgabe sei, und daß Goethe zweimal erschien, den Aufbau und den Zusammenbruch der Steine dort zu studieren. Der höchste Punkt der Luisenburg ist der Burgstein (871,1 m), ein hervorragender Aussichtspunkt. Die Bilder, welche sich dort dem Beschauer entrollen, werden nur von denen übertroffen, die man vom Gipfel der Kösseine aus genießt (945 m). Auch der Gipfel dieses Berges hat, wie alle Granitberge, sein aus dem Zusammenbruche der Massen herrührendes Felsenchaos. Der Fichtelgebirgsverein hat ein Logierhaus dort errichtet und so den zahlreichen Besuchern es ermöglicht, dort zu übernachten und Sonnenauf- und Untergang zu genießen. Die Kösseine bietet ein charakteristisches Panorama, denn von ihrem Gipfel aus übersieht man nicht nur die langgezogenen, mit dichten Wäldern besetzten Berge des Fichtelgebirges, sondern auch die bevölkerten, mit schimmernden Teichen besetzten Talgründe, in denen schieferige Gesteine lagern, deren Wasserläufe und Kirchtürme im Sonnenglanze leuchten. Aber nicht nur die schwermütige Fichtelgebirger Waldlandschaft übersehen wir, sondern wir begegnen auch, in die Ferne schauend, den Bergen des Jura bei Bayreuth, den Basalten bei Kemnath in der Oberpfalz, deren rundlichere Kuppen aus der Landschaft hervorragen. Entgegengesetzt im Osten steigen in Böhmen die Terrassen der Berge hintereinander auf. Es sind die des Kaiserwaldes, an dessen Fuße Marienbad liegt und an dessen Westhang die Hotels und Schlösser der Metternichschen Residenz Königswart glänzen. Mehr gegen Nordost erscheinen die Häuser von Franzensbad, und der Kapellenberg bei Elster hebt sich dachartig. Mit ihm beginnen die Berge des Erzgebirges, die hier den Zusammenhang mit dem Fichtelgebirge erkennen lassen und sich blaudämmernd in der Ferne verlieren. In der Richtung des Thüringer Waldes ziehen dicht vor uns, wie schon erwähnt, die Berge der Schneeberggruppe (der höchste Punkt der Schneeberggipfel 1052,8 m), ein massiger Granitzug, in den ein wenig breiter Streifen von Gneis an der Farrenleite (895,4 m) und beim Nußhardt (972,2 m), eingelagert ist. Auf dem Gipfel des letzteren trifft der Besucher eine merkwürdige und für den Geologen interessante Erscheinung: Gneis- und Granitfelsen lagern durcheinander. Hier findet der Forscher staunenden Auges die Tatsache bestätigt, daß in geologisch früher Zeit der Granit emporsteigend in die Massen der schieferigen Gneisgesteine hineingepreßt wurde, um sie schließlich zu durchbrechen. In zerklüfteten, großen Brocken baut der Granit den Nußhardtgipfel auf, und die leichter verwitternden Gneisfelsen umlagern seine Blöcke. Dabei drängt sich der Wald heran zum höchsten Gipfel, auf dem wir eine weitere merkwürdige Erscheinung antreffen. Eine Anzahl flacher Becken und Schüsseln sind in den Stein eingekerbt. Lange hatte man sie als von Menschenhand erzeugt angesehen und beschrieben. Man hielt sie für Opferschüsseln und den hohen Felsen für den Altar, an welchem in wildernster Umgebung ein vergangenes Volk seinen Göttern opferte. Doch machte kritische Forschung dieser Romantik ein Ende. Man erkannte die Becken als von fallenden Tropfen gewühlt, oder von Eis und Schnee geschaffen. Aber es war verzeihlich, sich in die erstgeschilderten Verhältnisse hineinzuträumen, sind doch Umgebung und Ausblick vom Nußhardt derart, daß man die Erzählungen leicht glauben kann. Dicht vor uns hebt sich der 1052 m hohe Schneeberg, auf dessen Gipfel der Wald nicht mehr gedeiht, und im Westen lagert der Ochsenkopf 1024 m, der alte Fichtelberg der Umwohner, in dem König Salomo oder Karl der Große schlafen, der also dem Kyffhäuser Konkurrenz macht, in dessen Wäldern das Moosweib sitzt, in dem die mit Gold gefüllte Geisterkirche eingeschlossen ist, an dessen Felsen die Venedigermännlein nach Gold und Edelgestein suchen und in dem, was noch wenig bekannt wurde, Frau Venus wohnt. So wird der Ochsenkopf mit seinem dunklen Walde und seinen Felsen zum Venusberg. Auch hier im Fichtelgebirge die Tannhäusersage! Und am Fuße des sagenumwobenen Berges, zwischen ihm und den Bergen der Schneeberggruppe, lag einst der jetzt verschwundene, im Mittelalter viel und überschwänglich geschilderte Fichtelsee. Ein weites Moor bezeichnet die Stätte, wo früher seine, wohl von allem Anfange an moorigen Wasser fluteten und eine Fläche von nicht weniger als 241 Hektar bedeckten. Kundige fanden wohl heraus, daß dieser Fichtelsee, die Seelohe, die letzte Spur ehemaliger Gletscher sei, und niedere Schutthügel sind auch unschwer als Moränenreste zu erkennen. Aber das Moor ist interessant, weil es seltene Pflanzen birgt (Vaccinium oxycoccus, Empetrum nigrum, Andromeda polifolia, Ledum palustre u. dgl.), weil ein großer, wohl auch aus der Glazialzeit geretteter Bestand der seltenen Sumpfföhren (Pinus uncinata Ramond und Pinus Mughus Scop.) dort anzutreffen ist, und weil auf den unvertorften Holzstücken, die im Moore liegen, die Kohlenwasserstoffe Fichtelit und Reten, in der Torfmasse selbst Dopplerit zu finden sind. Interessant ist es auch, daß Goethe, der am 29. Juni 1785 mit Knebel und dem Eisenacher Gartendirektor Dieterich Ochsenkopf und Seelohe besuchte, dort die fleischverzehrende Eigenschaft des Sonnentaues, Drosera rotundifolia, zuerst beobachtet hat. Unweit der »Seelohe« rauschen die Wasser des jungen Mains, die sich durch die Silikatgesteine hindurch ihren Weg bahnen, bis sie an dem durch seine uralte Glas- und Perlenindustrie berühmten Bischofsgrün vorbeifließend, in der Nähe des immer mehr aufblühenden Kurortes Berneck in das sonnige, milde, nach ihnen benannte Maintal gelangen. Dort tritt der berggeborene Strom in das fruchtbare Land der Franken.
Grüne Diabasgesteine sind es nun, die wir treffen, die in niederen Zügen wieder zu den Graniten ziehen, welche im Norden und Nordwesten die Berge des Fichtelgebirges aufbauen. Aus ihnen ragt der Gipfel des Waldsteins (879,5 m) empor, einer der schönsten Berge des Gebietes. Auch ihn zieren mächtige Felsentürme, die man zugängig machte und von denen aus der Blick das Land überfliegt; ein von zahlreichen Buchenschlägen durchsetzter Nadelwald umrauscht den Berg. Zwischen den Felsen finden wir die Trümmer einer 1553 zerstörten, den Sparnekern einst zugehörigen Ritterburg, einer uralten kleinen Kirche, wohl einer der ältesten im Fichtelgebirge, eines Bärenfanges und vor allem eine größere, aus vorhistorischer Zeit stammende Wallanlage, die man einem wendischen Volke zuschreibt und die wohl dazu diente, ein wendisches Heiligtum zu schützen, nach dessen Zerstörung man die Kirche baute. Hat man vom Kösseinegipfel bei Wunsiedel einen Blick in das Gebirge selbst, in die böhmischen Lande und die der Oberpfalz, so überschaut man vom Gipfel des Waldsteines aus das Frankenland, die Täler der Saale, und der Blick fliegt weit hinein nach Thüringen, Koburg, zur Plassenburg bei Kulmbach, zum Kloster Banz, dem Staffelberg, zur Stadt Hof und einem Teil des Erzgebirges, wie auch die Basalte in der Umgebung von Eger leicht zu finden sind, während im Südwesten und Süden die bewaldeten Höhen der Schneeberg- und die Kösseinekette, sowie der wenig bekannte dem ostbayerischen Grenzgebirge zugehörige Steinwald das Panorama schließen.
So wechseln, wie wir eingangs berichteten, im Fichtelgebirge Fels und Wald. Letzterer hat unter der kundigen Hand der Forstbehörde wohl einen andern Charakter angenommen. Ursprünglich war er viel reicher an sumpfigen Stellen wie jetzt, obgleich die Moore im Fichtelgebirge heute noch nicht selten und von mehr Einfluß auf Vegetation, Wasser- und klimatische Verhältnisse sind, als man bisher annahm, aber es ist zu natürlich, daß der Wald unter der wirtschaftlichen Hand sich verändern mußte. Er war einst unwirtlich, undurchdringlich, feucht und deshalb zur Besiedelung ungeeignet. Daß sich in den Moorgebieten keine Spur menschlicher Wohnungen oder Tätigkeit findet, wie in denen des benachbarten Franzensbades, wo man jetzt einen Pfahlbaufund nach dem anderen macht, daß man in den Wäldern weder auf Spuren von Niederlassungen, noch auf solche von Gräbern stößt, spricht dafür, daß früher die Berge des Fichtelgebirges wenig bewohnt waren. Nur eines lockte, das war der Reichtum an Metallen, ja an edlen Metallen der Berge. Bei Gold-Kronach, wo man Gold fand, und zwar in sehr abbauwürdiger Menge bei jenem jetzt einsamen Bergstädchen, das den Ruf des Fichtelgebirges im Mittelalter begründete, und am Ost- und Westhange der Schneebergkette bis weit herein in das Wunsiedler Tal und in die Umgebung von Weißenstadt reihen sich Halden- an Haldenzüge. Hier baute man seit unvordenklicher Zeit auf Zinn.
Diese Grubenfelder, die sehr ausgedehnt und zum Teile von schönem Wald bedeckt sind, an dem man deutlich sieht, wie lange vergangene Bergmannsgeschlechter lange Zeit und gründlich gearbeitet, hier die Gruben angelegt, dort die Wasser reguliert und an ihnen das ausgewaschene Erdreich aufgetürmt haben, sind sehr der Beachtung und des Studiums wert. Das Gold lockte die Menschen ja zu allen Zeiten, und das Zinn war mehr begehrt in vorgeschichtlichen Tagen wie jetzt, doch die Zahl seiner Fundstätten auf dem europäischen Kontinente war sehr beschränkt. Man fand es, weniger ergiebige Gruben in Schlesien und Frankreich abgerechnet, nur in den geologisch und genetisch verwandten Bergen des Erz- und Fichtelgebirges. Aber es mußte begehrt sein, weil man es, bevor man das Eisen zu verarbeiten lernte, mit Kupfer legiert zur Bronze brauchte.
So werden es nur Bergleute gewesen sein, welche in die Berge des Fichtelgebirges in frühester Zeit eindrangen; welchem Volke sie angehörten, ist nicht entschieden. Gegen Mitte des 6. Jahrhunderts nahten von Osten her wendische Völker, welche dann bis 806 an der Eger und am oberen Main das Land besetzt hielten. Nachgewiesen ist, daß 805 Karl der Große oder sein Sohn Karlmann nach Beendigung der Sachsenkriege gegen sie gezogen ist. Nach für die Deutschen siegreichen Kämpfen wurden sie entweder vertrieben oder von den Siegern aufgesogen, aber zahlreiche Fluß-, Orts- und Flurnamen erinnern in der Umgebung des Fichtelgebirges immer noch an ihr einstiges Dasein. Nach Unterjochung der Slawen war das Land Reichsgebiet geworden, als dessen erster Beherrscher jener König Heinrich II. (1002-1024) erschien, den man später heilig sprach. Gegen die Wenden hatte man die Nordmark gegründet, deren Grafen ursprünglich in Nabburg in der Oberpfalz residierten. Als infolge des Zusammendrängens der Wenden der Grafensitz weiter nach Osten verlegt werden mußte, siedelten die Markgrafen von Nabburg nach Eger über. Im Jahre 1122 erschien dort Diepold von Gingen, später nach seiner Herrschaft Vohburg in Niederbayern von Vohburg geheißen. Die mit ihm von dort und aus Schwaben gekommenen Ministerialen siedelten sich auf den Bergen an, errichteten die Burgen, deren Gemäuer wir noch an den Felsen finden, und mit den Burgen kam die Kolonisierung, die Meierhöfe, die Dörfer, kurz, die Besiedelung. So kam das Fichtelgebirge zum größten Teile unter die Herrschaft der Markgrafen, die in Eger saßen, und später unter die Herrschaft der ehemals reichsunmittelbaren, jetzt böhmischen Stadt Eger. Nur im Nordwesten und Westen, bei Bayreuth und Berneck, herrschten die Grafen von Orlamünde, und im Norden bis Hof die Vögte von Plauen und Weida. Ende des 13. Jahrhunderts erschienen die Hohenzollern im Fichtelgebirge. Sie erwarben zuerst die reichen Besitztümer der Herren von Wunsiedel und von Hohberg. Wie sie es verstanden, durch Kauf und Händel sich in den Besitz der Gegend zu setzen, ist bezeichnend für ihre Mission. Burg um Burg kam in ihre Hände, und bald war der Reichsstadt das Urteil gesprochen, die auch immer mehr Besitz an das aufstrebende Kloster Waldsassen verlor. Mitte des 14. Jahrhunderts konnte die Hauptmannschaft oberhalb des Gebirges gegründet werden, der bald die Gründung des markgräflich brandenburgischen Fürstentums mit dem Herrschersitze in Kulmbach, später in Bayreuth gefolgt ist. 1613 wurde der Bezirk gegründet, von dem Wunsiedel die Hauptstadt war. So blieben die Verhältnisse, bis 1791 der letzte Markgraf Alexander von Bayreuth, der Gründer von Alexanderbad bei Wunsiedel, nach England zog und sein Fürstentum an Preußen abtrat. Nicht lange erfreuten sich die Fichtelgebirger Lande preußischer Herrschaft, sie kamen 1807 an Frankreich und 1810 an Bayern. Die Hauptstädte Hof, Kulmbach und Wunsiedel gingen infolge anderer Einteilung als Hauptstädte ein, Bayreuth wurde Kreishauptstadt. Infolge seiner geographischen Lage blieb Wunsiedel in touristischer Hinsicht der Mittelpunkt des Fichtelgebirges, ist heute auch der Sitz des Fichtelgebirgsvereins. Daß die Stadt jetzt, wo sie längst nicht mehr markgräflich Bayreuther oder königlich preußische Hauptstadt ist, nicht viel mehr von ihrer ehemaligen Bedeutung hat, ist erklärlich, aber sie liegt an waldumrauschten Höhen, am Fuße der Luisenburg, welche ihr gut gepflegtes Gemeindeeigentum ist, und unweit des aufstrebenden Alexanderbades. Schon frühe, schon 1326, hatte der zur Stadt erhobene Ort durch die Herstellung verzinnter Eisenbleche (Zinn und Eisen fand man ja in seiner unmittelbaren Nähe) Bedeutung erlangt. Seine Bürger waren die einzigen, welche 1421 und 1462 die Hussiten und Böhmen schlugen. Zur Zeit des kommenden Humanismus schufen sie nach Melanchthons Vorschriften ein Lyzeum, und ein Wunsiedler Professor und späterer Kardinal Friesner legte 1482 die erste Druckerei zu Leipzig an. Bekannt ist, daß der unglückliche Burschenschafter Georg Sand 1798 und Deutschlands größter Humanist, Jean Paul, 1763 in Wunsiedel das Licht der Welt erblickten. Des letzteren Büste stellte man vor seinem Geburtshause auf.
Wer in das Fichtelgebirge eindringen will, wird dies, durch die Bahnverhältnisse veranlaßt, immer von den Städten Hof, Bayreuth oder von Eger aus tun müssen. Hof ist eine derjenigen Städte in Bayern, die dank ihrer geographischen Lage den raschesten Aufschwung nahmen. Es liegt an der tiefsten Stelle der Bodenfalten, welche vom Frankenwalde, vom Fichtelgebirge und schließlich auch vom Erzgebirge abfallen. Bayreuth macht eine zweite Blüte durch. In die Straßen, in denen man auf Schritt und Tritt auf zum Teile sehr hübsche Bauten aus der fröhlichen Markgrafenzeit stößt, grüßt das Wagnertheater herein, und Eger zehrt an seinen Erinnerungen. Seine Bewohner haben nie vergessen, daß sie einst Angehörige einer freien, reichsunmittelbaren Stadt waren, einer Stadt, in der man Reichstage abhielt, in der sich Barbarossa seine Frau holte, in der eine großartig angelegte Kaiserburg, deren schöne Ruine heute noch Stadt und Land übersieht, gestanden ist und in der Wallenstein den Tod fand. Straßen und Häuser sind voller schöner historischer Erinnerungen. Aber Eger liegt den granitischen Bergen des Fichtelgebirges ferne, in dem tertiären Becken, welches die große böhmische Thermalspalte durchquert, welche wahrscheinlich bis an die granitischen Höhen des Fichtelgebirges sich hinanzieht und welche wohl Ursache der zahlreichen kleinen kohlensäure- und eisenhaltigen Quellen im Gebiete und der bedeutenderen von Ottobad und von Alexanderbad ist. Es besteht kein Grund für die Annahme, daß diese tiefe Spaltung des Geländes an der bayrisch-böhmischen Landesgrenze aufhört.
Es ist kein Zufall, daß die uralten Völkerstraßen, welche zum Main und anderseits zur Donau ziehen, an dem Fichtelgebirge geradezu vorbeigehen. Man suchte sich bequeme, die Kämme und die unwirtlichen Wälder meidende Pfade. Aber die Völkerstraßen entwickelten sich zu Heerstraßen, und später suchten sich die Eisenbahnen dieselben Täler und drangen nur, wenn es nicht anders ging, in die Berge ein. So sind die Hauptbahnen alle um das Fichtelgebirge, manche in weitem Bogen herumgeführt, und die Anlage vieler Kleinbahnen ist nicht im entferntesten in der Lage, den dadurch herbeigeführten wirtschaftlichen Nachteil gut zu machen. So fahren alljährlich viele an den dunklen Bergen vorüber, die so leicht zu erreichen sind, zur bayrischen Landeshauptstadt oder zur Reichshauptstadt in umgekehrter Fahrt. Diejenigen aber, welche es unternehmen, die Bergfahrt in das Fichtelgebirge zu machen, die werden alle Ursache haben, sich der Gegend zu freuen, die sie finden. An den mächtigen Felsen werden sie staunend stehen und die wechselnden Eindrücke aufnehmen, welche eine Wanderung durch die Labyrinthe hervorruft. Sieht man aber von hoher Felsklippe oder von leicht erreichbarem Bergesgipfel herunter, so tritt uns eine Landschaft entgegen, die gerade durch ihre Ursprünglichkeit sich auszeichnet, Fels und Wald sind dieselben geblieben. Tiefe Einsamkeit und tiefer Frieden liegt über dem von herrlicher Luft umfluteten Wald, dessen Stille nur der Wind unterbricht, der durch die Wipfel rauscht, oder das ferne Picken der Steinhauer, die den Granit an der Stelle bearbeiten, wo er in längstvergangener Zeit an das Tageslicht emporgestiegen ist. Die von ihnen geschaffenen Denkmalssockel stehen fast in allen deutschen Städten, und schöne Arbeiten gehen durch alle Lande, ja nicht selten auch weit über das Meer.
Von August Lingke in Dresden.
Tausende von Reisenden aus den nördlichen Gegenden unseres deutschen Vaterlandes strömen alljährlich nach den mitteldeutschen Gebirgen; der Harz, der Thüringer Wald, das Fichtelgebirge und die sächsische Schweiz wimmeln zur schönen Jahreszeit von Fremden; nur das Erzgebirge liegt da, von der Mehrheit der Touristen noch wenig beachtet und wenig besucht, als wäre jeder Zugang zu ihm versperrt, oder als wäre es eine traurige, reizlose Einöde. Und doch bietet es des Schönen und Merkwürdigen so viel, doch verdient es die Betrachtung des Natur- und Menschenfreundes in hohem Grade. Man braucht nur den zahlreichen Flüssen und Bächen nachzugehen bis zu ihren Quellen und sich an dem saftigen Wiesengrün ihrer Ufer, an den von Wald und Felsen malerisch bekleideten Talseiten zu erquicken, man braucht nur die bald wilde, bald idyllische Romantik der Weißeritztäler, die schauerliche Schönheit des schwarzen Pockautales mit dem Katzenstein, das anmutige Flöhatal und die mit den mannigfaltigsten Uferlandschaften, stattlichen Felsenschlössern und gewerbreichen, freundlichen Städten gesegneten Täler der Zschopau, der westlichen Mulde und des Schwarzwassers mit ihren Nebenflüssen zu durchwandern, braucht nur von den Gipfeln des Keil- und Fichtelberges sowie des Auersberges eine Rundschau zu halten oder von einem Hochpunkte am Kamme des Gebirges einen Blick in das böhmische Wunderland hineinzutun, und man wird zu der Überzeugung kommen, daß das Erzgebirge einen viel mannigfaltigeren Charakter hat als der Thüringer Wald und der Harz, daß aber diese Mannigfaltigkeit dem Wanderer nicht auf den ersten Blick oder innerhalb einer kleinen Tagereise entgegentritt, sondern daß man oft viele Stunden weit gehen muß, ehe sich der Charakter des Gebirges wesentlich verändert.
Wenn man freilich von Norden, also von Sachsen her kommend, immer nur die nächste Wellenkette dieser gewaltigen schiefen Ebene, die vom Fuße weg sechs bis acht Meilen braucht, um bis zu einem Kamme von mehr als 1200 m Höhe anzusteigen, vor sich hat und so auf der Landstraße fort bis zum Kamme hinaufwandert, so wird man dem Eindruck der Einförmigkeit nicht entgehen. Anders wandert es sich nach Süden, etwa von Johanngeorgenstadt oder Oberwiesenthal nach dem Egertale, oder von Altenberg oder Sayda aus hinab ins Tal der Biela. Schon nach einem Marsche von drei bis vier Stunden welcher Wechsel in der Landschaft! Wie schnell der Übergang vom Wilden zum Milden! Geht es doch von dem Scheitel des Keilberges bis zum Egerspiegel bei Damitz in zwei und einer halben Stunde fast 950 m abwärts. Es soll damit aber durchaus nicht gesagt sein, daß die sächsische Seite des Gebirges von der Natur stiefmütterlicher behandelt worden sei als die böhmische. Im Gegenteil; denn wenn man die rechten Punkte kennt und aufsucht, die in der Nähe der zahlreichen und meist vorzüglichen Straßen, die das Erzgebirge durchziehen, einen weiteren Ausblick gewähren, so hat man Mühe, alle die verschiedenen großartigen Landschaftsbilder in sich aufzunehmen und festzuhalten, die sich da im Laufe eines Tages dem Wanderer in Auge und Seele drängen.
Wir beginnen unsere heutige Wanderung in Freiberg, dem alten Vriberc, das schon von jeher als die Haupteingangspforte zum Erzgebirge bezeichnet wird. Obwohl es uns für diesmal weniger darum zu tun ist, größere Städte aufzusuchen, als vielmehr unsere Wanderlust zu befriedigen und Land und Leute kennen zu lernen, halten wir uns doch hier in der ehemals von den Landesfürsten mit Freiheiten und Rechten reich begnadeten Bergstadt einen halben Tag auf und statten den vielerlei Altertümlichkeiten, die sich die Stadt bewahrt hat, dem Schloß, dem Rathaus, dem Dom mit der berühmten Goldnen Pforte, dem herrlichsten Werke der gesamten romanischen Bildnerkunst des zwölften und des dreizehnten Jahrhunderts, wie weder in Deutschland noch in Italien ein zweites dieses Zeitalters zu finden ist, sowie dem noch stehenden Teile der alten Ringmauern, mit ihren Türmen und dem Altertumsmuseum einen Besuch ab, fahren wohl auch auf einem der vielen um die Stadt herumliegenden Schächte in ein Silberbergwerk ein. Ist doch seit seinem Ursprung der Bergbau für Freiberg ein Hauptnahrungszweig gewesen, gaben doch die reichen Silbergruben bis zum Jahre 1883 dem Lande über 9 587 000 Pfund Silber, ungerechnet andere Metalle. Leider sind die Tage des Bergbaues für Freiberg gezählt. Die staatlichen Gruben sind schon seit Jahren in der Abrüstung begriffen, da ihre Ausbeute die Kosten des Ausbringens nicht mehr lohnt. Im Jahre 1913 wird die Abrüstung beendet sein, wird der letzte Bergknappe seine letzte Schicht fahren, und der Freiberger Erzbergbau, der einst Stadt, Land und Fürsten reich und mächtig machte, nur noch der Geschichte angehören. Trotzdem aber treten uns auch heute noch in Freiberg fast auf Schritt und Tritt Anzeichen des Bergbaues entgegen, sei es nun in Figuren oder schönen altgotischen Portalen an alten Bürgerhäusern, die sich darauf beziehen, sei es in den Schaufenstern, wo bergmännische Gebrauchsgegenstände, Kittel und Paradeuniformen ausgelegt sind, oder in dem Läuten des Häuer- oder Bergglöckchens, das in den Morgen-, Mittags- und Abendstunden die Bergleute von und zur Schicht ruft.
Doch wir müssen weiter und verfügen uns deshalb wieder nach dem Bahnhof, um hier zur Fortsetzung unserer Tour Sachsens schönste Gebirgsbahn, die Linie Freiberg–Klostergrab zu benutzen, die von Freiberg aus über Nossen und Döbeln Anschluß an Leipzig hat, während Klostergrab die Verbindung mit dem dichten Schienenweg der nordböhmischen Bahn herstellt. Zwischen Berthelsdorf und Lichtenberg betritt die Bahn das Muldental. Von hier aus begleitet sie den Fluß bald auf der rechten, bald auf der linken Seite bis fast an seinen Ursprung und erklimmt dann von Moldau an, dem Hirschbach und zugleich der Landesgrenze folgend, den Kamm des Gebirges. Auf der Haltestelle Bienenmühle, die schon 544 m hoch gelegen ist, verlassen wir den Zug und wandern, um den großen Bogen der Poststraße abzuschneiden, über den sogenannten »Butterweg« nach Kämmerswalde, einem langgestreckten Dorfe, das bereits in der 700 m hohen Erhebung des Erzgebirges liegt. Von hier aus geht es weiter nach Neuhausen, einem freundlichen Ort mit einer schönen, neuerbauten gotischen Kirche, der zu den sieben Spielwarendörfern des Seiffener Kreises gehört und hart am Fuße des 787 m hohen Schwartenberges liegt. In Neuhausen steht das alte Schloß Purschenstein, schon zu Beginn des zwölften Jahrhunderts angeblich von Borße von Rysinborg erbaut, wahrscheinlich ursprünglich Pyrsenstein (Pirschenstein = Jagdschloß) genannt, jedenfalls aber ein Zeuge dafür, wie weit man schon in damaliger Zeit in dieses Waldgebiet vorgedrungen war. Malerisch erheben sich die runden Türme des Schlosses aus dem dichten Grün der Berghänge; in seinem Innern ist es geschmackvoll eingerichtet und in seinem Äußern wohlerhalten. Purschenstein mit seinen immerhin nicht ganz unbedeutenden Spuren alter Befestigungen ist eins der imposantesten Schlösser des Erzgebirges und Sitz eines der reichsten Zweige des in Sachsen sehr ausgebreiteten Adelsgeschlechts derer von Schönberg, das schon in der ersten Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts, im Jahre 1336, in den Besitz dieser Herrschaft kam.
Wir sind nun in dem Tale der Flöha, des östlichen Hauptzuflusses der Zschopau, die weitab von dem Zentralstock des Gebirges entspringt und bis zu ihrer Mündung in die Zschopau 121 Quellbäche aufnimmt. Hier bei Neuhausen-Purschenstein hat sie 10 m Fall, am Einfluß in die Zschopau nur 2,5 m. Die dicht bewaldeten Hänge bieten ein reizvolles Bild. Im Tale entlang wandernd, kommen wir bald nach Nieder-Seiffenbach, dann nach dem Bergflecken Seiffen, einem Hauptort der Spielwarenfabrikation. Wäre nicht gerade ein Sonntag gewesen, so würden wir hier Gelegenheit gehabt haben, die Spielwarenverfertiger bei ihrer interessanten Arbeit zu beobachten. Denn fast in jedem Hause dieser Ortschaft wird gedrechselt, geschnitzt, geleimt und gemalt. Männer, Frauen, Greise und Kinder sind dabei beschäftigt. Jedes hat seine besondere Arbeit, und eins fertigt tagaus tagein nur ein und dieselbe Teilarbeit. Nur die äußerste Teilung der Arbeit macht die erstaunliche Wohlfeilheit der hiesigen Fabrikate möglich. Die Hauptarbeit hat der Dreher. Er dreht aus einem größeren Stück Holz die Grundformen der verschiedenen Spielsachenteile im ganzen, als »Reifen« auf der Drehlade, die durch Wasserkraft getrieben wird. Diese Reifen werden dann radial in eine Anzahl Teile zerspalten, von denen nun ein jeder, wenn auch nur in Umrissen, eine bestimmte Tiergestalt hat, so daß im Handumdrehen ein Schock Pferde, Kühe, Schafe, Esel usw. im Rohzustande fertig sind. Der Schnitzer und der Maler machen dann das Tier vollends fertig, indem sie die Beine ausschneiden, Ohren, Hörner, Schwänze ansetzen und ihm Farbe geben. Häufig besteht das Malen nur darin, daß man das Tier in flüssige Farbe taucht, trocknen läßt und nachher ein paar schwarze Punkte als Augen aufsetzt. Wöchentlich ein- oder zweimal werden die fertigen Stücke an den Unterhändler oder direkt nach Seiffen an die Grossisten abgeliefert. Diese besorgen das Sortieren in die Schachteln, das Verpacken und den Versand. So entstehen Schäfereien, Tierweiden, Geflügel- und Bauernhöfe, Dörfer, Städte, Bergwerke, Eisenbahnen, Jagden, Menagerien, Militär, Infanterie und Kavallerie auf Scheren, Wachtparaden, Lager usf. In den Handlungsbüchern gibt es zweitausend Nummern Spielzeuge. Man kann annehmen, daß fünf Sechstel der dortigen Bevölkerung von diesem Industriezweige leben. Wer hätte es sich wohl träumen lassen, daß sich aus den schlichten gedrechselten Nadelbüchschen, die ein Seiffener Leinwandhändler um das Jahr 1760 mit auf die Leipziger Messe nahm, eine großartige Industrie entwickeln würde, die heute gegen zehntausend Personen beschäftigt. In dem Hauptorte Seiffen selbst sowie in Grünhainichen und Olbernhau gibt es auch eine Fachschule und eine ständige Ausstellung von Spielwaren, in der man über diesen Zweig der Industrie den richtigen Überblick gewinnt. Von Nieder-Seiffenbach an führt die Straße fortwährend am linken Ufer der forellenreichen Flöha durch ein anmutiges Wald- und Wiesental bis zur Vereinigung der Flöha mit der Schweinitz, die vom Katharinenberg in Böhmen herabkommt. Hier öffnet sich das Tal in ein weites Becken, das an seiner Nordgrenze das Tal der Natschung aufnimmt. Talabwärts von stattlichen Wäldern umgeben, bildet zur rechten Seite des Flusses die am Talrande hochliegende Kirche von Ober-Neuschönberg eine prächtige Staffage, und vor uns in der Ebene, im Mittelpunkt einer der reizendsten Gegenden Sachsens, liegt das Bad Grünthal mit einer schwefel- und eisenhaltigen Quelle. Das Bad ist zugleich Gasthof.
Nach einstündiger Mittagspause bei gutem Tisch und vortrefflichem böhmischen Bier brechen wir von hier wieder auf, um durch den Kupferhammer-Grünthal hindurchgehend zunächst den Bruchberg zu besteigen. Der Kupferhammer, ein ehemals fiskalisches Hüttenwerk, wurde im Jahre 1491 von den aus Ungarn nach Sachsen eingewanderten, später in Freiberg reich begüterten Gebrüdern Alnpeck angelegt und ging im Jahre 1567 in den Besitz des Kurfürsten August über, der ihn verbesserte und erweiterte. Das Werk war vornehmlich eine »Saigerhütte«, das heißt, es wurde hier das silberhaltige Schwarzkupfer gesaigert, oder mit anderen Worten, vermittels eines Schmelzprozesses durch zugesetztes Blei, das mit dem Silber verwandter ist als das Kupfer, vom Silber befreit und sowohl das Kupfer wie das Silber von allen sonstigen Beimengungen gereinigt. Jetzt geschieht dies mit weit mehr Vorteil auf anderem Wege in den Freiberger Hütten, und so sehen wir die riesigen Saigeröfen, die über dritteinhalbhundert Jahre Dienst getan, dieser Tätigkeit entzogen. Im Jahre 1710 besuchte Peter der Große, von Karlsbad kommend, mit großem Gefolge das Gebirge. »In der Saigerhütte Grünthal,« schreibt Hering in seiner Geschichte des sächsischen Hochlandes, »setzte sich der Kaiser auf einen der größten auf und nieder gehenden Hammer und hielt die Erschütterung wirklich einige Minuten aus.« Während des Siebenjährigen Krieges besetzten preußische Truppen wiederholt die Hütte, ohne sie zu schädigen, 1778 aber wurde sie durch ein österreichisches Streifkorps niedergebrannt. Seit 1752 war auf der Hütte eine Münzstätte für Kupfergeld angelegt, in der man während des Siebenjährigen Krieges auch polnische Groschen und sächsische Silberscheidemünzen prägte; später lieferte die Hütte hauptsächlich gewerblichen Zwecken dienende Gegenstände, zum Beispiel ausgeschmiedete Bleche, Braupfannenböden, Kesselschalen usw., so daß sie nach verschiedenen Vergrößerungen zu Anfang der vierziger Jahre im Jahre 1868 10 740 Zentner Kupferwaren aller Gattungen fertigte. Im Jahre 1873 gingen die Werke in den Besitz des Kammerrates Lange über, der als Neuheit die Fabrikation von Tombak und Messing, beide in Blechen und Drähten, einführte. Es werden nunmehr hier Kupferblöcke, Kupferdraht und Kupferdrahtseile zu Blitzableitungen, ferner Druckkupferbleche, Kupferstecherplatten und Kupferdrähte zum Umspinnen von Klaviersaiten gefertigt.
Vom Kupferhammer nach dem Bruchberg (674,4 m) führt anfangs ein sanft ansteigender Fußweg zwischen Getreidefeldern und Wiesen bis an den Waldrand, dann nimmt uns ein herrlicher hochstämmiger Buchenwald auf, in dem es ziemlich steil bergan geht. Um aber schließlich zum Gipfel selbst zu gelangen, müssen wir uns durch Gestrüpp und Gras und über wildes Trümmergestein ziemlich mühsam emporarbeiten. Rechts und links stehen Himbeeren in großer Menge. Endlich sind wir oben und sehen unsere Mühe reichlich belohnt, denn nicht nur bietet sich uns ein herrlicher Blick auf Grünthal und Olbernhau, sondern auch in die Täler der Flöha, der Natschung und des Schweinitzbaches, die sich tief unter uns durch die dunkle Waldung hinwinden, sehen wir hinein – ein schönes Gebirgsbild, das da vor uns liegt!
Hochbefriedigt kehren wir zum Fuße des Berges zurück und wenden uns nach links auf den »Königsweg«, eine sanft ansteigende Waldstraße, so genannt zur Erinnerung an einen Besuch des Königs Johann. Wir wandern weiter, ein herzerquickender Spaziergang durch einen Wald prächtiger Säulenschäfte, die ihr grünes Laubgewölbe oben harmonisch verzweigen und verschlingen; zahlreiche Bäche rieseln von den Hängen zu Tal, und eine lungenstärkende, feuchtdunstige Luft umgibt uns. Bei jeder Biegung des Weges zeigen uns diese wunderbaren Domhallen neue Gestalten, schönere Bilder, herrlichere Effekte der durch die Zweige hereinbrechenden Abendsonne, und durch das Einatmen der frischen, duftigen Waldesluft, die uns so lind und lau umfächelt, fühlen wir uns wie neugeboren. So gehen wir etwa fünfviertel Stunden lang auf der schönen Straße fort, durch den Wald nach Olbernhau, wo wir mit einbrechender Dunkelheit ankommen. Am zweiten Tage brechen wir ½7 Uhr in der Frühe auf und wandern mit Umgehung des auf halbem Wege liegenden Ortes Ansprung über Grundau direkt nach Zöblitz. Kurz vor der Stadt schwenken wir noch nach rechts ab, um die Serpentinsteinbrüche zu besuchen, die auf dem gegen Ansprung hinstreichenden Höhenzuge, der »Hartha«, liegen.
Das Serpentin lagert hier auf dem Gneis in drei Flözen übereinander. Das oberste Flöz, zwölf bis fünfzehn Ellen mächtig, enthält den dunkelgrünen, seiner Sprödigkeit wegen nur zum Straßenbau tauglichen Kammstein; das mittlere, von einviertel bis dreiviertel Ellen Mächtigkeit, den hellgrünen, oft ins Blaue spielenden sogenannten Horn- oder Lawetzstein, und erst das unterste den zum Drechseln brauchbaren, bisweilen mit Granaten vermischten Serpentin. Die vorherrschende Farbe des Serpentins ist grün, selten findet man den braunen und gelben; roter lagert nur in einem Bruche. Seine Farbe behält nur der schwarzgrüne Stein, die feinste Politur nimmt der rötlichgraue an. Die früher von den Serpentinsteindrechslern selbst – es bildete sich schon im Jahre 1613 in Zöblitz eine besondere Innung, eine Steindrechselzunft – auf sehr unwirtschaftliche Weise bearbeiteten Brüche sind seit 1861 in dem Besitz einer Aktiengesellschaft, die nunmehr einen bergmännischen Abbau eingerichtet hat, wodurch die ganze Serpentinindustrie neu belebt worden ist. Mit Recht wird anerkannt, daß die Fabrikate in neuerer Zeit eine größere Formvollendung zeigen. Von Zöblitz, einer Stadt von 2400 Einwohnern, die mehrmals, besonders 1854, durch Brandunglück heimgesucht wurde, wandern wir hinunter in das Tal der Schwarzen Pockau. Die Schwarze Pockau, die am Katzenstein 40 m Fall hat, ergießt ihr Wasser in die Flöha und rauscht durch eines der wildesten Täler des Erzgebirges. Wir betreten das Tal bei den Hintergrundhäusern, wenden uns sogleich nach links und wandern auf gutgepflegter Straße seinem schönsten Teile zu. Mit dem Beginn des Kriegswalder Reviers wird die Gegend immer wilder, die Felsbildung immer schroffer. Hier hat das Gebirge noch den großen Vorzug der fast unberührten, unentweihten Natur. Die Einsamkeit des unvergleichlich schönen Weges wird noch wenig durch die bunte Schar lärmender Touristen gestört, und nur selten kommt uns ein Holzfäller oder ein altes Mütterchen, das Kräuter und Pilze sucht, entgegen. Endlich erreicht die Wanderung in dem auf Marienberger Revier liegenden Katzenstein ihren Glanzpunkt; bevor wir aber zu dessen Plateau hinaufsteigen, gehen wir eine Strecke weiter im Tal aufwärts bis zu der Teufelsmauer, einem großartigen Felsenpaß, der sich quer vorschiebend sozusagen einen riegelartigen Abschluß der Schönheiten des Tales bildet, denn dahinter verflacht es sich und wird weniger reizvoll. Wir gehen deshalb hier zurück und steigen nun erst auf bequemen Waldwegen links die Höhe zum Katzenstein hinauf. Oben hat man von einer weit vorstehenden, mit eisernem Geländer geschützten Felsplatte eine prächtige Aussicht auf das unten liegende Tal und seine Umgebung. Senkrecht stürzt der Felsen etwa 60 m zur Tiefe, in der die Schwarze Pockau ihre Fluten dahintreibt. Oben links fesselt uns eine ungeheure Felswand, die Ringmauer, die mit den dunkelgrünen Fichten auf ihren Abhängen ein höchst malerisches Bild bietet. Der Ringmauer gegenüber liegt der mit dichtem Gehölz bedeckte Rabenberg, auf dessen vordersten Ausläufer nach der Volksmeinung ehemals ein berüchtigtes Raubschloß gestanden hat. Jedermann in der Umgegend kennt diese Stätte nur unter dem Namen »das alte Raubschloß«, und selbst die Forstverwaltung gibt diesem Teil des Kriegwalder Forstreviers diese Bezeichnung. Wenn aber an langen Winterabenden die Leute der dortigen Gegend in der Rockenstube beim »Hutzen« zusammenkommen, dann erzählt man sich schaurig-schöne Geschichten von der Bande des »Bastels« oder des »Schmiedeberger Karls« (der Wilddieb Karl Stülpner) und des »dürren Schneiders«, die noch zu Mitte des vorigen Jahrhunderts in den weiten Waldungen am Katzenstein und am Rabenberg ihr Unwesen trieben. Ehe wir den Katzenstein verlassen, betrachten wir auf dem Plateau selbst noch eine tischähnliche Felsplatte, die gewissermaßen von historischer Wichtigkeit ist, da an ihr schon Kurfürst Johann Georg der Erste und später König Johann und König Albert als Kronprinz große Jagdfrühstücke gehalten haben. In einer benachbarten Felsgruppe zeigen sich hohle Räume, die als Vorratskammern dienen können. Unser Weg führt nun zunächst nach den Pobershauer Feldern und dann nach dem Dorfe Pobershau selbst, das lebhafte Spielwarendreherei und Schachtelfabrikation betreibt. Die Schachteln werden aus entsprechend breiten und langen Spänen von Tannen- oder Fichtenholz über eine Form gebogen, an den Enden mit Spänchen zusammengeheftet und mit einem dünnen, durch Holzstifte befestigten Brettboden versehen.
Um nach Marienberg zu gelangen, wählen wir von Pobershau aus den sogenannten »Stangenweg«, überschreiten die Rote Pockau, passieren die Ortschaften Dörfel und langen endlich um Mittag in Marienberg an. Die 608 m hoch gelegene und 7600 Einwohner zählende Stadt verdankt ihre Gründung (1521) durch Herzog Heinrich dem Frommen dem reichen Bergsegen und war ehedem befestigt, woran noch Reste der früheren Stadtmauer, ein Wartturm und das mächtige Zschopauer Tor erinnern. Der Ort ist völlig regelmäßig angelegt, hat aber außer der Kirche mit ihrer dreischiffigen Hallenanlage, einer der schönsten domartig gebauten Kirchen Sachsens, und dem großen quadratischen, mit Linden umpflanzten Marktplatz keine besonderen Sehenswürdigkeiten. Dagegen weist seine Umgebung mehrere hübsche Punkte auf. Einer davon ist die Drei-Brüder-Höhe, mit eisernem Aussichtsturm, von dem aus man eine wundervolle Fern- und Rundsicht genießt. Wir berühren diesen dreiviertel Stunden vor der Stadt liegenden Punkt auf unserm Weitermarsche nach Wolkenstein. In dem Dorfe Geringswalde fällt uns das Gerippe eines Habichts auf, der an das Scheunentor eines Gehöftes angenagelt ist. Der Besitzer erklärte uns auf Befragen, es sei dies eine Jagdtrophäe, da aber diese Erklärung etwas zögernd herauskam, so vermuten wir, daß dieses Annageln des Raubvogels vielmehr mit einem Aberglauben zusammenhängen könnte. Nach zweistündigem Wandern von Marienberg aus erreichen wir endlich Warmbad Wolkenstein. Es liegt als ein stattlicher Häuserkomplex in einem flachen, von dem Hilmersdorfer Bach durchflossenen anmutigen Tale, das durch künstliche Anlagen bedeutend verschönert ist. Das Bad hat den wärmsten (30° C) Gesundbrunnen Sachsens, mit Vorteil gegen Gicht, Rheuma und verwandte Krankheiten zu gebrauchen und in seiner Wirkung den Wassern von Wildbad Gastein und Pfäffers ähnlich. Aus der in neuerer Zeit frisch gefaßten Quelle wird das Wasser durch ein Hebewerk nach dem Badehause geleitet. Auf dem Boden des Brunnens liegen zahlreiche Geldstücke, die stahlblau aus der Tiefe heraufschimmern. Es sind dies milde Spenden der Besucher des Brunnens, die bei der alljährlich nach Schluß der Saison erfolgenden Reinigung herausgeholt und zur Unterstützung armer Badegäste verwandt werden.
Das seit dem zwölften Jahrhundert bestehende Bad hätte früher die nähere Bezeichnung: »Warmbad zu unserer lieben Frauen auf dem Sande«, so genannt von einer im vierzehnten Jahrhundert gegründeten Kapelle, worin die Maria »auf dem Sande« verehrt wurde, der in Prag das Karmeliterkloster »auf dem Sande« geweiht war. Das alte wundertätige Marienbild, zu dem früher stark gewallfahrtet wurde, hängt heutzutage noch in dem Brunnenhause, und darunter steht der Spruch:
Das Warmbad am Sand zu Unsrer lieben Frawen
Hat Gottes Wunder gelegt in diese Auen,
Wodurch dem Leib nach heil werden kranke Herzen
Christi Verdienst und Blut heilt alle Leibesschmerzen.
Nachdem auch wir, wie üblich, unsern Obolus in das Wasser geworfen, verlassen wir um 6 Uhr das Bad Wolkenstein und wandern auf einer schönen, über den Berg führenden Straße in einer halben Stunde nach dem Städtchen Wolkenstein selbst. Wolkenstein, 470 m hoch gelegen, mit 2300 Einwohnern, hat infolge vielfachen Brandunglücks ein modernes Aussehen erlangt. Es war früher eine bergfreie Stadt und hatte viel Bergbau, lebt aber jetzt von Ackerbau, Spitzenklöppelei und Posamentiererei. Auf einem fast senkrecht nach der Zschopau abstürzenden Felsenvorsprung liegt das Schloß, das aus einem älteren, in Trümmern gesunkenen Teil, dessen einstige Erbauung man den Wenden zuschreibt, und einem neueren, noch wohlerhaltenen besteht. Der Schloßfelsen enthält Amethystgänge, in seiner Umgebung findet sich Jaspis, Onyxachat, Bergkristall und nach alten Berichten sogar Rubin. Den Namen hat das Schloß von seinem mutmaßlichen Erbauer, Bolko von Waldenburg, erhalten, weshalb es eigentlich Bolkenstein heißen müßte. Im fünfzehnten Jahrhundert kam es an die Landesherren, in den folgenden Jahrhunderten hat es als Jagdschloß der sächsischen Herzöge und Kurfürsten glänzendes Hofleben gesehen.
Von Wolkenstein aus erreichen wir mit dem Abendzuge Annaberg, die wichtigste, 17 000 Einwohner zählende Stadt des Obererzgebirges, an dem der Sehma zugekehrten Abhänge des Pöhlberges ziemlich abschüssig gelegen. Einst hieß diese Gegend die »wilde Ecke« und war wüst und einsam. Da geschah es, daß im Jahre 1492 im Schreckenberge ein gewaltiger Silberreichtum entdeckt wurde. Die »wilde Ecke« zog nun viele Bergleute, Abenteurer und Händler herbei, und schon 1496 verwandelte Herzog Georg der Bärtige die Ansiedlung in eine Stadt, die erst »Neustadt am Schreckenberge« hieß und später Annaberg genannt wurde. Die Silberausbeute war namentlich im sechzehnten Jahrhundert, wo eine Grube nach der andern angelegt wurde, ganz enorm – von 1496 bis 1594 betrug sie 3 737 839 Gulden –, und die Üppigkeit der Bergherren wuchs mit ihrem Reichtum. Die Annaberger Münze, die die sogenannten Schreckenberger oder Engelsgroschen prägte, war nicht imstande, das gewonnene Silber ganz auszumünzen, sodaß das meiste ungemünzt in Silberkuchen ausgegeben werden mußte. Aber wie anderwärts, so hielt auch bei Annaberg der reiche Bergsegen nicht aus. Der Bergbau Annabergs hat seit dem siebzehnten Jahrhundert nur ein langsam dahinsterbendes Dasein gefristet und ist trotz aller Versuche, ihn wieder in Aufschwung zu bringen, so gut wie tot. Dazu wurde die Stadt am 27. April 1604 durch eine große Feuersbrunst heimgesucht – 700 Häuser und fast alle öffentlichen Gebäude (Kloster, Rathaus, Schule, Dach und Turm der Hauptkirche) sanken in Asche – und so ihr Wohlstand aufs tiefste erschüttert. Da gelang es in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts durch Einführung von mancherlei Hausindustrie für weitere Kreise lohnende Beschäftigung zu schaffen. Es kam die Bortenwirkerei auf, aus der sich die noch heute bestehende Posamentenindustrie entwickelte. Einen ähnlichen Verlauf scheint das Aufkommen des Spitzenklöppelns gehabt zu haben, wenn auch die Frage, ob die Klöppelkunst im Erzgebirge selbständig erdacht oder von auswärts dorthin verpflanzt wurde, unentschieden ist. Unter den Frauen Annabergs, die damals einen gewinnbringenden Handel mit Borten und Spitzen betrieben und dadurch zahlreichen Händen Beschäftigung und Verdienst boten, ist die denkwürdigste Barbara Uttmann, geborene von Elterlein, Witwe des 1553 gestorbenen Bergherrn Christoph Uttmann. Durch Klugheit, Umsicht und Tatkraft hat sie sich bleibende Verdienste um die Verbreitung beider Industriezweige und die Einführung in immer weitere Kreise des Gebirges erworben. Infolgedessen hinterließ sie bei ihrem Tode ein gesegnetes Andenken, und es darf nicht wundernehmen, daß etwa hundert Jahre nach ihrem Abscheiden die dankbare Gebirgsbevölkerung sie als Erfinderin und Einführerin des Spitzenklöppelns feierte. Heute erinnert ein aus Bronze gegossenes Denkmal auf dem Marktplatz der Stadt an die Verdienste der ausgezeichneten Frau.
Am nächsten Morgen verlassen wir Annaberg wieder und fahren mit der Annaberg-Weiperter Bahn im Sehmatale aufwärts nach Cranzahl. Im Sehmatale beginnt die Posamentenerzeugung als Hausindustrie und zieht sich in stark bevölkerten Dörfern über Buchholz bis zum Fichtelberg hinauf. Die Mannigfaltigkeit der Fabrikate der Posamentenbranche läßt sich nur andeuten: alles, was Kleiderbesatz und Garnitur heißt, Ornament, Knopf, Borte, Franse, Quaste, Schnur, wird hier gewirkt und geschlungen, gedreht und genäht. Geht das Geschäft flott, dann sind Tausende von Posamentierstühlen, Hunderte von Mühlstühlen und Chenillemaschinen im Gange. Im Jahre 1863 hat ein Annaberger Geschäft für 600 000 Mark umgesetzt. Der Jahresexport nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika (Konsulat in Annaberg) beträgt ungefähr 5½ Millionen Mark. Annaberg hat über 100 Posamenten- und Spitzenhandlungen; Buchholz 100 Posamentenfabrikanten und Verleger. In Annaberg wohnen über 600, in Buchholz über 450 Posamentierer. Je nach der herrschenden Mode werden fast auf dem ganzen Gebirge durch Frauen- und Kinderhände Zwirn-, Woll- oder Seidenspitzen geklöppelt. Freilich ist der Verdienst der Klöpplerinnen sehr gering, aber dennoch mögen manchmal im Annaberg-Buchholzer Bezirk 20 000 Klöppelkissen in Tätigkeit sein. Aber auch andere Geschäftszweige sind vertreten, sodaß bei gänzlichen Modeveränderungen allgemeine Notstände nicht mehr aufkommen können, zum Beispiel Kartonnagenfabriken, die Pappkartons von den einfachsten Apothekerschächtelchen bis zu den feinsten Bonbonnieren und Ostereiern verfertigen, und Präganstalten, die aus Gold- und Silberpapier Sargverzierungen und aus Silber- und Papierkanevas tausenderlei Unterlagen zu Stickereien, vom Buchzeichen bis zum Lampenteller und -schirme, verfertigen. Andere Geschäfte versenden Kränze von Moos und trocknen Blumen oder fertigen auf eigenartigen Stühlen Perlengewebe für Etuis und Portefeuilles an als Ersatz für kostspielige Stickereien.
In Cranzahl verlassen wir den Zug, durchschreiten den hohen Viadukt, auf dem die Annaberg-Weiperter Bahn von dem linken nach dem rechten Talhang geht, und wandern durch den freundlichen Ort nach dem sich daran anschließenden Neudorf, einer reich belebten Ortschaft, die Ackerbau und Industrie treibt. Aus dem Grün der umgebenden zahlreichen Obstbäume heraus über Hecken und Gärten blicken die freundlichen Häuser mit ihren weißen Mauern und silbergrau blitzenden, schiefergedeckten Dächern. Die je nach persönlichem Geschmack schwarz oder braun, manchmal auch rot oder blau gestrichenen Balken stechen wie ein Netz von den grellweiß gefärbten Zwischenräumen ab, in denen die Fenster mit ihren kleinen Schößchen und halben Scheiben leuchtend hervortreten. Eines nach dem andern, zuweilen eine Reihe, zuweilen ein großer Trupp werden sichtbar; an den Fenstern grünen und blühen Blumenstöcke überall, auch da, wo man keinen Garten am Hause oder davor besitzt. Freundliche Mädchenköpfe zeigen sich hinter den Scheiben, einen flüchtigen Blick nach der Straße werfend, während die fleißigen Hände emsig und unablässig bei der Arbeit bleiben. Heitere Kinder spielen vor den Türen, ein harmloser Hund kläfft uns an, während die Hühner gackernd über den Zaun flüchten und die Gänse nach dem Bach eilen; Wagen mit stattlichem Zugvieh ziehen die Dorfstraße einher; die rauchenden Essen lassen ihren Dampf kräuselnd aufwärts steigen, und über dem leichten Rauch und dem stattlichen Grün der Bäume, den silbergrauen Schiefer- und dicht bemoosten Schindeldächern tritt der spitze, nadelförmig aufragende oder viereckige, zwiebelförmig gekrönte Turm des Kirchleins in das Bild.
So kommen wir nach etwa fünfviertel Stunden an das Ende von Neudorf und wenden uns unmittelbar bei der letzten Sägemühle auf den Vierensteig, der zu dem nahen Walde führt. Hatten wir bisher zu beiden Seiten der Eisenbahn und der Fahrstraße fast ununterbrochen menschliche Wohnungen, so ändert sich mit einemmal die Szenerie vollständig. Ein staubfreier, gut gehaltener Fahrweg windet sich eine reichliche Stunde lang dicht an der huschenden und rauschenden Sehma durch schattenspendenden Wald zu dem mächtigen Gebirgskamm empor, geht links am Fuße des 1028 m hohen Eisenberges hin und erreicht vor dem roten Vorwerk eine Ruhebank, bei der rechts der Fußpfad zum Gipfel des Fichtelberges abzweigt. Um ¼11 Uhr stehen wir unten an der großen Schneise, die nach Süden und nach Osten weite Ausblicke ermöglicht und in verblüffender Steilheit in dreiviertel Stunden zum Gipfel des Fichtelberges hinaufführt.
Vom Fichtelberg, 1213 m hoch, noch 56 m höher als der Brocken des Harzes und nur 370 m niedriger als die Schneekoppe des Riesengebirges, überschaut man bei ganz klarem Wetter das ganze Erzgebirge und einen Teil des sächsischen Niederlandes bis zu den Rochlitzer Bergen, auch schweift der Blick nach Südwesten in die Gegend des Fichtelgebirges und des Böhmerwaldes und nach Osten auf das böhmische Mittelgebirge, den Milleschauer und die Biliner Berge. Der Berg hat eigentlich zwei Gipfel, von denen der eine um 18 m höhere der vordere, der andere der hintere Fichtelberg heißt, und die durch eine sattelförmige Vertiefung miteinander verbunden sind. Der Fichtelberg und sein Nachbar, der Keilberg, sind die höchsten Gipfel und das Zentrum des Erzgebirges, beide haben auch dieselbe geognostische Beschaffenheit, sie bestehen aus Glimmerschiefer. Die Abhänge des Fichtelberges sind mit prächtigen Wäldern bedeckt und bieten dem Botaniker reiche Ausbeute an Moosen und subalpinen Pflanzen. Auf ihm entspringen das Schwarzwasser, die Mittweida, die Zschopau und die Sehma. Seit dem Sommer 1889 steht auf dem Gipfel des Berges ein Unterkunftshaus, dessen Mauern ebenso stark und wetterfest sind, wie seine innere Einrichtung praktisch und die Verpflegung gut ist. Das Gebäude hat geräumige Gastzimmer und einen kleinen Saal, außerdem Küche und Kellerräume. Daneben steht der ebenfalls neu gebaute Aussichtsturm.
Nachdem wir unser Mittagbrot eingenommen und etwa zwei Stunden geruht haben, verlassen wir um 1 Uhr den Berg und marschieren, ohne nach Oberwiesenthal hinabzugehen, über den hinteren Fichtelberg hinunter zum » Neuen Haus« an der Straße von Kupferberg nach Gottesgab. Dieses Gebäude ist Sachsens höchster bewohnter Punkt (1080 m), und darum war es dem Besitzer erlaubt, sich dem vorüberfahrenden König als »Allerhöchster Untertan« vorzustellen. Von hier aus nach dem Keilberg hinüber führt ebenfalls eine schöne breite Straße; wir schlagen jedoch einen wenig betretenen Fußweg über die nördliche Abdachung des Berges ein, ödes Heideland, das nur mit spärlichem Fichtenbestand besetzt ist. Nach unten zieht sich der sogenannte »Kalte Wintergrund« hin, der wohl die traurigste Gegend des ganzen Erzgebirges ist, denn auf der Mitternachtsseite, wo selten ein Sonnenstrahl in diese beinahe unheimliche Schlucht dringt, liegt sogar im Juni noch Schnee. Und doch findet sich auch da noch eine menschliche Ansiedlung, »Der kalte Winter«, im Volksmunde »Böhmisch-Sibirien« genannt. Die Bewohner können bei schrecklichen Schneestürmen oft acht Tage lang nicht aus dem Hause, und es wäre fürwahr tollkühn, wenn sie sich aufs Geratewohl durch die klafterhohen Schneemassen einen Weg bahnen wollten. Bei den »Sonnenwirbelhäusern«, die schon böhmisch und die höchste Ansiedlung im ganzen Erzgebirge sind (1154 m), erreichen wir die Straße wieder und wenden uns nun nach der Spitze des Keilberges, der, 1244 m hoch, eine herrliche, das Panorama vom Fichtelberge ergänzende Aussicht auf Böhmen darbietet.
Der Keilberg, auf Böhmisch Bartum, d. i. Bartholomäusberg, der höchste Gipfel des Erzgebirges, bildet gewissermaßen den Hauptstock des ganzen Gebirges, einen Gebirgsknoten, von dem es in nordöstlicher und südwestlicher Richtung verläuft, und um den sich die höchsten Punkte gruppieren, so daß es hier fast das Ansehen eines Hochgebirges erhält. Dieser Vergleich kommt vorzugsweise dem steilen, südlichen Abfalle des Keilberges zu, dessen Fuß unmittelbar von der Talsohle des Egertales begrenzt wird, aus der er plötzlich sehr schroff sich erhebt, im Gegensatze zum nördlichen Abfalle, der ganz allmählich zum Gipfel ansteigt. In der nächsten Nähe des Berges stehen dicht aneinandergereiht, wie Mastbäume, die schlank gewachsenen Fichten und Tannen des »Schwarzwaldes«, ein Name, den die ausgedehnten herrlichen Waldungen am Südabhange des Keilberges führen, an die sich weithin nach den verschiedenen Richtungen die gewaltige Waldregion, ein förmliches Forstmeer, der mannigfaltigsten Höhenzüge mit ihren Kuppen anreiht. Der Blick schweift bei heiterem Himmel über das ganze böhmische Erzgebirge, vom Böhmerwalde und Fichtelberg an bis an das Riesengebirge, eine wundervolle Aussicht, wie sie in solchem Maße kein zweiter Berg im ganzen Erzgebirge bietet. Alle einzelnen Punkte dieses farbenprächtigen Panoramas zu schildern, ist unmöglich. Den Gipfel des Keilberges ziert ein schöner, steinerner Aussichtsturm, dessen Plattform überglast ist, um den heftigen Luftzug abzuhalten, und der den Namen »Kaiser-Franz-Josephturm« führt; die Kosten des von dem Erzgebirgsverein Joachimsthal erbauten Turmes betrugen 7000 Gulden.
Von Keilberg gehen wir in dreiviertel Stunden hinunter nach Gottesgab, das 1015 m hoch auf einem überaus stiefmütterlich ausgestatteten, unwirtschaftlichen und frostig rauhen Moorplateau hart an der sächsischen Grenze liegt, die höchstgelegene Stadt der österreichisch-ungarischen Monarchie und nebenbei der Geburtsort des erzgebirgischen Volksdichters Anton Günther ist. Von der Tiefe und Innigkeit des Gemütes dieses Dorfpoeten, der in seinem Lebensgang und seiner ganzen Veranlagung viel Ähnlichkeit mit dem steierischen Dichter Peter Rosegger hat, und von seiner heißen Liebe zur Heimat mag das Lied auf sein Vaterhaus ein Beispiel geben:
Dort wu da Grenz ve' Sax'n is',
en Wald da Schwarzbeer blüht,
dort wu mr heit' noch klipp'ln tut,
en Wenter hutz'n gieht,
do schtieht net weit von Wald drva',
sieht kla' ond ärmlich aus,
a Hüttl, när aus Holz gebaut,
das is' mei Vatterhaus.
Do drauß'n en de fremd'n Walt,
da fend ich halt ka' Ruh,
da Heiser sei do ganz aus Sta',
da Menschen a' a su;
a jeder sengt a' andersch Lied,
doch mitt'n drenna 'raus,
do klengt's on ruft's: Vergass fei net
drham dei Vatterhaus.
Auf der baumlosen, öden Hochfläche, die Gottesgab umgibt, kommt nur ein dürftiger, dafür aber sicherer Graswuchs vor, wird der Hafer selten reif, und der Kartoffelbau, der manche Jahre ganz mißlingt, lohnt kaum das Legen und die Pflege. Darum beschränkt sich die Landwirtschaft fast ausnahmslos auf die Viehzucht. Auf den weiten Grasflächen in der Nähe des Ortes bemerkten wir eine Herde von 120 Stück schönem Rindvieh, der Bestand der ganzen Gemeinde Gottesgab. Das Vieh wird von früh 8 bis 6 Uhr abends ausgetrieben und tagsüber nicht gemolken. Die weibliche Bevölkerung beschäftigt sich hauptsächlich mit Spitzenklöppeln, Weißstickerei und Näherei. Fahrende Musikanten aus Gottesgab sind in aller Herren Ländern zu treffen. Der einst so blühende Bergbau ist auch hier gänzlich in Verfall geraten. Ursprünglich hieß das Städtchen Wintersgrün und gehörte vom Jahre 1459 bis 1547 zu Sachsen, erhielt aber eben seiner reichen Silbererze wegen von frommen und dankbaren Bergleuten den bedeutungsvollen Namen: »Gottes Gabe«.
Von Gottesgab wandern wir dann weiter über Seiffen nach Johanngeorgenstadt. Wir folgen dabei von Seiffen aus dem Laufe des am Fichtelberge entspringenden Schwarzwassers, kommen zunächst nach Zwittermühl und gelangen dann, an dem rauschenden Gebirgsbache weiter abwärts wandernd, zwischen Jungehengst und Bretmühle in ein reizendes Tal, in dem sich das Wasser in unzähligen Kaskaden schäumend über mächtige Granitblöcke stürzt. Schöne Berge mit dunklen Tannen- und Fichtenwäldern zu beiden Seiten, an deren Abhängen kleine, mit Schindeln gedeckte Hütten malerisch verstreut liegen, dazwischen blumenreiche Wiesen, die, von hundert kleinen Kanälen durchschnitten, das frische, klare Quellwasser mit sichtbarer Labung einschlürfen, darüber der schöne Gebirgshimmel mit seinen silbernen Wolkenschichten, vor den Häusern arme, aber zufriedene Menschen, Kinder, die uns ihr »Grüß Euch Gott« mit auf den Weg geben, dazu die herrliche, Lungen und Nerven stärkende Luft, alles das zusammengenommen machen den beinahe vierstündigen Weg bis Johanngeorgenstadt zu einem höchst genußreichen.
Johanngeorgenstadt, das gegenwärtig etwa 6000 Einwohner zählt, verdankt sein Entstehen der Glaubenstreue und wurde im Jahre 1654 mit Genehmigung des Kurfürsten Johann Georg des Ersten von böhmischen Auswanderern, größtenteils Bergleuten aus Platten und Gottesgab, die ihres lutherischen Glaubens wegen das Land verlassen mußten, gegründet. Auf dem Marktplatze steht seit 1863 des Kurfürsten Standbild. Früher war auch hier der Bergbau sehr lohnend, von 1645 bis 1766 betrug die Ausbeute der Bergwerke 3 623 979 Taler. Jetzt treibt der Ort besonders Glacéhandschuhnäherei, Schatullenfabrikation und Maschinenstickerei, ist auch von dem verheerenden Brande im Jahre 1867 wieder vollständig erstanden und macht in seinem neuen Gewande einen freundlichen Eindruck. Am nächsten Morgen setzen wir unsern Weg von Johanngeorgenstadt auf der Eibenstocker Straße entlang zunächst nach Steinbach fort. Von der Höhe der Straße, die wohl eine der höchsten im ganzen Gebirge sein dürfte, hatten wir hübsche Blicke hinüber in die Schwarzenberger Gegend. Vor dem Dorfe Steinbach schwenken wir rechts ab und besteigen den Königin-Carola-Turm. Daneben liegt der »Wilde Mann-Schacht«, wo auf Wismut gebaut wird. Der Turm des Keilberges und das neue Fichtelberghaus lagen in greifbarer Klarheit vor uns. In Steinbach fragten wir nach der »Sauschwemme«, fünf einzeln stehenden Waldhäusern, kamen rechts und links an zahlreichen Mooren und Torfstichen vorbei und stiegen zuletzt auf schöner, breiter Waldstraße zum Auersberg empor. Auf dem Wege von Steinbach bis zum Fuße des Auersberges bemerkten wir an den hochstämmigen Fichten die Bartflechte in reichlicher Menge. Den Gipfel des Auersberges, des dritthöchsten Berges Sachsens, 1022 m über der Ostsee, ziert ein massiv steinerner Turm, auf Staatskosten gebaut, der schon durch seine Höhe und seinen trotzigen ernsten Stil imponiert. Die Granitzinnen zu seinen Häupten geben ihm ein altersgraues Aussehen. Die Aussicht vom Auersberg wird von vielen der vom Fichtelberg noch vorgezogen. Über den Höhen hin, die das Erzgebirge im Westen abschließen, sehen wir das Vogtland mit der Göltzschtalbrücke und unzähligen Ortschaften, dahinter die Thüringer Vorberge, davor den Kuhberg. Im Norden verliert sich das Auge in der weiten norddeutschen Ebene, nur die menschliche Sehkraft zieht der Aussicht hier Grenzen. Die Leipziger Türme, das Altenburger Schloß und der Petersberg bei Halle geben für das Auge schwache Anhaltepunkte. Näher heran sieht man die Waldenburger Höhen, den Rochlitzer Berg mit seinem Turm, den Kapellenberg, die Stadt Hohenstein, rechts davon die Chemnitzer Rauchwolke, dahinter die Höhen von Lößnitz. Von Osten schauen die bekanntesten Berge des Erzgebirges herüber. Die beiden tafelförmigen Erhebungen des Pöhlbergs und des Bärensteins erscheinen sehr nahe, die Stadt Annaberg ist am Abhange des Pöhlbergs sichtbar, weiter hinaus zeigt sich die schwarze Tellkoppe bei Kipsdorf, näher der Scheibenberg, ferner der Ochsenkopf und nun vor allem die beiden Hünen, der Fichtelberg und der Keilberg, die von keinem Orte gigantischer erscheinen als von ihrem Kameraden, dem Auersberg, aus. Das Haus auf dem Fichtelberg ist sichtbar, und am Abhange lugen die Tellerhäuser aus ihren Waldverstecken hervor. Gegen Süden hin deuten dunkle Linien im Walde Täler an, hervorragende Höhen sind nur der Hirschberg, der Spitzberg bei Frühbuß und der Große Rammelsberg. Wir schauen sodann die lange Schneise hinab; ihr zur Linken buchtet sich das Große Bockautal ein, zur Rechten das Kleine; vor uns am Berge treffen beide Täler zusammen, und die vereinigte Bockau strömt hinab in das Muldental. Links drüben liegt Eibenstock, rechts das Dorf Sosa. Das Muldental ist abwärts weithin zu verfolgen, so auch das Schwarzwassertal; das große Dorf Breitenbrunn breitet sich an seinem rechtsseitigen Abhang aus; ganz hinten, wo sich das Tal zu verlieren scheint, lugen die obersten Häuser von Johanngeorgenstadt neugierig hervor, und gegen Süden und Südwesten ist nichts zu erschauen als meilenweit Baumwipfel, Wald und immer wieder Wald.
Vom Auersberg steigen wir in einer halben Stunde hinunter nach Wildenthal, einem 730 m hoch an der Bockau und der Eibenstock-Karlsbader Straße liegenden Dorfe, und treten von hier aus, Eibenstock und Schneeberg für diesmal weglassend, das letzte Stück unserer Reise, die Wanderung durch das tiefe, wildschöne Tal der am Auersberg entspringenden Großen Bockau bis nach Unterblauenthal an. Das ziemlich enge Tal ist von hohen Wäldern eingefaßt, die sich bei herrlichen Rückblicken von Biegung zu Biegung kulissenartig verschieben, und zeigt allerlei Spuren von Bergbau. Bei seiner Blüte haben um Wildenthal herum dreihundert Erzgruben bestanden. So kommen wir nach Unterblauenthal, Station der Aue-Adorfer Bahn, nehmen in dem schattigen Lindengarten des Gasthauses noch einen Abschiedstrunk ein und gehen dann zum Bahnhof, um über Aue, Lößnitz und Chemnitz die Heimreise mit der Überzeugung anzutreten, daß das Erzgebirge durchaus nicht der rauhe, unfreundliche und wohl auch von sichtbarer Armut beherrschte Landstrich ist, als der es von Nichtkennern leider noch oft hingestellt wird, daß vielmehr dieses Ländergebiet unendlich reich ist an landschaftlichen Schönheiten, so reich wie kaum ein anderes und ebenso leicht zugänglich dem rüstigen Fußgänger auf schöner Straße wie dem bequem auf der Eisenbahn Reisenden; daß die Luft rein, kräftig und gesund, die Unterkunft und Bewirtung meist allerorten gut und die Aufnahme überall eine freundliche ist. Und damit nehmen wir für heute Abschied von den Bergen und wünschen sehnsuchtsvoll die Zeit herbei, die es uns möglich macht, wiederzukommen in das schöne Erzgebirge mit seinem dem Harzer gleichenden Wahrspruch:
Es grüne die Tanne, es wachse das Erz,
Gott schenke uns allen ein fröhliches Herz.
Glück auf!
Die Grenzboten, 66. Jahrg., Leipzig 1907.
Von Dr. Hans Stübler in Bautzen.
I.
Wenn man in den Herbsttagen im freundlichen Berggasthause auf dem Lilienstein Einkehr hält, vor Tau und Tage aufsteht und hinaustritt auf die kieferbewachsene Bergplatte, kann man Zeuge werden eines erhabenen Herbstschauspiels.
Soweit das Auge reicht, nichts als ein weites milchiges Nebelmeer, darüber die letzten bläulichen Schatten der Nacht, der Lilienstein eine steilgeuferte Insel, im Osten glimmt schmal der Frührotschein an der fernen Küste auf. Wir kennen uns nicht mehr aus in der Landschaft, wir werden entrückt in graue Urzeit. Wie die nebligen Wogen drunten kochen und brauen, sehen wir, wie über altes Grundgebirge, über Granite und kristallinische Schiefer, ähnlich denen im heutigen Vogtland und im Frankenwalde, das Meer vordringt, von Süddeutschland her, wie es nach kurzer Zeit, ohne dauernde Ablagerungen zu hinterlassen wie dort, zurückweicht, dann aber über Ostbayern, Böhmen, Schlesien und die Lausitz her langsam sich ausbreitet, weithin bis auf das östliche Erzgebirge ansteigend. Dies liegt als bewaldeter Landvorsprung da, Flüsse springen, mit Geröllen polternd, Kiese und Sande herabschwemmend, ins Meer. Eichenblätter, Blätter andrer Laubhölzer betten sich zwischen den Schlamm, Baumfrüchte und Holzstücke treiben hinaus ins Meer, sinken endlich ein im Grundsediment und werden zu Kohle verwandelt. An dem Fuße der Granitit-, Porphyr- und Syenitklippen des alten Festlandes haften in der Brandung Korallen, Seelilien, Austern in großen Bänken, Armfüßer, Muscheln verschiedener Art mit festen Byssusfäden. Während auf dem Grunde Sandbank auf Sandbank sich legt, alle Untiefen einebnend, schichten sich an der oft verschobenen Küste die Sandlagen diagonal. Während hier in unserer Gegend die gröberen, schwereren Kieselsedimente sich setzen, untermischt mit wenig tonigem Zement, lagern sich weiter gegen Meißen zu mehr die feineren kalkigen Niederschläge ab, die schon in der Pirnaer Gegend überwiegen. So steigen denn in jahrtausendelanger Meeresbedeckung vom Grunde aus Sandbänke bis zu 500 m Mächtigkeit heran, weithin bis nach Schlesien alles mit einer hartgepreßten Decke überziehend.
Inzwischen ist es rings um unsern Ausguck lichter geworden, das Nebelmeer des Herbstes weicht, senkt sich mit der steigenden Sonne. Sonnenvergoldet blitzt drüben die Feste Königstein hervor, Papst- und Pfaffenstein, die Bärensteine, selbst die kleine Kaiserkrone und der Zirkelstein – die ganze Tafelberglandschaft hat sich rings enthüllt und schimmert über den breiten Ebenheiten so ebenmäßig und zierlich, als hätten Kinder Sandtorten mit Blumentöpfen auf dem Gartentisch aufgebaut. Das ist die Landschaft, die den Dresdener Künstler Ludwig Richter für die ideale Kuchenberglandschaft des Schlaraffenlandes Modell stand. Aber was sagt sie uns?
Als in der jüngeren Kreidezeit die letzten Wogen des Meeres sich nach Süden und Norden verzogen hatten, lag die breite Sedimentschicht glatt und eben da, dem Spiel von Wind und Wetter preisgegeben. Es gingen nacheinander über sie hin eine Zeit subtropischen Klimas mit langen Trocken- und gewaltigen Regenzeiten, eine Zeit arktischen Eiszeitklimas, dann kontinentalen Steppenklimas in der Interglazialzeit (Zwischeneiszeit), wiederum polares Klima der zweiten Eiszeit und endlich das veränderliche Klima der Gegenwart. Diese Faktoren haben die heutige Landschaft der Sächsischen Schweiz geschaffen. Es kommen aber dazu die bodenumgestaltenden Vorgänge, die aus dem Erdinnern herauswirkten:
Dem Angriffe jener klimatischen Kräfte auf die gewaltige Kreidescholle arbeitete mit dem Beginne der Tertiärperiode eine Bewegung der Erdrinde entgegen, wie sie seit dem Oberkarbon Mitteleuropa nicht gesehen hatte. Längs gewaltigen Bruchspalten verschieben sich Keilschollen der Erde gegeneinander, hier wird eine in die Tiefe gedrückt, dort wird eine andere horstartig emporgepreßt. Dabei zerbricht die Kreidescholle, das Lausitzer Granitmassiv löst sich wie eine berstende Eisdecke im Frühjahr in Stücke auf, die sich gegeneinander stauen und stemmen. Es bildet sich jene gewaltige Lausitzer Hauptverwerfung, die heute die Ostgrenze der Sächsischen Schweiz haarscharf bezeichnet, ein blitzartiges Zickzack mit den Eckpunkten Porsberg, Dürröhrsdorf, Hohe Liebe, Zeidler, Altdaubitz.
Längs dieser Bruchspalte wurde der Sandstein von dem schräg gegen Westen aufsteigenden Granit umgepflügt, sodaß sich sein Unterstes zu oberst kehrte, sogar Ablagerungen der ersten kurzen Meeresbedeckung aus der mittleren und jüngeren Jurazeit heraufgewalzt wurden. Der Granit selbst wurde in »gneisartige, schulpige Scherben zerquetscht« und türmte mantelförmige Sandsteinberge auf, wie z. B. die Hohe Liebe, die man aus der Ferne für einen Granitberg halten könnte. Östlich dieser Linie ist heute vom Sandstein fast nichts mehr erhalten. Ebenso sank die Sandsteintafel gegen Süden staffelförmig ab, indem sich der erzgebirgische Steilabsturz bis hierher fortsetzte, wenn auch immer mehr an Sprunghöhe abnehmend; über dem abgesunkenen Sandstein aber quoll phonolithisches und basaltisches Magma auf und formte die Domvulkane des böhmischen Mittelgebirges.
Druck und Erschütterung lockerten aber auch das Gefüge des eingebetteten Sandsteindreieckes, das westlich der Hauptverwerfung liegen geblieben war. Tausende von mehr oder minder senkrechten Klüften durchsetzten und zerspellten das Gestein in 2-5 m großen Abständen. Im nördlichen Teile der Sächsischen Schweiz kreuzen sich diese Klüfte rechtwinklig einmal gegen NNO, zum andern gegen WNW zielend, im südöstlichen Teile dagegen dreht sich das Klüftungskreuz etwa 30° gegen O. Im Verein mit den schon bei der Ablagerung gebildeten Schichtfugen war damit das Quadersystem gebildet, auf das sich sowohl die formende Arbeit der Atmosphärilien bei der Herausbildung des heutigen Landschaftsbildes wie die mühevolle Kleinarbeit des Steinbrechers heutzutage gründet. Parallel mit diesen aus dem Erdinnern heraus in großen Zeiträumen und mit gewaltiger Kraftentwicklung sich abspielenden Zerbrechungen und Verschiebungen ging jene reiche vulkanische Füllungs- und Ausgleichstätigkeit, die das böhmische Mittelgebirge schuf, wie die Spitzberge der Lausitz, und auch in der stehengebliebenen Sandsteintafel Basaltstiele und -linsen emporschickte, die oft im Kanale erstickten, bisweilen aber auch durchbrechend eine kleine Quellkuppe schützend über den Sandstein legten. Der Rosenberg am südlichen Horizont, der sich in seiner Form in nichts von einem Domvulkane des Mittelgebirges unterscheidet, trägt doch nur eine 60 m dicke Basaltkappe, die dem Angriffe des Wetters die Spitze bot und breithin den mächtigen Sandsteinsockel vor Abtragung schützte. Winterberg und großer Zschirnstein z. B., die beiden höchsten Berge der Sächsischen Schweiz, stellen ebenfalls eine Bergform für sich dar, ein Sandsteinmassiv, das an Basaltstiele, die darin erstarrt waren, sich anlehnend, der Abtragung trotzte.
Die charakteristischste Bergform unserer Sandsteinschweiz sind aber ihre Tafelberge. Schon 1725 schreibt ein Chronist: »In diesem Revier, sowohl diesseits als jenseits der Elbe, gibt's mehrere wunderbare Steine und Felsen, so auf freien Feldern gerade in die Höhe steigen und der Gegend ein artiges (will sagen eigenartiges) Ansehen geben.« Diese Tafelberge rings um den Lilienstein her sind, wie ihre annähernd gleiche Höhe zeigt, Reste der einst zusammenhängenden Decke von Sandsteinbänken, Zeugenberge, wie sie der Wüstenforscher nennt. In den Wüsten finden wir auch rings um jene Zeugen ähnliche Ebenheiten wie hier, Hammada oder Sserir genannt, die der breitfegende Wüstenwind mit dem beweglichen Kieselschutt schleifend in jahrtausendelanger Arbeit glatt geweht hat.
So klingt es nicht verwunderlich, wenn der Afrikareisende Passarge beim Anblicke des Tschebtschigebirges am Benue sich in die Sächsische Schweiz versetzt fühlt, eine Gebirge, das unter einem tropischen Klima dieselben Formen erhielt. Ist da nicht der Schluß berechtigt, daß sich diese Großformen unserer Sächsischen Schweiz unter ähnlichen Bedingungen bildeten? Auf der meerentblößten, nahrungsarmen Sandsteinscholle wuchs keine schützende Urwalddecke im Tertiär empor, die heiße Sonne und die Winde der Trockenzeit konnten ihre ganze Kraft äußern wie in unsern heutigen Wüsten und ähnliche Formen schaffen. Noch einmal arbeiteten dieselben Kräfte, Insolation und Deflation (Besonnung und Windfegung), an diesem Stück Erde in der Interglazialzeit. Wir erinnern uns jetzt der prachtvollen quarzitischen und granitischen Dreikanter aus dem Pillnitzer Tännicht, die wir im Museum zu Pirna sahen, wie der Windschliffe, die wir in der Dresdner Heide und bei Tetschen fanden. Sie sind »untrügliche Beweise einstiger Deflation« oder Windfegung. Wir erinnern uns ferner an jene fast wasserlosen, den Wadis entsprechenden Trockentäler der hinteren Sächsischen Schweiz, an jene Terrassenbildungen hinter dem Prebischtor, ganz ähnlich denen, die sich heute unter dem ausgesprochenen Trockenklima des Coloradogebietes bilden, an manche Tore, Höhlen, Pilzfelsen und Wackelsteine der Sächsischen Schweiz, an Sanddünen und Lößgebiete im Norden und Süden unseres Gebietes, die ihre Entstehung den Sand- und Staubstürmen der Interglazialzeit verdanken. Sicherlich sind diese klimatischen Faktoren nicht spurlos am weichen, modellierfähigen Sandstein vorübergegangen. Aber diese Windformen blieben nicht rein erhalten.
Polares und ozeanisch-feuchtes Klima schufen die Gletscherzeiten Mitteleuropas. Die Schmelzperioden des Eises, das sich auch auf die Ebenheiten unseres Kreidegebirges gelegt hatte, brachten eine Überfülle von fließendem Wasser, d. h. bedeutender talbildender Kraft. Die Anlage zu jenem weitverzweigten Netze steilwandiger Täler, dessen Hauptader das breite kanonartige Elbtal zu unsern Füßen ist, zu dem sich seitwärts die düstern »Gründe« der Nebenflüsse öffnen, welche sich wiederum bis in ein Geäder von zuletzt kaum mannesbreiten »Schluchten« verfolgen lassen – diese Hohlformen gehen großenteils auf jene Zeit in ihrer Entstehung zurück, wenn auch die Regenzeiten des Tertiär schon manche Narbe und Wunde in den Sandsteinkörper gerissen haben mögen, wenn auch die Hauptader, der Durchbruchskanon der Elbe, präglazial (vor der Eiszeit entstanden) sein mag. Die Tätigkeit des fließenden Wassers schloß sich jenen beiden Kluftsystemen eng an, der Lauf der kleinen Gewässer ist noch heute, wie ein Blick auf die Spezialkarte lehrt, vollkommen von ihnen abhängig, und selbst größere passen sich streckenweise den gegebenen Klüften an, wenn auch ihre gesteigerte Stoßkraft anderswo eigene Wege bahnte. Sogar den Lauf der Elbe im Sandsteingebiete könnte man als bezeichnend für jene Kluftrichtungen ansehen. So entstehen die klammartigen Täler, die die Ebenheiten begrenzen und dem Verkehr von einer zur andern schwer überbrückbare Hindernisse schufen. Die Wasser- und Regenfülle wirkt aber überall abrundend durch die Verwitterung und Kleinerosion. Die scharfen Kanten der Ebenheiten zersägt sie entlang den Klüften in fransenartige Hörner oder Vorgebirge, diese wieder in Säulen oder Monolithe, die die Talwände flankieren und oft geradezu Spalier bilden. Seitlich werden die Wände und Säulen weniger angegriffen, nur die Schichtfugen werden ausgewetzt und treten überall deutlich hervor, sodaß die Säule wie aus Quadern aufgetürmt erscheint. Desto deutlicher arbeitet der Regen an der obersten Quaderreihe, an der Gipfelbank, das zusammengeflossene Wasser am Fuße der Wände.
Zunächst wird überall die obere scharfe Kante der Wand abgeschliffen zu einem rundlichen Wulst, der bald überall da, wo ihn eine Kluft anschneidet, durch Erosionskerben in eine Reihe backofenähnlicher Buckel zerlegt wird. Gute Beispiele dazu bieten östlich von unserm Standpunkte die Ochelwände. Da sich auch längs der parallel zur Talwand streichenden Kluft eine Abrundung geltend macht, entsteht eine Reihe von Glockengipfeln. Auf diesen furcht nach und nach das abfließende Regenwasser seine Rillen, in denen sich fein verteiltes Erdreich besonders nach der Schneeschmelze sammelt, Lebensboden genug, um sie alsbald durch einen Mooswulst zu markieren. Dieser hält das Wasser fest, durchsetzt das benachbarte Gestein mit Humussäuren, lockert auch mechanisch mit seinen Würzelchen des Gefüge der Kieselkörnchen und vertieft so die Rille. Auch Ungleichheiten im Korn des Gesteins machen sich geltend: Ein größeres Quarzsteinchen, eine knollige Eisenkonkretion wird durch die Abrundung bloßgelegt und wirkt nun als Deckstein für alles, was vor und unter ihm liegt. Nach und nach modelliert das abfließende Wasser eine kleine Pyramide aus dem Glockengipfel heraus. Endlich saugt wohl auch eine Stelle schlechtverkitteten Gesteins das Regenwasser ein, Feuchtwerden und Verdunsten, Frieren und Wiederauftauen lockern das lose Gefüge, der Wind in der Höhe entführt die abgebröckelten Körnchen, der Schnee hält sich länger über der Stelle – endlich ist eine Grube ausgehöhlt, in der sich das Regenwasser sammelt, dessen Überfluß sich ringsum lange Traufrinnen ausnagt. Das Ergebnis aller dieser sehr langsam sich vollziehenden Vorgänge ist zuletzt die Umwandlung des rundlichen Glockengipfels in den stumpfzackigen Kronengipfel, einer im Schrammsteingebiete ziemlich häufigen Form.
Der Verwitterung und Erosion fallen schließlich auch die Kronenzacken zum Opfer, ihre Decksteinchen und harten Spitzen schwinden, neue Hindernisse des Wasserablaufs schaffen neue Pyramiden. Endlich ist von der ganzen Gipfelbank nur noch ein plattes Scheibchen übrig, die harte Grundschicht. Sie bröckelt am Rande immer mehr ab, sodaß sie den darunter liegenden Quader nicht mehr deckt. Dieser tritt nun schon wieder ins erste Stadium der Abtragung und rundet sich zum Glockengipfel. Damit ist jene Form geschaffen, der der Volksmund den anschaulichen Namen »Habersäcke« gibt. Je mehr das deckende Schildgipfelchen an Umfang verliert, je mehr sich in der ausgeweiteten Schichtfuge Humus sammelt, desto eher wird es abgelöst. Ein Krönchen Heidekraut kränzt das Steinchen, der Wind bringt einmal einen Flügelsamen herbei, bald wächst eine Kiefer unter dem Scheibchen hervor, deren eindringende Pfahlwurzel das Deckelchen ganz absprengt, bis es über die glockige Unterbank zum Tale gleitet. Auf dieser beginnt nun das Spiel von neuem: vom Quader zur Glocke, zum Kronen-, zum Schildgipfel. Auch an den Rändern der Tafelberge bilden sich ähnliche Formen heraus, doch bewirken hier, gewöhnlich 100-200 m höher, die stärkere Sonnenstrahlung, das kräftigere Windgebläse, der Spaltenfrost meist klüftigere und zackigere Formen, wie wir sie am Liliensteine besonders gut beobachten können.
Unten am Fuße der Wände wirkt das gesammelte Wasser in verschiedener Weise: als fließende, verfrachtende Kraft, indem es die Schutthalde, die sich durch die Abtragung von oben bildet, aufräumt, als ausnagende Kraft, indem es in stetiger unendlich langsamer Arbeit eine Quadersäule unterminiert und zuletzt zum Absturz bringt. Sie legt sich oft schräg an eine der Schluchtwände, oder sie zerbricht in Trümmer, die den schmalen Talboden bedecken und erst in jahrhundertelanger Arbeit Korn für Korn vom fließendem Wasser, vom Tau, vom Pflanzenleben aufgearbeitet werden. Bisweilen bleibt in enger Schlucht ein abstürzendes Trumm zwischen den Wänden klemmen, wie z. B. bei dem bekannten Uttewalder Tor. An den Wänden der Tafelberge fehlt diese aufräumende und zerstörende Wasserkraft, ihr Fuß ist deshalb eingebettet in eine Sandhalde, deren weiche Linie absticht von dem schroffen Abfall der Steinwand. Aber auch hier gibt es Felsstürze, zumeist bewirkt durch Sprengeis in Spalten. Die Trümmer graben sich tief in die weiche Halde ein, und so entstehen auch an den Bergen unserer Sächsischen Schweiz moos- und farnüberwucherte »Felsenmeere«, die für unsere deutschen Mittelgebirge so charakteristisch sind.
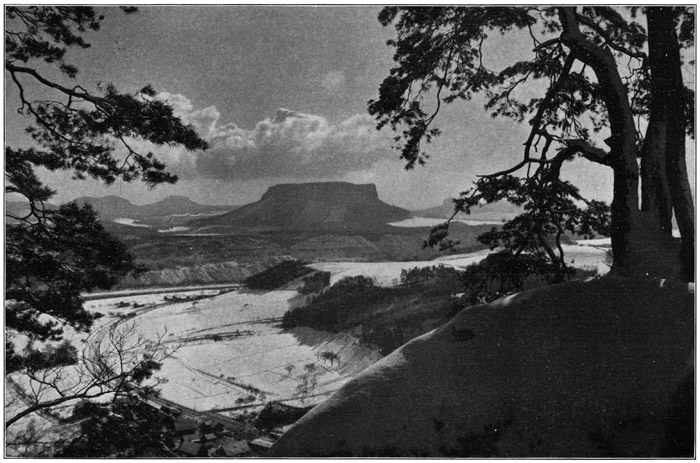
Aus der Sächsischen Schweiz. (
Der Lilienstein von der Bastei aus gesehen.) Nach einer Photographie von J. Ostermaier, Dresden.
Große klimatische Gegensätze schufen, wie wir sahen, die Architektur der Sächsischen Schweiz. Unter dem abgeglichenen, wenig gegensätzlichen Klima der Jetztzeit bildete sich auch eine Ornamentik im Sandsteine aus. Das atmosphärische Wasser dringt auch außerhalb der Klüfte in den porösen Sandstein ein. Das Sickerwasser wirkt bald auflösend auf das Bindemittel der Quarzkörnchen, bald auch absetzend und bindend. Auf diese Weise entstehen seitlich an den Wänden bald dicke Sickerleisten von Eisenoxyd oder gar ganze Wandpanzerungen, bald auch tiefe Schichthöhlen, oder auch Klufthöhlen. Wir denken dabei z. B. an den Diebskeller am Quirl oder an die Femhöhle unterhalb der Bastei. Besonders auffällig ist die sonst nur im Wüstensandstein beobachtete Wabenstruktur, bald flachschüsselig, bald halbkugelig, bald wie das Netzwerk eines Schwammes, bald fast wie das feinste gotische Maßwerk. Neben der Sickerung, die Eisenoxyd, Kieselsäure, Kalk ungleich im Gestein verteilt, wirken bei ihrer Bildung verschiedene andere Ursachen mit, z. B. Nebelbeschlag und Rauhfrost, Regenprall und Windstoß, kreisförmig ausgebreitete Flechtenkolonien, denen bald hartwurzelige, tiefbohrende Farne, besonders Polypodium- und Adiantumarten folgen. Im Winter hängen sich an ihre welken Wedelbärte gewaltige, schwere Eiszapfen, oft von Eisenoxyd rot gefärbt, deren Gewicht den Büschel herauszieht samt allem an den Wurzeln haftenden gelockerten Gestein. Das Studium dieser für unser Insekten- und Vogelleben nicht unwichtigen Kleinformen würde aber eine Arbeit für sich bedeuten.
II.
Langsam, stückweise, deshalb für unsere, den ursächlichen Zusammenhängen nachgehende Betrachtung recht geeignet, enthüllten sich uns die Bodenformen der Sächsischen Schweiz aus dem Nebelmeer des Herbstes; erst ein urzeitlicher Anblick: Meer, Fels und Himmel, dann die Felsformen im ersten Morgenlicht, Voll- und Hohlformen. Aber der Fels ist lebensfeindlich in jeder Form, erst wenn ihn die Verwitterung in Schutt verwandelt hat, trägt er ein Pflanzenleben, damit ein Tierleben, und beides lockt den Menschen an. So erwachte auch stückweise unter uns das Leben in dieser Landschaft: wir hörten es erst nur, ein Dohlenschrei aus der Tiefe, ein Rotschwänzchenzwitschern im Geklüfte, dann teilte, schon sichtbar, ein Turmfalke mit schwebenden Schwingen das brodelnde Gewog, dann stieg eine dunkle Rauchwolke im weißen Nebel auf, die Schlepperkette rasselte, Dampfpfeifen schrillten, die Dampfsägen kreischten, der Schnellzug rollte donnernd durchs Tal, endlich der Klang der Morgenglocken vom Königsteiner Turm, herauf sich schwingend wie aus der versunkenen Vineta – und jetzt »ein Riß im neblichten Meer«, und die »Stätte der Menschen« wird sichtbar. Je heller und sonnenklarer die Landschaft wird, desto mehr Spuren menschlichen Lebens entdeckt unser Blick überall, selbst dort, wo die Berge blau in der Luft verschwimmen, hebt sich inmitten eines buntgestickten Felderteppichs oder einer Waldblöße das rote Dach einer menschlichen Siedelung heraus. Das bringt uns gebieterisch die Forderung nahe, nicht über dem Sehnen und Denken des fast verlorenen Paradieses der Naturlandschaft zu vergessen, daß das Menschenleben diese Gegend wie alle andern im alten Mitteleuropa beherrscht, daß auch die Sächsische Schweiz Kulturlandschaft ist, daß der Mensch ihr seine Lebensformen aufgeprägt hat – oder wie sich ein moderner Dichter drastisch ausdrückt, daß der Mensch auch dieses Stück Erde – »heruntergewohnt« hat.
Doch hat unsere Gegend mit dem Erzgebirge und dem Lausitzer Bergland den Vorzug genossen, ziemlich spät vom Menschen besetzt worden zu sein, da sie mit jenen Landschaften zusammen den breiten Grenzwald bildete, der einst die Menschen der böhmischen Tieflandgaue von denen der nördlichen sächsischen schied. Die Sächsische Schweiz wirkte außerdem durch ihre Unwegsamkeit länger und sicherer trennend, auch zwischen West und Ost; der Landverkehr zwischen Nord und Süd war lange Zeit zur Umgehung des klüftigen, verkehrsfeindlichen Sandsteingebietes gezwungen und tastete sich an der Lausitzer Granitgrenze zuerst, dann auch an der erzgebirgischen Seite auf den Wasserscheiden der nach Norden abfließenden Gebirgsbäche hin. Der Wasserpaß der Elbe, der heute den Hauptverkehrsweg im Elbsandsteingebirge darstellt, war für eine primitive Schiffahrt nur schwer benutzbar. Denn Stromschnellen und Schotterheger, besonders aber der Wasserfall bei Niedergrund, Klippen, die von Felsstürzen herrührten, wurden dem Schiffer gefährlich, und außerdem waren die zeitraubenden Umwege hinderlich. Gerade zu unsern Füßen zieht die Elbe durch zwei große Krümmen, die einen Umweg von 100 % bedeuten, und der ganze Stromweg von Pirna bis Aussig ist wegen der östlichen Ausbiegung gerade noch einmal so lang als der Landweg über den Nollendorfer Paß. Nur ein so billiges Verkehrsmittel wie die Schiffahrt oder ein so schnelläufiges wie die Eisenbahn (seit 1852) nimmt solche Umwege ohne Nachteil, wenn sonst günstige Bedingungen eines glatten Verkehrs geschaffen sind. Noch heute führt keine durchgehende Fahrstraße längs der Elbufer nach Böhmen hinein. Ähnlich ungünstig für den Verkehr waren die Nebentäler; die des Lausitzer Flügels öffneten sich mit vorwiegend ostwestlicher Richtung nur dem Verkehr von der Lausitz zur Elbe, der erzgebirgische Flügel aber schnitt die Verfolgung dieser Richtung ab mit seinen südnördlichen Wasserläufen und zwischenliegenden Ebenheiten, war aber für die Hauptverkehrsrichtung zugänglicher mit Ausnahme des Südabbruchs gegen Böhmen.
Daher wanderte auch der Mensch in unser Vaterland nicht von Süden her, sondern von Westen ein, nachweislich in der jüngeren Steinzeit. Gegen das Elbsandsteingebirge dringt er aber nur bis in die Gegend von Niedersedlitz vor. In der folgenden Bronzezeit aber wagt er mit metallenen Werkzeugen und Waffen schon einen Vorstoß gegen die südliche Waldschranke, besiedelt bereits die Ebenheitsränder um Pirna-Copitz und gelangt sogar bis auf den genau südlich von unserm Standpunkte gelegenen Pfaffenstein. Steinwallbefestigung am Zugang zum Bergplateau, Mahlsteine aus fremdem Material, Getreidereste, Feuerstätten weisen darauf hin, daß diese menschliche Raststatt in der Grenzwildnis wahrscheinlich eine Zufluchtssiedelung war, ähnlich jener Anlage auf dem verwandten Oybin der Lausitz. Oder sollte, entsprechend der Überlieferung und dem Namen, hier eine religiöse Kultstätte gewesen sein? Das Fehlen von Knochen jeder Art spricht dagegen, die geschichtliche Entwickelung für die Deutung als Schutz- und Trutzsiedelung. Die Tafelberge mit ihren unersteiglichen, mauerartigen Abhängen luden ja geradezu zu derartigen Anlagen ein. Der Waldmantel der Gebirge, der sich auch über die Sächsische Schweiz ausgedehnt hatte auf dem Schuttboden der Eiszeitgletscher, bot immer Flüchtlingen und Ausgestoßenen Bergung, hier gab auch das zerklüftete Gestein Gelegenheit zu Unterschlupf und Schutzsiedelung aller Art, am sichersten auf den Tafelbergen, dann auch auf vorspringenden Hörnern der Ebenheiten, auch in Schluchten und Höhlen. Übte doch das Gelände auf alles Leben einen schützenden Einfluß: aus den tropischen Regenwäldern des Tertiär rettete es im Uttewalder Grunde einen zarten Hautfarn auf die Gegenwart, aus der Eiszeit die Viola biflora z. B.; hier allein nistet der unstete Falco peregrinus noch und auch der bunte, sonst nur alpine Mauerläufer. Bis tief ins 18. Jahrhundert hielten sich Bär, Luchs und Wolf hier im Geklüfte. So bot auch dem Menschen das naturbefestigte Ländchen seinen Schutz an. Namen wie Windisch-Kamnitz, Wendisch-Fähre, Windisch-Heynirsdorf (für Kleinhennersdorf), Bogansdorf (= Papstdorf), Wünschendorf (der Windischen Dorf) weisen darauf hin, daß vor dem Vorstoß des germanischen Elements gegen die sorbischen Fluß- und Tieflandsgaue »windische« Waldsiedler ihr Volkstum und ihren Glauben hierher retteten. Ruinen und Spuren menschlicher Tätigkeit in Inschriften und Jahreszahlen findet man überall in dem versteckreichen Gebirge. Burgruinen sind am häufigsten längs den beiden Randstraßen und dem Elbwege, besonders aber in dem Winkel der hinteren Sächsischen Schweiz mit ihren tiefen Hohlwegen nachzuweisen. Im 14./15. Jahrhundert war hier ein Raubritterparadies, fast jeder sichere »Stein« und »Berg« trug ein Raubschloß, sodaß man die Felsen dieser Gegend noch im 18. Jahrhunderte in genere Raubschlösser nannte. In allen Kriegsfährden erstanden vorübergehende Flüchtlingssiedelungen bis herab auf 1813, Lausitzer Landvolk flüchtete stets in die von Natur sicheren Ortschaften der Sächsischen Schweiz. Die Burgen aber, jene dauernderen Schutz- und Trutzsiedelungen, wurden an Zahl seltener, dafür in steigender Anpassung an die vervollkommneten Machtmittel stärker. Der Festungsbaumeister verstärkte durch seine Kunst die natürliche Gunst der Schutzlage, wozu sich an Ort und Stelle das vorzüglichste Steinmaterial fand. Drüben der Königstein zeigt, wie dieses Werk bis auf die Gegenwart fortgesetzt wurde, er ist der einzige übriggebliebene und weiterentwickelte Typus der Schutzsiedelungen, er verdankt das seiner günstigen Paßlage, wie auch der Nähe der Residenz mit ihren Schätzen. Die Stadt- und Straßburgen Sonnenstein, Hohnstein, Tetschen zeigten sich 1813 noch einmal als Trutzsiedelungen, castrum Rathen und Wilin liegen seit dem 15. Jahrhundert schon in Trümmern, das Wachthaus auf dem Ylgenstein ist seit dem Ausgang des Mittelalters bis auf die Grundmauern verfallen, und von dem altbischöflichen castrum Libental hoch über der Wesenitz ist sogar der Grund und Boden, der es trug, durch die Arbeit der Steinbrecher verschwunden. Diese Entwickelungsreihe veranschaulicht deutlich das Absterben dieser Siedelungsart gegen unser Zeitalter gewaltig gewappneten Friedens hin. Die Entdeckung der lebenschützenden Eigenschaften des Elbsandsteingebirges führte also seit frühester Zeit zu Schutz- und Trutzsiedelungen verschiedener Art an einer großen Anzahl einzelner wohlgeborgener Orte. Als im Siebenjährigen Kriege und nachmals 1813 der Versuch gemacht wurde, die Schutzlage als allgemeine Eigenschaft des ganzen festungsartigen Tafellandes zu Verteidigungsstellungen zu benutzen, da scheiterten die Versuche an der Unfruchtbarkeit des Bodens wie besonders an der räumlichen Enge des Gebiets, das leicht zu zernieren war.
Im benachbarten Erzgebirge führte die Entdeckung und Ausbeutung der Bodenschätze zur Anlage dauernder Siedelungen, zu Erwerbs- oder Nutzsiedelungen. Hier lockten wenig Güter des Bodens an. Ein bronzezeitlicher Angelhaken aus einem Copitzer Grabfund, der im Dresdener prähistorischen Museum verwahrt wird, deutet uns hier den Anfang der Entwickelung an. Denn die sicheren, bergklaren Gewässer der Sächsischen Schweiz waren die Laichgründe einwandernder Lachse und Lampreten. Polenz und Sebnitz hießen vor 200 Jahren noch die Lachsbäche, und noch heute haftet der Name auf dem Unterlauf; die Forstordnungen Vater Augusts zählen dazu eine ganze Anzahl »Forenbäche« auf. Die slawischen Namen der Gewässer und der meisten anliegenden Talsiedelungen sprechen ebenfalls dafür, daß wendische Fischer, wie unten im Niederlande, den Laichzügen der Fische folgend, die ersten Keime zu den zahlreichen Talorten legten. Das Eindringen in die Gewässerbahnen auf dem primitiven Einbaum führte aber zugleich zur Entdeckung der Elbe als Weg, zuletzt als Durchgangsweg durch den breiten Grenzwald. Dauernde Fischersiedelungen mußten schon mit Nahrung vom Niederlande oder Nisangau her versorgt werden, es mußte ein primitiver Elbhandel entstehen, der Fische gegen Brotfrucht tauschte. Für diesen Verkehr mußten Raststätten und Landeplätze geschaffen werden, Siedelungen, die schon fester im Boden wurzelten, als die oft nur Sommers bewohnten Fischerweiler. Bei der Spärlichkeit des Siedelungsraumes am Strome und bei der Gleichheit der Voraussetzungen fanden sicher Verschmelzungen zu Fischer-Schiffersiedelungen statt. Ihre Form war durch das Tal genau vorgeschrieben: einfache Aneinanderreihung von Haus an Haus, nahe genug dem erwerbbietenden Strome, zugleich fern genug seinem Hochwasser, das hier im engen Tale mit konzentrierter Kraft zerstörte – wo Platz war, eine hakige Abbiegung des Zeilendorfes in eine Seitenschlucht. Das ist die Grundform aller Talsiedelungen in der Sächsischen Schweiz. Die Handels- und Verkehrsbedeutung der Elborte mußte wachsen, als auf den Ebenheiten die deutschen Rodedörfer entstanden, die die eiszeitlichen Schuttinseln vom Walde befreiten und zu Kulturland machten im 12. und 13. Jahrhundert. Sie bildeten das verbrauchende Hinterland für die Elbhandelsplätze. Je weitere Fäden der Verkehr spann, desto mehr mußte der Elbweg gewinnen, wegen seiner Richtung auf die Nordsee und gegen die Donauländer. Die Hemmung des Landverkehrs am Ein- und Austritt der Elbe im Sandsteinkañon schuf die deutschen Kolonialstädte Tetschen und Pirna, bequeme Zollstätten und noch heute Umschlagsplätze des Verkehrs. Die Gleichheit der Anlage ist die Wirkung der Gleichheit der Entstehungs- und Lebensbedingungen. Gesteigerte Bedürfnisse der sich verdichtenden Bevölkerung schufen wie anderwärts so auch innerhalb der Elborte eine Teilung in bestimmte Gewerbsviertel und Gewerbsgassen. Vlamische »Wullwewer« setzten die Keime zu späterer Textilindustrie aller Art: Der Flachsbau brachte für Jahrhunderte die Leineweberei von der Lausitz her, sodaß Wehlen z. B. 1802 noch vorwiegend Leinweberstädtchen war. Die englische Baumwollenmanufaktur verdrängte von Pirna aus jenes alte Gewerbe. Der Hopfenbau, der in den nebelfeuchten Tälern noch heute nicht ausgestorben ist, führte im Verein mit den überall vorhandenen Felsenkellern zum Braugewerbe, sodaß bald die Hopfeneinfuhr aus dem Leitmeritzer Gau herangezogen werden mußte. Königstein hatte sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer Bierstadt ersten Ranges aufgeschwungen, die in der Residenz ihr bestes Absatzgebiet fand. Der Elbhandel blieb für die Talsiedelungen die »anima«, wie der Chronist schreibt. Auch die kleineren Orte erkämpften sich Stadtrechte gegen Pirna und Tetschen. Schandau wurde 1479 Stadt und blühte auf als Getreidestapel für die Herrschaften Hainspach und Schluckenau, deren »kalter und leimichter Boden« nicht genügende Erträge lieferte. Selbst Krippen hatte einmal kurze Zeit sich Marktrechte erkämpft. Königstein-Rathen betrieben seit dem Anfang des 18. Jahrhunderts die Flußreederei im Dienste der Meißner Kaufmannschaft im Großen, ihre »fichtenen Pferde« gingen bis zur »Hamonsburg«, aufwärts bis Labeschitz oder Lobositz. Durch Zollkriege und Stromzölle sank zwar dieser Hauptnahrungszweig der Elborte bis 1866, aber seitdem hat er wiederum einen gewaltigen Aufschwung genommen: Schiffsbau, Holzschneiderei, Ankerschmiederei usw., alles greift dermaßen organisch ineinander, daß es schwer wird, davon eine Schilderung zu geben. Besonders ergänzen sich Schiffahrt und die eigentliche, aber verhältnismäßig junge Sächsische Schweiz-Industrie, die Steinbrecherei. Zur Ausfuhr wird der Sandstein, wahrscheinlich aber nur als Mühlstein, nicht als Baustein schon 1325 gebracht. Erst 1609 macht sich die erste staatliche »Bergkordnung« nötig, und unter August dem Starken steigt die Sandsteinindustrie immer weiter im Elbtal aufwärts bis zu den Postelwitz-Schönaer Brüchen hinauf, die Landschaft an Naturformen beraubend, an Farben und Kulturformen bereichernd: die gelblichweißen bis -roten Wände mit dem zu Fall gebrachten Trümmergestein, darunter die gewaltigen Schutthalden, deren schiefe Ebene ausgenutzt wird zum Transport der Steine an das am Stromufer verankerte Schiff, mit den Wendelwegen und Treppensteigen, die zu den mehr oder weniger kunstlosen Steinbrecherkantinen führen usw.
In den Gründen, den Nebentälern war nur Platz für Einzelhöfe, die die Wasserkräfte in Arbeit umsetzen wollten. Heut sind die malerischen Mahlmühlen und Bretmühlen meist verwandelt in Holzstoffabriken und Steinschneide- und Steindrechselwerke, wo die Wasserkraft ausreicht wie im Wesenitz- und Gottleubatal. Die alten Hämmer, die Erze des östlichen Erzgebirgs pochten oder wohl gar den Brauneisenstein der Sächsischen Schweiz, die Hütten, die die zerpochten Erze schmolzen, sind nach oft mannigfaltigem Betriebswechsel schließlich zu Ackerbausiedelungen oder zu Industriesiedelungen geworden. Die Wasserkräfte nutzt man allenthalben in Elektrizitätswerken, die teils Licht, teils Kraft für die Überwindung der Verkehrshindernisse oder für mannigfaltige Industrien liefern müssen (vgl. Gießhüblichen, Kleingießhübel und die Hammergüter im Bielatal, den Ortsteil Hütten bei Königstein).
Auf den Ebenheiten endlich entwickelten sich Ackerbausiedelungen. Schon die Sorben hatten solche auf der Copitzer und Pirnaer Ebenheit: der Rundling Goes, das Straßendorf Doberzeit zeigen das deutlich genug. Doch erst der deutsche Kolonist im 12. und 13. Jahrhundert nahm die Rodung zu Kulturland energisch in die Hand, in drei Angriffslinien ging er vor, von den beiden Randstraßen aus und von der Elbe her: Die Namenreihe Lichtenhain im Osten, Altendorf in der Nähe der Elbe und Mittelndorf dazwischen ist dafür bezeichnend. Wie in den Tälern durch den Mangel an Siedelungsboden der Zug des Räumlich-beengten sich den Ortschaften aufprägte, so auch auf den breiten und geräumigen Ebenheiten. Das breitspurige und weitläufige germanische Reihendorf, das für die flachen Muldentäler des Mittelgebirges berechnet war, mußte hier abgeändert werden. Die räumlich beschränkte Schuttinsel glazialen Lehms mußte als Ackerboden ausgespart werden.
Der Wassermangel auf den Ebenheiten zwang die Siedler, sich hart an dem Ebenheitsrand anzubauen, oft hufeisenförmig um eine Erosionskerbe, in der ein Steig hinab zum Bache führte. Andere Dörfer bauten sich am Fuße der Tafelberge an, wo manchmal Quellen auf tonigen Schichten austraten, wie auf der Rosenbergebenheit und auch hier am Lilienstein bei Ebenheit und Waltersdorf deutlich zu sehen ist. Diese teils von meißnischen, teils von böhmischen Herren, von den Birken von Dauba, von den Burggrafen von Dohna, von den Wartenbergern auf Tetschen ausgesetzten Kolonistendörfer waren mit der Zeit wegen der quantitativen Beschränktheit und qualitativen Minderwertigkeit des Bodens gezwungen, sich andere Lebensadern zu erschließen als den Ackerbau. Lange Zeit hat die Leinweberei von der Lausitz her Ersatz geschafft, die Schafzucht auf den Hochflächen sollte wie im Tafellande Spanien nach dem wirtschaftlichen Niedergange in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts einen Aufschwung bringen, einzelne Orte machten Bergbauversuche, die wenigstens zur Ausbeutung jener Kalkreste der Jurazeit führten, der Wald führte zur Bienenzucht auf den Zeidelweiden (Dorf Zeidler), zu Picherkolonien (Elbleiten), zur Flößerei auf den leicht staubaren Nebenflüssen, zur Holzindustrie, die noch heute in Lichtenhain und Daubitz blüht. Ganz bodenfremd ist die neuerdings von Böhmen her eingeführte, jetzt bis Schandau hin von der Zentrale Sebnitz ausgebreitete Fabrikation künstlicher Blumen, es vollzieht sich hier derselbe Vorgang wie auf den Höhen des Erzgebirges.
Die größte Umgestaltung aller Siedelungen der Sächsischen Schweiz, sowie die Anlage einer Menge neuer bewirkte aber die Entdeckung der Naturschönheit dieses Ländchens vor reichlich 100 Jahren und der dadurch herbeigezogene Fremdenverkehr, der teils Touristen-, teils Kurverkehr ist. Der reiche Wechsel der Formen bei aller Einheit des Stoffs, die durch diese Formen bedingte eigenartige Lichtverteilung, die die engen, kellerfeuchten Täler in Schatten hüllt und mit Schattenpflanzen füllt, auf den heideartig trockenen Ebenheiten aber eine blendende Lichtfülle verstreut, die die aufragenden Felsen morgens und abends einseitig rosig anglüht und auf der andern Seite blaue Schatten wirft – das alles bot und bietet dem in der Stadtkultur verarmten Auge und der Phantasie reiche Anregung und Genuß und erzeugt einen angenehmen Wechsel der Stimmung, wenn man aus der Gründe quetschender Enge, aus der Schluchten düsterer Nacht plötzlich herauf ans Licht wird gebracht.
Auf dem Liliensteine steht ein Denkmal zur Erinnerung an die Besteigung unseres Berges durch August den Starken 1708, sie ward rein zur Ergötzung unternommen. Schon um 1750 hört man von fremden »Passagiers«, und seit Maler und Zeichner, seit auch Schriftsteller, angeregt durch Rousseaus Alpenschilderungen, hier eine zweite »Schweiz« zu finden glaubten, indem »sie sich alles vergrößert dachten«, seitdem zog jeden Sommer ein immer stärkerer Schwarm naturhungriger Städter in die Sächsische Schweiz. Schandau errichtete, um den Menschenstrom zu halten, 1799 ein »mineralisches Gesundheitsbad« nach dem Vorbilde Tharandts und Berggießhübels, es hatte 1899-4021 Badegäste. 1836 folgte die Verwandlung der Oberhütten im Bielatal in Bad Schweizermühle. Gasthäuser wuchsen allerorten empor: 1739 hatte Schandau, 1755 Königstein noch keinen öffentlichen Gasthof, heute haben sie hochstöckige städtische Gasthausfronten. Ebenso wurden die sonntagsstillen abgeschiedenen Mühlen zu Hotels, und ganz neue Siedelungen entstanden auf den Tafelbergen und aussichtsreichen Ebenheithörnern, von denen die Bastei, auch der Brand, schon einen kleinen Weiler trägt. Die Ebenheitdörfer, deren Ackerbau unter dem Wildschaden litt, eine Folge ihrer zentralen Waldlage – sie wurden eben darum zu Luftkurorten, Sommerfrischen und Villenkolonien. Das beste Beispiel hierfür ist Gorisch.
Die Steigerung der Bevölkerung führte zu einer Ausbreitung der Siedelungen, die Naturfesseln, unter denen sie bisher gestanden hatten, mußten gesprengt werden. Schon früher hatte man die Raumenge durch die Streusiedelung zu überwinden gesucht. Wo irgend in der Nähe eines Ortes ein Plätzchen sich bot, entstand ein Ableger, eine »Folge«, ein Weg führte dahin wie der Ausläufer zum Neutrieb einer Walderdbeere. Drunten das Städtchen Königstein ist ein gutes Beispiel dafür, aber auch Hinterhermsdorf mit seinen zahlreichen Räumichthöfen ringsum. Auch der Hausbau im einzelnen zeigte das Streben nach Raumgewinnung, ähnlich wie in alten Festungsstädten, die durch Ringmauern eingeengt waren. Aus dem Mittelgebirge übernahm man das Ganghaus, dessen erster Stock überhing, von dem in Postelwitz noch einige prächtige Exemplare erhalten sind. In Schmilka aber überbaute man sogar die Wege, und es entstand eine Art Brückenhaus. Jetzt hat der städtische Hochbau Platz geschaffen, Kaimauern rangen dem Ufer neuen Baugrund ab. An den Bergstraßen und Halden wird durch Futtermauern, die treppenartige Terrassen stützen, dasselbe erreicht, Felssprengungen beseitigen alle Hindernisse. Nur die großen Bruchhalden, deren Abräumung vorläufig nicht lohnend zu bewerkstelligen ist, rauben hier und da noch Siedelungsraum.
Von Dr. Hans Stübler, Bautzen.
Die Lausitz ist unter den deutschen Mittelgebirgslandschaften nicht gerade wegen ihrer Schönheit bekannt und besucht. Professor Beyer, der ein hübsches Buch von der Oberlausitz mit herausgegeben hat Beyer, Förster, März – Die Oberlausitz – Meißen. H. W. Schlimpert, 1906., verglich sie einmal mit einer Dorfschönen, deren Reize nicht alle Welt anlocken, wie die der koketten Weltdame, zu der man aber, wenn man sie erst kennen und lieben lernte, gerne zu dauerndem Aufenthalte zurückkehre, während jene nur für kurze Zeit zu fesseln vermöge.
Die Schönheit einer Landschaft wird noch viel zu häufig nach ihren Schönheiten bewertet, wieviel romantische oder historische Absonderlichkeiten, wieviel aussichtsreiche Berge mit Türmen und Gasthäusern sie hat, während man doch versuchen sollte, Schönheit auch hier als Eigenart zu begreifen.
Jede Landschaft besteht aus Himmel und Erde. Das scheint ein Gemeinplatz zu sein. Es liegt aber darin ausgesprochen, daß sie ein Erzeugnis ist der bildenden und zerstörenden Kräfte von oben und von unten, und daß jede Landschafts schilderung die Erscheinungsfülle einer Landschaft aus diesem Kräftespiel heraus zu erklären und darzustellen hat, daß sie somit oft kleine, unansehnliche Züge der Landschaft hervorhebt, weil sie als Zeugen des Werdens der Gesamtlandschaft wichtiger sind als die bekannten, vielgenannten, vielbesuchten Schönheiten.
Die Eigenart einer Landschaft geht einem um so leichter auf, wenn man anders geartete Landschaften kennt und zum Vergleiche heranziehen kann. So richtig das Wort ist: Wer die Heimat nicht kennt, die er sieht, wie will er die Fremde verstehen, die er nicht sieht?, ebenso richtig ist es auch, daß sich erst in der Fremde der Blick schärft für die Besonderheit der Heimat. Es liegt auf der Hand, daß die Juralandschaften Süddeutschlands, die triassischen Landschaften Thüringens usw. ein anderes Gepräge tragen, als die wesentlich granitische Lausitz denn hier ist zwar der »Himmelsstrich« fast derselbe, aber nicht der »Erdboden«. Aber auch bei der Betrachtung ähnlich gebauter Landschaften, wie der Granitlandschaften des Fichtelgebirges oder des Riesengebirges ergeben sich für die Einschätzung der Eigenart der Lausitzer Granitlandschaft treffliche Gesichtspunkte, weil hier der Blick geschult wird für die feineren Formunterschiede der Granitlandschaft, die bald auf der Verschiedenheit des Baumaterials (denn es gibt fein- und grobkörnigen, dünnplattigen und klotzigen Granit), bald auf der Verschiedenheit der auflösenden und ausnagenden Tätigkeit des atmosphärischen Wassers beruhen.
I.
Wenn wir im Winter etwa von der Höhe des Valtenbergturmes Berg und Tal der Lausitz überblicken, dann trägt sie durch die weiße Schneedecke, die alles zudeckt, sodaß selbst die schwarzen Fichtenwälder der Berge nicht mehr gegen die hellen Felder und Wiesen abstechen, sodaß auch die zahlreichen Ansiedlungen in den Tälern für das Auge fast verschwinden, einen einheitlichen Zug, der zu der Buntheit der Sommerpracht den schärfsten Gegensatz bildet. Bei aller Eintönigkeit liegt doch Größe in dieser weißen Decke, die alle Unterschiede der Farben und bis zu einem gewissen Grade auch der Formen unserer Landschaft verwischt. Es ist deshalb dem Geiste gerade im Winter am leichtesten, sich einmal das grüne Lebenskleid der Landschaft hinwegzudenken, sich hinwegzudenken auch all die Dörfer, Städte, Menschen, und sich den nackten Boden, den Erdboden, vorzustellen, wie er einmal in grauester Urzeit aussah, da noch kein Moos den Felsen kleidete, da noch kein Baum grünte, da noch keines Tieres Laut über die Erde klang, geschweige denn ein Menschenwort.
Wenn wir diesen Denkvorgang einmal an der Lausitzer Landschaft vollziehen, da bleibt zuletzt ein grauweißer Felsboden übrig, der nur hier und da von weißen Tonen und gelblichen Sanden, von gelbem, zähem Lehm und Kies überdeckt, an wenigen Stellen nur von schwarzen Felsen abgelöst wird, besonders im Süden. Der grauweiße Felsboden aber ist Granit. Der Granit gibt der Lausitzer Landschaft den wesentlichsten Zug; wo wir nur gehen und stehen, wo wir auch durch Kiese, Lehme, Tone, Sande hindurchbohren, überall stoßen wir auf jene uralte Lava, die einst in mächtigem Ergusse über altsilurische Schiefer und zwischen sie hinein aus dem Erdinnern eindrang. Der heißglühende Brei schmolz die alten Grauwacken entweder völlig in sich ein, wie wir es auf den Fußsteigplatten bei jedem Regenwetter deutlich sehen können, oder er schmolz sie nur an und hob große Schollen davon mit empor, sodaß sie auf der Lava schwimmend verschoben und vertragen wurden. Das sind die Kamenzer und Königshainer Grauwackenberge.
Es ist eine altbekannte Erscheinung, daß solche umgeschmolzene Gesteine den Charakter des Schmelzgesteins annehmen, und so kommt es, daß die alten Grauwacken bis in ihre kleinsten Teilchen ebenso kristallinisch geworden sind wie die Granite, so kommt es, daß man aus der Ferne einen solchen Berg des Grauwackenriffs nicht von einem Granitberge unterscheiden kann: er hat auch im großen Granitcharakter angenommen. Wenn wir also die Lausitzer Landschaft nach ihrem Grundzuge erfassen wollen, so müssen wir festhalten, daß es eine alte plutonische Landschaft ist, der der Granit das Gepräge gibt. Heutzutage rührt sich der Vulkanismus in der Lausitz nicht mehr, längst ist der alte Glutbrei erhärtet, von außen nach innen natürlich, und hat sich dabei in dicke Schalen oder Bänke gesondert, zwischen denen sich deutliche Fugen gebildet haben. Es sind nicht gleichmäßige Lagen, sondern meist sehr flache, langgestreckte Fladen, von denen immer der obere mit seiner Ausbauchung in die Senke zu liegen kommt, die durch das Aneinanderstoßen zweier darunterliegender entsteht. Die linsenförmigen Fladen sind von ganz verschiedener Größe und Stärke. Auf dieser merkwürdigen Absonderung bei der Erstarrung aber beruht zum großen Teile die schöne, wellenförmige Linienführung der Lausitzer Bergketten, wenn man sie von einem nördlichen oder südlichen Standpunkte aus betrachtet.
Denn obwohl jede Bergform im wesentlichen das Ergebnis zweier miteinander streitender Kräfte ist: der Widerstandsfähigkeit des Gesteins und der zersetzenden und ausnagenden Kraft des Wassers in seiner verschiedenen Gestalt, so ist es doch bei dem Granit sicher, daß er sich weniger von außen modeln läßt und vielmehr seine innere Art allen Gewalten zum Trotz behauptet. Denn der Lausitzer Granit ist bei seinem hohen Quarzgehalt ein äußerst widerstandsfähiger Gegner; vom Wasser zersetzbar ist nur der säulige Kalifeldspat, der zuletzt ein wasserhaltiges Tonerdesilikat bildet, d. h. chemisch reinen Ton oder Kaolin. Mechanisch leicht zerstörbar ist im Granit der blätterige Glimmer, der uns von vielen Bergwegen der Lausitz wie Silber entgegenschimmert. Da aber der Quarzgehalt des Lausitzer Granits ungefähr 65 Prozent der Gesamtmasse ausmacht, darf man sagen, daß die Granitberge in ihrer Form weniger von außen als von innen bestimmt sind. Außerdem sind die Bestandteile des Granits bei der Bildung und Erstarrung zu einem überaus dichten kristallinischen Gefüge zusammengepreßt worden. Eine Schneewehe oder Sanddüne ist in ihrer Form völlig von der von außen wirkenden Kraft, dem Winde, abhängig. Ein Mittelding stellt etwa der Tafelberg dar, den wir in der Sächsischen Schweiz so häufig sehen: er behauptet in seinem harten Kopfe seine Art, in seinem weichen Fuße überwiegen die formenden Kräfte von außen. Die Lausitzer Granitberge aber zeigen überall die flache, halblinsenförmige Rundung, die in dem inneren Bau, in der Erstarrungsweise des Granitbreies schon vorgebildet ist. Mit Wohlgefallen gleitet das Auge an den welligen Berglinien hin und erfreut sich zugleich an der wunderschönen mattblauen Färbung der Ferne, die auf den Bergen liegt, vergleichbar dem Blau einer bereiften Heidelbeere in ihren Wäldern, das besonders schön wirkt, wenn man es aus dem Rahmen einer schönen, dunkelgrünen Heidekiefer oder einer Zottelfichte im Vorgelände heraus betrachtet.
Wenn man nun einem solchen Granitberge, sei es dem Czorneboh, sei es dem Mönchswalde oder einem anderen, zu Leibe geht, so spürt man freilich sehr bald, daß auch jene von außen wirkenden Kräfte im Laufe der Jahrtausende dem alten Granit trotz alles eisernen Widerstandes böse mitgespielt haben. Es lassen sich drei Zonen unterscheiden beim Anstieg. Weit draußen in der Felderebene, wo noch einige Waldinseln von alter Waldausbreitung zeugen, beginnt der weiche Fuß des Berges; das ist alles vom Wasser herniedergetragener Schutt, die feinsten und weichsten Teile sind naturgemäß am weitesten geführt worden. Hier spüren wir noch nichts vom eisenharten Granit. Hier ist die Zone der schmutzigen, lehmigen Hohlwege, die sich tief in die weiche Halde hineinziehen, der Ansiedlungen und ihrer ausgedehnten Feldfluren. Gewöhnlich aber rechnen wir den Berg erst von da ab, wo die zweite Zone beginnt: das Felsenmeer, in dem sich zwischen moosigen Blöcken die Fichtenwurzeln ihren Weg in die weichen Schuttmassen der Tiefe suchen, wo Farnkräuter und Kratzbeeren wuchern, wo im Frühling der Seidelbast blüht. Je höher wir steigen, desto größer werden die Blöcke in diesem Steinmeer, und der Weg ist erst dadurch entstanden, daß die Arbeiter die Steine wegräumten. Meist sind diese Blöcke rundlich, und besondere, wenn sie Schneekappen tragen oder mit Glatteis überzuckert sind, bieten sie einen herrlichen Anblick dar. Sie sind ebenso wie die sanfte, weiche Fußhalde allen Granitbergen eigentümlich; wer einmal die Schneekoppe bestiegen hat, wird sich des Blockmeeres erinnern, das dort um so eindrucksvoller wirkt, weil es in solcher Höhe nicht vom Fichtenwald überschattet werden kann. Am großartigsten im Kranze der deutschen Mittelgebirge treten die Felslabyrinthe im Fichtelgebirge an der Luisenburg und Kösseine auf. Als hätten Zyklopen gewürfelt, so liegen dort mehr oder weniger kuglige Blöcke von 7-8 m Durchmesser übereinander. Einfältige Gemüter suchten hier die Heimat der schätzereichen Zwerge und Kobolde, wozu nicht wenig das Leuchtmoos beigetragen hat, das mit seinem phosphorgrünen Goldschein auch in den Felsenmeeren der Lausitzer Berge an verborgenen Stellen glüht. Leider räumen die Steinarbeiter und die Forstleute mehr und mehr in diesen Blockwildnissen auf, am Czornebohwege sieht man es manchem Stein an, daß hier Meißel gesetzt sind, um eine Treppenstufe abzusprengen, dort Bohrlöcher in einen schönen Block getrieben wurden, um ein Grundstück zu gewinnen.
Fragen wir, woher diese steinernen Meere? Sie sind teilweise an Ort und Stelle entstanden dadurch, daß aus der Erstarrungsschale das Wasser die Blöcke herausmodellierte, teilweise sind sie aber aus größerer Höhe herabgerollt, wo noch der nackte Fels dem Wasser trotzt. Damit sind wir in die dritte Region hinaufgestiegen, wir stehen etwa an den Klippen des Hromadnik, des Drohmberges, der Schmoritz, auf der Teufelskanzel oder am Bismarckdenkmal auf dem Czorneboh. Diese Gipfelklippen sind anstehende Felsen, mit dem Kerngestein des Berges verwachsen, das sonst überall von Block- und Schuttwerk überdeckt ist. Es sind oft prächtige Felsgestalten, die natürlichen Aussichtstürme auf den flachen, breiten Gipfeln. Auf dem Sybillenstein bei Elstra z. B. hat man sie zugänglich gemacht, auf anderen dienen sie ebenso wie viele Steine der hinteren Sächsischen Schweiz den Alpenkletterern als Übungsberge. Auch diese Gipfelkronen sind für die Granitberge des deutschen Mittelgebirgszuges kennzeichnend, man denke z. B. an die herrlichen Mittagssteine über der Spindlerbaude im Riesengebirge, an die Klippen des Greifensteins im Erzgebirge oder des Rudolphsteines im Fichtelgebirge.
Die Mittelgebirgslandschaft wird durch den Wald beherrscht, wenn man auf die Lebensdecke sieht; denn nur ganz selten ragt ein Gipfel über die Baumgrenze hinaus. Fichtenforst deckt auch weithin die Flanken und Rücken der Lausitzer Berge, es ist zumeist gleichaltriger Wald, mehr Baumschule als Wald. Landschaftlich schöner ist der Femelwald, wie ihn der Forstmann nennt, der noch an einigen Stellen herrscht: wo unter alten Schirmbäumen der Jungwuchs von Tannen und Fichten vom Keimpflänzchen bis zum mannshohen Vorwuchs steht. Dort gedeihen auch unsere Nadelbäume in bunter Mischung; der Alpenbaum: die Lärche, der Heidebaum: die Kiefer, und auch Tannen durchsetzen die Fichten. Wenn der Rauhreif die Wälder überzuckert, ist der Femelwald von überraschender Pracht. Laubwald ist selten geworden im Granitgebirge, es finden sich noch Inseln von Buchen und Bergahornen am Czorneboh und Valtenberg; Niederwald von Erlen, Birken oder Eichen, die sich aus Stockausschlägen immer wieder von selbst verjüngen, wenn sie Brennholz geliefert haben, begleitet besonders auf moorigen Stellen den Saum des Waldmantels der Granitberge.
Von der Höhe der Gipfelklippen oder der Türme, die man darauf errichtet hat, weil die Granitrücken so breit sind, daß man gewöhnlich, im Hochwalde vollends, des Umblicks entbehrt, schaut man hinab in breite, wannenförmige Täler, die mit langen Häuserzeilen besetzt sind: mit langgestreckten Hufendörfern, die sich an den Bach anlehnen, der das Tal entwässert, so z. B. Cunewalde-Weigsdorf – Wilthen-Tautewalde-Neukirch-Putzkau – Lawalde-Lauba-Beiersdorf-Oppach – Ebersbach-Friedersdorf-Neusalza-Spremberg-Taubenheim-Sohland usw. Alle diese breiten Talwannen ziehen zwischen zwei Granitwällen von Osten nach Westen, sie sind in ihrer Form das Gegenbild der Berge, also wohl ebenso durch die Natur des Granits bestimmt wie jene, wenn sich auch teilweise durch spaltenfüllende Quarzgänge in der Längsrichtung der Täler Andeutungen von Bruchversenkungen finden, die an der Bildung der Talwannen mitbeteiligt sind. »Jede dieser Tallandschaften ist eine geographisch-geschichtliche Einheit, jedes dieser deutschen Hufendörfer mit eigener Kirche und Schule eine selbständige Lebensgemeinschaft. Ein freier Bauernstand bewirtschaftet seit der Besiedlung den vielfleckigen Felderteppich, die kleinen Wirtschaften bilden nur den Nebenerwerb alter Hausindustrie. Die Oberdörfer, insbesondere Ebersbach, Neugersdorf, Eibau usw., sind durch die industrielle Entwickelung der letzten Jahrzehnte zu umfangreichen Industriedörfern umgewandelt worden, in denen die einförmigen, nüchtern gebauten Fabrikgebäude mit ihren langen, hell gehaltenen Fluchten schon einen wesentlichen Zug der Landschaft bilden. Diese deutschen Siedlungen der Oberlausitz sind bis in die jüngste Zeit hinein durch Zuwanderung böhmischer Exulanten vermehrt worden, die ihres Glaubens wegen vertrieben wurden. Für die Landschaft sind die Seitenteile mancher Dörfer, die jenen Vertriebenen ihre Entstehung verdanken, ebenso kennzeichnend wie die ›Neudörfer‹, unter denen Herrnhut, gegründet 1722 von mährischen Auswanderern, einen Weltruf erlangt hat.« Nach Curt Müller, Löbau, Die Oberlausitzer Landschaft, Wissenschaftl. Beil. der Leipz. Zeitung 1902, Nr. 68.
Auch in der Bauart der Häuser zeigt sich dies geschichtliche Werden. Alte Holzhäuser mit Blockrahmen, mit den Bogen des Balkenstuhls über den kleinen, freundlichen Fenstern, die entweder das Schindel- oder Strohdach oder ein Stockwerk aus Riegelwand mit Lehmfüllung tragen, am Giebel von Rebe, Efeu oder Kletterrosen umrankt, oft mit der Schützenscheibe oder dem Pfingstritter geschmückt, stehen neben neueren geräumigeren Walmhäusern mit geschlitzten Schiefer- oder Ziegeldächern, deren Erdgeschoß solider Granit- oder Ziegelbau, deren oberes Stockwerk Riegelwand mit Backsteinfüllung ist. Herrnhut zeigt am Markte hübsche Barockhäuser mit gebrochenen Mansardendächern, kleinen Freitreppen und hohen, hellen, viergliedrigen Fenstern, und seine Heckenzäune, gestutzten Lindenalleen, steifen Zopfzeitgärten verkünden neben den schlichten Bauerngärtchen der »Häuslernahrung« in den Weberdörfern mit ihren Holunderbüschen, ihren Georginen und Astern usw. eine neuere, verfeinerte Kulturperiode. Nachdem geraume Zeit auch in den Lausitzer Dörfern mit den Fabriken eine ganz undörfliche Bauweise Einzug gehalten hatte, die sich namentlich in den Erweiterungsbauten der Gasthäuser zu »Tanzetablissements« und bei Schulneubauten in ihrer ganzen Häßlichkeit zeigte, regt sich in neuester Zeit wieder das künstlerische Gewissen, das dem Dorfe gibt, was des Dorfes ist: Zeugen sind z. B. die Schulen von Soculahora, Großdubrau, Oberneukirch, Eibau; auch die neue Kirche von Kunnersdorf bei Kamenz wäre hier zu nennen. Doch hat diese Bewegung in anderen Teilen unseres Vaterlandes schon kräftiger eingesetzt und schönere Ergebnisse erzielt.
II.
Neben den breiten Talwannen, die ihre Gestalt im wesentlichen, dem Gebirgsbau verdanken, gibt es andere Täler, die sich das fließende Wasser geschaffen hat: Quertäler, die die Granitwälle in der Richtung von Norden nach Süden durchsetzen. Da fast alle Lausitzer Flüsse nach Norden abfließen, der Hauptrichtung des deutschen Bodens folgend, so nagten sie alle mehr oder weniger enge Schluchttäler in die Lausitzer Bergzüge hinein. Senkrechte Klüfte im Granit, an denen oft durch den Gebirgsdruck sich Verwerfungen längs glatten Harnischen gebildet hatten, kamen der talbildenden Kraft des fließenden Wassers manchmal entgegen. Aber die Spuren des wilden Kampfes mit dem Granit sind im Flußbette überall in Gestalt von Blockwerk, an das die Wasser branden, in Wasserschnellen und Wasserfällen zu sehen und zu hören. Am Ufer aber stehen die zersägten Granite in steilen Klippen an und zeigen die Matratzenlagerung ebenso schön wie die Gipfelklippen auf den Bergen.
Diese fast unersteiglichen Talpfeiler sind in der Lausitz nicht so hoch und trotzig wie in vielen anderen Quertälern der deutschen Mittelgebirge. Es fehlt ihnen auch der Burgenschmuck, der landschaftlich so schön im Erzgebirge im Zschopautale z. B. hervortritt, am herrlichsten aber im Rheintale. Aber die Lausitzer Quertäler haben auch ihre Eigenart. Der Name Skalen (skala von wendisch skaly, d. h. Fels), den sie in der Lausitz führen, besonders an ihren nördlichen Enden, wo sie die letzten Granitwälle durchsägen, ehe sie ins Tiefland eintreten, deutet das schon an. Das Tiefland war ehedem waldlose Weidesteppe; bis zu den Skalen reichte der Waldmantel der Berge herab. Wenn nun ein Steppenbrand das dürre Gras erfaßte, wenn ein Feind ins Land fiel, zog sich die Urbevölkerung in den Schutz des Waldsaumes zurück. Sie hatte auf den Uferklippen der Skalen halbkreisförmig riesige Erd- und Steinwälle aufgerichtet, so hoch und steil, daß kein Brand darüberschlagen, daß ein Feind sie schwerlich erstürmen konnte. Auf halsbrecherischem Pfade aber konnte man aus dem Flusse das nötige Trinkwasser heraufholen. Noch heute stehen an den Lausitzer Skalen die uralten »Heidenschanzen« oder Ringwälle, während die wenigen mittelalterlichen Burgen fast vom Erdboden verschwunden sind, z. B. Burg Kirschau im oberen Spreequertale. Aber am Klosterwasser erhebt sich die Ringschanze von Ostro; an der Nedaschützer Skala des Schwarzwassers die mächtige Koblenzer Schanze; am Langen Wasser die Burgwälle von Dahren und Göda; an der Spreeskala sind gar vier Schanzen errichtet, die äußerste war bei Niedergurig, dann stand eine an der Stelle der heutigen Ortenburg in Bautzen (der erhöhte Garten gegen die Stadtseite verrät vielleicht noch etwas davon). Hier haben wir die interessante Tatsache vor uns, daß der deutsche Eroberer die alte Wendenschanze benutzte, um sie zu einem »Zwinglausitz« zu machen. Weiter oben folgten die Wälle am Bautzener Exerzierplatze und die vom Tal aus schier unersteigliche Schanze von Doberschau. Auch das Tal des Albrechtsbachs hat bei Blösa, das des Rodewitzer Wassers bei Niethen, das der Kotitz bei Lauske seine Ringschanze. Charakteristischerweise sind auch die Lausitzer Städte Kamenz, Bautzen, Weißenberg, Löbau, Görlitz gerade an solchen Stellen gelegen, wo die an ihnen vorübereilenden Flüsse einen Bergwall in kurzem Steiltale durchbrochen haben, das in neuerer Zeit oft durch Eisenbahnbrücken überspannt wird. Die vieltürmigen Lausitzer Städte, ganz besonders Bautzen, gewinnen durch ihre hohe Lage am Rande der Skalen, besonders von Norden aus der Ebene gegen den blauen Bergrahmen gesehen, bedeutend an landschaftlicher Schönheit. Andererseits macht sich solche Lage auch darin geltend, daß diese Siedlungen den Stürmen sehr ausgesetzt sind, wie z. B. der Volksmund von Bautzen sagt:
Wenn der Wind nicht weiß, wohin? –
Dann weht er über Budissin.
Auch manche der wendischen Kirchdörfer haben diese beherrschende Lage der Städte, z. B. Storcha, Quatitz, Hochkirch, Gröditz und Kittlitz, wenn auch zu ihrem Bannkreis nur kleine, wendische Rundlinge in der Ebene gehören. Diese Zentralisierung entspricht dem großzügigen, einheitlichen Charakter der Ebene ebenso, wie der Eigenart des hier wohnenden Slawenstammes. (Vgl. C. Müller a. a. O.)
Es würde aber ein Zug im Bilde der Lausitzer Quertäler fehlen, wenn wir nicht der Anlagen tief im Tale am rauschenden Wasser gedächten; zwar ist im Engtale wenig Raum für größere Ansiedlungen, – im großen oberen Spreequertal z. B., wo die Granitschultern von beiden Seiten herandrängen, weichen die Siedlungen seitwärts nach Osten und Westen in die natürlichen Talwannen aus, am deutlichsten Schirgiswalde, Crostau –, aber es war hier am leichtesten, den Fluß zu zähmen und seine Kraft durch ein Stauwehr zu spannen.
Man findet in den Lausitzer Quertälern noch hier und da etwas von dem Mühlenzauber der guten, alten Zeit; stille Weiher hinter tosendem Wehr, wenn auch zumeist an die Stelle der beschaulichen Mühle im Grunde die vielfenstrige Fabrik getreten ist, deren Wahrzeichen die hohen Minarette der rußgeschwärzten Schornsteine sind. An vergangene Zeiten erinnert z. B. die kleine Mühle im Engtale nördlich von Niethen, wo am Apfelbaume das ehrwürdige Verbot prangt: Das Vorwerk, das durch die Mühle geht, das ist verboten! (Vorwerk = Fuhrwerk.) Einen Übergang bildet etwa die zu einer Jutespinnerei umgewandelte Mühle in der Nedaschützer Skala. Mit dem Anblicke der neuzeitlichen Fabriksiedlungen söhnt man sich am ehesten des Abends aus, wenn die schlanken Schlote mit goldigem Qualm in den roten Abendhimmel hineinstechen. Oft hat erst der Steinbrecher Platz für die raumfordernde Anlage der Papierfabriken, der Spinnereien usw. schaffen müssen, ein recht deutliches Bild gibt uns die Ölgasanlage der Doberschauer Papierfabrik, die sich eng in einen alten Bruch schmiegt. Die alte Linde dabei steht mitten im ölgetränkten Schutt und dazu ein Kirschbäumchen, arme Lazarusse der vordringenden Kultur. Und es ist rührend anzusehen, wie sie in jedem Frühjahr noch dem vergifteten Boden so viel abgewinnen, um an ein paar Ästchen Blätter und Blüten zu treiben.
Der Wald an den Gehängen der Quertäler ist meist lichter Buschwald: seltene Blumen entblühen dem Laubboden im Frühling, der »Abgott« bei Bautzen war ja deswegen einst den Pflanzenkundigen weithin bekannt. Wer aber nicht Seltenheiten sucht, erfreut sich im Frühjahr der Sternenpracht der weißen Windröschen unter den Haselstauden, im Sommer der grünen Rabatten der gelben Röderblume oder des Sonnenhutes (Rudbeckia laciniata) An der Röder ist diese nordamerikanische Pflanze um 1820 zuerst angepflanzt worden und hat sich seitdem in der Lausitz weithin verbreitet. oder des lianenähnlichen Hopfengerankes und der kletternden Nachtschatten (Solanum Dulcamara) in den Erlendickichten und Weidengestrüppen, im Herbst des Spiegelbildes der bunten Gehänge im stillen Wasser: sind es doch fast die einzigen Stellen, wo die Herbstfärbung noch landschaftlich hervortritt; denn die Bergwälder sind fast überall immergrüne Fichtenforste. Reiches Vogelleben belebt die Skalen der Lausitz, in einigen nistet noch die Nachtigall. In dem Gebüsch baut auch die Haselmaus noch ihr Nest, und die Brandmaus sammelt sich aus Eicheln und Haselnüssen in Wurzelhöhlen ihren Wintervorrat.
III.
Nach Norden hebt und senkt sich der Granit in immer niedrigeren Wellen, bis er endlich untertaucht in einem kiesigen Schuttmeer. Die gelben Kiesgruben mit ihrer Braue von braungrünen Kiefern sind ebenso Wahrzeichen der Gegend wie die darunter erschlossenen Steinbrüche auf Granit, die man eher mit Bergwerken vergleichen könnte. Krane und künstliche Bremsberge müssen die Steine aus der Tiefe heraufwinden, und die wasserhebende Windturbine ist das landschaftliche Kennzeichen solcher Tiefenbrüche. Das Klappern von Meißel und Fäustel, der harte Schlag des Perls und die Kanonade der Sprengschüsse, die fast täglich in den Arbeitspausen abgefeuert wird, gehört aber auch hier wie in den großen Brüchen, die in die Flanken der Granit berge hineingetrieben werden und zur Beförderung des gebrochenen Steines das natürliche Gefälle ausnutzen können (Demitz!), zu den charakteristischen Lauten, in denen die Lausitzer Landschaft den Wanderer begrüßt.
Stiller sind die gelben Gruben, an deren Hängen oft ein gelbbrauner, zäher Lehmbrei mit zermalmtem Gestein gespickt in allen Größen, Formen und Farben wie eine Art Beton aufgeschlossen liegt. Untersuchen wir die Geschiebe und legen wir sie einem Gesteinskundigen vor, so hören wir mit Staunen, daß es fast lauter Fremdlinge sind: grobkörniger Rapakiwi aus Finnland, rote Granite vom Siljan-See in Schweden, Porphyre von Elfdalen, Dalaquarzite, Silurkalke von Gotland und Schonen, Feuersteine und Kreidekalke von Rügen, oft mit schönen Seeigeln oder Korallen als Einschlüssen, Muschelkalk von Rüdersdorf bei Berlin, endlich auch Grauwackenkonglomerate, Kieselschiefer und Quarzglimmerfelsbrocken aus dem nördlichen Sachsen. Dazu als besonders schöne Zugabe hier und da buntstreifige Achate, blutrote Carneole, auch Amethystdrusen. In den Bautzener Anlagen liegt ein riesiger nordischer Granitfindling, dessen Gewicht auf 280 Zentner veranschlagt wird. Hinter der Spinnerei Hainitz bei Großpostwitz liegen in einer Kiesgrube viele solcher Irrblöcke von ziemlicher Größe wild durcheinander. Das ist alles auf dem Grunde einer uralten Eisdecke, die sich wie ein riesiges Eisbärenfell dereinst von Skandinavien bis an die deutschen Mittelgebirge erstreckte, langsam bis zu uns gewandert: Grundmoräne nicht eines Gletschers, sondern einer Gletscher masse, eines Inlandeisschildes, wie es jetzt Grönland begräbt. Zeugnis legen dafür auch in der Lausitz Schliffflächen ab mit Schrammen auf dem heimischen Granit (am bekanntesten sind die Demitzer Gletscherschliffe), auch Stauchungen von Braunkohlenflözen in der Ebene. Die Granitbuckel sind stets an der Nordseite glatt gehobelt, die Schrammen zeigen mehr oder weniger nordsüdliche Richtung.
In anderen Kiesgruben können wir beobachten, wie das ungeschichtete Material der alten Grundmoräne vom Schmelzwasser geschichtet, umgelagert, ausgeschlemmt worden ist. In der Schmelzzeit des Eises wurden die Geschiebe an vielen Orten nach der Schwere sortiert. Weithin ist der lockere Schutt entführt und von den träge dahinfließenden Wassern zu weiten Sandebenen ausgebreitet worden, die nur dürftige Kiefernheide und rotblühende Polster von Calluna ernährt. Der Wind treibt noch heute den beweglichen Sand zu Dünen auf, wie z. B. in den Hunnenhügeln bei Wessel, am Großteiche bei Großsärchen und anderswo. Dabei schliff er die Geschiebe, die er nicht verfrachten konnte, mit dem Sandgebläse derartig glatt und blank, daß sie auf weite Strecken eine Steinsohle von scharfkantigen Blöcken aller Art bilden. Diese dürren Sandflächen mit ihren armseligen Buchweizenfeldern, sonnenglühenden Kiefernheiden sind dünnbesiedelte Gebiete, gerade gut genug, um als Übungs- und Schießplätze unseres Heeres sich nützlich zu machen. Den feinsten Staub trieb der Wind in Mulden des Geländes zusammen, z. B. beim Kloster Marienstern, und bildete so die fruchtbaren Lößpflegen, die sicher in der Urzeit Steppengebiete waren. Vielleicht sind die gelben Narzissen, die im Frühlinge noch auf vielen Lausitzer Wiesen blühen, Überbleibsel alter Steppenblumenpracht. Die fruchtbaren Striche sind heutzutage nicht mehr Weidegebiet, wiewohl die neugegründeten Weidegenossenschaften die Lausitzer Wiesen wiederum mit schwarzfleckigem Vieh und Herdengeläut beleben, sondern Ackerland, Kultursteppe mit geometrisch abgegrenzten Feldern, deren Raine noch häufig wilde Rosenbüsche und Brombeerhecken, Schlehdorndickichte und schöne Grenzbäume zieren. Die vielen Rittergüter mit ihren alten Schlössern und landschaftlich schönen Parkanlagen, die in echt adliger Freigebigkeit jedem anständigen Menschen offenstehen, passen in dieses Bild. Ich nenne nur Teichnitz, Schmochtitz, Neschwitz, Lauske, Milkel. Industrielle Anlagen, wie Margareten- und Adolfshütte, stammen aus jüngster Zeit, seitdem man die von der Eiszeit begrabenen Moorwälder tertiärer Sumpfzypressen, Walnußbäume, Kastanien, Linden usw. wieder unter dem Schutt als Braunkohle herausgräbt und die Tone und Kaoline wirtschaftlich ausnutzt.
Der Wasserreichtum der Schmelzzeit scheint noch nicht versiegt: in Seen mit breiten Schilf- und Schachtelhalmsäumen, in Mooren mit grauer Erika, weißer Calla und dichten Sphagnumpolstern, in breiten, oft überschwemmten Flußtälern verrät sich noch die alte Lusa, die Lausitz, das Sumpfland, das unserer Landschaft den Namen gab.
Wenn man an einem schönen Nachmittage von der Höhe des Czornebohs nach Norden blickt, dann schneidet der Horizont geradlinig weit draußen ab wie beim Blick auf das Meer, und dieser Eindruck wird noch stärker, wenn über der mit dem Fernblau übergossenen Ebene, die in den Himmel sich zu verlieren scheint, die weißen Türme der Kirchdörfer oder die weißen Giebel der Heidehäuschen wie weiße Segel schimmern und herrliche Wolkengebilde darüber lagern, die ihre Schatten herniederwerfen. Es liegt etwas Richtiges in diesem Bilde; denn in der blauen Ebene steht der Grundwasserspiegel sehr hoch. Bei Hochwasser im Frühling werden die breiten Flußauen, die sich oft zu sumpfigen Flußgeflechten erweitern, meerartig überschwemmt. Erst in der preußischen Niederlausitz bildet sich diese »amphibische« Landschaft so recht aus zum Spreewalde, der mit seinen Kaupendörfern geradezu ans Marschland erinnert. Aber auch im sächsischen Teile gibt der Wasserreichtum der Niederung der Landschaft manchen charakteristischen Zug: Sumpfschanzen, ähnlich den Skalenschanzen im Süden, sicherten hier die Urbevölkerung in Notzeiten, z. B. bei Brohna, nördlich von Radibor. Wasserburgen treten an die Stelle der hochgelegenen Herrenhäuser der Hügellandschaft, z. B. Schloß Milkel. Der Kahn ist hier noch nicht wie im Spreewalde Verkehrsmittel, aber Dammwege und lange, schmale Brückensteige müssen die Bevölkerung durch die moorigen Striche und die wasserreichen Flußauen geleiten. Es gewährt einen hübschen Anblick, wenn die wendischen Kirchgänger »im Gänsemarsch« auf hochstehenden Granitschwellen die breite Aue der Schwarzen Elster queren. Das Storchnest, das über so manchem moosigen Strohgiebel der Niederungsdörfer thront, gehört auch hierher.
Am deutlichsten und schönsten spricht sich der Wasserüberfluß der Niederlausitz in ihren zahlreichen Teichen landschaftlich aus. Überall fast, wo man tiefer gräbt, tritt rasch Wasser auf, und manche sandige unfruchtbare Strecke ist künstlich unter Wasser gesetzt und als Fischteich nutzbar gemacht worden. Da neben den künstlichen auch zahlreiche natürliche Seen, die sich durch ihren unregelmäßigen Umriß von jenen deutlich unterscheiden, in der »Heide« vorkommen, erscheint sie auf der Karte wie durchlöchert von blauen Flecken. Wer aber vom Czorneboh im ersten Abendrot die vielen Seespiegel der blauen Ebene wie tausend funkelnde Augen hat aufblitzen sehen, dem ist das ein unvergeßlicher Anblick.
Aber auch in der Nähe gewähren die Teiche dem Heidewanderer, der, durch den Sonnenbrand ermüdet, ihre Kühle aufsucht, reichen Lohn für Auge und Ohr. Uralte Eichen, alte Platanen oder Kastanien bilden auf den Teichdämmen schattige Laubgänge. Darunter gibt es manchen ehrwürdigen Riesen, z. B. die große Eiche bei Niedergurig. Am Schützen, wo das Wasser durchs Gitter rauscht, ist eine Gasse durch den Schilf- und Rohrkranz des Teiches gelegt. Mit Wohlgefallen gleitet das Auge über die sonnenglitzernde Fläche; ein Haubentaucher segelt mit seinen Jungen auf dem Rücken soeben aus dem Schachtelhalmdickicht hervor. Durch das muntere Geplauder des Rohrsängers schallt der klagende Ruf des Bleßhuhns, und mit schwirrendem Geräusch fällt eine Schar Wildenten ein. Ein dicker Karpfen schnellt sich schwerfällig über die Wasserfläche. Stocksteif steht im Uferschilf die Rohrdommel auf Lauer … Wer sich aber einen besonderen Genuß verschaffen, wer den genius loci auf sich wirken lassen will, der gehe in stiller, warmer Sommernacht, wenn
Auf dem Teich, dem regungslosen
Weilt des Mondes holder Glanz,
Flechtend seine bleichen Rosen
In des Schilfes grünen Kranz, –
der gehe dann ins Froschkonzert hierher. Die ganze Luft scheint zu wirbeln vor eitel Lust und Lebensfreude, die hier aus tausend Kehlen so harmlos schlicht und doch so gewaltig ehrlich in den Mondenglanz schallt. »Die Teichrosen am Rande des Wassers haben ihre weiße Blüten zum Schlummer geschlossen. Der Teich scheint unergründlich zu sein. Denn in unerreichbarer Tiefe sehe ich den Mond und viele Sterne – und Strauch und Sträuchlein und die höchsten Eichen wachsen mit ihren Kronen ebenso tief in die Flut hinein, wie sie am Ufer darüber hinausragen. Eine Ente schwimmt leise rufend über den klaren Spiegel und läßt hinter sich eine silberne, funkelnde Wellenfurche« …
IV.
Wenn wir von den Lausitzer Granitbergen einen Blick nach Süden werfen, so zeigt sich dem Auge wiederum eine neuartige Landschaft. Über den schöngeschwungenen Granitwällen tauchen am Horizont sargförmige Berggestalten auf: dort der Pirsken und der Botzen bei Schluckenau und da der Tannenberg in Böhmen, zwischen diesen der spitzige Wolfsberg und linkerhand die domförmige Lausche. Das alles sind Bergformen, die jenseit der Landesgrenze im jungvulkanischen böhmischen Mittelgebirge ihre eigentliche Ausbildung erlangen, sie schicken aber bis ins nördliche Tiefland ihre Vorposten aus.
Die Sargberge sind Reste dünnflüssiger Basaltlaven, die sich über dem Lausitzer Granit in der Tertiärzeit als Decken ausbreiteten, jetzt aber bis auf einige Reste durch die zerstörenden Kräfte des Wassers beseitigt sind. Die größte Decke von Basalt tritt als Hochfläche am Westrande des Zittauer Beckens auf, einzelne »Spitzberge« ragen daraus hervor. Pirsken und Botzen sind ebenso Deckenberge wie der Kottmar, nur liegt hier Phonolith auf Granitit, dort aber Basalt. Die nördlichsten Deckenberge der Lausitz sind der Stromberg bei Weißenberg, der Schafberg bei Baruth und der Eisenberg bei Guttau.
Die Domberge aus Basalt und Phonolith sind meist sogenannte Quellkuppen. Zähflüssiger drang hier der Glutbrei aus dem Erdinnern herauf und bildete jene herrlichen Berggestalten, die im Milleschauer Donnersberg, im Lobosch, im Kleis u. a. von jeher das Auge der Naturfreunde und der Maler (Ludwig Richter!) entzückten. Der schönste der Lausitzer Domberge ist ohne Zweifel die Lausche. Auf einem Sockel von Brongniartiquader, der längs der Lausitzer Granithauptverwerfung aus der Sächsischen Schweiz bis hier herüberreicht, liegt, wie beim benachbarten Hochwald eine Phonolith-, so hier zunächst eine Basaltdecke. Der rote Basalttuff darunter fällt jedem auf dem Wege zum Gipfel der Lausche auf. Aber durch die Basaltdecke brach ein Phonolithgang hindurch, der dem Berge seine schöngerundete Domform gab. Wenn man das schöne Neißetal, das zwischen Hirschfelde und Ostritz an die Skalen der Nordlausitz erinnert, nach Görlitz hinabwandert, ragt dort die schöne Quellkuppe der Landeskrone auf; Löbau hat eine breite Quellkuppe aus Nephelinbasalt (mit Einschlüssen von Nephelindoleritfetzen); bei Großdehsa steht wohl die nördlichste dieser Quellkuppen, dafür aber auch die kleinste, der Bubenik mit seinen verglasten granitischen Einschlüssen; die westlichste in der Lausitz ist der Schloßberg von Stolpen, dessen 80 m tiefer Brunnen gerade in den Kraterschacht getrieben worden ist.
Hier zeigt sich sehr schön die bekannte Säulenstruktur des Basalts, die eigentümliche Erstarrungsart dieser Lava der Tertiärzeit, die also – gerade entgegengesetzt wie die granitische – senkrecht zur Grenzfläche in Säulen zusammenschrumpfte. »Danach stehen die Säulen in den Decken senkrecht, in den Quellkuppen konvergent und in den Schlotausfüllungen in ähnlicher Anordnung wie die Scheite einer Holzfeime, strahlenförmig um eine Mittellinie.« (Professor Dr. Beyer, a. a. O. S. 92.) Diese Schlotausfüllungen sind besonders im Zittauer Gebirge wichtig geworden dadurch, daß sie den Quadersandstein anschmolzen, härteten und fritteten, sodaß er bei Jonsdorf in den Zittauer Bergen zu Mühlsteinen verarbeitet werden kann. Ja, es kam sogar vor, daß der Basalt dem Quader seine Säulenstruktur aufzwang, wie es besonders schön die »kleine Orgel« in jenen Brüchen zeigt.
Auch an diesen Bergen aus jungvulkanischer Lava hat die Verwitterung Blockmeere geschaffen, die aber, entsprechend dem kleineren Durchmesser der Säulen, aus kleineren Brocken bestehen als die granitischen (Löbauer Berg – Kaltenberg, Kleis). Nach und nach entsteht aus dem Basalt ein sehr fruchtbarer Boden, der in den Tälern und an den Gehängen eine üppige Vegetation hervorruft. Die Wiesen deckt hier im Sommer oft wie ein leichter Schnee das Garn der Bleichereien, die früher viel weiter nach Norden gingen. Noch heute heißen in der Umgebung von Bautzen manche Wiesen Bleichen. Besonders aber sind die Bergwälder von wunderbarer Pracht: im zeitigen Frühjahr, wenn das Buchengrün den Wald mit Tausenden grüngelber Lämpchen illuminiert und der Waldmeister und die Zahnwurz blühen – im Herbst, wenn sich die Laubbäume vor dem Antlitz des Wintertodes verfärben, die Buchen sprunghaft und unregelmäßig, aber darum um so bunter, wenn am Waldrande die Pfaffenhütchenbüsche rosenrot prangen und in den ernstgrünen Fichten und Tannen die mit Tauperlen besetzten Spinnweben und Herbstfäden hängen, schöner wie Christkindleins Haar an den Weihnachtsbäumen, für die viele von ihnen bestimmt sind …
Die Landschaft der südöstlichen Lausitz weist also hinüber ins jungvulkanische böhmische Mittelgebirge und in die Sächsische Schweiz, die Landschaft der Nordlausitz mit Heide, Moor und Seen ins norddeutsche Tiefland, das sein Gepräge der Eiszeit verdankt. Das eigentliche Wesen der Lausitzer Landschaft aber offenbart sich dem Wanderer in dem alten plutonischen Granitbezirke der Mitte.
In dürftigen Resten hat sich die ehemals so gefürchtete wendische Nation erhalten; den einen finden wir in ziemlicher Geschlossenheit um den Mittelpunkt Bautzen gruppiert in der sächsischen Oberlausitz, den andern mehr zerstreut in der preußischen Niederlausitz um Kottbus herum. Dem Kulturhistoriker oder Ethnographen, der sich mit dieser kleinen Völkergruppe beschäftigt, drängt sich mit jedem Schritte die Überzeugung auf, daß diese Wenden zwar nicht als Einzelwesen, aber doch als Nation das Schicksal so mancher Südseevölker teilen, nur mit dem Unterschiede, daß sich bei ihnen der nationale Untergang ohne Härte, ohne unduldsamen Eifer von deutscher Seite, sondern in aller Stille, trotz aller Schonung wendischen Wesens, von selbst vollzieht. Die Eisenbahnen, die Fremdes durch Fremde – wie durch Einheimische aus der Fremde herbeiführen, haben an dem Schwinden des echt Volkstümlichen einen Hauptanteil, nicht wenig auch die Militärverfassung, »welche jeden wehrhaften Jüngling aus der slawischen Umgebung in die Reihen deutscher Kameraden und die Kreise deutscher Mädchen führt; dem zurückgekehrten Burschen gefiel die heimische Tracht, der volkstümliche Tanz, der schnarrende Dudelsack, die schreiende Tarakawa (eine Art Oboë) nicht mehr. Er brachte fremde Art und Sitte mit, wollte seinen Walzer und Galopp nach einer modernen Musik tanzen und spottete manches hinweg, was er sonst verehrte. Bei den Mädchen blieb das Urteil des schmucken Soldaten nicht ohne Einfluß, und so ward nach und nach das Althergebrachte und Eigentümliche abgelegt, beiseite getan und vergessen.« Die künstlichen Versuche einzelner Vollblut-Wenden, ihr Völkchen in sprachlicher und literarischer Hinsicht, in bezug auf Tracht, Sitte, Dichtkunst und Musik selbständig zu erhalten, sind gescheitert, nicht etwa durch polizeiliche Maßregeln der deutschen Mehrheit im Lande, sondern an der Gleichgültigkeit des Wendenvölkchens selbst.
Wer die eigentümliche Tracht der Wenden kennen lernen will, der begibt sich am besten in die katholischen Teile der Wendei, und zwar der Niederlausitz, in die Kirchen, auf die Hochzeiten oder den Markt von Kottbus und Lübbenau; nur die weibliche, in der Tat malerische und kleidsame Volkstracht hat sich in größerem Maße erhalten, weniger die männliche, die nichts Besonderes, am wenigsten Malerisches hatte. »Der kurze, faltenreiche Friesrock, das knappe Mieder, das Busentuch, die Schnallenschuhe, selbst die bunten, seidenen Bänder, die, mit großem Luxus gewählt, über die Brust fallen, sind in allen wendischen Orten zum weiblichen Anzug gehörig. Die Halskrause dagegen wird nicht allgemein getragen; wo sie sich findet, erinnert sie lebhaft an die getollten Ringkragen auf alten Pastorenbildern: steife Jabots, die dem, der sie trägt, immer etwas von dem Ansehen eines kollernden Truthahns geben. Allgemein aber ist der wendische Kopfputz. Eine zugeschrägte Papier- oder Papphülse bildet das Gestell; darüber legen sich Tüll und Gaze, Kanten und Bänder und stellen eine Art Spitzhaube her. Ist die Trägerin eine Jungfrau, so schließt die Kopfbekleidung hiermit ab; ist sie dagegen verheiratet, so schließt sich noch ein Kopftuch um die Haube herum und verdeckt sie, je nach Neigung, halb oder ganz. Diese Kopftücher sind ebenso von verschiedenster Farbe wie von verschiedenstem Wert. Junge, reiche Frauen scheinen schwarze Seide zu bevorzugen, während sich ärmere und ältere mit krapprotem Zitz und selbst mit ockerfarbenem Kattun begnügen.«
Eine Wanderung durch die wendischen Dörfer der Oberlausitz bietet – freilich sehr vereinzelt – so manches Interessante für den Forscher. So zeigt beispielsweise das Örtchen Krischa (östlich vom sächsischen Städtchen Weißenberg, schon auf preußischem Boden gelegen) noch die echte altwendische Bauart der Dörfer, wenn auch nicht ganz unverfälscht. Die Häuser bilden eine lange Zeile zu beiden Seiten der Straße, auf welche ihre Giebel weisen. Die Kirche nimmt die Mitte der Anlage ein; in ihrer unmittelbaren Nähe gewahren wir Friedhof, Pfarre, Schule. Von den nach gleicher Schablone aufgeführten Bauernhäusern sticht der Herrensitz in städtischer Bauart, mit Garten oder Park umgeben, gar sehr ab. Hier in Krischa hat man Gelegenheit, nicht bloß die altwendische, an das Heerlager erinnernde Dorf anlage, sondern auch die altwendische Bauart der Häuser kennen zu lernen. Zwar drängt sich schon mancher modische Ziegelbau in die lange Zeile wendischer Höfe; doch nur diese fordern unsere Aufmerksamkeit heraus; ein niedriger Unterbau aus rohem Stein trägt die Balkenvierecke, welche wie beim Blockhaus die Wände ersetzen; auf diese einstöckigen Grundmauern stützt sich das Strohdach, über sie herabhängend. Der Giebel weist keinerlei Schmuck auf; wohl aber spannen sich über die Fenster die echt wendischen Holzbogen. Das Innere ist höchst einfach: auf ein paar steinernen Stufen tritt man in die Hausflur ein, welche das Haus mitten durchschneidet. Zur rechten Hand liegen, durch eine Wand geschieden, die Ställe, zur linken die Wohnstube (stwa), hinter der sich noch ein besonderes Stübchen (stwièka) befindet. Auf einer Treppe oder Leiter steigt man von der Flur aus nach dem Heuboden hinauf. Ein Blick in den Wohnraum läßt uns den bescheidenen, aber stets wiederkehrenden Hausrat erkennen, zu dessen Hauptstücken der große Kachelofen (kachle), der Stube und Stübchen heizt und auch auf die Hausflur hinausreicht, wo er als Herd benutzt wird, und ebenso das unvermeidliche Tellerbrett (polca) gehören, das den Wandschmuck bildet.
Die Insassen des Herrenhofes sind immer deutscher Abkunft und bildeten in früherer Zeit, da die Bewohner der sogenannten Laßhütten für sie fronden mußten, die Hauptorgane der Germanisierung, mehr als gegenwärtig. Ihnen gegenüber vertreten die meist aus dem wendischen Bauernstande hervorgegangenen Pfarrer das starr am Hergebrachten und Volkstümlichen festhaltende Element. Es gehört übrigens zu den Seltenheiten, daß ein Bauernsohn anstatt der Pflugschar das Predigtbuch oder die Feder des Beamten ergreift, oder daß er das Katheder der Schule besteigt. Meist sind die Wenden Bauern, kennen zwar weder Berufsstände, noch Adel, sind aber keineswegs frei von Dünkel. Dem Großbauern (Bur), der 30 Hufen Landes besitzt, würde es als eine Kränkung erscheinen, wenn ein Halbhufner (Polenjk) oder gar ein Häusler (Budarj) um die Hand seiner Tochter einkommen wollte. Am Gemeindeleben nimmt der Wende mit großem Interesse Anteil. Grund- und Hausbesitzer finden sich im Sommer unter der Linde, im Winter im Kretscham (der Schenke) zusammen, um über das öffentliche Wohl zu beraten. Früher kam es hier und da noch vor, daß der Ortsschulze (šolta) die Gemeindeversammlung durch das Krummholz oder den hölzernen Gemeindehammer, Instrumente, an denen die schriftliche Einladung befestigt war und von Haus zu Haus wanderte, zusammenrief; nur zur Beteiligung an Begräbnissen wurde anstatt durch das Krummholz durch den schwarzen Stab aufgefordert. Als Trauerkleidung gilt jedoch nicht Schwarz, sondern Weiß; der weiße Überwurf wird von den nächsten Angehörigen ein ganzes Jahr getragen und in manchen Gegenden durch die weiße Stirnbinde oder das weiße Mundtuch unterstützt.
Besonders auffällig ist bei einer Wanderung durch Wendendörfer das Vorkommen deutscher Familiennamen bei Leuten, die unzweifelhaft wendischer Abkunft sind; die Müller und Schulze, die Meier und Schmied in den verschiedenartigsten Schreibungen sind bei ihnen geradeso anzutreffen wie bei uns. Das Verdeutschen der Personaleigennamen ist stillschweigend vor sich gegangen, nicht wie in Ungarn, wo der Abtrünnige mit eigennütziger Prahlerei durch die Zeitung seine Namensänderung aller Welt ankündigt. Wurde in unserer Wendei der Bauer von seinem nur Deutsch verstehenden Prediger oder Gerichtsvorsteher nach seinem Eigennamen gefragt, so mußten beide Obrigkeiten schon aus orthographischen Rücksichten demselben eine deutsche Form geben, falls es der Bauer nicht vorzog, seinen Namen selbst in deutscher Übertragung zu nennen. Mögen nun jene beiden Formen – die wendische und deutsche – ursprünglich nebeneinander hergegangen sein, so erhielt doch die deutsche sehr bald als die »feinere«, dazu vor Gericht und Pfarramt geltende das Übergewicht. Jedes Kirchenbuch einer wendischen Pfarre beweist diesen Vorgang; so lesen wir im Totenregister des Pfarramts Krischa vom Jahre 1818 unter Nr. 3: Johann Kurjo, sage Hünichen, desgl. 1819 unter Nr. 4: Johann Ziste, genannt Reinhardt. Bei den Ortsnamen war der Vorgang keineswegs ein anderer. Zuweilen ist nachweislich die Überleitung aus der wendischen Form des Eigennamens in die deutsche eine allmähliche gewesen; im Krischaer Kirchenbuche erscheint z. B. ein Familienname Broidky, also rein wendisch; bei den folgenden Generationen wird daraus ein Brody, Brady, endlich Brode und Brade; desgl. wird aus dem wendischen Honik nach und nach ein Honig, Höhnich, Hänig, Hennig usf.
Als besonders hervorstechende Charakterzüge werden den Wenden Geselligkeit, Heiterkeit, Fröhlichkeit nachgerühmt; auf jedem Jahrmarkte, auf jeder Hochzeit, Kindtaufe, Kirmes und am Tanzabend im Kretscham kann man sich davon überzeugen; merkwürdig nur, daß durch die Melodie ihrer reichen Volkslieder, und zwar auch derjenigen heiteren Charakters, ein Zug von Melancholie hindurchklingt. Nur durch eine mißliche Leidenschaft wird das Bild der Wenden getrübt, dadurch nämlich, daß sie im Bier- und Branntweingenuß zuweilen über die Grenze des Erlaubten und Zuträglichen hinausgehen. Das originelle Sprichwort »Palenc je walenc« (der Branntwein ist ein Umwerfer) drückt leider nur eine Erfahrung aus, die jeder soundso oft auf ihre Wahrheit an sich selbst prüft. Am Abend der Markttage kann man so manchen in Schlangenwindungen seinen Heimweg suchen sehen, und ein Beobachter sagt uns über die Wenden der Niederlausitz bzw. des Spreewaldes ganz Ähnliches: »Eine besondere Freude,« sagt er, »bereitet den Spreewäldern der Besuch der Jahrmärkte, während die jungen Burschen, vom Branntwein erhitzt, auf dem Heimwege nicht selten mit ihren Stöcken beweisen, daß ein Wendenschädel nicht so leicht zerbricht.«
Quellen: R. Andree, Wendische Wanderstudien. Stuttgart 1874. – Th. Fontane, Wanderungen durch die Mark Brandenburg. IV. Bd. Berlin 1882. – Der Artikel wurde 1909 durchgesehen von Dr. Curt Müller, Leipzig.
Der Name »Riesengebirge« kommt nur einem kleinen Teile jener großen Gebirgskette zu, die sich in nordwestlicher Richtung über 220 km weit, von den Quellen der Oder und dem Fuße der Karpaten bis über die Quellen der Lausitzer Neiße unter mancherlei Abwechselungen ihrer Höhe und Breite ausdehnt und die in geographischen Handbüchern und Reisebeschreibungen das sudetische Gebirge oder die Sudeten genannt wird. Der Teil dieser Kette, der im eigentlichen und engeren Sinne das »Riesengebirge« heißt, erstreckt sich etwa von 15° 30' bis 16° ö. L. von Greenwich von 50° 35' bis 50° 55' n. Br. und hat in dieser Ausdehnung, abweichend vom Laufe der Hauptgebirgskette, eine mehr westnordwestliche Richtung.
Vergleicht man die Bergketten, welche Deutschland vom Rhein bis nahe an die Oder und von den Alpen bis an die norddeutsche Tiefebene durchschneiden, mit dem Riesengebirge, so ergibt sich, daß dieses nach Form und Größe und Umriß unter ihnen ebenso sich auszeichnet, wie es selber wiederum von den Alpen übertroffen wird, und so gewissermaßen eine Mittelstellung als subalpinisches Hochgebirge einnimmt. Das Riesengebirge hat freilich nicht die malerischen Kegelformen, wodurch sich die oft viel weniger hohen Vulkangebirge so vieler Gegenden unseres Weltteils und namentlich die der Länder am Rhein und der Elbe so vorteilhaft auszeichnen; noch weniger prangt es mit den himmelanragenden beschneiten Scheiteln, Hörnern und Nadeln, wodurch die Alpen schon von fern jedem empfänglichen Gemüte Staunen und Bewunderung einflößen; allein es übertrifft die übrigen Gebirge Deutschlands, die mit den Alpen in keiner unmittelbaren Verbindung stehen, wie den Schwarzwald und die Schwäbische Alb, die Donaugebirge in Österreich, das Böhmer- und Thüringerwaldgebirge, das Erz- und Fichtelgebirge, die Rhön, den Spessart, den Harz, den Odenwald und die Bergketten am Rhein nicht unbeträchtlich an Kamm- und Gipfelhöhe. An die gegen 1600 m (genauer 1611 m) hohe Riesen- oder Schneekoppe reihen sich in kleinem Raume so viel bedeutende Höhen – Gr. Sturmhaube (1482 m), Kl. Sturmhaube (1416 m), Hohes Rad (1515 m), Reifträger (1350 m) u. a. – daß in Beziehung auf die niederen Teile des Sudetenzuges und gegenüber den deutschen Mittelgebirgen der Name des Riesengebirges gerechtfertigt erscheint, wenn er auch seine Entstehung einer anderen Ursache verdankt. Und während jene oben genannten Gebirge in der Ferne dem Auge nichts als sanfte, wellenförmige, mit Wäldern bewachsene Bergrücken zeigen, unter welchen sich etwa bloß ein einzelner Punkt durch besondere Höhe auszeichnet: so bietet das Riesengebirge dem Blicke einen viel schärfer gezeichneten Aufriß, mehr kahle Berghöhen und stumpf-pyramidale Gipfel, steilere Abhänge und schärfer zugeschnittene Kämme, mehr schroffe Klüfte und finstere Abgründe, und es hat deshalb ein von den allgemeinen Gesichtszügen gewöhnlicher Berge sich sehr unterscheidendes, erhabenes und ehrwürdiges Antlitz, eine Großheit, die zu den Alpen hinstrebt, wenn sie auch deren Größe nicht erreicht.

Der große Teich mit Heinrichsbaude und Schneekoppe.
Auf der südlichen, nach Böhmen zugekehrten Seite ist die Abstufung freilich allmählich, während auf der schlesischen Seite das Gebirge ziemlich steil aus der Tiefe emporstrebt. Die böhmische Seite bietet schon darum, weil sie die ausgedehntere ist, einen größeren Reichtum an eigentümlichen Formen und einen reichhaltigeren Wechsel in der wildromantischen Beschaffenheit ihrer Berge, Täler und Schluchten, als die schlesische Seite; aber sie entbehrt gänzlich der Totalansicht des Hauptkammes, weil fast auf jedem Punkte ein bewaldeter Bergrücken den andern verdeckt und darum der Wanderer nur dann und wann die Spitze der Schneekoppe oder eines ihrer Nachbarn über die Berge hervorragen sieht. Ganz anders gestaltet sich der Anblick auf der schlesischen Seite. Hier zeichnet sich schon in großer Ferne das Riesengebirge im Sommer als hellblaue, im Winter als silberweiße Masse am Horizont ab, die in immer schärfer gezeichneten Formen hervortritt, je mehr man dem Hirschberger Tale, dessen Südrand das Riesengebirge bildet, sich nähert, und wenn dann die den nordöstlichen Talrahmen bildenden Ausläufer des Katzbachgebirges auch zeitweise den Anblick des mächtigen Gebirgswalles dem Auge entziehen, so erhebt er sich doch um so schöner und großartiger vor dem Blicke, wenn man ins Tal selbst eintritt. Was aber dem Bilde noch ganz besonderen Reiz verleiht, ist der Umstand, daß es der vielen Vorberge und Bergrücken wegen, welche kleinere Tallandschaften abgrenzen, mit jedem Schritte des Beobachters ein anderes wird und immer neue Schönheiten entfaltet. Dabei verliert das Ganze nie den großartigen Hintergrund, den die aufsteigende Gebirgswand mit ihren in schwach gebogenen Linien nebeneinander sich erhebenden Kuppen bildet, während ostwärts der Landshuter Kamm und westlich die Züge und Ausläufer des Isergebirges die Perspektive wirkungsreich zusammenhalten.
Die Grenze des ewigen Schnees erreicht das Riesengebirge freilich nicht; aber der Winter ist in seinem Gebiete doch bereits sehr lang und dauert in den oberen Höhen 8-9 Monate. Die vier Sommermonate tragen ganz das Gepräge des Frühlings. Die Luft ist – wenige besonders schwüle Tage im Juli und August ausgenommen – selbst während der Mittagsstunden und bei sonst schönem Wetter gewöhnlich kühl auf diesen Höhen, der Boden aber teils wegen der noch übrigen Winterfeuchtigkeit, teils wegen seiner schwammigen Beschaffenheit, mittels welcher er die Feuchtigkeiten der Atmosphäre leicht an sich saugt, immer naß und sumpfig, so daß die Bergbäche stets reichlich mit Wasser versorgt werden. Hierzu tritt der bunte Schmelz der blühenden Alpenpflanzen, die in verschiedener Aufeinanderfolge hervorbrechen und wieder verschwinden, und die außerordentlich üppige Pflanzenwelt an den Abhängen der Berge und in den Tälern: das alles begünstigt die Idee eines im Vergleich mit dem Unterlande viel längeren und wonnereichen Frühlings.
Der Übergang aus dem ungefähr vier Monate langen Lenz in den Winter ist indes auch wieder viel schneller als im tiefen Lande. Kaum sind nach der Herbstnachtgleiche einige Nebel als Vorboten des nahen Winters eingefallen, als gewöhnlich auch sofort Kälte und stürmisches Schneewetter hereinbricht und der Winter mit allen seinen Unannehmlichkeiten von den Höhen der Sudeten Besitz nimmt. Der erste Schnee bedeckt gewöhnlich nur vorübergehend die »Koppe« und die höchsten Rücken des Kammes. Ist er zeitig, d. h. vor Michaeli, wenn in den Tälern der Pflanzenwuchs noch grünt, eingetreten, so gilt dies den Gebirgsbewohnern als sicheres Zeichen eines noch nachfolgenden schönen Herbstes. Nach und nach aber »rückt der Winter« immer weiter herab, und dann erscheint das Gebirge nach dem Hirschberger Tale hin im schönsten Rahmen der Winterlandschaft, in dem nicht nur die langen blauen Waldstreifen, gesondert von den schneebedeckten, lang sich hinziehenden holzfreien Stellen, sondern auch einzelne Felspartien und kleine Höhen in scharfen Umrissen hervortreten.
Die Höhen der Sudeten sind, wie alle höheren Bergspitzen unseres Planeten, den größeren Teil des Jahres hindurch in Wolken gehüllt. Der Hauptwolkenherd ist aber in dem nordwestlich an das Riesengebirge anstoßenden Isergebirge; aus dieser Gegend werden die Wolken in ihrem weiteren Zuge durch die herrschenden Westwinde fortgetrieben und hüllen zuerst den westlichen Flügel – bald darauf, durch diejenigen Dunstmassen, welche in den waldigen und feuchten Tälern der Siebengründe entstanden sind, verstärkt, auch den östlichen Flügel des Riesengebirges ein. Beinahe das nämliche geschieht, wenn schon geformte Wolkenmassen durch Winde aus entfernten Westgegenden herbeigeführt werden. Das waldige Isergebirge und der westliche Teil des Riesengebirges sind auch alsdann immer die ersten Bollwerke, welche ihrem ferneren Zuge nach Osten ein Hindernis in den Weg legen, und erst, wenn sie an diesen angeprallt sind und sich dann zerteilen, legen abgerissene Massen derselben sich an die hohen Lehnen des Riesengebirgsflügels an und entziehen auch diesen nach und nach dem Anblick des Beschauers. Die Riesenkoppe, die in dieser Richtung den letzten hohen Scheitel dieses Flügels ausmacht, ist daher auch meist der zuletzt eingehüllte Gipfel des Riesengebirges, und wenn es zuweilen geschieht, daß sie allein »eine Haube hat«, während der übrige Gebirgsrücken frei bleibt, so rührt dies davon her, daß die vom Winde herbeigetriebenen Dunstmassen sich rasch am kalten Koppenkegel verdichten, wodurch um denselben eine fortwährend sich erneuernde und infolge der Windesgewalt sich wieder zerteilende Wolkenbildung erzeugt wird, während in größerer Ferne es scheint, als ob ein und dieselbe Wolke dauernd den Kegel verdecke. Die bei solcher Gelegenheit auf der Koppe eintreffenden Touristen spüren nichts weniger, als eine schützende »Haube«, vielmehr aber den auf sie eindringenden, oft eisigen Sturmwind, vor welchem sie nur in den gastlichen Räumen der »Koppenhäuser« sicheren Schutz finden.
Sind alle Bedingungen vorhanden, so hüllt sich oft in wenigen Stunden das ganze Riesengebirge in Wolken ein. Der Gebirgsbewohner bedient sich dann, wenn die Koppe oder einzelne Berggipfel bereits von Wolken bedeckt sind, des Ausdruckes: das Gebirge popelt sich ein; überziehen aber dichte Nebel bereits das ganze Gebirge, zugleich schon die Täler ausfüllend, so heißt es: das Wetter oder der Nebel sackt sich ein; hellt sich dagegen die Witterung wieder auf, so sagt er: das Wetter räumt auf, wird gescheiter. Es ist ein höchst anziehendes Schauspiel, obwohl es den Reisenden oft in Verlegenheit setzt, den Übergang vom heiteren zum bedeckten Himmel und endlich zum Regen zu beobachten. Noch schreitet der Wanderer bei klarer Luft im heiteren Sonnenschein fröhlich dahin und erfreut sich der herrlichsten Aussicht in die Ferne; aber plötzlich fühlt er einen kalten Luftstoß, und dünne, geisterhafte Dunstgebilde jagen an ihm vorüber, worauf er oft schon nach wenig Minuten sich vom dichtesten Nebel eingehüllt sieht. In anderen Fällen eröffnet eine einzelne, nach ihrem Umfange sehr unbedeutend scheinende Wolke, die sich irgendwo, nicht selten auch auf der Oberfläche der Teiche oder in den Schneegruben und anderen Abgründen niederläßt, die Szene; unter den Augen des Zuschauers wächst sie durch unsichtbare Zuflüsse, und daher gleichsam aus ihrer eigenen Masse, zu einem weit verbreiteten Dunstmeere an, dessen ungeheure Wogen bald das ganze Riesengebirge überfluten. Das niedere Land von Schlesien genießt unter solchen Umständen gewöhnlich noch einen oder ein paar Tage eines heiteren Himmels, oder hat bloßen Wind, wenn es bereits auf der benachbarten böhmischen Seite regnet und stürmt, weil das hohe Bollwerk des Gebirges das von Westen heranziehende Gewölk noch eine Zeitlang aufhält. Bald verlieren aber die ungeheuren Wollballen des »Windgewölks« ihre Spannkraft, ändern ihre weißliche Farbe in Grau und Dunkelblau und senken sich immer tiefer an den nordöstlichen Scheiteln der Sudeten herab, bis der Wolkenozean seinen Vorrat über ganz Schlesien ausschüttet.
Nicht immer geht indes das Windgewölk in Regengewölk über; bei schnell sich verändernden Luftströmungen zerteilen sich oft die Dunstmassen ebenso plötzlich, wie sie gekommen, und die Gipfel des Bergzuges ragen dann wieder kühn in die blaue Luft, stolz auf die tiefer gesenkten und auseinander gesprengten Wolken hinabschauend. Der Talbewohner weiß sehr wohl das lichte »Windgewölk«, das oft in wunderbarster Weise sich ballt oder als welligkrauses Wolkenmeer den ganzen Gebirgskamm scheinbar in eine Ebene verwandelt, von den regenbringenden Wolken zu unterscheiden und sagt dann: » Auf dem Gebirge liegt Wind«. Nach wirklich erfolgtem Regen ist aber das Schauspiel noch schöner. Es wogen dann noch ungeheure Wolkenmassen unter tausend phantastischen Formen an den Abhängen der Berge, enthüllen hier einzelne schon wieder von der Sonne beschienene Teile des Gebirges, zeigen sich dort von noch höheren Wolken beschattet, oder verklären sich zusehends zu einzelnen weißen Dunstkreisen, die an dem Saume der Wälder, aus denen der Nebel in Säulen, »Waldweibel« genannt, aufsteigt, sich hinziehen, um in das Nichts zu verschwinden, aus welchem sie kurz zuvor entstanden zu sein schienen. Da denkt der Beobachter wohl an die Wahrheit des Psalmenwortes: »Du rührst die Berge an und sie rauchen!«
Auf den höheren Bergregionen ist der Regen mehr ein starker Nebel und feiner Staubregen. Dagegen werden in den Tälern und den am Fuße des Gebirges gelegenen Flächen die Regen ohne Dazwischenkunft trockener Ostwinde oft sehr heftig und anhaltend. Gewitterregen zumal arten leicht in verheerende Hagelwetter und Wolkenbrüche aus, infolge deren die Gebirgsbäche plötzlich weit über ihre Ufer austreten, Fluren und Dörfer überschwemmen und, Felsstücke, Waldbäume und Gegenstände aller Art mit fortreißend, ihre verheerenden Wirkungen bis ins flache Land hineintragen, worauf sie ebenso schnell sich wieder in ihre gewöhnlichen Rinnsale zurückziehen. Die Gewitter bilden im Gebirge, wenn sie an hohen Bergwänden oder in den Talschluchten sich festsetzen und hier im Zickzack ihre grellen Blitze umherschleudern, während die Donner im Echo sich vervielfachen, eine majestätische Erscheinung. Reisenden, die von einem solchen Wetter, bei welchem die Temperatur oft plötzlich bis unter den Gefrierpunkt herabsinkt, im Freien überrascht werden, bleibt gewöhnlich weiter nichts übrig, als an Ort und Stelle, wo sie sich gerade befinden, auszuharren und das Wetter über sich hinziehen zu lassen. Einen unbeschreiblich großartigen Eindruck aber macht es auf den Wanderer, wenn er auf den hohen Kuppen des Gebirges einen höheren Standpunkt, als die Gewitterwolke selbst, einnimmt und somit »über den Wolken« im Sonnenschein die zu seinen Füßen tobenden Elemente beobachten kann; doch bietet sich eine solche Gelegenheit nur selten, indem in der Regel die Gewitterwolken auch den Kamm des Gebirges einhüllen.
Die großen Waldstrecken des Riesengebirges, die kräuter- und wasserreichen Gehänge seiner Berge und die vielen engen, von der Sonne nur wenige Stunden beschienenen Täler und Schluchten in demselben begünstigen die Ansammlung wässeriger Dünste, und die jährlichen wie die täglichen (oft plötzlichen) Temperaturschwankungen veranlassen reiche Niederschläge in fester und flüssiger Form.
In besonders schneereichen Wintern oder bei anhaltenden Schneestürmen kommt es vor, daß einzelne »Bauden« (so werden die Wohnungen im Gebirge genannt) bis zum Dache hinauf einschneien; dann wühlen die Bewohner von der Haustür aus eine stollenähnliche Öffnung durch den Schnee oder nehmen durch den Dachgiebel ihren Ausgang. Ihr Verkehr mit den Talbewohnern zum Zwecke der Beschaffung von Lebensmitteln oder anderen Bedürfnissen ist dann äußerst erschwert oder gänzlich unmöglich; die Erfahrung hat sie aber gelehrt, sich alljährlich beizeiten mit dem in den Wintermonaten zum Leben Unentbehrlichsten zu versehen.
Die über das Gebirge führenden Pfade werden, noch bevor die Schneezeit eintritt, durch ausgesteckte lange Stangen bezeichnet, die man nach Erfordernis im Laufe des Winters ergänzt und erneuert. Auf denjenigen Wegen, welche am meisten begangen oder mit Holzschuhen befahren werden, bildet der Schnee sehr bald eine genügend feste Unterlage; sind aber Holzarbeiter oder andere Personen genötigt, über frischgefallenen Schnee ihre Wege zu nehmen, so bedienen sie sich der sogenannten Schneereifen, die aus Knieholz gefertigt und mit starken Hanfschnüren durchflochten sind und dadurch, daß man sie unter die Füße festbindet, das Einsinken in die Schneemassen verhindern.
An steilen Abhängen, besonders an den Rändern des großen und kleinen Teiches, im Riesen- und Melzergrunde, in den Schneegruben, in den Siebengründen, in der Kesselgrube und auf ähnlichen Punkten werden durch herbeigewehte Schneemassen gewaltige überhängende Schneewände oder Schneelehnen gebildet, welche, wenn sie bei heftigen Lufterschütterungen oder infolge von Tauwetter zusammenbrechen, verheerende Schneestürze herbeiführen, die im donnernden lawinenartigen Falle alles, was ihnen in den Weg kommt, mit sich fortreißen und unter ihrer Last begraben. Da den Gebirgsbewohnern dergleichen gefährliche Stellen bekannt sind, so werden jetzt Ansiedelungen an denselben vermieden. Leider aber fällt auch in neuerer Zeit, namentlich an den Teichrändern, noch so mancher unkundige Gebirgswanderer seinem Wagemut, mit welchem er die trügerische Schneelehne betritt, zum Opfer. In den Nischen der Koppenteiche und in den Schneegruben hält sich infolge ihrer nach Norden gerichteten Lage der im Winter durch Niederschläge und im Frühjahr durch Lawinenstürze dort aufgehäufte Schnee in einzelnen Flecken nicht selten das ganze Jahr hindurch. In der der erdgeschichtlichen Gegenwart vorausgegangenen eiszeitlichen Periode lagen große Teile des Gebirges über der Schneegrenze, und der kundige Forscher findet Spuren eiszeitlicher Vergletscherung, sowohl am schlesischen wie am böhmischen Abhang. Insbesondere sind die Koppennischen und die Schneegruben nichts anderes als jene in den Alpen mit dem Namen »Kar« bezeichneten Hohlformen, aus denen gewaltige Firnlager einstens, wenn auch nur kleine, Gletscher zu Tal sandten.
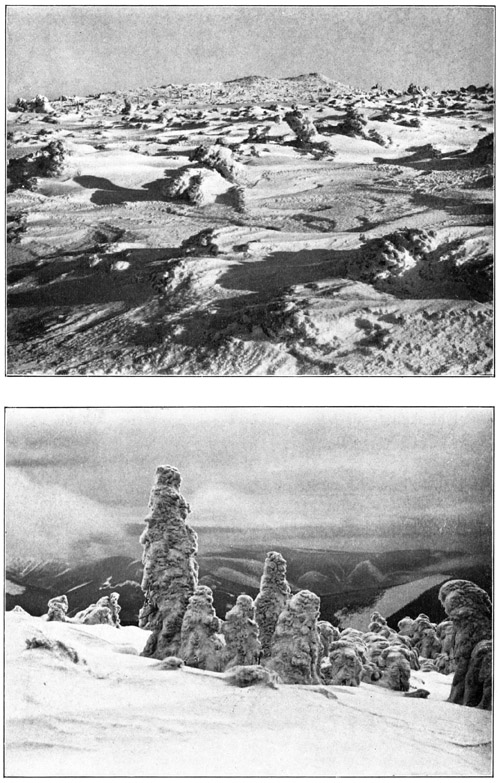
Oben: Winter im Riesengebirge. Kammlandschaft in der Nähe der Schneegrubenbaude.
Nach Photographien von Dr. Kuhfahl, Dresden.
Unten: Winter im Riesengebirge.
Am Hohen Rad. Nach Photographien von Dr. Kuhfahl, Dresden.
Trotz der mancherlei Unannehmlichkeiten, welche der Winter dem Hochgebirge bringt, bietet doch auch die rauhe Jahreszeit in diesen Gegenden ihre besonderen Reize, die von Naturfreunden und rüstigen Bergsteigern gern aufgesucht werden. Außer dem weiten Schneemeere, welches, namentlich von der Schneekoppe aus gesehen, im Wechsel der Tagesbeleuchtung einen großartigen Anblick gewährt, sind es besonders die Wälder, welche infolge der winterlichen Niederschläge einen in der Ebene ganz unbekannten Zauber entfalten. Die unteren Waldgürtel des Gebirges zeigen zwar keine auffälligen Erscheinungen; weiter hinauf aber muß der himmelanstrebende Fichtenbaum der Gewalt des über ihn gekommenen Stärkeren – des Schnees – sich fügen; beladen von der auf ihm ruhenden Last schmiegt er seine Äste immer inniger an den Stamm, bis er, besonders wenn der auf der Erde lagernde Schnee bis in die weit herabgehenden unteren Astpartien hinanreicht, einer kunstvoll durchbrochenen Silberpyramide nicht unähnlich sieht. Die sonderbarsten Gebilde zeigen an der oberen Grenze des Waldgürtels in einer Höhe von 1200 m die schneeverhüllten verkümmerten Fichtengestalten und die Gesträuche des Knieholzes. Im buntesten Wechsel erblickt hier das Auge Elefanten-, Kamel-, Bären- und Hundegestalten, dort Reiter, gebückte Männer und Frauen, Statuen und hundertfältige andere Figuren, deren Betrachtung der Phantasie unerschöpflichen Stoff gibt; man glaubt sich beim Anblick dieser Gebilde ins Zauberreich des Berggeistes versetzt. Nicht minder überrascht fühlt sich der Wanderer von den kristallinischen Reif- und Eisbildungen, welche die Äste und Zweige der Fichten und Tannen zierlich und federartig umhüllen oder sie mit den schönsten Drusenformen überziehen, während namentlich bei eintretender Frühjahrszeit die feuchten Niederschläge, welche an den Stämmen, Ästen, Zweigen und Nadeln gefrieren, einzelne Waldstrecken oft in förmliche Eisdome umwandeln.
Außer diesen Schönheiten, zu denen übrigens auch die zu Kristallgewölben erstarrten Wasserfälle und Kaskaden gezählt werden müssen, bietet das Riesengebirge im Winter mancherlei andere eigenartige Vergnügen, welchen, sobald die nötige Schneeunterlage vorhanden ist, zahlreiche kleinere und größere Gesellschaften aus der Nähe und Ferne sich hingeben. Es sind dies vor allem die beliebten
Hörnerschlittenpartien
Eine Hörnerschlittenfahrt von den Grenzbauden, verkürzt nach Dr. Georg Friedländer. Vor dem »Goldnen Stern« in
Schmiedeberg steht am Silvesterabend eine ganze Wagenburg von wunderlichen Fahrzeugen! Sind das die berühmten Hörnerschlitten? Schlitten sind's merkwürdiger Art, aber noch nicht die Hörnerschlitten. Diese dienen nur zur Talfahrt, jene hier zum Aufstieg. Sie werden von Pferden gezogen, haben nur einen schmalen Rücksitz, das erleichtert dem Pferde das Hinanziehen und ermöglicht uns den ungeschmälerten Rückblick in das Tal, aus dem wir uns langsam erheben. Man fordert jetzt einander zur Bergfahrt auf – immer zwei Personen fahren zusammen –, setzt sich fest und warm zurecht, und bald ist die Reihe geordnet. Wir sind heute 14 Schlitten, aber je mehr, desto lustiger.
Lustig klingeln die Schlitten über den Marktplatz, einer hinter dem andern, doch der lange Zug fällt niemand auf, so gewohnt ist der Anblick. Nun über den Eglitzbach, der schäumend und brausend seine Schneewasser hinabstürzt, nun immer weiter durch die Stadt, die allmählich ihr Gepräge verliert und einen fast dörflichen Charakter annimmt. Wahrlich, sie hat nur
eine Ausdehnung; eine Meile lang und nur
eine Straße! Bloß noch vorbei am Bergwerk! Wie das dampft und treibt und die Erzkarren hinabscharren! Wir verlassen nun die Straße, die über die Paßhöhe weiter nach Landeshut und Liebau führt, und biegen in einer weiten Kurve rechts hinauf, auf einen steilen, hohen Berg, dessen blendend weißer Abhang keine anderen Spuren zeigt, als die von Schlitten. Während wir uns langsam die Kurve hinaufwinden, immer scharf hintereinander, haben wir zum erstenmal die Gelegenheit, unseren Schlittenzug ganz zu übersehen. Ein drolliges Bild! Die 14 Pferde und Schlitten mit ihren Pelzgestalten heben sich scharf ab von dem leuchtenden Schnee. Tief unten liegt die langgestreckte Stadt, dampfen die Schlote, tummeln sich die Menschen; – darüber hinaus erheben sich jenseits die Höhenzüge des Landshuter Kammes, die Friesensteine, und öffnet sich der Blick ins Schmiedeberger Tal. Umgeben von den Vorbergen liegen Buchwald und Erdmannsdorf, liegt Fischbach mit seinen Falkenbergen, und das Katzbachgebirge umsäumt den Horizont in bläulichem Schimmer.
Endlich sind wir im Walde, am Forstkamme. Die Pferde brauchen eine Rast. Der Winter macht aus den Bäumen hoch oben im Gebirge etwas viel Schöneres: da ist jeder Ast, jede Fichtennadel mit einer dünnen, feinen, ganz klaren Eisschicht überzogen, sodaß der ganze Baum und alle seine kleinsten Teile wie überglast erscheinen. Schnee deckt das Unterholz. Ein Volk schwarzer Krähen ist das einzige Lebendige. Wir fahren weiter, und die Großartigkeit nimmt zu. Der Schnee liegt noch tiefer, die kleineren Fichten und Felsblöcke am Wege sind gar nicht mehr zu erkennen, die Äste der hochstämmigen Fichten hängen schwer beladen herab mit ihrer weißen Bürde. Im schmalen Seitentale von Arnsberg ballen sich die Wolken geheimnisvoll zusammen, sie kämpfen gegeneinander, umschlingen sich endlich und steigen wie versöhnt zu unserer lichten Höhe empor. Der Weg wird plötzlich breiter, und ehe wir merken, warum, klingt aus dem ersten Schlitten ein plötzlicher Freudenruf: Wir sind an der Landesgrenze! Die Höhe der Grenzbauden ist erreicht, jenes Plateau, von dem der höchste Gipfel des Gebirges nur noch zwei Stunden entfernt ist. Die Grenzbauden bilden eine Kolonie des böhmischen Dorfes Klein-Aupa, dessen kleine Häuser hier oben weit zerstreut sind. Kein Wald mehr, offenes Land; weiter Blick über die zerstreuten Bauden hin. Nun erklimmt das müde gewordene Pferd den letzten kleinen Abhang. Wir sind am Ziel, in den Grenzbauden. Wie wohltuend umfängt uns die Wärme des Zimmers, von dessen Wänden Kaiser Franz Josef und Kaiser Wilhelm freundlich vereint herabgrüßen. Nun hängen Pelze und Decken an langen Stangen um den mächtigen Ofen, guter böhmischer Kaffee dampft aus den Tassen, und dazu gibt's Preßburger Zwieback, so hart wie der Wintertag, und Brot mit herrlicher Butter. Und oben im Saale schmettern böhmische Musikanten die Tanzweisen, und der Ungarwein steigert die Fröhlichkeit, bis die Uhr die 12. Stunde schlägt.
Wir gehen ein Stück auf den Steinfliesen vor der Baude hin und schauen in die Winternacht der weißen Berge. Es ist mäßig kalt, ganz klarer Himmel, und die Lichter der einsamen Hütten von Klein-Aupa blinken durch die kleinen Scheiben. Nun schlägt die Uhr im Dörflein – langsam, knarrend, unregelmäßig, und was das Merkwürdigste bei dieser Jahreswende ist: alles bleibt still und feierlich.
Nun aber zur
Talfahrt! Draußen werden Fackeln angezündet und die Hörnerschlittenfahrt gerüstet. Der Hörnerschlitten besteht aus einem schmalen Sitz auf langen Kufen, die vorn in Manneshöhe gekrümmt sind wie gewaltige Hörner. Auf den Sitz hockt sich der Reisende, wickelt sich ein und streckt die Beine nach vorn, wo der Schlittenführer mit seinen Füßen das leichte Fahrzeug lenkt und den Flug an den Krümmungen der Schlittenkufen regelt. Wer's noch nie gewagt, dem bangt wohl ein wenig. Aber die Beklemmung schwindet bald vor dem Vergnügen. Wenn der lange Zug geordnet ist und der erste Schlitten das Signal gegeben hat, dann rutschen wir wohl gleich einen kurzen Abhang hinab, aber nur, um eine Strecke wieder anzusteigen, also gezogen zu werden. So geht's noch langsam bis zum Zollhaus an der Grenze. Hier wird gerastet und man rückt sich zurecht. Aber was ist denn das für ein Flammengruß? Wahrhaftig, es ist auf der Koppe! Es sind – wie wir wissen – Schmiedeberger Herren, die ihren Silvester noch höher gefeiert, die mit Eissporen und spitzen Bergstöcken 5000 Fuß hoch gestiegen sind und nun oben vor dem Hospiz in bengalischen Flammen dem Tal verkünden, daß sie glücklich angelangt sind.
Jetzt hinab! Das ist kein Gleiten, das ist Fliegen! Lautlos saust der Schlitten mit uns dahin; wir jauchzen vor Vergnügen und fliegen hintereinander her, immer rascher, immer schneller; manchmal ein hemmender Ruck, daß wir nicht stürzen, und vorbei an jenen Gnomen und Vermummten, vorbei an den Tannenriesen, an Schluchten vorbei, sausend hinab in das Tal, aus dem uns bald hier, bald da ein Licht entgegenflackert. Wir fliegen so weich, wie in der Luft, so still, wie die Vögel, viel schneller als mit Dampf und haben weder Zeit noch Sinn, die Geschicklichkeit zu begreifen, mit der unsere Lenker die Biegungen nehmen und den Lauf der weißen Straße regieren. Nur wenn der Weg einmal weniger steil, schöpfen wir Atem; dann wieder pfeilschnell dahin, lautlos durch die feierliche Stille des Waldes. Nach wenigen Minuten liegt der Wald dahinten, und wir gleiten über den letzten baumlosen Abhang. Ehe wir's überhaupt für möglich halten, sind wir im Städtchen und rutschen nun zwischen den Häusern weiter, am Rathause vorbei, am Ringe – und sind vor der Tür unserer Herberge. Zwei Stunden hinauf – 20 Minuten herab; das war eine Hörnerschlittenfahrt von den Grenzbauden., die von den zur böhmischen
Ortschaft Klein-Aupa gehörenden »Grenzbauden« nach Schmiedeberg oder von der auf dem Kamme selbst in einer Meereshöhe von 1238 m belegenen »Peterbaude« nach Agnetendorf und Hermsdorf unterm Kynast, sowie im kleineren Maßstabe im Hirschberger
Tale vom Kynast nach Hermsdorf ausgeführt werden. Von den genannten Hauptpartien ist die Peterbauden-Partie die lohnendste, da sie neben dem Vergnügen auch einen Gesamteinblick in die geschilderten winterlichen Verhältnisse des Riesengebirges
gewährt und gleichzeitig kostbare Aus- und Fernsichten gestattet. Die Hörnerschlitten, welche in einfacherer Form auch zur Holzabfuhr benutzt werden, fassen 1-2 Personen und haben ihren Namen von den hörnerförmig nach oben zu gebogenen vorderen Kufenenden, zwischen welchen der Führer sitzt, um mit seinen Füßen das Gefährt sicher zu lenken, während es pfeilschnell auf dem gebahnten Pfade hinabgleitet und denselben Weg binnen 15-25 Minuten zurücklegt, für welchen zur Auffahrt, die mittels Pferde- oder Ochsengespannes erfolgt, zwei Stunden und darüber gebraucht wurden. Auch der in allen unseren Mittelgebirgen überraschend schnell sich entwickelnde Schneeschuh- und Rodelsport findet gerade auf dem in wellenförmigen Linien verlaufenden Hauptkamm des Riesengebirges zwischen Schneegrubenbaude und Koppe ein hervorragend geeignetes Terrain, sodaß bei schönem Winterwetter gerade der höchste Teil des Gebirges einen Fremdenverkehr zeigt, der dem Besuch in den besten Sommermonaten zum mindesten gleichkommt.
Was den Bau und die Gliederung des Riesengebirges trifft, so unterscheidet man zwei Parallelkämme, den schlesischen, auf welchem die Grenze von Schlesien und Böhmen sich hinzieht, und den böhmischen Kamm, beide über 1255 m hoch. Jeder dieser Kämme zerfällt in einen Ost- und einen Westflügel, welche schlesischerseits durch die Mädelwiese und böhmischerseits durch den Elbgrund voneinander getrennt sind. Die Ostflügel beider Kämme sind durch den Brunnenberg, die weiße Wiese und den Koppenplan, die Westflügel aber durch die Kesselkoppe und die Elbwiese miteinander verbunden. Auf der ausgedehnteren böhmischen Seite ziehen sich, meist an einen dritten, niedrigeren Parallelzug sich anschließend, noch weitere, gegen 940 m hohe Kämme bis zum Fuße des Gebirges. Das ganze Gebirge ist von vielen Quertälern durchzogen, welche die herrlichsten landschaftlichen Reize einschließen.
Auf dem schlesischen Ostflügel erhebt sich die höchste Kuppe des Riesengebirges und Norddeutschlands überhaupt, die Riesen- oder Schneekoppe, deren Höhe, wie eingangs erwähnt, 1611 m beträgt. Sie fällt nördlich in den Melzergrund und südwestlich in den gegen 625 m tiefen Riesengrund steil ab und bildet einen aus Granit bestehenden, abgestumpften, mit Gneis- und Glimmerschiefergerölle bedeckten Kegel, dessen Plateau von Osten nach Westen 50-70 m lang und von Norden nach Süden 40-50 m breit ist und außer einer im Jahre 1688 erbauten, dem heiligen Laurentius gewidmeten Kapelle zwei »Koppenhäuser« aufweist, von denen das ältere und größere allein gegen 150 Nachtgäste beherbergen kann. Die unter günstigen Umständen bis zu den Hauptstädten Schlesiens und Böhmens sich erstreckende Aussicht auf der Schneekoppe ist überwältigend schön, bietet sich aber in ihrer vollen Klarheit und Schärfe während der verkehrsreichen Monate Juli und August selbst bei wolkenfreiem Himmel der »hegerigen« Atmosphäre wegen nur selten.
Nächst der Schneekoppe gehören zu den bemerkenswertesten Punkten des Ostflügels, welcher mit der 1482 m hohen, einem Granit-Trümmerhaufen gleichenden Sturmhaube abschließt, der forellenreiche kleine und der fischlose große Teich, von denen jener 2½ ha und dieser 6½ ha umfaßt, sowie die turmähnlichen, im Tale weithin sichtbaren Granitmassen des Mittagssteins und der Dreisteine.
Auf dem Westflügel liegt die bereits erwähnte Peterbaude; unweit davon aber erhebt sich der abgestumpfte, mit Granitgeröll besäte Kegel der Sturmkoppe, an welche, nur durch eine unbedeutende Einsenkung von ihr geschieden, der höchste Punkt des Westflügels, das Hohe Rad (s. eingangs die Höhenangabe), dessen halbkugelförmige Kuppe ebenfalls mit Granittrümmern bedeckt ist, sich anschließt, worauf den Schluß dieses Gebirgszuges der einem lang hingestreckten Sargdeckel gleichende, aus zwei gewaltigen Haufen aufgetürmter Granitblöcke bestehende Reifträger = 1350 m bildet. Einen überwältigenden Eindruck auf das Auge des Wanderers üben die am Westende des Hohen Rades gelegenen Schneegruben, deren vielfach zerzackte Felswände über 300 m senkrecht in die grausige Tiefe abfallen. Auf deren Westseite, da, wo ein die große und kleine Schneegrube voneinander trennender Felsgrat sich hinabzieht, bietet Rübezahls Kanzel, die als ein Haufen von übereinander lagernden Granitfelsen unmittelbar hinter der Schneegrubenbaude sich erhebt, eine fast ebenso großartige Aussicht, wie der Schneekoppenkegel.
Der Ostflügel des böhmischen Kammes wird durch den lang sich hinziehenden Brunnenberg (nächst der Schneekoppe der höchste Punkt auf dem Riesengebirge), der auf seinem oberen felsigen Absturze »Rübezahls Lustgarten«, einen an Alpenkräutern außerordentlich reichen Punkt, aufweist, und den durch seine scharfkantigen, aus wilden, tiefen Schluchten schroff aufsteigenden Gneisgrate sich auszeichnenden Ziegenrücken gebildet, von welchem aus der Wanderer, welcher die etwas beschwerliche Partie über diesen Kamm nicht scheut, das Gebirge noch in seiner urwüchsigen Wildheit erschaut und die beste Aussicht auf die Sieben Gründe genießt.
Als Teile des Westflügels der böhmischen Parallelkette sind der rechts am Elbgrunde sich hinziehende, 1428 m hohe Korkonosch und die 1385 m hohe Kesselkoppe, auf welcher sich die herrlichste Aussicht nach Böhmen hinein eröffnet, sowie die den Schneegruben am Hohen Rade vollständig ähnlich sehenden Kesselgruben zu nennen. Am Fuße der Kesselkoppe breitet sich die Elbwiese aus, auf welcher der Gebirgspfad der »großen Kammtour« bei der Elbquelle vorbeiführt.
Der Naturfreund begnügt sich nun allerdings nicht mit dem Gesamteindruck der Hauptkämme des Gebirges, sondern er sucht ihre Einzelheiten und die der sich weitverzweigenden Nebenzüge mit ihren Höhen, Tälern und Schluchten auf, um gerade in dem, was der »Menge am Wege« sich entzieht, die Natur in ihren wunderbarsten Schöpfungen und Schönheiten kennen zu lernen. An den malerischen Reizen, denen er hierbei auf seinen Wanderungen begegnet, haben die Gebirgsflüsse und -bäche mit ihren zahlreichen Wasserfällen und Kaskaden keinen geringen Anteil; sind sie doch gegenüber den starren Formen der Bergzüge und Berge recht eigentlich das belebende Element in dem Antlitz des Gebirges. Zu den besuchtesten Wasserfällen des Riesengebirges gehören der Kochel-, Zacken- und Elbfall. Die beiden ersteren werden durch zwei Nebenflüsse des das eigentliche Riesengebirge vom Isergebirge scheidenden, im raschen Laufe in seinem Felsenbette dem Hirschberger Tale zueilenden Zackenflusses – durch die Kochel und das Zackerle – gebildet. Der Kochelfall, welcher von der den Zacken begleitenden Kunststraße aus in wenig Minuten erreicht wird, gewährt inmitten seiner anheimelnden Umgebung, während sein Wasser über eine Felsenverengung 13 m tief einem trichterartigen Schlunde zustürzt, ein äußerst liebliches Bild. Großartiger in wildromantischer Umgebung ist der Zackenfall, welcher 25 m in eine enge, durch haushohe, senkrechte Felsenwände gebildete Schlucht über mehrere Vorsprünge hinabtost. In noch höherem Maße, jedoch auf Grund anderer Bedingungen, welche in dem offen vor Augen liegenden Gegensatze der riesenhaften Bergerhebungen zu beiden Seiten und der gewaltigen Einsenkung des vor den Füßen des Beobachters sich auftuenden Abgrundes beruhen, überwältigt das Bild des Elbfalles, dessen Wasser 47-50 m tief in den Elbgrund sich hinabstürzt. Höchst lohnend ist es für den beim Elbfalle weilenden Gebirgsreisenden, auch den nahen Pantschefall zu besuchen, welcher am Abhange des Korkonosch seinen Silberschaum 251 m tief dem Elbseiffen, wie hier die Elbe noch genannt wird, zuschickt. Dieser Punkt ist aber auch noch aus dem Grunde einer der interessantesten im ganzen Riesengebirge, weil er in einem Bilde den Anblick der Pflanzengürtel gestattet, wie dieselben vom Tannen- und Fichtenwuchsstande tief unten im Elbgrunde aus bis zur höchsten Erhebung des Kammes, wo über dem Knieholze die kahle Kuppe des Hohen Rades hervorragt, sich gestalten. Der Blick über die zum großen Teil senkrecht sich abstürzenden Felsränder des Korkonoschfußes in die schwindelerregende Tiefe des Elbgrundes hinab ist großartig.
In geognostischer Beziehung ist zu bemerken, daß der Nordrand des Riesengebirges ganz aus Granit besteht, welcher am Schmiedeberger Kamm und einzelnen nördlichen Abdachungen porphyrartig auftritt, während auf der böhmischen Seite, südlich von einer die Urgebirgsarten scheidenden Grenzlinie, welche vom Gipfel der Schneekoppe aus im Weißwasser- und Elbgrunde bis weiter nach Böhmen hinein sich erstreckt, Gneis und Glimmerschiefer, von denen der letztere zum Teil auch den Granit noch bedeckt, die Grundmasse bilden. Geologisch merkwürdig ist der Basaltdurchbruch am Westrande der kleinen Schneegrube, der bis jetzt bekannten größten Höhe, bis zu welcher die Basalt-Eruption in Deutschland sich zeigt. Der dort zutage tretende Basaltgang, welcher einst die Granitmassen durchbrochen, ist an seiner südwestlichen Seite so fest mit dem Granit verwachsen, daß der Geologe v. Gersdorf, welcher am Ende des vorigen Jahrhunderts diesen Basalt entdeckte, aus dem Gestein eine Dose anfertigen lassen konnte, welche zur Hälfte aus Granit und zur Hälfte aus Basalt bestand.
In dem großen Granitgebiete des Riesengebirges zwischen Reichenberg und Hirschberg treffen wir nördlich Gneisdecken mit eingelagertem Glimmerschiefer, südöstlich aber in den höchsten Regionen Glimmerschieferumhüllungen mit eingelagertem, körnigem Kalkstein. Der Granit bedingt die Abrundung der nördlichen Kammkuppen, während der Gneis, aus welchem einige größere Höhen auf der böhmischen Seite bestehen, steile und schneidige Gratbildungen, wie sie der Ziegenrücken aufweist, hervorruft.
Die reichbedachte Pflanzenwelt des Riesengebirges hat je nach der Höhe, zu welcher sie aufsteigt, ihren ausgeprägten, eigentümlichen Charakter. Der Fuß des Gebirges gehört noch dem Pflanzengebiete der Ebene an, zu deren charakteristischen Bäumen die Eiche und die Kiefer gehören; mit 533 m Höhe aber beginnt die Region der Vorberge, für welche die Fichte und die Tanne charakteristisch sind, worauf man mit 1130 m in die Region des Hochgebirges eintritt und hier als charakteristischen Vertreter des Baumwuchses das Knieholz antrifft. Die Getreidegrenze stellt sich auf 1035 m; doch ist die Reife des Roggens schon in einer Höhe von 500 m nicht mehr gesichert. Selbst der Hafer, welcher in einer Höhe von gegen 800 m noch häufig angebaut wird, unterliegt oft, ehe er völlig reift, dem frühzeitigen Winter.
Quelle: Das Riesengebirge und seine Bewohner, von Dr. K. Hofer, herausgegeben von der Gesellschaft des vaterländischen Museums in Böhmen, Prag 1841. – Neue Beiträge von Lehrer Hänsel in Hirschberg.
Bevölkerung, Leben und Sitten.
Ungezählte Jahrhunderte haben die Hochkämme und Gipfel des Bergwalles, der den böhmischen Kessel von dem schlesischen Flachlande trennt, in unnahbarer Majestät auf das Menschengetriebe herabgeblickt, das sich zu ihren Füßen abspielte und in wechselnder Wellenbewegung keltische, germanische, slawische und wieder germanische Scharen an ihnen vorüberführte. Zu Beginn unserer Zeitrechnung finden wir suevische, das sind ostgermanische, Stämme auf beiden Seiten der Sudeten ansässig, die Markomannen in Böhmen, das sie nach den vor ihnen ausgewanderten keltischen Bojern Böheim (Boihaemum), d. i. Bojerheim, nannten, die Lygier und später die Vandalen (Silinger) in Schlesien. Die Germanen gaben dem Hauptfluß Böhmens den Namen Elbe (= Weißwasser); an einen ihrer Stämme, die Korkontier, erinnert noch der Bergname Krokonosch oder Korkonosch, dessen Pluralform (krkonose) im Tschechischen für das ganze Riesengebirge gebraucht wird. Ums Jahr 1000 waren Böhmen und Schlesien rein slawische Länder. Aber Tschechen wie Polen sind nur an wenigen, leichter zugänglichen Stellen über die Schwelle des Gebirgsrandes tiefer in dessen Inneres eingedrungen; hier haben die polnischen Siedelungen schon vor der Wand des Bober-Katzbachgebirges Halt gemacht, in dessen Bereich indes die Dörfer weit überwiegend, die Städte, mit einziger Ausnahme von Lähn (vlan), ausschließlich deutsche Namen tragen. Allerdings finden sich auch im Hirschberger Tale einige slawische Ortsnamen, Jannowitz, Lomitz und wohl auch Straupitz, aber nur an der Nordoststrecke, wo die Boberschlucht die natürliche Zugangspforte zum Tale bildete. Vielleicht haben sich polnische Jäger in der Verfolgung des Edelwildes, nach dem der Fluß benannt ist, des Bibers (polnisch Bobr), vorübergehend hier niedergelassen.
Gegen Ende des 12. Jahrhunderts beginnt dann die ewig denkwürdige Rückeroberung der deutschen Ostmark, die in wenig mehr als zwei Jahrhunderten den größten Teil Schlesiens und in wechselnder Breite auch den Rand des böhmischen Kessels dem deutschen Volkstum wiedergewann. Durch sie sind die Sudeten ein deutsches Bergland geworden. Erst in neuerer Zeit sind auch diesseits des Kammes in die Gebirgsorte zahlreiche tschechische Handwerker, besonders Schneider und Schuster, eingewandert, die aber in der deutschen Bevölkerung aufgehen. Die große (mitteldeutsche) Kolonisation bemächtigte sich bald der Hügel- und Vorgebirgslandschaft; bei weitem die meisten der noch heute bestehenden Ortschaften, auch im Hirschberger Tal, sind schon im 13. Jahrhundert gegründet worden. Ja, die deutschen Neusiedler schoben ihre Niederlassungen überraschend schnell bis unmittelbar an den Fuß des Hochgebirges vor. Doch hatten wohl die damals noch wasserreicheren Gebirgsbäche breite Gassen durch den Urwald gezogen, welche im Tale verhältnismäßig bequeme Zugänge boten. Vielleicht befanden sich auch unter jenen ersten Einwanderern schon Bergleute und ähnliche Gewerbetreibende; denn um die Mitte des 14. Jahrhunderts war sowohl das Eisen- und Schmiedewerk im Eglitztal wie die Schreiberhauer Glashütte anscheinend schon längere Zeit im Betriebe. Die Ortschaften sind größtenteils nach dem Anleger oder dem Führer (»Weiser«) der Neusiedler (»Neubauern«) benannt, an dessen Namen, wie im ganzen mitteldeutschen Kolonisationsgebiet die Bezeichnung »Dorf« (= Neuanlage, Neudorf) angefügt ist, z. B. Cunnersdorf (aus Kunradsdorf), Herischdorf (aus Heroldisdorf), Hermsdorf (aus Hermannsdorf) usw. Waren die Ansiedler alle oder überwiegend aus demselben Orte, so übertrugen sie auch wohl dessen Namen auf die Neugründung, z. B. Kauffung, Rudelstadt u. a. Aber manche Ortsnamen erzählen uns auch von der Natur und den Bodenschätzen, die die Gründer vorfanden (Warmbrunn, Kupferberg u. a.), oder von den Kämpfen, die sie gegen eine wilde Natur und wilde Tiere zu führen hatten, z. B. Wolfshau, Rohrlach (aus Rürlach, von rüren, graben, schürfen, ackern) u. a. Besonders charakteristisch für das Gebirge sind die Ortsnamen auf -seifen und -hübel (= Hügel).
Vielleicht wurde schon der erste, niederländische Strom deutscher Auswanderer (»flämische Kerle«) vorzugsweise in die Ödländereien gelenkt; das häufige Vorkommen mancher Personennamen, Boer im Waldenburger Gebirge, Friese in der Schmiedeberger Gegend (nach einem Besitzer dieses Namens sind die Friesensteine getauft), scheint dafür zu sprechen. Doch ist auch im Gebirge wie im übrigen Schlesien und angrenzenden Böhmen die Hauptmasse der Bevölkerung mitteldeutschen Ursprungs. Nach den Ortsnamen zu schließen, haben sich thüringische Einwanderer im Bobertal um Rudelstadt, hessische im Katzbachtal um Kauffung und Schönau angesiedelt. Indes überwogen im eigentlichen Gebirge die ostfränkischen Einwanderer bei weitem; denn ihre Mundart mit der Verkleinerungssilbe -le (Voaterla = Väterchen) steht der im Maintale gesprochenen sehr nahe; ostfränkisch ist auch die dem schlesischen Gebirgsdialekt eigene Vokalisierung des auslautenden -n: will ma dâr rîpel doas ganza ixla ze schanda reita (will mir der Rüpel das ganze Öchslein zuschanden reiten).
Geistige Beweglichkeit hat die deutschen Schlesier von jeher ausgezeichnet und ihnen wiederholt die Führung in der Entwickelung des deutschen Schrifttums zugewiesen. Frohsinn und Leichtlebigkeit, die einerseits ihnen den Ehrennamen der »gemütlichen Schlesier« eintrugen, andererseits leicht in Sentimentalität und Weichlichkeit umschlagen, sind allen Deutschschlesiern eigen, eine tief wurzelnde Heimatsliebe und ausgesprochene Begabung für mechanische Fertigkeiten besonders dem Gebirgsbewohner. Obwohl die Hirtenbevölkerung des Binnengebirges, teilweise durch ihren Beruf zu einem halbnomadischen Leben verurteilt ist und daher ihren Wohnort innerhalb des Gebirges leicht wechselt, hängt sie doch mit rührender Anhänglichkeit an den Bergen der Heimat. Der Anblick einer charakteristischen Bergform, der Klang eines heimischen Lautes in der Fremde trifft den Schlesier ins Herz und facht die nie ganz schlummernde Sehnsucht nach der Heimat zu verzehrender Stärke an. Die Treuherzigkeit und biedere Einfalt, Genügsamkeit, Gastfreundschaft und Dienstfertigkeit der Gebirgsbauern, von der alle älteren Besucher des Lobes voll sind, wird man heute mehr abseits der großen Heerstraßen des Fremdenverkehrs suchen müssen. Auch in körperlicher Hinsicht hat der Sudetenbewohner eine gute Mitgift von der Natur mitbekommen; unter der Weber- und Fabrikbevölkerung freilich, die durch Notjahre und Stubenarbeit in ihrer körperlichen Entwickelung zurückgeblieben ist, trifft man mehr zierliche als kräftige Gestalten an, aber der eigentliche Gebirgsbauer ist von ebenmäßigem, starkem und zähem Körperbau; die Langlebigkeit war ehedem berühmt; Greise von 80, 90 und selbst 100 Jahren gehören auch jetzt noch nicht zu den Seltenheiten. Die Träger und Führer des Gebirges entwickeln in der Lenkung schwerbepackter Schlitten eine erstaunliche Gewandtheit und Körperkraft; Lasten von 1½-2 Zentnern tragen sie stundenweit von der Höhe des Kammes bis zum nächsten Dorf. Aber die schwere Arbeit zieht die Körper zusammen und macht sie früh altern; die wetterharten, durchfurchten Gesichtszüge lassen die Leute meist älter erscheinen als sie sind. Nicht umsonst sagt man, daß die Gebirgsluft zehrt. Aber unter günstigen Verhältnissen, bei guter Kost und gesunder Beschäftigung gedeiht auch heute noch ein stattlicher Menschenschlag. Neben den Wagen, die das Langholz der Gebirgswälder den Holzstoffabriken des Tales zuführen, sieht man oft wahre Enakssöhne von hohem Wuchs und mächtiger Schulterbreite einherschreiten. In den Binnentälern des Gebirges überraschen nicht selten die jungen Burschen und Mädchen durch kühnen Schnitt des Gesichtes und Feinheit der Züge, die mehr an die Bewohner der deutschen Alpen erinnern. In der Tat haben wir hier es mit den Nachkommen deutscher Älpler zu tun, welche zusammen mit mitteldeutschen (meißnischen) Bergleuten im 16. Jahrhundert einwanderten und das Binnengebirge nicht bloß im Riesengebirge, sondern auch in anderen Teilen der Sudeten, z. B. im Altvater, erst erschlossen.
Um das Jahr 1300 mag die Verteilung von Wald und Flur im Hirschberger Tale in ihren Grundzügen schon das Bild der Jetztzeit gezeigt haben, obwohl der Wald ungleich größeren Raum bedeckte. Nur die hohe Bergwand im Süden starrte noch zwei Jahrhunderte im finsteren, lückenlosen Waldkleide. Im Jahre 1511 drangen meißnische Bergleute bis in den Riesengrund vor und durchwühlten den Leib des Gebirges nach verborgenen Schätzen. Wertvoller aber erwiesen sich die Schätze, die der Gebirgsboden auf seiner Oberfläche trug, in den herrlichen Waldungen. Diesen Reichtum an Nutz- und Brennholz begann man jetzt (noch in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts) weniger für den heimischen Bergbau als für das große Kuttenberger Werk auszunutzen. Die geschlagenen Stämme wurden auf dem Wasserwege zu Tal gefördert, »getriftet«. Diese Arbeit erforderte geschulte Kräfte, wie sie besonders in den deutschen (und romanischen) Alpen, wo der Bergbau seit keltischer und römischer Zeit blühte, zu Hause waren. Aus dem Steirischen, Salzburgischen und Tirol wanderten zahlreiche Holzarbeiter ins Riesengebirge ein, von denen wenigstens ein Teil nachweislich zurückblieb und sich dauernd im Binnengebirge niederließ. Viele von den älteren Familiennamen im Elb- und Aupatal wie in ihren Nebentälern tragen daher in Bildung und zuweilen selbst noch in ihrer Bedeutung ein echt bajuvarisches Gepräge.
Um die verkleinerten Holzstämme dem Bergbach zuzuführen, wurden an den Bergwänden in Zickzacklinien verlaufende Holzrinnen, »Riesen«, angelegt; diese leicht gezimmerten Bauten sind bis auf die letzte Spur verschwunden, leben aber noch in mehreren Ortsbezeichnungen fort: Riesengrund, Riesenhain, Riesenkämmen u. a. Ja, wahrscheinlich ist auch der Name für den höchsten Berg (»Riesenkoppe« = Schneekoppe) und danach für das ganze »Riesengebirge« auf sie zurückzuführen. Um zum Flößen des Holzes die nötige Wasserkraft zu gewinnen, wurden an geeigneten Stellen geschrotete Talsperren, »Klausen«, errichtet, welche den Klausengründen und -graben den Namen gaben. Das Öffnen der Klausen, »Schlagen«, erforderte besondere Kraft und Geschicklichkeit. Überreste dieser Bauten sind noch an manchen Stellen zu finden; das Holz der in den Boden getriebenen Balken hat sich so vortrefflich erhalten, daß es zu Schindeln und anderen Holzarbeiten verwendet wird. Wo die Holzscheite im Flußbett sich stauten, wurden sie mit den Haken der »Griesbeile« gefaßt und in die hochgehenden Wogen hinausgestoßen. Am Ausgange der Gebirgstäler wurden sie durch die Querrechen der »Lände« aufgefangen und dann gelandet. Alle diese mit den Sachen aus Oberdeutschland eingeführten Ausdrücke sind noch heute bekannt. Auch außerdem hat sich manches oberdeutsche Sprachgut erhalten: »Kloam« (= Elbklemme), »Boden« für eine von steil aufragenden oder abfallenden Bergwänden begrenzte Fläche (davon Bohnwies = Bodenwiese), »Eben« für eine weniger scharf abgegrenzte Fläche, »Krakse« neben der mitteldeutschen Bezeichnung »Reff« (daher Reifträger, d. i. Reffträger) für das auf dem Rücken getragene Holzgestell u. a. Auch in den wirtschaftlichen Formen des Binnengebirges ist oberdeutscher Brauch noch erkennbar, vor allem im Sennereibetrieb auf dem Kamm. Wie in den Alpen, so erfolgte auch bis vor kurzem im (böhmischen) Riesengebirge der Auftrieb nach dem Kamm in festlicher Weise gleich nach dem Pfingstfest unter Schalmeienbegleitung und wohlabgestimmtem Schellengeläut. Das Leittier schreitet blumengeschmückt voran, Mädchen und Burschen folgen in festlichem Putz der freudig erregten Schar. Zum Transport des Heues werden, wie in den Alpen, nicht bloß auf der Schneebahn, sondern auch auf geeigneten Grasflächen die plumpen Hörnerschlitten gebraucht; daneben waren von jeher kleinere Schlitten von eigentümlicher Bauart, in den französischen Alpen ramasses oder luches genannt, im Gebrauche. Wie gefährlich diese Beförderung ist, das bezeugen die hier und da noch vorhandenen »Marterln«, die wohl ebenfalls auf oberdeutschen Gebrauch zurückzuführen sind. Zur Beherbergung der Senner und des Melkviehs wurden Sennhütten, »Sommerbauden«, auf dem Kamm errichtet, wohl schon im 16. Jahrhundert. Bald entspann sich auch ein lebhafterer Verkehr von Schlesien über den Kamm hinüber nach Böhmen. Im Jahre 1625 wurde die Wiesenbaude als ein echtes Tauernhaus zur Bewirtung und Beherbergung von Trägern und Handelsleuten erbaut; sie war die erste bleibende Niederlassung auf dem Kamm. Der Verkehr hier oben steigerte sich noch durch den Bau der dem heiligen Laurentius gewidmeten Koppenkapelle (1665-1681), welche im Notfall auch Unterschlupf bot. Mit Ausnahme der Hampelbaude, welche als Wohnung für den Teichwärter des Kleinen Teiches schon vor 1670 bestand, sind die Bauden am südlichen und nördlichen Gehänge des Kammes meist in der zweiten Hälfte des 18., die Gasthäuser auf dem Kamm erst im 19. Jahrhundert entstanden.
Auch ein eigentümlicher Erwerbszweig, der später namentlich auf der schlesischen Seite des Gebirges blühte, das Laborantentum, dürfte auf die oberdeutschen Einwanderer des 16. Jahrhunderts zurückgehen. Die Zunft der Laboranten hatte ihren Sitz in Krummhübel, wo der letzte Laborant 1894 gestorben ist; ihre Blütezeit fällt vor das Jahr 1829, in dem die preußische Medizinalbehörde ihrem Betriebe bestimmte Schranken setzte. »Ein Apothekerdorf! Gewiß eine geographische Merkwürdigkeit!« ruft ein Schriftsteller aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts mit Recht aus; denn diese Laboranten waren eine Art Laienapotheker, welche schon im 18. Jahrhundert als eine geschlossene Zunft organisiert waren. Von der landläufigen Sage, daß die Zunft der Laboranten 1700 von zwei böhmischen Studenten, die eines Duells wegen aus Prag geflüchtet seien, begründet worden sei, ist nur der dürftigste Kern, die Kunde von fremder Herkunft des Gewerbes, als geschichtlich anzusehen. Gewerbe und Name waren sicher schon früher vorhanden.
Die im 13. Jahrhundert von Deutschen erbauten Städte zeigen mit den früheren polnischen »Städten« nur insofern eine gewisse Ähnlichkeit als das Rathaus in der Mitte des Marktplatzes errichtet ist. Der deutsche Markt ist viereckig, nicht ringförmig, obwohl man die Bezeichnung für den alten slawischen »Ring« beibehielt. In den Gebirgsstädten ziehen sich unter den vorspringenden ersten Stockwerken der Häuser rings um den Markt die »Lauben«, offene Verkaufshallen, die nach den dahinter liegenden Lagergewölben genannt wurden. Die Kirche liegt meist in der Nähe des Marktes, selten vor der Stadt. Die Scheuern oder »Scheunen« der Ackerbürger waren entweder durch eine Quergasse von den Markthäusern getrennt, oder lagen auch wohl, wie es Goethe in »Hermann und Dorothea« schildert, in langer Zeile vor der Stadt.
Die ursprüngliche Anlage der Dörfer wie die Bauart der Häuser und die Form der Gehöfte im Riesengebirge ist die fränkische. Die Eigentümlichkeiten derselben: den geschlossenen Hof, die Stellung des Wohnhauses mit der Giebelseite nach der Dorfgasse, den Eingang an der Langseite vom Hofe aus, die Verbindung des Stalles mit den Wohnräumen unter einem Dach, die Trennung von Haus und Scheune, die überwiegende Zweistöckigkeit, den Bohlen- und Fachwerkbau treffen wir auch in altschlesischen Bauernhäusern im Gebirge wieder. Das fränkische Haus ist eine Spielart des oberdeutschen oder Flurhallen-Hauses, dessen wichtigster, kennzeichnender Bestandteil der Hausflur ist. Auf der böhmischen Seite begegnet sich der deutsche Blockwandbau mit dem vermischten Block- und Pfahlwandbau der Tschechen. Jetzt sind Holzbauten nur noch im waldreichen Innern des Gebirges vorherrschend. Auch der rasch und billig herzustellende Fachwerkbau hat dem Ziegelbau weichen müssen; nur die Scheune und das steilgiebelige Dach werden noch öfter aus Holz hergestellt. Stroh- und Schindeldächer sind noch häufiger, als man erwarten sollte.
Sobald die Ansiedelungen in das Binnengebirge tiefer eindringen, löst sich die den Gebirgsdörfern eigentümliche lange Häuserzeile auf. Die vereinzelt an den Abhängen des Gebirges umherliegenden Häuser, »Bauden«, wie sie im Riesengebirge und Isergebirge mit einem gut deutschen, von den Tschechen übernommenen Worte (bouda) genannt werden, zeigen zwar im Grundriß durchaus die fränkische Anlage, aber auch manche Ähnlichkeit mit dem Hause des deutschen Älplers. Wenn möglich, ist die der Bergwand zugekehrte Rückseite des Hauses so angelegt, daß man das Heu vom Berge geradeswegs auf den Heuboden schaffen kann. Das Dach ist steil, damit der Schnee sich nicht zu gefährlichen Massen häufe. Von einem aus Glimmerschieferplatten bestehenden Gange, der »Brücke«, die sich an der anderen Langseite hinzieht, gelangen wir durch einen Vorbau, das »Bürhäusla«, oder daran vorbei zur Haustür, vor der sich öfter noch eine durch einen Schnallendrücker geschlossene Halbtür, das »Gatter«, befindet. Die Haustür führt unmittelbar in den Flur, das »Haus«, das sich durch die ganze Breite der Baude hindurchzieht; auf der rechten oder linken Seite liegt die Wohnstube, in den Einkehrhäusern die Gaststube mit einer Kammer, auf der anderen Seite, außer einer kleinen, einfensterigen Stube für einen »Hausmann«, die Vorratskammern, »Keller«, die also nicht unter, sondern über der Erde sich befinden. Meist ist durch die Milchkammer ein Quell hindurchgeleitet. An die Keller schließen sich die Stallungen an. So tritt uns die ursprüngliche Dreiteilung des altfränkischen oder oberdeutschen Hauses noch deutlicher vor Augen.
Die ansässige Bevölkerung im Binnengebirge nährt sich noch immer vorwiegend von der Viehwirtschaft. Die Wartung des Viehs im Hause liegt den Frauen ob, ebenso das Buttern und Bereiten des Käses. Mit der weithin geschätzten Gebirgsbutter wird ein schwunghafter Handel bis Stettin und Hamburg getrieben; weniger geschätzt sind die kleinen Gebirgskäse, die auf den schmalen Fenstersimsen der Außenwände zum Trocknen im Freien aufgehängt werden; einigen Ruf genießt nur der grüne, mit Gebirgskräutern stark gewürzte Koppenkäse. Die Kinder und alten Frauen sind im Walde mit Einsammeln von Pilzen, Beeren und Kräutern, die von Händlern und Destillateuren aufgekauft werden, den ganzen Sommer über tätig. Als Spezialitäten des Gebirges gelten der weit über Deutschland versandte »Stonsdorfer Bitter« und der mehr von Einheimischen geschätzte Kiesewalder »Ebereschenschnaps«. Alle schwereren Arbeiten, wie das Schneiden des Grases und das Einbringen des Heues, werden von den Männern verrichtet; für ihre übrige Zeit finden sie in den herrschaftlichen Waldungen lohnende Arbeit, im Sommer mit dem Fällen, im Winter mit dem »Rücken«, d. h. Zutalfahren des Holzes auf Hörnerschlitten. Einen dürftigen Ersatz für die immer mehr zurückgehende Handweberei gibt die Herstellung von mancherlei Holzwaren, namentlich Streichhölzerschachteln. Manches ursprüngliche Gewerbe, das von der Poesie des deutschen Bergwaldes unzertrennlich erscheint, ist so gut wie verschwunden; der Köhler und der Roamfaßlamann, der seine Kienrußtönnchen »drei Schtick an Bihma« auf den Jahrmärkten ausbot, sind aussterbende Typen. Wie in allen Grenzgebirgen, sind auch im Riesengebirge und Isergebirge zwei gesetzlich verbotene Erwerbsarten, die aber in weiten Kreisen der einheimischen Bevölkerung nicht für unehrenhaft gelten, wie es scheint, unausrottbar, wenn sie sich auch zum Glück jetzt in engeren Grenzen halten als vor Jahrzehnten: der Schmuggel und die Wilddieberei. Der Schleichhandel von Schlesien nach Böhmen befaßt sich hauptsächlich mit Zucker, Kaffee und Tabak, umgekehrt mit Butter und Wein. Gefährlicher als der im allgemeinen harmlose »Pascher« ist der Wilddieb. Blutige Zusammenstöße mit den Förstern gehörten bis vor kurzem nicht zu den Seltenheiten. Eine wirkliche Begebenheit derart hat Th. Fontane ausgesponnen zu einem meisterhaften Roman: Quitt, in dem er die Gebirgsbevölkerung mit realistischer Treue schildert. In den letzten beiden Jahrzehnten hat sich die allgemeine Lebensführung der Gebirgsbevölkerung, hauptsächlich durch die Wirksamkeit des Riesengebirgsvereins, außerordentlich gehoben. Durch die Fremdenindustrie ist in die einst armen Weberdörfer ein behaglicher Wohlstand eingekehrt, der sich schon äußerlich in den meist massiven Wohnhäusern, den sorgfältig gepflegten Vorgärten und in dem reichen Blumenschmuck der Fenstersimse kundgibt.
Aber freilich ist mit dem Einzuge des modernen Geistes auch viel von der guten alten Sitte und manch schöner Brauch verloren gegangen. Namentlich unter der leichtlebigen Fabrikbevölkerung ist ein Hang zu lärmenden und nicht immer harmlosen Lustbarkeiten unverkennbar; mit einem gewissen Stolze sagt so ein junger Bursche von seinem Wohnort: »Ja, 's is a liederliches Näst.« Weit konservativer ist die Hirtenbevölkerung des Binnengebirges. Hier hat sich viel von der alten Einfachheit und Herzenseinfalt, aber auch viel von dem alten Aberglauben erhalten. Steinsammler durchstöbern die innersten Winkel des Gebirges nach gleißenden Erzadern und verborgenen Schätzen in Felsklüften, die sich in der Johannisnacht von selbst öffnen; in den handschriftlich noch vielfach erhaltenen »Walenbüchlein«, deren Kern unzweifelhaft etwa ein halbes Jahrtausend alt ist, verfolgen sie die Spuren der »Venediger«, welche in vergangenen Jahrhunderten unermeßliche Reichtümer fortschleppten und sich im welschen Lande von schlesischem Golde prächtige Paläste erbauten. Hin und wieder sieht man sie auch jetzt noch durchs Geklüft huschen. In der Waldeinsamkeit erscheinen den Holzschlägern die Waldweiblein und der wilde Jäger, der noch in allen wesentlichen Zügen die alte Wodansnatur zur Schau trägt. An den langen Winterabenden, wenn der Lampe trauter Schein die Familie versammelt, erzählt man sich von dem Klausenmann, der wegen verübter Mordtat mit dem gefährlichen Amt, die Klause zu schlagen, betraut wurde und seine Schuld mit dem Tode büßte, von der Klausenkatze, die seitdem um die Unglücksstätte streicht, von dem Wassermann, der seine Opfer in Teichen und Bächen durch tückische Strudel in die Tiefe zieht, vom Feuermann, der den schlafenden Bewohnern nächtlicherweile den roten Hahn aufs Dach setzt, merkwürdigerweise aber selten oder nie von dem Berggeist, der in der ganzen deutschen Welt als spezifischer Schutzgeist des Riesengebirges bekannt ist, von – Rübezahl.
Keine andere Gestalt der deutschen Sage hat eine so allgemeine Verbreitung gefunden und ist in allen deutschen Gauen so volkstümlich geworden als Rübezahl, dessen launenhafte, oft von gutem Humor diktierte Streiche noch heute das Entzücken von Alt und Jung sind. Diese Volkstümlichkeit hat ihren Ausgang unzweifelhaft vom Riesengebirge genommen; in der nächsten Umgebung der Koppe ist von alters her des Berggeistes Wohnstätte. Um so auffallender ist es, daß die Kenntnisse, die die Gebirgsleute von ihm haben, ihnen auf literarischem Wege zugeflogen sind. Und nach den Berichten älterer glaubwürdiger Schriftsteller ist es auch in früheren Jahrhunderten nicht anders gewesen. Wie ist dieser Widerspruch in der Entwickelung der Sage zu erklären? Nach einer bestimmten Nachricht ist sie von den Bergleuten, welche um 1500 das Innere des Gebirges erschlossen, aus dem Harze ins Riesengebirge verpflanzt worden; darin erscheint der Berggeist durchaus als eines der sogenannten Bergmännlein, die »kaum drei Spannen lang, in Gestalt eines grauen, alten Männleins, mit einer Bergkappe verhaubet und einem Leder begürtet«, in reichen Bergwerken anscheinend geschäftig hin und wieder fahren. Ursprünglich war die Sage rein bergmännischer Natur und nur unter den Bergleuten im Schwange; Rübezahl ist ein Schätze hütender, unter Umständen spendender Geist, »ein Herr und Gebieter der Metalle und Schätze«. Unbefugten freilich wehrt er den Zugang zu seinen Schätzen, indem er sie durch allerlei Verkleidungen und Verwandlungen foppt oder auch durch »schreckliche Wetter« zurückscheucht, also durch Mittel, wie sie ihm die wetterwendische Natur des Gebirgsklimas an die Hand gab: Donner, Blitz, Hagel und Platzregen. Diesen letzten, ganz unwesentlichen Zug haben erst die späteren Erzähler, die die ursprüngliche Sage nicht mehr kannten, zur Hauptsache gemacht. Von den (mitteldeutschen) Bergleuten ging die Sage zu den (oberdeutschen) »Schwazern« über, welche bereits dem »Rübenzagel« (d. i. Rübenschwanz), wie es scheint, allerlei Streiche, die mit seinem ursprünglichen Wesen und Wirken nur in lockerem Zusammenhang standen, andichteten. Von den Schwazern übernahmen sie die Laboranten, welche sie bereits praktisch ausnutzten, um vorwitzige Leute von dem Besuche ihrer Kräutergärten im Gebirge abzuschrecken. Als im Jahre 1665 der Bau der Koppenkapelle begann, der viele Besucher von nah und fern dem Kamme zuführte, die nun den Schauplatz von Rübezahls Taten durch eigenen Augenschein kennen lernten, ließen sich die Spukgeschichten, welche man von seinem Aufenthalt an der Koppe erzählte, nicht mehr aufrecht halten; man ließ daher den Berggeist einfach verschwinden und »beteuerte es gar sehr mit vielen Umbständen«; manche versicherten, er hätte sich nach Frankreich gewandt, wo er »verkehrte Ratschläge wider Spanien suppediert habe«. Inzwischen aber hatten sich bereits die Leinwand- und Garnhändler des dankbaren Stoffes bemächtigt; sie waren es hauptsächlich, welche die Rübezahlsage über die Grenzen Schlesiens hinaus verbreiteten, namentlich durch den Besuch der Leipziger Messe. Hier erhoben sich ihre Zelte und Buden, die auf großen Tafeln gewöhnlich den Rübezahl als »ihren Patron, spiritus familiaris oder Hausgötzen« darstellten, um die Käufer anzulocken. Von diesen Leuten aber hat, nach seinem eigenen Geständnis, der Leipziger Gelehrte und Vielschreiber Prätorius die Sage übernommen. Er hat den lohnenden Stoff begierig aufgegriffen und ihn, mit einigen Erfindungen stark vermengt, in feste literarische Form gegossen. In seiner 1668 ff. erschienenen Daemonologia Rubinzalii Silesii tritt dann der Berggeist seinen Siegeszug durch das gebildete Deutschland an. Endlich gab Musäus in seinen Volksmärchen (1782 bis 1786) der Sage die novellistische Abrundung, in der sie noch heute allen Deutschen lieb und vertraut ist.
Leider ist auch das alte volkstümliche Sagengut mehr und mehr im Schwinden begriffen. In noch höherem Grade gilt dies von den alten Trachten, und wenn das Wort Friedrichs des Großen: »Das Temperament der Völker offenbart sich in ihrer Kleidung«, der Wirklichkeit entspricht, so müßte man den Gebirgsbewohnern, wenigstens auf der schlesischen Seite, ein scharf ausgeprägtes Temperament überhaupt absprechen. Eine eigentliche Volkstracht bekommt man hier kaum noch zu sehen. Auf österreichischer Seite fällt die Tracht der Frauen und Mädchen auf durch die Vorliebe für grelle Farben und bunte seidene oder halbseidene Kopftücher. Innerhalb eng gezogener Grenzen sind im preußischen Anteil des Gebirges die alten Trachten wieder zu verdienter Geltung gelangt: in den sogenannten Hainer Spinnabenden, welche unzählige Wiederholungen und Nachahmungen hervorgerufen haben.
Mit der Wiederbelebung der Spinnabende wurde hin und wieder auch der Versuch verbunden, die alteinheimischen Musikinstrumente, Trompta Maria und Harmoniflett, die einst vor Kaisern und Königen mit Ehren bestanden hatten, wieder zur Geltung zu bringen. Ohne rechten Erfolg. Sie gehören wohl für immer der Vergangenheit an, ebenso wie die böhmischen Harfenistinnen und Dudelsackspieler, die man noch vor zwei Jahrzehnten in den Gebirgslanden nicht selten hören konnte. Mit den alten Bauden sind auch diese originellen Gäste verschwunden, wenigstens im Riesengebirge. Im einsamen Isergebirge kann man eher noch hier und da einen Nachzügler alter Kunst und Sitte antreffen.
Auch von anderen Volksbelustigungen und Volksfesten sind nur spärliche Überreste erhalten geblieben. Die Weihnachtsspiele verschwinden mehr und mehr. Die Pfingstmärkte auf dem Bolzenschloß und Kynast und die Kirmes bei der Annakapelle am Sonntage nach dem Annentage werden nur noch aus der nächsten Umgegend besucht. Ebenso hat das Blücherfest in Löwenberg nur lokale Bedeutung. Dagegen erfreut sich der Taubenmarkt in Lähn und neuerdings in Löwenberg guten Rufes und Besuches, und ein wirkliches Volksfest, das von Tausenden auch aus weiter Ferne, aus Böhmen wie aus Schlesien, besucht wird, ist noch immer der Kirchweihmarkt am Palmsonntage zu Warmbrunn oder, wie er nach einem Gebäck in Form eines plumpen Mannsbildes gewöhnlich genannt wird, der Tallsackmarkt. Das ist noch ein Jahrmarkt im alten Stile, wo die Kuriositäten und Wunder der Welt sowie die neuesten Begebenheiten der Weltgeschichte in naturgetreuer Darstellung einem staunenden Publikum vorgeführt und aus beredtem Munde erläutert werden, wo die altbeliebten Volksbelustigungen, Scheibenschießen und Würfelspiel winken und die erlesensten Erzeugnisse schlesischer Koch- und Backkunst, vor allem der hochgeschätzte »Pauerbissen«, auf jedes schlesische Gemüt ihre unwiderstehliche Anziehungskraft ausüben. Ein im böhmischen Binnengebirge beliebtes Vergnügen ist der Scheidowetz, eine Art Lichterabend, der unter Begleitung primitiver Musikinstrumente, der Ziehharmonika, Violine und Teufelsgeige, mit Gesang und Tanz gefeiert wird.
Quelle: P. Regell, Das Riesen- und Isergebirge. Bielefeld und Leipzig 1905 (Velhagen & Klasing).