
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Thüringen. Land und Leute. – 2. Die Wartburg. – 3. Thüringer Industrien. – 4. Der Brocken. – 5. Skizzen aus dem Kulturleben des Oberharzes. – 6. Die Höhlen des Harzes.
Thüringen ist die Grenzscheide des deutschen Südens und Nordens, und wer diesen verläßt, um jenen zu betreten, mag mit dem auffallenden Wechsel der sandigen Ebenen, die sich an die fruchtbarsten Partien Thüringens keck heranwagen, sehr zufrieden sein. Ohne Übergang gerät man in den Segen eines Landes, das von jeher der Stolz Obersachsens war.
Thüringen hat von der Natur seine Grenzen erhalten, und wenn auch der Name in der deutschen Statistik erlosch, im Munde des Volkes und der Geschichte wird er länger fortleben als die neueren Zustände und politischen Zerstückelungen, die an die Stelle des alten Thüringer Landes traten. Im Osten umsäumt die Saale mit ihren bunten Bergen und Hügeln diesen Landstrich; im Norden umrauscht ihn der Wellenschlag der zwar kleinen, aber wilden, ausgelassenen Unstrut, im Nordwesten überragt der Harz die thüringischen Ebenen und das hagere Eichsfeld erhöht ihre üppigen Reize; im Süden spannt sich in einer Entfernung von 135-163 km der Thüringer Wald aus, eine Mauer aus Wald und Fels, oder vielmehr ein Meer von Bergen, die wie die Wellen nebeneinander liegen, als könnte man von der einen Höhe auf die andere hüpfen, aber unbeweglich – ein grün bewachsenes Meer.
Auf seinem Hauptkamm verläuft ein ununterbrochener und überall mit hohen Rainsteinen (Grenzsteinen) besetzter fahrbarer Pfad, den man Rainweg, Rennweg oder Rennsteig heißt. Dieser Pfad war sicherlich bereits in den ältesten Zeiten Grenze zwischen Thüringen und Franken, wie das ganze Gebirge bis auf den heutigen Tag infolge seiner beträchtlichen Kammhöhe und seines Mangels an Pässen zwischen beiden Landschaften eine deutliche Scheide der Sprache, des Rechts, der Sitten und Eigentümlichkeiten in Haus und Leben bildet. Aus dem im Mittel 750 m hohen Kamm steigen die höchsten Gipfel noch etwa um 200 m empor. Die höchste Spitze des Thüringer Waldes ist der Beerberg (984 m hoch), der bekannteste aber der Inselsberg, der für den Brocken des Thüringer Waldes gilt. Er liegt in dem nordwestlichen Teile der Bergkette, und seine kahle Kuppe ist 916 m hoch, also noch 227 m niedriger als der Brocken. Das Gestein des Inselsberges ist rötlichbrauner Porphyr mit großen Quarz- und Feldspatkristallen Ein gemütvoller thüringischer Dichter, Ad. Bube, singt:
Sieh dort den Inselsberg
Aus dem Gebirge ragen;
Einst war von Wogenschaum
Sein Riesenleib geschlagen,
Und nur sein Porphyrhaupt
Gerundet, rötlich braun,
Von Möwen dicht umschwärmt
Als Fels im Meer zu schaun.
Jetzt blickt er auf ein Meer
Von hohen Waldeskuppen,
Sieht frischen Wiesengrund
Mit Bach und Felsengruppen,
Und schön bebautes Land,
An Stadt und Dörfern reich,
Darin ein biedres Volk,
Dem bravsten Volke gleich.
Wie ein Pilot, der lang
Das wilde Meer durchzogen,
So eilt' ich oft zu ihm;
Müd von des Lebens Wogen
Stand ich auf seinem Haupt;
Meist wogte dann umher,
Wie vormals Flutenschwall,
Ein graues Nebelmeer.
Doch wenn zum Himmelszelt
Die Nebel sich erhoben,
Wenn sie im Sonnenglanz
Tief unter mir zerstoben,
Dann dankt' ich staunend Gott
Mit hoher Herzensglut,
Daß er mein Vaterland
Erhob aus öder Flut.. Man sieht von seiner Kuppe zunächst zwar nur die bewaldeten Höhen und Tiefen des Bergwaldes um sich, in der Ferne aber südwestlich die Hohe Rhön, nordwestlich den Meißner bei Kassel, nördlich sogar den Harz. Eine volle Rundsicht hat man von dem Turm auf dem Kulm des Berges, auch über das nördliche Hügelland mit seinen Städten und Dörfern. Man überblickt Thüringens Gaue bis zur Sachsenburg und zum Ettersberg bei Weimar. Um die nächsten Vorberge des Inselsberges, an deren Fuße Schnepfenthal und Reinhardsbrunn liegen, windet sich die
Hörsel. Im Durchbruch zur Werra trennt die Hörsel den Thüringer Wald von der Fortsetzung der Höhen an der Werra, eine anmutige, drei Stunden lange Pforte bildend, in der die Stadt
Eisenach und dicht daneben auf waldiger Höhe die
Wartburg liegt, der Lieblingssitz thüringischer Landgrafen bis ins 13. Jahrhundert hinein, und noch berühmter durch den Aufenthalt Luthers 1521.
Die engen Täler der Gera und Ilm sind reich an malerischer Schönheit, aber es fehlt dabei nicht an schauerlich düsteren Tannengründen, namentlich im Tal der Schwarza, wo die alte Schwarzburg auf steilem Felsabhange thront, um den sich der Fluß windet. Diese Schwarzburg ist das Stammhaus der Fürsten von Rudolstadt und Sondershausen und bewahrt noch eine Sammlung von Ritterrüstungen und Waffen des Mittelalters. Nicht weit davon sind die immer noch großartigen Ruinen der einst reichen und blühenden Abtei Paulinzelle. So stößt man in Thüringen überall auf Baudenkmäler, die an die merkwürdige Geschichte des Landes erinnern.
Der Thüringer Wald ist als eine Fortsetzung des Fichtelgebirges und Frankenwaldes anzusehen, sein Wald besteht nordwestlich aus den schönsten Buchen und Eichen und östlich aus Fichten und Tannen. Nur drei kahle Gipfel ragen aus dem dichten Kranze der thüringischen Bergkette hervor: der Gerberstein (teilweise bewachsen), der Tröhberg und Hermannsberg, sie dienen aber nur dazu, die bunte Färbung zu erhöhen, die hier durch ein Meer von Laub und bei heiterem Wetter durch einen blauen Horizont über diesen grünen Wogen eines Riesenwaldes gebildet wird. Der Thüringer Wald ist holzreicher als der Harz und das Erzgebirge; man kann stundenlang in einem Walde von Fichten fortgehen, und es ist schon erfahrenen Wandersleuten und Jagdmännern begegnet, daß sie sich in dieser Waldwildnis verirrt haben. Übrigens ist in neuerer Zeit sehr viel für Wegebauten, namentlich im gothaischen und weimarisch-eisenachischen Anteil, geschehen.
Bietet so der Zug des Hauptkammes wenig Abwechselung, da kaum Täler ihn durchbrechen, und wird eben hierdurch die sinnende Phantasie mächtig angeregt, so ist hinwiederum der Gegensatz zu den lieblichen und doch malerischen Hügeltälern der Gera und Ilm, der Hörsel und Schwarza, Saale und Unstrut um so größer.
Auch das Thüringische Binnenland, das vom Thüringer Wald und vom Harz in mehreren Stufen zu der Ebene an der mittleren Unstrut hinabsteigt, ist durch die Mannigfaltigkeit seiner Bodenform, der Bewässerung, des Anbaus und der Siedelung ausgezeichnet. Mit größeren oder kleineren plateauartigen Erhebungen wie dem Eichsfeld, dem Hainich und der Hainleite wechseln kleine, reichbewaldete Gebirge wie der Ettersberg, die Finne und der Kyffhäuser, und breite, wohlangebaute Talniederungen ab, unter denen die durch ihre Fruchtbarkeit berühmte »Goldene Aue« an der unteren Helme die bekannteste ist. Emsiger Bodenbau, mannigfache Gewerbe, reiche Geschichte und Sage verleihen der Landschaft neben ihren natürlichen Schönheiten besondere Reize.
Im Norden wird das Thüringer Stufenland durch den Harz begrenzt. Im Gegensatz zu der langgestreckten Gestalt des Thüringer Waldes bildet er eine Ellipse von etwa 100 km Länge und 30 km Breite, die sich inselartig über ihre Umgebung erhebt und besonders gegen das norddeutsche Tiefland steil abgesetzt ist. An seiner Oberfläche ist der Harz ein von Nordwest nach Südost geneigtes, sanft gewelltes Plateau, das zwar durch tiefe Täler zerschnitten ist, dessen einzelne Teile aber doch ihre Zusammengehörigkeit deutlich erkennen lassen. Entsprechend der Neigung dieses Plateaus liegen die höchsten Partien im Nordwesten, sie bilden den sogenannten Oberharz, der durch das bis zu 160 m tief eingeschnittene Selketal von dem südöstlichen Unterharz geschieden ist. Im Oberharz sind der Hochfläche einzelne sanfte Bergwölbungen aufgesetzt, unter denen als Hauptgipfel des ganzen Gebirges der 1140m hohe Brocken hervorragt. Mit seinen Nachbargipfeln das sogenannte Brockengebirge bildend, liegt dieser Berg am äußersten Nordrand des Harzes, sodaß sein Anblick von der norddeutschen Tiefebene her ein besonders imposanter ist, was wohl der Grund dafür ist, daß der Brocken trotz seiner mäßigen Höhe lange Zeit für die höchste Erhebung Deutschlands gehalten wurde.
Für die Bildung der Oberflächenformen sind im Harze in hohem Grade auch die Gesteinsarten maßgebend gewesen. Die Hauptmasse des Gebirges wird von alten Schiefern und Grauwacken gebildet, in die aber vielfach Porphyrgebiete eingesprengt sind. Der Porphyr und noch mehr der durch Abtragung der über ihm liegenden jüngeren Schichten entblößte Granit bilden häufig die höchsten Kuppen des Gebirges. Insbesondere gibt der Granit mit seinen aus wollsackartigen Massen aufgebauten Türmen und Klippen, seinen Felsenmeeren und Blockstreuungen vielen Gipfelflächen des Harzes ihr charakteristisches Gepräge. Auch die Tallandschaften sind verschieden, je nach der Beschaffenheit des Gesteins. In die weichen Schiefer und Grauwacken schnitten sich die Flüsse weite, offene Täler in vielfach gewundenem Lauf. In den harten Granit-, Porphyr- oder Grünsteingebieten mußten sie ihre nagende Kraft auf schmale, oft überaus steile Rinnen konzentrieren. So entstanden jene wildromantischen, von dem Touristenverkehr mit Vorliebe aufgesuchten Tallandschaften, wie wir sie in den Engtälern der Bode, der Ilse und der Oker bewundern. Wo an einzelnen Stellen zwischen den alten Gesteinen die jüngeren Kalke eingelagert sind, gaben diese Veranlassung zur Bildung der bekannten Tropfsteinhöhlen des Harzes, die dem Leser in einem besonderen Bilde dargestellt werden sollen.
Die besonders gegen die nordwestliche Wetterseite exponierte Lage des Harzes läßt diesen zu den regenreichsten Gebirgen Deutschlands gehören, und der Brocken bildet für die von Norden anziehenden feuchten Luftströmungen einen so gewaltigen Kondensator, daß er nur an verhältnismäßig wenigen Tagen des Jahres ganz frei von Nebel, Regen oder Schneefällen bleibt und daß Brockenbesucher, die eine freie Aussicht nach allen Seiten haben, von Glück reden können. Trotz der großen Menge der Niederschläge genügt aber die Höhe des Harzes nicht zur Bildung das ganze Jahr hindurch dauernder Schneeflächen. Das Gebirge liegt in seiner Gesamtheit unterhalb der Schneegrenze.
Daher dringt auch das Leben bis zu seinen höchsten Erhebungen vor. In den unteren und mittleren Regionen wird Ackerbau und Weidewirtschaft in ausgedehntem Maße betrieben. Einen bedeutenden Nutzwert und zugleich einen prachtvollen Schmuck hat der Harz in seinen ausgedehnten Nadelwäldern, die das ganze Gebirge überziehen. Nur die beständig von rauhen Winden bestrichene Fläche des Brockengipfels liegt über der Baumgrenze und bringt ihre beherrschende Höhe auch dadurch zum Ausdruck.
Der Nutzwert des Waldes steht in enger Beziehung zum Bergbau des Harzes. Ihm liefert er die dicken Stützen für seine Gruben und in Form von Holzkohle das Brennmaterial für viele Hütten. Die Waldköhlerei, ein von den Harzbewohnern seit uralter Zeit betriebenes Gewerbe, erfreut sich auch heute noch, besonders in den höheren Teilen des Gebirges, eines gegen früher nur wenig eingeschränkten Betriebes. Die wichtigsten Erzeugnisse des Bergbaues liefert der Oberharz mit seinen Eisenerz-, Blei- und Silbergruben in der Gegend von Goslar, Harzburg, Klausthal, Zellerfeld, St. Andreasberg und Harzgerode. Der Unterharz birgt in der Umgebung von Mansfeld ausgedehnte Kupferschieferlager, deren Abbau allerdings in mehr als einer Hinsicht mit großen Schwierigkeiten verknüpft ist. Eine wichtige Erwerbsquelle der Harzbewohner ist schließlich der starke Fremdenverkehr, der Sommer und Winter Tausende von Touristen und Sommerfrischlern dem Gebirge zuführt.
Der Name Thüringen wird hergeleitet von den Vorfahren seiner jetzigen Bewohner, von den Hermunduren, die an die Stelle der Katten traten. Andere führen ihn zurück auf den Gott Thor oder auch auf die Theoringer oder Toringer, einen westgotischen Stamm, dessen Reich von großer Ausdehnung gewesen sein soll. Etymologen wollen sogar duros homines Harte Männer. in Thüringen finden, eine Behauptung, die durch den tüchtigen und ausdauernden Menschenschlag unterstützt wird, aber schwerlich durch die Geschichte, die nirgends dartut, daß germanische Stämme lateinische Bezeichnungen angenommen hätten. Am richtigsten unter diesen Vermutungen mag die von den Theoringern oder Toringern sein, die sich zweifelsohne auf die Hermunduren werden zurückführen lassen, einen Namen, der immer als Grundlage von Thüringen zu betrachten ist.
Was die Charaktereigenschaften der Bewohner Thüringens anbetrifft, so sehen wir in ihnen die Lage ihres Landes im Herzen Deutschlands und an der Grenze der ehemals von Slawen besiedelten Gebiete deutlich ausgeprägt. Wir finden ein Gemisch von süddeutschem Temperament und norddeutscher Bildung, slawischer Lebenslust und deutscher Sentimentalität Von hier an nach O. Weise, Die deutschen Volksstämme und Landschaften. 2. Aufl. Leipzig 1903, B. G. Teubner..
Was Gustav Freytag von seinen Landsleuten, den Schlesiern, sagt, gilt auch mehr oder weniger von den Thüringern, zumal diese das Land am Mittellaufe der Oder besiedelt haben: »Sie sind ein lebhaftes Volk von gutmütiger Art, heiterem Sinn, genügsam, höflich, eifrig und unternehmungslustig, arbeitsam, aber nicht vorzugsweise dauerhaft, elastisch, aber ohne gewichtigen Ernst, behend und eifrig in Worten, aber nicht ebenso in der Tat, sehr geneigt, Fremdes anzuerkennen.« Jedenfalls macht sich das Gemüt ebensosehr geltend als der Wille. Wenn es wahr ist, daß Blumen und Lieder einen guten Maßstab für das Vorhandensein des ersteren abgeben, so kann sich Thüringen mit jedem anderen Teile unseres Vaterlandes messen. Denn die Blumenzucht wird dort mit Vorliebe getrieben, und ein Blumengärtchen vor dem Hause bildet die Regel. Musik aber erfährt so eifrige Pflege, daß nach dem Sprichwort in zwei Häusern drei Geigen gespielt werden. Und »wo man singt, da laß dich ruhig nieder; böse Menschen haben keine Lieder«. Konzerte und Tanzvergnügungen lösen einander ab; nicht nur im Saale, sondern auch auf dem Dorfplan führt man die Schönen zum Reigen. Wenn irgendwo, so blüht in Thüringen die Geselligkeit und Vereinsmeierei. Volksbelustigungen sind ziemlich zahlreich. Vogelschießen und Kirmes, Gregorius- und Kirschfest, Turner- und Sängerzusammenkünfte geben Anlaß zu freudiger Erregung, zu Schmaus und Trinkgelage. Das beliebte Kegelspiel wird selbst auf der Straße vorgenommen, und dabei brodelt über dem Holzkohlenfeuer die thüringische Rostbratwurst. Das eigentliche Nationalgericht aber bilden die Klöße, besonders die aus rohen Kartoffeln bereiteten, aber auch Kuchen wird gern gegessen und daher oft gebacken, denn er dient immer zur Erhöhung der festlichen Stimmung A. Kirchhoff in H. Meyer, Das deutsche Volkstum S. 92: »Bei der Dorfkirmes kann sich die thüringische Lust am Schmausen und Trinken wohl zum Übermaß versteigen, für gewöhnlich aber wird nüchtern und mäßig gelebt, obschon sich die Neigung zu heiterer Geselligkeit, zu Musik und Tanz niemals verleugnet. Wie rührend geringe Ansprüche macht der »Wäldler« ans Leben! Das Gebirge hat ihn an Entbehrung gewöhnt, seinen Fleiß, seine Handgeschicklichkeit gezüchtet, ihn aber belohnt mit frohsinniger Empfänglichkeit für die Schönheit seiner Heimat. Er braucht nicht mit Hab und Gut zu geizen, denn er hat davon gewöhnlich nur soviel, wie er eben unumgänglich bedarf; die meist zahlreichen Kinder verdienen sich frühzeitig schon ein wenig in der Fabrik oder helfen mit beim Hausgewerbe. Kartoffelkost herrscht eintönig vor, aber gleich wie reiche Leute halten sich die Thüringerwäldler ihre lieben Waldvögel zu fürsorglicher Pflege im Bauer, ja manche schlichte Hütte sieht man mit einer Vielzahl von Vogelbauern behängt. Mit dem Finken singt Bursche und Mädchen selbst um die Wette; und wie gut steht es dem jungen Volk, wenn es nach Feierabend in Gruppen durch die Dorfgassen schlendert und frohgemut das aus dem Herzen kommende Lied aus hellen Kehlen hören läßt: »'s ist mer alles eins, 's ist mer alles eins, ob ich Geld hab' oder habe keins.«.
Die Bewohner stehen mit Recht im Rufe der Gemütlichkeit. Gegenüber dem schneidigen Wesen der Preußen ist hier ein leichtes Sichgehenlassen an der Tagesordnung, strammes und barsches Auftreten verhaßt. Man kann schnell mit jemand warm, ja herzlich werden und ist rasch mit dem vertraulichen »Du« bei der Hand; so entgegenkommend und freundlich sind die meisten im geselligen Verkehr. Freilich decken sich die Worte nicht immer mit den Gedanken, und oft spricht bloß die Zunge, ohne daß das Herz dabei Anteil hat. So ist es öfter vorgekommen, daß der oder jener Biedermann, der auf der Reise oder im Bade mit einem gemütlichen Thüringer bekannt geworden und in liebenswürdiger Weise zu einem baldigen Besuche aufgefordert worden war, bei der Ausführung dieses Wunsches unfreundlich aufgenommen wurde.

Burg Plauen in Thüringen. Nach einem Gemälde von
Paul Schulze-Naumburg im Städt. Museum der bildenden Künste zu Leipzig.
Verlag von Friedrich Brandstetter, Leipzig Lumièreaufnahme, Farbenätzung und Druck von F. A. Brockhaus, Leipzig.
Doch die Thüringer sind nicht bloß »gemütlich«, sondern auch rührig und betriebsam. Wenige Gebirge haben eine so reich entwickelte Industrie wie die Höhen von der Werra bis an die Elster. Auf dem Thüringer Walde finden wir die meisten Porzellanfabriken Deutschlands; ihre Anlage wurde namentlich begünstigt durch die billigen Preise des Holzes in einer Zeit, wo man die Kohlen noch nicht für diese Zwecke verwendete. Die ersten Glashütten wurden durch zugezogene Glasbrenner aus dem Böhmerwalde eingerichtet, die Herstellung der Spielwaren in Sonneberg, Waltershausen und anderwärts durch Nürnberger Kaufleute, die zur Leipziger Messe zogen. Auch das Vorland ist reich an industrieller Tätigkeit. Zervelatwurst wird in Gotha und Erfurt gemacht, Garn in Gera und Greiz gesponnen und verwebt. Suhl und Sömmerda haben großen Ruf durch ihre Gewehrfabriken, Weißenfels durch seine Schuhwaren, Erfurt durch seine Blumen- und Gemüsezucht. In Ruhla werden namentlich Tabakspfeifen, in Apolda und Zeulenroda Strumpfwaren, in Nordhausen Branntweine hergestellt.
Frühzeitig sind in Thüringen manche gemeinnützige Unternehmungen ins Leben gerufen worden, so die Gothaische Lebensversicherungsgesellschaft, die 1827 nach englischem Vorbilde als erste in Deutschland gegründet wurde; ferner die Gothaische Feuerversicherungsgesellschaft, die größte in unserem Vaterlande, die 1820 nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeit eingerichtet wurde. Und wie Jena durch die Karl Zeißsche Anstalt für Anfertigung vorzüglicher Fernrohre, Mikroskope und anderer optischer Instrumente weithin berühmt geworden ist, so Gotha durch die kartographische Werkstätte von Justus Perthes. Hier trat auch in den zwanziger Jahren das Bibliographische Institut von Meyer ins Leben, das später nach Hildburghausen und von da nach Leipzig verlegt wurde. Bei dem geistig so geweckten Volke war auch die Phantasie ziemlich rege. Daher fehlt es nicht an Erfindern. Es genügt, hier daran zu erinnern, daß Joh. Friedr. Böttger aus Schleiz Anfang des 18. Jahrhunderts uns mit dem Porzellan beglückte, daß Friedrich König aus Eisleben 1811 in London die erste Buchdruckerschnellpresse konstruierte und Nikolaus Dreyse aus Sömmerda 1828 das Zündnadelgewehr mit Patrone erfand.
Nächst dem Rheinlande haften an dieser Gegend die meisten Sagen. Der Brocken, auf dem die Hexen in der Walpurgisnacht schon seit geraumer Zeit mit Besen umherreiten, ist von den deutschen Geisterbergen der bekannteste. Von dort aus durchsaust bei nächtlicher Weile Wodan mit seinem »wütenden Heere« die Luft und verursacht so das Getöse der wilden Jagd. Daher wird aus Rostock schon bei Beginn des 17. Jahrhunderts die landesübliche Verwünschung eines Mannes gegen seine unholde Frau gemeldet: »Sie möge auf dem Blocksberge sitzen«; und ein ums Jahr 1300 niedergeschriebenes Gedicht enthält die Beschwörung einer großen Zahl von quälenden Geistern, die zum »Brohelsberge«, d. h. zum Brocken, fahren und dort ihre Versammlung halten. Und wie der Brocken als einzeln stehender, oft von Wolken umhüllter Berg reichen Anlaß zur Sagenbildung gegeben hat, so auch der Hörselberg. Dort halten sich Frau Venus und der Tannhäuser auf, eine Sage, die sich unter anderem daraus erklärt, daß man in der 22 m langen Höhle des Berges das Summen von Millionen kleiner Mücken vernimmt. Ebenso berühmt ist der Kyffhäuser, der Stützpunkt der Sage vom Kaiser Barbarossa, welcher in seinem Innern jahrhundertelang geschlafen und auf die Wiederherstellung der Macht und Einheit Deutschlands geharrt hat. Ferner begegnen wir auf dem Thüringer Walde dem getreuen Eckart und der Frau Holle, die Rudolf Baumbachs Muse so schön besungen hat. Bei Arnstadt lebte der Graf von Gleichen, der durch seine sagenhafte Doppelehe bekannt geworden ist, und auf Schloß Giebichenstein ward Landgraf Ludwig der Springer gefangen gehalten, der sich angeblich in die Saale hinabstürzte, um aus dem Kerker zu entrinnen; auf der Wartburg hauste Landgraf Ludwig der Eiserne, der nicht hart werden wollte, und Elisabeth die Heilige, deren Speisen sich im Korbe zu Rosen verwandelten; in der Kemenate zu Orlamünde geht die weiße Frau um usw. Sagenhaft ist auch der Sängerkrieg auf der Wartburg, aber er lehrt uns, wie eifrig die Landgrafen von Thüringen das Singen und Sagen pflegten, genau so wie im 18. Jahrhundert Herzog Karl August von Weimar, der Goethe und Schiller, Herder und Wieland in seine Nähe zog und dort festzuhalten wußte.
Ein Wallfahrtsort ist die Wartburg in Wahrheit geworden. Ihr Name weckt in den Herzen nicht nur der Thüringer, sondern aller Deutschen die hehrsten und heiligsten Empfindungen, und viele Tausende pilgern alljährlich hinauf zur waldigen Höhe. In schönen Frühlingstagen, wenn rings der Wald im mannigfachsten Grün prangt, in heißen Sommertagen, wenn hier oben die reine Waldesluft erquickend und belebend weht, in klaren Herbsttagen, wenn des Waldes Blätterschmuck vor seinem Abschied noch in bunter Farbenpracht erglüht, dann blühet hier ein frisches, frohes Wanderleben, dann zieht's und singt's auf allen Wegen zu der Burg hinan, und Schar auf Schar wallt durch das alte Tor und schaut mit Ehrfurcht die geweihten Hallen. Ja, es ist gewiß: unter all den Burgen und prächtigen Schlössern, die auf deutscher Erde stehen, ist doch keine, die so eng mit dem deutschen Gemüte verbunden ist, die mit so unwiderstehlicher Gewalt den Fuß der Deutschen zu sich heranzieht, die mit so innerer Erhebung und so trautem Heimatgefühl betreten wird, wie die Wartburg. – Was aber ist es, das ihr diese Macht verleiht? Worin liegt die geheimnisvolle Kraft ihres Zaubers? –
Willst du, Wanderer, Antwort finden, so komme und schaue es selbst, wie sie frei und stolz, gleich einer Königin, über rauschender Waldesherrlichkeit thront, wie sie – bist du erst in ihren Gesichtskreis getreten – mit hellen Augen zu dir herüberblickt, dich von Höhe zu Höhe begleitet und auf verschlungenen Waldespfaden zu ihrem Felsenthrone leitet. Und welch herrliches Landschaftsbild breitet sich hier oben vor den Blicken aus! Die Berge des Thüringer Waldes schlingen ihre grünen Arme ineinander. Es wallet und woget zu deinen Füßen wie Meereswellen, und dein Auge hängt trunken an dem satten Grün und der wundersamen Gliederung. Hier schroffe Felsen und tiefe Schluchten, dort grüne Matten und freundliche Täler. Hoch über allen Wellenhäuptern aber reckt sich breit und hoch der Inselsberg heraus. Und drüben überm Waldmeer blicken die vorgeschobenen Rhönkegel: der Öchsen, der Dietrichsberg und der Baier, zu uns herüber.
Wie friedlich ruht das Dörfchen Stedtfeld im Wiesengrunde des lieblichen Hörseltales, während dahinter der scharfrückige Kielforst und der turmgeschmückte Heldrastein zur Werra abstürzen und in verschleierter Ferne der massige Meißner sich erhebt. Hier lehnt sich fruchtbares Hügelland an die waldige Höhe des Hainichs an, und dort winkt von Osten her der kahle Rücken des sagenumwobenen Hörselberges, während der Blick bis zu den Gleichen und weiter bis zum Ettersberg bei Weimar schweift. Drunten aber am Fuße des Wartberges hat sich die lebensfrohe und tätige Stadt Eisenach gelagert und schmiegt sich zärtlich wie ein Kind an der Mutter hohen Bergsitz.
Nun, da dein Auge die wunderbare Schönheit des Rundblicks genossen, wirst du das Wort, das die Sage dem Erbauer der Wartburg in den Mund legt, verstehen. Ein Wild verfolgend, war Graf Ludwig der Springer auf diese Höhe gelangt, und voll Entzücken über die herrliche Aussicht und die vorzügliche Lage des Berges rief er die Worte aus: »Wart', Berg, du sollst mir eine Burg werden!« Graf Ludwig war ein kluger Herr, der sofort erkannte, daß die schroff abstürzenden Wände eine auf dem Berge stehende Burg fast uneinnehmbar machen müßten. Darum zögerte er auch nicht lange, seine Absicht auszuführen. Dabei stieß er jedoch auf eine große Schwierigkeit; denn die Herren von Frankenstein, die auch Eigentümer des benachbarten Metilsteins waren, erklärten den Berg als zu ihrem Besitz gehörig und erhoben Klage gegen Ludwig Der richterliche Schiedsspruch lautete dahin, daß Ludwig mit zwölf Rittern sein Recht auf den Berg beschwören sollte. Der schlaue Graf wußte sich auch hier zu helfen. In dunkler Nacht wurden Körbe voll Erde aus seinem Besitztum auf den Berg geschafft, und nun – die Schwerter in die Erde stoßend – schwur er mit seinen Eideshelfern, daß er auf eigenem Grund und Boden stehe. So ward ihm der Berg zugesprochen. Um diese Zeit trat eine Hungersnot ein; da nun Ludwig große Getreidevorräte hatte, waren tausend Hände gern bereit, am Bau der Wartburg zu helfen, um nur das tägliche Brot zu verdienen. In drei Jahren schon (1067-1070) war die stolze Feste mit Türmen und Zinnen errichtet. Sie wurde nun der Sitz der Landgrafen von Thüringen und erlebte unter Ludwigs Nachfolgern Tage voll Glanz und Herrlichkeit. Das gilt vor allem von der Regierungszeit Hermanns I., jenes kunstbegeisterten Fürsten, der an seinem Hofe die bedeutendsten Dichter seiner Zeit versammelte, einen Reinmar von Zweter, einen Biterolf, einen Heinrich von Ofterdingen, einen Walter von der Vogelweide und vor allen den ernsten Wolfram von Eschenbach, der auf der Wartburg den »Parzival« dichtete und von Hermann Anregung und Stoff zum »Willehalm« erhielt. Es sind die Minnesänger, die, wie die Sage erzählt, an dem »Sängerkrieg auf der Wartburg« beteiligt waren. Das waren hohe Zeiten. Da rauschten die Harfen in Hof und Saal, da erklangen süße Minnelieder, da hallte Palast und Saal von frohen Festen wider.
Den Vorgänger des jetzigen Schirmherrn der Burg, den Großherzog Karl Alexander, hatte es schon als Jüngling tief betrübt, daß das Schloß seiner ruhmvollen Ahnen, diese von der Sage so blütenreich ausgeschmückte Stätte, die mit ihren weihevollen Erinnerungen so eng mit den bedeutendsten Perioden unserer deutschen Kulturgeschichte verbunden ist, teils schon dem Verfalle preisgegeben, teils von unverzeihlichster Geschmacklosigkeit entstellt war. Ein Denkmal von so hoher geschichtlicher Bedeutung und poetischer Weihe zu erhalten, erschien dem patriotischen und kunstsinnigen Fürsten eine vaterländische Pflicht. So faßte er denn den Entschluß, »die Wartburg möglichst treu in ihrer früheren Gestalt wiederherzustellen, damit sie ein Bild gebe zunächst von ihrer Glanzperiode im 12. Jahrhundert als Sitz mächtiger, kunstliebender Landgrafen und als Kampfplatz der großen deutschen Dichter des Mittelalters, und dann später im Anfange des 16. Jahrhunderts als Asyl Dr. Martin Luthers und als die Stelle, von der der große Glaubenskampf ausging«. Eine große und schöne, aber auch eine schwere Aufgabe. Doch im Verein mit ebenso begeisterten wie kunstverständigen Beratern und ebenso eifrigen wie genialen Künstlern wurden alle Schwierigkeiten überwunden. Und wie meisterhaft wurde das Werk, das im Jahre 1847 unter der Oberleitung des Hofbaurats H. v. Ritgen aus Darmstadt in Angriff genommen worden war, durchgeführt! Das noch Vorhandene wurde pietätvoll erhalten, das Verfallene ließ man in seiner Urgestalt neu erstehen und das schon Erstandene durch den Zauber der Kunst verklären. So steht die Wartburg wieder da in altem Glanze, ein hellstrahlend Bild, aus dem Dunkel der Vergangenheit hervorgezaubert, ein wahres Kunstwerk.
Da steht sie wieder, wie einst, in Vorburg und Hofburg geteilt. Von der zinnengekrönten Bastei führt der Weg über die Zugbrücke durch das alte, dunkle Torgewölbe in den Hof der Vorburg, die mit dem Ritterhaus in Stil und Einrichtung des sechzehnten Jahrhunderts erhalten ist. Dort laufen links und rechts die Verteidigungsgänge (Letzen) den Hof entlang. Durch die Torhalle, welche mit der gleichfalls neuerstandenen Dirnitz und Kemenate die Vorburg abschließt, gelangt man in den inneren Burghof. Dort erhebt sich wieder, von Grund auf neu errichtet, der Hauptturm oder Bergfried, ein weithin leuchtendes, vergoldetes Kreuz tragend; dort am unteren Ende des Hofes hat sich der alte Turm mit den fast 3 m starken Mauern durch alle Stürme der Zeiten hindurch erhalten. Was aber steht hier für ein Prachtbau des romanischen Stils, mit herrlichen, säulengetragenen Bogenhallen geschmückt, mit Kapitälen, deren Mannigfaltigkeit und Schönheit man nicht müde wird zu bewundern? Das ist das Landgrafenhaus (Palas), wie es zur Zeit Hermanns I. gestanden. Wie schon im Anschauen des äußeren Palas die Zeit der Landgrafen lebendig vor uns aufsteigt, so lebt auch drinnen in Sälen und Hallen, in Gängen und Gemächern in treuer Wiedergabe die Vergangenheit mit allen Erinnerungen an die, welche einst dort geatmet. Von den Wänden des Landgrafenzimmers herab schaut uns aus sieben Bildern, von der Meisterhand eines Moritz v. Schwind gemalt, das Wirken der Landgrafen entgegen, wie es die Geschichte berichtet oder die poesiereiche Sage verklärt.
Im Sängersaal versetzt uns Schwinds großes Freskogemälde mitten in die Aufregung des Sängerkrieges hinein, während wir in der anstoßenden Elisabethengalerie, wo Elisabeth bei der Nachricht von dem Tode ihres Gemahls ohnmächtig niedersank, das Leben der milden Landgräfin und ihre frommen Werke in sieben Medaillonbildern verherrlicht sehen. Von hier aus treten wir in die zu ernster Andacht stimmende Burgkapelle, in der die Schwerter von Gustav Adolf und Herzog Bernhard aufbewahrt werden. Im obersten Geschoß des Landgrafenhauses aber nimmt uns der glänzende Festsaal auf, dessen Ausschmückung ganz im Sinne der mittelalterlichen Kunst die Macht und den Sieg des Christentums verherrlicht; es war ja auch die glänzendste Zeit des christlichen Rittertums, die einst den Saal entstehen und drei der Landgrafen das Kreuz nehmen und dem gelobten Lande zueilen ließ. Wie in den Ornamenten des Landgrafenhauses vorzugsweise die religiöse Anschauung des 12. und 13. Jahrhunderts ausgesprochen ist, so vergegenwärtigen die Skulpturen der Kemenate (Wohnung der Landgräfinnen) die höhere, sittliche Seite des Burglebens, welche in der Verehrung der Frauen und in der Treue der Mannen zu ihrem Fürsten, wie in dessen Treue zu den Vasallen, die schönsten Blüten getrieben hat. – Während unser Geist noch erfüllt ist von den Bildern aus der Zeit des Rittertums, schreitet unser Fuß hinüber in das untere Geschoß der Dirnitz, in den Waffen- und Rüstsaal. Wir glauben uns auf einmal in den Schranken eines Turniers zu befinden: von allen Seiten starren uns geharnischte Ritter zu Roß und zu Fuß, Lanzen, Speere und gewaltige Schwerter, Panzerhemden und Helme entgegen. Die meisten Rüstungen stammen indessen aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts, aus jener Zeit, deren geistiges Ringen uns lebhaft vor Augen tritt in den Räumen des Ritterhauses, die der Erinnerung an Luther und den großen Glaubenskampf geweiht sind. Mit tiefer Ergriffenheit treten wir in das kleine, in rührender Einfachheit erhaltene Stübchen, wo der große Mann gerungen und gebetet und die Schätze des göttlichen Wortes in kräftiger Muttersprache ans Licht gefördert hat. Alles, was wir hier sehen, mahnt uns an ihn und sein großes Werk. Dem Andenken an diese Zeit dienen auch die reicher ausgestatteten Reformationszimmer, das Pirkheimerstübchen und vor allem die kräftigen Sprüche an der Wand des Ganges.
Wem so auf der Wartburg die Erinnerung an die gewaltigsten Ereignisse unserer deutschen Vergangenheit wachgerufen, wessen Augen durch die herrlichsten Kunstschöpfungen entzückt worden, und wer zugleich hier oben den schönsten Naturgenuß in sich aufgenommen, der weiß, warum die Wartburg mit geheimnisvollem Zauber die deutschen Herzen zu sich zieht. Mit dem Gefühle dankbarer Erhebung verläßt er die geweihte Stätte, und ihm ist, als sei ein Teil der alten Kraft und des idealen Sinnes, den die Wartburg predigt, auf ihn übergegangen.
Von C. Kühn. Aus: Thüringen in Wort und Bild. Berlin 1900, Julius Klinkhardt.
a) Ruhlas Gewerbtätigkeit.
Die ersten Nachrichten von den Ruhlaer Industrien reichen hinein in den Sagenkreis des 11. und 12. Jahrhunderts. Ein Ruhlaer Waffenschmied war es, der Ludwig II. zum »Eisernen Landgrafen« hartschmiedete.
Es steht wohl außer Zweifel, daß die umliegenden Berge eine für damals reichliche Ausbeute an Eisenerz geboten haben. Die massenhaft bei den späteren Mahlmühlen und Schleifwerken gefundenen Eisenschlacken dürften darauf hinweisen, daß an Stelle dieser Mühlen einst Eisenhütten gestanden haben.
Mit dem Aufhören des Faustrechts und dem Ende des Raubritterhandwerkes wendeten sich die Waffenschmiede der Messerfabrikation zu.
Genaue Nachrichten über diesen Industriezweig sind schon aus dem Jahre 1519 vorhanden, und 1656 erlangen die Ruhlaer Messerschmiede das Innungsrecht. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts werden jährlich für 120 000 Taler Messer und Hiebwaffen aus Ruhla ausgeführt, dagegen 1747 nur noch für 40 000 Taler. Während zweier Jahrhunderte hat die Messerfabrikation Ruhlas Bevölkerung ausreichenden Lebensunterhalt gewährt. In den Jahren 1747-1750 wanderten an 500 Messerschmiede aus Ruhla aus nach Neustadt-Eberswalde, wo Friedrich der Große eine Messer- und Stahlwarenfabrik gegründet hatte. Da der preußische König infolgedessen die Einfuhr der Ruhlaer Fabrikate in seinem Lande verbot, so war der Rückgang dieser Industrie und ihr nahes Ende gewiß.
Aber der Ruhlaer ist erfinderisch. Zur Zeit des Siebenjährigen Krieges erfand Christoph Wagner die messingenen krummen Kämme. Diese und andere Artikel, wie Schnallen, Feilen, Bohrer, Schusterwerkzeuge und besonders Pfeifenbeschläge, boten bald neue und lohnende Arbeit. Um dieselbe Zeit führten findige Köpfe die im Eisenacher Oberlande aus Masernholz ins Grobe geschnitzten Pfeifenköpfe in Ruhla ein, bearbeiteten sie künstlerisch fein und beschlugen sie mit Kupfer und Messing.
Wieder andere, wie Hartmann, verschrieben rohe Meerschaumköpfe und ließen sie in bessere Formen bringen. Der Krieg (1756 bis 1763) begünstigte den Verbrauch dieser Artikel, sodaß große Mengen davon nach Leipzig und Frankfurt a. O. zur Messe gingen.
In diese günstige Zeit fällt auch die Gründung eines der größten Pfeifengeschäfte Ruhlas, der Firma Gebrüder Ziegler. Noch heute beschäftigen die gegenwärtigen Leiter, direkte Nachkommen des Gründers, die Herren Kommerzienrat P. Ziegler und Arthur Ziegler, einige Hundert Arbeiter in und außer der Fabrik in Meerschaum- und Holzpfeifen, namentlich Bruyerepfeifen.
Zu hoher Blüte gelangte Ruhlas Pfeifenindustrie erst seit 1750 durch die Erfindung des unechten Meerschaums durch Johann Christian Dreyß. Hier sei bemerkt, daß die erste Sorte des unechten Meerschaums aus den Abfällen des echten hergestellt wird; aus den weiteren Abfällen der ersten Qualität gewinnt man die zweite und dritte Sorte der sogenannten Masse. Obwohl die Nachfrage nach echten Meerschaumpfeifenköpfen in keinem Vergleich steht zu der vor 40 und mehr Jahren, so ist doch die Verarbeitung des echten Meerschaums zu künstlerisch ausgeführten Schmucksachen in Ruhla immer noch beträchtlich Vgl. Grube, Geogr. Charakterbilder, Bd. II, S. 403: In den Meerschaumgruben bei Eski-Schehir..
Aus einer Aufstellung aus dem Jahre 1797 ist zu entnehmen, daß damals in Ruhla beschäftigt wurden: 500 Messerschmiede, 25 Feilenhauer, 14 Schlosser, 25 Messing-Kammacher, 6 Elfenbein-Kammacher, 282 Pfeifenarbeiter, 255 Pfeifenkopf-Beschläger, Versilberer und Deckelstecher, 12 Rohrdrechsler und 9 Frachtfuhrleute.
Ein volles Jahrhundert hat die Pfeifenindustrie der Ruhlaer Bevölkerung gute Einnahmen gebracht und einigen Unternehmern zu Wohlstand und Reichtum verholfen.
Leider geht dieser Industriezweig seit 30 Jahren zurück. Die Ursache dieser Erscheinung dürfte vornehmlich in der starken Konkurrenz zu finden sein, die Wien und Paris besonders in den echten Meerschaum- und Bernsteinfabrikaten machen.
Noch gelingt es der tapferen und erfinderischen Tätigkeit der Ruhlaer Fabrikanten und Arbeiter, für die Fabrikate des unechten Meerschaums, wie für Holz- und Hornpfeifen guten Absatz nach allen Teilen der Erde zu finden und der Konkurrenz von Wien, Prag, Paris und Holland zu begegnen. Die gefällige Form und die schöne Ausstattung der Ruhlaer Pfeifen, namentlich auch der unechten Meerschaumköpfe, die sowohl rein weiß, wie auch kalziniert (in Öl und Wachs bunt gesotten), von dem Laien kaum von den echten zu unterscheiden sind, üben noch immer ihren Reiz auf den Liebhaber und Kenner aus.
Doch ist und bleibt das Pfeifengeschäft gegen früher nur wenig lohnend, und es bedarf der angestrengtesten Tätigkeit und der Einstellung mechanischer Hilfskräfte, um durch Herstellung großer Massen die Pfeifenindustrie über Wasser zu halten. Mit der Erzeugung der Pfeifen gehen Hand in Hand die Beschlägerei, die Schlauch-, Etuis- und Kartonnagegeschäfte.
Nächstdem verdienen noch einige andere Fabriken der Erwähnung, die sich mit Herstellung von Glühlampenfassungen für elektrische Beleuchtung, Geldbörsenbügeln, Geldtaschenverschlüssen, Musterklammern, Aufhängeösen, Briefsiegelkrampen, Pfeffermühlengehäusen, Beschlägen für Tintenfässer, Pfeffer- und Salzstreuer, Kindertrompeten u. a. kleinen Artikeln beschäftigen. Auch einer Furnierschneiderei und einer Knopffabrik sei hier gedacht. Zwei Firmen haben sich zu einem Weltruf emporgearbeitet. Die eine ist die von Thiel & Bardenheuer, deren Spezialität die Herstellung von Lampenbrennern ist. Sieben Millionen Brenner in 100 verschiedenen Sorten gehen jährlich von hier aus in alle Länder Europas, besonders aber nach Rußland. Die andere jüngere, aber weit größere Firma ist die Metallwarenfabrik der Gebrüder Thiel, die einschließlich der Heimarbeit gegen 1200 Menschen lohnenden Verdienst gibt. Sie fertigt vor allem Kinderuhren, Bieruhren und billige Taschenuhren (»Thielsche Watches« zum Preise von drei Mark im Einzelverkauf), auch die dazu gehörigen versilberten und vergoldeten Ketten.
Wir gedenken noch der Tatsache, daß aus Ruhla die Anregung zur Gründung einer ganzen Reihe von Fabriken in der Nähe Ruhlas mit gleichen oder ähnlichen Artikeln hervorgegangen ist.
Wir nennen als solche die Portemonnaiebügelfabriken in Marienthal, Salzungen, Liebenstein, Barchfeld und Steinbach, in denen zurzeit wohl 1500 Arbeiter ihr Brot finden. Gewiß ein Segen für die mit irdischen Gütern wenig gesegnete Bevölkerung der genannten Ortschaften des Thüringer Landes.
b) Lauscha und seine Glasindustrie.
Wenn das Weihnachtsfest herannaht und jedermann darauf sinnt, womit er an diesem Feste seine Lieben beschenken kann, da ist es auch eine Hauptsorge der Eltern, den Weihnachtsbaum möglichst glanzvoll herzurichten; denn trotz aller andern Geschenke macht auf das Gemüt der Kleinen nichts einen so tiefen Eindruck, als der Tannenbaum in seinem Lichterglanz. Wir Deutsche haben uns an diese Sitte so sehr gewöhnt, daß wir uns ein Weihnachtsfest ohne Christbaum gar nicht mehr denken können. Wo nur immer Deutsche wohnen, und sei es im fernsten Winkel der Erde, da strahlt auch am Weihnachtsfeste der Christbaum.
Den Lichterglanz noch mehr zu heben, – daß »kein Baum im Walde glitzert so« – verwenden wir zur Ausschmückung des Baumes die verschiedenartigsten Artikel von Glas, die uns als Eiszapfen, als Kugeln, als Früchte und Figuren in allen erdenklichen Formen und Farben von geschickten Glaskünstlern für billiges Geld zur Verfügung gestellt werden. Das Glas, das wir von der Fensterscheibe und der Flasche und dem Trinkbecher her als spröde und zerbrechlich kennen, ist hier zu den feinsten Sachen und Sächelchen geformt, und man wundert sich schier, wie das möglich ist.
Willst du über diese Glasindustrie etwas mehr erfahren, so begleite mich auf einem Gange durch Lauscha, ein Dorf hoch oben im Thüringer Wald, im Volksmund schlechthin »die Lausche« genannt. Hier in Lauscha wurde der Christbaumschmuck von Glas zuerst angefertigt, und wenn das jetzt auch in den umliegenden Orten, als Ernstthal, Igelshieb mit Neuhaus, Steinheid u. a. geschieht, so ist Lauscha noch immer der Hauptort seiner Herstellung.
Am bequemsten erreichen wir den Ort, wenn wir mit der Eisenbahn über Sonneberg reisen, denn Lauscha ist Endstation der Bahnlinie Coburg–Sonnebergthal ins Gebirge hinein. Immer enger rücken die Berge zusammen; höher und höher klimmt die Bahn empor, insbesondere im letzten Teile vor Lauscha selbst. Den Lauschabach, einen Zufluß der Steinach, entlang streckt sich der Ort Lauscha in einer Länge von 3 km dahin, da das enge Tal keine Ausdehnung in die Breite gestattet, und gabelt sich in der oberen Hälfte in zwei Teile, weil hier zwei Täler zusammenfließen. Die Nordenden des Ortes sind nur 1 km vom Rennsteig entfernt und liegen 720 m über dem Meeresspiegel, also in einer Höhenlage, wo der Ackerbau nicht mehr lohnt. Deshalb sieht man auch nur wenig Feld an den Abhängen, und dieses wenige ist meist mit Kartoffeln, nur zur Abwechslung mit etwas Sommerfrucht bestanden. Ohnedies sind die Abhänge so steil, daß der Pflug wenig gebraucht werden kann. Die Mittel zur Unterhaltung der zahlreichen Bevölkerung von nahezu 5000 Seelen liefert eben die Glasindustrie.
In der Mitte des Dorfes, da, wo die beiden Täler zusammentreffen, steht heute noch die nunmehr 300 Jahre alte Glashütte, welcher der Ort seine Entstehung verdankt. Der Eintritt wird uns bereitwillig gestattet, und so treten wir ein und schauen der Arbeit zu.
Vor uns erblicken wir den Schmelzofen, einem großen Backofen ähnlich, aus Sandstein und feuerfestem Ton aufgebaut. Seine Wände zeigen Öffnungen, die mit angelehnten Platten notdürftig verschlossen sind; zwischen den Spalten schlägt die Flamme heraus. Wir lassen uns erzählen, daß das Glas in der Hauptsache aus Quarzsand (Kieselerde) hergestellt wird. Damit die Masse schmilzt und das Glas weicher wird, setzt man irgendein Salz zu. Das beste ist Pottasche, oder auch Soda oder reines Natron. Um aber eine bestimmte Farbe zu erzielen, muß der Glasmacher noch einen bestimmten Stoff beimengen, jedoch nicht so, daß er zu blauem Glas einen blauen Farbstoff, zu grünem Glas einen grünen nähme. Diese Farbstoffe, der Glühhitze ausgesetzt, geben nicht dieselbe Farbe wieder. Um z. B. grünes Glas zu erhalten, muß Kupferoxyd (Kupferasche) beigemengt werden, zu blauem Glase nimmt man Kobalt, zu gelbem aber Birkenholzkohle, zu rubinrotem dagegen echtes Gold, zu einer Abart davon Eisenoxyd, zu kristallhellem Kalk oder Gips, zu milchweißem Knochenmehl, zu milchweißem Emailleglas gar Arsenik. Alles muß im richtigen Verhältnis gemengt werden; ein Fehlgriff könnte leicht ein unbrauchbares Gemenge geben.
Das Schmelzen des Glases erfordert einen hohen Hitzegrad. Je höher dieser ist, desto rascher schmilzt und desto besser wird das Glas. Der größte Hitzegrad ist nun gegenwärtig durch die Stein- und Braunkohle zu erreichen. Um diese aber hierzu verwenden zu können, muß der Ofen eine besondere Einrichtung haben, und so sind hier einige neue Glashütten entstanden mit Kohlenfeuerung. Die Dorfhütte hat aber noch Holzfeuerung, da ihr nach altem Rechte eine bestimmte Menge Holz zu billigem Preise geliefert werden muß. Damit nun auch aus dem Fichtenholz ein möglichst hoher Hitzegrad erzielt wird, so wird es vorher auf einer Vorrichtung nochmals besonders getrocknet.
Wenn der Glasmacher meint, daß die Glasmasse lauter genug sei, so hebt er an einer der Seitenöffnungen den Verschluß weg und entnimmt eine Probe, und wir haben jetzt auch Gelegenheit, einen Blick in das Innere des Ofens zu werfen. Wir sehen da hinter jeder Öffnung einen Schmelztiegel oder Schmelztopf stehen, wohl ½ m im Geviert und ebenso tief, vom Feuer umspielt. Der Glastopf ist aus feuerfestem Ton hergestellt, mit ziemlich starken Wänden, da die schwere Glasmasse einen großen Druck ausübt. – Der prüfende Blick des Glasmachers erkennt, wann die Masse genügend geschmolzen ist und die Verarbeitung beginnen kann. Gebrauchsgegenstände will er nicht machen, höchstens einen Krug oder eine Flasche zum eigenen Gebrauch. Alle Erzeugnisse dienen der Spielwarenindustrie. – Seine Werkzeuge sind höchst einfach. Die Hauptwerkzeuge sind ein etwa 1½ m langer, runder, hohler Eisenstab, Pfeife genannt, und ein gleichlanger, massiver. – Diesen Stab taucht er in die Glasmasse ein, von welcher ein kleiner Teil daran hängen bleibt. Durch mehrmaliges Eintauchen hat sich schließlich ein mehrere Pfund haltender Klumpen angehängt, gerade so viel, als der Glasarbeiter zu seinem Vorhaben für nötig hält. Dieser Klumpen wird mehrmals abgekühlt und wieder durchgeglüht, auch inzwischen auf einer Eisenplatte durch Umwälzen zusammengedrückt; denn es dürfen keine Luftbläschen dazwischen bleiben; alles soll lauter und rein sein. Gröbere Unreinigkeiten werden mit einer Zange entfernt, und wir bemerken dabei, daß sich die warme Glasmasse behandeln läßt wie warmes Pech oder Siegellack. Da wir gar so aufmerksam zuschauen, ist ein anderer Arbeiter bereit, uns zu zeigen, wie es möglich ist, einen Märbel (eine massive Kugel) herzustellen, der eine Figur oder auch Blumen in sich schließt. Ihm ist das ein Leichtes. Den einzuschließenden Gegenstand (aus unverkennbarem Stoffe) drückt er in die nötige Glasmasse ein und umwickelt ihn zu einem Ballen, etwa wie man einen Stein in einen Schneeballen einpacken könnte. Nur die Abrundung macht etwas Schwierigkeit. Hierzu bedient er sich einer Art Schere, an deren einem Ende eine Halbkugelform angebracht ist. Indem nun der sitzende Arbeiter auf seinen Oberschenkeln die Eisenstange hin- und herwälzt und dabei an die wieder flüssig gemachte Glasmasse die Schere anhält, wird dadurch die Glaskugel abgedreht.
Inzwischen hat nun unser erster Arbeiter seinen Glasklumpen fertiggestellt, daß er verarbeitet werden kann. Sein Gehilfe setzt oder hängt am untern Ende ebenfalls einen Eisenstab an und läuft nun, die Glasmasse auseinander und hinter sich herziehend, 10, 20, ja 30 m weit fort, zuweilen gar um einen Pfahl herum und wieder ein gutes Stück zurück. Hat dabei der Arbeiter durch seine Eisenpfeife mit dem Munde fortwährend Luft nachgeblasen, so ist eine lange Glasröhre entstanden; bläst er dagegen nicht, so erhält er einen massiven Glasstengel. Hat das Produkt Biegungen erhalten, so kommt das nicht in Betracht, weil es ja weiter verarbeitet wird. Kommt es aber darauf an, schnurgerade und gleichmäßig starke Röhren zu erhalten, wie sie zum Thermometer, Barometer, Wasserstandsrohr an der Dampfmaschine u. dgl. gebraucht werden, so werden behutsam nur kurze Stücke gezogen. Ist die Röhre erkaltet, was sehr rasch geschieht, so wird sie in Stücke zerbrochen (1-1½ m lang) und nach Gewicht an die Fabrikanten der Spielwaren verkauft.
Wir folgen einem solchen, der eben mit einem Bund Röhren vorübergeht, in seine Wohnung und sehen hier im kleinen, was uns die Hütte im großen zeigte. Der Schmelzapparat wird durch eine kleine, offene Lampe dargestellt, die früher mit Lein- und Rüböl, mit Talg, später mit Paraffin gespeist wurde. Besser ist die jetzige Einrichtung mit Leuchtgas. Um eine größere Hitze zu erzielen, wird, wie beim Lötrohr, eine Stichflamme erzeugt, wozu unter dem Arbeitstisch ein kleiner Schmiedeblasebalg angebracht ist, welcher mit dem Fuße gezogen wird. Die Glasröhre wird der Stichflamme nahe und nach und nach ganz in diese hinein gebracht. Wollte man sie unvermittelt hineinhalten, so würde sie zerspringen und unbrauchbar werden. Bald ist sie an der betreffenden Stelle so weich geworden, daß sie gebogen, ausgedehnt, zusammengeschoben oder durch Hineinblasen ausgeweitet werden kann. Alle aus Hohlglas verfertigten Gegenstände werden durch Hineinblasen hergestellt, wie das spielende Kind mit einem Röhrchen die Seifenblasen erzeugt. Deshalb werden alle diese Glaswarenfabrikanten als Glasbläser, die in der Hütte dagegen als Glasmacher bezeichnet. Um aber bequem aufblasen zu können, muß das Rohr vorher etwas zugerichtet werden. Am oberen Ende, wo es in den Mund genommen wird, wird es bedeutend verengt, am untern Ende aber ganz zu- und abgeschmolzen. Dies geschieht dadurch, daß man es zusammenbraten läßt und durch Wegziehen überflüssiger Teile abrundet. Diese Vorarbeit erfordert schon eine bedeutende Geschicklichkeit; der Glasbläser betrachtet das geschickte »den Spieß wegziehen« als Grundbedingung aller späteren Arbeit. Manche Dinge, z. B. Nüsse, Menschenköpfe, werden in Formen geblasen, jedoch nur solche, die keine bedeutenden Erhöhungen und Vertiefungen haben; andernfalls würden sie sich nicht gut aus der Form loslösen. Auch erfordert das Nehmen und Weglegen der Form etwas Zeit; deshalb werden die meisten Sachen, zumal die schwierigen, ganz frei auf- und ausgeblasen. Beobachten wir z. B. die Herstellung eines Hirsches, so werden, nachdem der Körper durch Biegen die richtige Form erhalten hat, die Beine, die Ohren, das Geweih herausgezogen. Wo es nicht zulangt, wird ein neuer Stengel angesetzt.
Eine große Mannigfaltigkeit wird erzielt durch Farbenspiel. Schon in der Glashütte hat das Glas verschiedene Farben erhalten, welche nun noch durch Bemalen und Lackieren auf alle mögliche Weise ergänzt werden. Manche Gegenstände sollen matt, andere hellglänzend, manche überzuckert, andere glatt, die verschiedenen Früchte ihrer Naturfarbe entsprechend recht duftig erscheinen. Christbaumschmuck soll den Lichterglanz zurückstrahlen und wird deshalb meist von innen verspiegelt. Dieses geschah früher und geschieht teilweise jetzt noch durch Bleifolie, zu welchem Zwecke das eine Ende des Gegenstandes in flüssiges Blei eingetaucht und dieses durch vorsichtiges Saugen mit dem Munde am andern Ende eingezogen wurde. Heute erreicht man denselben Zweck rascher auf kaltem Wege durch Einschütten von aufgelöstem Silber, dem noch einige, den Niederschlag bewirkende Stoffe (Salmiak, Natron) beigefügt werden.
Alle diese Spielwaren werden in den Wohnungen angefertigt, und so bildet fast jedes Haus eine kleine Fabrik für sich. Gar vielmal müssen die Gegenstände durch die Hände wandern, bis sie zum Versand fertiggestellt sind, und es hat jeder im Hause dabei eine bestimmte Arbeit zu verrichten, zu der er gerade am besten geeignet ist. Auch die Kinder müssen den Eltern hilfreich zur Seite stehen, zumal in der Zeit, da die meisten Bestellungen einlaufen. Da bewegen sich die kleinen Händchen flink beim Eintauchen und Überstreuen, beim Abschneiden und wieder Anreihen und Anleimen und Zusammensetzen, und sie arbeiten sich müde an den Sachen, die in der Ferne den Christbaum schmücken werden. Aber die Kleinen schaffen unverdrossen weiter; sehen sie doch die ob der vielen Arbeit so fröhlichen Mienen der Eltern, welche ihnen hin und wieder andeuten, daß das Christkind auch bei ihnen einkehren wird.
Außer Christbaumschmuck werden nun auch noch andere verwandte Artikel in Lauscha angefertigt, so z. B. Perlen und Glasschmelz zum Besatz der Damenkleider, Augen für Puppen, für ausgestopfte Tiere und für Menschen, Glasblumen, Zigarrenspitzen usw. Unter den Glasperlen nehmen besonders die Fisch- oder Wachsperlen eine hervorragende Stelle ein. Ihr Inneres ist mit »Silber« belegt, das von Fischschuppen abgelöst ist. – Die »Menschenaugen« können ja das verlorene Auge nicht ersetzen, aber sie geben dem entstellten Antlitz das normale Aussehen wieder, zumal sie dem gesunden Auge so täuschend nachgeahmt werden, daß kaum ein Unterschied zu merken ist. Ferner läßt sich das Glas zu haarfeinen Fäden ausziehen, welche dann wieder mannigfache Verwendung finden. Soll solches Glashaar hergestellt werden, so bedient sich der »Glasspinner« hierzu eines leichten Rades von 1-1½ m Durchmesser. Auf dem Rande desselben heftet er den Glasfaden an, und indem nun das Rad sich umdreht, zieht es einen Glasfaden ab, der desto feiner wird, je rascher sich das Rad dreht. In kurzer Zeit hat sich der Rand des Rades mit einer dicken Lage Glasfäden bedeckt, welche leicht abgehoben werden können. Sie gleichen gehecheltem Flachs. Ja, ein solcher feiner Faden kann trotzdem noch aus einer doppelten Lage von Glas bestehen. Das wird dadurch erreicht, daß der Glasspinner vorher zwei Glasstengel der Länge nach aneinander schmolz und dann abspann. Hatte das Glas verschiedenen Härtegrad, so zieht es sich bei der Abkühlung auch ungleichmäßig zusammen. Deshalb krümmt sich der Faden, und so entsteht elastische Glaswolle oder eine Glaslocke. – Das Glashaar wird verwendet zu Flügeln für Engel, Vögel, Schmetterlinge usw. Es wird auch verflochten zu Broschen, Krawatten und Geweben. Zu letzteren hat sich der Fabrikant einen Webstuhl im kleinen eingerichtet. Doch wird dann als »Zettel« gewöhnlicher Garnfaden und nur als Einschlag Glashaar genommen. Auf diese Weise lassen sich größere Gewebe herstellen; ja, ein Gesangverein hat sich sogar eine Fahne aus solchem Glasgewebe anfertigen lassen, die stets die Bewunderung der Fremden erregt.
Erwähnt sei auch, daß Lauscha zwei Porzellanmalereien besitzt, in denen auf Porzellanplatten wahre Kunstwerke – meist Porträts – hingezaubert werden. Ihre Erzeugnisse sind ebenfalls weltbekannt.
c) Geschichte der Sonneberger Industrie.
Die Anfänge seiner Industrie verdankt Sonneberg der Sage nach reisenden Nürnberger Kaufleuten, die den Wetzsteinbruch auf dem östlich des Ortes gelegenen Stadtberge entdeckt, die Bewohner Sonnebergs zur Wetzsteinindustrie angehalten und dann den Vertrieb der Steine übernommen hätten. Die Fabrikation der Wetzsteine, die sich sehr bald eines Weltrufes erfreuten, hob sich mehr und mehr, und die biederen Waldbewohner gelangten in immer engeren Verkehr mit den Bürgern der alten Reichsstadt. Infolge des Holzreichtums des Thüringer Waldes kamen die »Steinmacher« bald auch auf ein zweites Arbeitsfeld, die Holzwarenindustrie. Es ist nicht unmöglich, daß den Anlaß hierzu ebenfalls die Nürnberger gegeben haben, um so mehr, als wir wissen, daß bereits um die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts in Nürnberg ein Gewerk der Holzschnitzer blühte. Die Früchte der neuen Industrie, die, wie die Sage berichtet, anfänglich nur in Stiefelknechten, Tellern, Schüsseln, Löffeln usw. bestanden, wurden selbstverständlich auch von den Nürnberger Kaufleuten in den Handel gebracht. Nur äußerst selten versuchten die »Schnitzer« selbst, auf dem Weg des Hausierens ihre Erzeugnisse umzusetzen.
Während der Zeit der Reformation entwickelte sich im oberen Tale der Röthen auch die Schiefertafel- und Griffelindustrie, hervorgerufen durch die verbesserten Schulverhältnisse.
Als nämlich die Reformation in Thüringen Fuß gefaßt hatte und sogenannte deutsche Schulen in jedem Städtchen eingerichtet worden waren, entstand Nachfrage nach dem billigsten Schreibmaterial. Diesem Bedürfnis konnte in ganz Europa kein Ort besser entsprechen, als das Meininger Oberland, zunächst das Städtlein Sonneberg, dessen dünnspaltiger Schiefer im Röthentale und Schieferstein am Stadtberg vorerst ein genügendes Schreibmaterial lieferte. Die damaligen Schiefertafeln bestanden bloß aus länglich viereckigen, behauenen Schieferstücken und waren nicht umrahmt. So trat denn zuerst von Sonneberg aus das »steinerne Papier« als ein wahrer Volksbeglücker seinen Weg in alle deutschen Schulen, nach und nach in alle Weltteile an. Kein praktisches Volkslehrmittel in der Welt, das durch seinen geringen Kaufpreis so volkstümlich geworden ist, hat so ruhig, sicher und dauernd Epoche gemacht, wie die Schiefertafel und der Griffel. Kein zweites Hilfsmittel hat der Lehre Luthers fortwährend solchen Vorschub geleistet wie der Griffel und die Schiefertafel. So belohnte dies Zwillingspaar seinen Urheber, die Reformation. Die Wetzsteinfabrikation bestand natürlich fort. Aus der Holzwarenindustrie, die bisher nur allerhand Hausrat erzeugte, gingen um diese Zeit die Holzspielwaren hervor, die gleichfalls als »Nürnberger Waren« auf den Markt kamen. Zunächst bestanden sie wohl nur in »Klappern«, »Schnurren« und »Pfeufen«. Mit der Ausdehnung des Absatzgebietes steigerten sich jedoch bald auch die Ansprüche, die an die Holzwaren in bezug auf Aussehen und gefällige Form gestellt wurden. Deshalb begann man ungefähr zwei Jahrzehnte vor dem Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, die Schachteln und Koffer, Salzmesten, Mehlkübel und Nähpultchen mit Leimfarben bunt zu bemalen. Es entstand ein neuer Industriezweig, die Wismutmalerei, die Sonneberg ebenfalls Nürnberg verdankt. Rasch wurde die Wismutmalerei zum bedeutendsten Gewerbe in Sonneberg. Neben den »Weißmachern«, welche die Waren roh aus dem Holz schnitzten, bildete sich eine Gewerkschaft der »Maler«. Diese bemalten die Erzeugnisse der Weißmacher mit allerlei Zierat, Figuren und Blumen und setzten wohl auch einen Bibelvers oder einen selbstgedichteten kräftigen Reim darunter.
Dieser Periode der Entwickelung der Sonneberger Industrie folgte nun, hervorgerufen durch den Dreißigjährigen Krieg, eine Zeit des Rückschlags. Nürnbergs ausgedehnter Handel war lahmgelegt worden, und als endlich der ersehnte Friede in die erschöpften Länder einzog, ließen die »Kipper und Wipper« mit ihrer Münzverschlechterung den Handel noch lange nicht wieder zu Kräften kommen. »Es ist aber kein Übel so groß, daß nichts Gutes daraus entspringe.« Als im 17. Jahrhundert die Nürnberger der Geldverhältnisse halber mit so ordinären Waren, wie sie damals in Sonneberg angefertigt wurden, keinen Großhandel mehr treiben konnten, sahen sich die Meininger Oberländer genötigt, sich dem Verschleiß ihrer Waren selbst zu unterziehen. Durch ihren Verkehr mit den Nürnbergern hatten sie im Laufe der Zeit sich mannigfache geschäftsmännische Kenntnisse angeeignet, auch waren sie durch die »deutsche Schule«, welche im Jahre 1585 in Sonneberg errichtet worden war, im Lesen, Rechnen und Schreiben ziemlich bewandert, sodaß sie neben den Nürnbergern mit ihren Wetzsteinen und Holzwaren die Messen und Märkte besuchen konnten. Trotz der Geldnot fanden sie zufriedenstellenden Absatz. So wurden diese von der Not zum Reisen gezwungenen Wismutmaler und Steinmacher die Pfadfinder des Sonneberger Handels. Hauptsächlich waren es die Messen zu Frankfurt a. M., die von ihnen besucht wurden. Dort waren sie auch bald, wie die Nürnberger, fast von aller Zoll- und Geleitsabgabe befreit und hatten nur einige geringe selbstgefertigte Fabrikate dafür abzugeben. Obwohl sich nun die Sonneberger Kaufleute, die sich allmählich aus den Wismutmalern herauskristallisierten, mehr und mehr von den Nürnbergern unabhängig zu machen suchten, brachten sie ihre Spielwaren, »buntfarbig bemalt und g'spaßig anzuschauen«, überall als »Nürnberger« auf den Markt; denn Sonneberg kannte niemand, und Nürnberg hatte einmal den guten Klang. Dabei genossen die Sonneberger da, wo sie als Nürnberger angesehen wurden, weit größere Achtung und ließen sich diese auch gern zollen.
Aus dem Meßhandel entwickelte sich allmählich der Kommissionshandel, und zwar wird ein Holländer, ein gewisser Herr von Hütt, genannt, welcher dazu am Anfang des 18. Jahrhunderts die Veranlassung gegeben haben soll. Viele Sonneberger Kaufleute legten im Auslande ihre Verkaufsstellen an und eröffneten eine Reihe günstiger Absatzwege. Was damals alles verfertigt und wohin es versendet wurde, gibt ein Bericht vom Jahre 1735 an: »Nebst dem Ruß, womit ein großes Commercium getrieben, finden hier Spiegel, Schiefertafeln und Schieferbüchlein, welch letztere durch die ganze Welt, besonders nach West- und Ostindien gehen, Kisten, Schachteln, Spiegelrahmen, von denen ganze Kisten nach Nürnberg geliefert werden, Brieftaschen, Kammfutterale, messingene Nägel, Handknöpfchen, Bleistifte, Wandleuchter, Tabuletten, Wasserspritzen, Würzladen, Schränkchen, Salz- und Mehlfässer, Tabakspfeifenfutterale, Bierstutzen, Schüsseln, Teller, Eß- und Kochlöffel, Schreibzeuge, Zuckerbüchsen und allerhand Kinderwaren, als Nähpultchen, Coffrigen, Degen, Pistolen, Flinten, Pfeufen, Geigen, Kegelspiele, Nußbeißer, Klapper, Guckguck, Schnurren, Pfennigpfeufen u. dgl. m. ihren Vertrieb, zu dem Ende sind gewisse Magazine und Packhäuser angelegt, worin alle diese Waren, jedes nach seiner Art rangiert wird, welches wegen der mancherlei buntfarbigen Vermischung eine charmante Veränderung macht und artig in die Augen fällt; mit allen diesen Waren wird von hier aus nach Holland und England, nach Dänemark, Schweden, Norwegen, Moskau, Astrachan und Archangel, nach Österreich-Ungarn und Siebenbürgen, nach Nürnberg, Prag und München, nach Frankfurt a. M., Straßburg, Leipzig, Magdeburg, Braunschweig, Hamburg, Lübeck, Breslau und Königsberg ein unaussprechlicher Handel getrieben und daraus sowohl zu der Handelsleute selbsteigener, als zu der gesamten Bürgerschaft und benachbarter Dorfschaften Aufnahme und Wohlsein ein schönes Geld gelöst und ins Land hereingebracht.« Ein Sonneberger, namens Joh. Nic. Döbrich, hatte sogar Schiffe zur See gehen, wovon eins den Namen Sonneberg führte. Nicht geringen Anteil an dieser Blüteperiode der Sonneberger Industrie hatte der spanische Erbfolgekrieg. Nürnberg, das bis dahin fast im Alleinbesitz des Flintensteinhandels war und die Steine aus Frankreich bezog, konnte von dort her eben des Krieges wegen keine mehr erhalten. Es suchte Bezugsquellen in Deutschland. Sonneberg konnte die Steine liefern und nahm auf diese Weise teil an dem einträglichen Handel, der sich auf nahezu sämtliche Heere Europas erstreckte.
Die erste Blütezeit Sonnebergs endet mit dem Beginn der französischen Revolution und der darauffolgenden langjährigen Kriege Napoleons. Der Rückgang war zu gewaltig, als daß die Sonneberger nicht auf Mittel gesonnen hätten, auf irgendwelche Weise einen Ausgleich zu schaffen. So erfanden die Wismutmaler die Kunst des »Bossierens«. Um jene Körperteile, welche aus Holz besonders schwierig oder umständlich zu schnitzen waren, leichter, minder kostspielig und doch eleganter herstellen zu können, hatte man aus Schwarzmehl und Leimwasser eine Teigmasse gebildet, aus der man beschriebene Teile auf die gewünschte Art formen konnte. Die Beschäftigung der Bossierer setzte eine gewisse Fertigkeit voraus, da sämtliche Figuren, Stück für Stück, aus freier Hand hergestellt werden mußten. »Bossieren« = »bosseln«, heißt auch soviel wie »fingern«, »mit der Hand formen«. So viele Vorteile aber die bossierten Fabrikate hatten, so viele Nachteile hatten sie auch. Bei der geringsten Feuchtigkeit, der sie ausgesetzt waren, verschimmelten sie, und mußten sie sogar übers Meer, so kamen sie äußerst selten ohne einen dicken grünen Überzug beim Besteller an. Außerdem waren die Teigwaren ein gesuchter Leckerbissen der Mäuse. Diese Übelstände zwangen die Sonneberger, ein Mittel zu erfinden, das frei von solchen Mängeln sei. Der Kaufmann Friedrich Müller war es, der im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts seiner Vaterstadt die Papiermasse gab. Diese, ein Gemisch aus Papier, Leimwasser, der Masse (geschlemmter weißer, tonhaltiger Sandstein) und Schwarzmehl, besaß die gewünschten Vorzüge. Nun wurde die ganze Spielwarenindustrie eine andere. Man modellierte den herzustellenden Artikel in Ton, verfertigte mit Hilfe des Modells Schwefelformen, welche die Figur in vertiefter Arbeit enthielten und drückte einfach die Papiermasse hinein. Eine Kategorie von Arbeitern entstand, die »Drücker«. Nun nahm man vom Modell ein Dutzend Formen, gab diese einem Dutzend Drückern und erhielt in kurzer Zeit Tausende von Figuren geliefert. Jetzt erst war es möglich geworden, Massenartikel für ein billiges Geld herzustellen und ihnen ein gleichmäßiges Aussehen zu geben, wie es der Weltmarkt verlangt.
Während dieser Entwickelungszeit der Sonneberger Industrie war Napoleons Sturz und die Aufhebung der verderblichen Kontinentalsperre erfolgt. Ein Aufblühen des Handels wurde aber durch die hohen Zölle noch verhindert. Wurden doch selbst die einzelnen Bundesstaaten im eigenen Vaterlande durch Schlagbäume voneinander getrennt. In Österreich und Rußland, jenen weiten Ländern mit ihrer zahlreichen Bevölkerung, wurde mit Ausnahme von Schiefertafeln, Griffeln und Wetzsteinen die Einfuhr sämtlicher Sonneberger Fabrikate gänzlich verboten; Spanien, Portugal und die italienischen Staaten folgten diesem Beispiele nach, und Frankreich belastete die meisten Waren mit so hohen Eingangszöllen, daß deren Verbrauch sich notwendigerweise vermindern mußte. Deshalb bahnte man Ende der zwanziger Jahre den Absatz über das Meer an, der denn auch in dem Maße gelang, daß schon 1826 die Ausfuhr auf 18 000 Zentner stieg.
Vorteilhaft wirkte auch der 1833 ins Leben gerufene deutsche Zollverein auf den Sonneberger Handel. Jedoch bei all diesen nun günstigen äußeren Umständen konnte sich der Handel in der gewonnenen Ausdehnung nicht halten oder gar steigern, wenn sich nicht auch die Gewerbtätigkeit beständig fortschreitend entwickelte. Es wichen deshalb manche geringe, keines großartigen Betriebs fähige Industriezweige anderen, besser lohnenden. Die Anfertiger der Schieferbüchlein, der Spiegelrahmen, Hemdknöpfchen, Bleistifte usw. gaben ihre bisherige Beschäftigung auf und wandten sich der Spielwarenfabrikation zu. Die alten, unzierlich geformten Spielwaren wieder wurden durch schönere, den gesteigerten Ansprüchen des kaufenden Publikums entsprechende ersetzt. Eine besondere Art der Fabrikation, die Puppen- oder Dockenfabrikation, entwickelte sich. Köpfe, Arme und Beine wurden meistenteils aus Papiermasse hergestellt, während die Bälge, die aus Leder oder Schirting bestanden, mit Heu oder Sägespänen ausgestopft wurden. Heutzutage verwendet man jedoch nur zu den ganz gewöhnlichen Sorten gedrückte Köpfe. Nach dem Vorgang des Sonneberger Fabrikanten Heinrich Stier verfertigt man seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts die Wachspuppenköpfe. Bei dieser den Chinesen nachgeahmten Methode braucht man gerade wie beim Drücken ein Modell, wonach man Gipsformen herstellt, in die das flüssige Wachs gegossen wird. Nach ungefähr zwei bis drei Minuten gießt man die Formen wieder aus, öffnet sie und erhält den hohlen Wachspuppenkopf, den man mit Glasaugen versieht, der Dauerhaftigkeit wegen inwendig mit einer gipsartigen Masse auslegt, dann malt und zuletzt frisiert. Noch neueren Ursprungs sind die Puppen mit Porzellanköpfen, die ebenfalls mit Glasaugen versehen und frisiert werden müssen. Auch vollständig aus Pappe gestanzte Puppen und Gelenkpuppen (mit beweglichen Gliedern) werden jetzt vielfach fabriziert.
Seit dem letzten, glorreichen Kriege hat Deutschland in seinem Handel und in seiner Industrie einen derartigen Aufschwung genommen, daß es jedem Wettbewerb des Auslandes erfolgreich gegenübertreten kann. So hat sich auch die Spielwarenindustrie in einer Weise gehoben, daß sie wohl einzig in der Welt dastehen dürfte. Neben der Fabrikation gekleideter Puppen, die zu beschreiben Eulen nach Athen tragen hieße, da sie von den einfachsten bis zu den feinsten überall bekannt sind, verfertigt Sonneberg Spielwaren, die in ihrer Zusammensetzung und Ausführung nicht weit von den Erzeugnissen der Kunst entfernt sind. Die sinnreichsten mechanischen, die prachtvollsten Musikdrehfiguren, die naturgetreu, oft in Lebensgröße hergestellten und meist mit natürlichem Kleide versehenen Tiere, sie alle gehen nach allen Richtungen der Windrose als »Sonneberger Spielwaren« über den ganzen Erdball und gereichen ihrer Heimat zur Ehre. Der Achtung, die dereinst der Nürnberger in Deutschland genoß, erfreut sich heute der Sonneberger selbst im Auslande. Nicht vergessen sollte er aber, daß er die Grundlage seiner Existenz und seines Ruhmes dem verödet auf dem Stadtberg liegenden alten Wetzsteinbruche verdankt.
d) Die Griffelindustrie des Meininger Oberlandes.
Schon das Kind in der Wiege begrüßt in der Klapper ein Erzeugnis Thüringer Gewerbefleißes. Der glänzende Glasschmuck des Christbaumes, den es jubelnd umspringt, ist ebenso ein Erzeugnis des Thüringer Waldes, wie das Wiegenpferd des Knaben und die Puppe des Mädchens, die neben andern Sonneberger Spielsachen den Weihnachtstisch schmücken. Mit einigem Stolz empfängt der sechsjährige Erdenbürger von einer guten Tante oder Pate die Schiefertafel und das Kästchen mit Griffeln und trägt dann beides an jenem großen Tage mit etwas gemischten Gefühlen zur Schule. Schiefertafel und Schiefergriffel, auch sie sind Erzeugnisse des Thüringer Waldes. Besonders im östlichen Teile dieses Gebirges, im Herzogtum Meiningen, tritt sowohl Tafel- als Griffelschiefer zutage. Der Griffelschiefer ist insofern vom Tafelschiefer verschieden, als er nach zwei Richtungen hin sich spalten läßt, was beim Tafel- und Dachschiefer, welchen besonders die weltbekannten Brüche bei Lehesten liefern, nicht möglich ist. Griffelschiefer wird besonders bei Hasenthal, Haselbach, Spechtsbrunn und Steinach gefunden. Die Griffelindustrie ist eine verhältnismäßig noch sehr junge. Bis zur Mitte dieses Jahrhunderts beuteten nur einzelne in den angegebenen vier Dörfern den Schiefer aus, schabten die Griffel noch mit der Hand rund und gaben sie an den Kaufmann oder auch den Lehrer des Ortes ab. Dieser verschickte sie dann an die Ortschaften des Flachlandes. Später, als die Nachfrage eine größere wurde, taten sich die Bewohner der genannten Dörfer zu Genossenschaften zusammen, nahmen von dem Meininger Staat ein großes, Griffelstein bergendes Areal in Pacht und betrieben dessen Ausbeutung auf eigene Rechnung und Gefahr. Als die goldene Zeit preisen die Griffelmacher die von 1872 bis in die achtziger Jahre. Ein einziger Unternehmer hatte eine Zeitlang die gesamte Griffelindustrie in der Hand und bestimmte, da ja der Bezirk der erwähnten vier Dörfer die meisten und besten Griffel der Welt lieferte, den Griffelpreis. 50 Mark und noch mehr verdiente da bei fleißiger Arbeit wöchentlich eine Griffelmacherfamilie. Manche haben die Zeit benutzt und sind zu einigem Wohlstand gelangt, manche haben es auch nicht getan. Sie sind arm geblieben und sehnen sich nun gleich jenem Bergmann nach der Wunderblume und den verschwundenen Schätzen. Die hohen Griffelpreise veranlaßten auch andere Orte im Meininger Oberlande und im Schwarzburgischen, nach Griffelschiefer zu graben, und zum Teil geschah das mit Erfolg. Es entstand Wettbewerb, mit ihm Zwistigkeiten zwischen Griffelmachern und Unternehmer, schließlich durch Überproduktion ein rasches Sinken der Griffelpreise, was den Meininger Fiskus veranlaßte, die Industrie selbst in die Hand zu nehmen und die Griffelbrüche zu Hasenthal, Haselbach, Spechtsbrunn und Steinach zu verstaatlichen. – Besuchen wir nun, um zu sehen, wie eigentlich unser Schieferstift entsteht, einen solchen Griffelbruch. Jeder ist mit einem kleinen Koloniedorf von Bretterhütten umgeben, den Arbeitsstätten der Griffelmacher. Mit kräftigem »Glückauf!« fährt früh eine Abteilung in den Bruch ein, um den nötigen Griffelstein zu brechen. Die Arbeit ist keine leichte, und Unglücksfälle sind dabei nicht selten. Der gewonnene Stein wird in gleiche Haufen geteilt und verlost. Jeder Griffelmacher bringt sein »Los« in das »Steinloch«, eine kellerartige, mit einer Tür versehene Vertiefung bei seiner Hütte. Darin muß der Stein feucht gehalten werden; denn nur feuchter Griffelschiefer spaltet, einmal trocken geworden, ist er wertlos. In seiner Hütte zersägt dann der Griffelmacher den Stein in kleine, der Griffellänge entsprechende Stücke. Die Arbeit geschieht mit der Handsäge und ist nicht nur anstrengend, sondern auch wegen des eingeatmeten Schieferstaubes gesundheitsschädlich. Die erhaltenen Stücke werden dann nochmals zersägt oder auch mit einem scharfen Hammer in Platten und diese wieder in lauter viereckige Säulchen gespalten. Der hierbei Zusehende weiß nicht, was er mehr bewundern soll, die Fertigkeit und den sicheren Blick des Arbeiters oder das Material, das sich leichter spalten läßt als Holz. In einer Ecke der Griffelhütte steht die »Maschine«, die das »Durchmachen« der Griffel besorgt, ein einfaches Holzgestell. Zwischen zwei aufrechtstehenden Holzsäulen ist ein Querbalken befestigt, welcher ein kegelförmiges Eisen trägt, das mit einer geschärften, der Griffelstärke entsprechenden Öffnung versehen ist. Ein anderer Querbalken ist unten mit einem Fußtritt, oben mit einem federnden, an der Decke der Hütte befestigten Fichtenstämmchen verbunden und läßt sich zwischen den beiden Säulen auf und ab bewegen. Der rohe Stift wird auf die Mündung des Eisens aufgesetzt, ein Druck mit dem Fuße, der Querbalken senkt sich nieder, drückt den Stift durch die Öffnung, und er fällt gerundet und geglättet unten heraus. Je nach Beschaffenheit der Mündung können schwache und starke, vier- und dreieckige Griffel gefertigt werden. Das »Durchmachen« war früher die Aufgabe der Frauen und Kinder, jetzt ist die Kinderarbeit auf den Brüchen verboten. Der Verdienst der Griffelmacher ist dem anderer Arbeiter gegenüber ein geringer. Die Schuld liegt aber nicht an dem Staate als Arbeitgeber, sondern an dem Wettbewerb der entstandenen Privatbrüche, mit welchem auch er zu rechnen hat. Große Ansprüche an das Leben stellt der Griffelmacher nicht. Fast jeder besitzt ein Häuschen und ein Stück Feld, das ihm sein Hauptnahrungsmittel, die Kartoffel, liefert. Der Griffelmacher genießt sie selbstzubereitet als Mittagsmahl allein in seiner Griffelhütte und als Abendbrot zu Hause mit seiner Familie. Am Sonntag erscheint sie in Form von rohen Klößen auf dem Tisch. Der geringe Verdienst der Griffelmacher wird durch die Arbeit ihrer Frauen und Kinder etwas erhöht, welche sich mit dem »Veredeln« der Griffel beschäftigen. Die rohen Griffel werden aus dem staatlichen Lager an die Händler abgegeben, welche sie zur Veredelung an einzelne Familien verteilen. Frauen und Kinder umwickeln die Griffel mit Gold-, Silber- oder Buntpapier und spitzen sie mit einem beilartigen Instrument. Neuerdings werden die Spitzen größtenteils angeschliffen, Kisten und Kästchen jeder Größe, vom geringen Holzkasten bis zum feinsten Etui, in denen die Griffel versandt werden, werden ebenfalls in den Griffelorten selbst gefertigt und sind Gegenstände eines besonderen Erwerbszweiges. Bei ihrer Herstellung sowohl, als auch beim Verpacken der Griffel sind Frauen und Kinder mitbeschäftigt. Die Händler des Griffelbezirkes versenden ihre Ware nach allen Teilen der kultivierten Welt. Die meisten, aber auch geringsten Griffel, z. B. die sogenannten Stümpfe, kaum fingerlange, aber doch mit Kattunpapier umwickelte Abfallgriffel, gehen nach England oder direkt in dessen Kolonien. Mit dem Stifte, den der Griffelmacherknabe »gewickelt«, während der Schneesturm an den schieferbeschlagenen Wänden seines Vaterhäuschens klapperte, malt der ebenso arme Hinduknabe unter der heißen Sonne Indiens seine ersten Schriftzeichen.
Die vier Abschnitte »Thüringer Industrien« sind etwas gekürzt entnommen aus: Thüringen in Wort und Bild. Herausgegeben vom Thüringer Pestalozziverein. Berlin 1900 (Julius Klinkhardt).
Von Hans Hoffmann.
In der altersgrauen und halbbarbarischen Zeit des 19. Jahrhunderts, das will sagen, bis zum Frühling 1899, pflegte man den Brocken von Wernigerode aus auf drei oder vier verschiedenen Wegen zu Fuß oder zu Wagen zu ersteigen: entweder über die Steinerne Renne und weiter an der Holtemme hin, bis nahe an deren Quelle auf dem Renneckenberg, und endlich auf der Ilsenburger Chaussee bis zum Gipfel; oder durch das Drängetal über Schierke; oder über den Ottofelsen und die Hohneklippen; oder man fuhr nach Ilsenburg und hatte von hier aus den kürzesten Aufstieg. Das sind nun alles verschollene Dinge. An Wagenfahrten denkt niemand mehr, und zu Fuß kraxelt höchstens noch hier und da einmal ein altmodisch romantisierendes Individuum oder ein bußfertiger Pilgrim zur Abspülung seiner Sünden.
Da wir aber einmal vom vergangenen Jahrhundert reden, so mag es von Interesse sein, zur Vergleichung noch eine Nummer weiter zurückzugreifen und uns zu vergegenwärtigen, in welcher Art man damals den Brocken erklomm.
Im Jahre 1786 wurde zu Braunschweig ein Büchlein ans Licht gegeben, in dem ein junger Mann, namens Karl Bläß, seine »Reise nach dem Brocken« sehr ausführlich, mit guter Beobachtung und noch besserer Begeisterung geschrieben hat. Er war von Ilsenburg aufgestiegen, wo er einen Führer nahm, der soeben zwei Fremde aus Quedlinburg vom Brocken zurückgeleitet hatte. »Die beiden hörten kaum,« so berichtet er, »daß wir auf den Brocken wollten, so wandten sie alles an, um uns von dieser abscheulichen Reise zurückzuhalten. Sie konnten nicht Worte genug finden, uns ihr ausgestandenes Ungemach hinlänglich zu schildern; perorierten uns solche schrecklichen Dinge vor, daß uns Hören und Sehen verging; beschrieben den halsbrecherischen Weg, redeten von dem vielen Wasser, zugleich auch von dem ungewöhnlichen Durste, den man unterwegs leide, ohne einen Tropfen Wasser zu finden; von der Kälte auf dem Brocken behaupteten sie, daß alle Kleider nicht hinreichten, dieselbe einigermaßen erträglich zu machen. Wie ist es möglich, sagten sie warnend zu unserem Lehrer, für die Kinder, solches auszustehen! Die werden nicht lebendig herunterkommen! – Wie bange meinem Bruder und mir wurde, kann man sich leicht vorstellen.«
Und da will man von Verweichlichung des heutigen Geschlechts reden! Heute gehen wir mit sechsjährigen Kindern hinauf und suchen mit Vorliebe Pfade, wie den durch das Schneeloch, der die alten Wege an Beschwerlichkeit zweifellos übertrifft. Im Bergsteigen sind wir offenbar rüstiger geworden, als unsere Altvorderen; nur über Durst hört man auch wohl Männer unseres Säkulums klagen, aber auch nur Männer; alles andere ertragen wir willig. Abzuwarten bleibt nur, ob die sich mehrenden Bergbahnen nicht von neuem entnervend auf die kommenden Generationen einwirken werden; vielleicht, daß man sich künftig im sichern Abteil, mit leise gesträubten Haaren, von den halsbrechenden und tollkühnen Brockenerklimmungen im 19. Jahrhundert grausige Mären ins Ohr raunen wird.
Eins aber können wir aus jener Schreckensschilderung der Quedlinburger – die am 27. Juni, also in allerbester Jahreszeit, aufstiegen – deutlich ermessen, daß Goethes Dezemberbesteigung bei metertiefem Schnee in Wahrheit für seine Zeit ein großes Heldenstück gewesen ist. Ist doch solch ein Wintervergnügen noch heute nicht jedermanns Sache und tatsächlich nicht immer ohne ernste Gefahren.
Die Schönheit des Weges talaufwärts weiß der Jüngling gebührend zu würdigen. »Alles war voller Bäume, es waren meist Tannen und Birken, dazwischen auch Eichen und Buchen; ziemlich oben fanden wir einen einzigen Lärchenbaum; es soll aber mehrere in dieser Gegend geben.« Wobei zu bemerken ist, daß dieser reizende Nadelbaum erst im 18. Jahrhundert in den Harz eingeführt ist, zurzeit aber gibt es, zumeist in den Fichtenwäldern eingesprengt, nicht bloß ihrer »mehrere«, sondern eine sehr erfreuliche Anzahl. Besonders hübsch ist im ersten Frühling der Gegensatz zwischen ihrem zarten Neugrün und der dann noch ganz dunklen Färbung der Fichten; ebenso fein hebt sich im Herbst ihr goldiges Gelb ab; ein eigener Anblick ist es, wenn nach frühem, herbstlichem Schneefall die Lärche ihre zarten Nadeln als ein zierliches Streuwerk über die weiße Decke hinschüttet.
Unser Wanderer gelangt an den Ilsenstein. »Wir erblickten zu unserer Linken eine nackte Felsenwand von ungeheurer Höhe und außerordentlicher Breite, entsetzlich anzusehen.« Erstiegen wird er nicht, »denn man kann nicht alles sehen«. »Wir sahen nahe bei diesem Felsen, etwa in der halben Höhe desselben, etwas wimmeln, mit Mühe erkannten wir, daß es Menschen waren.« Das ist bei der mäßigen Höhe des Felsens doch wohl etwas stark aufgetragen! –
Die Wanderschaft geht weiter, an der Ilse entlang, in der Richtung des heutigen Fahrweges, zunächst auf die Heinrichshöhe. Die Ilsefälle werden nicht bemerkt: ein Beweis, wie nötig die jetzigen Handweiser sind. Heute wählt man zumeist den stark abkürzenden und interessanteren Fußweg durch das Schneeloch, eine Stelle, wo der Winterschnee sich besonders lange zu halten pflegt. Die obere Strecke ist äußerst steil, führt uns aber durch die echteste Brockennatur. Da ist Hochgebirgsurwald, knorrige, zottige Fichtenstämme, mit graugrünem Moose wie mit einem wunderlichen Pelzwerke dicht überkleidet, herauswachsend aus weiten Feldern verworrenen Felsgebröckels, unter dem geheimnisvoll nimmermüde Quellen, meist unsichtbar, überall sickern und rinnen, bald munter plätschernd, wie in anmutigem Geplauder, bald unheimlich aus der Tiefe glucksend und gurgelnd. Die Baumwipfel sind von der Gewalt der Stürme nicht bloß zerzaust und zerrissen, sondern fast immer auch abgebrochen und zu seltsam formlosen Bildungen verzerrt. Solch ein Wald ist wie geschaffen, die Phantasie zu befeuern und ihr allerhand mißgeborene Geschöpfe entwachsen zu lassen, Gnomen und Zwerge, Erdmännlein, Berggeister und Nixen, halb lustig, halb grotesk von Ansehen und Gebaren, halb unheimlich und verderblich. Und nun muß man diesen verwunschenen Wald erst im Winter sehen! Da wächst der Zauber ganz ins Abenteuerliche hinein.
Doch wir kehren zu unserem jungen Freunde zurück, der inzwischen die Heinrichshöhe erreicht hat, den südlichen Vorsprung des Brockens, den eine leichte Senkung von der 100 m höheren Hauptkuppe trennt. Wir erfahren, daß sich hier damals ein Wirtshaus befand, »ein steinern Gebäude von mäßiger Größe, mit einer geräumigen Stube und einem Kämmerchen daneben, einer Diele, kleinen Küche, Vorratskammer und doppelten Stallung; über das ganze Haus geht ein großer Boden, der mit Schindeln gedeckt ist: sodaß es denn doch wahrlich kein Loch zu nennen ist«, fügt der Schreiber vorwurfsvoll hinzu, auf die frühere Behauptung der Quedlinburger Warner zurückdeutend; nach unserer überfeinen Anschauung dürften diese allerdings kaum allzu hart geurteilt haben. Dagegen verzeichnet er einen höchst merkwürdigen Luxus, den wir sogar heute noch nicht wiederfinden, nämlich eine Kegelbahn, wo sich die wackeren Jungen »einige Zeit von dem beschwerlichen Marsche mit Kegelschieben erholten«. Das Essen, Weinsuppe, Braten und Salat, wird als reinlich und wohlschmeckend gerühmt. An einem Fremdenbuche fehlte es schon damals nicht. Das Nachtquartier war freilich desto bescheidener. »In der Stube an der Wand waren zu einer Pritsche eingerichtete Bretter aneinander geschoben, mit Stroh und etwas Betten für uns drei belegt. Unser Führer und ein Hüttenarbeiter brachten hier gleichfalls die Nacht, ein jeder auf einer besonderen Bank, zu. Diese nächtliche Kameradschaft mußten wir uns gefallen lassen.«
Die Grundmauern dieses Wirtshauses bestehen noch, und wer von Wernigerode oder Schierke aus zu Fuß den Brocken ersteigt – wenn ja noch jemand zu Fuß geht – und einen kleinen Marsch auf schmalem Jägerpfade durch Wald- und Moorwildnis nicht scheut, dem ist sehr wohl anzuraten, die Chaussee kurz vor dem schönen Aussichtspunkte an der Flanke der Heinrichshöhe zu verlassen und den weit interessanteren Weg über den Gipfel dieses Berges zu nehmen. Nicht nur der herrliche Wald belohnt ihn, sondern auch die glanzvolle Aussicht, die zwar der von der Hauptkuppe mit der durch diese gebotenen Beschränkung sehr ähnlich ist, aber gerade durch den Blick auf sie ihr besonderes und eigenartiges Gepräge erhält. – Das Gebäude ist 1799 abgebrannt, was den Anlaß zu einem größeren Neubau auf der Gipfelhöhe gab.
Dort befand sich 1786 – seit 50 Jahren – nur erst eine steinerne Schutzhütte mit Rauchfang, die heute noch steht und ursprünglich als Brocken- oder Brunnenhaus bezeichnet ward und später erst den hübschen Namen »Wolkenhäuschen« erhielt. Hier konnte unser junger Bergsteiger sich wenigstens ausruhen und auf einem breiten Steine in der Mitte ein Feuer anzünden. Seine ausführliche und »empfindsame« Schilderung des Sonnenunterganges und der Aussicht können wir auf sich beruhen lassen, weil diese schönen Dinge sich bis heute nicht verändert haben. Bemerkenswert mag nur ein Ton der Mißbilligung scheinen, der in die hohe Bewunderung der Naturgröße des Brockens seltsam hineinklingt: »Nur die Steine, womit er belegt ist, machen in der Tat einen höchst merkwürdigen Eindruck, der Geschmack findet bei einem solchen Anblick wahrhaften Übelstand. Welch einen auffallenden Kontrast machen diese Steine mit dem Ganzen, mit dem Begriffe des Ehrwürdigen, des Erhabenen oder Majestätischen!« Wir heutzutage würden die so getadelten Steine gewiß nicht missen wollen, sie vollenden uns erst den Eindruck erhabener Öde und Wildheit; die rundlich gewölbte Grasfläche würde uns sonst ein gar zu friedfertig behäbiger Anblick sein.
Wir nehmen hier Abschied von unserem jungen Reisebegleiter mit der kurzen Notiz, daß er aus allen Schrecknissen des bösartigen Berges gerettet und trotz der schlimmen Prophezeiung lebendig wieder heruntergekommen ist.
Wie anders gestaltet sich eine Brockenfahrt und ein Brockenaufenthalt heute! Aus einer starken Strapaze ist ein Ausruhen geworden, aus Entbehren und Unbequemlichkeit ein Schwelgen in üppigen Mahlzeiten und molligen Betten.
Im Frühling 1899 ist die Brockenbahn eröffnet worden und zugleich die erste Querbahn über den ganzen Harz. Sie ist freilich ein Kind des Streites gewesen, diese Bahn, und es ist ihr nicht leicht geworden, sich ins Leben zu ringen. Nicht bloß die Gelehrten der Börse und der Stadtverwaltungen waren sich uneins darüber, ob sie ihre finanzielle Daseinsberechtigung werde nachweisen können oder nicht, auch die Naturfreunde und Harzwanderer standen ihr zwiespältig und zweifelnd gegenüber. Ist es zu billigen, so fragte man mißmutig, daß der grelle Pfiff und das mißtönige Rasseln den Frieden der Natur stören und in jungfräuliche Waldeinsamkeiten das lärmvolle Hasten des gemeinen Welttreibens hineindränge? Ist es nicht ganz abscheulich, sogar dem erhabenen Haupte des Vater Brocken höchstselbst den eisernen Reif um den geweihten Scheitel zu legen? Darf der prosaische Schienenstrang die poesiegeweihte »Gegend von Schierke und Elend« verunzieren? Soll künftig nicht mehr das kräftige »wie sie schnarchen, wie sie blasen!« nicht mehr auf die »langen Felsennasen«, sondern auf das allübertönende Pusten und Fauchen der stöhnenden Berglokomotiven bezogen werden? Und werden die hurtigen Besenstiele der Hexen die Konkurrenz mit der Dampfkraft bestehen können? Oder wird man zur Walpurgis dem luftigen Gesindel einen Mitternachtszug zur Verfügung stellen? Ist das dann noch der Berg, »den mit Geisterreihen kränzten ahnende Völker«? Welch ein Greuel muß es sein, wenn erst an jedem schönen Tage die überfüllten Bahnzüge den zappelnden Reisepöbel auf die ernste Brockenkuppe speien! Verdient der überhaupt die Schönheit der Berge zu genießen, der sie nicht im Schweiße seines Angesichts ringend sich erobert hat?
Nun das hat wohl alles seine Wahrheit. Nur reicht die Wahrheit nicht allzu weit. Der rechte Gebirgswanderer braucht noch lange nicht aus dem Harze zu verschwinden: der Harz ist groß genug, den fadendünnen Querstrich über seinen Rücken vertragen zu können. Es gibt noch grundeinsame Täler wie Höhen in Hülle und Fülle, und vielleicht wird gerade die Eisenbahn, die Masse an sich lockend, solche noch einsamer machen.
Und dann, was die Hauptsache scheint: jene beglückende jungfräuliche Einsamkeit gab es gerade auf der von der Eisenbahn durchmessenen Strecke schon lange nicht mehr! Die Lokomotive konnte da mit aller Anstrengung gar nichts mehr schlimmer machen. Wer den früheren Wagen- und Omnibusverkehr mit seinem Staub und Unrat an schönen Sommertagen auf den Brockenstraßen und auf der Kuppe kennt, wer dort im Gasthause einmal, in Menschenmassen eingekeilt, unter Lebensgefahr um ein Glas Bier oder Sauerbrunnen gerungen hat, – der lächelt stumm über jede Befürchtung, es könnte noch ärger werden. Nein, der Tiefpunkt des Schreckens war längst erreicht, es konnte nur noch besser werden. Vor allem sind die alten Wege vom Wagenverkehr entlastet worden, der weit störender ist, als die Eisenbahn, denn da klappern die Züge doch nur zeitweilig vorüber, und der Rauch verfliegt weit schneller als der Staub auf der Straße. Die Menschenfluten werden zwar wohl in noch größerer Zahl, aber auch in beschleunigtem Zeitmaß über die Kuppe gespült, dazwischen aber werden Ruhepausen eintreten, in denen der bessere Mensch zum Aufatmen kommt.
Wer aber unverbesserlich besserer Mensch ist und die ganze Neuerung unversöhnlich haßt, dem bleiben für die eigenen Freuden noch immer die Wintermonate übrig, wo die Berglokomotive ihre Lunge ausheilt: und daß gerade dann der Brocken seine weitaus besten Tage hat, weiß der Eingeweihte wohl. Die Schneeschuhe an die Füße und die Bergbahnen verlacht! Und was die Hexen angeht, so ist zu glauben, sie sind Weibs genug, um für sich selbst zu sorgen. Und endlich noch eins: hat die Eisenbahn wirklich hier und da ein Stück Waldpoesie zerstört, so hat sie in Wahrheit weit mehr aufgebaut. Sie hat eine Fülle neuer Ausblicke erschlossen, und keiner der alten Fuß- und Fahrwege kann sich an reicher und wechselvoller Schönheit mit der neuen Bahnlinie auch nur annähernd messen. Dieser ihrer werbenden Kraft wird sich so leicht kein Harzreisender entziehen können.
Kurz, wir steigen beruhigten Gemütes in Wernigerode aus dem Zug der Staatsbahn in die Schmalspurwagen der Gebirgsbahn, deren weite Fenster ein bequemes Ausschauen ermöglichen. Auch ist dafür gesorgt, daß der Landschaftsgenuß nicht durch eine allzu stürmische Heftigkeit der Fahrt beeinträchtigt werde; wenn das Kursbuch sagt, daß auf 32 Kilometer 2 Stunden verwendet werden, so sagt das ja genug; ein Radfahrer macht's allenfalls in der halben Zeit – freilich nur bergab. Da es zudem nur eine reine Adhäsionsbahn, ganz ohne Zahnrad, ist, so werden bei der sehr allmählichen Auffahrt alle Winkel ausgefegt und die Höhen von allen Seiten betrachtet, so daß dem Fahrgast im Wechsel der Szene das Mögliche geboten wird.
Die Fahrt geht zunächst im Bogen um die Stadt, dann durch Hasserode etwas abseits von der Hauptstraße und um ein Geringes über der Talsohle, wodurch sogleich ein prächtiger Brockenblick sich auftut und wir unsere Hoffnung auf gute Aussicht vom Gipfel von vornherein abschätzen können – freilich nicht selten mit schweren Rechnungsfehlern. Wir fahren an der Kirche vorüber, einem etwas wunderlichen Experiment Friedrich Wilhelms IV., einem byzantinischen Zentralbau mit weit abgesondertem Glockentürmchen, und biegen dann zur Rechten des Beerberges in das sich jäh verengende obere Holtemmetal ein. Mit einem Schlage sind wir aus der belebten dörflichen Flur mitten ins dunkle Waldgebirge versetzt. Einige Minuten lang hat es den Anschein, als habe der Zug die Absicht, mit kühnem Draufgehen den Brocken in geradem Anstieg durch die Steinerne Renne zu nehmen.
Doch das geht ohne Zahnrad nicht an; wir überqueren plötzlich in sehr kurzem Bogen die schmale Talsohle, um drüben in genau entgegengesetzter Richtung an der Lehne des Beerberges dahinzufahren. Man könnte fürchten, der Zug trete, völlig entmutigt von dem Schrecken der beginnenden Wildnis, einen fluchtähnlichen Rückzug auf Wernigerode an, wenn nicht gerade jetzt ein energisches Aufsteigen uns eines Besseren belehrte. Ja, bald machen wir eine neue starke Biegung um die Nase des buchenbestandenen Beerberges herum und nehmen an seinem östlichen Hange so ziemlich die anfängliche und zielbewußte Richtung wieder auf.
An dieser Stelle entsteht mit mathematischer Sicherheit eine Bewegung im Publikum; man drängt die Köpfe noch näher an die Fenster und hebt ein vielstimmiges Bewundern an. Und man hat auch allen Grund dazu: der Rückblick auf das hellschimmernde Hasseröder Tal mit der Stadt und dem Schloß dahinter ist wahrhaft entzückend in seinem lebhaften Farbenglanz, zumal wenn voller Sonnenschein den heiteren Eindruck noch steigert. Fast gleichzeitig aber eröffnet sich auch schon nach der anderen Seite ein scharf gegensätzliches Bild, ein großartiger Gebirgsblick in das tannendunkle Drängetal, über dem wir jetzt schon in bedeutender Höhe dahingleiten, während die alte Fahrstraße mit viel geringerer Aussicht die Talsohle entlang schleicht.
Schade, daß man kaum Zeit hat, diese beiden, schnell einander ablösenden Prachtbilder recht in sich aufzunehmen; ein Aufenthalt von einigen Minuten wäre hier eine erfreuliche Zutat.
Die Bahn setzt mit einer weiteren Ausbiegung über das Thumkuhlental – das zum Ottofelsen und dem Forsthaus Hohne hinaufführt – und folgt dann dem Drängetal bis zu seinem Ende. Einmal gibt es einen kleinen Tunnel, von dem man behauptet, er sei zwecklos wie ein Kunstwerk, nur um seiner selbst willen und zur Freude des Volkes erbaut, und der deshalb sinnvoll der Renommiertunnel genannt wird. Einige Male geht es über steile, hohe Dämme, dieses nicht zur Freude des Volkes, denn es sieht etwas beängstigend aus. Nachdem wir auf der Höhe des Drängetalkopfes mehrere Quelladern des Zillierbaches überquert haben, erreichen wir die Station Dreiannen-Hohne, wo die Lokomotive Wasser und der Reisende andere Getränke einzunehmen pflegt. Hier ist schon ein neues, ansehnliches Gasthaus entstanden, wo man auch ausgiebiger Stärkung sich mit Vorteil hingeben kann.
An dieser Stelle teilt sich die Bahn: links läuft der Strang der Harzquerbahn auf der Hochebene weiter über Elend und Sorge nach Benneckenstein, von wo sie dann langsam wieder absteigt, rechts zweigt sich die eigentliche Brockenbahn ab, welche, die Ostecke der Hohneklippen umfahrend, bald wieder ansteigt. Nach Überschreitung des Wormketals öffnet sich von der Höhe der Feuersteinswiesen wieder ein weiter und schöner Blick über die breiten Wellenzüge der großen Unterharzebene, und dann halten wir im Walde bei der Station Schierke. Sie liegt 80 m hoch über dem Dorfe, von dem man nichts sieht und zu dem neben einem steilen Fußwege eine weitgewundene Fahrstraße hinabführt.
Es geht weiter durch den Wald, der nun immer schöner, hochgebirgsmäßiger wird und von Granitblöcken durchsetzt ist, an der Lehne des Erdbeerkopfs und des Ahrensklints, dann an der Südostecke des Renneckenberges hin, wir überschreiten im Bogen die Senkung zwischen diesem und der Heinrichshöhe und steigen jetzt an deren Südhange selber empor; jetzt sind wir im engsten Brockengebiet, die großen Windungen um die Kuppe beginnen, und damit entfaltet sich Aussicht über Aussicht, immer wechselnd und immer sich steigernd, immer überraschend, in überwältigender und wahrhaft verwirrender Fülle. Man genießt das ganze Brockenpanorama Stück für Stück, und eben, weil in Stücken, mit viel packenderer Wirkung. Es ist gar nicht zu leugnen, die Eisenbahn hat den Brockenbesuchern etwas ganz Neues erobert, das früher nicht vorhanden war. Jeden einzelnen Punkt, den die Bahn berührt, konnten rüstige Bergwanderer – aber auch nur solche – wohl sonst schon erreichen, aber das Neue ist der wirbelnde Wechsel, der schier wie ein Wunder wirkt.
Zunächst wird mit tiefer Einbiegung Eckerloch überschritten, die tiefe Schlucht des Schluftwassers, die die Heinrichshöhe vom Königsberge trennt; hinter uns tritt plötzlich die Brockenkuppe fast erschreckend nahe und machtvoll hervor, dann vor uns das Dorf Schierke, reizend ins Tal gebettet, ein entzückendes Bild; die Südostecke des Königsberges, der Schluftkopf wird umfahren, dann in längerer Linie sein Südwestabhang bestrichen, und das Tal der Kalten Bode und die Berge dahinter marschieren auf, einer nach dem anderen, der Barenberg mit den Schnarcherklippen, der große und der kleine Winterberg und hinter diesen, sie alle überragend, der gewaltige Wurmberg, die spitze Kuppe der Achtermannshöhe, nun das Gebiet der großen Moore, der Rehberg, der Bruchberg; und nun wieder eine Wendung um die Nordwestecke des Berges dicht unter den Hirschhörnern hin; wir erkennen das Torfhaus und das Sonneberger Weghaus, die Hopfensäcke und die Quitschenbergklippen, dann die Okertalberge, die Schalke dahinter, die Harzburger Gegend – und dann sind alle diese Augenblicksbilder plötzlich verschwunden. Die Bahn durchbricht in tiefem Hohlweg das große Moor der Senkung zwischen Königsberg und Brocken und wendet sich ganz nach Osten, im Süden der Kuppe selbst hinziehend – hier wieder einen Blick über das Eckerloch nach Schierke und durch die Talöffnung der oberen Bode auf die weite Hochebene bei der Senkung der Heinrichshöhe eine Wendung nach Norden und mehr und mehr nach Westen; der Nordrand des Harzes tritt in die Erscheinung, Wernigerode mit dem Schlosse, Ilsenburg, Harzburg; wieder die Schalke, Bruchberg, Rehberg, auch der lange Acker –, und die Dampfpfeife ertönt, Station Brocken ist erreicht. Noch ein kurzer Weg zum Turme und zum Hause – nicht immer ein ganz leichter bei Sturm und Wetter – das Ziel ist errungen, und man kann sich von den schweren Anstrengungen der Maschine bei Bier oder Champagner gebührend erholen.
Doch nicht allzulange wird es uns im Zimmer halten; der Turm lockt und die Aussicht, der Himmel ist klar, die Luft ist rein, doch wer weiß, wie lange das dauert? Wir ersteigen den 18 m hohen Turm – die einzige Arbeit dieses schweren Tages –, wir finden tadellose Fernsicht, kein Zweifel, wir übersehen heut die berühmten 250 km zwischen den entferntesten Punkten, wir grüßen die Türme von Braunschweig und Hannover, von Magdeburg und Leipzig, ja, den Brandenburger Hagelberg, Rhön, Thüringer Wald selbstverständlich, kurz, wir haben Glück, ganz seltenes Glück – das Ergebnis wird wahrscheinlich eine ganze leise oder, je nach der Gemütsart, eine ziemliche Enttäuschung und Ernüchterung sein.
Was mußte man vom Brocken nicht alles erwarten, dessen ehrwürdiges Haupt wir so oft aus der Ferne und Nähe bewundert haben, der den Harz und weithin die Vorlande des Harzes beherrscht, so ausschließlich, so streng monarchisch, wie kein anderer Hochgipfel sein zugetanes Gebirge, nicht der Feldberg den Schwarzwald, nicht der Belchen die Vogesen, nicht die Schneekoppe das Riesengebirge, noch auch Montblanc oder Ortler die Alpen: alle diese Häupter sind erste unter gleichen, die vornehmsten Herren einer aristokratischen Republik: der Brocken ist unbeschränkter König, alles bezieht sich auf ihn, in jeder Fernsicht noch im östlichen Winkel des Harzes, noch weit in der nördlichen Ebene spielt er die erste Rolle. Jedes Bild erhöht und verklärt seine edle und mächtige Form; aus jedem anderen Bilde kann man dessen höchsten Gipfel getrost hinwegdenken, ohne daß es wesentlich seinen Charakter verändert: der Harz ohne Brocken ist ganz undenkbar. Ist dieser doch schon darin einzig, daß er allein im Harze über die Waldzone hinausragt, daß er unabänderlich von Amts wegen eine Glatze trägt: diese Glatze ist das, was sterblichen Königen die Krone ist. Sie drückt ihm den Hochgebirgsstempel auf, sie entrückt ihn völlig dem Kreise seiner Brüder in eine höhere Sphäre.
So war die Erwartung auf die von ihm zu offenbarenden Wunder aufs höchste gespannt – und siehe, er gibt freilich sehr viel mehr als die anderen Berge, aber er gibt auch sehr viel weniger, weil er das Maß und die Form vergißt. Das griechische tiefe Wort von der Hälfte, die mehr ist als das Ganze, gilt auch vom Brocken. Es ist eine ungeheure Weite, die wir überblicken, aber eine haltlose, ungegliederte, zerfließende Weite. Nach drei Seiten dehnen sich ziemlich gleichförmige Ebenen, nur gleichsam in mehreren Stockwerken gelagert: die große Tiefebene füllt den ganzen Nordhalbkreis aus, gestaltlos und eintönig hingegossen, mit gleichgültigen Städten und Dörfern übersprengt; die belebenden Hügelzüge sind fast verschwunden, erscheinen plattgedrückt aus der zu großen Höhe.
Dasselbe gilt von der großen Hochfläche des Unterharzes im Osten, die noch aus der Höhe von Schierke so reizvoll erschien: von hier oben reckt sie sich vor uns fast noch einförmiger als das Tiefland, größtenteils mit Wald bedeckt, doch mit breiten Feldflächen untermischt, wenige Ortschaften dazwischen, die eingeschnittenen Täler, in denen die Schönheit des Harzgebirges wohnt, dem Auge nicht erkennbar, die geringen Erhebungen, wie der Ramberg und der Auerberg von unbedeutendster Form. Nicht viel besser ist's im Westen; der Oberharz, um eine Stufe höher getürmt, ist doch in der Hauptsache wieder eine Ebene, nirgends eine geschlossene, formenreiche Bergkette, nur im Süden die Fläche gespickt mit einer großen Zahl spitzig-runder Kegelberge, einer fast genau den anderen gleichend, stumpfsinnig nebeneinandergesetzt wie Sandhäufchen, von spielenden Kindern in einer Form gebacken, nirgends auch ein klar gezeichneter Taleinschnitt, noch weniger ein malerischer Aufbau, ein poetischer Winkel: einzig die Gegend von Wernigerode zeigt etwas der Art, aber auch in allzu verkleinernder Entfernung und Tiefe. Das meiste Interesse werden im Süden und Südwesten die fernen Bergketten erwecken, der Thüringer Wald, der Meißner, die Hohe Rhön und andere; sie können bei günstigem Sonnenstande auch durch feine Beleuchtungen erfreuen.
Und dann hat freilich auch der Vordergrund seine Anziehungskraft, das Brockenfeld und das Brockengebirge selbst mit seinen Verzweigungen und Ausläufern, hier gibt es doch feste Gliederung, feste Täler und Höhen: nur geben auch dies Bild die umliegenden Berge zwar nicht so vollständig, aber mit größerer plastischer Kraft – schon weil sie die Brockenkuppe selbst mit in den Rahmen fassen.
So mäßig begeisternd mag manchem wackeren Naturfreunde die Brockenaussicht auf den ersten Augenblick sich darstellen. Gelingt es ihm aber, den stillen Unwillen in sich zu überwinden, so wird er sich dennoch ergriffen fühlen von der ernsten Erhabenheit einer so großen Raumweite an sich, von dem vornehmen Gefühl des herrschenden Schwebens über allen Dingen. Solchem Gefühl mag auch die freilich nur vermittelte und anschauungslose Betrachtung zu Hilfe kommen, auf wie riesenhafte Strecken hin unser bescheidener Brocken mit seinen armen 1142 m Höhe seine herrschende Stellung behält: findet er doch nach Osten und Westen erst in Asien und Amerika seinesgleichen. Nach Süden und Norden ist er freilich entthront, aber ein ganz hübscher Weg ist es bis zu den Alpen und norwegischen Gebirgen immerhin doch auch.
Sodann aber, und das ist die Hauptsache: er kennt in Wahrheit vom Brocken und seinen Reizen noch verzweifelt wenig. Ein vollkommen gutes Sommerwetter ist für den Brocken bei weitem nicht das beste Wetter. Viel großartiger ist es schon, wenn stürmische Wolken über die Kuppe fahren und in aufregendem Wechsel die Welt bald verhüllen, bald wieder freigeben, bald diesen, bald jenen Teil des großen Rundbildes der Betrachtung öffnen; oder wenn gar ein Gewitter unter unseren Füßen sich austobt, ein wunderbarer und unvergeßlicher Anblick. Vom Sonnenaufgang und -untergang soll hier gar nicht die Rede sein: diese Schauspiele brauchen schließlich keinen Brocken, um durchschlagende Erfolge zu erzielen, wenn sie auch hier noch besondere Effekte zustande bringen.
Die großen Künstler aber, welche den Charakter des Brockens vollkommen verwandeln und mächtig erhöhen, sind Nebel, Schnee und Rauhreif.
Im Spätherbst ist es eine fast regelmäßige Erscheinung, daß tage-, auch wochenlang dicker, kalter Nebel die unglückliche norddeutsche Tiefebene in Trostlosigkeit einwickelt, während im Gebirge der Himmel in bezaubernder Klarheit lacht und eine fast sommerliche Wärme die Höhen überflutet. Es kommt vor, daß in den Städten des Harzrandes unter dem Nebel Stein und Bein friert, während man auf dem Brocken seinen Nachmittagskaffee im Freien trinkt; man fühlt sich hier mitunter im November im ungeheizten Zimmer behaglich, wenn unten im Tale die Kohlenhändler jauchzen. Die Nebelschicht ist nicht selten so dünn, daß schon die Spitzen der Kirchtürme darüber hinwegragen und man schon auf den niedrigen Randbergen, wie beim Wernigeroder Schlosse, im schönsten Sonnenschein wandelt.
Ist dies der Fall, so hat man vom Brocken den Anblick eines uferlosen Meeres, in dem sich, scharf abgegrenzt, mit deutlichen Rändern das Harzgebirge emporhebt. Dieses Trugbild des Meeres kann bis zur vollkommensten Täuschung gehen. Manchmal ist es eine glatte und ruhige Fläche wie bei tiefer Windstille, manchmal aber wälzen sich gewaltige Wogen, schwerflüssig und langsam, die Wasserwogen nur noch in der Form, nicht mehr in der Bewegung nachbildend, und doch die Illusion nicht störend. So stark ist diese, daß man in der Ferne hier und dort die Rauchsäulen eilender Dampfschiffe zu sehen glaubt: es werden Fabrikschornsteine sein, deren Qualm den Nebel durchbricht. Man sieht auch wohl riesige Brandungswellen zäh schwellend gegen die Berge schlagen und wuchtig wieder zurückprallen, ein Anblick so wunderbar und voll dauernden Reizes, wie die wirkliche Wasserbrandung.
Der Nebel kann aber auch höher steigen und neue Wunder bewirken. Er dringt hoch hinauf in die Täler, zeichnet deren Verlauf nun fest und deutlich und macht sie zu tief einschneidenden Föhrden oder breiten Strömen und steilen Waldufern. Er steigt noch weiter und überdeckt die ganze Hochebene des Unterharzes, die Insel ist auf ein Drittel zusammengeschrumpft, nur der Oberharz ist übrig. Auch dieser versinkt und nach ihm auch seine überragenden Kuppen, der Ravensberg, der Knollen, der Stöberhai, zuletzt auch die Schalke; langsam wird vom Oderteich her auch das Brockenfeld überflutet, auf dem eine kurze Zeit lang der See, von dem wir träumten, sich leibhaftig darstellt. Immer enger und immer öder wird das Eiland, auf dem wir stehen, mit dem Torfhause versinkt die letzte Spur von menschlichem Siedeln. Was jetzt noch Land ist, ist ein zersplittertes, vielgegliedertes Gebiet mit lang vorgestreckten Halbinseln – und jetzt schon Inseln für sich: der Wurmberg mit den Winterbergen hat sich losgetrennt, ebenso der Bruchberg mit dem höheren Acker, – die Hanskühnenburg ist schon verschlungen – und der rundköpfige Rehberg steht für sich und für sich die Achtermannshöhe.
Die schweigsame Flut leckt weiter und weiter; der Acker versinkt ganz, dann die Quitschenbergklippen, der Rehberg, die Winterberge, der Bruchberg, vom engeren Brockenstock sind Erdbeerkopf und Hohneklippen von den Wogen überschwemmt, der Renneckenberg und die Zeterklippen, auch nur in den allerhöchsten Spitzen noch sichtbar, abgetrennt und verinselt. Auch diese tauchen unter und zugleich die Achtermannshöhe: was bleibt, ist noch die Wurmbergspitze als Inseln und der Brocken mit seinen beiden Schultern. Auch jene ertrinkt, und Königsberg und Heinrichshöhe werden zu Inseln, um bald, erst jener, dann diese, von der Sintflut gefressen zu werden.
Jetzt steht nur noch die Kuppe selbst über Wasser, immerhin noch ein ganz ansehnliches Stückchen Land, das dem oberen Ausschnitt einer schwimmenden Kugel gleicht. Dieser wird kleiner und kleiner; die letzten verkrüppelten Bäumchen verschwinden, nur eine einsame Arche, das Brockenhaus, schwimmt noch auf endlosem Meere. Und zuletzt geht es auch ihr und dem Turme ans Leben. Und wollten wir auf seine höchste Kuppe hinaufklettern, so könnte es geschehen, daß wir bis zum Halse von der festen, weißlichen Masse umwogt werden und nur noch unser verdutztes Haupt wie ein Böcklinsches Seeungetüm aus dem weltverschlingenden Meere hervorguckt, über ihm Sonnenschein und lachender Himmel. Doch auch dies Ungetüm muß hinab in sein Element, und wenn sein Auge auch noch so sonnenhaft ist, so wird es von der Sonne keine Spur mehr erblicken.
Vielleicht nun tage-, vielleicht wochenlang keine Spur. Immer der dicke, zäh lagernde Nebel: und dazu kommt auf einmal ein kräftiger Frost. Wir verweilen die Nacht in dem gastlichen Hause und getrösten uns des Morgens, der uns neue Klarheit bringe. Das tut er zwar nicht, der Nebel klebt: doch als wir aus der Tür treten, entdecken wir neue Wunder, die wir einzig diesem liebenswürdigen Nebel verdanken. Er ist es, der aus jedem Gegenstand im Freien weitum, jedem Baume, jeder Stange, jedem Draht, jedem Grashalm ein entzückendes Kunstwerk gemacht hat. Wer den Rauhreif – der hier Anhang genannt wird – nur in der Ebene oder niederen Gebirgsschichten kennt, kann sich schwer eine Vorstellung von seinen Großtaten auf dem Brocken machen. Zwar die entzückend zierliche Spitzenklöppelarbeit im kleinen kennt und bewundert man auch dort nach Gebühr, aber nicht seine Kraftleistungen, nicht, was er im großen verrichtet. Man betrachte nur die Telegraphenleitung, ein an sich weder poetisch oder künstlerisch interessantes oder gar schönes Ding: die Stangen sind in eine prächtig schimmernde Eiswand von beträchtlicher Breite, oben bis über Mannslänge, unten etwas schmäler, eine sonderbare Form, verwandelt, die Drähte sind spanndicke Gewinde geworden, die tief bis zum Boden herabhängen, wenn sie nicht schon längst zerrissen sind. Man hat die Schwere des Anhangs am Draht zwischen zwei Stangen nach einer Nebelnacht auf über 10 Zentner berechnet. Daß die dünnen Drähte das tragen sollen, kann man nicht verlangen; sie werden deshalb regelmäßig vom Herbst bis zum Frühling abgenommen und der Telegraph außer Betrieb gesetzt, sodaß der Verkehr mit der Welt auf Briefe beschränkt ist, die auf Schneeschuhen nach Schierke gebracht werden – für die Wetterberichte vom Brocken ein bedeutender Übelstand.
Wenn das am dürren Holze – das ist doch eine Stange – geschieht, was soll am grünen werden? Und es wird auch etwas! Daß der Rauhreif nicht nur Drähte zerreißen, sondern auch hohe Bäume zerbrechen kann, sei nur nebenher erwähnt, denn das geschieht immerhin seltener. Zumeist begnügt er sich, in souveräner Künstlerlaune den Fichten eine Gestalt zu geben, wie sie toller und abenteuerlicher keine Phantasie auszudenken vermag. Die modernsten Künstler, die das Bizarre so lieben, sollten einmal auf dem winterlichen Brocken ihre Studien machen; das könnte etwas geben! Zunächst überzieht sich jede einzelne Nadel, jeder Zweig mit einem dichten Gespinst von allerzierlichster Arbeit und doch von solchem Gewicht, daß die Zweige sich demütig immer tiefer herabsenken. Ein Sonnenschein bricht durch und schmelzt im Augenblick die zartesten Eisfasern, die am hangenden Zweige herabrinnen, unten im Schatten schnell gefrieren und sich durch neuen Zuschub von oben zu immer längeren Eiszapfen auswachsen, die mit der Zeit den Erdboden erreichen, aber nicht mehr als dünne Stäbe, wie sie anfingen, sondern durch den Rauhreif selbst wieder in neue Arbeit genommen, zu handfesten Säulen gestaltet, die nun ihrerseits den Ästen als gediegene und sehr wertvolle Stützen dienen.
Nun denke man sich einen solchen, auf zahlreichen glitzernden Säulen ruhenden Baum, dessen einzelne Äste und Zweige wiederum durch hundert und aberhundert Säulchen gestützt und verbunden sind und der ringsum von einer, wie Perlen und Diamanten schimmernden Eishülle umgeben ist – das ist ein Weihnachtsbaum, wie ihn kein menschliches Schmuckwerk zustande bringt! Und nun einen solchen Wald, wo die Fichten nicht regelmäßige Pyramiden sind, wie tiefer unten, sondern schon im Sommer die allerbarocksten, verrenktesten Formen zeigen, da Baum für Baum in so launenhaft phantastischem Aufputz: das kann ganz berückend schön sein, wenn plötzlich die Sonne die schleichenden Dünste auflöst und nun ein überschwengliches Funkeln und Leuchten aller Regenbogenfarben in dem silbernen Zaubergewande beginnt und zugleich ein leises Rieseln und Raunen und Tupfen von Millionen abgleitender Tröpfchen: es kann aber auch unheimlich bis zur Beängstigung sein, wenn schleichende Nebel lautlos diese verhexte Wildnis durchwandern und die tollgewordenen Baumgestalten noch ungeheuerlicher und spukhafter verzerren. Solcher Anblick könnte allein schon das Entstehen der Hexensagen erklären, mit denen die Volksphantasie diesen einsamen Gipfel umsponnen hat.
Und wieder verweilen wir wohl eine Nacht, begeistert durch solche Entdeckungen: und am anderen Morgen finden wir eine tiefe und leuchtende Schneedecke über die Kuppe gebreitet, und nicht über diese allein, sondern auch über das ganze Gebirge nach allen Weiten: und mit einem Schlage ist die Landschaft wunderbar verwandelt und verklärt und in ihrer Wirkung unendlich gesteigert. Das ist der Brocken, den Goethe gesehen hat: »Ich stand wirklich in der Mittagsstunde, grenzenlosen Schnee überschauend, auf dem Gipfel des Brockens, zwischen jenen ahnungsvollen Granitklippen, über mir den vollkommen klarsten Himmel, von welchem herab die Sonne gewaltsam brannte.« Man hat sich wohl gewundert, daß Goethe, der doch die Schweiz schon gesehen hat, sich über seine Brockenbesteigung gegen Frau von Stein in gar so überschwenglicher, so leidenschaftlicher Verzückung äußert; die Erklärung liegt zu einem guten Teil in der Tatsache, er hat den Brocken eben im Winter gesehen, im vollen Schneeschmuck, der alle Gebirgsformen edler und größer erscheinen läßt.
Heutzutage wird er im Winter keineswegs mehr selten bestiegen; das Brockenhaus ist das ganze Jahr hindurch bewohnt und mit allem Nötigen zum Empfange der Gäste wohlversehen. Anstrengend ist der Aufstieg allerdings, auch bei gutem, tragendem Schnee und mit Schneeschuhen, ohne solche bei frischem, lockerem Frostschnee oft nahezu unmöglich und zumal für einen einzelnen Wanderer lebensgefährlich. Gut Wetter ist Vorbedingung; in einen Schneesturm zu geraten, ist nie ohne Gefahr, gegen einen solchen bergauf anzudringen, undenkbar. Es ist vorgekommen, daß Leute stundenlang auf der Kuppe selber umhergeirrt sind, ohne das Haus finden zu können; die rufende Stimme erstickt der Wind erbarmungslos. Die Gewalt solcher Stürme spottet jeder Beschreibung; nur kriechend können die Leute das Haus verlassen, der Wind reißt ihnen beim Stehen die Beine unter dem Leibe weg.
Die Winterbesteigung geschieht am häufigsten und leichtesten von Schierke durch das Eckerloch, wohin auch der Verkehr der Brockenleute geht, deren Schneeschuhspuren man häufig folgen kann. Auf der Eisenbahn gehen wohl auch im Winter gelegentlich Sonntagszüge hinauf, und man kann dann ohne Mühe und Gefahr einen Vorgeschmack von der Herrlichkeit gewinnen, hat man rechtes Glück, auch wohl schönen Rauhreif finden. Nach stärkerem Schneefall aber hört dieser Verkehr auf, auch der Schneepflug kann es dann nicht mehr schaffen, die Verwehungen durch die selten ruhenden Stürme sind zu gewaltig; sind doch die Schneedünen am Brockenhause bis zu 9 m gestiegen. –
Doch der Sommer hat auch seine Rechte, und die meisten Menschen werden immer diese beliebte Jahreszeit für ihre Reisen vorziehen, weil es da wärmer ist. Wer nun im Sommer dem Brocken seine intimeren Reize ablauschen will, der soll sich nicht mit dem flüchtigen Besuche seiner Hauptkuppe begnügen, sondern auch seinen Trabanten einen oder einige Tage widmen, in erster Linie dem Königsberg und der Heinrichshöhe, sodann den etwas entfernteren, aber doch noch der Gruppe zugehörigen Zeter- und Hohneklippen.
Von der Heinrichshöhe (1042 m) haben wir schon geredet. Noch interessanter und schöner, doch etwas schwer zugänglich ist der Königsberg (1029 m). Immerhin geht ein Pfad von Schierke her über den Schluftkopf hinauf bis zur ersten Klippe, doch dieser ist recht steil und beschwerlich. Bequemer wohl geht man – bei trockenem Wetter – von der Senkung zwischen ihm und dem Brocken aus quer über das Moor, indem man die waldfreien Stellen sich mit eigener Schlauheit heraussucht. Man kann sich auch von den Hirschhörnern geradenwegs durch den Wald schlagen und hat dann fast gar nichts mehr zu steigen: dafür ist aber dieser Wald, obgleich nicht so ausgedehnt, ein wahrer Ausbund von Unarten und struppigen Launen, und man wird meist recht froh sein, wenn man ihm wieder entschlüpft ist, womöglich mit heilen Kleidern. Doch sobald man ihn im Rücken hat, ist alles gewonnen und jede Beschwerde vorüber; das offene Moor liegt vor uns, nur noch von kleineren und milderen Waldstreifen durchsetzt.
Der Königsberg ist ein länglicher Kamm, der sich zwischen dem Schluftwasser etwa 3 km lang von Nordwesten nach Südosten erstreckt und an diesen beiden Enden ziemlich steil abfällt. Sein mooriger, flacher Rücken ähnelt dem des Bruchberges und stünde diesem an geheimnisvoller Romantik kaum nach, wenn nicht die Eisenbahn seine frühere Einsamkeit ein wenig beeinträchtigte und auch das Brockenhaus mit seinem Menschengetriebe schon aus allzu vertraulicher Nähe herüberwinkte. Dafür trägt er eine Reihe von schönen Klippen, die wundervolle und wechselreiche Aussicht gewähren, die prächtigste die Rabenklippe, etwa in der Mitte des Kammes gelegen und leicht zu ersteigen. Gewaltig bauen sich im Norden und Süden die beiden Kolossalgruppen des Brockens, mit der Heinrichshöhe und des Wurmbergs, mit den Winterbergen, hinter den tiefen Talschluchten auf, dann weiter der Achtermann und Bruchberg, dazwischen ein reizender Weitblick nach Südwesten in die Gegend von Lauterberg. – Über den Aufbau der engeren Brockengruppe kann man sich hier besonders trefflich unterrichten.
Der Berg senkt sich nun langsam; auf mehrere kleine Felsgruppen folgt die Kanzelklippe, eine merkwürdige, burgähnliche Bildung, die deutlich einen halben Mauerring von beträchtlichem Umfang darstellt. In der Nähe findet man zwei eng umrahmte, sehr schöne Blicke, die wir beide, doch in Hast, von der Eisenbahn aus genossen haben, den einen in den tiefen, dunklen Tannengrund des Bodetales, mit dem Wurmberg dahinter, den anderen auf das Dorf Schierke, das, seiner ganzen Länge nach hingestreckt, in seinen Bergen gerade vor uns liegt. Endlich geht es über den Schluftkopf auf steilem, aber sehr hübschem und romantischem Wege, der die Eisenbahn kreuzt, zum Schluftwasser oder zur Bode hinab.
Die Zeterklippen sind die nördliche Fortsetzung des Renneckenberges, der sich mit einem schmalen, wenig eingesenkten Sattel, Brockenbett genannt (910 m), an die Heinrichshöhe anschließt. Auf diesem Sattel, auf dem das Ilsetal nach Norden hinabsteigt, treffen sich die Brockenwege von Schierke, Wernigerode und Ilsenburg. Wir folgen der Ilsestraße eine gute Viertelstunde abwärts, um dann einen Waldpfad zur Rechten einzuschlagen, der in einer weiteren Viertelstunde zur Zeterklippe (929 m) hinaufführt. Sie ist durch Leitern und Eisenstangen zugänglich gemacht, und die Aussicht, besonders auf den nur durch das enge, tiefe Ilsetal von ihr geschiedenen Brocken, ist von gewaltiger Wirkung; wahrhaft riesenhaft erscheint in dieser Nähe die kolossale Breitwand der Kuppe, mit der Heinrichshöhe zur Linken und dem Kleinen Brocken, dem nördlichen Ausläufer, zur Rechten.
Ostwärts kann man von hier in das obere Holtemmetal und dann nach der Steinernen Renne gelangen; wer aber Lust hat, sich pfadlos in die Wildnis zu vertiefen, der kann hier die Bekanntschaft einer steinübersprengten, sumpfdurchzogenen Urwaldwüstenei machen, wie sie in solcher wilden Herrlichkeit der Harz nur an vereinzelten Stellen noch aufzuweisen hat.
Der Hauptkonkurrent in diesem Fache ist der Hohneklippenkamm, der östlichste, weit vorspringende Ausläufer der Brockengruppe. Er ist durch eine flache Senkung, das Jakobsbruch, von dem südöstlichen Renneckenberge und dessen niedrigerer Fortsetzung, dem Ahrensklint (792 m) und dem Erdbeerkopf (857 m), getrennt und fällt nach den anderen Seiten steil zur Hochebene ab, die er um etwa 400 m überragt. Sein schmaler, doch in der Mitte breiter, anschwellender Rücken streicht von Nordwest nach Südost und ist durchweg mit sehr dichtem Walde bedeckt, aus dem eine ganze Reihe gewaltiger Klippen, die meisten sich weithin markierend, hervorragen. Eine von diesen, die mehr südöstlich gelegene Leistenklippe, ist von Schierke, dem Forsthaus Hohne (nahe der gleichnamigen Station) und von Wernigerode über den Ottofelsen (im ganzen drei Stunden) auf verschiedenen Pfaden leicht zugänglich, auch ihre Besteigung künstlich erleichtert, und sogar eine Schutzhütte ihr zugesellt. Sie wird viel besucht und bietet ihren Gästen eine der glänzendsten Fernsichten, nach drei Seiten hin ungefähr die der Brockenkuppe, nur daß der westliche Abschluß durch diese selbst dem weiten Blicke einen kräftigen Halt, ein bedeutsames und großartiges Zentrum, verleiht. Die freundlichste Stelle ist auch hier wiederum Wernigerode.
Auch weiter längs des Kammes führt von der Leistenklippe ein kleiner Jägerpfad, und wer ihn einschlägt, kann mit erfrischender Sicherheit darauf rechnen, sich sehr bald zu verirren. Und hat man einmal den Pfad verloren, so geschieht es gewöhnlich, daß man nach einer halben Stunde Suchens an einer Stelle wieder anlangt, die man vor dreißig Minuten verlassen hatte. Die Zahl der Wiederholungen dieses Kunststücks ist verschieden, je nach Laune und Lust der neckischen Klippenkobolde. Denn völlig mit rechten Dingen geht die Sache nicht zu; festgestellt aber ist sie durch das klassische Zeugnis der gewiegtesten Harzwanderer. Es gibt auch ermunternde Abwechselungen bei dieser Irrfahrt; einmal gerät man in einen Sumpf, aus dem man sich jedoch manchmal bald wieder herausfindet, ein andermal in ein Steinmeer mit sehr tiefen, aber keineswegs regelmäßig angebrachten Löchern, die einem graziösen Tänzeln einigermaßen hinderlich sind, oder man wird von einem boshaften Fichtendickicht eingefangen, das mit tausend spitzigen Aststümpfen das Entrinnen zu verhindern sucht und oft recht erfolgreich darin ist. Oder man hat auch diese drei Freuden alle auf einmal und noch dazu ein hochmalerisches Labyrinth umgestürzter Baumstämme, über die hinwegzuklettern zu den anregendsten Turnübungen gehört.
Wenn man jedoch durch irgendein liebliches Wunder aus solchen Fährnissen gerettet wird und wieder auf ehrbarem Boden wandelt, so wird man sich gestehen müssen, daß man etwas Großartiges, etwas so die Phantasie und alle Sinne Berauschendes, wie diesen Wald und diese Klippen, so bald nicht gesehen hat. Es gibt auch ein Rettungsmittel ohne erheblichere Wunder, und zwar ein sehr einfaches: man besteigt eine der Klippen, nimmt eine Prise Aussicht und orientiert sich. Allerdings wird man sich nachher doch wohl wieder verirren, aber es war doch ein Zwischenspiel, und die Aussicht war entzückend. Ersteigbar sind sie wohl alle, wenn auch nicht immer bis zum höchsten Blocke, und nicht immer ohne Hände, Knie und Hosenboden; im Winter bei starkem Schnee ist das Klimmen jedoch bedeutend erleichtert. Die Aussichten geben das nämliche Bild in immer neuen, reizvollen Schiebungen und steigern die Wirkung nach Nordwesten mit der Annäherung an den Brocken. Die letzte in der Reihe ist die Landmannsklippe; von ihr führt ein schwer auffindbarer Pfad, nahe dem Lauf der Kleinen Holtemme, zur Steinernen Renne hinab. Wir aber wenden uns diesmal weglos nach der anderen Seite und wandern durch das offene Jakobsbruch und über den Erdbeerkopf, dessen abgeholzte Kuppe einen guten, übersichtlichen Rückblick auf die Klippenreihe bietet, hinab nach Schierke.
Aus: Hans Hoffmann, Harzwanderungen. Leipzig 1902, C. F. Amelangs Verlag.
a) Kulturmädchen.
Der Abend dämmert herauf; auf einsamer, gut gehaltener Straße streben wir unserem Ziele zu; Wald vor uns, Wald zu unseren Seiten. Die sinkende Sonne trifft mit goldenem Strahl noch die Wipfel der mit Zapfen dicht behängten Tannen. In den Tälern lagert sich bereits weißer Nebel. Aus der Ferne tönt verklingendes Geläute der heimwärts ziehenden Herden. Das Reh tritt vorsichtig, scheu aus dem Dickicht; in ergreifender Weise spricht aus dem Liede der Drossel abwechselnd tiefe Klage und Jubel der Hoffnung. – Da trifft ein anderer Sang unser Ohr; wir stehen lauschend. Das sind Menschenstimmen im gemischten Chor; rein und voll und hell führt der Sopran die Melodie; nur nach Gefühl, kunstlos und doch harmonisch bildet der Alt dazu die Begleitung in Sexten und Terzen, und eine einzige Männerstimme gibt mit Kraft und Sicherheit den einfachen Harmonien Grund und Fülle. Nun unterscheiden wir auch die Textesworte, die gleich den Tönen der frischen, waldigen Umgebung angepaßt sind:
»Der Jäger in dem grünen Wald
Muß suchen seinen Aufenthalt:
Er ging in den Wald wohl hin und her:
Ob auch nichts,
Ob auch nichts zu suchen wär.«
Jetzt mündet ein schmaler Waldweg in die Straße, und die Sängerinnen, kräftige, gedrungene Gestalten mit der Kiepe auf dem Rücken, dem Strickstrumpf in der Hand, hochgeschürzt, das Gesicht vom Wollentuch umrahmt, schreiten singend über die Heerstraße, um auf der anderen Seite auf der Fortsetzung des engen Waldpfades zu verschwinden. Es sind Harzer »Kulturmädchen« mit ihrem Kulturaufseher, die ihr Tagewerk hinter sich haben. Sie streben der Köte (Waldhütte) zu, die mitten im Walde, dort am Ende des Dickichts für sie errichtet ist. Bald prasselt das Feuer auf dem Herde; das Wasser siedet; geschnittenes Brot, Butter und Kümmel werden als Zutaten beigegeben, und das einfache Mahl ist bereitet. Die Glieder sehnen sich nach des Tages Arbeit zur Ruhe. Die Mädchen herbergen in der einen, der Aufseher und seine männlichen Gehilfen in der anderen Köte.
Die aufgehende Sonne weckt sie zu neuer Arbeit. Man zieht nämlich die Pflänzchen für die Forstkultur in sogenannten Saatkämpen, lichten Stellen des Waldes, die an den Seiten von mittelhohen Stämmchen gegen den Wind, durch Umzäunung aber gegen Wildschaden geschützt sind. Hier sind nun in 20-40 cm Entfernung voneinander seichte Furchen gezogen; darin schlummert der Tannensame, den man den am besten entwickelten Zapfen entnommen. Auf drei bis fünf Jahre hat das Pflänzchen in diesem Tannengarten seine Heimat, bis man es mit einem Wurzelknollen dem Boden entnimmt, um es auf den entholzten, von Stöcken und Stümpfen gesäuberten Stellen anzupflanzen, und zwar in Abständen von 8,2-8,5 m. Die Einzelpflanzung hat jetzt in allen Teilen des Harzes Eingang gefunden und das Einsetzen von Büscheln zu je fünf und sechs Stück, von denen man nur das lebenskräftigste stehen ließ, verdrängt. Der Tannengarten, sowie die Anpflanzung (auch Hai oder Schonung genannt) ist jedes Jahr derartig von Gras, Kräutern und Blumen überwuchert, daß von den zarten Pflänzchen aufs erste nichts zu sehen ist. Nur dem genau prüfenden Blicke werden die Reihen der frischen, kleinen Fichtenquirle sichtbar, die sich mühsam der rasch aufschießenden Nachbarn erwehren. Hier ist nun Arbeit genug für die sichtende, jätende Frauenhand, mit deren Hilfe sich die Stämmchen siegend emporringen.
In 10, 15, 20 Jahren sind sie in die Höhe geschossen, und die schweren, nach abwärts geschwungenen Äste haben sich nach allen Seiten derartig ausgebreitet, daß jeder Abstand zwischen den Stämmen verschwunden ist; sie bilden eine »Dickung«. Die weitausragenden, stachlichten Äste sind Schirm und Schild gegen jeden unberufenen Eindringling, nicht bloß für den Stamm, sondern auch für die Rehmütter und die Wildsau, die unter solchem Tannendunkel am liebsten ihr Wochenbett bereiten, wie ja auch Meister Reineke darin seines Frevels Frucht am ungestörtesten genießt. Je mehr die Bäume emporwachsen, um so mehr benehmen sie einander Luft, Licht und Raum, sodaß ein Teil ihres unteren Astwerks dürr wird. Nun durchschreitet der Forstmann prüfenden Auges die dichtgeschlossenen Reihen seiner aufgestellten Bataillone, das Dürrholz beseitigend, Schwächlinge aus der Front weisend, sodaß nun der nötige Abstand geschaffen und aus der Dickung ein »Stangenort« geworden ist. Die Durchforstung wird im Laufe der Jahre mehrmals wiederholt, sodaß schließlich schlanke Stämme mit schwankender Krone an Stelle des Dickichts treten. Aus dem Stangenort ist ein »hoher Ort« geworden; wie Grenadiere in Reih' und Glied recken sich die Tannen; kein raschelndes Laub unterbricht die ernste Stille, kein Beerengesträuch hemmt unsere Schritte, wenn wir eintreten in die riesigen, ernsten Säulengänge; wie auf glattem Parkett gleitet der Fuß über die Nadelmatten, und die Brust atmet in tiefen Zügen den Harzduft, welchen die Tausende gleich Kerzen aufgesetzter Triebe ausströmen.
b) Der Köhler.
Im Oberharze ist der Meiler noch nicht zur Seltenheit geworden, ist doch dort die »Kunst« des Kohlenbrennens zum Vorteil des Handwerks in manchen Familien erblich; denn nach Köhlersprichwort muß ein rechter Köhlermeister den Stufengang der Ausbildung vom Haijungen durch den Gehilfen lückenlos und in vieljähriger Übung durchgemacht haben, und wo könnte er diese Schulung von frühester Jugend auf leichter empfangen als beim Vater und Großvater? Suchen wir ihn auf an seiner Werkstatt, dem Meiler!
Mit Vorsicht will die Kohlstätte gewählt sein. Sie muß die bequeme Anfuhr des Holzes, die leichte Abfuhr der Kohlen gestatten; da will der vorherrschende Strich des Windes, sowie der Untergrund ebenso genau beobachtet sein. Nicht schon jede leicht zu ebnende Fläche ist zur Anlage von Meilern geeignet; wäre ihr Boden feuchter Lehm, so »frißt er zuviel Kohlen«; wäre er felsig, so würde der Holzstoß »zu hitzig brennen«. Ist die rechte Stelle gefunden, so wird der Rasen abgestochen, der Boden geebnet und festgestampft, doch so, daß nach der Mitte zu eine geringe Steigung von 15-20 cm (der sogenannte Anlauf) bemerklich wird. Die Kreisform der Grundfläche wird dadurch erzielt, daß der Meister eine 4-5 m lange Stange als Halbmesser eines Kreises ansieht, dessen Zentrum der Gehilfe darstellt; er hält das eine Ende des Halbmessers in der Hand, mit dessen anderem Ende der Meister die Peripherie gehend umschreibt und abpflöckt.
Das nächste Geschäft ist nun das »Richten«, der Aufbau des Meilers. In der Mitte des Kreises werden zwei Pfähle (Quandelpfähle), ein großer und ein kleiner, eingeschlagen; der Zwischenraum zwischen beiden (etwa 30 cm) ist bestimmt, eine Art Luftgang oder Esse zu bilden und wird teilweise mit leicht brennenden Holzsplittern ausgefüllt. Die Zufuhr von Luft zu jener Esse erfolgt aber auch von unten durch einen wagerechten Kanal, den man nicht etwa ausgräbt, sondern dadurch erhält, daß man einen starken Knüppel von jenen zwei Quandelpfählen aus in der Richtung eines Radius legt und ihn beim Wachsen des Aufbaues in sich gleichbleibender Richtung immer mehr nach außen zieht. Um die Mittelpfähle herum werden nun die Scheite in fast senkrechter Lage ganz dicht aufgestellt; auf dieser ersten Lage baut sich eine zweite, auf dieser eine dritte usw. auf, bis der ganze Bau einem Kugelabschnitt oder abgestutzten Kegel gleicht. Da um die Luftesse in der Mitte das Feuer am stärksten brennt und die in unmittelbarer Nähe stehenden Scheite eine zu mürbe, kleine Holzkohle geben, so wird dort nur minderwertiges Holz eingesetzt. Hat der Köhler nun auch die Lücken und Fugen »beschmalt«, d. h. mit dünnen Ästchen verstopft, so kann die Arbeit in die nächste Stufe der Entwickelung treten; der Meiler kann bedeckt werden. Es geschieht dies mit Tannenzweigen, Laub, Rasen oder Moos, welche das Unterkleid darstellen von einer Dicke, daß man das Scheitholz nicht hindurchfühlt. Nun bekommt der Meiler noch einen Oberrock, aus einer Schicht von Erde und Kohlenstaub, die, je weiter nach unten, um so stärker wird. Jetzt ergreift der Meister den »Schuh«, ein an beiden Enden gespaltenes Stück Holz. In die eine Spalte klemmt er ein mit Harz gefülltes Stück Baumrinde, das er entzündet, während er das andere Ende des Schuhes an der Klopfstange befestigt und den Brand durch die Zugesse auf die leicht entzündlichen Späne in der Mitte hinabläßt.
Mehr als die bisher beschriebene Tätigkeit verlangt das » Regieren« des brennenden Meilers die ganze Kunst und Erfahrung des Meisters. Ein weißgrauer Rauch steigt von dem Holzstoß nach oben; das Feuer dringt in der Luftesse herauf und erreicht am zweiten Tage die Umhüllung. Jetzt gilt es, Zuglöcher oder »Räume« in den Mantel zu stechen, damit die Glut von der Peripherie nach der Mitte zu vordringe. Besondere Sorgfalt erfordert das Aufstellen der »Windschauer« (Windschutz aus Brettern, Tannenzweigen usw.), um die Flamme, die dem Winde entgegeneilt, nicht zu lange nach einer Richtung wirken zu lassen.
Einen eigenartigen Anblick gewährt der glutaushauchende Meiler bei Nacht; an die Gestalten der Märchen erinnert dann der im roten Scheine hantierende Meister, der Zuglöcher sticht, die Windschauer ordnet, der, die Klopfstange in der Hand, seinen Steg (einen Balken mit eingeschnittenen Stufen) bald hier, bald dort anlegt, den Meiler erklettert, den Mantel an einer Stelle abschaufelt, die Kohle im Innern niederstößt, neues Holz in den entstandenen Hohlraum schüttet und dann eiligst die Haube wieder schließt, damit ihm die auflohende Flamme nicht gar zu viel Kohlen zu Asche verbrenne. Acht bis zehn Tage, ja bei hartem Holze zwölf bis vierzehn Tage ist die ununterbrochene Aufmerksamkeit von Meister oder Geselle bei Tag und Nacht erforderlich. Zwar wenn der Rauch anfangs grau, später blau gleichmäßig durch die gesamte Umkleidung entweicht, ist die Arbeit gering, die Aussicht auf gute, feste Kohlen begründet; anders steht jedoch die Sache, wenn die Flamme an einzelnen Stellen die Haube sprengt, durchbricht und der Rauch feuerfarbig aussieht; da gilt's zu eilen, und mit Klopfstange und Rasenstücken den Schaden zu bessern. Wenn am fünften oder sechsten Tage der Rauch in blauer Farbe erscheint, so ist dies ein Zeichen, daß die Holzmasse glühend ist und die »Kohlen garen«. Doch noch ist die Ruhezeit für den Köhler nicht gekommen; denn der Meiler muß » abgekühlt« werden, indem die glühende Decke streifenweise abgenommen, ausgebreitet, mit frischer Erde vermischt und wieder aufgelegt wird. Erst am zehnten bis vierzehnten Tage ist die Abkühlung so weit vorgeschritten, daß das »Ausladen« erfolgen kann. In dicken Holzschuhen, welche den Fuß gegen die ausstrahlende Hitze schützen, rückt er dem Meiler zu Leibe, entfernt an verschiedenen Stellen den Mantel und holt mit dem Haken ungefähr sechs Karrenladungen Kohlen heraus, die entweder durch bloße Wärmeausstrahlung auf der Kohlstätte oder durch Begießen mit Wasser erkalten. Während er diese sechs Karren abfährt, muß der Mantel wieder geschlossen werden, damit der Meiler nicht nochmals durch Luftzutritt in Glut gerate. Ist der Meiler ausgeladen, so schreitet man zu einer sorgfältigen Auslese der Kohlen nach vier und mehr Sorten, von denen die schwersten, hellklingenden, mattschwarzen mit stahlblauen Flecken die wertvollsten sind.
Die Abfuhr nach den Versandplätzen erfolgt in einspännigen, zweirädrigen Karren, die anstatt des Kastens einen Korb besitzen, der sich durch Türen nach unten öffnen läßt. Die Kohlenbeförderung gehört von jeher zu den gefährlichsten Verrichtungen des Köhlerwesens, da eine einzige glimmende Kohle die ganze Ladung entzünden kann, und weil ferner die Wege furchtbar steil und schmal sind. An dem Karren ist keine Radbremse anzubringen, jedenfalls weil den Holzachsen dadurch zu viel zugemutet und sodann, weil die Last das ohnehin nicht starke Pferd zu Boden drücken würde. Höchstens ein nachschleppendes, mit Erde beschwertes Reisigbündel konnte als Hemmung verwendet werden, und die Schwierigkeit der Talfahrt noch vermehrend trat der Umstand hinzu, daß ein Fuhrmann oft drei hintereinander fahrende Karren zu beaufsichtigen hatte.
Der Köhler ist ein halber Waldmensch. Da seine Arbeit im Sommer ihn jeden Tag in Anspruch nimmt – denn während der eine Meiler ausgeladen wird, stehen bereits andere im Brande –, so gelangt er nur bei äußerst wichtigen Ereignissen zur Wohnstätte der Dorfgenossen und erfährt im übrigen von dem Gange der Welt nur durch die Hausfrau, die ihn wöchentlich einmal mit den nötigen Nahrungsmitteln versorgt. Seine Köte ist aus Fichtenstangen gebildet, die er kreisförmig in die Erde rammt und oben zusammenbindet. Diesen Kegel verschalt er außen mit Baumrinde und verstopft die Fugen innen mit Stroh. In der Mitte der Waldherberge brennt das ewige Feuer; links und rechts vom Eingange stehen einige verschließbare Schränkchen mit Vorräten; die Bank zur Rechten des Feuers ist der Sitz des Meisters, die links gehört dem Gehilfen, während der Köhlerjunge in den Hintergrund verwiesen ist. Die Nachtwachen sind streng geregelt. Wie die Bewohner der Köte nicht gemeinschaftlich ruhen können, so können sie auch sehr selten miteinander die dreimal täglich wiederkehrende Brotscheibensuppe verzehren; höchstens daß ihnen einer der treuen, zottigen Gefährten Gesellschaft leistet. In alter Zeit rief die »Hillebille« die Genossen desselben Bezirks bei drohender Gefahr zusammen; sie bestand aus einem zwischen zwei Bäumen in der Schwebe hängenden Buchenbrett, worauf ein Holzhammer aufschlug; dies Alarmsignal ist jedoch gegenwärtig kaum noch zu hören.
c) Der Hirt.
Es wird Frühling in den Harzbergen; die Sonne leckt den Schnee von den Bergeshängen, und die Bergwiesen bedecken sich mit dem ersten Grün. Sobald nun lohnende Weide vorhanden ist, tritt der Hirt in Tätigkeit; jeden Morgen, wenn die Tauperlen vom frischen Grase verschwunden sind, ertönt auf den Straßen des Bergstädtchens das mächtige Kupferhorn. Nach tiefem Atemzuge setzt er es an die Lippen, den Ton so lange als möglich aushaltend, und ein-, auch zweimal tönt's widerhallend durch das Örtchen, und zwar jeden Tag vom Mai bis Martini. Während in den Ställen nun seine Pflegebefohlenen geglättet und losgebunden werden, mustern wir unsern Mann mit dem Hifthorn. Ein schwarzer Leinwandkittel schlägt seine Lenden; die Unterglieder sind durch kleidsame graue Gamaschen umhüllt; ein breitkrempiger schwarzer Hut ist ihm Sonnen- und Regenschirm zugleich; ein langer Hirtenstab ohne Griff ist ihm Stütze, Bergstock und Leitstab; ein scharfes Beil, dessen Schneide mit einem Futteral umgeben ist, hängt an seiner Seite, damit den Tieren, die sich mit den Hörnern im Gestrüpp oder mit den Füßen im Wurzelgeflecht verwickelt haben, Hilfe gebracht werden kann. Der zusammengerollte Lederriemen, den er trägt, ist gewissermaßen sein Lasso, sofern er widerspenstige Tiere damit einfängt, während das scharfe Messer im Köcher dazu bestimmt ist, das Schlachten verunglückter Tiere zu erleichtern. Ein zottiger Hund hilft ihm bei Ausübung seines Dienstes. Seine Gehilfen, Knecht und Junge, sind seine Abbilder, nur daß das Beil an ihrer Seite fehlt. Der Hirt im Oberharz weicht wesentlich ab von jenen ärmlichen Gestalten, die auf unsern Dörfern zum guten Teil des Hirtenamtes walten, gewöhnlich als Entschädigung an die Gemeinde, der sie zur Last fallen. Der Hirt im Oberharz ist, wie schon seine Kleidung ausweist, ein wohlbestallter Mann, nicht selten Grund- und Gasthofs-, ausnahmslos aber selbst Viehbesitzer; ihm liegt nicht bloß das Weiden, sondern auch die Züchtung ob, und er sucht es seinen Standesgenossen in der Erzielung reinrassiger, kräftiger Tiere zuvorzutun.
Doch welche Wirkung hat der Ton seines Hornes? Da schauen jetzt aus allen Häusern die gestirnten Häupter der Kühe und Ochsen; mit Gebrüll begrüßen sie die Gefährten und traben dem Zuge nach. Es sind meist rote oder hellbraune Tiere, deren weit auseinanderstehende Hörner mit den Spitzen nach oben weisen. Man hat von Rassenkreuzungen auf Grund gemachter Erfahrungen abgesehen, einmal weil die Harzkuh eine Milch gibt, die 25 Prozent mehr Fettgehalt besitzt als die der Marschenkuh, und sodann, weil sie allein mit ihren schmalen, eisenfesten Hufen das Klettern auf dem Felsboden aushält. So ziehen sie hin, jeden Morgen, und zwar bis Mitte Mai und nach der Grumternte auf die Wiesen, in der Zwischenzeit in die Tannenwälder. Sobald der Austrieb in den Wald beginnt, hängt der Hirt jedem seiner Tiere eine wohlgestimmte Glocke mittels eines Holzbügels um den Hals, und man hat nun jeden Tag Gelegenheit, das Glockenspiel zu hören. Während der Senn nur die Leitkuh mit der Glocke schmückt, tragen sie hier alle Kühe ohne Ausnahme, und zwar richtig eingestimmt. Das Stimmen geschieht durch Einschlagen von »Stimmbeulen«. Im vorigen Jahrhundert waren die Glocken (Stumpe, halbe Stumpe, große und kleine Bell) auf die Töne des Dreiklangs cis eis gis nebst der Oktave eingestimmt, während heute (auf acht Glockenarten) der Dreiklang auch durch die zweite Oktave fortklingt und die letzte Glocke den Grundton der tieferen Oktave anschlägt. Im Frühling, wenn die Stimmung neu und rein und die Herde nicht allzu nahe ist, tönt das Glockenspiel am schönsten; allmählich werden die Akkorde unreiner, weil die Tiere durch Reiben an den Stämmen die Glocken sehr oft drücken und so verstimmen. Wenn bei Mittagsglut der Herde wie dem Hüter die Zunge fast am Gaumen festklebt, suchen sie das Lager auf im schattigen Grunde, am Bache oder Teiche, die Rinder letzen sich an der kühlen Flut und strecken sich dann wiederkäuend in den Schatten der schlanken Stämme, während der Hirt sein einfaches Mahl verzehrt. Sobald es dunkelt, treibt er ein in die Ställe.
In früheren Zeiten ähnelte das Leben des Harzer Hirten mehr dem des Sennen, sofern einzelne Gemeinden ihre Herden auf die oft weitentlegenen Kommunweiden (auf dem Brockenfelde, am Bruchberge usw.) im Mai entsendeten, um sie bis zum Herbst dort zu belassen. Nun waren für die nächtliche Unterkunft Rinderställe errichtet, die uns noch heute als Ruinen entgegentreten. Folgen wir unserem Gewährsmann zu einem solchen Hirtenidyll auf den Bruchberg: »Wir wandern einsam über den mit Klippen übersäten Bruchberg und schlagen einen wenig betretenen Waldpfad ein, um die Windungen der Chaussee abzuschneiden. Bald nehmen die Fichten an Höhe ab, und nun stehen wir auf weiter, nur mit Beeren und Heide bewachsener Blöße. Welch wunderbar schönes Bild liegt da wie mit einem Zauberschlage vor unseren Augen! Dort die unabsehbare Hochebene mit ihren aneinander gereihten Bergstädten, ihren halb sich versteckenden Gruben- und Forsthäusern, ihren aus den Hüttentälern emporsteigenden Rauchwolken; hier unmittelbar zu unseren Füßen, jäh niederstürzend, das scharfrandig eingeschnittene Sösetal und darüber hinaus, in der Ferne kaum noch von den Wolkenzügen zu unterscheiden, Berggruppen und Hügelreihen bis zur Bramburg und zum Meißner in Hessen. Doch die wachsenden Schatten mahnen uns zur Eile. Vergeblich sehen wir uns nach dem zuletzt kaum noch erkennbaren Pfade um, dem wir's verdanken, den Weg verloren zu haben. Wohin sollen wir uns wenden? Hier türmen sich schwer ersteigliche Klippen auf, dort zieht die Tannendickung eine undurchdringliche Mauer. Kein Laut ringsum, nur der Abendwind fängt an, leise und warnend in den Wipfeln der Bäume dort unten zu rauschen, und das seine Talfahrt beginnende Wasser sickert flüsternd durch das Moos und tröpfelt kaum hörbar von einem Stein auf den andern. Doch jetzt trägt der anschwellende Wind Klänge einer harmonischen Musik herüber, erst geisterhaft leise, dann klarer und bestimmter: mitten in der Wildnis, dem Abendgeläut eines Eremiten gleich, das Glockenspiel einer dem Stalle zuwandernden Rinderherde. Wir eilen ihm freudig entgegen, und kaum haben wir das Steingeröll überwunden, so begrüßen uns knurrend und kampfbereit die langhaarigen vierfüßigen Gesellen des Hirten. Noch zu rechter Zeit aber erklingt der gellende Pfiff, wie ihn die Hirten auf zwei in den Mund gesteckten Fingern mit großem Geschick hervorbringen, und die durch die auffallende Erscheinung eines Menschen aufgeregten Hunde beschränken sich nun darauf, uns mißtrauisch zu beobachten und unheimlich unsere Füße zu umschleichen. Der Hirt ist gern bereit, uns den Weg zu zeigen, aber zunächst müssen wir ihn und seine Herde auf dem Wege zum Rinderstalle begleiten. Dort, schon oberhalb der am höchsten in das Gebirge hinaufgreifenden Stelle des Sösetales, der Geburtsstätte des Flüßchens, lehnt sich das Stallgebäude in malerischer Umgebung an die Bergwand. Bald sind die Tiere unter Dach und Fach gebracht, und wir folgen dem Hirten in seine unter demselben Dache liegende Sommerwohnung, denn ohne einen Imbiß läßt er uns nicht ziehen, und wenn er auch unter so langen einsamen philosophischen Betrachtungen wortkarg geworden, so macht es ihm doch augenscheinlich Vergnügen, einmal wieder menschliche Sprache zu hören. Die Hunde als Wache zurücklassend, führt er uns dann den schönen Weg am Morgenbrotsgraben entlang bis zur Chaussee oberhalb des Dammhauses.«
Übrigens muß mit Dank anerkannt werden, daß die preußische Regierung alles mögliche tut, um die Harzer Rindviehrasse zu kräftigen, Wiesenkultur und Milchwirtschaft zweckentsprechender zu gestalten.
Quelle: F. Günther in Joh. Meyers, Die Provinz Hannover. 2. Aufl. Carl Meyer (G. Prior), Hannover.
Von O. Graßhof.
Nicht bei gewaltsamen Umformungen, denen die Erdrinde im Verlaufe der Jahrtausende unterworfen war, ist die Bildung der sack- und labyrinthförmigen Höhlen des Harzgebirges erfolgt. Diese sind vielmehr das nachträgliche Ergebnis eines langsam, aber beständig wirkenden Naturspiels, das vor unendlich langer Zeit begann und teilweise noch jetzt und für unabsehbare Zeiten fortwirkt. Die Bildung der Anfänge einer Höhle muß man sich folgendermaßen vorstellen: Eine winzige unterirdische Wasserader bahnt sich durch weniger widerstandsfähige Teile des Gesteins, meist Kalk oder Mergellager, allmählich einen Weg; fortgesetzt nagt sie an den Wandungen und führt die losgebröckelten Teile fort. Die anfangs winzige Höhlung vergrößert sich durch Einstürze; Steinchen für Steinchen wird fortgeschwemmt, und es entstehen weite Hallen. Andere Wasserläufe und Quellen wieder zersetzen das Gestein, namentlich Gips, chemisch und führen die Bestandteile in gelöstem Zustande allmählich hinweg, bis einmal unauflösliches Gestein oder widerstandsfähiger Felsen kommt, der der Zerstörung ein Ziel setzt. Hier und da beginnt alsdann ein anderer Prozeß, indem der Boden, die Seitenwände und Decken der Höhle mit neu sich bildendem Material überzogen werden, den sogenannten Tropfsteinbildungen.
Wenn auch nach den Daseinsbedingungen der heutigen Menschheit die Höhlen als Wohnstätte jetzt nicht mehr in Betracht kommen, so steht doch fest, daß sie in der Urzeit Menschen und Tieren als sichere Zufluchtsstätte gegen das Wetter und feindliche Angriffe, wohl auch als ständiger Aufenthaltsort gedient haben; die Funde, die in den Höhlen gemacht sind, bieten einen sicheren Anhalt dafür. Reste aus den verschiedensten Zeiten sind angetroffen und von den Gelehrten forschungsmäßig gegliedert worden. Die gefundenen Tierknochen stammen durchweg von Raubtieren, in erster Linie von Höhlenbären, dann auch von Hyänen, Höhlenlöwen, Wölfen und Füchsen. Doch auch die Pflanzenfresser sind vertreten durch Mammuth, Rhinozeros, Hirsch und Renntier. Der Umstand, daß alle diese Geschöpfe mit ihren weit voneinander verschiedenen Existenzbedingungen hier leben konnten, dient als Beweis dafür, daß unsere Zone verschiedene klimatische Veränderungen zu bestehen gehabt hat. Die Zeiten, zu denen der Mensch diese Höhlen bewohnte, hat man annähernd nach den von ihm hinterlassenen Gerätschaften, die auch wieder verschiedenen, weit auseinander liegenden Zeitperioden entstammen, zu bestimmen gewußt. Alle diese Rückstände einer unendlich weit hinter uns liegenden Zeit hat man teils bloßliegend, teils im Felsen versintert, teils im Bodensatz der Höhlensohle verschwemmt gefunden.
Ihrem Entstehen und ihrem jetzigen Zustande nach sind die Harzhöhlen verschiedener Art.
Wir betreten bei Thale das hochromantische Bodetal, wandern an der Roßtrappe und dem Hexentanzplatz vorbei über das liebliche Treseburg, über Altenbrak, erfrischen uns in dem Wald- und Bergidyll Wendefurth und gelangen von hier bald nach Neuwerk, einem neuerdings als bescheidener Luftkurort und Sommerfrische beliebt gewordenen Dörfchen. Noch eine kleine halbe Stunde, und wir sind in dem ansehnlichen braunschweigischen Hüttenort Rübeland an der Bode, d. h. am Ziel. Unmittelbar bei dem malerisch in die Talwände eingebetteten Orte befinden sich die Hermanns-, die Baumanns- und die Bielshöhle.
Der am rechten Bodeufer gelegenen Hermannshöhle als der größten und schönsten aller Felsenhöhlen Deutschlands gilt unser erster Besuch. Sie ist, wie auch die beiden anderen, eine Schwemmhöhle in marmorartigem Kalkstein der Talwände. Doch steigen wir hinab in das Reich der Gnomen, nachdem wir so vorsichtig waren, uns etwas abzukühlen. Durch einen engen, künstlich in den Berg getriebenen Stollen schieben wir uns vorwärts. Dankbar nehmen wir noch die Belehrungen historischer und wissenschaftlicher Art an, die der Führer herbetet, und beginnen dann den Rundgang. Undurchdringliches Dunkel würde uns bereits umhüllen, wenn nicht die ganze Höhle in den »befahrbaren« Teilen durch elektrisches Licht erhellt wäre. Dieser Beleuchtungsart haben wir es zu verdanken, daß die wunderbaren Tropfsteingebilde, die die Hermannshöhle in einer seltenen Reinheit und Menge aufweist, uns in ihrer ganzen ursprünglichen Schönheit erhalten geblieben sind. In früherer Zeit behalf man sich mit Fackeln und Grubenlichtern, wodurch natürlich die Decken und Wände mit der Zeit verräuchert und gedunkelt wurden.
Wir gelangen auf ein kleines Plateau, das einen Überblick über einige terrassenartig liegende Hohlräume bietet. Schweigend stehen wir und staunen die großartige Schönheit der vom bleichen Lichte der Bogenlampen übergossenen Prunksäle der Berggeister an. Feuchtkalte Luft umgibt uns, in eintönigem Takte klatschen die Wassertropfen auf das Gestein, allein das vieltausendjährige Schweigen dieser Katakomben einer entschlummerten Welt unterbrechend. Sieh dort den mit einer Tropfsteinschicht überzogenen Beinknochen eines Höhlenbären, daneben den gewaltigen Schädel. Überall in der Höhle stoßen wir auf diese Zeugen der Vorzeit. Doch folgen wir unserm Führer zur Besichtigung der einzelnen Teile der Höhle. Man stelle sich nämlich diese nicht als eine einzige große Wölbung vor; wir sehen vielmehr ein Labyrinth mehrerer in verschiedenen Ebenen liegenden Gewölbe von bald größerem, bald kleinerem Umfange. In ihrer ganzen Ausdehnung ist die Höhle noch gar nicht erforscht, weil Felsblöcke und Trümmer hier und da den Durchgang sperren.
Die mit Tropfstein überzogenen Felsen und Zacken von seltsamen Formen hat die Phantasie der Führer mit mehr oder weniger zutreffenden Beinamen belegt. Man sieht da eine »Kapelle«, ein »Schloß«, eine »Kanzel«, frosch- und pilzartige Gebilde und dergleichen. Auch die Souveräne und Heiligen müssen zur Vergleichung herhalten. Die Wände sind, namentlich in der oberen sogenannten Bärenhöhle mit prächtigen Steinbehängen in mächtigem Faltenwurf – Tropfwasserarbeit – geschmückt. Dort hinten scheint es, als sei ein Wasserfall zu Eis erstarrt. Besonders prachtvoll nehmen sich die von der Decke herabhängenden Steinzapfen – Stalaktiten – und die ihnen vom Boden her gegenüberstehenden Säulen – Stalagmiten aus. Schlägt man an eine solche Säule, so gibt sie einen metallisch klingenden Ton. Und all dies ist in unvergänglicher Nacht im Laufe vieler Jahrtausende entstanden.
Bei seinem Durchgange durch das Kalkgestein löst jeder Tropfen des nach unten strebenden Wassers vermöge seines Kohlensäuregehaltes gewisse Mengen kohlensauren Kalkes auf und scheidet diesen dann an den Decken und Wänden der Grotte wieder ab. Wenn die an der Gewölbedecke hängende Wasserperle herabfällt, so läßt sie einen kaum sichtbaren weißlichen Kalkring zurück. Das ist der Anfang der Stalaktitenbildung. Ein zweiter Tropfen folgt und setzt an derselben Stelle einen neuen zarten Ring ab. So folgt Tropfen auf Tropfen mit derselben Wirkung, sodaß sich allmählich Zapfen bilden, die zu ansehnlicher Größe anwachsen, zwar unendlich langsam, aber beständig. Das Tröpfchen, das von dem Stalaktiten auf den Boden fällt, hat sich aber noch keineswegs aller Kalkteilchen entledigt; es läßt beim Aufschlagen am Boden wiederum Kalkspuren zurück, sodaß der Stalagmit nach oben wächst, sich vielleicht nach langer, langer Zeit mit seinem Gegenüber, dem Stalaktiten, vereinigend. So entsteht der zauberische Schmuck der Tropfsteinhöhlen.
Wir kommen jetzt vorbei an Nischen und Nebenhöhlen, an sich kreuzenden und sich übertürmenden Galerien. Fahl und düster schimmert eine Grotte zwischen den Bogen und Pfeilern her, durch die Eigenart ihres Einbaus und der Beleuchtung gespenstische Dämmerungserscheinungen hervorrufend. Weiter geht es durch den sich in drei Stockwerken übereinander gliedernden Wunderbau.
Gegen 500 m der gangbaren Teile haben wir durchmessen, haben das rot beleuchtete »Marienkind«, die über 3 m hohe »Riesensäule«, den »Kaiserthron« und hundert andere Naturschöpfungen bewundert. Es bleibt uns noch der Glanzpunkt der Höhle, die in einer Abzweigung gelegene Kristallkammer. Sie ist erst im Jahre 1896 aufgedeckt worden und zeigt eine Fülle ganz eigenartiger korallenähnlicher Kristallgebilde von wunderbarer Schönheit. Diese Abteilung ist denn auch gegen unerwünschte Angriffe der Besucher besonders geschützt. Nachdem wir uns satt gesehen an dem Gefunkel, streben wir durch mehrere Stollen dem Ausgange zu. Laue Luftwellen schlagen uns wohlig entgegen; schon sehen wir den ersten Schimmer des Tageslichts, und plötzlich stehen wir geblendet an der Oberwelt. Die Hermannshöhle ist erst 1866 entdeckt worden, und zwar durch den beim Straßenbau beschäftigten Arbeiter Angerstein, genannt Sechserding, weshalb sie den Namen Sechserdingshöhle erhielt. Doch es erging dem armen Angerstein-Sechserding, wie es vielen Entdeckern und Erfindern geht. Der braunschweigische Geheime Kammerrat Hermann Grotian nahm 1874 eine Untersuchung der Höhle vor und flugs wurde aus der Sechserdings- die Hermannshöhle. Hatte doch sogar Christoph Kolumbus nicht einmal das Vergnügen, das von ihm entdeckte Amerika nach sich benannt zu haben! Er mußte die Ehre der Namengebung an den Florentiner Amerigo Vespucci abtreten, weil dieser auch einmal, allerdings lange nach ihm, nach der Neuen Welt gesegelt war.
Am linken Ufer der Bode, 44 m über der Talsohle, liegt der Eingang zu der zweiten Höhle Rübelands, der Baumannshöhle. Ein zweiter, vor 10 Jahren künstlich hergerichteter Zugang befindet sich im oberen Orte. Die Baumannshöhle ist nur gegen 300 m lang und bis 10 m hoch, doch lohnt ihr Besuch nicht minder. Weist die Hermannshöhle einen größeren Figurenreichtum und eine gewisse Eleganz der Felsbildung auf, so imponiert die Baumannshöhle durch die gigantische Wucht der Bauart. Gewaltige Säle mit von Titanen hineingeschleuderten kolossalen Felsblöcken sehen wir. Alles trotzig, alles wild romantisch. Da die Höhle bereits seit 400 Jahren bekannt ist, so sind durch die früher beim Besuch gebrauchten Pechfackeln die zarten Farbentöne des Tropfsteins verwischt. Jetzt ist jedoch auch hier elektrische Beleuchtung, und die rastlos schaffende Natur wird alles, was der Tropfen berührt, allmählich wieder neu auskleiden. Auch in der Baumannshöhle wurden viele interessante Knochenfunde gemacht; hier ist die beste Fundstelle des Renntiers in Deutschland. Für die Gelehrten waren die an dieser Stelle aufgefundenen Geräte und Werkzeuge, namentlich Feuersteingeräte, von hoher wissenschaftlicher Bedeutung.
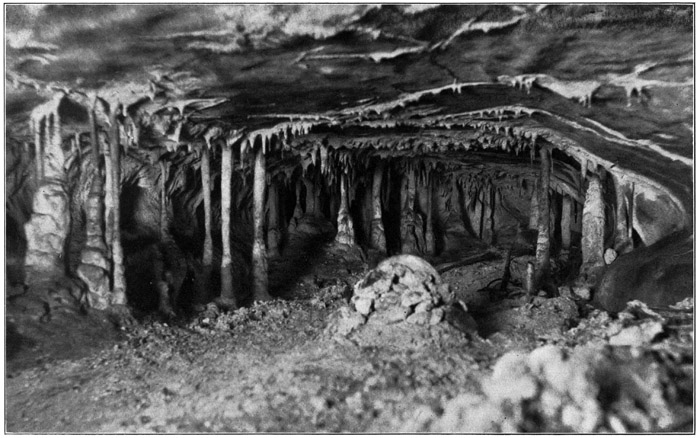
Hermannshöhle bei Rübeland im Harz.
Nach einer Photographie von Fr. Rose in Wernigerode.
Die Baumannshöhle hat zwar ihrer jüngeren Schwester, der Hermannshöhle, den ersten Platz räumen müssen; eins aber hat sie dadurch für den stillen Naturbewunderer voraus: er ist hier ungestörter. Man kann einmal allein diese Welt für sich durchstreifen, ohne einen Troß lärmender und zum Teil verständnisloser Reisegenossen um sich zu haben. Der tiefe Eindruck, den die Erhabenheit dieser großartigen steinernen Landschaft, dieser Hügel und Gletscher auf uns macht, wird durch die Einsamkeit gesteigert. Es ist ein eigener Reiz, dies unbedingte Schweigen auf sich wirken zu lassen, diese Totenstille mit angehaltenem Atem zu kosten, sich selbst zu schrecken durch einen plötzlich ausgesprochenen Laut, dessen Echo sich heulend an den Wänden der Klüfte und Grüfte bricht. Rasch eile ich dem Führer nach. Er berichtet mir, daß im Jahre 1712 Zar Peter der Große und 1777 Goethe hier geweilt haben.
Die Höhle fällt nach dem Innern des Berges in vielen, wunderbar miteinander verketteten, höher und niedriger, kreuz und quer liegenden Grotten und Schluchten immer tiefer ab. Manche Nebenhöhlen sehen wir durch wild übereinander gestürzte Trümmer und jähe Abgründe versperrt und ungangbar. Wir sind schon in der dritten Höhlenabteilung und steigen in die vierte hinab. Hier befindet sich das Kapitalstück aller Stalagmiten, die berühmte 2½ m hohe, inwendig hohle, klingende Säule. Der Führer schlägt sie an und bringt einen scharfklingenden Glockenton hervor. Die fünfte und sechste Höhle sind so geschichtet, daß jene über dieser liegt; über die siebente hinaus ist kein Vordringen mehr möglich. Wenn jetzt plötzlich die Lichter verlöschten, würden wir schwerlich den Ausgang wiedergewinnen. Wir befinden uns nicht in dieser ungemütlichen Lage und treten befriedigt den Rückweg an. Ohne durch Aufzählung all der prachtvollen Tropfsteingebilde, mit denen auch die Baumannshöhle gesegnet ist, ermüden zu wollen, muß ich doch einige der bemerkenswertesten hier anführen. Da ist die »betende Nonne«, der »Mönch«, die »Orgel«, das »Schloß«, der »Totenkopf«, die »Pferdeohren«, die »Kanzel«, die »Eule« und vieles andere mehr. Die Phantasie hat da eben einen weiten Spielraum.
Nachdem wir die Höhle verlassen, sehen wir uns von außen noch die dritte der Rübeländer Höhlen, die Bielshöhle, an. Sie liegt eine Viertelstunde weiter an der rechten Talwand und ist etwa 240 Jahre bekannt. Sie wurde, obgleich ebenfalls durch schöne Tropfsteinbildungen ausgezeichnet, weniger besucht. Sie ist nur etwa 190 m lang und hat eine flachere, einförmigere Bogenspannung. Jetzt ist sie verschlossen und wird nicht mehr gezeigt.
In welcher Weise in früheren Jahrhunderten Wahrheit und phantasiereiche Dichtung vermengt wurden und welche Rolle selbst bei gebildeten Leuten der Aberglaube spielte, sehen wir aus einer spaßig zu lesenden »Epistola de Specu Bumanni, vulgo Baumannshole«, die der Prior des Klosters Walkenried, Heinrich Eckstorm, dem Professor Brendel in Jena im Jahre 1591 berichtete. Ich lasse sie wegen des bezeichnenden Inhalts im Wortlaut folgen: »In denen Eisenhütten bei dem Rübelande hat sich ein armer gemeiner Bergmann mit Namen Baumann aufgehalten, welcher einesmahls, als die Höle noch offen gestanden und mit keiner verschlossenen Thür verwahret gewesen, sich unterstanden, gantz allein vor sich in die Höle zu kriechen, habe sich aber aus denen Klüfften nicht wieder finden können, weil er kein brennend Licht mit sich genommen, derohalben er acht Tage lang mit Herumwandern daselbst zubringen müssen, bis er endlich durch Gottes sonderbare Hülffe hinwieder an das Tages Licht gelanget, und nachdem noch kurze Zeit gelebet; in diesen acht Tagen habe aber er vor großer Furcht und Schrecken gantz Eis-graue Haare bekommen; weilen derselbe durch viele Gespenster, wie er erzehlet, auf mancherley Art geplaget worden, denn es hätten etliche derselben ihn angegriffen, eines Diebstahls beschuldiget, und deswegen aufzuhängen befohlen; wenn er nun dieser los gewesen, sey er von anderen eines Totschlages bezüchtiget und daher zum Schwerdt verdammet worden; noch andere hätten ihn auf eine andere Weise gequälet und gepeiniget, auf welche Art es ein Wunder gewesen, daß der Mann nicht aus Angst verzweifelt wäre.«
Auch der Geograph Happel schildert die »entsetzliche Höle«. Er sagt u. a.: »Dieweil per Rerum Naturam in diesen Locus Subterraneus kein Tages-Licht hineinfallen kann, dann aber sothane Höhlen sammt und sonders, mit stätigen dicken Dünsten und Nebeln angefüllet, und dazu stäts Wasser von oben herab darein tröpfelt, ohne, daß auch der Ort, wegen darin befindlicher Gespenster, sehr beschryen ist, als versammeln sich gemeiniglich der Jenigen, so den Ort zu besehen willens, eine ziemliche Gesellschaft und versehen sich mit einer Menge Fackeln oder Lichter sammt einem oder anderm Feuer-Zeug« usw. Wir haben gesehen, daß es ganz so schlimm nicht ist.
Die soeben besprochenen Höhlen, deren Besuch je 1 bis 1½ Stunden erfordert, werden heute sämtlich von den »Harzer Werken zu Rübeland und Zorge« verwaltet und erhalten. Auch das Höhlenmuseum gehört dazu, in dem sich neben anderen in den Höhlen gefundenen Gegenständen das vollständige Skelett eines Höhlenbären befindet.
Verlassen wir nun das romantische Tal der Bode und steigen über das Gebirge in genau südlicher Richtung! Den Harzrand erreichen wir dann bei Nordhausen. Von hier zieht sich nach Osten bis Kelbra und weiter das fruchtbare Tal »Goldne Aue«, das weite Bett des Helmeflusses, den Südrand des Harzes begleitend, der hier vorzugsweise aus mächtigen Gipslagern besteht. Durch Auflösung dieses leicht löslichen Gesteinmaterials sind hier zahllose sogenannte Schlotten entstanden, unterirdische Höhlungen von größerer oder geringerer Mächtigkeit, die sich wohl mit den Bodetalhöhlen an Schönheit und Größe nicht messen können, die aber immerhin nicht nur die Beachtung des Geologen, sondern auch des Naturfreundes verdienen. Teils sind sie erst durch den Bergbau in die Tiefe erschlossen, teils schon von alters her bekannt Ihr Gepräge ist ein völlig anderes als das der Tropfsteinhöhlen. Erfreuen uns diese durch ihre wunderbaren Gestaltungen, so überraschen die Gipshöhlen durch die blendende Weiße, in der sie erstrahlen. Sie erleiden noch heute Größenveränderungen durch gar nicht so seltene Einstürze, die eine Folge der Weichheit des Gesteins sind. An der Sohle findet sich häufig ein mehr oder weniger großes und tiefes Standwasser. In den Tropfsteinhöhlen fließen die zu Boden kommenden Niederschlagsmengen meist durch den Höhlenbach ab.
Von beträchtlicher Ausdehnung sind die altberühmten Gipsschlotten bei Wimmelburg, südlich von Mansfeld. Beim Abteufen der Schächte deckte man sie in 100 m Tiefe auf. In dem Längstale, das zwischen Uftrungen, Breitungen und Agnesdorf (ungefähr Richtung Rottleberode-Wallhausen) die Gipskette vom Hauptgebirge scheidet, liegt höchst malerisch der Hungersee. Dieser ist nichts weiter als ein Erdfall, der durch den Zusammenbruch einer großen Gipshöhle entstanden ist, wie dies am Südharz häufig zu sehen ist. Noch heute entstehen da neue Erdfälle, kraterkessel- oder trichterförmige Einstürze, die sich meist mit Wasser füllen. Der Hungersee verliert zuweilen sein Wasser, was man unterirdischen Durchbrüchen zuschreibt; verstopfen sich diese Abflüsse durch neue Einstürze, so füllt sich der See wieder mit Wasser an.
Zwischen Rottleberode und Uftrungen finden wir eine sehr merkwürdige Gipsschlotte, die »Heimkehle«. Der Einstieg erfolgt durch eine Krateröffnung; unten sieht man sich einem Wasserbecken gegenüber, das den Grund der ganzen, 60 m langen und 12 m hohen Höhle einnimmt. Wem es Spaß macht, der kann über die im Wasser zerstreut liegenden Gipsblöcke in die Halle vordringen.
Abenteuerlich ist der Besuch des » Försterlochs«. Diese Höhle besteht aus 11 Abteilungen von den verschiedensten Dimensionen. Zuweilen kann man nur auf allen Vieren kriechend vorwärts gelangen, um urplötzlich in einer gewaltigen Halle zu landen.
Eine Höhle von herrlicher Form der Gewölbe befindet sich zwischen Ellrich und Appenrode, die »Kelle«. Sie hat einen 25 m hohen bequemen Eingang; nachher erweitert sich die Wölbung zu 50 m Höhe, 80 m Breite und 100 m Länge, einen mächtigen Hohlraum darstellend. Das aus den Wänden sickernde Wasser bildet einen Höhlensee von wunderbarer Klarheit; er soll über 10 m tief sein. Die Temperatur der Höhle und des Wassers ist außerordentlich niedrig.
Als man die Bahn von Ellrich nach Walkenried baute, entdeckte man beim Durchschneiden eines das »Himmelreich« genannten gewaltigen Dolomitfelsens eine prachtvolle Höhle von 130 m Länge, 50 m Breite und ansehnlicher Höhe. Leider kann die Bahnverwaltung im allgemeinen das Betreten der Höhle nicht gestatten, weil sehr häufig massige Gipsklumpen von der Gewölbedecke herabstürzen.
Ebenso ist es in dem » Weingartenloch« unweit Osterhagen und Nixey.
Am Rotenberge bei Ruhmspringe – schon im flachen Lande südlich von Herzberg – ist die Quelle des Ruhmeflusses, ein sprudelndes und brodelndes Wasserbecken von 40 Schritt Länge und 20 Schritt Breite, das dem jungen Flusse ermöglicht, seinen Lauf gleich mit etwa 10 m Breite zu beginnen, ein Schauspiel, wie wir es in Mittel- und Norddeutschland wohl nicht mehr finden. Das Zutagetreten einer so gewaltigen Wassermenge steht sicher in Verbindung mit den vielen Höhlen und Erdfällen der Umgegend. Von letzteren sind in dieser Landschaft der »Ochsenpfuhl« und der »Jües« bei Herzberg wegen ihrer großen Tiefe bemerkenswert. Die Wasser beider stehen sicher mit den Gipsschlotten und deren Gewässern in unterirdischer Verbindung.
Wir wollen unsere lichtscheuen Wanderungen beschließen mit dem Besuche der beiden interessanten Höhlen des Südharzes. Auf einer felsigen Anhöhe südöstlich von Herzberg, bei Scharzfeld, finden wir eine nicht sehr große Höhle von 40 m Länge, 12 m Breite und 7 m Höhe, die sich vor ihren Schwestern durch Trockenheit auszeichnet. Sie heißt die » Steinkirche« und führt den Namen mit Recht, denn sie ist eines der ältesten Denkmäler des Christentums im Harze. Daß Bonifazius hier in eigener Person den trotzigen Sachsen die Kreuzeslehre gepredigt hat, mag Sage sein. Doch steht es fest, daß die Höhle im frühesten Mittelalter den ersten Christen dieser Gegend als Gotteshaus gedient hat. Der Eingang zeigt Spuren, die darauf deuten, daß die Grotte einst verschließbar war. Eine in den Felsen gehauene kleine Kanzel mit einigen vorgebauten Stufen sehen wir rechts, eine Nische mit Spitzbogen links. Auch zu einem Altar gelangen wir auf einer kleinen kunstlosen Steintreppe. Mit seltsamen Gedanken verlassen wir das eigenartige Gotteshaus. –
Noch einmal ergreifen wir den Wanderstab, um zur Eichhornhöhle zu gelangen. Es ist der Mühe wert; wir haben es nicht weit dahin, nur eine Stunde Marsch in östlicher Richtung: durch das schön bewaldete Gebirge auf Lauterberg zu, bis auf den Kamm der »Schneie«. Auf 45 Steinstufen steigen wir in den Orkus hinab, in die »große Vorhalle«. Durch eine Deckenspalte flutet das Tageslicht mächtig herein. Weiterschreitend, gelangen wir in die Leibnizhalle, so genannt zu Ehren des großen Philosophen, der die Höhle einer eingehenden Untersuchung und Beschreibung für würdig erachtete. Schon damals erregte die ungeheure Zahl der in der Höhle gefundenen fossilen Tierknochen Verwunderung. Bis in die jüngste Zeit fortgesetzte Ausgrabungen der den Boden bedeckenden 2-3 m tiefen Höhlenlehmschicht förderten immer neue Funde, darunter Hausgeräte, Gebrauchsgegenstände, Aschenreste usw. zutage. Hieraus und aus der Art, wie die Knochen zerschlagen und aufgespalten waren – offenbar um das Mark zu gewinnen – kann man mit Sicherheit schließen, daß auch hier in diesen Tiefen der Mensch gehaust hat, und zwar vor Tausenden von Jahren, als der Harz noch von Gletschern bedeckt war. Viele der Knochen zeigen nämlich deutliche Spuren der durch die Fortbewegung im Wasser erfolgten Abrollung; dies aber konnte nur geschehen, als noch ein Gletscherbach die Höhle durchflutete. Diese muß also vor der Eiszeit bewohnt gewesen sein. Die auswaschende Wirkung des fließenden Wassers ist auch sonst überall sichtbar; die Wände sind bis obenhin geglättet und durch die Fluten des Gletscherbachs abgeschliffen. Die Art der in den verschiedensten Tiefen des Höhlenlehms gefundenen Geräte läßt die Vermutung gerechtfertigt erscheinen, daß man es hier mit mehreren Kulturstufen des Menschen zu tun hat, die zeitlich wieder unendlich weit auseinander liegen. Wir schreiten weiter und gelangen in den Bärengang, den wir gebückt passieren müssen, um in die Schillergrotte, einen gewaltig großen Raum, einzutreten. Hier wurde im Jahre 1859 zum Gedächtnis des 100jährigen Geburtstages des Dichters eine eiserne Gedenktafel angebracht. Durch enge Durchschlupfe und Grotten dringen wir noch bis zur Wolfskammer und, wenn es unser Körperumfang gestattet, durch eine ganz enge Spalte in das letzte große Gewölbe, die Karlsgrotte oder den weißen Saal vor, der die allerschönsten Tropfsteinbildungen aufzuweisen hat. 250 m tief sitzen wir in dem Körper des Felsens.
Nochmals sind wir, wie im Bodetale, Zeugen gewesen der Wandlungen, denen die stumme und doch lebendige Natur im Verlaufe von ungezählten Jahrtausenden unterworfen gewesen ist. Einen unendlichen Zeitraum haben wir im Geiste durchlebt und uns gebeugt vor der Allmacht und Majestät dessen, »vor dem tausend Jahre sind, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie eine Nachtwache«.
Magdeburgische Zeitung 1907.