
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Das deutsche Mittelgebirgsland.
1. Der Rhein. – 2. Aus dem Elsaß. – 3. Die Vogesen und ihre Täler im Oberelsaß. – 4. Die Arbeiterstadt in Mülhausen. – 5. Aus dem Schwarzwald. – 6. Aus der Pfalz. – 7. Der Limes und die Saalburg. – 8. Der Spessart. – 9. Eine Frühlingsfahrt auf dem Rhein. – 10. Das Niederwalddenkmal. – 11. Das Moseltal. – 12. Die Eifel und ihre Vulkane. – 13. Der Kölner Dom. – 14. Gewinnung der Steinkohle im Ruhrkohlengebiet. – 15. Wanderungen durch die Hauptorte des Bergischen Fabriklandes. – 16. Die Kruppschen Werke in Essen.
Von Carl Gude.
Stellt man eine vergleichende Betrachtung über sämtliche Hauptströme der Erdoberfläche an, so kommt man schließlich zu dem Ergebnisse, daß der Rhein, alles in allem genommen, den ersten Rang einnimmt. Auch unter den Flüssen findet eine Rangordnung statt. Es stehen diejenigen Flüsse am tiefsten, welche den eigentlichsten Bestimmungsort eines Flusses, das Meer, nicht erreichen, sondern im Sande verlaufen. Afrika, Asien und Australien sind reich an solchen Flüssen. So untergeordnet aber auch ihr Rang sein mag, so sind sie doch ein wahrer Segen für die Wüstengegenden. Mit Freuden werden sie von den Karawanen begrüßt, die in der Richtung ihrer Handelswege vorzugsweise durch sie bestimmt werden.
Wichtiger sind diejenigen Flüsse, die in einen Binnensee münden. Da sie gleichfalls das offene Meer noch nicht erreichen, so kann bei ihnen natürlich nur vom Binnenhandel die Rede sein. Es gehören dahin die Wolga, der Ural, der Amu und Syr usw. Die Wolga nimmt unter diesen den ersten Rang ein, nicht sowohl ihrer Größe wegen, als weil auf ihr der bedeutendste Binnenhandel getrieben wird. Von Osten her führt ihr die Kama die Waren aus Sibirien und China zu, und die Oka trägt sie bis tief in das Innere von Rußland weiter. Städte wie Twer, Nischnij Nowgorod, Kasan usw. verdanken ihre Entstehung und Größe vorzugsweise dem Binnenhandel auf der Wolga.
Von den Flüssen nun, welche in den Ozean gehen, sind wiederum diejenigen von geringer Bedeutung, welche in das Polarmeer münden, das auch nicht viel mehr als ein Binnensee ist, indem die Eisschollen es den größten Teil des Jahres unzugänglich machen. Der Ob, der Jenissei, die Lena in Asien, der Mackenzie in Amerika haben trotz ihrer Größe für den Welthandel keine Bedeutung, da das Eis des Polarmeeres den Schiffen den Zugang zu ihrer Mündung verwehrt.
Faßt man nun die Flüsse ins Auge, die in ein zugängliches Meer sich ergießen, so sind diejenigen, welche in ein Meer mit Ebbe und Flut münden, wiederum wertvoller, als solche, die ein Meer ohne Ebbe und Flut erreichen, indem bei jenen die Schiffe tiefer landeinwärts dringen können, als bei diesen, was für den Handel nicht unwichtig ist. Die Flut staut das Wasser der Flüsse an und erhöht es, sodaß die See eigentlich bis dahin geht, wo die Flut zu wirken aufhört. Stark beflutete Küsten, wie die des nordwestlichen Frankreichs und Deutschlands, haben die Mündungsstädte 75-150 km an den Flüssen stromaufwärts liegen, was bei der flutlosen Ostseeküste nicht der Fall ist, und wenn Bremen, Hamburg, Rotterdam, Bordeaux usw. als Flußmündungsstädte einen höheren Rang einnehmen, als Stettin, Danzig, Königsberg, so hat das in dem Angeführten mit seinen Grund.
Für die Bedeutung eines Flusses ist es aber auch nicht gleichgültig, ob derselbe sich in der Richtung des Meridians oder des Äquators bewegt. Ein Fluß, der von Süden nach Norden oder umgekehrt geht, durchschreitet Länder von verschiedenartigen Zonen und Produkten, begründet daher einen lebhafteren Verkehr, als ein Fluß, der in äquatorialer Richtung sich bewegt. Dieser durchschneidet meist denselben Vegetationsgürtel; das Bedürfnis nach gegenseitigem Austausch ist im allgemeinen zwischen Ost und West nicht so groß, als zwischen Nord und Süd.
Der Wert eines Flusses hängt aber außerdem auch davon ab, ob er der Schiffahrt durch Stromschnellen oder durch große Krümmungen Hindernisse in den Weg legt, oder ob dies nicht der Fall ist. Der Nil würde ohne die Katarakte seines Mittellaufes dem Verkehr der an ihm gelegenen Länder bei weitem mehr Vorschub leisten, als es wirklich der Fall ist, ebenso der Orinoko, der außerdem noch durch seine fast kreisförmige Windung an Wert für die Schifffahrt verliert.
Wenden wir das Gesagte auf den Rhein an, so vereinigen sich bei ihm alle jene Bedingungen, die einem Flusse Wert verleihen. Er ist ein Strom, der in ein Meer mit Ebbe und Flut mündet; sein Lauf geht von Süden nach Norden, ist ohne erhebliche Krümmungen und wird durch Stromschnellen nur an einer einzigen Stelle, und zwar sehr weit von seiner Mündung ab, unterbrochen Durch Sprengung der Klippen unter dem Wasser ist die früher gefährliche Stromschnelle des »Binger Lochs« soweit beseitigt, daß sie kein Hindernis für die Schiffahrt mehr bildet.. Hierbei können wir jedoch nicht stehen bleiben. Die Bedeutung eines Flusses ersieht man schon aus der Menge der Ansiedelungen an seinem Ufer: je größer der Städtereichtum eines Flusses ist, desto bedeutender muß er auch sein. Nun aber ist der Rhein der städtereichste Fluß der Welt. Da liegen unmittelbar an seinen Ufern Konstanz, Speier, Mannheim, Worms, Mainz, Koblenz, Bonn, Köln, Düsseldorf, Wesel usw. Ja, das Bedürfnis nach einer Ansiedelung am Rhein ist so groß gewesen, daß eine zweite, ebenso schöne Städtekette in nächster Nähe des Rheins sich gebildet hat, wie Freiburg, Rastatt, Karlsruhe, Heidelberg, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, Elberfeld, Barmen, Krefeld. Und das sind Städte von gar gutem Klange. Von Freiburg und Mainz gingen zwei wichtige und folgenreiche Erfindungen aus, die Erfindung des Schießpulvers und die Erfindung der Buchdruckerkunst, dieses Kleinodes in dem herrlichen Strahlenkranze deutscher Erfindungen. In Kolmar erblickte Lebrecht Rust, Zeitgenosse Gutenbergs und Erfinder der Kupferstecherei, das Licht der Welt. Frankfurt, viel genannt und weit gekannt schon im 11. Jahrhundert, ist die Vaterstadt Goethes. In Frankfurt wurde lange Zeit das deutsche Reichsoberhaupt gewählt und die Krönung des deutschen Kaisers vollzogen; in Frankfurt tagte der deutsche Bundestag, hier trat im Jahre 1848 das erste deutsche Parlament in der Paulskirche zusammen, die dadurch ebenso bekannt geworden ist als das Rathaus, worin die Kaiser gekrönt wurden, und das »der Römer« heißt. Am 10. Mai 1871 wurden in Frankfurt die Friedensunterhandlungen abgeschlossen, die den von Deutschland glorreich geführten Krieg mit Frankreich beendeten.
Die Wichtigkeit und Anziehungskraft dieser Stadt bekunden außerdem viele deutsche Reichstage und Konzile, die dort abgehalten wurden, nicht minder die Messen, die einst zu den bedeutendsten im mittleren Europa gehörten. Auch Aachen hat als Wahl- und Krönungsstadt deutscher Kaiser geschichtlichen Ruf, während man in dem ehrwürdigen Dome des hochberühmten Speier acht Kaisergräber findet, unter denen das Grab Rudolfs von Habsburg das wichtigste und das Denkmal des Nassauers Adolf das bedeutendste ist. Nicht minder berühmt als diese Totenstadt deutscher Kaiser ist das alte Worms, in welchem Luther seine Lehre heldenmütig verteidigte. Eines guten Rufes genießt Köln, das in seinem Handel mit Rotterdam wetteifert und einst mächtig genug war, eine Flotte ins Mittelmeer zu senden, in Kunst, Wissenschaft und Handwerk keiner deutschen Stadt nachstand, und so ließe sich noch manche Stadt am Rheine anführen, die als leuchtender Punkt in der Geschichte unseres Vaterlandes steht und eine wahre Zierde desselben ist; ich brauche nur an Koblenz und Heidelberg, an Bonn und Düsseldorf, an Elberfeld und Barmen, Solingen und Krefeld zu erinnern. Welcher Fluß hätte ferner solche Baudenkmale, wie der Rhein in seinen Domen zu Freiburg, Straßburg, Speier und Köln? Der Kölner Dom mit seinen zwei Riesentürmen, das großartigste Werk gotischer Baukunst, an welchem Jahrhunderte gebaut haben, ohne es zu vollenden – er steht nun in all seiner Herrlichkeit da, und unser Geschlecht darf mit Stolz auf das große Werk als ein Bild deutscher Beharrlichkeit und idealen Strebens hinschauen. – Welcher Fluß zählt so viel große Männer und ist geschmückt mit ihren Standbildern? In Mainz steht die von Thorwaldsen entworfene, in Erz gegossene Statue Gutenbergs, in Bonn das stattliche Denkmal Beethovens, des Meisters der Töne, in Frankfurt das Standbild Goethes, der mit Schiller unsere Literatur zur Weltliteratur erhob; in Worms ist Luther ein Denkmal errichtet worden. Und wie diese Denkmäler des Friedens von deutscher Kunst und deutscher Wissenschaft ein Zeugnis ablegen, so erzählt das Nationaldenkmal am Niederwald, Bingen gegenüber, von dem siegreichen Kampfe Deutschlands, den unsere tapferen Heere in den Jahren 1870/71 mit Frankreich kämpften, von dem gewaltigen Ringkampfe, der das neue Deutsche Reich erstehen ließ; – und so erzählen auch die ergrauten Burgen und Schlösser, welche in reicher Fülle von den starren Felsen des Rheins herab auf seine grünen Wogen schauen, von dem Lanzen- und Schwertgeklirr der Ritter, von ihren Harfnern und Edelfrauen, von deutscher Minne und deutscher Heldenkraft. Manche dieser Ritterburgen, wie Rheinstein bei Bingen und Stolzenfels bei Koblenz, sind ganz im Stile des Mittelalters wieder hergestellt worden und stehen nun da als stattliche Zeugen einer kräftigen Zeit; andere sind mehr oder weniger zerfallene Ruinen, und wo einst Eisenharnische klirrten, da flüstert jetzt das Rebenblatt, und wo Edelfräulein lauschten, da schaut die Traube aus dem offenen Fenster. Und wie diese Burgen von den mächtigen Flügelschlägen einer längst vergangenen Zeit umkreist werden, so rauscht, einer noch älteren Zeit entquollen, ein mächtiger Strom der schönsten Sagen um alle Orte des Rheintals. Da ist kein Plätzchen, an dem die Sage nicht weilte. Von großen Königen und tapfern Helden, von holden Jungfrauen und schrecklichen Drachen, von guten und bösen Geistern weiß ihr Mund zu erzählen und Berg und Tal, Burgen und Kirchen, Städte und Dörfer in den Zauber ihrer Dichtungen zu verweben. Wo der Rhein das Hochland durchbricht, um in das Flachland zu treten, steht als Grenzstein das Siebengebirge, in einer Gegend, die noch einmal allen Zauber, die der herrliche Strom von Mainz bis Bonn in so reicher Fülle aufzuweisen hat, in sich vereint. Dort, in jenem Paradiese des Rheins, erhebt fast unmittelbar aus dem Strome der Drachenfels »wie ein erzgepanzerter Riese das helmbewehrte Haupt«, und dort war es, wo, wie die Sage erzählt, Siegfried den Drachen erschlug. Dem Drachenfels gegenüber erheben sich die Ruinen von Rolandseck, einst eine Klause, in der Roland um die schöne Hildegund trauerte. Zwischen Drachenfels und Rolandseck liegt mitten im Rheine eine Insel, auf der das Kloster stand, in das Hildegund sich von der Welt zurückgezogen hatte, um nur dem Himmel zu leben. Und wie die Sage die Heldengestalt eines Roland und Siegfried mit mehreren Orten am Rheine in Verbindung gebracht hat, unter anderen auch mit Worms, wo der Nibelungen oft gedacht wird, so hat sie auch die Heldengestalt Karls des Großen an mehr als einem Ort verherrlicht: in Aachen, in Köln, in Frankfurt, in Rüdesheim usw. Wem wäre ferner die Sage vom Mäuseturm bei Bingen unbekannt; wer kennte nicht, wenn auch nur aus Heines reizendem Gedichte, die Sage vom Loreleifelsen bei Kaub?
Denkmale aus der Zeit der Römer führt uns der Rhein ebenfalls in reichem Maße vor. Noch jetzt werden alljährlich an seinem Ufer aus dem Schoße der Erde römische Münzen, Grabsteine, Spangen, Hausgeräte usw. ausgegraben. Verdanken doch viele Städte, wie z. B. Köln, Mainz, Straßburg, ihre Entstehung geradezu den Römern, und so spiegeln die Fluten des Rheins jedes Blatt der Geschichte unseres Vaterlandes wider. Wohl mag der Nil eine ältere Geschichte aufzuweisen haben, aber so reich an historischen und mythischen Erinnerungen ist er nicht, ist überhaupt kein Fluß der Erde. Nimmt man dem Nil seine Pyramiden und Obelisken, seine Sphinxe und Mumien, was bleibt ihm noch? Er hat längst seine Blütezeit in Sand und Schlamm vergraben, ist längst mit seiner Geschichte zur Mumie geworden, während der Vater Rhein ewig jung geblieben ist und durch alle Jahrhunderte bis auf die Gegenwart die edelsten Blüten der Kultur in seinem Schoße entfaltet hat. »Das ganze Mittelalter hindurch hat er den vornehmsten Schauplatz der deutschen Geschichte hergegeben, alle Schicksale unseres Volkes sind an ihm entschieden worden, und wäre seine Vergangenheit nicht so reich und groß, könnten wir alles auslöschen, was auf den Blättern der Geschichte von dem Rheinlande geschrieben steht, so würde die Gegenwart den rheinischen Boden von neuem zu klassischem stempeln.«
Doch der Rhein zeichnet sich auch noch in anderen Beziehungen aus. Jeder vollkommen entwickelte Fluß muß in seinem Laufe drei Stufen aufzuweisen haben: einen Oberlauf, einen Mittellauf und einen Unterlauf. Dem Amazonenstrome, diesem Riesen unter den Strömen, fehlen diese, und so wenig er sich in kulturgeschichtlicher Hinsicht mit dem Rheine messen kann, so wenig kann er es auch, was Ebenmaß und Gliederung betrifft. Der Oberlauf des Rheins liegt im mittleren Teile der Alpen und der Vorderrhein beginnt am St. Gotthard. Die Quellen des noch wasserreicheren Hinterrheins hängen hoch oben an den himmelhohen Felsgipfeln des Rheinwaldgletschers, liegen also hier und dort der italienischen Grenze ganz nahe. Mehr als dreihundert Gletscher senden ihm aus dem Reiche der Wolken und Stürme, des Eises und des Schnees ihre tobenden Gewässer zu. Raschen Laufes stürzen sie über graue Felsblöcke und schwarze Schlünde und läutern sich in etwa fünfzehn kleinen Seen, die noch in dem oberen Stockwerke der Alpen liegen, wo nur der Schrei des Adlers und der Donner der Lawinen die schaurige Stille unterbricht. Später in einem Bette vereint, eilen sie den tieferen Tälern der Alpen zu. Immer reicher wird die Ausstattung der Umgebung, immer belebter Ufer und Wasser. Statt der Eiskronen und Eisurnen, der Gletschermeere und Schneehörner erscheint der bunte Teppich der grünen Matten der mittleren Alpen. Ansehnliche Ortschaften treten nun auf: die Stadt Ilanz, die höchstgelegene, der Flecken Reichenau, wo Vorder- und Hinterrhein zusammenkommen, Chur, die Hauptstadt Graubündens, Ragaz, der berühmte Badeort usw., bis der tief gelegene, sieben Meilen lange und beinahe zwei Meilen breite, mit Städten reich bekränzte Bodensee den Fluß aufnimmt. In ihm beruhigt und läutert er sich. Bei dem Orte Stein verläßt er den See wieder und fließt westwärts nach Schaffhausen, wo er den weltberühmten Wasserfall bildet. Bald darauf empfängt er das schöne Alpenkind, die Aar, die ihm die Limmat und die Reuß zuführt. Diese, durch Schiller in seinem Bergliede, wie in seinem Tell verherrlicht, bahnt der herrlichen Gotthardstraße den Weg, die in unzähligen Windungen und Zickzacklinien bald auf der rechten, bald auf der linken Seite dieses Flusses hängt, ängstlich seinem wilden Lauf folgend. So viel Sanftes und Wildes, so viel Liebliches und Grausiges hat die Natur an dem Oberlaufe keines deutschen Flusses ausgegossen als am Rhein. Die Eisenbahn, die in seinem steinigen Bette entlang von Chur bis Rorschach führt, gehört wohl zu den schönsten. Man hat hier die ganze Romantik der Alpenwelt, wie in dem mittleren Laufe des Flusses die der deutschen Kaiser- und Ritterzeit und das ganze katholische Mittelalter. Bei Basel verläßt der Rhein die Schweiz; sein Lauf ist nun weniger ungestüm. Da, wo sich die beiden ersten, von hohen Gletschern herabschießenden Bäche des Rheins bei Schamut vereinen, ist seine Seehöhe 1730 m. Bis Reichenau, wo der Hinterrhein hinzutritt, also auf einer Strecke von nur 60 km, beträgt sein Gefäll 1144 m, denn die Seehöhe des Flusses bei Reichenau ist 586 m. Von hier aus bis zum Bodensee fällt er noch über 180 m, denn der Spiegel dieses Sees liegt 395 m über dem Spiegel der Nordsee. Bei Basel hat er nur noch 246 m Seehöhe und also auf seinem langen Laufe bis zur Nordsee nur geringen Fall. Zwar ist zwischen Basel und Straßburg die Bergfahrt immer noch beschwerlich, aber doch gehen auf dieser Strecke schon Kähne von 5-600 Zentnern Ladung, und während der Sommeranschwellungen des Stromes verkehren neuerdings flachgehende Schleppdampfer bis Basel. Auf der Strecke von Straßburg bis Mannheim geschieht der gesamte Gütertransport bereits durch einen regelmäßigen Dampfschiffsverkehr, und die größten Kähne, die die Fluten auf diesem Stromabschnitt abwärts tragen oder die Dampfer aufwärts schleppen, haben schon die stattliche Tragfähigkeit von 1600 t oder 32 000 Zentnern. Von Mannheim abwärts findet die Rheinschiffahrt in dem großen Maßstabe statt, wie sie von hier bis Rotterdam und umgekehrt betrieben wird. Von Köln aus endlich fahren die Schiffe direkt hinaus in den Ozean nach allen Häfen der Nord- und Ostsee.

Weinbau im Rheinland (Ahrtal).
Nach einer Photographie der Neuen Photographischen Gesellschaft, Steglitz.
Bei seinem Eintritte in das Mittelgebirge Deutschlands verläßt der Rhein die westliche Richtung. Plötzlich nach Norden sich wendend, tritt er zwischen dem Jura und den Vogesen in eine Tiefebene ein, die gegen 300 km lang ist und in den sie einrahmenden Gebirgen ein Ebenmaß zeigt, wie wir solches auf der ganzen Erdoberfläche nicht leicht wiederfinden. Auf der Ostseite der Ebene erhebt sich, von Süden nach Norden gehend, der Schwarzwald mit seiner Fortsetzung, dem Odenwalde; auf der Westseite streichen parallel mit dem Schwarzwalde die Vogesen. Wie in der Richtung, so zeigen auch in anderen Stücken diese Gebirge eine merkwürdige Ähnlichkeit. Beide, der Schwarzwald wie die Vogesen, steigen sogleich im Süden achtunggebietend empor, sinken gegen die Mitte und erstreben dann weiter nördlich noch einmal eine größere Höhe, die jedoch dem südlichen Teile nicht gleichkommt; beide fallen steil nach der Rheinebene ab, allmählich nach den angrenzenden Hochflächen, der Schwarzwald nach Schwaben, die Vogesen nach Lothringen; beide haben eine gleiche Bewaldung, indem die hohe schlanke Fichte der vorherrschende Baum ihrer Wälder ist; beide werden endlich von einem Flusse umströmt, der Schwarzwald vom Neckar, die Vogesen von der Mosel.
Tiefe Gebirgslücken, tiefe Einschnitte und schiffbare Flüsse sind die natürlichen Straßen, die aus der 22-44 km breiten Rheinebene hinausführen. Der Rhein selbst führt aufwärts nach Schwaben und zum Bodensee, abwärts in das Innere des Rheinischen Schiefergebirges und in die Ebenen des nördlichen Deutschlands. Die wichtigste Gebirgslücke auf dem linken Rheinufer ist zwischen den Vogesen und dem Jura. Hier kämpfte Cäsar mit den Deutschen; hier nahm Fürst Schwarzenberg im Jahre 1814 seinen Weg nach Frankreich, hier standen sich im Januar 1871 Bourbaki und General von Werder gegenüber. Straßen, Eisenbahnen und sogar ein Kanal zum Doubs und der Rhone führen durch diese Lücke hindurch und verbinden das Mittelländische Meer mit der Nordsee. Von hier an bleibt aber die Kette der Vogesen undurchbrochen. Kurze Täler geleiten auf die Höhe, aber nicht hindurch. Nur beschwerliche Pfade führen hinüber zur Saar und zur Mosel. Erst der Paß von Zabern am nördlichen Ende des Gebirges erlaubt der Eisenbahn und dem Rhein-Marnekanal den Durchgang nach dem lothringischen Plateau. Weit mehr durchbrochen ist dagegen die östliche Gebirgsreihe. Quer durch die höheren Bergrücken des Schwarzwaldes senken sich einige große Seitentäler hinab zum Rhein. Durch das Höllental und durch das Tal der Kinzig ziehen Landstraßen und Eisenbahnen ohne Schwierigkeiten bis zum Bodensee und nach Schwaben. Sie gehen über die höchsten Gegenden des Schwarzwaldes. Auch das Murgtal durchschneidet das Gebirge. Ganz offene Verbindungen bietet die große Gebirgslücke zwischen Schwarzwald und Odenwald dar. Sie führt zum Neckar und Main und tiefer nach Schwaben und Franken. Zwischen Spessart und Odenwald tritt der Main hinaus in den großen nordöstlichen Busen der Rheinebene. Er bietet eine natürliche Wasserbahn, die bis an den Fuß des Frankenwaldes und des Fichtelgebirges leitet und sich den Flußgebieten der Donau, der Weser und der Elbe nähert. In dem nordöstlichen Busen der Rheinebene liegt so recht im Herzen des ganzen Rheingebiets Frankfurt und in seiner Nähe Mainz, beide gleich wichtig und gleich bedeutend. Kein Wunder, daß in dem großen, schönen Becken, das vom Main und Rhein gebildet wird und das man mit Recht Wonnegau genannt hat, zwei solche Städte erblühten. Kreuzen sich doch hier Land- und Wasserstraßen von Norden und Süden, von Osten und Westen. Der Kaufmann und der Krieger haben von jeher diesen Punkt, der seinesgleichen in Deutschland nicht wieder findet, im Auge gehabt. Schon die Römer erkannten die Wichtigkeit dieses Punktes und bestimmten ihn zu ihrem vornehmsten Waffenplatze, von wo aus sie bequem zu Wasser und zu Lande nach den verschiedensten Richtungen hin ihre Legionen vorrücken lassen konnten. Später bildete Mainz den Mittelpunkt des Rheinischen Städtebundes und erhob sich zu einer kirchlichen Metropole, deren Sprengel beinahe halb Deutschland umfaßte.
Wie im Nordosten die Rheinebene eine Verbindung mit den Main-, Weser- und Elblanden eröffnete, so bietet sie im äußersten Südwesten ein Tor zu dem Gebiete der Saone-Rhone, und wie dort Mainz und Frankfurt, so hat hier Basel durch seine Lage eine große Wichtigkeit erlangt. Zur Blütezeit des Deutschen Reiches gehörte Basel zu den ansehnlichsten und reichsten Handelsplätzen und war die wichtigste freie Reichsstadt am Oberrhein. Basel ist eine Flußstadt, die an dem Scheitel des Stromwinkels liegt, der ungefähr gleich einem rechten ist. Es ist die vorteilhafteste Lage, die ein Fluß einer Stadt bieten kann. Alle Waren des Rheins, die über Schaffhausen usw. herabkommen, werden von Basel teils auf dem Rheine weiterbefördert, teils ausgeladen, wenn sie nach dem Westen, nach Frankreich gesendet werden sollen; kommen die Waren den Rhein herauf, so treten sie ebenfalls bei Basel aufs Land über, wenn sie nach Bern und überhaupt nach der südwestlichen Schweiz gehen sollen. So kreuzen sich auch hier Land- und Wasserstraßen, wie im Nordosten der Rheinebene.
Die Ebene selbst, wahrscheinlich einst ein See, bildet eine fast wagerechte Fläche. Nur in der Nähe von Freiburg erhebt sich inselartig eine kleine bewaldete Gruppe von Bergen, der Kaiserstuhl genannt, ein Lustgarten für die Umgegend und eine herrliche Warte zum Überschauen der reichen, offenen Landschaft, die überall gut angebaut, mit Städten und Dörfern gesegnet ist. Der beste Fruchtboden lagert am Fuße der Berge. Hier wechseln treffliche Weingärten und Obsthaine in üppigster Fülle miteinander ab; ja Mandeln und süße Kastanien sieht man an den warmen unteren Abhängen der Berge, während höher hinauf altes Burggemäuer, mit Efeu und wildem Weine umkränzt, in die Ebene schaut. Herrliche Wiesengründe breiten sich mit mildem Glanze selbst noch in den hochgelegenen Tälern aus. Ihr Teppich bringt einen neuen Wechsel in das dunkelfarbige Grün der majestätischen Edeltanne, die oft tief ins Tal hinabsteigt und sich dort mit ihren weißen Stämmen und silbernen Nadeln in den Kastanienwäldern verliert. Dicht am Fuße des Gebirges ziehen auch die Landstraßen und Eisenbahnen hin. An den Ufern des Rheins wehren Dämme den Überschwemmungen. Mächtige Tannen, zu Riesenflößen verbunden, schwimmen hier den Rhein hinab nach den Niederlanden, um dort reichen Städten feste Unterlagen, schwellenden Segeln Stützen zu gewähren. Die Flöße, die so charakteristisch für den Rhein sind, haben oft den Wert von je 5-900 000 Mark. Die zu 4-5 Lagen übereinander geschichteten Stämme gehen 2 m tief im Wasser, Bretter, Bohlen und andere zum Schiffsbau nötige Stücke sind darauf geladen. Am vorderen und hinteren Ende sind 20-22 Ruder, die sämtlich durch kräftige Männer in roten Westen und weißen Hemdsärmeln regiert werden. Außerdem führt das Floß noch Masten und Segel und alle Lebensmittel für die ganze Reise. Nicht selten sind 500 Mann, Fleischer, Bäcker, Köche und Aufwärter mit eingerechnet, auf einem solchen schwimmenden Walde. Für Holz tauscht der Schwarzwälder das Brotkorn ein, das ihm sein Boden auf den Bergeshöhen verweigert. Seine Holzschnitzereien, seine Uhren und Strohhüte gehen durch ganz Deutschland, ja nach Amerika. Die Wohnungen der kräftigen, gesunden und wackeren Bergbewohner, die Berthold Auerbach dichterisch verklärt hat, liegen in wildschönen Tälern zerstreut umher. Mit ihren weit hervorspringenden Dächern und herumlaufenden Gängen erinnern sie an die Schweizerhäuser in den hohen Alpen. Keine dieser Hütten ist ohne plätschernden Brunnen, und nicht selten steht eine kleine Kapelle daneben mit einem Glöckchen zum Morgen- und Abendgebete.
Das schönste Kleinod der Rheinebene ist Straßburg mit seinem Münster. Fast in der Mitte der Ebene gelegen, steigt dieser wundersame Bau hoch und ernst in die Luft empor. Straßburg, einst eine starke Vormauer des heiligen römischen Reiches, von dem Kaiser Karl V. äußerte, daß, wenn Straßburg und Wien zu gleicher Zeit belagert würden, er zuerst Straßburg retten würde: Straßburg war auf die schmachvollste Weise in die Hände des uralten Feindes von Deutschland, an die Franzosen, gekommen. Dadurch hatte Frankreich sich das ganze Rheinbecken offen erhalten und hatte sozusagen »einen Keil mitten in unser Herz gebohrt«. Nirgends in der Welt gibt es aber eine Landschaft, die von der Natur mehr als etwas ganz und gar Zusammenhängendes geschaffen wurde, wie das Rheintal zwischen Schwarzwald und Vogesen. Derselbe Menschenstamm, derselbe Boden, dieselben Erzeugnisse und eine gemeinsame geschichtliche Entwickelung von zwei Jahrtausenden. Diesen geschichtlichen Faden hat Ludwig XIV. durchschnitten. Aber seit den großen Kämpfen der vereinigten deutschen Völker ist er wieder angeknüpft worden. Auch die übrigen Stücke am Rhein, welche uns von diesem herrlichen Flusse verloren gegangen waren, sind durch jene Großtaten wieder mit dem Deutschen Reiche vereinigt worden.
Gänzlich verschieden von der Rheinebene ist die Gegend, die der Fluß, wenn er den Hunsrück und Taunus durchbrochen hat, in seinem weiteren Laufe durchströmt. Zwischen engen Felswänden eingeklemmt, ohne breite Talebene, rauscht er stolz und majestätisch dahin bis zum Siebengebirge. Von da an begleiten ihn nur noch auf der rechten Seite die Berge bis gegen die Mündung der Ruhr. Dichter und Reisende haben ihn, wo er von Bingen bis Bonn das Gebirge durchströmt, vielfältig und nie zu sehr gepriesen. Die Berge enthüllen hier ihren innersten Gliederbau und zieren ihn mit prächtigen Felsgruppen; die Rebe breitet sich an seinen Ufern aus und hat selbst die gefährlichsten Stellen erklettert, um ihn von den Felsen herab noch mit schönen Weingeländen zu schmücken und an der milden Sonne köstliche Trauben zu reifen; hohe, prachtvolle Walnußbäume beschatten die schmalen Ebenen am Strome; alle Arten von Obstbäumen schütten im Sommer und Herbst ihren reichen Segen in großer Fülle aus und bezaubern im Frühjahre durch eine unvergleichliche Blütenpracht; Städte und Felsenschlösser, mächtige Festen und herrliche Kirchen, Klöster und Landhäuser zieren die Ufer des Flusses, während auf der Wasserfläche sich die Wolken der stolz einherschwimmenden Dampfschiffe hoch in die Luft wälzen.
Die ganze rheinische Berglandschaft, welche sich bis zu einer Höhe von 700 m erhebt, wäre eine sehr einförmige, wellige Ebene, wenn sie nicht von tiefen Tälern in ihrer ganzen Ausdehnung durchschnitten würde. Während auf den Hochflächen nur Kornbau, oft nur Hafer gedeiht, schmücken Obsthaine und Weinreben die sanften Abdachungen, wie die steilsten Bergwände der tief eingeschnittenen Täler. Die Bäche bewässern schmale Wiesengründe, treiben Mühlen oder Hammerwerke. Diese engen Täler sind reizende Oasen, denen die geschütztere Lage ein milderes Klima verleiht als den hochgelegenen Umgebungen. Sie haben sich mit blühenden Ortschaften und wohlhabenden Städten angefüllt. Es sind außer dem Rhein namentlich die Lahn, Sieg, Ruhr und Lippe, die das rheinische Hochland in verschiedene Gebirgslandschaften spalten. Etwas dem Verwandtes suchen wir vergebens bei den übrigen deutschen Strömen. Keiner von ihnen hat ein so regelmäßig gespaltenes, von parallel gehenden Flüssen durchfurchtes, mit so kostbaren Schätzen der Ober- und Unterwelt so mannigfach ausgestattetes Gebirgsland aufzuweisen. Im Siegenschen Lande sieht man überall den Boden von Stollen durchwühlt, sieht man Rauchwolken an Rauchwolken aus den Hüttenwerken aufsteigen und hört überall bergmännischen Gruß und bergmännische Gespräche. Im Ruhr- und Wuppertale reiht sich ebenfalls Fabrikort an Fabrikort. Das Gebiet der Lahn dagegen ist reich an berühmten Heilquellen. Tausende von Gästen, aus den reichsten und vornehmsten Klassen aller Teile von Europa, suchen in Ems, Wiesbaden, Schwalbach, Schlangenbad Heilung; Millionen von Wasserkrügen von Selters, Fachingen usw. bringen selbst über den Ozean hin eine erwünschte Erquickung. So zeichnet sich das Rheinische Schiefergebirge durch eine Fülle der Produktion, durch einen Wechsel der Landschaften und des Klimas aus, wie eine solche Mannigfaltigkeit weder auf der Südseite der Alpen im heißen Tieflande des Po, noch in der rauhen Hochfläche der oberen Donau zu finden ist.
Nachdem der Rhein das Schiefergebirge verlassen hat, teilt sich der mächtige, 600 m breite Strom Bei Duisburg beträgt die Breite 655 m, bei Rees sogar 715 m; bei Schaffhausen hat der Rheinstrom nur 150 m Breite. in mehrere Arme und schüttet durch diese eine Wasserfülle in den Ozean, wie kein zweiter deutscher Fluß. Das Deltaland, das zwischen seinen weit ausgebreiteten Armen liegt, verdankt seine Entstehung recht eigentlich deutscher Erde, die von alters her der Rhein hier absetzte. Noch jetzt trägt er so große Erdmassen in seinen Wellen fort, daß man jährlich 600 Millionen Ziegelsteine daraus gewinnen könnte. Einst hieß das Meer, in welches er mündet, das deutsche Meer. Das Nordseegestade ist der Ursitz des germanischen Stammes, und bis 1648 hatte das heilige Deutsche Reich hier seine wichtigste Meeresprovinz, die Niederlande. Zur Zeit der Hansa war diese zu einer solchen Blüte gelangt, daß Antwerpen seine Mauern hinausrücken mußte, um die Menge der aus aller Welt zuströmenden Menschen aufnehmen zu können, da an Markttagen nicht selten 800 Schiffe in seinen Hafen einliefen. Amsterdam vermochte ein Stadthaus zu bauen, das 36 Millionen Mark kostete, und Brügge war so bedeutend, daß alle Handelsvölker Gesandte dort hielten. Auch jetzt noch zeichnen sich die Niederlande durch ihren Handel wie durch ihre Fabriken aus. Überall weben und spinnen die Maschinen in den zahlreichen Städten, in allen Kanälen und Flüssen steuern schwerbeladene Schiffe, und aus den Häfen schnauben die Seerosse nach allen Richtungen.
»Wo wäre ein Strom, der eine Schweiz an seinen Quellen, ein Holland an seiner Mündung hätte? Den seine Bahn so durch lauter fruchtbare, freie, gebildete Landschaften führte? Haben andere weit größere Wasserfülle und Breite, so hat der Rhein klare, immer volle, sich fast gleichbleibende Fluten, so ist seine Breite gerade die rechte, hinreichend für Floß und Schiff, für allen Verkehr der Völker, und doch nicht so groß, daß sie die beiden Ufer voneinander schiede, daß nicht der erkennende Blick, der laute Ruf ungehindert hinüber reichte. Mächtig und ehrfurchtgebietend erscheint er, als ein bewegter Wasserspiegel in den heitersten Rahmen gefaßt, nicht als eine wässerige Öde mit nebligen Ufern.«
»Von jeher,« sagt Simrock, »war der Name dieses Flusses ein süßer Klang in jedem deutschen Ohre. Wie oft und gerne flochten die Minnesänger ihr sehnsüchtiges »alumbe den rîn« ihren schönsten Liedern ein, zuweilen ohne weiteren Grund, nur um des lieben Namens willen. Heute noch, wenn man in dem Rheinweinliede des trefflichen Matthias Claudius an die Stelle kommt, wo es heißt: ›Am Rhein, am Rhein!‹ wie stimmen da alle Kehlen vollkräftig mit ein, wie klingen alle Römergläser an, wie schüttelt der Deutsche dem Deutschen die Hand, wie fühlen sich alle Teilnehmer des Festes, so zufällig sie zusammengekommen seien, in dem Gedanken an den geliebtesten unserer Ströme befreundet und verbrüdert.«
»Ja, der Rhein ist uns ein heiliger Strom, und seine Ufer sind die wahre Heimat der Deutschen, der ehrwürdige Herd aller deutschen Kultur. Was dem Inder der Ganges, das ist dem Deutschen der Rhein. Religion, Recht, Kunst und Sitte haben sich von ihm aus über die Gaue unseres Vaterlandes verbreitet!« Darum ist es unsere heilige Pflicht, Gut und Blut einzusetzen, sollte je sein Besitz uns streitig gemacht werden.
Wenn wir im Schnellzug unter vollem Dampf von Mülhausen nach Straßburg das Land rasch durchziehen, so überschauen wir mit einem Blick die Gestaltung des elsässischen Bodens. Dieser stellt sich in drei voneinander unterschiedenen Zonen dar. Im Westen erhebt sich die Gebirgskette der Vogesen – der Wasgenwald unserer deutschen Altvordern, der Wasichenstein der Sage – Der römische Name Mons Vôs?gus wurde von den Franzosen in les Vosges umgebildet, woraus die Deutschen wieder »Vogesen« machten. gleich einem natürlichen Wall zwischen dem Innern von Frankreich und dem Becken des Rheins. Ein Saum von Hügeln und Weinbergen umfaßt den Fuß der Kette, den Übergang bildend von der höhern Region zu der Ebene. Dann dehnt sich das Flachland selbst aus, einförmig, niedrig, eben, dem Rhein entlang ziehend in einer Länge von 200 Kilometern oder 27 deutschen Meilen, von Basel bis Lauterburg, die Hügelregion und den zu Elsaß gehörenden Teil der Vogesen zusammen an Flächeninhalt übertreffend.
Diese drei Zonen sind durch geognostische Beschaffenheit, durch den Anbau, wie durch die äußere Gestalt des Bodens scharf getrennt. Jede hat ihr eigentümliches Klima, ihre eigentümliche Pflanzendecke. Im Hochgebirge sehen wir nur Wald und alpenähnliche Weiden; die Hügelregion ist mit Reben bedeckt, das Flachland hat besonders Getreidebau.
Dem Rhein parallel, das Elsaß von Süden nach Norden durchströmend, läuft die Ill oder die Ell (lateinisch Alsa), die Land und Leuten den Namen gegeben hat: Elsassen oder Elsässer. Sie entspringt im Jura, ihre Zuflüsse empfängt sie aber alle auf der linken Seite von den Vogesen. Ihr Wasserstand ist sehr ungleich; auf lange Trockenheit folgen Überschwemmungen. Ein oberelsässisches Sprichwort lautet: »Die Ell geht wo sie well!«
Der Boden der elsässischen Ebene erhebt sich kaum einige Meter über den Rhein, dessen Meereshöhe in Kolmar 200, in Straßburg nur 144 m beträgt. Er besteht aus Lehm, Sand oder kleinen Rollsteinen, die teils durch den Rhein, teils durch die Ill und ihre vogesischen Zuflüsse abgelagert wurden. Eine schwache Bodenfalte, auf deren Rücken sich der Rhône-Rhein-Kanal von Süden nach Norden hinzieht, bezeichnet die Grenze zwischen den Diluvialgebilden von vogesischem Ursprung und denen des Rheins, dessen Rollsteine andere sind. Wo das Geröll vorherrscht, ist der Boden dürr und trocken, mit Gebüsch bewachsen, wie im Hardtwald, im Kardenwald (Kartenwald) und in der Gegend zwischen Hagenau, Sulz und Selz. An den fruchtbaren Stellen erscheinen große Wiesen. Kommt aber der fruchtbare Lehm über die Oberfläche, so gedeihen fröhlich die Getreidefelder, mit Pflanzungen aller Art gemischt, auf beiden Ufern der Ill, von Mülhausen bis unterhalb Straßburg.
Ein gesegnetes Land ist dieses Flachland des Elsasses; allein die mittlere Hügelregion erfreut sich eines noch reicheren Wohllebens. Vor allem wird dort der Weinbau getrieben. Nirgends gibt der Boden einen so hohen Ertrag, nirgends hat er einen so hohen Wert. Prachtvolle Reben bedecken die unteren Bergabhänge und ziehen sich am Eingange der Täler unter der erwärmenden Mittagssonne hin, bis auf eine Höhe von mehr als 400 m ü. M. Die Meereshöhe der Hügelregion schwankt meistens zwischen 300 und 400 m. Die Hügel liegen teils wellenförmig am Fuße des Gebirges, teils strecken sie sich wie Vorgebirge der Ebene entgegen. Sie bieten die schönsten Blicke in die lachende Rheinebene und in die grüne Romantik des Berglandes; eine Menge von Schlössern prangen eines neben dem andern, an das alte Wort erinnernd:
Drei Schlösser auf einem Berg,
Drei Kirchen auf einem Kirchhof,
Drei Städte in einem Tal
Hat ganz Elsaß überall!
Diese Hügelregion, 1-3 km breit, erweitert sich gegen Norden zwischen Zabern und Weißenburg, aber auch im Sundgau zwischen Thann, Belfort und Mühlhausen, wo sie das ganze südliche Elsaß bis zu den ersten Stufen des Juragebirges einnimmt. Sie besteht meist aus Tertiärbildungen (Grobkalk, Süßwasserkalk), bisweilen aus Sandstein oder Kalkschichten des Jura und Buntsandstein.
Durch tiefe Täler erheben wir uns über die Weingaue und betreten das Innere der Bergregion. Grüne Wiesen, die sich längs der rauschenden Gebirgsbäche ausdehnen, deuten hier besonders auf Viehzucht. Auf die Wiesen folgt Wald, dann wieder Alpenweiden oder kahle Felsstürze. Der obere Teil der Vogesen ist ganz von unübersehbaren Waldungen und stellenweise mit Weiden bedeckt. Die strenge Witterung erlaubt kaum auf einigen gut geschützten Abhängen den Anbau von kleinen Korn- und Kartoffelfeldern, auf den höchsten Gipfelflächen liegt der Schnee von Anfang Oktober bis in den Mai hinein.
Wie im Schwarzwald, gegenüber auf der andern Seite des Rheins, finden sich auch im Wasgenwald auf den höchsten Flächen, von finstern Tannenwäldern umgeben, kleine dunkelfarbige Seen; einige, wie der Sternsee und der Weiße See, zeichnen sich durch die karartige Gestalt ihrer Becken aus; die Bergbewohner behaupten, sie hätten eine unermeßliche Tiefe und reichten bis zu den untersten Abgründen des Meeres. Die meisten dieser kleinen Seen verdanken ihre Entstehung wahrscheinlich den Gletschern, welche während der Eiszeit auch in die Täler der Vogesen hinabstiegen und dort unverkennbare Spuren ihres Daseins zurückließen – geritzte Rollsteine und moränenartige Steinwälle.
Die Masse der oberen Vogesen, von vorwiegend kristallinischer Beschaffenheit, hat abgerundete Kuppen von bedeutender Höhe (der Elsässer Belchen hat 1244 m; der Große oder Sulzer Belchen bei Gebweiler 1426 m). Der mittlere Wasgenwald ist wie der untere Schwarzwald ein breitrückiges Buntsandsteinplateau, das sich nach Norden abstumpft. Die Täler \der Hochvogesen sind tief eingeschnitten, und in ihrem unteren Teile herrscht große Fruchtbarkeit, wenn auch die Dörfer nicht die Größe und Bedeutung derer in der Rheinebene erreichen.
Die Bewohner des Elsaß entstammen in der Hauptsache einer Mischung zweier Rassen, der der schwarzhaarigen und dunkeläugigen Kelten und der blondhaarigen und blauäugigen Germanen. Schwarzes und blondes Haar, helle und dunkle Augen halten sich heute ungefähr das Gleichgewicht, jedoch scheint nach Körpergröße und Gestalt das germanische Element zu überwiegen. Die Sprache der Elsässer ist das Deutsche, und zwar im Oberelsaß die alemannische, im nördlichen Unterelsaß die fränkische Mundart. Nur ein kleiner Bruchteil der Bewohner spricht das Französische als Muttersprache, meist aber nicht ein reines Französisch, sondern jenes kelto-romanische Platt, Patois genannt, das besonders in den Hochtälern der Vogesen, so im oberen Bechine-, Weißheber- und Weilertal, sich noch erhalten hat.
In dem fruchtbaren angeschwemmten Boden der Ebene hat deutscher Fleiß die Landwirtschaft auf einen hohen Grad der Entwicklung gebracht. Kein Stück Boden bleibt unangebaut. Schachbrettartig reihen sich die buntfarbigen Felder der Ebene in ungezählten schmalen Äckern aneinander. Die Kirchtürme der zahlreichen Städte und Dörfer ragen aus einem breiten Kranz von Obsthainen und Gärten empor. Über die Hälfte des Landes ist mit Getreide bepflanzt. Getreidearten, die einem armen Boden eigentümlich sind, finden sich nicht. Überwiegend wird Weizen gebaut, weniger Gerste, Roggen und Hafer. Das Elsaß gehört zu den besten Hopfenländern unseres Vaterlandes und erzeugt etwa 20 Prozent der gesamten Ernte Deutschlands. – Auch Tabak, Zuckerrüben, Flachs, Hanf und Raps werden in vorzüglicher Qualität auf großen Flächen der Ebene gebaut.
Von hervorragender Bedeutung für das Elsaß ist der Weinbau, der 27 000 ha oder mehr als 3 Prozent des gesamten Flächeninhaltes des Landes einnimmt. Er bedeckt vor allem die den Vogesen vorgelagerte Hügelregion, geht aber gelegentlich auch weit in die eigentlichen Gebirgstäler hinauf. Zahlreiche alte Weinsprüche rühmen besonders die edlen Eigenschaften Oberelsässer Weine, eines »Thanner Rangen«, »Gebweiler Kitterle«, »Rappoltsweiler Riesling« und anderer. Viehzucht wird vorzugsweise in der Hügelregion und auf den Hochweiden des Gebirges, dort in der Form der Sennwirtschaft, mit Erfolg betrieben. Der Holzreichtum, den die prachtvollen Nadelwälder der Vogesen bergen, ist seit dem Einsetzen der planvollen Forstverwaltung unter der deutschen Herrschaft eine ständig steigende zuverlässige Einnahmequelle des Landes geworden.
Die Bevölkerungsdichte ist bedeutend, denn es kommen im Durchschnitt auf das Quadratkilometer im Unterelsaß 143, im Oberelsass 146 Bewohner. Natürlich wechselt sie vom Flachland bis auf die höheren Lagen im Gebirge; in der Ebene und besonders in der Weinzone der Hügelregion ist sie am größten, während man in den hohen Tälern nur etwa achtzig Bewohner auf dem Quadratkilometer zählt.
Die größeren Städte fallen alle auf das Flachland: Straßburg, Mülhausen, Kolmar, Schlettstadt und Hagenau. Die ehemalige Reichsstadt Straßburg (1905: 168 000 Einw.) entstand an der Vereinigung der beiden Flüsse Ill und Breusch, 3 km vom Rheine entfernt, der sich hier auf eine kurze Strecke zu einer Stromenge mit festen, sumpflosen Ufern zusammendrängt, also leicht zu überbrücken war, und dessen Schiffbarkeit erst hier eigentlich beginnt. Gleichzeitig liegt die Stadt am Eingang der Zaberner Stiege, des wichtigsten Passes, der quer durch die Vogesen führt und den der Rhein-Rhône-Kanal, sowie die von Straßburg nach Paris führende Eisenbahn benutzt. Wegen seiner beherrschenden Lage im mittleren Teile der Rheinebene ist Straßburg seit alters stark befestigt. Die innere Stadt zieren zahlreiche alte Bauten, allen voran das herrliche Münster (142 m), ein Werk des deutschen Meisters Erwin von Steinbach und eine der edelsten Blüten gotischer Baukunst.
Daß die Elsässer nicht nur im Ackerbau und im Obst- und Weinbau, sondern auch in der Industrie eine der höchsten Stufen unter allen europäischen Völkern erreicht haben, ist weltbekannt. Billige Arbeitslöhne infolge der Anzahl unbeschäftigter Bewohner, entwickelten frühzeitig größere Gewerbsanstalten in den Tälern des Elsasses und der Vogesen. Anfangs wurde die Baumwolle von der Hand gesponnen und gewebt; damals fand die Fabrikation besonders in dem geringen Lohn der Handarbeit ihren Vorteil. Als später die mechanischen Kräfte (Maschinen) die Oberhand gewannen, wurden die vereinzelten Werkstätten durch gemeinsame ersetzt, und die Fabrikanlagen ließen sich am laufenden Wasser nieder.
Bald aber reichte die Triebkraft des Wassers nicht mehr aus, zumal da die Bergströme, die von den Vogesen herabfließen, sehr veränderlich sind in ihrer Wasserfülle. So nahm man zu Dampfmaschinen seine Zuflucht. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, für solche größere Fabrikanstalten die Ebene zu wählen, weil diese durch die Nähe der Eisenbahn die wohlfeilste Fracht für Kohlen und Baumwolle ermöglichte. Städte wie Mülhausen, Sennheim, Kolmar laufen den Vogesenorten den Rang ab. Aber es dauerte nicht lange, so brachte der wachsende Reichtum und die immer mehr zunehmende Entwickelung der Fabriken es dahin, daß auch Eisenbahnen in die Gebirgsgegenden geführt wurden, welche diese mit der Hauptbahn von Mülhausen nach Straßburg verbanden. Damit wanderte die Fabriktätigkeit wieder in die Vogesentäler hinein, deren Wasserkräfte durch den Bau von Stauweihern – die Seen des Hochgebirges haben einen nutzbaren Inhalt von 7 Millionen cbm – zu vermehren, sich die Regierung in den letzten Jahren besonders angelegen sein läßt.
Die Wichtigkeit der Baumwollenindustrie überragt jede andere im Elsaß. Sie beschäftigt über 70 000 Personen oder 8 % aller Erwerbstätigen des Landes und kann sich getrost mit den Betrieben und Fabrikaten Englands messen. Nach der Spinnerei, Weberei und Druckerei der Baumwolle kommt die Fabrikation der wollenen Tücher, der Stoffe aus Wolle und Baumwolle, aus Garn und aus Seide, danach der Maschinenbau, die Fabrikation chemischer Produkte; die Wollkämmerei, die Gerberei und verschiedene Gewerbe von minderer Wichtigkeit. Wenn die Gegend nördlich von Straßburg eine unstreitige Überlegenheit besitzt durch blühenden Ackerbau, so hat sich die Großindustrie besonders an der Ill niedergelassen.
In Mülhausen, dem Hauptzentrum der Industrie, befand sich bei der Volkszählung im Jahre 1894 eine Bevölkerung von 82 000 Seelen, 1905: 95 000, ungerechnet die Bevölkerung der Nachbargemeinden, die sozusagen die Vorstädte bilden. Die gedruckten Tücher von Mülhausen zeichnen sich nicht nur durch ihren guten Geschmack aus, selbst die Erfindungen in diesem Industriezweige rühren besonders aus dem Elsaß her, obschon in England die Fabrikation gedruckter Tücher ausgedehnter ist und eine größere Menge von Arbeitern beschäftigt. Nach Mülhausen reisen Industrielle aus allen Ländern, wie nach einer Hochschule, um sich zu belehren und den Geschmack zu bilden.
Die Fabrikstadt Mülhausen wird noch lange den deutschen, österreichischen und selbst den Schweizer Fabriken zum Muster dienen. Auch mit der Erbauung einer »Arbeiterstadt«, aus beinahe 1200 kleinen wohnlichen Häusern bestehend, welche die »industrielle Gesellschaft« ins Dasein gerufen hat, um sie den Arbeitern gegen allmähliche Abtragung der Herstellungskosten zu überlassen – ist Mülhausen allen Fabrikstädten vorangegangen.
Quellen: Charles Grad, Skizzen aus dem Elsaß und Vogesen im »Ausland« 1871. – Eduard Grucker, Die Vogesen. Monographien zur Erdkunde. Leipzig und Bielefeld 1908 (Velhagen & Klasing).
Von L. H. Werner in Mülhausen i. E.
Benutzt der Reisende die Bahn von Basel nach Straßburg, so sieht er sich auf der einen Seite beständig von einem kuppenreichen Höhenzug begleitet, welcher der Rheinebene zu oft steil abfällt, oft in kleine, sich abstufende, ruinengekrönte Vorberge übergeht und dem Unterlande zu immer mehr und mehr verflacht. Diesen Gebirgswall, der eine natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich bildet und sich bei einer Länge von ungefähr 330 km und einer Breite von 40-45 km von Belfort bis in die Pfalz erstreckt, nennt man den Wasgau oder die Vogesen. Sie erreichen in Oberelsaß ihre größte Höhe und Breite, ihre Gipfel stehen aber in bezug auf großartige und majestätische Höhe denen der Schweiz nach; hingegen können sich die Vogesen, was Naturschönheit anbetrifft, mit sämtlichen mitteleuropäischen Gebirgen messen. Die wilde Romantik des Harzes, die Wellenformen der Thüringer Berge, die Wälder und Seen des Schwarzwaldes, mit dem die elsässische Kette in Richtung, Form und geologischer Beschaffenheit eine große Ähnlichkeit besitzt, die felsigen Höhen des Riesengebirges und die Granitkolosse des Fichtelgebirges trifft man hier vereinigt, selbst die Vegetation der Alpen findet sich oft in größerem Maßstabe auf diesem Gebirge.
Geologisch teilen sich die Vogesen in die oberen oder kristallinischen und niederen oder Sandsteinvogesen. Die erste Masse liegt hauptsächlich im Oberelsaß und hat abgerundete Kuppen von bedeutender Höhe, Ballons oder Belchen genannt; sie entsprechen genau den Belchen des gegenüberliegenden Schwarzwaldes. Über den Ursprung des Wortes Belchen ist schon viel geschrieben und gestritten worden; einige Geographen suchten die Erklärung des Wortes in der kuppenartigen Gestaltung der Berge, was wohl für einige Gipfel zutreffen könnte, für andere jedoch gänzlich verfehlt ist, unter anderem hat der spitze Jura-Belchen auf allen Seiten nur schroffe Abhänge, im Norden sogar eine senkrechte Felswand aufzuweisen. Andere wollen das Wort ohne genügenden Grund von »Berg« oder gar von »Balkon« ableiten. Neuerdings neigt man dazu, Belchen aus Bélén oder Bel, d. h. ein dem Sonnengotte geweihter Ort, zu erklären. In der Tat wurde in keltischer Zeit dieser Gottesdienst auf den Höhen der Berge abgehalten.
Aus der Vogelschau gesehen, lassen die oberelsässischen Vogesen deutlich zwei parallel laufende Kammlinien erkennen, während eine dritte sich auf der Westseite hinzieht, gegenüber den Buttes des Hautes Chaumes das elsässische Gebiet berührt und kurz darauf in das Unterelsaß übergeht. Die beiden ersten Gebirgszüge beginnen ungefähr in gleicher Höhe, der eine am Welschen oder Elsässer Belchen, der andere am Bärenkopf, und nehmen auf dieselbe Weise im Unterlande ihren Schluß. Beiderseits verteilen sich die höchsten Gipfel ziemlich gleichmäßig; der eine Strang bildet mit dem Elsässer Belchen (1295 m), dem Drumont (1208 m), dem Ventron (1209 m), dem Rheinkopf (1319 m), dem Hoheneck (1366 m) und den Hautes Chaumes (1306 m) den Grenzkamm, während der andere Zug mit dem Bärenkopf (1073 m), dem Roßberg (1191 m), dem großen Belchen (1424 m), dem Kahlen Wasen (1268 m) und dem Hohenack (976 m) die mittlere Linie zwischen der Grenze und den Vorhügeln der Vogesen beibehält. Diese beiden Hauptstränge sind untereinander durch Querketten verbunden und bilden deshalb nur eine Masse, deren tiefe Einschnitte und schroffe Abdachungen um so mehr auffallen, als sie auf der Westseite wenig oder gar nicht vorkommen. Charakteristische Beispiele hierfür liefern die Kesselseen und Zirkustäler des Hoheneck, der Schlucht und des Rothenbachkopfes, deren Ränder von Nadelfelsen sonderbarster Form oder von steilen und hohen Felswänden umgeben sind. Hieran schließen sich gewöhnlich die Gipfel von geringerer Höhe, welche sich dann ihrerseits verzweigen, um sich wieder um den Hauptgipfel zu gruppieren. Zwischen den Verbindungsketten liegen die Täler, die durch Einsenkungen in jener Zeit entstanden, da Vogesen und Schwarzwald nur ein Hochland bildeten. Die an die Rheinebene grenzende Vorhügellinie ist sehr unregelmäßig gegliedert, an einzelnen Stellen sogar schroff abgebrochen.
Die Vogesenkette gehört ihrer inneren Beschaffenheit nach zur Porphyrbildung; das Urgebirge besteht aus Granit und Gneis. Dieser findet sich bei Rappoltsweiler, Markirch und in Verbindung mit dem Granit in der Umgebung der Drei Ähren. Der Granit lagert hauptsächlich zwischen der oberelsässischen Grenze und dem Col de Bussang und tritt im Quellgebiete der Meurthe und Mosel sehr bedeutend auf. Ein rötlicher Granit, der auch im Masmünstertal erscheint, bildet das Massiv des Elsässer Belchens; ein grobkörniger Granit erstreckt sich vom Brézouard bis nach Rappoltsweiler. Im Süden des Gebirges und an seinen Abhängen lagern vorherrschend verschiedene Arten von Sandstein, dessen fein gewordenes Korn, mit tonartigen Teilen vermischt, den schieferartigen Sandstein Grauwacke entstehen läßt, der sich im Doller- und Thurtal und an den beiden Belchen findet, sogar sich bis ins Fechttal hineinzieht. In dem Schiefer- und Grauwackengebiete finden sich häufig Versteinerungen, Abdrücke fossiler Pflanzen, Mollusken und Korallen, die in der Gegend von Niederburbach nicht selten sind. Auf einem Vogesenhügel bei Thann liegt der sogenannte versteinerte Wald, ein alter Steinbruch, dessen Name sich auf die zahlreichen darin gefundenen versteinerten Baumstämme, Versteinerungen aus der Steinkohlenzeit, zurückführen läßt. Bei Gebweiler bestehen verschiedene Lager von Eruptivgesteinen in braunen, grauen und grünlichen Massen, die in besonders schönen Farben bei Oberburbach vorkommen.
Eine eigentümliche Verschiedenheit haben die Vogesen in bezug auf ihre beiderseitigen Täler aufzuweisen. Während auf der Westseite das Gebirge langsam abfällt und zwischen den Hügeln die Täler je nach ihrer Lage größere oder kleinere Kessel- oder Zirkusformen aufweisen, bringt die Ostseite einen vollständig steilen Absturz nach der oberrheinischen Tiefebene, wodurch naturgemäß auch andere Talformen auftreten müssen. Die oberelsässischen Täler nehmen meist ihren Anfang an dem Gebirgskamme, stürzen schroff ab und laufen dann zwischen kurzen Bergrücken trichterförmig in die Rheinebene hinaus. Dies fördert nicht allein den Gesamtanblick von einem höher gelegenen Standpunkte, sondern läßt auch die landschaftlichen Schönheiten, die nirgends zahlreicher als in den durch besondere Eigentümlichkeiten und Fülle der Gebirgsformen auffallenden Längstälern der Vogesen zu finden sind, viel schärfer hervortreten. Größere Nebenflüsse der Ill, wie solche des Rheins, beleben diese Täler und erinnern durch ihre Anordnung an die Verzweigungen eines Baumes, dessen Stamm durch den Hauptfluß versinnbildlicht wird.
Das Dollertal, das südlichste, wird halbkreisförmig von dem Gebirge umgeben; den Hintergrund bildet die schroff ansteigende Felsenwand des Elsässer Belchen, auf dem in einer steilen Schlucht der durch den Besuch des deutschen Kaisers vielgenannte Stauweiher Alfeld liegt. Die Gipfel des südlichen Gebirgsrückens des Kreises übersteigen außer dem Bärenkopf nirgends die Höhe von 1000 m; der Nordrand hingegen ist bei weitem imposanter und schärfer gegliedert, und Bergkolosse wie der Rimbacher Kopf (1195 m), der Roßberg und der Kratzen (1116 m) schneiden weit in das Tal hinein, das wie die meisten der Vogesen einst vergletschert war. Mächtige ausgedehnte Eismassen, die von den höchsten Gipfeln herab durch die Seen sich nach der Ebene zogen, deckten einst den ganzen hinteren Einschnitt. Eine eiszeitliche Endmoräne, die noch in jetziger Zeit das Tal abschließt, liegt oberhalb des Dorfes Sewen, eine andere bei Kirchberg. Das Dollertal besitzt die einzige Tropfsteinhöhle der ganzen Vogesenkette; leider ist sie noch unerforscht, teilweise unzugänglich. Der Berg unterhalb Sentheims ist ganz ausgehöhlt, die Gänge schmal und niedrig, jedoch entsprachen nähere Untersuchungen des sogenannten Wolfenloches im Jahre 1900 nicht den gehegten Erwartungen. Gehörig ausgegraben, ausgeputzt und gesäubert, ergeben diese Höhlen vielleicht später geographisch wichtigere Tatsachen.
Zu den schönsten Gebirgsbildern des Masmünstertales gehört die Umgebung der beiden Neuweiher, welche sich durch eine wunderbare alpine Felsformation auszeichnet und bis zur oberen Bershütte das Auge des Wanderers gefangen hält. Die Neuweiher, zwei natürliche Seen, liegen in einer Meereshöhe von 804,5 und 824 m; das Becken des größeren hat die Form einer ausgeschweiften, flachen, in Granit eingegrabenen Mulde. Die größte Tiefe des Sees beträgt 10 m. Über den Neuweihern, 984 m über Meer, in einem gewaltigen Trichter und rund von wenig bewaldeten Granitbergen eingeschlossen, breitet der Sternsee seine schimmernde, ca. 4,4 ha große Fläche aus; seine Tiefe wechselt zwischen 16 und 18 m.
Das Thur- oder St.-Amarintal hat im gesamten eine große Ähnlichkeit mit dem vorigen, nur ist es länger, breiter und tiefer, und seine Nordspitze bildet sozusagen die Verlängerung des Meurthetales. Der mittlere Südrand des einschließenden Gebirges verläuft ruhig und einheitlich und flacht sich dem Tale zu ab, während der Nordrand unzugänglich und schroff sich erhebt, als scheinbar unübersteigbare Mauer sich um den Gebweiler Belchen gruppiert, teilweise in dem mächtigen Hundskopf (1247 m) emporsteigt. Dicht bewaldet ragt am Eingang des Tales der Hartmannsweilerkopf empor, auf dessen Gipfel sich ganz rätselhafte Steingebilde von schwärzlicher Farbe, verglast, porphyritisch und porös befinden. Frühere Untersuchungen wollten darin Reste von Lavablöcken eines erloschenen Kraters sehen; neuere Berichte hingegen geben dieser Erscheinung eine ganz gewöhnliche Deutung, indem sie die Verglasung einem mächtigen Feuer, vielleicht einem Hochofen zuschreiben. Der hintere südliche Gebirgsrücken, der mit den höchsten Gipfeln den Grenzkamm bildet, fällt steil der Ostseite zu und läßt besonders genau die Spuren ehemaliger Vergletscherung erkennen. Die Felsenflächen sind glatt und abgeschliffen, die Wände zeigen parallellaufende Einschnitte und Risse, die zwar dem Auge durch wucherndes Moos und Gras entzogen, im Laufe der Zeiten aber schon vielfach bloßgelegt wurden. An dem Glattstein, der seinen Namen seinem glattpolierten Äußeren verdankt, sind noch heute deutlich die Spuren von Eisschliffen und Eisstreifen sichtbar; ein anderes Produkt der Glazialperiode ist ein in der Nähe des Heidenbadfalles gelegener Gletschertopf von 1,20 m Tiefe. Andere solcher Töpfe, von einem Gletscherbach durch mitgeschobene, im Kreise gedrehte Felsstücke hervorgebracht und langsam ausgeschliffen, finden sich vielfach im oberen Thurtale, ebenso zahlreiche erratische Blöcke, mehrere kleinere Moränen und zwei große Endmoränen, wovon die eine das Tal bei Wasserung abschließt, die andere unterhalb des Dorfes Krüth lagert. Die geschilderten Erscheinungen erinnern lebhaft an jene Zeit, da die Vogesengipfel noch nicht ihre heutige kuppenartige Form besaßen, sondern kahl und glatt aus den Eismassen hervorstarrten, um sich später durch Verwitterung oder durch Einwirkung der atmosphärischen Luft nach und nach umzubilden. Durch die Straße von Bussang sind Thurtal und Westvogesen miteinander verbunden; sie führt von Urbis aus stufenweise in die Berge, windet sich förmlich durch Felskolosse, die sie stellenweise wie Mauern umgeben, hindurch bis hinauf zum Gipfel, dessen Höhe 734 m beträgt und den ein finsterer Wald von Tannen deckt. Hier führt die Poststraße durch den 300 m langen, in den Felsen gebohrten Tunnel, dessen Innen- und Außenwände mit starken Steinen ausgemauert sind: an den Seiten liegen mächtige Felsstücke aufgebaut, um im Winter die Straße vor den oft sehr bedeutenden Schneemassen zu schützen. Hinter dem Tunnel von Bussang befinden sich die durch eine Holzhütte gedeckten Quellen der Mosel, die hier klein und unbedeutend ihren Anfang nimmt.
Das Lauch- oder Blumental hat die Länge des Dollertales (17 km) und zieht sich halbkreisförmig von Osten nach Westen, mit der Kurve nach Süden gerichtet. Reich gegliedert, von gleich hohen Kuppen beiderseitig begrenzt, wird das Tal seinem Hintergrunde zu immer enger, bis beim Lauchenkopf (1313 m) das Gebirge nur noch der Lauch den Platz einräumt. Auf beiden Strängen erheben sich die höchsten Gipfel der Vogesen; oben kahl, unten mit Wald bedeckt, erstrecken sie sich gleichmäßig, der eine mit der Belchenkuppe bis zum Rheinkopf, der andere mit dem Kahlen Wasen (meist kleiner Belchen genannt) bis zum Rothenbachkopf. Der Belchen von Gebweiler ist mit 1424 m der bedeutendste Berg des ganzen Höhenzuges und setzt sich größtenteils aus Schiefer und Grauwacke zusammen. Dichte Waldstrecken bedecken die unteren Abhänge, Matten und öde Weideflächen ziehen sich dem Gipfel zu, aber nie hört die Vegetation gänzlich auf. Die Aussicht, die man vom Belchenkopfe aus genießt, ist eine unumschränkte, da er durch seine Höhe sämtliche Felsenhäupter und bewaldete Kuppen seiner Umgebung überragt. Im Westen blickt man an kahlen Gipfeln vorbei in das französische Flachland, im Osten erstreckt sich der vielgegliederte Schwarzwald, während der Süden durch die weißglänzende Kette der Alpen, hinter welcher bei heiterem Himmel der Montblanc mit seinem eisigen Haupte sichtbar wird, geschlossen ist.
Am Nordabhang des Belchen liegt in einer Höhe von 936 m, in einem unheimlichen Belchenbecken, der 7,5 ha umfassende, stellenweise über 23 m tiefe, forellenreiche, der Gletscherzeit entstammende Belchensee. Seine mangelhafte Stauung im 18. Jahrhundert war die Ursache einer verheerenden Überschwemmung; heute benutzen Industrie und Landwirtschaft den teilweise unterirdisch abfließenden und ins Lauchtal stürzenden Seebach. Nordwestlich vom Belchensee breitet inmitten eines Berglabyrinthes der vor einigen Jahren errichtete Stausee Lauchenweiher seine Wasserfläche aus. Unterhalb des Sees liegen die vielbesuchten Lauchenfälle. Auf dem Belchengipfel selbst befindet sich seit Anfang 1888 eine von der Landesregierung errichtete meteorologische Station; eine ebensolche sollte der Hoheneck im Jahre 1902 erhalten, jedoch unterblieb die Ausführung aus technischen Gründen.
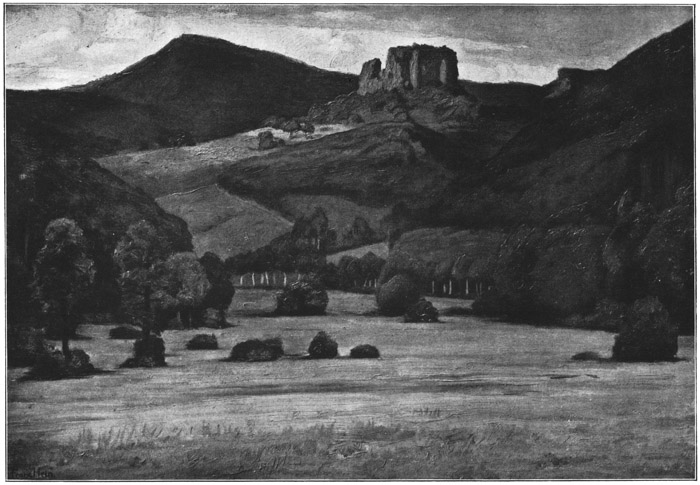
Vogesenlandschaft.
Nach einem Gemälde von Franz Hein.
Der Kahle Wasen (1278 m), dem großen Belchen gegenüber, überragt bedeutend den von seinem Fuße losgetrennten niederen Höhenzug, der sich vom Eingange des Fechttales bis nach Lautenbach zieht; die zwischen beiden befindliche langgezogene Schlucht entstand wahrscheinlich zur Zeit der Einsenkung der Rheinebene. Im Norden geht das Gebirge nach und nach in die Vorhügel über, die das Münstertal begrenzen; der Hauptstock hingegen teilt sich in zwei Stränge, welche, durch einen wald- und mattenreichen Saum voneinander geschieden, in gebrochenen Linien nach Westen verlaufen und am Rothenbachkopf sich wieder vereinigen.
Das Tal der Fecht, besser unter dem Namen Münstertal bekannt, ist das breiteste der Vogesen, das seinerseits wieder das Seitental Sulzbach bildet und sich bei Münster in das Groß- und Kleintal verzweigt, in welches Dreieck der Hoheneck mit seinen Ausläufern weit hineingreift. Nach dem Belchen ist dieser die höchste Spitze (1361 m) der Vogesen; er liegt in einer der schönsten Gegenden des Oberelsasses und gilt besonders in orographischer Hinsicht als wichtiger Ausgangspunkt. Über den Hoheneck zieht sich die Grenzscheide; genau in der Mitte des Gipfels steht der Grenzstein, und während das Granitplateau nach Norden und Westen sich langsam in einem Höhenzug verliert, fallen andererseits die felsigen Abhänge sehr schroff dem Tale zu. Vier Flüsse haben in der nächsten Umgebung dieses Berges ihre Quellen und verteilen sich von hier aus strahlenförmig: die Fecht und die Thur fließen nach Osten und Südosten, die Moselotte und die Vologne nach Süden und Westen; außerdem erhält im Norden die Meurthe einige kleinere Zuflüsse. In dieser Hinsicht gleicht der Berg einigermaßen dem St. Gotthard der Alpen, von welchem ebenfalls in entgegengesetzter Richtung vier Flüsse entspringen.
Nicht minder merkwürdig ist der Hoheneck in bezug auf seine Flora, welche durch ihren Artenreichtum sämtliche Vogesengipfel übertrifft. Im Vergleiche zu dem Badischen und dem Schweizer Gebirge ist das bunte Gemenge der Pflanzen auf diesem Gipfel auffallend; eine genaue Feststellung der Ursache dieser Erscheinung erfolgte durch die Untersuchungen der Geologischen Landesgesellschaft. Hiernach wurde erwiesen, daß meist nur spärlich bewaldete, tief eingeschnittene Täler auf die oberelsässischen Gebirgshöhen führen und so im allgemeinen die Vegetation ohne Hindernis aufwärts gelangt. Daraus läßt sich vielleicht erklären, warum oben so viele Pflanzen der Ebene neben alpinen und subalpinen Formen getroffen werden. Als Seltenheiten finden sich verschiedene Steinbrecharten (Saxifragaceen), die ohne Zweifel aus den Pyrenäen nach den Vogesen verpflanzt wurden. Weniger reich in dieser Hinsicht ist der große Belchen, obwohl auch er einzelne Arten aufweisen kann, die sonstwo nicht gefunden werden. Reichhaltiger tritt die Vegetation in der Nähe der Seen und in den Torfmooren auf, darunter die sehr seltene Nixblume Nuphar pumilum.
Nördlich vom Hoheneck liegt der Gebirgspaß der Schlucht, der höchstgelegene Übergang der Vogesen nach der Westseite. Der Gebirgskamm ist im allgemeinen waldfrei, ein Umstand, der die Kammwanderungen besonders begünstigt; von der Schlucht aus lassen sich solche beiderseitig unternehmen und gewähren dem Naturfreunde herrliche Aussichten. Ein zurzeit vielbesuchter Punkt in dieser Gebirgswelt ist der Altenweiher, der größte Stausee des hinteren Fechttales, in wildromantischer Lage. Er wurde 1886-89 in einem tiefen Becken, das von einem vermoorten See eingenommen war, gebaut, und seine Staumauer, welche eine mittlere Höhe von 20 m erreicht, verdient neben derjenigen des Alfeldweihers die größte Bewunderung.
Der Nordrand des Fechttales, der beim Eintritt in dasselbe steil zur Ebene abfällt, während die niederen Vorhügel sich dem Weißtale zu ziehen, erstreckt sich nach Westen, nachdem seine Grenze durch die jäh abbrechenden Gipfel des Hohenecks (976 m), Kühbergs (966 m) und Hörnlekopfes (1040 m) gebildet worden. Im Westen türmt sich das Gebirge in hohe Grenzspitzen, wie Tannet (1292 m) und Wurzelstein (1266 m), auf, in deren Felsenbecken sich die bedeutendsten Vogesenseen befinden, darunter der Weiße und der Schwarze See; dieser wurde im Jahre 1900 mit einer Staumauer versehen, welche dazu dienen soll, den Abfluß des Behälters zur Regulierung der Niederwasserstände im Interesse der Landwirtschaft und Industrie des Tales in sicherer Weise zu regeln. Ähnlich liegen auch die übrigen Weiher des Wasgaus; auf den Höhen des Gebirges in felsiger, schluchtenreicher Umgebung breiten sie ihre stillen Wasserflächen aus, während der Wald, der gewöhnlich die eine Seeseite umgrenzt, dem Ganzen einen Anstrich von Größe und Feierlichkeit verleiht. Auf den Vogesenhöhen haben ebenfalls fast sämtliche kleinere Flüsse und Bäche des Oberelsasses ihre Quellen, so die Weiß, die Fecht, die Lauch, die Doller und die Thur, deren Oberlauf um so unregelmäßiger, als ihr Quellgebiet regelmäßig ist. Bald stürzt die Wassermasse wild brausend über ein felsiges, tief eingeschnittenes Gehänge, bald leise wie ein Silberfaden zwischen dem Gestein hindurch oder als murmelnder Waldbach durch den schattigsten und kühlsten Teil des Waldes, bald wieder in zickzackförmigem Laufe durch eine kleine Schlucht, hier und da durch Trümmeransammlungen dammförmig gehemmt, über welche das Wasser einen Fall bildend hinwegschießt und laut rauschend die Eintönigkeit und Stille des Gebirges unterbricht. Die Vogesenflüsse haben im allgemeinen den Nachteil, daß sie in ihrem hinteren Laufe sehr steil sind und ihr Quellgebiet von abschüssigen Talwandungen umgeben ist, welche mit ihrem felsigen Boden und infolge der teilweise nur spärlichen Bewaldung wenig Niederschlagswasser aufnehmen und zurückhalten können. In der Tat, die oben unscheinbaren Gebirgsbäche werden in den einzelnen Tälern zu größeren Flüssen, deren Wasser leider auch hier durch das starke Gefäll allzu schnell der Rheinebene zueilt und deshalb im Hochsommer schon öfters zu verhängnisvoller Trockenheit Anlaß gab.
Auf den Höhen der Gebirgskette liegen, außer den größeren Seen, auch viele vermoorte, sumpfartige Moränenseen, die keinen Abzug des Wassers haben. Dieser Boden fördert das Wachstum gewisser Pflanzen, wie Riedgräser, Binsen, Moose u. a., welche von Zeit zu Zeit absterben und sich nur teilweise zersetzen. Diese Überreste in Verbindung mit Erdharzen und Erdarten bilden den Torf, dessen Entwickelung jedoch nur langsam vorangeht; jedes Jahr entsteht eine Schicht, die oben locker und braun, unten dicht und schwarz ist. Die elsässischen Vogesenseen werden mit der Zeit das Los derjenigen der gegenüberliegenden Seite teilen, welche, durch die fortwährende Bildung des Torfes eigentlich nur noch große Sümpfe darstellen, so der See von Lispach. In der Nähe des Forlenweihers in der Gebirgswelt des hinteren Fechttales befindet sich der unter dem Namen Karpfenweiher bekannte Trockensee, vorzeiten ein größerer Gletschersee, heute nur noch ein hart eingetrocknetes Hochmoor. Unweit davon liegt ein zweiter vermoorter Seeboden, der ebenfalls der Torfbildung sein Verschwinden verdankt. Der Hexenteich unweit des Grenzkammes (929 m), früher ein kleiner Kesselsee, ist durch dieselben Umstände eingegangen. Dasselbe Schicksal wird in den nächsten Jahrzehnten das Rote Ried, die sumpfige Matt auf den Höhen des Stolzen Ablaß (810 m) erreichen. Das beste Beispiel der Torfbildung bietet der Sewensee; früher war er vielleicht fünfmal größer als er heute ist, mit der Zeit hat sich jedoch sein Wasserspiegel verkleinert, Geröllmassen deckten einen Teil des Sees, und von den Ufern aus schritt die Vermoorung so bedeutend vor, daß sein Flächeninhalt bei 12 m Tiefe sich auf ungefähr 3,5 ha verringerte.
Das Gebirge zwischen dem Fechttale und der oberelsässischen Grenzlinie wird durch das lange, enge Weißtal durchbrochen, das bis zu seinem hinteren Teile beiderseitig von Bergen mittlerer Höhe eingeschlossen ist, nach der Westgrenze zu jedoch schroff emporsteigt; links ragt die Felsenkuppe des Fauxkopfes (1219 m) in die Lüfte; nördlich davon zwängt sich die Straße des Col du Bonhomme durch die Felsen. Dem Fauxkopf gegenüber erhebt sich vereinzelt der Doppelklotz des Brézouard (1231 m). An seiner Westseite zieht sich das Lebertal bogenförmig bis an die Grenze, umgeben von granitischen Hügeln, die sich nirgends über 1000 m erheben. – In dieser romantischen Gebirgsnatur liegen zwei der besuchtesten Luftkurorte des Oberelsasses: Tannenkirch (580 m über dem Meeresspiegel), am Fuße des Tännchel (910 m) mit seinen sonderbaren Felsenformationen, deren sich die Sage reichlich bemächtigt hat, erfreut sich des Rufes, ein Gebirgsdorf im wahren Sinne des Wortes zu sein und wird hierin nur von Altweier übertroffen, das als höchstgelegenes Dorf des Elsasses gilt. Seine mittlere Höhe beträgt 828 m, einzelne seiner weithin zerstreuten Häuser gehen jedoch über 900 m hinaus. Dieser Teil der Hochvogesen ist auch die Heimat der Sennen, die mit ihren Herden auf den Höhen in voller Abgeschiedenheit ein wirkliches Alpenleben führen. Die niedrigen, einfachen, an einen Bergabhang gebauten Sennhütten sind durch ihre mit Steinen und Felsstücken beschwerten Strohdächer schon von weitem sichtbar. Diese Dächer, die oftmals wegen ihrer Feuergefährlichkeit abfällig beurteilt wurden, haben den Vorteil, im Winter die Kälte, im Sommer die Hitze leidlich fernzuhalten; außerdem bilden sie einen wind- und wasserdichten Schutz bei Sturmwetter. Außer dem Sennen ist auch der Holzschlitter, der mühsam auf seinem Schlitten das Holz zu Tale führt, eine den Vogesen eigene Erscheinung, bis der Fortschritt der Neuzeit ihn wie so viele andere um das tägliche Brot gebracht hat.
Das Klima der Vogesen ist in Anbetracht der unregelmäßigen Höhenlagen ein verschiedenes; im gesamten berechnet, kann eine mittlere Jahrestemperatur von 7 bis 8° angenommen werden. Ebenfalls durch die Lage des Gebirges bedingt ist die verhältnismäßig heftige Kälte des Winters; häufig und rasch sind auch die atmosphärischen Änderungen, die im Sommer oft trübe, kalte Tage, im Winter manchmal warme und schöne Tage hervorbringen. Nach oben zu nimmt die Temperatur auf 150 m um etwa 1° ab. Die Höhen zeigen im Winter gewöhnlich eine geringere Bewölkung als das Tal, das hingegen bis auf etliche hundert Meter Höhe starke und dichte Nebel aufzuweisen hat. In diesem Falle erfährt die obere Temperatur eine Steigerung und bedeutende Abweichung von derjenigen des Tales, sodaß auf den Höhen das schönste Sommerwetter herrscht, während unten kalte und nebelige Wolken lagern. Diese Erscheinungen zählen nicht zu den Seltenheiten, im Jahre 1897 wurde ein solcher Fall ganz genau beobachtet. Am 26. Dezember war der Belchen und seine Umgebung ganz von Schnee eingeschlossen; ein undurchdringlicher Nebel ballte sich unter der Kuppe und entzog dem Auge die Ebene, oben hingegen herrschte der schönste Sonnenschein. Eine unvergleichliche Fernsicht bot sich dem Auge; über die Nebelmassen ragten schneeige Gipfel empor, hinter welchen im Westen der Grenzkamm, im Süden die Alpen sichtbar wurden, während der Osten durch die langgezogene Gipfelkette des Schwarzwaldes begrenzt war – hoch darüber glänzte der schönste blaue Sommerhimmel. – Das Klima der Täler ist im allgemeinen dasselbe wie das der Ebene; jedoch bringen die sehr häufigen Südwestwinde oftmals Regen oder feuchte Witterung. Ebenso sind die nicht seltenen Gewitter meist von andauernden Regengüssen begleitet, der Überfluß an Wasser eilt dann mit rasender Geschwindigkeit von den Höhen der Ebene zu und richtet dort manchmal große Verheerungen an. Der Schnee erscheint auf den Vogesengipfeln gewöhnlich Mitte Oktober und hält sich bis Anfang Juli; in den Felsenritzen ist er oft das ganze Jahr zu sehen. Im Jahre 1900 waren die Schneeverhältnisse der Vogesen ausnahmsweise sehr ungünstig. Noch Ende Mai fiel Schnee auf den Höhen; der Elsässer Belchen hatte eine weiße Decke von ca. 7 m, der Rothenbachkopf und der Hoheneck wiesen 2 m hohe Schichten auf, die aber durch kurz darauf eingefallene Regen teilweise wieder verschwanden. In den hochgelegenen Schluchten erhielt sich der Schnee bis Ende Juli. Seit dem Monat Oktober hüllte wiederum eine Schneedecke das Gebirge ein. Als Merkwürdigkeit sei erwähnt, daß ein Schneefall im Jahre 1888 noch Ende Juli in den höchsten Regionen des Gebirges auftrat. Ebenfalls schneereich waren die Jahre 1904 und 1907; im Monat März des letzteren wies die Schlucht eine Schneedecke von 3,50 m auf. Mächtige Lawinen gingen zu Tal und rissen Steine, Geröll und Bäume mit; ebensolche Schneeanhäufungen befanden sich an den steilen Wandungen des Welschen Belchen, des Kahlen Wasen, des Hoheneck, des Rotenbacher Kopfes usw.
Im Vergleiche zu dem vorigen Jahrhundert ist der Bergbau in den Vogesen bedeutend zurückgegangen; nichtsdestoweniger sind die Minen noch zahlreich und beschäftigen eine Menge Hände. Die großen Silberminen von Markirch sind zum Teile eingegangen, sollen jedoch nach neueren ergiebigen Versuchen wieder in Betrieb gesetzt werden. Die Eisen-, Blei- und Kupferminen liefern einen ansehnlichen Ertrag, so hauptsächlich im hinteren Masmünstertal, von dessen alten Erzgruben behauptet wird, daß man in ihren Stollen, wenn keine Verschüttung eintreffe, einen ganzen Tag fortgehen könne.
Die Bevölkerungsverhältnisse der Vogesentäler sind im allgemeinen als sehr günstige zu bezeichnen; die zahlreichen Fabriken, die seit etwa 100 Jahren dort entstanden und Tausende von Arbeitern beschäftigen, mögen viel dazu beigetragen haben. Die Landbevölkerung ist durchschnittlich ein kräftiger, gutherziger, friedliebender, besonders gastfreundlicher Menschenschlag, der in vieler Hinsicht seine von den Vätern ererbten Gewohnheiten beibehalten hat. Die Sprachgrenze zieht sich nach den Untersuchungen von Dr. C. This vom Elsässer Belchen bis Münster in gleicher Linie mit der Grenze und der Wasserscheide, von hier in einer Zickzacklinie über Schnierlach, Diedoldshausen, Altweier, Leberau, Groß-Rumbach usw. bis zum Donon, der höchsten Erhebung der unterelsässischen Vogesen. In den Tälern der Fecht, Thür und Doller, die durch ihren steil nach Osten abfallenden Hintergrund dem Vordringen der Talbewohner mehr Schwierigkeiten entgegensetzten, scheint die Sprachgrenze viel schärfer abgebrochen als in den anderen, die eine gegenseitige Annäherung förderten.
Deutsche Rundschau für Geographie und Statistik, 1901, umgearbeitet 1909.
Wer Deutschlands Bezirke für Großindustrie aufzählt, der darf den südwestlichen Winkel unseres Vaterlandes, das Oberelsaß mit den Brennpunkten Mülhausen-Kolmar, entschieden nicht außer Betracht lassen. Wenn man auch geneigt sein mag, das Zahnrad im Stadtwappen von Mülhausen als Wahrzeichen seiner großen industriellen Betriebsamkeit aufzufassen, so ist doch zu bedenken, daß die Großindustrie hierzu nicht alt genug ist, daß vielmehr das Rad hindeutet auf die ehemals an der Ill gelegenen Mühlen des alten Straßburger Stephansklosters.
Den Grundstein zur Textilindustrie des Oberelsaß und Mülhausens insbesondere legten im Jahre 1746 Samuel Köchlin, Joh. Jakob Schmeltzer und Joh. Heinrich Dollfuß in der Absicht, die baumwollenen, bunten indischen Tücher fabrikmäßig herzustellen; also baumwollenes Gewebe mit Buntdruck war das Ziel! Und hierin liegt heute noch der Schwerpunkt der gesamten Oberelsässer Großindustrie, die sich an der Grenze dreier Zollgebiete (Deutschland, Schweiz, Frankreich) entfaltet hat. Solange Mülhausen als deutsche Reichsstadt zwischen zwei Stühlen saß und bald zum Reich, bald zur Eidgenossenschaft hinneigte, wollte seine Industrie nicht recht vorwärts. Erst nachdem es 1798 seine Aufnahme in die französische Republik nachgesucht, als es ein großes Absatzgebiet in Frankreich, eine Auslage für seine Erzeugnisse in Paris gefunden, als die Handelssperre für seine Artikel eine ungeheure Nachfrage herbeiführte: da schoß die Textilindustrie üppig ins Kraut und streckte wie ein Polyp ihre Arme in die Vogesentäler, zunächst um deren Wasserkräfte in ihren Dienst zu nehmen. Doch schon 1812 stellte Dollfuß die erste Dampfmaschine auf; dadurch war dem Maschinenbau ein Fingerzeig gegeben, und 1824 trug Nikolas Schlumberger in Gebweiler dem neuen Erfordernis Rechnung. Schon 1838 baute Köchlin in Mülhausen Lokomotiven, doch – was noch wichtiger war! – er half dem mechanischen Webstuhl aus den Kinderschuhen heraus. Ferner fand die Technik auch in Josua Heilmann, dem Erfinder der Kämmaschine mit Wechselbewegung, und G. A. Hirn, welcher die Anwendung des überhitzten Dampfes entdeckte, ingeniöse Vertreter, die zum Heil des Oberelsaß ihre Erfindungsgabe in den Dienst der heimischen Industrie und damit des öffentlichen Wohles stellten.
In jene Zeit (1831) fällt die großartige Anlage des Rheinkanals (363 km), der Mülhausen in Verbindung setzte mit zwei Hauptströmen, mit zwei Haupthandelsmeeren, mit den Welthandelsplätzen Antwerpen-Marseille und mit dem französischen Kanalnetz, und während dieses Verkehrsmittel den Weltmarkt öffnete, den Blick in die größten Fernen lenkte, überbrückten bald auch die Eisenbahnschienen – vom Hauptstrange Basel-Straßburg aus – nach Osten den Rhein, um den Anschluß an das deutsche Netz zu suchen, nach Westen die Vogesenpässe, um Fühlung mit dem frühzeitig und in großartiger Weise entwickelten französischen Eisenbahnnetz zu erlangen. Der Ausbau dieser Verkehrsstraßen zu Wasser und Land hat bis in die neueste Zeit nie Stillstand erfahren, und diesem Umstande ist es zu danken, daß die Mülhäuser Großindustrie ihren wichtigsten Rohstoff, die Baumwolle, sofern sie indischen, algerischen oder ägyptischen Herkommens ist, von Marseille, sofern sie aus Georgien, Neworleans, Mittelamerika, Peru stammt, von Havre, Dunkerque und Antwerpen bequem und billig bezieht; und ebenso findet die Kohle des Saarbeckens, des Ruhrgebietes, Belgiens, ebenso die von St. Etienne leicht und ohne erhebliche Kosten auf den Wasserstraßen ihren Weg in die beiden großen Kanalbecken Mülhausens.
Der Sinn für Hebung der heimischen Industrie führte bereits 1825 zur Gründung der sogenannten »Industrie-Gesellschaft«, zu deren wichtigsten Aufgaben das Herbeiziehen aller nur denkbaren Unterrichtsmittel für den genannten Zweck, die Übermittelung aller neuen Erfindungen an ihre Mitglieder und das jährliche Ausschreiben von Preisaufgaben gehören, welche zur Lösung praktisch wichtiger Fragen Anlaß bieten sollen. Vor uns liegt ein Verzeichnis solcher Preisaufgaben; wir heben aufs Geratewohl einige heraus, um ihre Zuspitzung auf den industriellen Zweck zu kennzeichnen: Theorie der Fabrikation von Türkischrot und Alizarinrot, Einwirkung von Chlor auf Wolle, Präparation der Baumwolle mit Albumin, Fixierung der Anilinfarben, Bestimmung des Wertes vom Indigo, Verwendung des Harzes in der Baumwollbleicherei, Selbstregulator für Trockenböden, Verbesserung in der Walzenstecherei (es sind die gravierten Walzen für Buntdruck gemeint), Transport zu Wasser im Elsaß, Abhandlung über die Lohnverhältnisse in Elsaß-Lothringen usw.
Die Gesellschaft hat ferner und zwar durch die Beiträge ihrer Mitglieder geschaffen: ein schönes Gesellschaftsgebäude mit stattlicher Bibliothek, naturgeschichtliche Sammlungen und Gewerbemuseum, eine Zeichenschule und Malerakademie, weil der Ruf der Elsässer Buntdrucke auf ihrer künstlerischen Ausführung beruht. Denn jene Zeiten sind längst vorüber, da man die Stoffe einfach auf eine gefärbte Platte aufdrückte; heute geht die Ware zwischen kunstvoll gestochenen (gravierten) Walzen hindurch, die sich selbst färben, und durch deren peinliches Zusammengreifen werden den vorübergleitenden Stoffen herrliche, sechs- bis zwölffarbige Muster aufgedruckt, daß man vor den Möbelkretonnen. staunend, wie vor Stickerei und Kunstmalerei steht. Man begreift so erst, daß sich sogar indische Farbenfreude und türkischer Geschmack durch solche Leistungen befriedigen lassen. Und neben dem Kunstvollsten enthält das Musterbuch des Oberelsässer Fabrikanten auch das Allereinfachste, jene Kalikos, die den bescheidenen Südsee-Insulanern genügen.
Um einen Maßstab für die Größe der industriellen Anlagen zu bieten, sei erwähnt, daß im Oberelsaß die Zahl der Betriebe, welche mehr als 100 Arbeiter beschäftigen, größer ist als selbst im Königreich Sachsen. Es liegt auf der Hand, daß in dem Brennpunkte dieser Großindustrie die Ereignisse von 1870 am härtesten empfunden wurden, weil die Verkettung mit Frankreich nicht nur eine politisch-nationale, sondern auch und vielleicht in noch höherem Grade eine wirtschaftliche war, und was für eine Großindustrie die plötzliche Änderung der Bezugswege und Absatzgebiete zu bedeuten hat, das wird sich jeder halbwegs billig Denkende selbst sagen. Der einzige Weg, die Oberelsässer nach der äußerlichen Angliederung zu überzeugten Anhängern der neuen Heimat zu machen, war vorgezeichnet, es war vor allem die wirtschaftliche Annäherung zu pflegen; alle die Verkehrsstränge, die früher vorzugsweise nach Westen ausliefen, mußten – wie auf einer Drehscheibe – nach und nach zum Einmünden in die Anschlüsse nach Osten gebracht werden.
Unser Besuch in Mülhausen gilt heute weder den beiden Hafenbecken, noch dem rauchgeschwärzten Kerne, ebensowenig jenen über die alte Umgürtung hinausgequollenen Villen- und Fabrikvierteln, sondern dem Norden der Stadt, wo Humanität und wohlverstandenes Geschäftsinteresse die in ihrer Art erste, einzige und großartigste Schöpfung hervorgebracht: » das Arbeiterviertel«, oder sagen wir lieber die Heimstätten für die Fabrikbevölkerung. Sie sind ebenfalls in erster Linie auf Rechnung der Industriegesellschaft zu setzen.
Das Verdienst, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft durch Vorlegung eines Planes von einem englischen Musterhause Er rührte von keinem Geringeren als vom Prinzgemahl Albert her. und des Werkes »Die Wohnungen der arbeitenden Klassen« Henri Roberts, The dwellings of the labouring classes. auf diese wichtige Frage gerichtet zu haben, darf das Mitglied Jean Zuber Sohn (1851) in Anspruch nehmen. Auch in Mülhausen galt bis dahin der Grundsatz, auf teuerem Grund und Boden unter einem Dache möglichst viele Arbeiterwohnungen in einem Kasernenbau zu vereinigen; gewiß richtig vom Standpunkte des Unternehmers aus, nicht aber von dem der Gesundheit und Sittlichkeit. Die Gesellschaft mußte, da gerade die letzteren Gesichtspunkte für sie ausschlaggebend waren, brechen mit einem alten System, um erfinderisch ein neues, bisher unbekanntes erst zu suchen; denn auch die Richtlinien des englischen Werkes konnten als allseitig maßgebend für Mülhausen – nicht erachtet werden. Die ersten Schritte zur Lösung der Aufgabe bestanden in dem Einholen von gutachtlichen Äußerungen über die Baupläne einzelner bereits ausgeführter Arbeiterhäuser, über die Zahl der in jedem untergebrachten Familien, über die Vor- und Nachteile der angewendeten Bauart, über den Preis des Bodens, über die Höhe der Miete usw. Es war keine leichte Arbeit, sich auf dieser Grundlage über ein System zu einigen, das allen Anforderungen entsprach. Das von der Industriegesellschaft empfohlene Modellhaus schloß sich am meisten demjenigen an, das der Urheber der ganzen Frage, Jean Zuber, für seine Arbeiter bei der Papierfabrik Napoleonsinsel verwirklicht hatte. Es zeichnete sich aus durch bequeme Verteilung der Wohnräume, billige Ausführung und demzufolge niedrige Mietpreise, ferner dadurch, daß jedes Haus nur eine Familienwohnung und den Genuß eines angrenzenden Gärtchens darbot. In dem Gutachten, das Dr. Penot in der Septembersitzung 1852 abgab, heißt es wörtlich: »Der Arbeiter, der nach vollendetem Tagewerk in ein elendes schmutziges Loch einkehrt, wo er ungesunde, verdorbene Luft einatmet, kann sich darin nicht gefallen und wird seine Wohnung fliehen, um im Wirtshause seine freie Zeit zuzubringen. Der Sinn für Häuslichkeit geht bei ihm verloren, er nimmt schlechte Gewohnheiten an, die ihn zu Ausgaben zwingen, welche den Seinigen nur zu bald fühlbar werden und sie fast immer ins Elend führen. Bieten wir diesen Männern reine und reizende Wohnungen, geben wir jedem ein Gärtchen, worin er eine angenehme und nützliche Beschäftigung findet, wo in der Erwartung seiner bescheidenen Ernte er den richtigen Wert des Triebes zum Besitztum, den die Vorsehung in jeden Menschen legte, erkennen wird. Werden wir dann nicht auf eine befriedigende Weise eine der bedeutendsten volkswirtschaftlichen Fragen gelöst haben? Werden wir nicht dazu beitragen, die Bande der Familie enger zusammenzuziehen und der Klasse unserer Arbeiter und der gesamten Gesellschaft einen Dienst leisten?«
Die Industriegesellschaft ist jedoch nur eine Körperschaft der Mittel und Wege und mußte die Ausführung der Modellhäuser edeldenkenden Männern oder einer Vereinigung solcher überlassen. Und sie fanden sich. J. Dollfuß ließ in Dornach (hängt mit Mülhausen zusammen) vier Musterhäuser erbauen; deren Mieter wurden bei den weiteren Erwägungen herangezogen, und unter Nutzung ihrer hinreichend langen Erfahrungen entschied man sich schließlich für zwei Grundgestalten der Arbeiterhäuser, die bei Anlage der »Arbeiterstadt« in Mülhausen, Gebweiler und an anderen Orten zur Verwendung kommen sollten. Da die Frage aber eben nicht bloß vom Standpunkte des Erbarmens, sondern volkswirtschaftlich ins Auge gefaßt wurde, so darf uns das Hineintragen eines ganz neuen Gesichtspunktes in die Beratungen nicht wundernehmen, nämlich: könnte man denn über das Vermieten der Häuserchen zu billigem Preise nicht noch hinausgehen und den Arbeiter unter leidlichen Bedingungen zum Besitzer machen? Diesen letzten Zweck erkannte die im Juni 1853 gegründete »Mülhauser Arbeiterhäuser-Gesellschaft« als den richtigsten. Den Vorsitz hatte J. Dollfuß übernommen, die 20 Aktionäre brachten ein Kapital von 284 000 Mark (71 Aktien à 4000 Mark) zusammen, wozu ein Zuschuß Napoleons III. in Höhe von 240 000 Mark kam. Diese letzte Summe wurde zur Herstellung von Straßen, Fußsteigen, Schleusen, Brunnen, Einfriedigungen, Anpflanzung von Bäumen, zur Einrichtung einer Badeanstalt, Waschküche, Bäckerei verwendet, sodaß die einzelnen Häuser nur mit den Kosten des Baugrundes und der Herstellung belastet zu werden brauchten. Für den staatlichen Zuschuß tauschte die Gesellschaft die Verpflichtung ein, die Häuser den Arbeitern zum Herstellungspreise käuflich zu überlassen oder – solange sich Käufer nicht finden – billig zu vermieten Die Miete durfte 8% des Herstellungspreises nicht übersteigen..
Um den käuflichen Erwerb zu erleichtern, wird nur eine Anzahlung von 200-300 Mark verlangt, während die verbleibende Kaufsumme in monatlichen Teilzahlungen von 15-20 Mark getilgt wird, sodaß ein Haus im Werte von 2400 Mark Übrigens sei bemerkt, daß heute infolge der Preissteigerung der Rohmaterialien und der Arbeitslöhne das Haus ohne Stockwerk sich auf 2760, das mit Stockwerk auf 4480 Mark stellt. im Verlaufe von etwa 13 Jahren in den Besitz des Arbeiters übergeht. Übrigens hat er sich zu verpflichten, den Besitz vor Ablauf einer Mindestfrist von 10 Jahren nicht zu veräußern – es sei denn an einen anderen Arbeiter! –, um nicht Unternehmern Gelegenheit zu geben, die Häuserchen billig aufzukaufen und teuer zu vermieten. So sind seit Gründung der »Mülhauser Arbeiterhäuser-Gesellschaft« etwa 1200 in den Besitz der arbeitenden Klasse übergegangen.
Die Häuser des Arbeiterviertels weisen – wie gesagt – in der Hauptsache zwei Grundformen auf, die man wohl als die anlehnende Reihenform und als Gruppenform bezeichnen kann. Im ersten Falle denke man sich eins unserer Häuser (in Straßenfront), einen Vollbau, in der Richtung des Dachfirstes von oben nach unten durchschnitten, beide Hälften durch eine Mauer getrennt und vor jeder Hälfte ein Gärtchen; mit Ausnahme derjenigen, die sich an den beiden Enden einer Zeile befinden, haben diese angelehnten Reihenhäuser nur einseitiges Licht, nur von der Fassade aus, und das ist in gesundheitlicher Hinsicht ein Mangel. Als eine verbesserte Ausgabe dieser Grundform haben wir die kleine Anzahl solcher Häuserchen anzusehen, die außer dem Garten einen Hinterhof besitzen. – Der zweite Typus, der Gruppenbau, faßt je vier Häuser zusammen zu einem Ganzen; sie gleichen vier zusammengeschobenen gleichgroßen Würfeln eines Baukastens, die wie ein schönes Quadrat inmitten eines Gartens stehen (siehe nebenstehende Skizze). Jedes Haus empfängt in diesem Falle von zwei Seiten Licht, die Gärtchen sind genau abgeteilt, früher durch Lattenzaun, jetzt durch Eisengitter, und ebenfalls an zwei Seiten des Häuschens gelegen (vorn und am Giebel). Die Baufläche eines Hauses umfaßt 40 qm, der Garten 120 qm. Dieser nimmt den Häuserchen die sonst vielleicht ermüdende Einförmigkeit und erhält seinen Wert weniger durch den daraus gezogenen Nutzen, als vielmehr dadurch, daß er den Kindern gefahrlose Spielplätze, den Eltern angenehme und gesunde Nebenbeschäftigung, vor allem auch an schönen Sommerabenden Erholung und Freude am Blumenbeete, Obstbaum und Beerenstrauch gewährt. Wie erfreulich oft dieser kleine Besitz seine sittliche Aufgabe erfüllt, mag ein Beispiel für viele ins rechte Licht setzen. Der französische Unterrichtsminister, der (1864) eingehend Kenntnis nahm von der philanthropischen Schöpfung, richtete an eine Hausfrau unter anderem die Frage: »Wo bringt Ihr Mann den Abend zu?« »Mit uns, seit wir ein Haus haben«, war die Antwort, welche in Rücksicht auf den letzten Zweck der Gründung kaum schöner ausfallen konnte.
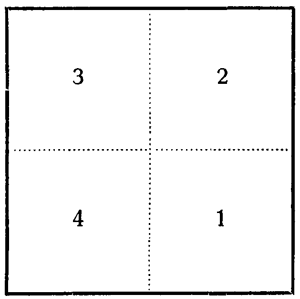
Grundriß.
Die Hauptstraße der Arbeiterstadt ist die 11 m breite Straßburger Straße; an ihren Seiten sind Baumreihen, 3 m breite Fußwege, die Druckständer der städtischen Wasserleitung, die Gaslaternen; ähnlich sehen auch die Seitenstraßen aus, nur daß ihre Breite auf 8 m beschränkt ist. Ihre Bewohnerzahl beträgt über 8000. Die Bauflächen für das alte wie für das neue Arbeiterviertel liegen so, daß einerseits Grund und Boden nicht übermäßig hoch zu stehen kommen (80 Pfennige fürs Quadratmeter im alten, 56 bis 72 Pfennige im neuen Viertel), andererseits aber den Arbeitern, mögen sie in Mülhausen oder Dornach tätig sein, der täglich viermal zurückzulegende Weg von und zur Fabrik nicht unnötig verlängert wird. Die Gesellschaft hat vertragsmäßig den Überschuß ihrer Einnahmen Sie hat sich auf 4% Verzinsung ihrer Kapitalien zu beschränken. gemeinnützigen Zwecken zugeführt: sie zahlte namhafte Zuschüsse zur Kleinkinderschule, stellte zwei Häuser zinsenfrei zur Verfügung für eine Diakonissin und als Sprechzimmer für einen Arzt; in einem anderen Gebäude hat sie eine Bäckerei errichtet, welche – allerdings nur gegen Barzahlung – das Pfund Brot vier bis acht Pfennige billiger verkauft, als es in den Bäckerläden der Stadt zu haben ist. Herr Jean Dollfuß wollte auch den ledigen Arbeitern zu einem guten, billigen Mittagstisch verhelfen, und seine Privateinrichtung ist eine Speiseanstalt, die für 50 bis 60 Pfennige Suppe, Rindfleisch, zwei Sorten Gemüse und Brot gewährt. Eine ganz besondere Würdigung erfährt die von der Gesellschaft im neuen Arbeiterviertel errichtete Badeanstalt, die Bäder werden zu 30 und 40 Pfennigen verabreicht, ebenso die Waschküche, mit einem 112 qm großen Warmwasserbecken, an dem die Frauen das Waschen der Wäsche stehend verrichten. Für zweistündige Benutzung der Waschräume sind 4 Pfennige zu zahlen.
Wir schließen mit der Bemerkung, daß jedes Arbeiterhaus, da es nur als Wohnung für eine Familie gedacht war, Küche, Wohn- und Schlafzimmer enthält; seit 1887 jedoch erscheint den Leuten das Haus mit Stockwerk begehrenswerter und zwar aus dem Grunde, weil es Gelegenheit zum Vermieten des Obergeschosses und damit die Möglichkeit darbietet, die Kaufsumme in kürzerer Frist abzustoßen. Mag sein, aber die schöne Idee, Familienheimstätten zu gründen, mußte entschieden darunter leiden.
Quellen: Das Mülhauser Arbeiterviertel, herausgegeben von der Industriellen Gesellschaft, Mülhausen 1891; und: Unser Deutsches Land und Volk, 3. Bd. Leipzig, Spamer. Der Aufsatz wurde 1909 nachgeprüft von Herrn Aug. Thiem, Generalsekretär der »Industriellen Gesellschaft«.
a) Allgemeine Charakteristik.
Von A. W. Grube.
Solange Elsaß-Lothringen den Franzosen gehörte, bildete der Schwarzwald den äußersten südwestlichen Grenzwall Deutschlands; jetzt ist es der Wasgenwald oder die Vogesen. Zwischen beiden liegt die Ebene des oberen Rheintals. Beide Gebirge, von Süden nach Norden ziehend, zeigen eine Reihe ähnlicher Erscheinungen. Sie fallen beide steil zum oberrheinischen Becken ab Siehe den Artikel: Der Rhein.. Der Schwarzwald ist aber dem Rheinstrom viel näher gerückt und bildet von Schaffhausen bis fast nach Karlsruhe hinab dessen schroff ansteigendes Ufergebirge. Auf seiner Nord- und Ostseite hingegen verläuft er ganz allmählich in das schwäbische Hochland, ganz so wie der Wasgenwald gegenüber in entgegengesetzter Richtung (nach Westen zu) allmählich in die Plateaulandschaften von Lothringen übergeht und nach Norden gleichfalls in sanften Wellen sich absenkt. Am steilsten und mächtigsten setzen beide Gebirge im Süden ein; das eine im Feldberg, das andere im Elsässer Belchen. Auch ist die ganze Südhälfte beider Gebirge die bei weitem höhere; sie besteht beiderseits aus kristallinischem Gestein: Gneis und Granit –; beide gehen nordwärts mit mäßigen Hochflächen in den Buntsandstein über, treten aber auch da noch mit scharfgezeichneten Wänden an das Rheintal heran.
An dem Nordende beider Gebirgswälle liegen ferner die Haupttore für die Straßen von Ost nach West: dem Tor von Zabern am linken Ufer des Rheins steht rechts das Tor von Pforzheim Pforzheim vom lat. porta = Pforte. gegenüber. Bis zu diesem Tor erstreckt sich der Schwarzwald vom Rheinknie bei Basel an gerechnet 165 km lang und 38-45 km breit. Die Berge weiter dem Neckar zu noch zum Schwarzwald zu rechnen, ist weder geognostisch noch durch den Sprachgebrauch des Volkes gerechtfertigt.
Den Kern und Knotenpunkt des Gebirges bildet im Süden die Gruppe des Feldbergs, dessen Gipfel übrigens nicht so frei und ansehnlich aufragt, wie der Brocken im Oberharz, obwohl er über 350 m höher ist als dieser; denn er mißt 1494 m. Als Knotenpunkt charakterisiert er sich dadurch, daß fünf Bergzüge von ihm ausgehen, oder wenn man lieber will, zu ihm hinstreben; ein über 1000 m hohes, sehr rauhes Plateau lehnt sich an seinen Osthang, durchschnitten von der Landstraße und der Eisenbahn, die aus dem Höllental nach Lenzkirch führt. Dort liegen auch die Hochseen des Schwarzwaldes: der kleine Feldsee (1112 m hoch), der Titisee und Schluchsee.
Von den genannten Bergästen, die vom Feldberg ausgehen, ist ein südöstlicher gegen diesen Schluchsee gerichtet und erreicht in der Bärhald noch eine Höhe von 1320 m, der südwestliche Teil erreicht die höchste Höhe im Belchen mit 1415 m – 15 km vom Feldberg entfernt – und endigt ob Badenweiler mit dem am weitesten vorgeschobenen und daher aussichtsreichen Blauen, 1175 m. Die zwei nordwestlichen Äste verlieren sich in der Ebene.
Einige Meilen nördlich von der Feldberggruppe erhebt sich der Kandel (1213 m, südlich von Waldkirch), östlich von diesem der Hornkopf, nordnordwestlich (durch ein tiefes Tal geschieden) der Rostock.
Im nördlichen, unteren Schwarzwald ist die Hornisgrinde (1164 m) der höchste Punkt. Auf dem 1050 m hohen Seekopf liegt der kleine, fischlose, sehr tiefe, dunkle Mummelsee, dessen Rand oft Nebelstreifen ganz unheimlich umlagern und aus dessen Tiefe es bei stürmischer Witterung ebenso unheimlich grollt und aufsprudelt. In der Sage und Poesie des Volkes spielt der Mummelsee eine große Rolle. Der weit sich ausbreitende Rücken des Kniebis, obwohl er nur 972 m Meereshöhe hat, bietet eine schöne und großartige Fernsicht ins Rheintal, auf die Vogesen, auf die Schweizer Alpen und den größten Teil des Schwarzwaldes selber. Er hat überdies die meisten Flußquellen, das Murgtal ist das schönste des Schwarzwaldes; an den Abhängen des Kniebis sprudeln vier Heilquellen: Ripoldsau, Griesbach, Petersthal und Antogast – im Bezirk einer Quadratmeile.
Am südöstlichen Fuß des Kniebis rinnen die Quellen der Kinzig zusammen; das Flüßchen gewinnt ein geräumiges freundliches Tal, das zuletzt, nach Westen umbiegend und das ganze Gebirge in seiner Breite durchschneidend, ins Rheintal (bei Kehl, Straßburg gegenüber) mündet. Ebenso biegt die Elz nach Nordwesten um; bei Freiburg mündet das rasche Flüßchen Dreisam in die Elz, deren oberes Tal, von malerischen Felsen eingeengt, das Höllental genannt wird. Durch die von beiden Seiten in das Gebirge eingreifenden Täler wird dem Verkehr der Durchgang durch den Schwarzwald im Gegensatz zu den Vogesen wesentlich erleichtert. Zwei Bahnlinien, die Höllentalbahn und die Schwarzwaldbahn, die erste bei Freiburg, die andere bei Offenburg von der großen Rheinlinie abzweigend, durchqueren das ganze Gebirge, um sich an seinem Ostabhange bei Donaueschingen zu vereinigen und den Anschluß an die Bahnen des Donautals oder der Schweiz zu finden. Beide zeigen dem Reisenden, besonders in ihrem westlichen Abschnitt, wo sie den Steilabfall gegen das Rheintal hin überwinden müssen, Landschaftsbilder von entzückender Schönheit.
Im Schwarzwald sind rauhe, öde, wilde Partien ganz nahe an warme, fruchtbare, lachende Täler gerückt. Von den kahlen, mit dürftiger Grasweide bedeckten Stufen des Feldberges, die bei einer Höhe von 1300 m ein ganz nordisches Klima haben, oder vom Niederwald der Krummholzkiefer auf den moorbedeckten Hochflächen des Sandsteingebietes (der nördlichen Hälfte des Schwarzwaldes) steigt man zunächst durch größere und kleinere Wälder schlanker Tannen und Fichten in die mildere Region stämmiger Eichen herab, die bei 800 m Höhe beginnen und als Niederwald bis 500 m herabgehen. In den Einschnitten der Berge, in den warmen Talgründen entfalten Buche, Birke, Ahorn, Esche ihre mächtigen und zierlichen Laubkronen. Diese Vorberge des Schwarzwaldes tun dem Auge wahrhaft wohl durch ihren reichen Laubwald, in den sich die Obstgärten hineindrängen. Die echte Kastanie und die Walnuß zieren die unteren Hänge mit ihren weitschattigen, urkräftigen Bäumen, die an Stärke des Wuchses mit den Eichen wetteifern. Es breiten sich die Weizen- und Spelzäcker aus, umsäumt von Obstbäumen und riesigen Nußbäumen, deren Schatten der Fruchtbarkeit dieser Gefilde kaum Eintrag tut. Die letzten Hügel auf der Rheinseite sind alle mit edlen Reben bepflanzt. Dort an den südwestlichen Hängen gedeiht der würzige, feurige Markgräfler Wein (der Landesfürst hieß früher Markgraf von Baden), und die Sonne hat in dem tief eingeschnittenen Rheintal schon solche Macht, daß sie sogar Mandelbäume im Freien erblühen und Frucht bringen läßt.
Welcher Gegensatz zu den unwirtlichen Höhen im oberen Gebirge, wo die Kirschen erst im September reifen und die armen Bewohner schon froh sind, wenn ihre Felder nur Kartoffeln, Hafer und Wicken geben! Einer dieser unwirtlichsten, doch aber noch bewohnten Teile des hohen Schwarzwaldes zwischen den Flüßchen Alp und Enz heißt Dobel und ist sprichwörtlich geworden. Das kleine Pfarrdorf besteht nur aus niederen Hütten mit Schindeldächern. Auf der kahlen Hochebene kann kein Obstbaum gedeihen, nur verkrüppelte Birken fristen noch einigermaßen ihr Dasein. Auch im Sommer wehen mitunter sehr kalte Winde, welche geheizte Stuben zum Bedürfnis machen. »Wie auf dem Dobel« – sagt man, um eine recht rauhe, unfruchtbare Gegend zu bezeichnen.
Doch fehlt es auch dem ärmsten Schwarzwäldler an Brennholz nicht, da der Tannenwald nirgends weit entfernt ist. Und da auch der Rhein nicht weit ist, so kann mancher hohe schlanke Tannen- und Fichtenstamm den Strom hinab bis in die Niederlande geflößt werden, von wo er, in Gold und Silber umgesetzt, in die Heimat zurückkehrt. Auf den Bergwassern werden jahraus, jahrein die Holzscheiter und – wo die Wassermasse es erlaubt – auch große Stämme hinabgetrieben ins Rheintal. Vom Holzfällen erhält manche kräftige Faust ihre Schwielen und den Lebensunterhalt für eine zahlreiche Familie. Vor allem hat der Holzreichtum des Schwarzwaldes jene Uhrenindustrie in Aufnahme gebracht, die noch immer sein Ruhm und Stolz und seine, wenn auch nicht reiche, doch anhaltende Nahrungsquelle ist.
b) Die Uhrenfabrikation.
Unter den zahlreichen Hausindustrien des Schwarzwaldes, die meist auf der Verwertung des Holzes beruhten, hat sich nur eine lebenskräftig erhalten und neuerdings sogar zu einer bedeutenden Großindustrie entwickelt; es ist die seit dem 17. Jahrhundert betriebene Herstellung der Uhren. Aus den ursprünglichen hölzernen Wanduhren gingen nach und nach immer bessere Messingwerke, Spieluhren und endlich sehr künstlich zusammengesetzte Musikinstrumente, selbstspielende Drehorgeln hervor, die gar nichts mehr von einer Uhr an sich haben als das bewegende Gewicht. Diese Instrumente werden besonders in Vöhrenbach und in Kirnach gefertigt und vorzugsweise nach Rußland verkauft. Dort stellt man sie in den Wirts- und Teehäusern auf, und der Russe trinkt und tanzt nach der Schwarzwälder Pfeife, deren Noten von Petersburg bis Odessa gern gehört und pünktlich befolgt werden. Eins der größten Instrumente, das in Vöhrenbach einst gebaut und nach Odessa geliefert wurde, hatte tausend Pfeifen und kostete nach seiner Aufstellung in einem dortigen Teehause gegen 13 000 Rubel. So großen Wert legt man also in Odessa auf musikalische Unterhaltung beim Teetrinken!
Die Fabrikation der Uhren ist natürlich viel weiter ausgebreitet als die der Spielwerke. Sie nimmt das ganze Quellengebiet der Donau ein und greift noch weit darüber hinaus. Fast in jedem Orte findet man eine Anzahl Uhrmacher, die für sich arbeiten, d. h. die allein oder mit einem Gehilfen ganze Uhren fertig machen; selbst auf den höchsten Höhen des Waldes liegen vereinzelte Häuser und Hütten, in denen die Drehbank schnurrt, und die sich meist durch größere, hellere Fenster vor den anderen Wohnungen auszeichnen. Das ist natürlich die niederste und ursprünglichste Stufe der Fabrikation, da immer derselbe Arbeiter alle Teile einer Uhr, mit Ausnahme des Zifferblattes, anfertigt, folglich für keinen Teil eine vorzugsweise große Übung erlangt.
Die Zunahme des Absatzes aber bedingte bald eine Trennung der Arbeit, häufig wurde in derselben Familie nur ein einzelner Teil gefertigt, was schließlich zu fabrikmäßigem Betriebe Anlaß gab. Solcher besteht insbesondere in Neukirch, Schonach, Furtwangen, St. Georgen, Villingen, Vöhrenbach, Gutenbach, Neustadt, Lenzkirch, Schramberg und Schwenningen. Dabei hat sich doch in vielen Orten, wie in Neukirch, Schonach, Triberg und anderen, die Hausindustrie erhalten, sie steht aber meist im Dienst der Großindustrie. Neue Fabrikationszweige sind die Anfertigung von Gasuhren, elektrotechnischen Apparaten und Registrierapparaten. Belehrend auf die Ausbildung in der Uhrmacherei wirken verschiedene Staatsanstalten in Furtwangen, sowie die Gewerbeschulen der Hauptorte und die ständigen Ausstellungen in den Gewerbehallen. Jetzt beschäftigt die Uhrenindustrie im Schwarzwald weit über 10 000 Personen und liefert jährlich über 2½ Millionen Uhren im Werte von etwa 20 Millionen Mark, von den einfachsten, und billigsten Werken bis zu den prachtvollsten Salonstücken.
Offenbar sind solche Industriezweige vorzugsweise für Gebirgsgegenden geeignet, in welchen das Leben und folglich die Arbeitskraft billig ist, die Feldarbeit aber nicht alle Kräfte des bewohnten Raumes in Anspruch nimmt.
Nach Schnars und Gothein. Unter Zugrundelegung des alten Artikels.
Der Landschaftsname der »Pfalz«, so vieldeutig im Verlauf der Geschichte, befindet sich auf der heutigen Landkarte nur noch als Bezeichnung des bayerischen Rheinkreises. Die bayerische Rheinpfalz ist bloß das Bruchstück eines früher viel bedeutenderen Staatengebildes. Sie ist kein Naturganzes, obwohl die Bevölkerung sichtbar zu einem politischen Ganzen verwächst. Ein Bruchstück der Rheinebene, ein Bruchstück der Vogesen, Bruchstücke der Naheberge, des Westricher Steinkohlengebirges bilden, durch größtenteils zufällige Linien abgeschnitten, diese Provinz. Nimmt man etwa die kleine Donnersberggruppe aus, so besitzt die Rheinpfalz gar keine natürliche Landschaft, die ihr ganz und ausschließlich gehörte.
Als einzige Naturgrenze kann im Osten der Rheinlauf gelten. Allein der Strom wirkt hier ebensowohl verbindend als scheidend. Die Geschichte hat seit Jahrhunderten rechtes und linkes Ufer verbunden, und der staatliche Mittelpunkt für die jetzt bayerische Pfalz lag bis zur neuesten Zeit jenseits des Flusses. So ist selbst die anscheinende Naturgrenze des Rheins eine erst in unseren Tagen wieder zur Geltung gekommene politische Scheidelinie.
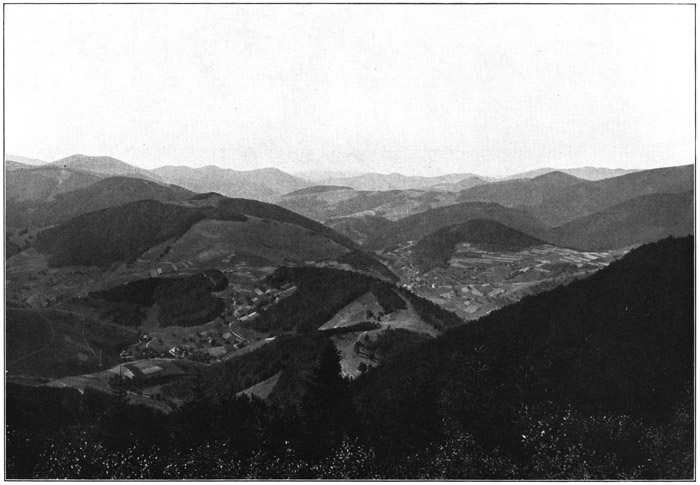
Der Schwarzwald vom deutschen Belchen aus gesehen.
Nach einer Photographie von Georg Röbcke, Freiburg i. B.
Es fehlt ferner der bayerischen Rheinpfalz der topographische Mittelpunkt, der sonst auch ein willkürlich abgegrenztes Land leicht wie zu einem Naturganzen zusammenzufassen vermag. Die Vorderpfalz, die Haardt und das westliche Hügelland ziehen in großen Parallelstreifen, dem Rheinlauf folgend, von Süden nach Norden. Jede dieser Landschaften hat ihre eigentümlichen Entwickelungen; keine herrscht. Der Rhein, der, mitten hindurch strömend, die topographische Achse der alten Kurpfalz war und das Land zusammenhielt, ist jetzt als Grenzfluß nur noch die Grundlinie der Vorderpfalz. Kein bedeutendes, den Verkehr zusammenfassendes Seitengewässer des Rheines durchbricht den Parallelzug des Gebirges und der Ebene und verbindet, wie in der jenseitigen Pfalz der Neckar, das Innere des Landes mit dem Stromgebiet. Weil die Bodenbildung des einigenden Schwerpunktes entbehrt, so hat sich auch keine eigentliche Hauptstadt von Rheinbayern bilden können. Speyer, der Regierungssitz, war trotz seiner Glorie als uralte Kelten- und Römerstadt, trotz seines hohen geschichtlichen Namens als Kaiser- und Bischofsstadt des Mittelalters, eigentlich doch immer nur die Hauptstadt der Vorderpfälzer. Heute ist es auch das nicht mehr, der eigentliche städtische Mittelpunkt für einen großen Teil der Vorderpfalz ist jetzt Ludwigshafen-Mannheim. Ludwigshafen (72 000 Einw.), erst durch Ludwig I. gegründet, ist in einem halben Jahrhundert durch Rheinhandel und Industrie zu fünfzigfacher Größe und zur ersten Stadt der Pfalz emporgewachsen. Andrerseits bilden für den Westrich das im Herzen der Pfalz und im Mittelpunkt seiner Straßen gelegene industriereiche Kaiserslautern, für die Donnersbergregion Mainz, für das bayerische Nahegebiet Kreuznach und Bingen; für die Gegend von Langenkandel Karlsruhe den wahren städtischen Schwerpunkt.
Schon hieraus ist zu ersehen, daß das Volksleben der Pfalz, obwohl auf der einen Seite verflacht und gleichförmig, doch auch wieder andererseits einheitslos zu zerbröckeln droht, und daß es darum eine der schwierigsten Aufgaben ist, einen neuen Schwerpunkt des öffentlichen Lebens für dieses Land zu schaffen.
Eine uralte volkstümliche Unterscheidung sondert die pfälzische Rheinebene und das Bergland, – oder – wie man jetzt aufs ungefähr sagt – die Vorderpfalz und das Westrich. Diese Einteilung ist natürlich, denn nicht nur die Bodenbildung, auch die Bodenkultur, die Anlage der Wohnorte, Mundart, Lebensweise der Bewohner, das alles hat ein anderes Gesicht vor und hinter dem Bergwall der Haardt. Doch genügt diese Zweiteilung noch nicht. Die Rheinniederung zerfällt nämlich wieder in die Ebene längs dem Strome und das hügelige Mittelland längs der Haardt bis über die Donnersberggruppe hinaus zu den Nahebergen. Ebenso scheidet sich das Westrich in den östlichen gebirgigen Teil und in die gegen Westen abfallenden Hügel und breiten Talniederungen. Alle vier Gruppen erstrecken sich überall parallel von Süden nach Norden.
So zeigen uns schon diese einfachsten topographischen Grundlinien ein Bild, wie es nur dem individualisierten Mitteldeutschland angehören kann. Und in der Tat trägt die Pfalz so deutlich wie kaum ein anderes Land das Motto Mitteldeutschlands an der Stirn: » Vielgestaltung ohne Einheit.«
Die Rheinebene liegt an der Weltstraße, nimmt aber erst neuerdings vor allem durch Ludwigshafen am großen Verkehrsleben des Stromes teil. Von Basel bis Mannheim ergoß sich nämlich früher der Rhein in einem Netz vielverschlungener Arme durch die Ebene, Tausende von Inseln und Halbinseln bildend. – Die Anwohner waren von Überschwemmungen und Fiebern geplagt. Der sumpfige Boden ihrer Gemarkungen war nur auf verhältnismäßig kleinen Strecken zu Ackerbau und Weidenutzung geeignet, und das angebaute Land gab häufig schlechte Ernten. Da der Strom wegen der geschilderten Zerfaserung in diesem Abschnitte auch für den Verkehr unbrauchbar war, konnten sich die Rheindörfer nur sehr langsam entwickeln. Aber gerade die Bedürfnisse des Verkehrs veranlaßten großartige Korrektionsbauten am Oberrhein; der Strom wurde durch Herstellung eines Normalufers in eine geschlossene Rinne eingeengt und durch Geradelegung auf der Strecke zwischen Basel und der hessischen Grenze um 85 km seiner Länge verkürzt. Durch weitere Bauten wurde die Verlandung der abgeschnittenen Flußarme und die Entwässerung der Überschwemmungsgebiete bewirkt und dadurch eine gewaltige Fläche neuen vorzüglichen Kulturlandes gewonnen. Der Weinbauer drüben an der Haardt, der weiland so stolz auf die armseligen Rheinbauern herabsah, mußte auswandern, weil das Land zu eng geworden für seine Kinder; der Rheinbauer kann bleiben, denn für ihn gibt es noch ganze Gemarkungen fruchtbaren Ackerbodens aus dem Wasser zu ziehen. Die Wälder an den herrlichen Vorbergen der Haardt sterben ab, Und kein Doktor kann ihnen helfen; denn der Boden ist ausgedörrt oder bis auf den Felsengrund abgeschwemmt, und vielleicht ist es Jahrhunderten nicht möglich, eine neue Humusdecke zu bilden. Auf den früher wenig ergötzlichen Börden und Auen des Überschwemmungsgebietes dagegen wuchern dichte Forste von Kopfholz und Buschwerk, und manches Tagwerk, das jetzt noch Waldboden, wird, entwaldet, nicht kahler Felsgrund, sondern gesegnetes Ackerland sein.
An den sonnigen Rebenhügeln der Haardt ist der leichtblütige, lustige Pfälzer zu Hause; hier ist der rechte Boden zur Anlage von Städten gewesen, hier zog die altberühmte Heerstraße des Mittelalters bequemer und sicherer als die Parallelstraße am Rheinufer. Die Städtebildung war eine so notwendige und zugleich auf einen so engen Raum zusammengedrängt, daß die Ortschaften des ganzen Striches ein vorwiegend städtisches Ansehen erhalten mußten. Denn an dem Verkehr, der sich in den Hauptpunkten sammelte, nahmen alle Dörfer der Haardtstraße mehr oder minder teil. Genau derselbe Zustand bildete sich auf dem jenseitigen Ufer, in der sogenannten »Bergstraße«, wo gleichfalls eine ganze Linie von Städten und städtischen Dörfern durch den Austritt des Odenwaldes in die Rheinebene notwendig vorbedingt war. Die städtische Dörferbildung ist sehr alt. Viel trug dazu der Umstand bei, daß seit alter Zeit vorwiegend eine Handelspflanze – der Weinstock – an den Hügeln der Haardt gebaut ward. Wo eine Handelspflanze den Boden beherrscht, da hält sich kein strenges Bauerntum.
Ganz anderes Land kommt hinter dem Vorwall der Haardt zum Vorschein; es ist das gebirgige, waldreiche Westrich. Wir kommen plötzlich aus einem Weinlande in ein Waldland, in welchem mehr als ein reines Holzhauerdorf vorhanden ist. Das Gebirge ist die Holzkammer des Vorlandes, dessen Feld- und Weinbesitzer hier ihre sogenannten »Geraiden« oder »Haingeraiden« haben. Die Waldbauern sind ärmlicher in ihrer Wohnung, Kleidung und Nahrung, doch keineswegs herabgekommen, und können in wirtschaftlicher Hinsicht immerhin getrost der Zukunft entgegensehen.
Am Saume des Gebirges bei Kaiserslautern westwärts nach Homburg zieht sich ein Gebiet großer, von Hügeln umsäumter Torfniederung, die nördlich noch teilnimmt an dem pfälzisch-saarbrückischen Steinkohlengebirge und im Süden das wellenförmige Hügelland des Bliesgebietes hat, bis hinauf zu den Waldbergen von Pirmasens und Fischbach – man könnte diesen Teil der Pfalz das hügelige Westrich nennen. Hier zeigt sich der pfälzische Kartoffelbau in seiner ganzen Glorie; auf den vielen und schönen Wiesengründen gedeiht das Rindvieh vortrefflich, die Täler des Glan, der Lauter, der Nahe und des Donnersberggebietes spielen für das Rheintal in diesem Punkt eine ähnliche Rolle, wie Jütland für Schleswig-Holstein. Schon von weitem kündigt sich das Glanvieh durch seine gleichmäßig weiße Farbe an. Die bequem zugänglichen Täler dieses Hügellandes sind für die Industrie wie geschaffen, die, von den nahen Saarbrückener Kohlenflözen unterstützt, in Pirmasens und Zweibrücken ihre Hauptorte erhalten hat. So vereinigt die Pfalz die größte Mannigfaltigkeit des Kulturlebens. Die wirtschaftliche Bedeutung großer kulturfähiger Sandflächen, auf denen Preußens ackerbauende Macht ruht, spiegelt sich in den weitgehenden sandigen Saatfeldern der Ebene von Speyer und Haßloch. Die ins kleinste durchgearbeitete Gartenkultur des Feldes in den Frankenthaler Fluren und der Weinbau des Hügellandes nebst seinem vortrefflichen Obst versetzt uns in die reichen, aufs äußerste ausgebeuteten Striche Mitteldeutschlands; einzelne Dörfer der Haardt verkünden jenen höchsten Glanz rheinischer Weinbauernwirtschaft, der dem tiefsten Elend die Hand reicht. Der südlichste Teil der Rheinebene hat einen weit ausgedehnten Hochwald schlanker Buchen, »Bienwald« genannt, mit einem reinen Walddorfe »Büchelberg«. Einzelne Dörfer am Rheinstrom sind echte Fischerdörfer wie nur irgendeine Gruppe von Fischerhütten am Meeresstrand, und gehen wir aus dem üppigen, von Menschen überfülltem Gartenlande bei Frankenthal und Dürkheim nur auf wenige Stunden ins Gebirge hinauf, so haben wir z. B. im Leiningertal die genügsame Lebensführung des deutschen Mittelgebirgsbauern unmittelbar neben dem ärmlichen Volke einer verödeten Rhön- oder Vogelbergsgegend, wie sie hier in den zerstreuten Hütten des »Metzenbergs« getreulich abgeschildert ist.
Im Charakter des pfälzischen Volkes mischt sich auf eigentümliche Weise alemannisches und fränkisches Wesen. Die alten Alemannen werden uns als wilde, trotzige Gesellen geschildert. »Schwabentrotz« ist zwar bei ihren suevischen Stammverwandten heute noch sprichwörtlich; bei den Pfälzern aber hat die schwäbische Starrheit des inwendigen Menschen meist der fränkischen Geschmeidigkeit weichen müssen. Dagegen ist der jenem Trotze nahe verwandte Drang nach persönlicher Unabhängigkeit und Selbstherrlichkeit, der demokratische Zug, der den Alemannen viel mehr eigen ist als den Franken, bei den Pfälzern nicht verloren gegangen. Die mittelalterliche Geschichte des Elsaß und der alemannischen Schweiz zeigt uns, wie namentlich im Städteleben und in der religiösen Entwickelung dieser Drang nach Selbständigkeit eigentümlich streng und gediegen zutage kam. Die alten Franken dagegen galten für biegsam, bildungsfähig, das Fremde leicht aufnehmend, zuweilen auch für wetterwendisch und unzuverlässig. Sie sind nächst den Goten derjenige deutsche Stamm, welcher sich am innigsten römischem Wesen zu verschmelzen wußte. Fränkische Rührigkeit, Gewandtheit der Auffassung, Schlagfertigkeit hat bei den Pfälzern – namentlich nördlich der Queich – in hohem Grade das schwere alemannische Wesen verdrängt. Licht und Schatten im Volkscharakter hängt recht augenfällig hiermit zusammen. Zunächst im wirtschaftlichen Leben. Die Pfälzer gehören zu den fleißigsten Landwirten Europas; ein gesegneter Boden begünstigt diesen Fleiß. Aber es kommt bei ihnen noch die glückliche fränkische Hand dazu, die Beweglichkeit, der Fortschrittstrieb, der rechnende Verstand des Franken. Der schwäbische Bauer ist nicht so hitzig, dagegen in seinem Fleiße noch zäher als der Pfälzer; er ist nicht so flink, nicht so gewürfelt, hat jenen schlagfertigen, fränkischen Mutterwitz nicht, für welchen der Pfälzer ein ganz eigenes Wort besitzt: »er ist nicht so schlitzohrig«, andere sprechen »schlitzhärig«, und meinen, es bedeute einen Haarspalter. Das trifft aber den Sinn nicht, und der grübelnde Schwabe wäre viel mehr ein Haarspalter als der Pfälzer. Wer so praktisch pfiffig ist wie einer, dem der Büttel schon einmal die Ohren geschlitzt hat, ist schlitzohrig, ein »durchtriebener« Schlaukopf. Kraft dieser angestammten Lebensklugheit hat sich der Franke in der Pfalz, am Mittelrhein und Untermain den Boden dienstbar gemacht, wie kein anderer deutscher Stamm. »Dem Pfälzer kalbt selbst der Ochs.« Der französische Marschall Grammont erzählt uns in seinen Denkwürdigkeiten, wie er zehn Jahre nach dem westfälischen Frieden durch die Pfalz gereist sei und das Land, das er zwei Jahre vor dem Frieden als ein von Grund aus verwüstetes geschaut, nun wieder aufblühend und bevölkert gesehen habe, »als sei niemals Krieg gewesen«. Wenn sich die Pfalz überhaupt nach so vielen und furchtbaren Kriegsnöten immer so fabelhaft rasch wieder erholt hat, so liegt das gewiß nicht bloß an der Üppigkeit des Bodens, sondern mehr noch in der unvertilgbaren Frische, Raschheit und Schnellkraft der Bewohner. Denn auch in der Pfalz wachsen nur Dornen und Disteln von selber, und nicht Brot und Wein. Zu der Notiz des Marschall Grammont muß man das Bild jenes Bauern fügen, der bei der Belagerung von Mainz im Bereich der Kanonen einen Schanzkorb auf Rädern vor sich herschob und hinter diesem seine Feldarbeit verrichtete. Hier hat man Ursache und Wirkung.
Ein glänzendes Beispiel fränkischer Regsamkeit bietet die wunderbare Ausbreitung und Vervollkommnung des pfälzischen Tabakbaues, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von der Rheinebene bis in die äußersten Täler des Westrich vordringend, das ganze Land in verhältnismäßig kurzer Zeit erobert hat.
Mit dieser rasch entzündeten wirtschaftlichen Tatkraft ist dann freilich auch der einseitige pfälzische Materialismus eng verkettet, und der rheinische Dialektdichter Lenning hat auf diesen Charakterzug seiner Landsleute den rechten Vers gemacht:
»Mar is uff dare Welt (freilich aach Gott zu ehrn)
Jo doch for sunscht nix do, als
for ze proffedeern.«
Die Pfälzer sind aber nicht bloß schlagfertig mit Karst und Spaten, wie ihre fränkischen Vorfahren schlagfertig waren in der Politik und mit dem Schwert, sie sind es auch mit der Zunge. Hier unterscheidet sich der Franke von dem nachdenklicheren Alemannen und vollends von dem noch viel schweigsameren Schwaben, und die Pfälzer sind in der flinken und schneidigen Rede ganz und gar fränkisch geworden. Namentlich der Vorderpfälzer; minder die etwas langsameren Westricher. Auf jedes Wort muß ein Gegenwort fallen und zwar Schlag auf Schlag. Auf jede unbequeme Bemerkung muß man kräftig auftrumpfen, damit man nicht für einen Pinsel gelte. Besser, du sagst eine Dummheit, als du sagst gar nichts. Sagst du die Dummheit nur recht nachdrücklich, so wiegt sie schon so schwer, wie ein gescheites Wort. Andere Leute reden auch nicht lauter Weisheit, aber sie reden leiser als die Pfälzer.
Man braucht nur die Eisenbahnfahrt eines Tages durch Bayern, Schwaben und die Pfalz zu machen, um am Morgen, Mittag und Abend ein dreifach aufsteigendes crescendo des Redetons bei den drei Stämmen wahrzunehmen. Der Bayer verstummt, wenn ein Fremder neben ihm sitzt; der Schwabe spricht schon offener; der Pfälzer aber redet die wildfremde Gesellschaft am liebsten gleich im ganzen an, jedes Eisenbahnabteil wird ihm zu einer Volksversammlung. Will man innerhalb des fränkischen Stammes eine ähnliche Stufenreihe des Redetons übersichtlich mit dem Eilzuge durchfahren, so nehme man die Linie Nürnberg-Frankfurt-Ludwigshafen. Der Obermain-Franke schlägt nur ein mezzo-forte an, bei Hanau und Frankfurt hebt sich die Unterhaltung schon zum vollen forte, sowie man aber bei Mainz den Rhein überschritten hat, schwillt der Redestrom zum fortissimo. Wenn wir uns am Sonntage einem pfälzischen Wirtshause nähern, so schallt uns häufig ein Wortgebraus entgegen, daß wir meinen, da drinnen zankten sich hundert Leute auf Mord und Totschlag. Treten wir ein, so sind es nicht zwanzig, die in friedlichen Gruppen mit all dem Getöse nur ein Plauderstündchen halten und von Wein und Wetter sprechen.
Goethe bemerkt einmal, daß in Frankfurt, als einer Reichsstadt, ein gewisses barsches Wesen durchaus nicht für unliebenswürdig gegolten habe, ja mit Verstand im Hintergrunde sogar willkommen gewesen sei. Dies trifft aber nicht bloß Frankfurt, sondern das ganze Frankenland, im Winkel des Rheins, Mains, Neckars und der Nahe bis zur Lahn. Die Franken des Obermains, namentlich wo sie sich ins Thüringische verlieren, sind schon milder und äußerlich höflicher in ihren Formen, desgleichen die Niederrheiner von Koblenz abwärts, wie auch die Alemannen des Oberrheins. Jene liebenswürdige Barschheit, die allerdings in Frankfurt und weiter nordwärts vorherrscht, ist keineswegs Grobheit, sondern soll vielmehr ein frisches, ungeniertes, überlegenes Wesen ausdrücken. Im schlimmsten Falle steckt manchmal etwas Prahlerei dahinter. Das Volk nennt solches Aussprechen einer gewissen Kraftnatur auch nicht »barsch«, sondern »forsch«. Wer pfälzische Dialektpoesie charakteristisch vorlesen will, der muß vor allem diesen »forschen« Ton inne haben, während derselbe bei alemannischen Gedichten sehr übel angewandt wäre. Grüßt der Pfälzer recht volkstümlich liebenswürdig, so wirft er seinen »Guten Morgen« gleichfalls im echten Kraftton dem andern entgegen und rückt nur ein wenig an der Kappe, »als säßen Spatzen darunter«. Das ist burschikos, nicht grob. Die Rheinfranken kommen darum bei den Altbayern leicht in den Ruf von Dünkel und Unart; denn der altbayerische Städter ist überreich an Höflichkeitsschnörkeln und zieht den Hut dreimal so tief wie der Pfälzer. Es fragt sich aber trotzdem sehr, wer von beiden im Wesen höflicher und zugänglicher ist. Durch ganz Deutschland zieht sich der Vorwurf gegenseitiger Grobheit; so nennen die Westricher die Vorderpfälzer »grobe Pfälzer«, diese dagegen die Leute von der Sickingerhöhe »grobe Sickinger«.
Die Bildung des Pfälzers geht mehr in die Breite als in die Tiefe. Es stimmt zu seinem demokratischen Zuge, daß sein Land eine der bildsamsten und verständigsten deutschen Volksgruppen beherbergt, aber innerhalb derselben ragen seit Jahrhunderten nur wenig berühmte Männer hervor und kaum ein großer Name.
Nach W. H. Riehl, Die Pfälzer. Ein rheinisches Volksbild. Stuttgart 1857 (Cotta).
(Die römische Militärgrenze am Rhein und an der oberen Donau.)
Von Museumsdirektor J. B. Keune, Metz.
Ein stehendes Heer kannte auch die römische Kaiserzeit. Dieses Heer war aber während der ersten 300 Jahre unserer Zeitrechnung nicht in Garnisonen über das ganze Reich verteilt, wie heutzutage, sondern an den Grenzen zusammengezogen. Die Landesteile, die nicht mit Truppen belegt waren, hießen daher »unbewaffnete Provinzen«; zu ihnen zählte auch Metz und das zugehörige Gebiet, die »civitas Mediomatricorum«, die Gaugemeinde der Metzer. So standen die Legionen und die ihnen zugeteilten, an Zahl ungefähr gleichen Hilfstruppen auch an der Rheingrenze. Solange der Rhein selbst die Reichsgrenze bildete, wurden beide Teile in Standlagern untergebracht, welche am linken Rheinufer errichtet waren. Als aber am Mittel- und Oberrhein die Reichsgrenze über den Rhein vorgeschoben war, wurden die leichten Hilfstruppen, nämlich die Reitergeschwader und die in selbständige Kohorten gegliederte leichte, teilweise berittene Infanterie, beide in einer Stärke von je 500 oder 1000 Mann, in die jenseits des Rheines angelegten Standlager vorgezogen. Die Legionen hingegen, welche weit stärkere Verbände von 5000-6000 Mann schwerer Infanterie darstellten, blieben als Kern und Rückhalt in den rückwärtigen Lagern zu Mainz und Straßburg – außerdem zu Windisch bei Brugg an der Aare in der Schweiz – stehen. Alle diese Standlager waren, wie dies ja selbst für die in der Regel täglich wechselnden Marschlager Vorschrift war, befestigt. Anfänglich waren es nur mit Hilfe von Erde und Holz hergerichtete »Erdlager«. Diese wurden aber später meist in Stein umgebaut. Eine Zwischenstufe bildeten Bauten, deren Mauern aus Holzbalken und Steinen ohne Mörtelverbindung nach gallischem Vorbild aufgeführt waren.
Der Zutritt zu diesen Lagerfestungen, die wir als »Kastelle« zu bezeichnen gewohnt sind, war nur den Soldaten gestattet. Bürgersleuten war der Zutritt zum Lager verwehrt: Daher siedelten sich Marketender, Krämer und Kneipwirte, wie auch die Soldatenfrauen mit ihren Kindern außerhalb des Lagers, insbesondere auf dessen Rückseite in gemessener Entfernung an. Diese bürgerlichen Niederlassungen oder Lagerdörfer hießen mit gemeinsamem Namen »canabae«, von welchem Wort das französische »cabane« (Hütte) wie unser Kraftwort »Kneipe« sich herleiten. Aus den Lagerdörfern haben sich später öfters große, blühende Gemeinwesen entwickelt.
Die Donau bildete die römische Reichsgrenze, nachdem die Stiefsöhne des Kaisers Augustus, Drusus und Tiberius, das Land südlich dieses Stromes erobert hatten (15 v. Chr.). Der Rhein war die Grenze, seitdem vom Kaiser Tiberius nach dem Jahre 16 n. Chr. die Eroberungspolitik im jenseitigen Germanien aufgegeben war. Damit war aber nicht etwa den Germanen das rechte Rheinufer zu freier Verfügung überlassen. Vielmehr waren diese vom Ufer abgedrängt und war hiermit ein von den römischen Truppen teilweise als Weideland u. dgl. benutztes Ödland geschaffen. Auch war am Mittelrhein das Vorland von Mainz militärisch besetzt geblieben. Doch die Grenze über den Rhein vorzuschieben blieb erst einer späteren Zeit vorbehalten. Nachdem bereits unter Kaiser Vespasianus im Jahre 74 n. Chr. (nach dem Zeugnis eines Meilensteines) eine durch Lagerfestungen gesicherte Militärstraße von Straßburg nach der oberen Donau angelegt war, hat Kaiser Domitianus gelegentlich eines Krieges mit den Chatten (Hessen) im Jahre 83 n. Chr. die Reichsgrenze am Mittelrhein bis zum Taunus und Vogelsberg verlegt und das geschaffen, was in seiner letzten Staffel als »Pfahlgraben« auftritt und wofür der Name »limes« seit den planmäßigen Ausgrabungen und Untersuchungen der Überreste der römischen Grenzanlagen in Deutschland (1892) jedermann geläufig ist.
Doch wird dem Wort »limes« allgemein ein Begriff untergelegt, der ihm nicht zukommt. Gewöhnlich wird nämlich darunter eine der chinesischen Mauer und ähnlichen Bollwerken gleichwertige fortlaufende Grenzbefestigung (Grenzwehr, Landwehr) verstanden. Da aber sorgfältige Untersuchungen gelehrt haben, daß das, was man als solche Grenzwehr ansieht und was als Pfahl, Pfahlgraben und Teufelsmauer bezeichnet wird, erst den Abschluß jener Grenzanlagen darstellt und zudem als regelrechte, gegen geordneten feindlichen Angriff widerstandsfähige Befestigung nicht angesehen werden kann, so hat die Limesforschung eine andere Deutung des Wortes »limes« angenommen. Das Wort bezeichnet eigentlich einen offenen, unbebauten, also weder von Gebäuden besetzten, noch beackerten oder bepflanzten Geländestreifen, wie er bei Wasserläufen und Wasserleitungen, bei Stadtmauern und Heerstraßen beiderseits belassen wurde. Durch diese Ödlandstreifen oder Schneisen wurden bei Fluß- und sonstigen Wasserläufen Rechtsstreitigkeiten verhindert, bei Wasserleitungen Stetigkeit und Trinkbarkeit des zur Siedelung geleiteten Wassers, bei Stadtbefestigungen deren wirksame Verteidigung und bei den dammähnlich gebauten Heerstraßen die Sicherheit der auf diesen marschierenden Truppe gewährleistet.
In ihren Anfängen war aber diese jenseits des Rheines vorgeschobene Reichsgrenze nur gekennzeichnet durch die Grenzschneise, in welcher, an eine die Schneise durchziehende Grenzstraße angelehnt, Wachttürme aus Holz errichtet waren. Diese Türme, die man durch Gräben und Pfähle (Palisaden) oder Zaun gegen etwaige Überrumpelung gesichert hatte, dienten der Überwachung des Grenzverkehrs und als optische Telegraphenstationen besonders in Stunden der Gefahr. Beide Zwecke bedingten Übersichtlichkeit des Geländes, und diese war ja durch die Eigenart des »limes« geboten, denn die Schneise war natürlich abgeholzt.
Später, unter Kaiser Hadrianus (nach dem Jahre 120 n. Chr.) wurde die ganze Reichsgrenze vom Rhein bis zur Donau, wie auch in anderen Gegenden, durch Palisaden, also sozusagen durch eine »Pfahlmauer« abgezäunt; nur wo ein Flußlauf, wie Main oder Neckar, die Grenze bildete, sah man von dieser Abzäunung ab.
Diese durch Schneise, Palisadenzaun und dahinter liegende Grenzstraße mit ihren Wachttürmen gebildete Grenze, »limes«, trennte damals die obergermanische und rätische Provinz vom germanischen Ausland und verlief von der Grenze Unter- und Obergermaniens gegenüber dem Vinxt-Bach, zwischen Hönningen und Rheinbrohl, bis nach Hienheim, donauaufwärts von Kelheim. Vom Main bis zur Grenze Rätiens war die Reichsgrenze aber zu jener Zeit noch nicht so weit vorgeschoben, wie sie es später bei Anlage des »Pfahlgrabens« gewesen ist, sie zog sich in früherer Zeit vielmehr von Wörth am Main durch den Odenwald bis zum Neckar.
Vor dem Jahre 150 n. Chr. waren die bisherigen Holztürme allmählich durch Steinbauten ersetzt worden. Nach 150 wurde aber zwischen Main und rätischer Grenze (Haghof bei Welzheim) die Reichsgrenze mit ihrer Pfahlmauer östlich vorgerückt und mit völliger Nichtachtung des Geländes großenteils schnurgerade gezogen. Im Anfang des 3. Jahrhunderts n. Chr. wurde schließlich der Pfahlzaun an der obergermanischen Grenze – mit einigen Unterbrechungen – durch einen dahinter liegenden Graben, den sogenannten »Pfahlgraben« verstärkt und stellenweise mit Rücksicht auf den neugeschaffenen Graben verlegt. Alle diese Anlagen hatten lediglich die Aufgabe, unbefugtes Überschreiten der Grenze zu verhindern oder zu erschweren, nicht aber etwa als selbständiges kriegerisches Verteidigungsmittel gegen regelrechten Angriff zu dienen. An der rätischen Grenzlinie jedoch ersetzte eine starke, hohe, zu Beginn des 3. Jahrhunderts n. Chr. an die Steintürme angebaute Steinmauer die bisherige Pfahlgrenze.
Die also gesicherte Reichsgrenze lief in ihrem letzten Zeitabschnitt großenteils in Übereinstimmung mit ihrem früheren Verlauf, von dem genannten Anfangspunkt am Rhein über die Ausläufer des Westerwaldes und den Taunus, die Wetterau umfassend, zum Main bis Großkrotzenburg bei Hanau, dann dem Main entlang bis Miltenberg, von hier, wie gesagt, in meist schnurgerader Linie bis Haghof und bog dann ab, der Grenze Rätiens entlang, ostwärts in einem Bogen über Gunzenhausen bis zu dem angegebenen Endpunkt westlich der Mündung der Altmühl. Von Großkrotzenburg bis Miltenberg war der Main natürliche Grenzscheide, im übrigen aber war die Reichsgrenze durch die geschilderten künstlichen Anlagen gekennzeichnet, die eine Länge von mehr als 175 320 = 495 km hatten.
Hinter dieser Grenze lagen die befestigten Lager, die »Kastelle«, in denen die Grenztruppen, Hilfskohorten und Reitergeschwader von je 500 oder 1000 Mann, später auch noch kleinere Truppenabteilungen Unterkunft fanden. In früherer Zeit waren streckenweise nur Detachements an die Grenze vorgeschoben, z. B. an der Stelle der jetzigen Saalburg im Taunus, die Haupttruppen aber lagen in größeren Festungen weiter rückwärts. Diese der wirksamen Verteidigung der Reichsgrenze gegen ernste Angriffe besser entsprechende Anordnung hat man jedoch unter Hadrian (117-138 n. Chr.), als der erwähnte Pfahlzaun angelegt wurde, verlassen und die Kastelle, soweit sie es nicht schon waren, alle an die Grenzlinie herangelegt; die rückwärtigen Lagerfestungen aber wurden aufgegeben. Damals wurde auch das erwähnte kleine Erdlager der Saalburg eingeebnet und hier ein größeres »Holzkastell« aufgeführt, das aber während der Regierung des Kaisers Caracalla von den Germanen im Jahre 213 n. Chr. zerstört wurde. An seiner Stelle wurde 220 m hinter dem »Pfahlgraben« eine neue, mit Steinmauern und doppeltem Spitzgraben umgürtete Festung von demselben Umfang und in ungefähr der nämlichen Lage erbaut, die mit der früheren Truppe, 500 Mann leichter Infanterie, belegt wurde. Dank der Entschließung Sr. Majestät des Kaisers ist dieses Steinkastell unter der Leitung des Geheimen Baurats Prof. L. Jacobi und seines Sohnes, des Königl. Landbauinspektors H. Jacobi, wieder erstanden und gibt ein anschauliches, lehrreiches Bild einer solchen römischen Grenzfeste zweiter Größe.
Wer jedoch hier Prunkbauten erwartet, irrt, denn ein solches Grenzlager zeigt recht einfache Verhältnisse, und der gezwungene, dienstliche Aufenthalt in ihm war gewiß nicht neidenswert, weit weniger noch als die vielgeschmähte Unterkunft in unseren heutigen Grenzgarnisonen, selbst wenn man Errungenschaften moderner Zeit, wie Eisenbahnverbindungen u. dgl. in Abrechnung bringt. Von der Einfachheit der sonstigen Verhältnisse heben sich allein ab etwa die Standbilder, die Göttern und Kaisern von den Soldaten errichtet waren, oder die besseren Badeeinrichtungen, die damals allgemeines Bedürfnis waren und daher auch bei den befestigten Lagern niemals fehlen (»Militärbäder«).
Gleich allen Kastellen, wenn man unregelmäßige Bauten der Spätzeit ausschließt, hat auch die Saalburg eine regelmäßige viereckige Gestalt mit abgerundeten Ecken. Während aber die älteren Anlagen gleichseitige, regelmäßige Vierecke (Quadrate) sind, hat das spätere Saalburgkastell eine damals übliche länglich-rechteckige Gestalt. Das ummauerte Lager der Saalburg hatte nämlich eine Länge von 150 und eine Breite von 100 römischen Doppelschritten (passus), also etwa 221 × 147 m, und zwar waren die in der Richtung der Grenzlinie verlaufenden Seiten die kürzeren. Gesichert war das Lager durch eine mit Zinnen gekrönte Mauer von 1,92 m Dicke, die in der mutmaßlich ursprünglichen Höhe von 4,80 m wieder aufgeführt ist. An die Mauer lehnt sich auf der Innenseite ein um etwa 2½ m niedrigerer Erdwall an, der als Wehrgang gedient hat. Hier standen die Verteidiger der Mauer, im Rücken gedeckt durch eine kurze Quermauer, welche sich an die Zinnen jedesmal links (von ihnen betrachtet), anschließt. Hier war auch Raum zur Aufstellung der Geschütze oder Wurfmaschinen In der Saalburg sind mehrere rekonstruierte Geschütze aufgestellt, die Seiner Majestät dem Kaiser von der Gesellschaft für lothringische Geschichte geschenkt wurden.. Am Fuß dieses hinter der Steinmauer angeschütteten Erddammes entlang läuft ein Verbindungsweg innerhalb der ganzen Lagerfestung herum.
Unterbrochen waren die Mauerzinnen nebst dem Wehrgang auf jeder der vier Seiten von zwei überragenden, jedoch verhältnismäßig niedrigen Türmen, welche die vier einfachen oder gedoppelten Lagertore einrahmten. Diese vier Tore, die allen Lagerfestungen eigentümlich sind, trugen dieselben besonderen Benennungen, wie beim Marschlager: Der Auslandseite zugekehrt war die »porta praetoria«; nach rückwärts, also dem Römerreich zu gelegen, war die »porta decumana«; die beiden als Ausfalltore benutzten Seitentore wurden als »porta principalis sinistra« und »porta principalis dextra« bezeichnet (linkes und rechtes Prinzipaltor, von rückwärts gerechnet). Dagegen entbehrten die abgerundeten Ecken des steinernen Saalburgkastells der Türme, die wir sonstwo antreffen und die auch bei dem Vorläufer des Steinkastells der Saalburg in Holz vorhanden gewesen sind. Wie bereits bemerkt, umgab die Ringmauer des steinernen Saalburgkastells ein doppelter Spitzgraben, d. h. zwei nebeneinander ausgehobene Gräben mit spitz zulaufender Sohle. Sie setzten nicht unmittelbar am Fuß der Mauer an, sondern waren in einiger Entfernung vorgelegt, ließen also am Fuß der Mauer einen schmalen Zwischenraum, eine »Berme«. Mit Wasser waren die Gräben nicht gefüllt; ihre Aufgabe war, einen Sturm auf die Lagerfestung zu erschweren, die geschlossenen Sturmkolonnen zu lockern.
Die Gebäude innerhalb der Ringmauer waren meist aus sehr vergänglichem Stoff aufgeführt. Nur wenige massive Gebäude machten eine Ausnahme. Der ansehnlichste und umfangreichste Bau erhob sich am Kreuzungspunkt der beiden Straßen, von welchen eine die beiden Seitentore miteinander verband und daher »via principalis« hieß, die andere von dem rückwärtigen Tor, der »porta decumana«, ins Lager führte. Man pflegt diesen Bau als »Praetorium« zu bezeichnen, weil im Marschlager an dieser Stelle das so benannte Zelt des Heerführers Praetor d. i. prae-itor, unserem »Herzog« (lat. dux) entsprechend. errichtet wurde. Der mit dem Namen »Praetorium« belegte Steinbau des Standlagers diente aber nicht etwa dem Lagerkommandanten und Truppenführer als Wohnung, sondern umfaßte nur militärische Diensträume, die einen größeren und einen kleineren, von Pfeilerhallen umgebenen Hof umschlossen. An den größeren, der rückwärtigen Lagerseite mit der »porta decumana« zugekehrten Hof, den man mit einem von der Anlage des römischen Wohnhauses hergeholten Namen als »Atrium« bezeichnet hat, lehnt sich eine große, zu Versammlungen, Ansprachen und militärischen Übungen benutzte Halle an, der in erster Linie der vielleicht dem ganzen, an und über der »via principalis« errichteten Bau geltende Name »Principia« zukommt. Es ist dies eine Exerzierhalle, ein gedeckter Raum, in welchem »bei schlechtem, stürmischem Wetter die Truppe unter Dach unterwiesen ward«. Außerdem lagen hier eine Waffenhalle und sonstige Rüst- und Montierungskammern. Der kleinere, nach der »Porta praetoria« zu gelegene Hof ist durch eine Halle von dem größeren Hof aus zugänglich, während er bei anderen Lagerfestungen durch eine Mauer von diesem abgesperrt ist. Dieser kleinere Hof ist vor allem Vorhof des Lagerheiligtums, das die Mitte der dem Vordertor (»porta praetoria«) zugekehrten Seite einnimmt, während die beiden Schmalseiten dieses Hofes von heizbaren Geschäftsräumen und einer vermutlichen Wachtstube abgeschlossen sind.
Das Lagerheiligtum diente der Verehrung der Reichs- und Heeresgötter, wie zur Aufstellung der geheiligten Feldzeichen der Truppe und zur Aufbewahrung von hinterlegten Geldern, die ja damals überhaupt unter Obhut der Götter gestellt und daher im Bereich eines Tempels untergebracht zu werden pflegten. Dieses Fahnenheiligtum lag also nach der Auslandseite oder dem Feindesland zu, wo die »Porta praetoria« nach der nahen Grenze, dem Pfahlgraben, hinausführte.
Im Vorhof des Heiligtums waren nach Ausweis der in der Saalburg aufgefundenen Ehreninschriften und Statuenreste verschiedenen Kaisern Standbilder von der Lagertruppe aufgerichtet. Daher sind jetzt hier zwei bronzene Kaiserbilder aufgestellt, welche Hadrian und Alexander Severus darstellen: unter jenem ist, wie man annimmt, das vergrößerte Lager der Saalburg angelegt und von der Truppe bezogen worden; der letztere hat Umbauten im Lager vornehmen lassen. Auch vor der »porta decumana« hat, zwischen den beiden Toröffnungen, ein Bildnis, und zwar aus Stein auf steinernem Sockel, gestanden. Deshalb hat hier Se. Majestät der Kaiser eine Bronzestatue des Kaisers Antoninus Pius (138-161 n. Chr.) aufstellen lassen, den die Besatzung des Standlagers im Jahre 139 oder 140 nachweislich durch ein Bild und Sockelinschrift geehrt hatte, da unter ihm vielleicht erst das größere Standlager angelegt, gewiß aber die Anlage verbessert worden. Diese Bildnisse nebst den Weihdenkmälern waren, wie gesagt, fast das einzige, was von den sonstigen einfachen Verhältnissen abstach. Denn während die meisten Bauten im Lager sparsam aus Holz oder Fachwerk aufgebaut gewesen sein müssen und keine Spuren hinterlassen haben, waren außer dem geschilderten Hauptbau, dem »Praetorium« oder den »Principia«, nur noch zwei in dem rückwärtigen Teil des Lagers zwischen dem Hauptbau und der Porta decumana errichtete Bauten dauerhafter gestaltet: das eine der beiden Gebäude war ein Proviantmagazin, das andere ist als Intendanturgebäude (Dienstgebäude des Oberzahlmeisters), von anderen dagegen als militärisches Vereinshaus gedeutet worden.
Im Vorderlager, wo eben die leichten, mit Schindeln oder Schilf und Stroh gedeckten Lagerbaracken standen, in welchen die Mannschaften untergebracht waren, sind von dauerhafteren Bauten nur die Reste eines kleinen Bades mit seiner Heizanlage aufgedeckt. Dies Bad, das vielleicht zu einem Lazarett gehörte, entstammt jedoch einer älteren Zeit und war später eingeebnet. Das regelmäßig bei den Standlagern vorhandene »Militärbad« muß auch auf der Saalburg außerhalb der Lagerfestung angelegt gewesen sein.
Diese noch nicht festgestellte Badeanlage gehörte also zum Bereich der bürgerlichen Ansiedlung, der erwähnten »canabae«. Zu diesem »Lagerdorf« zählten auch zwei in nächster Nähe der Lagerfestung gelegene größere Baulichkeiten, die außerhalb der Porta decumana, seitwärts errichtet waren: Ein mit heizbaren Zimmern und Sälen sowie auch mit einem Baderaum ausgestattetes Gebäude war, wie man vermutet hat, die Wohnung des Lagerkommandanten in friedlicher Zeit. Dabei dehnte sich eine Anlage aus, deren Fundstücke, Ketten, Hufeisen, Trensen und anderes Zubehör zu Pferde- und Wagengeschirr, die Annahme wahrscheinlich machen, daß hier eine große Herberge und Ausspann für Fuhrleute gewesen: denn Frachtfuhrwerke spielten ja damals, wie überhaupt in der »eisenbahnlosen schrecklichen Zeit« eine sehr gewichtige Rolle im Verkehrswesen. Auch ein vor dem rechten Prinzipaltor, in der Nähe der nach dem germanischen Ausland führenden Straße gelegenes umfangreiches Gebäude hat vielleicht eine bedeutsame Rolle in dem Handelsverkehr jener Zeit gespielt und ist daher als »Kaufhaus« bezeichnet worden.
Von den einfacheren Bauten des Lagerdorfes, die sich vornehmlich weiter außerhalb, beiderseits der in schnurgerader Richtung die städtische Ansiedlung bei Heddernheim mit der Saalburg verbindenden Römerstraße aneinander reihten, sind neben den – auch innerhalb des Mauerringes der Lagerfestung nicht fehlenden und mehrfach auch festgestellten – Ziehbrunnen nur noch die Umfassungsmauern der Keller erhalten geblieben. Es sind dies die Reste der in ihrem Oberbau aus leichterem Stoff hergestellten Wirtschaften, Kramläden und Wohnungen der Soldatenfamilien.
Ferner waren aber hier – rückwärts und seitwärts von der Festung – die Tempel untergebracht, für welche das Lager selbst keinen Raum bieten durfte, nämlich die Tempel, in denen Soldaten wie Bürgersleute ausländischen und heimischen Gottheiten und Schutzgeistern huldigten. So sind im Lagerdorf der Saalburg nicht weniger als drei Kultstätten asiatischer Gottheiten nachgewiesen.
Jenseits des Lagerdorfes lagen – beiderseits der genannten Heerstraße nach Heddernheim – die Wohnungen der Toten, die Grabstätten. Es waren Brandgräber, da ja die Lagerfestung aufgegeben wurde zu einer Zeit, da die Leichenverbrennung noch nicht durch die Erdbestattung wieder verdrängt war. Schon vorher – gegen 234 n. Chr. – muß das Lagerdorf von germanischen Scharen niedergebrannt worden sein, während die Lagerfestung standhielt.
Das Jahr 260 n. Chr. ist aber der späteste Zeitpunkt für das Ende der beschriebenen Grenzwehr. Mit diesem Jahr ist sie endgültig aufgegeben und der Rhein wieder Reichsgrenze geworden. Allerdings zogen die Römer stellenweise auch damals ihren Fuß nicht ganz vom rechten Rheinufer zurück: so war Wiesbaden noch im 4. Jahrhundert n. Chr. in ihrem Besitz. Als Ersatz der Grenzanlagen wurde ein anderes Abwehrmitte gegen die drohenden und öfters einbrechenden Germanen geschaffen. Bis dahin offene Städte und Dörfer, die an den nach dem Binnenland führenden Heerstraßen lagen, wurden vor und nach 300 n. Chr. weit nach Gallien hinein in großer Zahl befestigt. Da ihre Mauerringe enger gezogen waren als das Weichbild des Ortes bisher gewesen, so wurden die vor und in die Befestigungslinie fallenden Gebäude wie auch die vor den Orten gelegenen Grabbauten mitleidlos niedergerissen, ihre Architekturstücke und meist mit Bildwerk geschmückten Blöcke aber in den Grundmauern der Befestigung verwertet. Aus dieser sind sie vielfach jetzt herausgeholt worden und legen Zeugnis ab von der großen Blüte des »unbewaffneten« gallischen Hinterlandes, insbesondere im 2. Jahrhundert n. Chr. So verdankt das Trierer Museum eine hervorragende Sammlung kulturgeschichtlich lehrreicher Bildwerke von Grabdenkmälern der Befestigung von Neumagen an der Mosel. Auch zu Metz sind solche Baureste und Bildersteine schon vor Hunderten von Jahren, wie auch im Jahre 1822 und neuerdings, 1900/01, in den Fundamenten der römischen Ringmauer zum Vorschein gekommen und teilweise erhalten und im Museum aufgestellt.
Die Metzer Mauer hat aber, vernachlässigt und verfallen, den Einbruch der Hunnen 451 n. Chr. nicht abzuhalten vermocht. Doch muß sie später wieder instand gesetzt worden sein und die mittelalterliche Stadt geschützt haben, bis eine Erweiterung durch Umspannen eines Teiles der vor der damaligen Altstadt erstandenen Vorstädte notwendig geworden war.
Die ältesten Berichte über die Geographie Innerdeutschlands machen uns nicht mit einem einzelnen Teile des deutschen Mittelgebirges bekannt, sondern fassen dessen Glieder unter dem Namen des Herzynischen Waldes zusammen. In unserem größten Volksepos wird der Spessart als selbständiges Einzelgebirge erwähnt, und zugleich zeigt sich sein Name dort in einer Form, die über seinen Ursprung kaum einen Zweifel übrig läßt. In der 16. Aventiure des Nibelungenliedes hören wir den auf die Ermordung Siegfrieds sinnenden Hagen von Tronje, der bei der Jagd im Odenwald den Wein absichtlich vergessen, sich entschuldigen mit folgenden Worten:
»Vil lieber herre mîn,
ich wânde daz diz pirsen hiute solde sîn
Dâ zem
Spehtsharte; den wîn den sande ich dar.«
Dieser Spechtswald ist fast auf allen Seiten durch Flüsse begrenzt. Seine südliche Hauptmasse ist hineingeschoben in das Viereck, welches der Main zwischen Gemünden und Hanau umschreibt, während der nördliche Teil in das Dreieck eingebettet ist, welches Sinn und Kinzig bilden, und dessen Spitze im Norden liegt. Man zerlegt das im Mittel 400 m hohe Gebirge, welches im Geiersberg (617 m) die höchste Höhe erreicht, gewöhnlich in drei Teile: in den Vorspessart, welcher den äußeren längs des Mains hinlaufenden Saum bildet, wiewohl man den Namen vorzugsweise nur auf den westlichen Teil anwendet; ferner in den Hochspessart, den steileren, rauheren, dicht bewaldeten östlichen Teil, und endlich in den Hinterspessart, mehr die nördlichen, nach der Kinzig und Kahl sich senkenden Plateaumassen bezeichnend. Die Hauptwasserscheide verläuft südnördlich, beginnt Mildenberg gegenüber mit dem Engelsberg und zieht über den Geiersberg nordwärts. Sie war lange Zeit zugleich politische Grenzscheide zwischen den östlich davon gelegenen würzburgischen und den westlich davon sich ausbreitenden kurmainzischen Besitzungen. Ferner lief auf dieser Wasserscheide in der Römerzeit die via asinina, eine Heerstraße, hin, welcher der wasserscheidende Rücken noch heute die Bezeichnung Eselshöhe verdankt; eine zweite, viel wichtigere Römerstraße führte von Hanau nach Gemünden.
Der Spessart ist geologisch ein Glied jener rechtsrheinischen Kette, zu welcher auch Schwarz- und Odenwald gehören. Denn obwohl er durch das Durchbruchstal des Mains von den südlichen Nachbarn getrennt ist und vor allem als ein Bau aus Buntsandstein erscheint, so fehlt doch auch ihm ebensowenig als dem Oden- und Schwarzwald der granitne Kern. Im westlichen Teile sind die Schichten des Buntsandsteins zuweilen von Basalt durchsetzt. Von jüngeren Ablagerungen wären die Schichten mit dürftigen Andeutungen von Braunkohlenflözen (bei Erlenbach und Aschaffenburg), die bis 15 m mächtigen Lager feuerbeständiger Tone (in und bei Aschaffenburg, Klingenberg), die braunen, lehmigen Schichten des Löß von ausgezeichneter Fruchtbarkeit (besonders zwischen Wallstadt und Kleinostheim), die Torfmoore des Lindigbruchs bei Dettingen und die von Stockstadt zu erwähnen. Die Pflanzenerde ist im ganzen Gebiete des Spessarts vorherrschend Sandboden, im Vorspessart reichlich mit Humus vermengt, im Hochspessart meist magerer, tonarmer, fast kalkleerer Quarzsand, aber durch beigemengte Feldspatteilchen und ziemliche Mächtigkeit imstande, herrliche Forsten zu tragen. Die Flußtäler sind eng und meist tief eingeschnitten; in ihnen eilen Bäche nach Osten, Süden und Westen zum Main; doch sind sie mit einer einzigen Ausnahme nicht geeignet zum Holzflößen.
Daß der Spessart in der vorchristlichen Zeit bevölkert gewesen, ist nicht erwiesen; denn die im Volksmunde übliche Bezeichnung »Allvaterbaum« für eine Eiche im Frammersbacher Forstrevier würde eher das Gegenteil beweisen; es würde darin mehr eine Hindeutung liegen auf jene Zeit, wo die Bewohner Asenheims allmählich aus der Erinnerung schwanden, sodaß man Donars Baum dem Wodan weihte. Erst als der heilige Kilian seine Missionstätigkeit begann im 8. Jahrhundert, folgten Klöster seiner Spur am Main im Vorspessart. Die frommen Väter suchten eine ihrer Hauptaufgaben im Landbau. Und je mehr sich der Vorspessart mit Ansiedelungen bedeckte, um so mehr mußte man hinaufrücken in die rauheren, anfangs nur als Jagdgebiet benutzten Striche des Hochspessarts. Sicher ist, daß im 14. und 15. Jahrhundert Hessen von den Ufern der Fulda in diese Teile des Spessarts eindrangen und im 16. Jahrhundert Einwanderer aus Böhmen und Tirol sich hinzugesellten, um Glas zu blasen und Kohlen zu brennen. So kommt es, daß die meisten Orte im Hochspessart ursprünglich Glashütten waren, wo besonders Glasknöpfe gefertigt wurden. Während diese Hütten anfangs hin und her wechselten, wurden sie später stehend, und um sie herum lagerten sich Ortschaften. Diese Anlehnung geht zum Teil aus dem Namen der Dörfer hervor: Heinrichshütte, Ruppertshütte, Knopfhütte usw. Die Anlage der Ortschaften hat sich den örtlichen Umständen anbequemen müssen. Entweder bilden die Häuser in doppelter Reihe an beiden Seiten des schmalen Tales eine lange Gasse, oder sie stehen in einer Talerweiterung, einer Talmulde zusammengehäuft.
Was das Innere der Wohnungen anbetrifft, so kann man auch in der Gegenwart noch Wohnungen finden, die an jene Schilderung erinnern, welche Simplicissimus, der Sohn des Spessart, von der Wohnung seines Knan (Vaters) in bitterer Ironie entwirft I. Buch, Kap. 1.: »Mein Knan hatte einen eigenen Palast; er war mit Laimen (Lehm) gemalet und anstatt des unfruchtbaren Schiefers, kalten Bleies und roten Kupfers mit Stroh gedeckt, darauf das edel Getreid wächst. Und damit mein Knan mit seinem Adel und Reichtum recht prangen möchte, ließ er die Mauer um sein Schloß aus Eichenholz aufführen. Seine Zimmer, Säl und Gemächer hatte er inwendig vom Rauch ganz erschwärzen lassen; nur darum, dieweil dies die beständigste Farbe von der Welt ist und dergleichen Gemälde bis zu seiner Perfektion mehr Zeit brauchet, als ein künstlicher Maler zu seinen trefflichsten Kunststücken erheischet. Die Tapezierereien waren das zarteste Geweb auf dem ganzen Erdboden (nämlich Spinnengewebe); seine Fenster waren keiner andern Ursach halber dem Sant Nit-glas gewidmet, als dieweil er wußte, daß ein solches Fenster von Hanf oder Flachs viel mehr Zeit und Arbeit kostet, als das beste Glas von Muran. Anstatt der Pagen, Lakaien und Stallknechte hatte er Schaf, Böcke und Sau. Die Rüst- und Harnischkammer war mit Pflügen, Kärsten, Äxten, Hauen, Schaufeln, Mist- und Heugabeln genugsam versehen, mit welchen Waffen er sich täglich übte. Denn Hacken und Roden war seine disciplina militaris; Ochsenanspannen sein hauptmannschaftliches Kommando, Mistausführen sein Fortifikationswesen, Ackern sein Feldzug, Holzhacken sein tägliches Exerzitium, Stallausmisten seine Kurzweil.«
Zwar gilt diese Schilderung, die auch für jene Zeiten übertrieben war, heute nach 300 Jahren nicht mehr in ihren Einzelheiten, aber auch jetzt noch machen die Wohnungen im Hochspessart vielfach einen traurigen Eindruck. Nur selten läuft an der Langseite des Hauses ein Gärtchen hin. Die Hütten bestehen oft nur aus übereinander geschichteten Balkenvierecken, deren Fugen mit Lehm verschmiert sind. Die Rückwand der einstöckigen Häuser ist an den Berg gelehnt, daher sehr feucht. Der Keller ist wegen des Felsenuntergrundes ein oberirdischer, der das Erfrieren der Kartoffeln begünstigt. Auf einigen Steinstufen gelangt man zu der über dem Keller liegenden Wohnung. Das Schwarz ist die überwiegende Farbe im Innern und Äußern und bei dem Mangel ordentlicher Schornsteine kein Wunder. Gewöhnlich besteht ein solches Wohnhaus aus zwei Kammern und der zugleich als Tenne benutzten Küche; die Dielen fehlen nicht selten. Der riesige Ofen, die Wandbank, der Tisch und ein sogenanntes Bett bilden den Hausrat, Heiligenbilder und Photographien solcher Angehörigen, die ein Stück Welt gesehen, den Zimmerschmuck. Wenn man nun erwägt, daß in solchen niedrigen, schmutzigen Kammern nicht bloß eine, sondern oft mehrere Familien in einer dem Fremden unerträglichen Hitze Tag und Nacht zusammengepfercht sind; daß man die winzigen Fenster nur aus Neugierde, nicht aus Gesundheitsrücksichten öffnet; daß man – durch die Ofenglut halb geröstet – nur leicht bedeckt in den Hofraum geht und sich hier beschäftigt; daß die Nahrung bei aller schweren Arbeit auf Kartoffeln, rahmlose Milch, Brot (aus Kartoffeln, Heidemehl und Hafer), auf Brot- und Bohnensuppe und auf sogenannten Kaffee (aus Zichorie und gebranntem Korn) beschränkt ist: so hat das ärmliche, dürftige Aussehen, das frühe Verblühen des Hochspessarters nichts Auffallendes. Viel vorteilhafter sind natürlich in bezug auf Wohnung und Ernährung die Bewohner des Vorspessarts gestellt, und ihren im allgemeinen sehr günstigen Gesundheitsverhältnissen ist es zuzuschreiben, wenn die Statistik der Pfarrbücher 25 Prozent der Spessartbevölkerung im Alter von 60 bis 90 Jahren angibt.
Der Spechtwäldler trägt keine eigentliche Volkstracht; höchstens der grüne Kittel erinnert an die Zeit gleicher, einfacher Kleidung und bekundet vielleicht unabsichtlich die Anhänglichkeit an den Wald. Die alte Spessarttracht, nämlich der bis an den Hals zugeknöpfte Oberrock, die kurzen ledernen Beinkleider mit Strümpfen und Schuhen, ist geschwunden. Man begnügt sich jetzt Sommer und Winter mit Barchenthosen oder solchen von Leinwand. Die meisten Spessarterinnen haben ebenfalls die ortsübliche, eigentümliche Kleidung aufgegeben; nur die Haartracht haben sie beibehalten. Das Haar wird nämlich nach hinten glatt gekämmt, dann zurückgeschlagen und auf dem Wirbel in einen Knoten befestigt, der meist mit einem Häubchen bedeckt ist. Zu Festlichkeiten bieten dem Spessarter meist nur Familienereignisse Anlaß, so Hochzeiten und Kindtaufen; einzig die Kirchweih ist ein Freudenfest von größerem Umfang. Das Familienleben entbehrt nicht der Innigkeit; friedliebend teilt der Vater Arbeit und Genuß mit Weib und Kind, erntet Teilnahme und treue Anhänglichkeit für die Beschwerden des Lebens. Das enge Beisammenwohnen mehrerer, oft nicht einmal verwandter Familien trägt freilich naturgemäß sehr oft den Keim zu unsittlichen Verhältnissen in sich. Treue Anhänglichkeit an Fürst und Verfassung, Gastfreundschaft, Biederkeit und Tapferkeit sind Eigenschaften, die man bis in unser Jahrhundert dem Spessarter nicht absprach. In neuerer Zeit jedoch sind viele der ehemals trotz ihrer dürftigen Lage zufriedenen Leute durch ausgewanderte und wieder heimgekehrte Landsleute sozialdemokratisch angehaucht. Kirchlicher Sinn zeichnet besonders die Jugend der katholischen Gegenden aus, wenn man Wallfahrten u. dgl. als Beweise eines solchen will gelten lassen.
Treten wir nun den Hilfsquellen näher, die der Spessart seinen Bewohnern eröffnet! Den Bergbau anlangend, so galt in früherer Zeit der Vorspessart für mineralreich. Kupfer- und Eisenschmelzen, Eisenhämmer, Glashütten, Porzellanfabriken deuteten darauf hin. Auch Kobalt und Schwerspat, feuerbeständiger Ton, Sandstein kamen und kommen an manchen Stellen vor. Gegenwärtig sind die Bergwerke aufgelassen, und die Eisenhämmer stehen still; denn das seit dem Bahnbau über den Spessart (von Aschaffenburg nach Lohr) eingeführte ausländische Eisen bereitete der heimischen Industrie den Tod, da sie infolge kostspieliger Landbeförderung und hoher Holzpreise den Wettbewerb nicht aushalten konnte. Auch die Glashütten sind mit dem Steigen der Holzpreise der Ungunst äußerer Verhältnisse zum Opfer gefallen. Von den alten, um 1400 entstandenen zwölf Glasmacherdörfern hatten bereits um 1780 acht keine Glashütten mehr, und 1889 stellte die letzte Löwensteinische Hütte zu Einsiedel den Betrieb ein.
Die landwirtschaftlichen Verhältnisse sind naturgemäß im Vorspessart andere als im Hochspessart. In diesem bereiten spät eintretende Frühlingswärme, die oft dünne, sandige Ackerkrume, steile Berge, ausgedehnter Wald, häufige Regengüsse, welche die Dammerde wegschwemmen, dem Landbau entschiedene Hindernisse. Kartoffeln, Hafer, Heidekorn, Flachs, Hanf und Sommerkorn sind die Haupterzeugnisse. Im Vorspessart wachsen bessere Getreidearten, gutes, schmackhaftes Obst und sonstige Gartenfrüchte. Für Obstkultur zeigt sich überhaupt im Spessartgebiet reges Streben, selbst die waldumschlossenen Höhen des Hochspessarts zeitigen hie und da veredelte Obstsorten. Die beste Ackerkrume haben natürlich die Randgebiete, die Mainebene und der Kahlgrund. An den Südabhängen des Spessarts wird sogar bei Wertheim, Stadtprozelten und Miltenberg bedeutender Weinbau betrieben.
Die Viehzucht ist im allgemeinen im Hochspessart noch in traurigem Zustande. Der Bauer unterhält, ohne sich um Verbesserung der Wiesen und Stallfutter groß zu kümmern, einen zahlreichen Rindviehstand von kleiner, schlechter Rasse, seine Tiere – sofern sie nicht weiden können – mit Stroh nährend. Der Dünger geht schon dadurch zum guten Teil verloren, ebenso durch die zu häufige Verwendung des Viehes auf der Landstraße. Diese schwächlichen Tiere werden durch zu zeitigen Gebrauch zugrunde gerichtet.
Die Hauptnahrungsquelle aber war für den Spessartbewohner von jeher der Wald, er gibt auch heute noch etwa 60 Dörfern mit 9000 Familien einen allerdings häufig recht kümmerlichen Unterhalt. Er bedeckt 70 Prozent der gesamten Bodenfläche, ist vorzugsweise Laub-Hochwald und seiner Zugehörigkeit nach teils Staats-, teils Stifts-, teils Gemeinde-, teils Privateigentum. In den Staatsforsten kommen nicht weniger als 68 Prozent auf Laubholz; namentlich trägt das Waldgebirge herrliche Bestände an Rotbuchen (bei Rothenbuch) und Eichen. Der Wald setzt eine Menge von Händen in Bewegung zum Holzfällen, Holzflößen, Bauholzschneiden, Dauben- und Weinpfahlzuhauen, Holzfahren, Kohlenbrennen und die Kinderhände zum Sammeln von Beeren. Die Verfrachtung von Waldprodukten ist eine bedeutende, Lohr der Hauptplatz in dieser Hinsicht. Der Main bildet die natürliche Abfuhrstraße für die geschlagenen Holzmassen, daneben werden aber auch von der Eisenbahn große Mengen befördert. Freilich hat die Waldarbeit ihre Schattenseiten: sie gewährt sofortigen Lohn und hält manchen Burschen ab von der Erlernung eines Handwerks, gewöhnt den Flößer an die Laster der Fremde, lockt manchen Bauern, seine Stiere vor den Holzkarren zu spannen und auf langen Wegen in den Wirtshäusern der Landstraße die Wirtschaft daheim zu vergessen. In neuerer Zeit ist man seitens der Regierung auch ernstlich mit der Einführung der Holzindustrie vorgegangen, die sich bei größter Arbeitsteilung mit Herstellung von Rechen-, Schaufel- und Spatenstielen, Holzschuhen, Löffeln, Korbflechtereien usw. befaßt und namentlich Winterbeschäftigungen schafft, wie dies die zum Teil recht rührig betriebene Papierfabrikation von Frammersbach bereits tut.
Eine lebhafte Anregung und Förderung erhielt die industrielle Tätigkeit im Spessart in den letzten Jahrzehnten durch den Bau verschiedener Eisenbahnen. Längs der Spessartquerbahn von Aschaffenburg nach Lohr entwickelte sich eine Fabrikindustrie in Hösbach und Laufach, für Stein- und Holzarbeiter in Heigenbrücken und Partenstein. Von Aschaffenburg aus dehnte sich seit den siebziger Jahren längs der Maintallinie bis Klingenberg die Kleiderkonfektion aus. Gegen 2000 Heimarbeiter sind in dieser Gegend für Aschaffenburger Kleiderfabriken beschäftigt. In etwa 50 Ortschaften des südlichen Maintals herrscht die Ton- und Steinindustrie. Die Kahltalbahn ließ in der Umgegend von Alzenau in kurzer Zeit zahlreiche Zigarrenfabriken entstehen, und von ihrem Endpunkt Schöllkrippen aus eröffnete sich für 25 Dörfer durch die Perlstickerei und Häkelindustrie eine neue Erwerbsmöglichkeit. Aber die besseren Lebensverhältnisse, die diese verschiedenartigen Industrietätigkeiten gestatten, kommen eben nur den Bewohnern jener in der Nähe der Bahnen und größeren Ortschaften gelegenen Randgebiete zugute. Für die Bewohner des eigentlichen Innerspessarts tritt die Ungunst der landwirtschaftlichen und industriellen Lage um so mehr hervor, als das Gebirge an Übervölkerung leidet. Ist das Leben schon in günstigen Jahren ärmlich, so tritt in Mißjahren allgemeiner Notstand ein. Unter solchen Umständen müssen schon die Bewohner der hinter der ersten Zone liegenden Randdörfer Verdienst in den Baugeschäften und Fabriken von Hanau, Frankfurt, Mannheim usw. suchen. Nur aller acht oder vierzehn Tage können sie einmal von ihren Arbeitsstätten nach Hause kommen. Der Hochspessarter aber steht als Erdarbeiter vielfach im Dienst großer Bauunternehmer. Die Kanalisation der Großstädte, der Nordostseekanal, die Petersburger Newabrücke, ja selbst die Anatolische Eisenbahn verdanken ihre Entstehung zum Teil Spessarter Händen.
Für die Hebung der materiellen Verhältnisse der Bewohner des Hochspessarts wirken jetzt mit Unterstützung der Regierung der St. Johannis-Zweigverein und der Verein der Spessartfreunde, die beide ihren Sitz in Aschaffenburg haben. Die Mittel, die diese Vereine nicht nur zur augenblicklichen Beseitigung der Not, sondern auch zur künftigen Verhütung allgemeiner Bedrängnis in Anwendung bringen, seien zum Schluß kurz zusammengefaßt: Einrichtung von Winterarbeitsschulen für Mädchen, Abhaltung von Kochkursen, Unterbringung konfirmierter Knaben in Lehrwerkstätten und bei tüchtigen Meistern zur Erlernung solcher Handwerke, die zur Beschaffung der Bedürfnisse des täglichen Lebens dienen (Maurer, Zimmerer, Schuhmacher, Schneider, Wagner, Schmiede); Förderung der Landwirtschaft durch Belehrung in landwirtschaftlichen Winterschulen über Einführung besserer Düngung, anderen Fruchtwechsels, besseren Samens; Hebung der Viehzucht durch Beschaffung guter Zuchtstiere, Gründung einer Holzschnittschule, Einführung weiterer Hausindustrien, Erschließung des Gebirges für den Touristenverkehr und endlich Verbesserung der menschlichen und tierischen Wohnungen.
Deutsche geogr. Blätter. IV. Jahrg. – Joh. Schober, Führer durch den Spessart. Aschaffenburg 1908, W. Hausmann.
Von W. Bigge in Koblenz.
Von Frankfurt, der alten Krönungsstadt und jetzigen mächtigen Handelsempore am Main, hat uns der Schnellzug südwärts getragen; jetzt braust er in die Bahnhofshalle zu Darmstadt hinein. Wir verlassen den engen Bahnwagen und wandern in der strahlenden Frühjahrssonne in die Stadt hinein, die breite Rheinstraße hinauf, an deren Ende sich die hohe, rötlich schimmernde Ludwigsäule erhebt. Ist das die stille Residenz des kleinen Hessenlandes, das Asyl für Rentner und Pensionäre? Stille und vornehme Ruhe mag in den mehr abseits gelegenen Straßen mit ihren breit und behäbig hingelagerten Adels- und Bürgerhäusern zu finden sein; im Mittelpunkt der Stadt aber herrscht kräftiges Leben und ein reger Verkehr. Darmstadt ist auf dem besten Wege, sich zur Großstadt auszuwachsen; es streckt und reckt sich und steigt langsam an den Hängen des Bergwaldes empor, der es schon von fast allen Seiten mit seinen grünen Armen umfaßt. Und dabei bleibt der Stadt immer noch ein gewisses Etwas, das ihre Eigenschaft als Residenz eines ruhmreichen Fürstengeschlechtes und zugleich als eine Pflegestätte künstlerischer Bestrebungen nicht übersehen läßt. Der Landesherr selbst ist ein eifriger Förderer modernen Fortschritts in der Kunst. Die Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe verdankt ihm ihre Entstehung, und im Jahre 1908 hat die hessische Landesausstellung in Darmstadt gezeigt, was Kunst und Gewerbe in diesem geistig regsamen Teile unseres Vaterlandes zu leisten vermögen. Überall treten uns in Darmstadt künstlerische Eindrücke entgegen. Wie der älteste, malerische Stadtteil mit den großzügigen, modernen Bauten am Paradeplatz stimmungsvoll zusammenklingt, muß jeden Beschauer angenehm berühren. Den Übergang vom Alten zum Neuen vermittelt das von blumenerfüllten Gräben umgebene Schloß der hessischen Landgrafen, ein weitläufiges Bauwerk vieler Jahrhunderte. Ihm gegenüber erheben sich das neue Hoftheater und das Landesmuseum, nicht weit davon der großartige Bau der Technischen Hochschule. Und zwischen ihnen öffnen sich die prächtigen Anlagen des Herrengartens mit ihren frischen Wiesengründen und alten Baumriesen. Was aber der Stadt ihren besonderen Reiz verleiht, das ist ihre herrliche Umgebung und die Nähe des Odenwaldes. Der Odenwald! – Es liegt ein eigner Hauch von Poesie über diesem schönen Berglande. Auch uns lockt es hinaus in seine grünen Täler und sonnigen Hänge. Ein leichter Wagen mit zwei flotten Pferden steht bereit, uns die »Bergstraße« entlang zu führen, die den Westabhang des Gebirges begleitet und ihm ihren Namen gegeben hat. Feiner, silberner Frühlingsduft schwebt über den waldigen Höhen, aus denen sich die Granitkuppe des Melibokus mit dem alten Wartturm eindrucksvoll abhebt. Weithin sind die Hänge von einem Blütenmeer bedeckt; Kirschen, Aprikosen, Pfirsiche und Mandeln stehen in voller Pracht und streuen uns weiße und rötliche Blätter in den Schoß. Wie hat sich die Natur auf diesem mildesten Fleck deutscher Erde in ihrer reichsten Gebelaune gezeigt! Da hegen sie alle, diese lieblichen Orte, wie auf einer Perlenschnur aneinandergereiht, hineingeschmiegt in die Mündungen der Täler oder malerisch emporsteigend an den Bergen. Saubere Dörfer wechseln ab mit alten, turmbewehrten Städtchen und freundlichen Villenorten. Wer kann ihre Namen alle nennen? Seeheim und Alsbach, die beide schon zu einer einzigen Kolonie von Landhäusern zusammenwachsen; Jugenheim mit dem lieblichen Schloß Heiligenberg, dessen Park sich im Bergwalde verliert; Zwingenberg, malerisch am Fuße des Melibokus gelagert; Auerbach mit seiner prächtigen, waldumrauschten Schloßruine und dem Fürstenlager; Bensheim, die fränkische Ansiedlung aus der Merowingerzeit, jetzt eine blühende Villenstadt; Heppenheim, überragt von der malerischen Ruine der Starkenburg.
Allmählich ist es Abend geworden, die Sonne sinkt fern im Westen hinter den blauen Bergzügen der Haardt und überströmt das Rheintal zu unserer Rechten mit rötlichem Glanz. Jetzt rasselt unser Wagen über das Pflaster von Weinheim und hält bald darauf am Bahnhof. Wir wollen heute noch mit dem Dampfroß nach Mannheim; denn es zieht uns gewaltig hin nach dem herrlichen deutschen Strom, der uns hinabtragen soll bis zur holländischen Grenze. Während die Dämmerung alles in ihren sanften Schleier hüllt und der Odenwald hinter uns langsam versinkt, führt uns der Zug durch die fruchtbare Ebene hinüber zu der großen Handels- und Industriestadt am Rhein und Neckar.
»Das freundliche Mannheim, das gleich und heiter gebaut ist«, singt Goethe in »Hermann und Dorothea«, und damals war Mannheim in der Tat eine Stadt, wie es nur wenige gab. Mit seinen schnurgeraden, rechtwinklig sich kreuzenden Straßen nach einem einheitlichen Plane angelegt, unterschied es sich gar sehr von den älteren Städten mit ihren krummen Gäßchen und engen, altertümlichen Plätzen. Auch heute macht die Stadt im wesentlichen einen modernen Eindruck, aber der Vorwurf des Eintönigen, den sie oft hat hören müssen, und den Goethe in eine so liebenswürdige Form gekleidet hat, trifft keineswegs zu. Wo Handel und Wandel so sichtbar emporblühen und eine betriebsame Menge die Straßen und Plätze mit geschäftigem Leben füllt, da kann keine Langeweile aufkommen. Seit der Befreiung der Rheinschiffahrt und dem Beitritt Badens zum Zollbunde hat sich Mannheim aus der ehemaligen kurpfälzischen Residenz zu einem der bedeutendsten Industrie- und Handelsplätze Deutschlands entwickelt, seine Hafenanlagen sind im Binnenlande kaum übertroffen. Wer einen Begriff von dem Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit, des vielverzweigten Weltverkehrs und der immer mächtiger emporblühenden Industrie Mannheims gewinnen will, der schaue von der prächtigen Rheinbrücke um sich, die zu dem bayrischen Ufer und der aufblühenden Industriestadt Ludwigshafen hinüberführt, oder unternehme eine Fahrt durch das Hafengebiet. Was er da erblickt, das ist zwar kein malerisches Städtebild im landläufigen Sinne, wohl aber ein Bild rastloser Tätigkeit und flutenden Lebens, aus dem auch ein Hauch von Poesie emporsteigt: der modernen Poesie der Arbeit.
Übrigens geht die Bevölkerung Mannheims keineswegs im Materiellen auf, sie wahrt vielmehr sorgsam die Überlieferung eines Mittelpunktes regen geistigen Lebens, und die Pflege der Künste findet eine Stütze an dem allgemeinen Wohlstand. Das Hof- und Nationaltheater steht auf der Höhe seiner ruhmreichen Vergangenheit, in welcher von seiner Bühne herab Schiller das erstemal zum deutschen Volke sprechen durfte. Und wer da glaubt, daß es in der Stadt wenig Bemerkenswertes zu sehen gebe, der irrt gewaltig. Von der Terrasse des monumentalen Wasserturmes überschauen wir ein wahrhaft großstädtisches Bild. Vor uns dehnt sich der Friedrichsplatz aus, einer der schönsten Schmuckplätze Deutschlands. In seiner großzügigen Geschlossenheit, von Laubengängen und prächtigen, einheitlich angelegten Gebäuden umgeben, macht dieser gewaltige, blumenerfüllte Raum einen unvergleichlichen Eindruck. Seine Glanzpunkte bilden die neue Kunsthalle und der »Rosengarten«, jene von Bruno Schmitz erbaute Festhalle, die in dem Nibelungensaal den größten Festraum des Kontinents birgt. Überall zeigt sich ein Zug ins Große: auch das von Parkanlagen umgebene großherzogliche Schloß gilt als der bedeutendste deutsche Dynastenbau der Barockzeit.
Doch nun heißt es weitereilen, den Rhein hinunter, wo uns neue Bilder erwarten. Am Stromufer liegt das prächtige Dampfboot der Köln-Düsseldorfer Gesellschaft bereit, das uns nach Mainz und zum sonnigen Rheingau bringen soll. Die Schaufelräder setzen sich in Bewegung, und rasch gleitet das Schiff zu Tal zwischen freundlichen baum- und buschbewachsenen Ufern, während rechts und links in der Ferne blaue Gebirgszüge den Blick begrenzen. Bald ist Worms erreicht, die alte Nibelungenstadt, vom Glanz der Sage und Geschichte so reich umgeben wie wenige andere. Da erhebt sich der herrliche Dom, eins der schönsten romanischen Baudenkmäler am Rhein, jetzt glücklich vor dem drohenden Verfall geschützt, daneben, auf der Stelle des durch die Franzosen zerstörten Bischofsitzes, der malerische Heylshof und inmitten des Rebgartens, der die köstliche »Liebfrauenmilch« erzeugt, die gotische Liebfrauenkirche. Reiche Zeugen der Geschichte der Stadt, Denkmäler aller Zeiten, vereinigen die herrlichen Sammlungen des Paulusmuseums in der alten romanischen Pauluskirche und in ihren gotischen Kreuzgängen. In Worms war es, wo der kühne Gottesstreiter Luther vor dem Reichstage seine Lehren verfocht; das herrliche Denkmal Rietschels auf dem Lutherplatz erinnert an diesen weltgeschichtlichen Augenblick.
Weiter geht die Fahrt rheinabwärts. Sie zeigt uns zwar immer noch keine romantischen Landschaftsbilder, aber grüne Inseln im Strom, freundliche Orte und Rebgelände am linken Ufer bringen beständig Abwechselung. Mancher dem Kenner edler Weine wohlbekannte Name klingt an unser Ohr: Osthofen und Mettenheim, Oppenheim, wo auf dem Goldberg ein feuriges Naß gedeiht, Nierstein, Bodenheim und Laubenheim. Jetzt tauchen schon die Türme von Mainz aus dem zarten Nebel auf, der über dem Strome lagert, wir fahren vorbei an der Stelle, wo der Main seine gelben Fluten in den grünen Rhein entsendet, und bald legt das Schiff an dem breiten Kai fest, der vor einer weitgedehnten Stadtfront sich ausstreckt.
Das »goldene« Mainz! Was hat diese alte Stadt im Laufe ihrer langen Geschichte alles über sich ergehen lassen müssen! Ihre günstige Lage an den Kreuzungspunkten uralter Straßenzüge Westdeutschlands brachte ihr von jeher lebhaften Verkehr und Handel, dafür brausten aber auch von den Zeiten der Völkerwanderung bis ins 19. Jahrhundert hinein Kriegsstürme zerstörend über sie dahin. Von der Römerzeit bis zur Gegenwart: Freude und Leid, Blüte und Verfall und neue Blüte. Zuerst eine Provinzialhauptstadt des Römerreiches, wurde das alte Moguntiacum im Mittelalter Residenz eines Erzbischofs und Kurfürsten, später Bundesfestung, und jetzt entwickelt es sich mit raschen Schritten zum Industrie- und Handelsplatz. Seitdem Mainz seinen engen Festungsgürtel gesprengt, hat es sich in seinem Umfang um das Doppelte vergrößert; neben der Altstadt, die in ihren Baudenkmälern noch die Zeugen einer fast zweitausendjährigen Geschichte bewahrt, ist auf dem ehemaligen »Gartenfeld« ein neuer Stadtteil durchaus modernen Charakters emporgewachsen. Prächtige Promenaden und Anlagen, drei monumentale Rheinbrücken, großartige Hafen- und Hochbauten, wie die kuppelgekrönte Christuskirche und die Stadthalle am Rheinufer, geben Zeugnis von dem staunenswerten Aufschwung eines blühenden Gemeinwesens. Wer vom Rheinufer aus das Innere der Stadt betritt, lenkt seine Schritte zunächst zu dem Dom, diesem kunstgeschichtlich so merkwürdigen Bauwerke, das mit seinen schlank aufstrebenden Haupttürmen das Stadtbild weithin beherrscht. An seinen ursprünglich romanischen Kern haben bis ins 19. Jahrhundert hinein alle Stilperioden immer wieder neue Bauteile angegliedert. Unweit davon erhebt sich das Gutenberg-Denkmal, das die Stadt ihrem berühmtesten Sohne errichtet hat.
Bei unserm Lustwandeln am Rheinufer in Mainz hat schon lange ein schön geformter Bergzug im Osten unsern Blick auf sich gezogen. Das ist der Taunus, das waldbedeckte Gebirge in dem Winkel zwischen Rhein und Main. Ihm wollen wir, bevor wir die Fahrt den Rhein hinab fortsetzen, einen wenn auch nur flüchtigen Besuch abstatten. Im raschen Fluge trägt uns die Eisenbahn über die Kaiserbrücke unterhalb Mainz hinüber nach der schönen Bäderstadt Wiesbaden. Hier hat eine freigebige Natur sich mit rührigem Fleiß zu seltenem Gelingen vereinigt. Im Laufe eines Menschenalters ist aus der früheren Residenz der nassauischen Herzöge, aus einer freundlichen Mittelstadt, ein Zentrum des Verkehrs von Fremden aus aller Herren Ländern geworden, deren Zahl die der Einwohner übertrifft. Wir wandern, vom Bahnhof kommend, an den prächtigen Kuranlagen entlang die Wilhelmstraße hinauf, und sofort umgibt uns ein lebhaftes Bild großstädtischen Treibens. Aber hier herrscht nicht die geschäftige Hast, die uns in anderen Großstädten oft auf die Nerven fällt, sondern behagliche Muße, die Erholung sucht und die Reize des Kurlebens, das hier auch im Winter keineswegs zurücktritt, genießen will. Den Mittelpunkt des Badelebens bildet das vor kurzem mit verschwenderischer Pracht nach den Plänen von Thiersch erbaute Kurhaus. Mit den prächtigen Park- und Gartenanlagen, den basarerfüllten Kolonnaden und dem hochragenden Hoftheater bildet das Kurhaus ein Ganzes von eindrucksvollem, künstlerischem Reiz. Aber auch der Naturfreund findet in Wiesbaden seine Befriedigung; stundenlang kann er in den herrlichen Eichen-, Buchen- und Kastanienwäldern der Umgebung lustwandeln, sei es durch das liebliche Nerotal, sei es hinauf auf die hochgeschwungenen Taunusberge oder hinüber zu dem in einem idyllischen, waldumkränzten Tal gelegenen Schlangenbad mit seinen heilkräftigen Wildbädern und reizenden Promenaden.

St. Goarshausen. Ruine Rheinfels.
Der Rhein bei St. Goar. (Durchbruchstal in der Hochfläche des Rheinischen Schiefergebirges.) Nach einer Photographie der Neuen Photographischen Gesellschaft, Steglitz.
Gern möchten wir noch länger in dem gastlichen Wiesbaden verweilen, aber am Rhein wartet unser schon wieder das Schiff. Die Straßenbahn führt uns über die Adolfshöhe hinunter an den Strom nach Biebrich, das man nicht mit Unrecht den Hafen Wiesbadens genannt hat; es vermittelt in der Tat den ganzen Schiffsverkehr der reichen Bäderstadt und wächst dabei selbst zu einem stattlichen Orte heran. Mit seinen großen Hotels am Rheinufer und dem von herrlichem Park umgebenen Schlosse bietet Biebrich von unserm Dampfer aus einen freundlichen Anblick. Und wie das stolze Schiff jetzt rasch den Strom hinuntergleitet, da rollt sich vor unseren Augen das lachende Panorama des gesegneten Rheingaues auf. Am Ufer folgt ein hübscher, weinberühmter Ort dem andern: Eltville mit der erzbischöflichen Burg und den weißen Villen am Strom; Erbach, der Hort des Markobrunners; Ingelheim, wo einst Karl der Große im Marmorpalast Hof hielt; Hattenheim und, in einer Bergabdachung fast versteckt, Hallgarten; Östrich und Winkel, überragt vom Schloß Johannisberg, von dem der Dichter singt: »Johannisberger schenkt man nur besternten Herren.« Und schon schimmert uns die goldene Sonnenbrücke entgegen, auf der die Sage den Kaiser Karl, die Reben segnend, hinüberwandeln läßt nach Rüdesheim, dem blühenden, weltbekannten Weinort am Fuße des Niederwaldes. Rings im Umkreise steigen die Hänge empor, auf denen die Sonne köstliche Tropfen kocht. Und während uns das Schiff jetzt hinüberträgt nach Bingen, grüßt stolz von steiler Höhe zu uns herab eine gewaltige, eherne Gestalt, den Arm mit der Kaiserkrone kühn emporreckend. Heil dir, Germania!
Da, wo die Ebene des Rheingaues nördlich ihr Ende erreicht und der Rhein sich brausend in einen tiefen Felsspalt zwängt, tritt aus einer zweiten Gebirgspforte die Nahe hervor, um ihre Wasser mit denen des größeren Stromes zu vereinigen. An ihrer Mündung liegt die alte Stadt Bingen zu Füßen des Rochusberges. Das schöne, weite Landschaftsbild an dieser bedeutsamen Stelle des Rheinlandes ist von überraschender Großartigkeit.
Von Bingen trägt uns die Eisenbahn an der eilenden Nahe aufwärts durch eine freundliche Hügellandschaft nach Kreuznach, einer Stadt, die ein Mittelpunkt des Weinhandels und aufblühender Industrie und zugleich ein eleganter Kurort ist. Dies tritt auch schon im äußeren Stadtbilde deutlich hervor: abseits von der mit geschäftigem Leben erfüllten Altstadt dehnt sich zwischen Rebenhügeln längs des Naheufers das von breiten, schattigen Straßen und freundlichen Villen gebildete Badeviertel aus. Die hier zahlreich zutage tretenden Kochsalzquellen, die einen großen Teil ihrer Heilkraft einer starken Radioaktivität verdanken und die bekannte Kreuznacher Mutterlauge liefern, versammeln alljährlich ein internationales Badepublikum um sich. In dem Kurhaus mit seinen hübschen Parkanlagen findet es einen Mittelpunkt der Geselligkeit und Erholung. Das liebliche Salinental mit seinen ausgedehnten Gradierwerken verbindet Kreuznach mit dem benachbarten Bad Münster am Stein, gleichfalls ein lebhaft aufblühendes Solbad, das auch landschaftlich einen Glanzpunkt des Nahetales bildet. Schroff, fast senkrecht steigen hier die rötlich schimmernden Porphyrfelsen empor; der eine, dicht an der spiegelnden Fläche des Flusses, trug einst die Burg der Rau- und Rheingrafen; auf dem andern liegt die schöne Ruine der Ebernburg, auf der Franz von Sickingen hauste. Weiter die Nahe aufwärts verbreitert sich das Tal, die Bergabhänge werden sanfter, bis sie bei Oberstein noch einmal den Fluß einengen und mit dem alten, von zwei Burgen überragten Orte und der in den Felsen gehauenen Kirche ein Bild von seltenem landschaftlichen Reize schaffen. Etwas seitlich, in einem von dem Glanflüßchen durchströmten reizenden Tal, liegt malerisch ein altes Städtchen: Meisenheim, das in seiner Schloßkirche eine Perle spätgotischer Baukunst besitzt.
Wir sind wieder nach Bingen zurückgekehrt, um nun die romantischste Strecke des Rheinstromes, die am reichsten von dem Duft der Sage und Poesie umschwebt ist, zu befahren. Abermals besteigen wir einen der prächtigen Dampfer. Bald rauscht das Schiff durch das mächtige Felsentor des Binger Lochs. Vom Niederwald bis Koblenz hat sich der Rhein durch das Gebirge in vielfach gewundenem Lauf ein enges, felsumstarrtes Bett gegraben, in dem er nun brausend dahinschießt. Ganz dicht drängen sich von beiden Seiten die Berge an den Strom heran, oft nur einen bescheidenen Platz lassend der Straße und der Eisenbahn, die von nun an bis Bonn zu beiden Seiten des Rheines hart am Strome entlang führt. Auf ihren den Windungen des Stromes sich anschmiegenden Schienensträngen brausen in dichter Folge, den Fels dort, wo er schroff zum Rhein abfällt, im Tunnel durchschneidend, die dem regen internationalen Verkehr dienenden D- und Luxuszüge daher. Überall hat die fleißige Hand des Menschen den schroff emporragenden Felsen noch ein Fleckchen Erde abgewonnen, auf dem er seine Reben zieht. Die Fahrt geht schnell zu Tale. Wir passieren rechts Aßmannshausen, da wächst ein feuriger Roter; gegenüber erhebt sich die schönste der rheinischen Burgen, der Rheinstein. Jetzt kommt Lorch, da reift ein Weißer, der hat schon manchen umgeworfen. Es folgt Bacharach, das malerische Städtchen mit der entzückenden Ruine der Wernerskapelle; hier öffnet sich ein reizendes Seitental mit dem weinberühmten Orte Steeg, wo ein gar herrlicher Tropfen quillt. Da ist Kaub mit der Pfalz, die sich wie eine rechte Trutzburg auf einem Felsen mitten im Strome erhebt. Links lassen wir das altertümliche Oberwesel, umgeben von wohlerhaltenen mittelalterlichen Befestigungen und überragt von den Trümmern der Schönburg; von ihm singt Freiligrath: »Gruß dir, Romantik! Träumend zieh' ich ein in deinen schönsten Zufluchtsort am Rhein.« Jetzt schiebt sich plötzlich von rechts ein gewaltiger, zerrissener Felsklotz in steilem Absturz und unverkennbarem Profil in den Strom hinein. Das ist die sagenberühmte Lorelei. Bis ins vorige Jahrhundert hinein brauste hier der Rhein zweihundert Schritt weit kochend und schäumend über Felsenriffe, heute deuten nur noch dunkle Strudel die gefährliche Stelle an. Und während wir den stolzen Felsen in scharfem Bogen umschiffen, tönt es begeistert aus aller Munde: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« …
Gleich darauf zeigt sich das liebliche St. Goar, die »Stadt, die allzeit gastlich war«, überragt von den gewaltigen Ruinen der ehemaligen Festung Rheinfels. Gegenüber liegt langgestreckt das modern anmutende St. Goarshausen, über dem sich auf steilem Felsen die stimmungsvoll wiederhergestellte Burg »Die Katz« erhebt. Von St. Goarshausen führt die Nassauische Kleinbahn durch eine romantische Schlucht vorüber an der schönen Ruine der Reichenburg zum Taunusgebirge hinauf nach Nastätten, um dann weiterhin in einem andern Seitental in kühnen Windungen wieder zum Rhein herabzusteigen.
Nun gleiten wir vorüber an dem neu entstandenen Badeort Salzig, der freundlichen, von Villen umkränzten Stadt Boppard, und dann, einem gewaltigen Bogen des Rheines folgend, an dem malerischen Braubach, über dem auf hohem Bergkegel die Marksburg thront, die einzige Feste am Rhein, die der Zerstörung entgangen und in ihrem ursprünglichen Zustande erhalten ist. Jetzt zeigt sich links das altertümliche Städtchen Rhens und gleich darauf, unter Nußbäumen fast versteckt, ein eigenartiges Bauwerk: der Königsstuhl, auf dem einst manch deutscher König von den Kurfürsten gewählt worden ist. Dicht daneben liegt der Rhenser Mineralbrunnen, der alljährlich sieben Millionen Flaschen seines köstlichen, beliebten Getränkes in alle Weltteile fließen läßt. »Das ist die Strafe des Himmels,« meint ein witziger Reisegefährte. »Einst hat auf dem Königsstuhl König Wenzel für einige Fuder Bacharachers sein Reich verschachert, zur Sühne für diese Tat sprudelt jetzt hier Wasser in unerschöpflicher Fülle.« – Wir passieren Oberlahnstein, wo, aus einem engen Felstal kommend, die Lahn mündet; gegenüber erhebt sich auf grünem Hintergrund das Schloß des Kaisers, Stolzenfels. Bald darauf fahren wir unter zwei elegant geschwungenen Eisenbrücken hindurch und erreichen das Ziel unserer heutigen Fahrt, die Residenzstadt Koblenz.
Da, wo Rhein und Mosel ihre Wasser vereinigen, stand schon zur Römerzeit das Kastell Confluentia. Seitdem ist manche schwere Zeit an diesem Orte vorübergezogen, er hat sich nie in voller Freiheit entwickeln können; erst in unseren Tagen ist dem Falle der Festungswerke ein überraschendes Aufblühen gefolgt. Überaus schöne landschaftliche Umgebung, mildes Klima, schmuckes Äußeres und städtische Einrichtungen, die auch verwöhnten Ansprüchen genügen, machen Koblenz zu einem Orte, wo sich's gut leben läßt. Hier pocht gleichsam das Herz des Vaters Rhein; hier strömt von weither alles zusammen, was an seinen Ufern Genuß und Erholung sucht. An schönen Sommertagen entwickelt sich namentlich vor den großen Gasthöfen am Rhein ein lebhaftes, buntes Treiben, die menschenerfüllten Salondampfer kommen und gehen, dazwischen fahren Schleppzüge zu Berg und zu Tal, Musik erschallt von allen Seiten, man hört in sämtlichen Sprachen Europas reden. Bei unserer Wanderung durch die Stadt erkennen wir bald, daß sie aus zwei Teilen besteht: aus der in dem Winkel zwischen Rhein und Mosel gelegenen, vielfach eng gebauten Altstadt und der eleganten Neustadt, die sich mit breiten Straßen und geschmackvollen, in Grün gebetteten Häusern und Villen weit rheinaufwärts erstreckt. Das Stromufer ist hier gesäumt von den prächtigen, blumenerfüllten Kaiserin-Augusta-Anlagen. Sehr stattlich zeigt sich uns auch die Rheinfront von Koblenz. Nach Süden ist sie begrenzt durch das breit hingelagerte königliche Schloß und den palastähnlichen Bau des Regierungsgebäudes, nach Norden reicht sie bis zum Deutschen Eck. Hier, wo Rhein und Mosel ihre Wasser mischen, ist ein bedeutungsreicher Punkt, an dem Natur und Kunst sich zu seltener Wirkung vereinen. Da liegt die uralte St.-Kastorkirche, ein Juwel romanischer Baukunst, daneben das Deutschherrenhaus, und auf der äußersten Landspitze erhebt sich, machtvoll die Umgebung beherrschend, das von der Rheinprovinz errichtete Denkmal Kaiser Wilhelms des Großen, wohl das schönste und eindrucksvollste, das in Deutschland steht. Gerade gegenüber, jenseit des Rheins, ragt das Felsmassiv des Ehrenbreitsteins empor, gekrönt von den gewaltigen, steinernen Festungswerken.
Wieder nimmt uns ein weißer Dampfer auf und trägt uns wie ein Schwan die grünen Fluten hinunter. Gleich hinter Koblenz verbreitert sich das Rheintal zu einer stundenlangen fruchtbaren Ebene, dem Neuwieder Becken. Auf den Hügeln ringsum, die in einiger Ferne sichtbar bleiben, schimmern weiße Dörfer; namentlich fällt uns schon von weitem hoch oben auf einer Berglehne ein großer, heller Ort ins Auge. Das ist Rengsdorf, ein aufblühendes Luftbad, das von Jahr zu Jahr in immer größeren Scharen müde Städter an sich lockt, die in der reinen, kräftigen Bergluft und den herrlichen Waldungen ihre Lungen stählen und die Wangen bräunen wollen.
Jetzt winkt uns schon dicht am rechten Stromufer Neuwied entgegen, eine heitere Stadt, die mit ihren breiten, geraden Straßen und den behäbigen, sauberen Häusern ihre Eigenschaft als Residenz der ehemals reichsunmittelbaren Grafschaft Wied nicht verleugnet. Reges Leben herrscht überall; denn Neuwied, das auch Sitz einer Herrnhuter Brüdergemeinde ist, verdankt seinem Gewerbfleiße einen erfreulichen Aufschwung in Handel und Industrie. Am Nordende der langgestreckten Rheinfront erhebt sich das stattliche Residenzschloß der Fürsten zu Wied, von einem prächtigen Park umgeben, der sich weithin am Rheinufer fortsetzt. Hoch oben im Bergwalde leuchtet aus hellem Grün das weiße Lustschloß Monrepos, Heimat und Lieblingsaufenthalt der königlichen Dichterin Carmen Sylva. Dort oben winkt uns ein Blick von fast alpiner Schönheit auf den Westerwald und in das Tal der rauschenden Wied, die man von Neuwied leicht erreicht. Bald nachdem wir das Ende des Schloßparks passiert haben, lenkt unser Schiff hinüber zum linken Ufer nach Andernach. Bot uns Neuwied das Bild einer ganz modernen Stadt, so tritt uns jetzt wieder ein altertümlicher Ort mit wettergrauen Türmen, Toren und Mauern entgegen. Andernach blickt auf eine lange Geschichte zurück. Schon zu Ende des fünften Jahrhunderts war es ein Königssitz der fränkischen Merowinger, die hier eine Pfalz hatten. Aus dem späteren Mittelalter stammen die mächtigen Trümmer einer kurfürstlichen Burg. Die Stadt hat noch zum Teil ihre alten Mauern bewahrt, die am Rhein mit einem hohen Wartturm abschließen. Nicht wenig trägt zu der malerischen Erscheinung des Städtebildes auch die viertürmige Pfarrkirche bei, eine spätromanische Pfeilerbasilika aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts mit wundervollen Formen. Wenige Stunden von Andernach entfernt liegt, in die waldigen Eifelberge eingebettet, eine Perle der Rheinlandschaft: der Laacher See. Gleich hinter Andernach schließen die Berge wieder dicht zusammen, der Rhein tritt durch ein enges Felsentor von neuem in das Gebirge ein. Abermals begleiten uns rebenbepflanzte oder waldbewachsene Berge, freundliche Städte und Dörfer am Ufer, Schlösser und Burgen auf den Höhen. Rechts erscheint das geschützt in einem Obsthain gelegene, freundliche Leutesdorf mit einer malerischen Uferstraße; nicht weit davon reckt sich der Felsklotz des Hammersteins mit den Trümmern einer Feste finster empor. Noch eine Strecke weiter treten auf dem linken Ufer die Berge etwas zurück und gewähren Einsicht in ein breites Seitental, dem die Ahr entströmt. Gegenüber ihrer Mündung liegt, teils in ein Seitental des Rheines gezwängt, teils an den Hängen des Kaiserberges stattlich emporsteigend, die von alten Türmen und Mauern wohlbewachte Stadt Linz. Ein reges Leben und Treiben herrscht in den malerischen Straßen des hübschen, gewerbfleißigen Ortes. Von Linz aus bietet sich ein bequemer Zugang in die Gebiete des hohen Westerwaldes mit seinen das ganze Landschaftsbild weithin überragenden spitzen Basaltkuppen, die leider der Steinbruchindustrie eine willkommene Beute geworden sind.
Jetzt landet unser Schiff am linken Stromufer bei Remagen. Wir wandern durch die saubere, betriebsame Stadt und freuen uns ihrer schönen Lage. Auf einem Felsen hoch über dem Orte schwebt die zierliche, gotische Apollinariskirche, dahinter steigt der Viktoriaberg empor, von dessen waldbedecktem Gipfel man eine großartige Fernsicht über das ganze Rheintal von Andernach bis zum Siebengebirge genießt. Und gegenüber, jenseit des Stromes, springt trotzig der dunkle, von mächtigen Basaltsäulen gebildete Felsklotz der Erpeler Lei bis dicht an das Ufer heran. In Remagen erwartet uns ein guter Freund mit seinem Automobil zu einer Spritzfahrt in das Ahrtal, das, wie kaum ein anderes Seitental des Rheines, auf kurzer Strecke eine Fülle von Naturschönheiten vereinigt. Anfänglich ist es noch breit und umschließt eine fruchtbare Ebene, die »Goldene Meile«. Wir fahren durch den freundlichen Weinort Bodendorf und bald darauf an der weltbekannten Apollinarisquelle vorüber. Bevor die Berge jetzt enger zusammentreten, lassen sie noch Raum für den Badeort Neuenahr, das »deutsche Karlsbad«. Hier entquellen mächtige, heiße Sprudel, die einzigen alkalischen Thermen Deutschlands, dem Boden und haben dem aufblühenden Orte bereits einen Weltruf geschaffen.
Wir folgen immer dem Laufe der rauschenden Ahr aufwärts durch die engen Straßen des noch von seinen alten Mauern umgürteten Städtchens Ahrweiler und durch Walporzheim, den durch seine kräftigen Rotweine berühmten Ort. Der Fluß tritt jetzt in ein enges Felstal ein. Als ein echtes Kind der wilden Eifel hat er sich in scharfen Windungen zwischen den schroff ansteigenden Bergen sein schmales Bett gegraben. Bei Altenahr halten wir mitten in einer prachtvollen, eigenartigen Gebirgswelt. Hoch über dem Orte ragt die Ruine der Burg Are empor, von allen Seiten drängen sich wild zerrissene Felsmassen heran. Weiter ahraufwärts wird das Tal stiller, aber der Zauber der Natur bleibt, und indem wir an einem silberklaren, forellenreichen Bach entlang noch bis Adenau hinaufsteigen, enthüllt sich uns die düstere Schönheit der Hohen Eifel, deren mächtigste Kuppen hier waldumrauscht zum Himmel streben.
Von Remagen nimmt uns wieder der alte und doch ewig junge Vater Rhein auf seinen breiten Rücken. Wir folgen einem großen Bogen des Stromes vorüber an dem malerischen, durch seine guten Rotweine bekannten Städtchen Unkel und dem gewerbfleißigen Oberwinter. Schon seit einiger Zeit ist am Horizont die wundervolle Silhouette des Siebengebirges aufgetaucht. Immer näher rückt der in kühnen Linien geschwungene waldbedeckte Gebirgszug, von dem feinen, blauen Duft des Frühlings zart überhaucht. Zu unserer Linken erhebt sich jetzt auf steilem Felsgrat der Rolandsbogen, zu seinen Füßen schimmert aus knospenden Büschen und bunten Gärten das reizende Rolandseck mit seinen großen Gasthöfen und den prächtigen, an der Berglehne emporsteigenden Landhäusern. Von hier aus ist wohl der schönste Blick auf das Siebengebirge und seine herrliche Umgebung geboten. Mitten im Rhein schwimmen zwei grüne Inseln: Nonnenwerth mit dem weißen Frauenkloster und das buschige Grafenwerth. Auf dem rechten Ufer sind die Berge etwas zurückgetreten und haben einer schmalen Ebene Platz gemacht. Ein gesegnetes Fleckchen Erde, das wie ein einziger Garten erscheint! Hier liegt, wie in einem Blütenmeer begraben, das »rheinische Nizza«, Honnef. Von einem reichen Kranze schmucker Villen umgeben, hat sich die freundliche Stadt zwischen Strom und Bergen ausgedehnt und fast die ganze Ebene erfüllt; schon wächst sie mit dem an den Fuß des Siebengebirges angeschmiegten Rhöndorf zusammen. Die hohe Wand des Gebirges schützt den Ort vor rauhen Winden und schafft ein Klima von seltener Milde. So ist Honnef zu einem vielbesuchten Luftkurort geworden, der auch im Winter seine Reize nicht verliert und in dem stattlichen neuen Kurhause seinen Gästen Anregung und Unterhaltung bietet. Eine stark kohlensäurehaltige Quelle, die dort dem Boden entströmt, die Drachenquelle, dient zu Trink- und Badekuren.
Nun rauscht das Schiff an dem Drachenfels vorüber, auf dessen Spitze die Turmruine wie ein steinerner Finger zum Himmel zeigt. An seinen Hängen reift das rote »Drachenblut«, an seinem Fuße liegt breit hingelagert die Stadt Königswinter. Welch ein Leben umfängt uns, wenn wir hier die schattige Uferpromenade betreten! Vor den stattlichen Hotels und Gasthäusern mit ihren weinumrankten Terrassen drängt sich eine bunte Menge in hellen Frühlingsgewändern; eine wahre Völkerwanderung scheint sich durch die sauberen Straßen der Stadt hinein in das Gebirge zu ergießen. Das schwirrt in allen Sprachen, das scherzt, lacht und flirtet, und über all den heiteren Szenen liegt goldener Sonnenschein, auch die ernsten Bergesgipfel mit freundlichem Schimmer verjüngend. Einst hoben hier geheimnisvolle, unterirdische Naturkräfte in gewaltigem Ringen ein Gewirr wilder Felsmassen aus der Tiefe; jetzt streift der Wanderer entzückt durch ihre Schluchten und waldigen Hänge. In seiner lieblichen Erhabenheit ist das Siebengebirge einer der Glanzpunkte des an Naturschönheiten so reichen Rheinlandes. Da reckt sich der stolze Drachenfels empor, seinen Fuß im glitzernden Strome badend; auf halber Bergeshöhe liegt die gotische Drachenburg, eins der prächtigsten Schlösser am ganzen Rhein. Dort erhebt der Petersberg sein breites, waldbedecktes Haupt, und, alles überragend, taucht in der Ferne die spitze Pyramide des Ölberges auf.
Wie mit einem rauschenden Akkord endet mit dem Siebengebirge die romantische Schönheitssymphonie der Rheinlandschaft. Von jetzt ab tritt der Strom in die Tiefebene ein, nur eine Hügelkette begleitet ihn noch eine Weile. Aus der Talebene zu unserer Linken hebt sich noch ein einzelner Felskegel empor, der die schöne Ruine der Godesburg trägt. Zwischen ihm und dem Stromufer breitet sich eine der hübschesten unter den rheinischen Städten aus: Godesberg, die elegante Residenz einer mit Glücksgütern gesegneten Menschheit. Die Stadt ist in lebhaftem Aufblühen begriffen; an Einwohnerzahl ist sie, nächst Koblenz, die größte zwischen Mainz und Bonn. Mit ihren in prächtigen Blumengärten versteckten Villen und den breiten, schattigen Straßen gleicht sie einem vornehmen Badeort, und wirklich sprudelt hier auch eine heilsame Quelle, die in immer steigendem Maße Gäste anlockt. Gegenüber der von großen Hotels und schönen Villen gebildeten Rheinuferfront von Godesberg liegt auf dem rechten Ufer in einem Obstwalde das freundliche Niederdollendorf, ein beliebter Ausgangspunkt für Fahrten in das Siebengebirge. Zwischen immer flacher werdenden, villenbesäten Ufern gleiten wir weiter zu Tale. Nun spannt sich eine schön geschwungene, hohe Brücke mit gewaltigem Mittelbogen über den Strom, und gleich darauf landet unser Schiff an dem lebenerfüllten Staden = Uferrand, Kai. der rheinischen Musenstadt Bonn, über den das fünftürmige Münster mächtig emporragt. Einst eine kleine kurfürstliche Residenz, hat sich Bonn jetzt zu einem blühenden Mittelpunkt des Verkehrs und aller geistigen Strömungen in den Rheinlanden entwickelt. Das Wachstum dieser schönen Stadt im letzten Menschenalter ist überraschend. Und was sich da in den schmucken Häusern mit ihren wohlgepflegten Gärten angesiedelt hat, das sind alles Leute, die ihr Leben genießen wollen und auch die Mittel dazu besitzen. Ein Kranz blumenumsponnener Villen umgibt den älteren Stadtteil, der mit seinen stattlichen Gebäuden und eleganten Läden gleichfalls den Geschmack, die Wohlhabenheit seiner Bewohner nicht verleugnet. In dem früheren kurfürstlichen Schlosse, das bei seiner Vollendung 1730 als einer der schönsten Paläste Deutschlands galt, hat jetzt die berühmte Universität, an der auch die preußischen Prinzen zu studieren pflegen, ihr Heim. Ihr zur Seite breitet sich der Hofgarten mit seinen prächtigen alten Bäumen und grünen Rasenflächen aus. Wenige Schritte führen uns von hier auf den »alten Zoll«, eine zum Rhein vorspringende frühere Bastion, von der man einen herrlichen Rundblick genießt auf das weite Rheintal und die feine Linie des Siebengebirges. Eine besondere Anziehung übt Bonn auch aus durch sein reges geistiges Leben; Wissenschaft und Künste haben hier ihre Stätte, und namentlich die edle Musika findet in der Geburtsstadt Beethovens eifrige Pflege.
Von Bonn abwärts trägt uns jetzt der Rhein durch eine weite, nur ganz in der Ferne von sanften Höhen umsäumte Ebene. Aus dem silbrigen Duft, der über ihrem fruchtbaren Boden lagert, ragen wie zwei Finger Gottes, schon auf viele Meilen weit sichtbar, die schlanken Türme des Kölner Domes empor. Langsam rückt uns die große Stadt näher: das »heilige« Köln, Nobilis Romanorum Colonia Agrippinensis! Zwischen mächtigen Hafenanlagen auf beiden Seiten des Stromes gleitet das Schiff hindurch und dreht bald darauf am linken Ufer bei. Vor uns liegt ein Städtebild von eindrucksvoller Schönheit. Über den schmalen, hochgegiebelten Häusern und dem alten Stapelhause am Stromesrand reckt sich ein Prachtbau romanischer Baukunst, die St.-Martinskirche, empor; etwas weiter zurück hebt der gotische Rathausturm seine zierliche Spitze. Stromabwärts, unterhalb der mächtigen Eisenbrücke, zeigen sich St. Kunibert und der kronengeschmückte Turm von St. Ursula. Überwältigend aber und alles Kleinere fast erdrückend, steigen in der Mitte des Bildes die herrlich gegliederten Massen des Domes auf, dieses gewaltigsten Wahrzeichens Kölns, das uns mit seinem Werdegang zugleich die Geschichte der alten Stadt erzählt. Aus einer großen römischen Kolonie hat sie sich im Mittelalter zu einem Hochsitz geistlicher Herrschaft und Bildung mit weit über die Rheinlande hinausreichender Bedeutung entwickelt. Nur damals konnte der Plan entstehen, in dem großartigsten gotischen Bauwerke der Welt dem Gottesgedanken eine würdige Stätte zu bereiten. Seitdem hat die Stadt freilich auch nach anderer Richtung gewaltig an Macht und Ansehen gewonnen. War sie auch schon früher lange Zeit ein durch seinen Reichtum berühmter Handelsplatz und Vorort der Hansa, so hat sie doch erst im letzten Jahrhundert eine Größe und wirtschaftliche Bedeutung erreicht, die sie tatsächlich zum Hauptort der Rheinlande macht. Ihre Einwohnerzahl dürfte in kurzem eine halbe Million betragen, und der Umfang des Grund und Bodens, den sie mit ihren Vorstädten bedeckt, übertrifft den von Berlin. So zeigt uns Köln das Bild eines mächtig aufstrebenden, schaffensfreudigen Gemeinwesens, durch dessen Adern ein Strom reichen Lebens flutet. Auf Schritt und Tritt, in den winkligen Gassen der Altstadt wie in den breiten, lichten Straßen der Neustadt, fühlen wir den Pulsschlag lebhaften Verkehrs, blühenden Handels und Gewerbes und hochentwickelter Industrie. Es ist unmöglich, im knappen Rahmen dieser Zeilen alles, was die Stadt des Sehenswerten bietet, auch nur zu nennen, seien es alte oder neue Bauwerke, Kirchen oder Profanbauten, Museen oder städtische Anlagen jeder Art. Aber eins soll nicht vergessen werden: das frische geistige und gesellige Leben, das hier von alters her gepflegt wird. Der Kölner ist ein echter Rheinländer, regsam, frohsinnig und für alles Schöne leicht begeistert. Und darum hält er auch an seinem Karneval fest. Alaaf Köln! Bevor wir uns der letzten Strecke unserer Frühlingsfahrt, dem Niederrhein, zuwenden, gebührt noch der westlichsten Großstadt unseres Vaterlandes ein Besuch, der Krönungsstadt so vieler deutscher Kaiser und Könige: Aachen. Große geschichtliche Erinnerungen knüpfen sich an diese alte Stätte der Kultur. Nur mit heiligem Schauer betritt man das im Laufe vieler Jahrhunderte aus den verschiedenartigsten Baugliedern zusammengesetzte Münster, in dem Karl der Große in ewigem Schlafe ruht, und dessen Kern, ein düsteres byzantinisches Oktogon, dem ersten Frankenkaiser seine Entstehung verdankt. Eine karolingische Pfalz stand an der Stelle, wo jetzt auf einem Hügel sich das großartige gotische Rathaus erhebt, in dessen »altertümlichem Saale« die Kaiser nach ihrer Krönung sich zum »festlichen Mahle« niederließen. Für »ewige Zeiten« bestimmte die Goldene Bulle Karls IV. Aachen als den Ort der Krönung, aber das sausende Rad der Zeit ist auch über diese Ewigkeit hinweggegangen, und heute verdankt die Stadt ihre Blüte ganz anderen Dingen: ihrem lebhaften Handel, einer mächtig aufstrebenden Industrie und den heißen Schwefelquellen, die hier in Fülle dem Boden entspringen. Schon Kaiser Karl soll sie zur Bekämpfung seiner Gicht verwendet haben, und seitdem haben sie Millionen heilbedürftiger Menschen Genesung gebracht. So zeigt sich uns in Aachen die eigentümliche Erscheinung, daß ein großer Industrie- und Handelsplatz zugleich ein vornehmer Badeort ist. Namentlich im Mittelpunkt der Stadt, an dem hübschen Kolonnadenbau des Elisenbrunnens und dem prächtigen neuen Kurhause, tritt das unverkennbar hervor. Zwischen eilig vorüberhastenden Geschäftsleuten promenieren elegante Badegäste, moderne Hotels und Badehäuser erheben sich neben alten Kirchen und malerischen Gebäudefronten. Zu den Reizen Aachens trägt auch nicht wenig seine schöne Lage in einem weiten, waldumgebenen Talkessel bei, aus dem sich noch innerhalb der Stadt der Lousberg mit schmucken Villen und schattigen Promenaden erhebt.
Wir sind von Aachen nach Köln zurückgekehrt und rüsten uns zur Fahrt auf dem Niederrhein. Mancher Reisende wird es vorziehen, dazu die Eisenbahn zu benutzen, die schneller zum Ziele führt und doch die Eigenart der Landschaft erkennen läßt. Wir wollen aber dem liebgewonnenen Wasserwege treu bleiben. Der Gedanke, daß an seinen Ufern die Göttin der Schönheit ihr Haupt verhülle, ist längst als ein Irrtum erkannt. Freilich, die Romantik burggekrönter Höhen und felsumstarrter Täler, das bunte, lustige Treiben des Rheins stromaufwärts von Bonn ist verschwunden; dafür enthüllt sich uns der stille Reiz der Niederung mit ihren weiten Umrissen, ihren wogenden Kornfeldern und grünen Triften. Und noch ein anderes kommt hinzu: hier am Niederrhein hat sich die Industrie des großen, völkerverbindenden Stromes bemächtigt; er ist die Via Triumphalis der Industrie. Was dort des Menschen Geist geschaffen hat, wie da Millionen fleißiger Hände sich rühren, um mit allen Mitteln der Technik und eines ins Riesige gesteigerten Verkehrs die Schätze der Erde zu heben, zu vervollkommnen und zu versenden, das erfüllt mit Staunen und Bewunderung und läßt uns empfinden, daß in all diesem rastlosen Schaffen und Drängen doch auch etwas Wunderbares und Ergreifendes liegt, vor dem selbst die Romantik verblaßt.
Unsere Fahrt auf dem Niederrhein beginnt am Abend. Das Schiff trägt uns rasch den Strom hinunter zwischen Weidengebüsch und grünen Saaten, am Ufer streifen dünne Nebel, ein kühler Hauch weht über den leise aufrauschenden Strom. Da taucht mit einem Male aus dem Wiesenland zur Linken, wie ein Märchengebilde, eine phantastische, alte Stadt auf mit gewaltigen Mauern, Türmen, Toren und einem Riesenschloß. Das ist Zons, das »rheinische Rothenburg«, das sich wie im Dornröschenschlaf aus der Ritterzeit in unsere Tage herübergerettet zu haben scheint. Jetzt hebt sich schon der herrliche Quirinusdom in Neuß mit seiner gebauchten Kuppel empor, deren Spitze noch ein letzter Sonnenstrahl vergoldet. Einst nächst Köln die mächtigste Stadt am Niederrhein und berühmt durch eine wecheselvolle Geschichte wilder Kämpfe und Belagerungen, hat Neuß es sich gefallen lassen müssen, daß der Rhein, der früher dicht an der Stadt vorüberfloß, sich ein anderes Bett grub und nur noch die stille Erft an seine Mauern spülte. Damit versiegte ihm zugleich die Lebensader; Handel und Gewerbe gingen zurück, bis sich in unserer Zeit die Industrie des Ortes bemächtigte. Sie schuf neue Quellen des Wohlstandes und hat es auch fertig gebracht, daß jetzt ein breiter Kanal nebst Hafen die Stadt wieder mit dem Rhein verbindet, wodurch sich auch der Handel wieder mächtig hob, glückliches Gedeihen für die Zukunft versprechend.
Inzwischen ist es Abend geworden; wir landen in Düsseldorf, während sich überall schon Tausende von Lichtern entzünden. Ist das ein Leben und Treiben in den hell erleuchteten Straßen der großen Stadt! Was mag alle diese geschäftigen Menschen, diese eleganten Herren und Damen, diese wackeren Bürger und Arbeiter so durcheinanderwirbeln? Man sagt doch: Düsseldorf ist die rheinische Kunst- und Gartenstadt, also ein Ort ruhigen Genusses und der Lebensfreude! Das war es auch und ist es noch heute, aber daneben hat es sich zu einem Sammelpunkt und Vorort des reichsten Industriegebietes Deutschlands entwickelt. Langsam heben sich in den breiten Straßen Düsseldorfs die Paläste, in denen die großen Industriegesellschaften sich ihr Heim errichten, und eine weitsichtige Stadtverwaltung kommt ihnen mit offenen Armen entgegen. Düsseldorf hat sich durch seine glänzend verlaufenen Industrie- und Kunstausstellungen in der ganzen Welt einen Ruf als Ausstellungsort und Metropole des wirtschaftlichen Lebens am Niederrhein erworben. Wie weit diese Entwickelung führen wird, ist gar nicht abzusehen, vieles ist noch im Werden; aber die Stadt, die heute schon über eine viertel Million Menschen birgt, hat ohne Zweifel eine glänzende Zukunft. Und darauf bereitet sie sich auch mit Eifer und Verständnis vor. Nicht nur durch Neuanlagen jeder Art, wie den großartigen Hafen, die Rheinkais, den Kunstausstellungspalast, den Kaiser-Wilhelm-Park und vieles andere, sondern auch durch pietätvolle Pflege des Schönen, das die Vorfahren überliefert haben. Und das ist durchaus nicht wenig, obschon Düsseldorf keine alte Stadt ist im Vergleich mit den rheinischen Schwesterstädten. Auf dem malerischen Marktplatz steht ein Reiterdenkmal des Kurfürsten Wilhelm, das zu den schönsten Deutschlands zählt, und im Jägerhof ist uns ein Rokokoschlößchen von überraschender Feinheit erhalten. Was aber Düsseldorf sein besonderes Gepräge verleiht und ihm mit Recht den Beinamen der »Gartenstadt« eingetragen hat, das sind die prächtigen Anlagen und der Hofgarten, die mit ihren blumigen Rasengründen, ihren alten Baumriesen und blinkenden Wasserflächen die ganze Stadt durchziehen. Die Heiterkeit seiner äußeren Erscheinung spiegelt sich auch im inneren Leben Düsseldorfs wider: es ist eine Stadt des verfeinerten Lebensgenusses und einer Gastfreundschaft, die durch die Kunst geadelt werden. Die Kunstakademie bildet den Mittelpunkt der berühmten Düsseldorfer Malerschule, deren Künstlerheim, der Malkasten, Weltruf genießt. Museen und Sammlungen bergen reiche Schätze, und auch Musik und dramatische Kunst finden eifrige Pflege.
Mit dem linken Rheinufer ist Düsseldorf durch eine mächtige Eisenbrücke verbunden, in ihrer spielenden Leichtigkeit und Eleganz wohl die schönste von den vielen, die sich über den Rhein spannen. Ein Wagen der elektrischen Bahn trägt uns hinüber und durch eine fruchtbare, aber etwas eintönige Ebene nach der Samt- und Seidenstadt Krefeld, die mit ihren blumengeschmückten und von plätschernden Springbrunnen belebten Plätzen und Gärten ein buntes Farbenspiel in das melancholische Bild der Bruchlandschaft zaubert. Man hört für Krefeld oft die Bezeichnung »das rheinische Lyon«. Aber solche Vergleiche sind mißlich; sie geben meist keiner Seite das, was ihr zukommt. Krefeld darf mit Recht beanspruchen, als ein Stadtwesen für sich angesehen zu werden, das keinen Vergleich nötig hat. Allerdings ist es der Vorort Deutschlands für die Herstellung von Samt und Seide, es sendet jährlich für 80 Millionen Mark dieser kostbaren Gewebe in alle Welt; aber seine Bedeutung als Industrieort ist damit keineswegs erschöpft, es nimmt auch in der Verarbeitung anderer Textilstoffe und der Metalle einen ersten Platz ein. Ihre steigende industrielle Entwickelung hat die Stadt denn auch gezwungen, sich einen Zugang zu der Verkehrsader des Rheinstromes, von der sie einige Kilometer entfernt liegt, zu schaffen. Durch die unter gewaltigem Kostenaufwand erfolgte Erbauung eines Industriehafens ist jetzt dem dortigen Großgewerbe die Vorbedingung für weitere wirtschaftliche Blüte gegeben. Als Stadt trägt Krefeld einen durchaus modernen Charakter. Der innere, in Rechteckform angelegte Teil ist von schönen, breiten Alleen umgeben, an denen sich stattliche Gebäude, wie das Rathaus und das Kaiser-Wilhelm-Museum, erheben. Rings um diesen älteren Kern breiten sich die neueren Quartiere aus mit breiten Straßen und geschmackvollen und vornehmen Häusern und Villen. Hier hat aber auch die Industrie ihren Sitz; da fauchen Dampfmaschinen, da dröhnen Hämmer, da sausen die Webstühle und schwirren viele Tausende von Spindeln. Wir verlassen Krefeld mit dem Eindruck eines in erfreulichem Aufschwunge befindlichen Gemeinwesens.
Es ist dunkle Nacht, wenn wir in Düsseldorf das Schiff wieder besteigen, um die letzte Strecke unserer Fahrt bis zur holländischen Grenze zurückzulegen. Diesmal ist es einer der hübschen, behaglichen Dampfer der Niederländischen Gesellschaft, dem wir uns anvertrauen. Obschon eine Schlafkabine mit sauberem Bett bereit steht, ziehen wir es vor, in der warmen Frühlingsluft auf Deck zu bleiben. Bald nachdem das Schiff sich in Bewegung gesetzt hat, gleiten wir unter der hohen Brücke hindurch, deren Lichter gleich einer feurigen Linie am Himmel zu schweben scheinen. Über der großen Stadt lagert es wie eine leuchtende Wolke, die noch stundenlang sichtbar bleibt. Der sinkende Mond wirft eine glitzernde Bahn auf den dunklen Strom und läßt zuweilen am Ufer eine Baumgruppe oder einen weißen Giebel aufleuchten und wieder verschwinden. Dann wird es völlig dunkel. So geht es lange Zeit in die Nacht hinein. Da sprüht mit einem Male ganz in unserer Nähe eine gewaltige Flamme in den Himmel empor und wirft ihren roten Schein auf hochragende Türme, Essen und geschwärzte Dächer. Jetzt leuchtet unweit davon ein neues Fanal auf, andere scheinen sich an ihm zu entzünden und eine Kette von Riesenfackeln über das Land zu ziehen. Wir sind in dem Industriegebiet des Niederrheins angekommen, wo Tag und Nacht die Hochöfen lodern, um die der Erde abgerungenen Schätze, die Kohle und das Eisen, zu verarbeiten. Ein gewaltiger Anblick – als ob Giganten am Werke wären! Nun macht der Rhein eine Biegung, und wieder ändert sich das Bild. In dem unsicheren Licht der Feuerschlote drängt sich am Ufer Schiff an Schiff, mächtige Krane ragen empor, dazwischen tauchen fensterlose, langgestreckte Lagerhäuser auf. Was da in schattenhaften Umrissen an uns vorüberzieht, das ist einer der größten Binnenhafen der Welt an der Mündung der Ruhr, bei den Schwesterstädten Duisburg und Ruhrort, den Hauptsitzen der rheinischen Schleppschiffahrt.
Langsam verschwindet das eindrucksvolle Bild hinter uns im Dunkel, wieder umfängt uns die Nacht mit ihrer tiefen Ruhe. Noch mehrere Stunden währt es, dann hebt sich im Osten ein sanftes Dämmern, nach und nach lösen sich die Ufer aus dem grauen Schein, über den Strom geht es wie ein leises Zittern. In Wesel fallen die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne auf den schlanken Turm der Willibrordikirche und die Festungswerke, die den Strom an beiden Ufern umsäumen. Von jetzt ab tritt der niederländische Charakter der Landschaft immer mehr hervor. Zu unserer Linken hebt sich ein sanfter Höhenzug, bald nahe, bald weiter zurücktretend. An seinen Fuß schmiegt sich das stille Städtchen Xanten, einst als Castra Vetera ein Hauptort der Römer am Niederrhein. Hier läßt das Nibelungenlied den Helden Siegfried seine Jugendjahre verleben; heute hebt sich der herrliche, gotische St.-Viktorsdom mächtig über die niederen Dächer. Vorüber an dem altertümlichen Rees, in blühenden Gärten halb versteckt, bringt uns das Schiff nach Emmerich, dem letzten größeren Orte auf deutschem Gebiet, dessen holländisch sauberes Stadtbild der Turm der Aldegundiskirche beherrscht. Hier hat unsere Fahrt auf dem Rhein ihr Ende erreicht. Gleich hinter der nahen Grenze teilt sich der Strom in mehrere Arme, die in vielfacher Verzweigung die Niederlande durchfließen, bis endlich ihre grau und trübe gewordenen Wasser sich mit den Fluten des Meeres mischen.
Noch winkt aber, bevor wir diese nordwestliche Ecke Deutschlands verlassen, als lieblicher Schlußpunkt unserer Reise drüben in einiger Ferne eine hochgelegene Stadt zu uns herüber: Cleve, der Ort der Sage vom Schwanenritter Lohengrin. Dehnte sich nicht im Osten das weite, grüne Tiefland aus, man glaubte kaum, am flachen Niederrhein zu sein, wenn man sich der Stadt nähert. Hoch über ihren freundlichen Straßen hebt sich auf steiler Höhe das alte Schloß der Herzöge von Cleve-Berg, die Schwanenburg. Von seiner Terrasse schweift der Blick auf der einen Seite weit hinaus in die Niederung, auf der andern aber drängt sich Hügel an Hügel, von fast unabsehbaren Waldungen bedeckt. Der Vorliebe der brandenburgischen Fürsten, namentlich des Großen Kurfürsten, für ihre zweite Residenz verdankt die Stadt einen seltenen Reichtum an prächtigen Parks und schattigen Alleen. Dicht an ihrer Grenze erstreckt sich der bereits im 17. Jahrhundert angelegte malerische Tiergarten, und weiterhin dehnt sich der wildreiche Reichswald aus, das größte Waldgebiet der Rheinlande. So ist es nicht zu verwundern, daß Cleve als Luftkurort und Sommerfrische sich eines von Jahr zu Jahr steigenden Besuches erfreut, namentlich von den Mynheers aus Holland. Wenn der Lenz seinen vollen Zauber über die knospenden Linden- und Buchenwälder ergießt, wenn in den Gärten Strauch und Baum in voller Blüte schimmern und die Wiesen der Niederung sich mit frischem Grün bedecken, dann umgibt diese niederrheinische Stadt ein eigener Hauch von sanfter Poesie.
Mit diesem freundlichen Bilde mag unsere Frühlingsfahrt an den Rhein ihr Ende finden.
Leipziger Illustrierte Zeitung 1908.
Von Freiherr von Ompteda.
Wie erfreut sich das Herz des deutschen Vaterlandsfreundes, wenn er nach Rüdesheim pilgert und aufschaut zum herrlichen Nationaldenkmal, das zum bleibenden Gedächtnis des großen nationalen Kampfes und Sieges von 1870 und 1871, der uns die Einheit brachte, als Wacht am Rhein dort am Steilhang des Niederwaldes aufgerichtet wurde.
Hoch, riesenhoch ragt sie empor, die Frau Germania, frei und meilenweit sichtbar – fast zur doppelten Höhe der Athene-Promachos, die einst, ein Denkmal der Siege über die Perser, die Akropolis überragte, den aus stürmenden Meeren heimkehrenden Schiffern ein Wahrzeichen des nahen heimatlichen Hafens. Ihr reiches blondes Haar wallt wie vom frischen Winde bewegt herab, die vollen, festen Lippen scheinen den gegenwärtigen, wie den kommenden Geschlechtern die Losung zu geben: » Weder trauen, noch fürchten!« Die Linke stützt sich auf das friedlich gesenkte deutsche Schwert, und hoch hebt die Rechte des Reiches neu erstandene Krone, unerreichbar allen Feinden und Neidern, in die freie Luft. Es ist ein wunderbarer Kopf, ein Adel in der Gestalt und Haltung dieser Figur, die Schillings Meisterhand ins Dasein gerufen hat, ein wunderbarer Verein der Anmut und Kraft. Ihre vollendete reife weibliche Schönheit ist erhöht durch den Ausdruck der Herrscherwürde, der gefaßten Entschlossenheit, der überwältigenden Erhabenheit. Wessen Auge dich einmal ehrfürchtig geschaut, der wird dich sein Lebtag nicht vergessen.
Der untere Teil des Sockels zeigt uns über drei Stufen die Gruppe, in welcher der alte Vater Rhein der jugendlichen Mosel, der neuen Grenzwächterin des Rheins, das Wachthorn überreicht; dann erheben sich zu beiden Seiten: der Krieg, ein feuriger Jüngling, in die Kriegsdrommete schmetternd, und der Friede, eine riesig schreitende Figur mit Palmenzweig und Füllhorn, deren milder Ausdruck wie von einem Schleier der Wehmut, im Gedanken der schmerzlichen Opfer, überhaucht ist.
Zwischen diesen zwei symbolischen Gestalten breitet sich das große, realistische Hauptrelief, die » Wacht am Rhein«. In der Mitte der kaiserliche Feldherr zu Pferde, um ihn geschart die Fürsten, Feldherren, Führer; rechts ausziehende, links heimkehrende Krieger; 200 Figuren, davon 150 Porträts! Darunter der volle Text unseres Nationalliedes, aus dem die das Relief erläuternden Schlußworte groß hervortreten:
»Lieb Vaterland, magst ruhig sein,
Fest steht und treu die Wacht am Rhein!«
In gleicher Höhe mit diesen vorderen stehen die beiden großen Seitenreliefs, rechts der Auszug des Rekruten, Reservisten und Landwehrmannes, links ihre Heimkehr zum Vater, zur Braut, zu Frau und Kind. Gestalten voll tiefster Innigkeit des Gefühls, ergreifend durch ihre Naturtreue und lebendige Bewegtheit.
In der Mitte der Vorderseite schwebt der Reichsadler, umkränzt von den Wappen der deutschen Staaten. Darüber das Eiserne Kreuz und über diesem die Widmung:
Zum Andenken an die einmütige siegreiche Erhebung des deutschen Volkes und die Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs 1870-71.
Treten wir, wenn wir uns am Denkmal, in seiner vollendeten Schöne auch ein Denkmal deutscher Bildnerkunst! satt gesehen, zur obersten vorderen Brüstung und betrachten das Land, über welches Frau Germania hütend und herrschend hinausschaut. Hier steht sie auf hoher Bastion, die weit hinausspringt, vor unserer unbezwinglichen Schutzwand aus lebendigem Stahl. Wahrhaftig einer der herrlichsten Flecke deutscher Erde.
Unmittelbar zu unseren Füßen fällt der weinberühmte Berg Rüdesheim steil zum Rhein ab. Die üppigsten Rebengehänge umkränzen das Ufer unseres mächtigen Stromes. Links unter uns Rüdesheim mit seinen altersgrauen Burgen und Türmen; dann breitet sich hinüber gen Bingen das mächtige Becken, in welchem der Rhein seine Wellen beruhigend sammelt, bevor er sich am Mäuseturm vorbei in die engen Pforten des Schiefergebirges und durch die Strudel des Binger Lochs drängt. Drüben links auf halber Höhe des bewaldeten tiefgrünen Bergzuges winkt Ingelheim, der alte Palast des ersten deutschen Reichsbaumeisters, Kaisers Caroli Magni, mit des neuen Reiches Farben zu uns herüber. Hart am Rhein zieht sich der Rochusberg entlang, zu dessen wundertätiger Kapelle heute nicht büßende Pilger, sondern kräftige deutsche Schützenbrüder wallfahrteten, denn dorthin hatte sie die gastfreie alte Stadt Bingen entboten. Rechts im Tale zieht sie sich hin bis zum Ufer der Nahe, deren silbernes Band, um den steil abfallenden Scharlachkopf gewunden, wir unabsehbar hinauf in die Pfalz, nach Westen hin, verfolgen können: das bleibende Merkzeichen der Heerstraße, auf der wir auszogen, um den ruchlosen Angriff unseres übermütigen Erbfeindes abzuschlagen, und auf der dann des neuen Reiches Heer, an der Spitze seinen sieggekrönten Herrscher, zurückkehrte. In der äußersten Ferne schauen der breite Donnersberg und der Odenwald – die zwei Heiligtümer unserer Altvordern – zu dem neuen Nationalheiligtum unseres Geschlechts durch die klare, nebelfreie Luft bläulich herüber.
Es war am 28. September des Jahres 1883, als in Gegenwart des greisen Kaisers, seiner fürstlichen Freunde und Bundesgenossen, vor allem des Kronprinzen Friedrich Wilhelm und des Feldmarschalls Moltke, der Minister und hohen Beamten, die das Werk gefördert, des Meisters Schilling und seiner Genossen, die es zustande gebracht, und einer Jubelschar hochschlagender deutscher Herzen das Nationaldenkmal eingeweiht wurde.
Daheim 1884.
(Zur Charakteristik eines Weinberglandes.)
Wir trafen es so glücklich, daß trotz der späten Jahreszeit doch diejenige Beschäftigung, welche für die Moselanwohner die wichtigste ist und welche die ganze Bevölkerung des Tales in die regste und freudigste, jährlich wiederkehrende Bewegung bringt, die Weinlese, noch nicht vorüber war. Der Sommer war besonders kalt gewesen, die Trauben waren nur sehr langsam gereift, und da ihre Ernte gewöhnlich zu Anfang Oktober vor sich geht, so war sie diesmal bis ans Ende aufgeschoben worden. Es entwickelte sich daher mit dem wachsenden Tage allmählich eine äußerst unterhaltende Tätigkeit längs der Ufer des Flusses, und es füllten sich die Bilder der Landschaften, an denen wir vorbeikamen, überall mit einer sehr mannigfaltigen und belebenden Staffage. Aus den Dörfern zogen ganze Gesellschaften von Winzern – Männer, Weiber und Kinder, denn bei der Weinlese kann ein jedes sich nützlich machen, jede Kraft gebraucht werden – hervor mit Körben auf dem Rücken, mit ihren Winzermessern in der Hand, zuweilen in ihrer Mitte ein Ochsen- und Pferdegespann, das auf dem knarrenden Wagen die Kufe, in der die Trauben getreten werden, schleppte. Bei der Weinlese sind die Leute sehr munter, denn sie legen nun die Hand an die schöne, unter so vielen Bemühungen und Besorgnissen gereifte Frucht. Jetzt endlich wird man des langen und unter mancherlei Gefahren in der Luft schwebenden Besitzes sicher. Ist auch nicht jede der in die Kufen fallenden Beeren so gut wie ein Groschen im Beutel, so tritt doch nun die Aussicht auf Lohn und Gewinn ganz nahe heran. Der Familienvater richtet seine Gedanken auf die Bezahlung einiger ihn schwer drückenden Schulden oder auf die Anschaffung eines lange gewünschten Gegenstandes. Auch ist ja die Arbeit der Weinlese die leichteste, im erfreulichsten Gegensatze zu den vorangegangenen, vorbereitenden Geschäften stehend. Während im Frühlinge und Sommer der Winzer einsam in seinem Weinberge tätig war, ist nun die ganze Familie in großen Gesellschaften beieinander. Selbst wenn die Lese nur unbedeutend zu werden verspricht, ist es doch eine alte, hergebrachte Sitte, dabei zu jubeln, zu schießen, sich zu necken, lustig zu sein und Freunde zu bewirten.
Die Wagen mit ihren Kufen und ihrem Ochsengespann blieben im Tal stehen, und die Leute verteilten sich dann in den Felsen und Klüften, um das edle Bergnaß herabzuholen und den gewonnenen Reichtum in den Bottichen am Uferwege wie zur Parade auszustellen. Und wie die Ufer und Hügel, so belebte sich allmählich unser Fluß selbst. – Die Moselanwohner haben häufig ihre Weinberge auf der einen Seite des Flusses, während ihr Dorf und ihre kleinen Äcker und Wiesen auf der anderen Seite liegen. Sie haben daher bei der Weinernte und bei allen ihren Weinbergsarbeiten die Schiffe noch häufiger nötig als die Wagen und Ochsen. Fast alle größeren Wirtschaften oder mehrere kleine zusammen haben daher auch ihre eigenen Moselnachen, und es entsteht eine Tätigkeit auf dem Wasser, wie man sie auf dem Rheine oder anderen Flüssen, die den Besitz zu beiden Seiten ihrer Ufer mehr auseinander halten als die Mosel, nicht kennt.
Man kann das Moseltal von Trier bis Koblenz als einen sehr langen und sehr schmalen Landstreifen betrachten, der – die Krümmungen des Flusses nicht mit eingerechnet – etwa 100 km lang und dabei im Durchschnitt von der einen Taluferhöhe zur andern, soweit zu beiden Seiten der Weinbau geht, etwa 7½ km breit ist. Das Ganze hat also etwa einen Flächenraum von 750 qkm. Und auf diesem Streifen gibt es wenigstens 200 menschliche Wohnorte: Städte, Flecken, Dörfer, Weiler, Schlösser und Klöster, sodaß das Moseltal hier eine Bevölkerungsdichte aufweist, wie man sie zu beiden Seiten des bezeichneten Striches weit und breit nicht findet.
Der Rhein durchbricht von Bingen bis Bonn das Rheinische Schiefergebirge, dessen Schichten im allgemeinen von Südwest nach Nordost streichen. Das enge Quertal, worin der Rhein im Zickzack sich windet, ist bekanntlich das an malerischer Schönheit reichste, besuchteste und berühmteste Stück des ganzen Stromlaufs. Die Zuflüsse des Rheins rechts und links bilden Längstäler im Schiefergebirge, dessen Richtung sie teilen. In den Quellgegenden sanft, sind sie nach ihrer Mündung hin sehr tief eingeschnitten, und wie in fast allen Tonschiefer- und Grauwackegegenden laufen sie in mäandrischen Windungen. Die auffälligsten und bedeutendsten macht die Mosel, – nachdem sie unweit Trier die Saar aufgenommen hat. Ihre Krümmungen sind so groß, daß, während die direkte Entfernung von Trier nach Koblenz, wie gesagt, nur 100 km beträgt, der Abstand auf dem Flusse selbst sich verdoppelt, indem man bei einer Messung längs der Ufer des Flusses eine Linie von etwa 200 km Länge gewinnt. Während der Fluß im ganzen nach Nordosten fließt, wirft er sich stellenweise derart herum, daß er auf einzelnen Stellen geradezu in entgegengesetzter Richtung strömt. Es scheint zuweilen, als wolle er wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, wieder zu seiner Quelle zurück. Die meisten dieser Krümmungen sind sehr kurz, und fast immer kehrt der Fluß sehr bald in die alte Richtung zurück. Sein Lauf erscheint daher wie ein vielgewundenes Band. Vermittels dieser Krümmungen schneidet er aus dem Festlandskörper eine Menge von Halbinseln von sehr mannigfaltigen Figuren heraus, die sich zum Teil als sehr lange, meist aber als breitköpfige Landzungen zwischen den Schleifen des Flusses darstellen. Zuweilen haben diese Halbinseln einen Umfang, der längs des Flußufers sechsmal größer ist, als die Grundlinie, durch die sie mit dem Festlande zusammenhängen. Die Halbinselgrundlinien bilden also schmale Isthmen, auf denen man, wenn man sie zu Fuße durchkreuzt, sehr schnell von einem oberen Flußpunkte zu einem unteren gelangen kann, während man auf dem Flusse selbst weite, oft sechsmal größere Umwege machen muß.
Daß diese vielfachen Flußwindungen dazu beitragen müssen, das Interesse einer Moselfahrt vielfach zu erhöhen, daß infolge dieser Krümmungen die landschaftliche Umgebung des Flusses, ebenso wie an einem vielgewundenen Bergpfade, sehr viel mannigfaltiger werden muß, als z. B. an einem geradeaus laufenden holländischen Kanalgewässer oder an einer schnurgerade gerichteten französischen Pappelchaussee, leuchtet jedem auf den ersten Blick ein. Der Fluß wird dadurch gleichsam in eine Menge Stücke zerschnitten. Oft ist der Abschnitt so klein und sein Ausgang hinter Bergen so versteckt, daß man bei einer Wendung glaubt, man sei in einen Sack geraten, man befinde sich auf einem kleinen, einsamen Bergsee, fern und abgelegen von aller Welt, oder fürchtet, der Fluß möchte sich dort bei jener Felsenwand in einem Erdschlunde verlieren, wie die Rhône bei ihrer berühmten »Perte du Rhône«, bis dann auf einmal bei einer neuen Wendung der schöne Silberfaden gerettet hervortaucht, weit hinaus sichtbar fortläuft und der Zusammenhang mit der übrigen Welt sich wieder herstellt. – In dem inneren Busen jener Krümmungen ist der Fluß gewöhnlich mit voller Gewalt gegen die Felsen gestürzt, die ihn zur Umkehr zwangen, und hat sie angenagt. Sein Bett ist hier daher tief ausgehöhlt, die Talwände sind schroff und steil abgeschliffen, während die gegenüberliegende Halbinsel, von welcher sich der Fluß zurückzog, niedriger und flacher ist, mit gelinde absteigenden Uferlanden gegen den Fluß ausläuft und oft den fruchtbarsten Wiesenboden rings um sich herum angesetzt hat. Es bieten sich infolgedessen auf beiden Uferseiten der Krümmungen immer die reizendsten Gegensätze dar, auf der einen hoch aufgetempelte und vielfach terrassierte Felsengelände, von oben bis unten entweder mit dunkler Buschwaldung oder mit zahllosen Weingärtchen besetzt, dann und wann auf einem besonders schroffen Vorsprunge eine alte Burgruine und auf der andern Seite die flachere Halbinsel mit grünem Wiesenbesatz, mit weidendem Vieh, mit kleinen Äckern und rings am Saume des niedrigen Flußufers die Flecken oder Dörfer.
Diese Einwirkung der Flußkrümmungen auf die Vervielfältigung des landschaftlichen Schmuckes der Gegend wird jeder sogleich erwartet haben. Allein es sind jene Krümmungen auch noch von sehr großem Einfluß auf die klimatischen, auf die ackerbaulichen und überhaupt auf alle wirtschaftlichen und Rechtsverhältnisse des Moseltales gewesen. Ja man kann sogar sagen, daß die ganze Geschichte, die ganze geschichtliche Bedeutung des Moseltales mit diesen Krümmungen eine ganz andere gewesen ist, als sie es ohne diese bei einer mehr geradläufigen Richtung des Flusses gewesen sein würde, und man kann daher geradezu diese Krümmungen als die wichtigste und beachtenswerteste Erscheinung, als das, was der Mosel ihren ganzen Charakter gab, bezeichnen.
Ich will mit dem Einfacheren und Handgreiflicheren, mit der Einwirkung der Krümmungen auf Klima und Bodenbau, beginnen und erst dann zu dem Verwickelteren, ihrer Einwirkung auf die geschichtliche Rolle, welche der Fluß spielte, fortgehen.
Hätte die Mosel von Trier bis Koblenz einen völlig geradlinigen Taleinschnitt wie ein holländischer Kanal gemacht, so würde bei der nordöstlichen Richtung des Flusses ein linkes Flußufer entstanden sein, das durchweg nach Südosten der Sonne zugewendet gewesen wäre, und dann ein rechtes Flußufer, dessen Gelände sich durchweg nach Nordwesten der Sonne abgekehrt hätte. Wir würden dann wahrscheinlich den Hauptanbau, namentlich den Weinbau, im ganzen Tale auf jener linken oder Sonnenseite finden, und auf der rechten oder Schattenseite würde vermutlich eine andere Bodenkultur begründet, überhaupt weniger Leben entstanden sein. Der ganze Anbau des Tales würde sich einförmig darstellen. Wald-, Wiesen-, Ackerbau und Viehzucht auf der einen, Garten-, Gemüse-, Obst- und Weinbau auf der anderen Seite. Die vielfachen Krümmungen des Flusses bewirken nun aber eine äußerst mannigfaltige Stellung der Ufergelände zur Sonne und bringen fast jeden kleinen Abschnitt des Flusses und Tales in andere klimatische Verhältnisse. Hier ist ein kleiner, ein oder zwei Stunden langer Busen, dessen Abhänge ganz nach Süden gekehrt sind, in dessen Felsengeklüfte die Sonnenstrahlen heiß zurückprallend zusammenschießen und der für den Wärme verlangenden Wein ganz vorzüglich gelegen ist. An diesen Abhängen ist dann jedes Fleckchen für den Weinbau in Anspruch genommen und mit Reben besetzt. Bald ist ein solcher Busen auf der rechten Seite des Flusses, bald, wenn dieser eine seiner neckischen Windungen ausführte, wieder auf der linken. Solche ganz dem Süden zugekehrte Busen erzeugen dann die schönsten Weine, und hier strebt jeder, ein kleines Gebiet zu gewinnen. Es gibt andere Felsenwände, die mehr nach Südosten und Osten, oder nach Südwesten und Westen gerichtet sind, und welche die Strahlen der Sonne im Laufe des Jahres unter sehr mannigfaltigen Winkeln empfangen. Sie erzeugen die mittleren Weinsorten. Endlich gibt es auch Abhänge, die ganz dem Süden abgekehrt und geradeswegs dem Nordpol zugewendet sind. Diese liegen entweder ganz oder doch einen großen Teil des Tages und Jahres im Schatten. Sie sind kalt und dem Weinbau ganz unzugänglich. An solchen nördlich gerichteten Abhängen findet man fast nur die Erzeugnisse, den Anbau und die Pflanzendecke des Hunsrücks und der hohen Eifel. Sie sind mit den sogenannten »Lohhecken« oder »Rodehecken« bedeckt, d. h. mit niedrigem Eichengebüsch, das die Moselaner wie die Hunsrückbewohner schälen, um die Rinde an die Lohgerber zu verhandeln. Fünfzehn Jahre lassen sie die Gebüsche wachsen, dann hauen sie sie um, benutzen das gewonnene Holz zu Stäben usw. bei ihrem Weinbau und verbrennen den Rest, indem aus der Asche und aus den alten Wurzelstöcken die Zweige dann wieder um so kräftiger hervortreiben. Die Lohe oder Eichenrinde dieser Gegenden wird weit und breit verschifft, im Hunsrück gibt es bekanntlich große und berühmte Ledergerbereien, und die Loh- oder Rodehecken des Moseltales bilden daher einen nicht unwichtigen Zweig der Landwirtschaft der Talbewohner. Allerdings spielt heute, wo vielfach chemische Gerbmittel verwendet werden, die Eichenlohe nicht mehr die Rolle, wie in früheren Zeiten, da manche Dörfer jährlich 60 000-90 000 Mark an Lohe und Holz aus ihren Rodehecken lösten. Auch diese nach Norden gerichteten Busenabschnitte sind bald auf der linken, bald auf der rechten Seite des Flusses, und die dunklen Rodeheckengelände mit ihren wilden Gebüschen wechseln daher überall in kurzen Abständen mit den lachenden, geordneten und kultivierten Weinrebenpartien anmutig ab.
Da, wie ich sagte, der Fluß immer wieder und wieder gegen die schroffen Felswände anstürmt und immer wieder und wieder von ihnen zurück- und hin- und hergeworfen worden ist, so liegt in der Regel einem schroffen Ufer ein flacheres und niedrigeres gegenüber. Auf diesem sind dann die Wiesen und Äcker, sowie auch die Häuser und Dörfer, auf jenem bleibt für diese neben dem alles in Anspruch nehmenden Weinbau kein Platz. Die Leute haben daher gewöhnlich ihre Wohnungen und Dörfer auf der einen Seite des Flusses, ihre Weingärten oder Rodehecken auf der anderen, und es ist daraus eine außerordentliche Verwebung der Besitztümer auf beiden Seiten des Flusses entstanden. Jeder Weingartenbesitzer muß doch zugleich auch ein wenig Wiese und Graswuchs für sein Vieh haben, womöglich auch etwas Acker- und Garten- oder Waldland, und da er beides immer auf den beiden entgegengesetzten Seiten des Tales zu suchen hat, so muß er auch auf beiden Seiten des Flusses Besitz erwerben. Demzufolge gibt es keine Dorfgemeinde, kein größeres Gut, ja auch kein allerkleinstes Grundeigentum im Moseltal, dessen Bodenfläche nicht von der Mosel durchschnitten würde. Alle Anwohner sind zugleich Zis- und Transmoselaner und haben den einen Fuß, sozusagen, auf dieser, den anderen auf der entgegengesetzten Flußseite. Und eben daher ist denn hier, wie ich oben schon sagte, auch in jeder Wirtschaft ein Nachen fast so nötig, wie anderswo ein Wagen, um bei der Ernte die Trauben oder das Heu oder die Lohe oder das Getreide hinüber und herüber zu schaffen.
Und nun wird man denn auch schon die Wahrheit dessen, was ich oben von dem Einflusse der Krümmungen auf den geschichtlichen Charakter und auf die politische Rolle, welche die Mosel stets in der Geschichte behauptete, besser erkennen. Ein gerade gerichteter Fluß macht immer einen viel schärferen Abschnitt zwischen den gegenseitigen Uferbewohnern, er verflicht ihre Verhältnisse nicht so sehr, hält sie vielmehr auseinander. Er ist daher in höherem Grade eine Völkerscheide. Er läßt sich auch als militärischer Grenz- und Verteidigungsgraben leichter festhalten und ist daher dienlicher zur Scheidung der Staaten und Provinzen voneinander. Ein vielgekrümmter Fluß, wie die Mosel, dagegen tritt selten oder gar nicht als Staaten-, Provinzen- und Völkerscheide auf. Seine vielen Busen und Krümmungen, die zahlreichen Vorsprünge und sich ineinander verzahnenden und verkettenden Halbinseln sind gleichsam als ebenso viele Glieder einer fortlaufenden Kette anzusehen, die sich untereinander verweben und welche die Berührungen und Beziehungen des Diesseits und Jenseits untereinander vervielfachen. Es schmilzt daraus ein schwer zu trennendes Ganzes hervor, ein Volk, ein Staat, eine Provinz. Bei dem Moseltale finden wir die Behauptung zu allen Zeiten seiner Geschichte bestätigt. Die Mosel hat nie, wie etwa z. B. die sehr geradeaus laufende Iller oder der Lech, zwei verschiedene Völkerstämme voneinander getrennt. Vielmehr wohnten stets zu beiden Seiten des Flusses ganz dieselben Nationen, von demselben Stamme, mit derselben Sprache. Auch hat die Mosel in diesem Teile nie zur Begrenzung eines Staates gedient, wie z. B. der Rhein oder hundert andere minder gekrümmte Flüsse. Vielmehr haben diejenigen Staaten und Nationen, die in das Moseltal vorrückten, immer das ganze Moseltal zu beiden Seiten des Flusses ihrem Gebiete einverleibt. Es gab nie ein Zis- und Transmoselanien, wie es zis- und transdanubische, zis- und transrhenanische, zis- und transalpine Gebiete gab. Die alten Trevirer herrschten zu beiden Seiten der Mosel von Trier abwärts bis Koblenz. Die Römer rechneten das Moseltal zu beiden Seiten des Flusses ebenfalls zu einer und derselben Provinz und teilten nicht etwa durch diesen Flußfaden zwei verschiedene Provinzen ab. Die deutschen Moselgaue lagen ebenfalls zu beiden Seiten des Flusses. Auch die Kurfürsten von Trier beherrschten, wie die alten Trevirer, beide Flußufer bis nach Koblenz, indem sie die Unterabteilung ihres Staates in Unterstift und Oberstift nicht nach dem Diesseits und Jenseits des Flusses, sondern nach dem Oberhalb und Unterhalb seines Laufes machten. Dieselbe Abteilungsweise bestand unter dem französischen Kaiserreiche, in welchem die Mosel wiederum nicht als Departementsgrenze, wie der Rhein an so vielen Stellen seines Laufes, erschien. Auch die Preußen haben das ganze Moseltal auf einmal ergriffen und beide Flußseiten zusammen bei denselben Regierungsbezirken gelassen. Selbst die Unterabteilungen in kleinere Provinzen, Kreise, Bürgermeistereien und Gerichtsbezirke springen an der Mosel immer auf beide Seiten des Flusses hinüber und gliedern sich bloß nach dem Unten und Oben ab. Es würde auch, wie aus dem Obigen zur Genüge hervorgeht, eine Zerreißung aller Lebensverhältnisse, alles Besitzstandes, aller Dorfgemeinden, aller Güterkomplexe, mit einem Worte alles von Natur und Menschenhand Vereinigten und Verschmolzenen sein, wenn etwa ein Machthaber es sich je einfallen lassen wollte, die linke von der rechten Moselseite politisch zu trennen. Nur unter den größten Leiden der Bevölkerung und zum Nachteile aller Verhältnisse würde sich eine solche Trennung bewerkstelligen lassen.
Die vielen mäandrischen Windungen der Mosel sind endlich in Verbindung mit der felsigen und gebirgigen Beschaffenheit der benachbarten Flußufer, mit der Schroffheit, Unzugänglichkeit und Zerrissenheit der beiden Flußseiten die Veranlassung zu der Ausbildung des eigenartigen Wegebaues an der Mosel gewesen, und sie haben auch hierdurch auf die Eigentümlichkeit und den Charakter der Mosellande, sowie auf ihre Schicksale einen mächtigen Einfluß ausgeübt. Die Felsen und schroffen Berggelände ziehen sich oft stundenweit in mächtigen Abhängen längs des Moselufers hin, sodaß dort gar kein Platz für eine breite Fahr- und Kunststraße bleibt, oder daß eine solche doch nur mit dem größten Aufwande von Mühe und Kosten durch die Felsenlabyrinthe gesprengt werden könnte. Wollte man mit einer solchen Kunststraße überall längs des Flusses bleiben und alle die vielen Windungen desselben begleiten, so würde man oft meilenlange Wege anbahnen müssen, um Ortschaften miteinander zu verbinden, die nur einige tausend Schritte auseinander liegen. Wollte man aber überall die Isthmen der Halbinsel in den kürzesten Richtungen quer durchschneiden, so würde man genötigt sein, auf vielen ebenso kostspieligen Brücken die Straße bald diesseits, bald jenseits hinüberzuführen. Ein Weg von Trier nach Koblenz längs der Mosel würde entweder doppelt so lang sein als die direkte Entfernung dieser beiden Städte, oder er hätte etwa 20 solcher Riesenbauten nötig, wie die Brücke bei Trier ist. Es sind daher auch zu keiner Zeit künstliche Fahr- und Steinstraßen längs der Mosel geführt worden, vielmehr hat man die Verbindungsstraßen zwischen der Moselmündung (Koblenz) und der oberen Mosel (Trier) immer in einiger Entfernung vom Flusse, entweder auf den hohen und ebenen Plateaus der Eifel auf der nordwestlichen Seite des Flusses, oder an dem Rücken des Hunsrück hin auf der südöstlichen Seite fortgeführt. Die Hauptstraße ging fast immer auf der Eifelseite. Dies war schon zu der Römer Zeiten der Fall und ist es noch heutigentags. Diese Hochstraße konnte auf dem Gebirgskamme viel gerader laufen als in der Talrinne und ließ sich auch mit weniger Kosten herstellen. Sie zieht sich in einer Entfernung von vier Stunden neben der Mosel hin. Auf ihr bewegten sich in der Regel die Heere, die Reisenden, die Warenzüge von der Obermosel zum Rheine. Das Moseltal selbst verlor daher als eine Völkerstraße, als ein Handelskanal, als ein Theater der Völkerschlachten und Kämpfe, für die der Schauplatz auf den benachbarten Bergrücken war, an Bedeutung. Auch der Wert des Moselfadens selbst als einer Schiffahrtsstraße wurde für große Entfernungen durch die vielen Krümmungen sehr vermindert, der Kostenaufwand der Verfrachtung verdoppelt. Und viele Waren mochten daher stets den kurzen Landweg dem Wasserwege vorziehen, die sonst wohl diesen eingeschlagen hätten, wenn er gerade und minder langwierig gewesen wäre. Das Moseltal mußte also an Bevölkerung und Leben auf der einen Seite wieder einbüßen, was es auf der anderen Seite durch seine klimatischen, dem Wein- und Gartenbau günstigen Verhältnisse gewann.
Ich kenne keine Gegend, der der Weinbau einen solchen Reiz wie dem Moseltale mitteilte, wo er zu so großartigen Bauten und Anstrengungen Veranlassung gäbe, wo er sich so malerisch darstellte wie hier. In den Ebenen der Lombardei sieht ein Weingarten genau aus wie der andere. Am Rhein auch hat man sich oft beklagt, daß die unabsehbaren Weingelände, die stets sich wiederholenden Querstriche mit einförmigen Schattierungen der wie die Soldaten in ihren Kompagnien aufgesteckten gleich hohen, gleich weit auseinander stehenden Rebstöcke die ursprüngliche Mannigfaltigkeit der Bergformen ganz verdürben, und wie die großen Kornfelder in Norddeutschland am Ende eine förmliche Kulturwüste herstellten. An der Mosel kann man eine ähnliche Klage nicht führen. Denn abgesehen davon, daß die Weingelände beständig, wie ich schon sagte, von Waldpartien, von Wiesenland usw. unterbrochen werden und sich dann und wann einmal höchstens eine oder anderthalb Stunden weit in ununterbrochener Masse forterstrecken, so bieten sie auch schon in sich selbst eine ganz außerordentliche und überraschende Mannigfaltigkeit der Gruppierungen und landschaftlichen Bilder dar. Die Bergabhänge, an denen sie liegen, sind viel steiler als am Rhein oder an irgendeinem anderen deutschen Flusse und auch viel bunter gestaltet. Da gehen Stufen über Stufen, Terrassen über Terrassen hinaus, und selbst die höchsten, zum Himmelsfirmamente emporgebäumten Spitzen bieten noch Reben dar und erscheinen wie Himmelstische, auf denen schöne Trauben aufgetragen sind. Die Bergpfade, die vom Ufer des Flusses zu diesen hochgelegenen Geländen hinaufführen, erfordern oft über eine Stunde mühsamen Aufsteigens, und wenn ich die Leute von daher mit den Trauben herunterkommen sah, gedachte ich der Senner und Älpler in der Schweiz, welche ihre Milch kaum weiter herabholen als diese Winzer der Mosel ihren Traubensaft. – Wenn man bedenkt, daß auch die Erde und der Dünger, in denen die Stöcke wachsen sollen, vom Fluß aus ebenso hoch in die Felsenbrüche hinaufgeschafft werden müssen, so erscheint einem die Kühnheit dieser Weingärtner wahrhaft großartig. Sie legen die Wurzeln ihrer Rebstöcke auf Felsenspitzen, auf denen es nur dem Adler bestimmt zu sein schien, seine Eier ins Nest zu legen, und sie trotzen dann dem unwirtbaren Gestein noch süße, goldene Früchte ab, wo die Natur kaum für Heidelbeeren, Schlehdornen und anderes Gestrüpp ein Plätzchen bereit zu haben schien. – Wir glaubten schon bei Bremm die höchsten Weinberge, »Weinalpen«, möchte ich fast sagen, gesehen zu haben. Aber bei Willingen erblickten wir höhere, und an manchen Stellen an der unteren Mosel schienen sie sich noch weiter hinaufzutempeln, so daß ich nicht zu bestimmen wage, wo wir die allerhöchsten zu sehen bekamen. Einmal zählte ich nicht weniger als 30 »Chöre«, eines über dem anderen, von denen sich die äußersten gleichsam in den Wolken zu verlieren schienen. »Chöre« nennt man hier die verschiedenen mit Reben besetzten Stufen oder Terrassen eines Weinberges.
Diese Chöre sind auf die mannigfaltigste Weise angelegt, gerichtet und geformt, je nach der Gestaltung des Bodens und je nach der Laune oder den Ansichten der Besitzer. Fast jeder Besitzer hat bei der Anlage und Kultur seiner Weinberge sein eigenes Verfahren. Und ein Weinbaukenner, der mich begleitete, konnte im Vorüberfahren schon aus dem bloßen Anblick der Chöre, sowie aus der Stellung der Rebstöcke auf ihnen mir mit Bestimmtheit vieles von der Eigentümlichkeit der Kultur jeder Abteilung sagen. – Die Bergabhänge sind von Natur so rauh, so zackig und zerklüftet als nur möglich. Da gibt es Höhlen und Grotten, Felsenspalten aller Art. Die Wände sind zuweilen mehr oder weniger schräg, zuweilen äußerst schroff abgedacht, zuweilen stehen ganz steile Felsenpyramiden wie Zähne hervor. – Da hat man nun sehr mannigfaltige Anstalten treffen, zahlreiche, oft ganz großartige Bauten unternehmen müssen, um so vielfach geneigten Boden zu gewinnen, auf dem etwas Erde und die Wurzeln der Pflanzen haften könnten. Zuweilen sind die Felsenköpfe durch hochschwebende Brücken mit der Hauptmasse des Berges verbunden, damit man das schmale Gelände, das die Scheitel der Felsen darbieten, noch zum Weinbau benutzen könne. Überall sieht man große Gewölbe auf langen, hoch emporragenden Pfeilern gebaut, auf deren Decke dann das Chor oder der Weingarten geordnet wurde. Auf solchen Gewölben wird hier an hundert Stellen der Wein, wie auf Aquädukten das Wasser, an den steilen Felsen herumgeführt, damit er das warme Sonnenlicht einsauge, das an Ihren Wänden zurückprallt. – Man hat die hängenden Gärten der Semiramis vielfach bewundert. Aber wenn man in Gedanken alles zusammenzählt, was im Laufe der Zeiten die Weinbauer hier im Moseltale an hängenden Gärten geschaffen haben, so kommt dabei ein viel größeres Wunderwerk der Welt heraus. – Der Raum ist überall sehr eng und beschränkt und oft, wo in einem Winkel die Lage der klimatischen Verhältnisse besonders günstig ist, sehr kostspielig und wertvoll. Da jede Lage eine andere ist, so ist es auf einer Moselfahrt eine unversiegliche Quelle der Unterhaltung, zu beobachten, wie sich der Mensch unter all den verschiedenen Umständen zu helfen wußte, und wie er bald auf dieses, bald auf jenes Auskunftsmittel verfiel. Zuweilen steht ein Gewölbe dem anderen über dem Kopfe, oft springen die Verbindungswege auf hohen Brückenbogen über die Weingärten, die unter ihnen grünen, hinweg, damit für die Wege kein Boden verloren gehe. Häufig hat man dem alternden Gerippe des Berges selber nachgeholfen und die Risse und Spalten eines Felsen, der mit Zusammensturz drohte, mit Mauerwerk geflickt oder ausgefüllt oder mit stützenden Pfeilern versehen. Und da scheint denn nicht selten das ganze Gebirge aus solcher künstlichen Weinbergsarchitektur zu bestehen, und es ist dabei zuweilen wenig von der natürlichen Gestaltung der Felsen übrig geblieben. – Die meisten dieser Weinberge sind wahrhafte Labyrinthe von natürlichen Felsen und von übereinander getempelten künstlichen Brücken, Pfeilern, Gewölben und Terrassen, an denen die Geschlechter der Moselanwohner seit des Ausonius Zeiten emsig bauten und schafften wie die Bienen an ihrem Wachszellengewebe. – So ein Moselweinbergsgelände von einer Stunde Länge und Höhe hängt da wie ein riesiges Spitzenklöppelwerk aus Stein, und es steckt oft mehr Arbeit und Mauerwerk darin als in einem gotischen Dombau.
Da erkennt man denn zu seinem Schrecken, welche unsägliche Mühe auch dies edle Erzeugnis dem Menschen macht, das die Dichter ein Geschenk des Bacchus zu nennen pflegen, das sie aber besser als ein mühsames Erzeugnis vielfachen menschlichen Fleißes und Schweißes bezeichnen könnten. In Griechenland mag es anders sein, aber hier in Deutschland wenigstens schenkt Bacchus nicht viel dabei; ein Stückchen Fels und einen Wurzelstock, das ist alles. Daß der Stock treibt und süße Früchte bringt, daß diese Früchte nicht nur einen genießbaren, sondern auch einen den Gaumen des Weinkenners entzückenden und den Geist des Dichters berauschenden Saft geben, das alles ist ein Erzeugnis der Kunst und der Schlauheit. Den ganzen Winter über muß der Bacchuspriester, ich meine den Winzer, an der Mosel »schiefern«, d. h. er muß die Schiefersteine aus den Felsen hervorkratzen, zerhacken und in den Weinbergen zerstreuen. Denn diese Schiefersteine des Moselgebirges haben eine gewisse frische, jungfräuliche Kraft, die sie dem Weinstock mitteilen. Sie halten den Boden feucht, verwitternd düngen sie ihn, und sie sind daher beständig zu erneuern. Zugleich müssen im Winter, wenn es die Witterung gestattet, die Mauern in den Weinbergen ausgebessert, die Felsen geflickt und gestützt werden. Dann im Frühling müssen die Winzer die Stöcke aufstellen, den Boden lockern, umgraben und düngen. Und hier bei dem Düngen fährt man nicht etwa, wie wohl unsere Bauern tun, mit einem vierspännigen Düngerwagen aufs Feld hinaus, sondern jede Mistgabel voll Dünger muß, sozusagen, besonders auf dem Rücken der Leute, oft, wie ich zeigte, stundenweit in die Berge hinaufgetragen werden. Die Kornäcker, wenn sie einmal geackert, gedüngt und bestellt sind, und wenn die Körner dem Boden anvertraut wurden, sind fertig, und der Landmann hat dann im Sommer nur zuzuschauen, wie die Ähren ihm in den Schoß reifen. Beim Weinbau ist dies anders.
Der Winzer darf seine Stecklinge fast das ganze Jahr hindurch nicht außer acht lassen. Von der heurigen bis zur nächsten Ernte geht die Kette von Arbeiten, fast ohne abzubrechen, fort. Gleich nach dem Stöckeaufstellen und nach dem Graben muß im Frühjahr auch das alte Holz ausgehauen werden. Der Boden ist immer locker zu halten wie die Poren unserer Haut, damit er Licht, Wärme und Wasser stets willig in sich aufnehme. Die Winzer müssen ihn daher, damit sich keine dichte Gras- und Unkrautsnarbe bilde, im Sommer abermals graben oder, wie man hier sagt, »rühren«. Und ebenso muß abermals im Sommer das überflüssige Holz ausgehauen werden, und zwar diesmal das frisch gewachsene, damit die Stöcke nicht ihre Kraft in der Ausbildung geiler, unfruchtbarer Zweige vergeuden. – Dies sind aber nur die großen und regelmäßig wiederkehrenden Arbeiten, die kleinere Mühe und Not, das Anbinden der losgerissenen Zweige, das Jäten usw. und die außerordentlichen Anstrengungen, zu welchen die Zerstörungen von Wind und Wasser Veranlassung geben, gehen noch immer zwischendurch. Der Regen richtet, namentlich bei heftigen Ergüssen, zuweilen in diesen hohen Weinbergen der Mosel die herzbetrübendsten Verwüstungen an. Weil die Gehänge so hoch und schroff sind, erlangen die Regenbäche oft eine unwiderstehliche Kraft und Mächtigkeit und sammeln sich zu wilden Strömen, die alles mit sich fortführen. Die Leute haben zwar in ihren Bergen auch Veranstaltungen getroffen, den überflüssigen Regen unschädlich abzuführen, Kanäle gebaut und Rinnen ausgemauert; aber gegen außergewöhnlich heftige Ergüsse sind diese Maßregeln zuweilen nicht ausreichend. Manchmal hat man wohl auch einen Weinberg, um doch einen Felsenabhang nicht unbenutzt zu lassen, etwas zu steil angelegt, oder vielleicht ist es eine ganz neue Anlage, die Erde ist frisch hinaufgebracht und noch nicht gehörig auf ihrer Unterlage befestigt, und da ergießt sich dann auf einmal in der Nacht ein unbarmherziger Wolkenbruch darauf herab, und am anderen Morgen finden die bedauernswerten Leute alle ihre mühselig hergeschleppten, zerhackten und sorgfältig ausgebreiteten Erdklöße, ihren ganzen Acker von oben herabgeführt und mit dem Erdreich ihrer Nachbarn am Fuße des Berges zu einer wilden Schlammlawine vermischt. Man sieht zwar in den Alpen der Schweiz solche Schlammlawinen in noch großartigerem Maßstabe, aber dort ist es dann nur wildes Erdreich, nutzloses Gestein, verwittertes Felsgetrümmer, das stets nur ein Spielzeug der Naturelemente war. Aber hier in den Weinbergen hatte fast jedes Schieferstück seine Bestimmung, an jeden Kloß knüpfte sich eine Berechnung, an jede Schaufel voll Erdreich oder Sand, welche nun die wilden, schmutzigen Gewässer zerstreuten und mit sich entführten, war eine Menge von Mühe verschwendet. Wir sahen im Vorüberfahren noch die Spuren mehrerer solcher unheilvollen Ereignisse, deren traurige Geschichte uns unsere Reisebegleiter erzählten.
Um das beständige Hin- und Herschleppen der Gerätschaften und Werkzeuge, die ihnen bei ihren mancherlei Arbeiten nötig sind, zu vermeiden, und um auch sonst noch andere nötige Dinge bergen und aufbewahren zu können, haben die Leute sich in den Weinbergen hier und da kleine Winzerhäuschen gebaut, die dann in der Zeit der Traubenreife als Wachthäuser und Wächterposten dienen. Auch diese Winzer- und Wächterhäuschen sind oft derart, daß sie einen Maler entzücken müssen. Zuweilen sind es neugebaute kleine Häuschen, das eine in diesem, das andere in jenem Geschmack. Zuweilen hat man irgendein altes Mauerwerk, einen von den Rittern des Mittelalters oder vielleicht gar noch von den Römern gebauten Wartturm dazu benutzt. Zuweilen hat man bloß die Felsengrotten und die Höhlen in den Bergabhängen mit verschließbaren Türen und Eingängen versehen. Vor diesen Höhlen sitzen die Wächter des Abends beim Feuer oder die Arbeiter während der Mittagssonne im kühlen Schatten, sich mit Trank und Speise labend. Es gibt da so hübsche Gruppierungen und Bilder, wie man sie nur bei den Hirten von Arkadien finden kann.
Der Weinbau ist den Moselanern alles. Es ist fast ihre einzige Kultur, ihre alleinige Industrie. Kornfelder trifft man bei ihnen selten, obwohl nicht mehr so selten wie früher. Ihre Wiesen, ihr Vieh haben sie hauptsächlich des Weinbaues wegen. Man sagt, daß es einzelne Dörfer gibt, die 9000-18 000 hl in guten Jahren erzeugen. Im ganzen Moseltal von Trier bis Koblenz werden auf 6400 ha Weinland jährlich 200-300 000 hl des edlen Getränkes gebaut – dabei ist der Wein, der von der Mosel nur den Namen hat, nicht eingerechnet.
Nach J. G. Kohl, Skizzen aus Natur- und Völkerleben, Bd. II.
Wandert man von der Rheinniederung das Ahrtal aufwärts, so gelangt man bald hinter Altenahr in eine Landschaft, die ernster und stiller ist, als die des unteren Talabschnittes. Höher wachsen die Berge an, tiefer steigen die Wälder herab oder machen weiten Heiden Raum, und die Reben bleiben zurück und mit ihnen manch heiteres Gewächs, das die sonnigen Gehänge des unteren Tales ziert. Eine gute Straße führt uns aufwärts. Vor etlichen Jahrzehnten war sie ein beschwerlicher Weg mit Furten durch den Bach und ungangbar nach längerem Regen. Damals ging noch zweimal in der Woche der Briefbote mit seinem Felleisen von Adenau hinab nach Bonn; nun fährt mehrmals des Tages die Eisenbahn.
Adenau selbst liegt in einem Seitentale der Ahr, das sich bei Dümpelfeld abzweigt und von sanft ansteigenden, aber hohen Bergen eingefaßt wird. Wer die gut bewässerten Wiesen, die zahlreichen Obstbäume des Ortes sieht, glaubt sich noch kaum in der hohen Eifel, aber in ihrer ganzen Eigenart liegt diese vor uns, wenn wir die Höhen erstiegen haben. Dann stehen wir mitten in jenem Berglande, das als ein Teil des großen rheinischen Schiefergebirges sich an die Ardennen in Belgien anlehnt, von den Tälern der Mosel und des Rheines begrenzt wird und den Südrand der Niederrheinischen Ebene bildet. Mehr oder weniger scharf trägt dieses ganze Gebiet das Gepräge der Hochebene. Grauwacken und Tonschiefer bilden zumeist deren Boden; aber zerstreut laufen Bergzüge von marmorartigem Eifelkalk, welche prächtige Bausteine liefern, hindurch. Auf einem solchen Kalkrücken entspringt die Erft, und in dem nämlichen liegt die Quelle der Ahr, welche stark und klar mitten im Orte Blankenheim an dem Fuße einer burggekrönten Anhöhe entspringt. Am Nord- und Südrande des Gebirges überlagert der Buntsandstein die devonischen Massen, im Norden bei Call und Mechernich, wo in ihm die großen ergiebigen Bleigruben liegen, im Süden an den Tälern der Prüm und Kyll, wo er in schroffen Felspartien herrliche Landschaftsbilder entfaltet. Ihre ganze Eigentümlichkeit und Berühmtheit aber verdankt die Eifel den zahlreichen vulkanischen Erhebungen, welche auf ihr einst stattgefunden und wechselvolle Bergsysteme aufgetürmt haben.
Wer im Frühling in die Eifel geht, wenn in den tiefen Flußtälern schon alles grünt und blüht, findet hier oben eben die ersten Spuren des erwachenden Lebens. Am frühesten regt sich das junge Pflanzenleben auf den vulkanischen Gesteinen, dem Basalt und dem Trachyt, welche die Humusbildung begünstigen und die ersten Sonnenstrahlen aufsaugen, später auf dem kälteren Schieferboden, zuletzt auf dem Kalk, einem schlechten Wärmeleiter, der dafür aber auch am längsten, bis tief in den Herbst hinein, sein grünes Pflanzenkleid bewahrt. Allmählich verwischen sich die Unterschiede, und langsam legt allenthalben das Heideland sein Festgewand an. Zuerst blühen Pfriemenstrauch und Ginster, die gesellig mit den düstern Wacholderbüschen auf der Heide wachsen, in goldener Pracht. Dann kommen die Heidekräuter selbst und breiten einen purpurnen Farbenton über das ganze Land. Lieblich wechselt mit ihm das Grün der Wiesen ab, welche die flachen Talmulden decken und die, obwohl häufig moorig und von geringem Ertrage, stets in buntestem Blumenflor stehen. Die Nebel, die am Morgen und Abend aus ihnen aufsteigen, vermischen sich dann mit dem Rauch der Schiffelfeuer, der in langen weißen Streifen über den öden Flächen ruht.
Kaum daß im Herbst die bläulichen Kelche der Zeitlose abgeblüht sind, so kommt ein früher Winter in das Land hinein und breitet eine Schneelage nach der anderen über die Eifel. Dann gibt's schlimme Zeiten für Menschen und Vieh. Die Postwagen ziehen mühsam auf Schlitten durch die Berge, und es kommt vor, daß die Leute in den Dörfern sich Tunnels von Haus zu Haus, durch den Schnee graben, um miteinander in Verkehr zu bleiben. Freilich sind diese Verhältnisse nicht überall gleich ungünstig. Am unwirtlichsten sind die Schneifel, ein gewaltiger, aus Quarziten gebildeter Gebirgsrücken im Osten, zwischen den oberen Tälern der Alf, Prüm, Our und Kyll, die Hochebene von Kelberg, welche die Wasserscheide zwischen Ahr und Mosel bildet, und einzelne höhere Bergzüge im Norden. Wo das Land sich nach den tieferen Tälern zu senkt, wird es milder, und in diesen selbst begegnet uns ein ganz anderer Landschaftscharakter. Die Dörfchen auf den Höhen sind klein und armselig, die in den Tälern wohlhäbiger, auch kleine Städte liegen dort. Sie tragen alle ein ähnliches Äußere, besitzen etliche altertümliche Häuser, einige neue Gebäude, vielleicht auch eine Fabrik, welche die Wasserkraft des Baches ausnutzt und daneben Bauernwohnungen. Vieh zieht durch die gepflasterten Straßen, und das Rollen des Postwagens und das helle Horn, das schon am frühen Morgen den Reisenden zum Aufbruch weckt, geben das Leben. Ein reger geselliger Verkehr unter den Gebildeten des Ortes bietet Ersatz für die vielen Mißstände, welche aus der Abgeschlossenheit hervorgehen.
Die Viehzucht ist bisher immer noch das wichtigste gewesen, was die Eifel gewährt. Die einzelnen Gemeinden besitzen zum Teil ausgedehnte Ödländereien, von denen strichweise der Morgen keine 15 Mark wert ist und auf denen die Herden den Sommer über weiden. Die Entschädigung, welche die Besitzer dafür an die Gemeindekasse entrichten, beträgt oft nur 50 Pfg. für ein Rind, und 40 Pfg. für ein Schaf, in manchen Gegenden freilich etwas mehr. Zugleich bezieht das Vieh dafür auch mit der gemeinsamen Herde die Brachäcker der einzelnen Bauern, nebst deren Wiesen, besonders im Vorfrühling und nach der Grummeternte. Der Hirt erhält als Lohn 20 bis 30 Pfg. täglich, nebst Kost, die ihm abwechselnd von den Viehbesitzern, je nach deren Zutrieb zur Herde, für eine bestimmte Zeit zuteil wird. Selbstverständlich jedoch unterliegen diese Verhältnisse bedeutenden Veränderungen je nach den einzelnen Bezirken. Die Schafherden der hohen Eifel führen manchmal ein echtes Nomadenleben, ziehen im Winter zu den wärmeren Bergen der Mosel, wo der Schnee früher schmilzt und weniger hoch liegt, oder vereinzelt auch in die Ebenen bei Euskirchen. Im Frühling kehren sie zurück und wandern häufig noch im Sommer ins Maifeld, wo sie die großen abgeernteten Äcker oder Brachfelder gegen geringe Entschädigung abweiden. Ähnliche Verhältnisse im Klima und Pflanzenwuchs bedingen somit die nämlichen Wanderungserscheinungen hier in der Eifel, wie bei den bergamaskischen Schafherden auf den Alpen Oberitaliens und bei den Merinos auf den Hochflächen Spaniens. Selbst die Schweine sind in der Eifel vielfach herdenweise draußen, erlangen deshalb kräftigere Gestalt und liefern gesuchte Ferkel zur Anzucht, die früher weithin durchs Land verkauft wurden.
Der Ackerbau in den höheren Teilen der Eifel erzeugt vorn wiegend Roggen, Hafer, Heidekorn oder Buchweizen und Kartoffeln. Letztere bilden das Hauptnahrungsmittel für den weitaus größten und ärmeren Teil der Bevölkerung. Aus großer, gemeinsamer Schüssel werden sie bei fast allen Mahlzeiten verzehrt, Kaffee ist das begleitende Getränk. Sobald in einem Jahre die Kartoffeln mißraten, ist der Notstand da. Ein solcher Fall hat in neuerer Zeit die Mißstände der Eifel den weitesten Kreisen zur Erkenntnis gebracht und zahlreiche Verbesserungsversuche ins Leben gerufen.
Einst, namentlich unter französischer Herrschaft, ist an dem Lande viel gesündigt und in den früher großen Waldungen arg gewirtschaftet worden. Infolgedessen veränderten sich Klima und Bodenbeschaffenheit in der schlimmsten Weise. Wer die Eifel vor Jahren in dieser ganzen Öde und Armut sah, ahnte vielleicht nicht, daß auch sie ihre glänzenden Zeiten gesehen, wo mächtige Dynastengeschlechter in ihr ihre Stammsitze hatten. Da standen stolze Burgen auf ihren waldgeschmückten Höhen und schauten mit schimmernden Zinnen und Fenstern hinab in die tiefen, friedlichen Täler. Jetzt ragen ihre öden Trümmer aus düsterm Heideland empor, und weidende Herden ziehen da, wo einst in lustigen Wäldern das Hifthorn erschallte. Die Geschichte hat uns viel aus diesen glänzenden Zeiten des Rittertums bewahrt, da der Ruhm der mächtigen Grafen von Virneburg sich vom Abend- bis zum Morgenlande verbreitete, da edle Geschlechter auf Are und Nürnberg, auf Wernerseck und Monreal, in Gerolstein und Manderscheid wohnten und bedeutende Kirchenfürsten und Kriegshelden aus ihnen hervorgingen und auf die Geschicke des weiteren Vaterlandes großen Einfluß übten.
Aber auch der veränderte Weltverkehr brachte der Eifel noch in jüngerer Zeit bedeutende Nachteile. Die großen Straßen von Bonn nach Wittlich, von Koblenz nach Aachen, von Köln nach Trier und manche andere gingen quer durch das Gebirge hindurch. Mancher weit hinaus reisende Fremde, der nunmehr im eleganten Eisenbahnwagen über die Schienengleise der großen Talbahnen fliegt, mußte ehemals in mehrtägigen Postfahrten durch die Eifel und ließ manch hübsches Stück Geld in der armen Gegend, das nun nimmermehr seinen Weg bis dorthin findet. Das ganze Leben, welches an einen solchen regen Postverkehr gebunden ist, zog sich aus dem Gebirge weg und ließ größere Armut zurück. Sonstiger Nebenverdienst blieb bei dem Mangel jeglichen Gewerbebetriebs und bei der Entfernung von den Absatzgebieten den Leuten der innersten Eifel schwer, und mochte auch mancher in einem einzigen Sommer für 25 Taler Wacholderbeeren schlagen oder Körbe voll Heidelbeeren pflücken, solche Fälle waren vereinzelt und hälfen der Gesamtheit wenig.
Jedoch eine neue Zeit hat unter der Fürsorge der Regierung bereits für die Eifel begonnen. Allgemein schreitet die Aufforstung der kahlen Gebirge fort; prächtige junge Wälder von Tannen überraschen bereits den Wanderer auf den Höhen der Schneifel und den meisten anderen Bergkämmen und Wasserscheiden. Jetzt liefern viele Waldungen längst schon hübschen Ertrag, und das »Preußenholz«, wie die Bewohner zuweilen die Tannen nennen, wandert als Stützmaterial zum Bau der Stollen in die Bergwerke Belgiens, des Ruhr- und Saargebietes. Zwar mußte zur Hebung der Waldkultur vielfach die Viehzucht in ihrer nachteiligen Ausbeutung des Landes eingeschränkt werden, und sie stieß deshalb auf viel Widerspruch, aber ihre wohltätigen Folgen tun sich heute schon mannigfach kund. Neben der Forstkultur ist Großartiges für Verbesserungen der sumpfigen Wiesen getan worden. Allenthalben werden ausgedehnte Flächen drainiert, d. h. durch Abzugsgräben vom moorbildenden Bodenwasser befreit und hernach durch Überrieselungsanlagen wieder bewässert. Ein besonders ausgedehntes Werk dieser Art ist die Drainierung des Dreiser Weihers, eines ehemaligen abgelassenen Maares, die mit großem Kostenaufwande betrieben wurde.
Als erste Bedingung einer günstigen Abfuhr ziehen überall gute Straßen durch das Gebirge, aber auch das Bahnnetz sendet langsam einen Zweig nach dem andern in die Eifel, für welche namentlich die Strecke Köln-Trier und neuerdings die Linie von Aachen über das Hohe Venn nach Montjoie, St. Vith, Prüm und Luxemburg, die Route Mayen, Daun, Gerolstein, Prüm und die Strecke Remagen-Adenau von weitgreifender Bedeutung waren. Sogar die Obstkultur hat trotz des rauhen Klimas bereits günstige Erfolge zu verzeichnen. Obst von Adenau wurde schon mehrmals auf Ausstellungen preisgekrönt, und vor einigen Jahren legte Manderscheid mit den Notstandsgeldern eine großartige, vielversprechende Obstbaumanlage an den warmen Schlackengehängen des Mosenberges an. In die Milchwirtschaft ist gleichfalls eine bedeutsame Wendung gekommen. Vielfach hat die bisherige Butterbereitung schon dem neuen, zuerst in Schweden und Norwegen angewandten Kaltwasser-Verfahren weichen müssen, welches den Rahm ohne Säuerung gewinnt, den Preis der Butter steigert und die zurückbleibende süße Milch für Haushaltungszwecke nicht entwertet. Die Geistlichkeit hat sich vielfach mit großer Hingebung um die Einführung dieses neuen Verfahrens verdient gemacht und dabei die regste Unterstützung seitens der Regierung gefunden, die unbemittelten Leuten sogar unentgeltlich die dazu notwendigen Zinkgefäße überließ. Neben dem materiellen Vorteil ist die Gewöhnung an Ordnung und Sauberkeit, von denen das Gelingen dieser Art der Butterbereitung mit abhängt, eine nicht zu unterschätzende, auch auf andere Verhältnisse notwendig sich übertragende Frucht dieser neuen Einrichtung. Auch hat man sich mancherorts um Einführung einer Hausindustrie bemüht, um die armen Leute an den langen Winterabenden, die sie meist arbeitslos verbrachten, zu beschäftigen. Ihre Bedeutung wird vielleicht für die Eifel einmal ebenso groß werden, wie sie es für andere rheinische Gebirge, z. B. den Schwarzwald oder den Hunsrück schon ist.
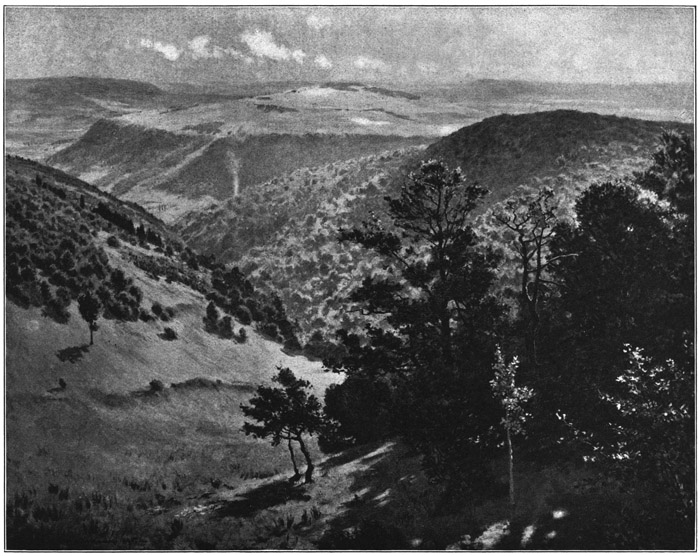
Eifellandschaft.
Nach einem Gemälde von Hans v. Volkmann im Städt. Museum der bildenden Künste in Leipzig.
So sehen wir von den verschiedensten Richtungen aus die Aufbesserung der Verhältnisse in der Eifel in Angriff genommen, die leider manchmal gerade bei denen auf Widerstand stößt, deren Lage sie verbessern soll. Für den weniger einsichtigen Teil der Bevölkerung ist es eben manchmal lästig, aus althergebrachtem Schlendrian von außen her aufgerüttelt zu werden. Aber die bessere Einsicht bleibt auf die Dauer doch nicht aus und überwindet das eingewurzelte Mißtrauen, und Männer, deren Vorgehen man anfangs mißdeutet hatte, werden jetzt schon als Wohltäter des Landes betrachtet. Endlich ist aber auch in neuester Zeit die Eifel das beliebte Wanderziel für Touristen und der gesuchteste Aufenthaltsort für Sommerfrischler, namentlich aus den großen rheinischen Städten, geworden. Besonders Daun, Gerolstein und Manderscheid sind hier als Mittelpunkte des Reiseverkehrs zu nennen. Aber dieser Zug in die Eifel steht erst in seinen Anfängen und wird für das früher so einsame Gebirge in Zukunft noch eine erhöhte und segensreiche Bedeutung gewinnen.
Wer über das ganze große Gebiet der mittleren Eifel, von welcher wir hier redeten, eine umfassende Rundschau genießen will, der besteige von Adenau aus die Hohe Acht, die höchste Erhebung im ganzen Gebirge (760 m). Prächtige Buchenwälder rauschen um diesen steilen, mächtigen Basaltkegel, von dessen Gipfel aus der Blick ein unermeßliches Wald- und Heidegebiet umfaßt. Vor dieser stolzen Höhe verflachen sich weithin alle umliegenden Berge und treten zurück; nur die Nürburg erhebt fast ebenbürtig in einiger Entfernung ihren burggekrönten Gipfel. Hier oben kann es geschehen, daß Morgennebel oder aufziehende Gewitter die unter uns liegende Hochebene mit dichten, weißen Wolkenschichten überziehen, während die Spitze des Berges sonnenbestrahlt und klar in die blaue Luft hinausragt. Wie von den hohen Gipfeln der Alpen schweift alsdann das Auge über ein unabsehbares, flockiges, im reinsten Lichte schimmerndes Wolkenmeer, aus dem ferne Berge wie dunkle Inseln sich erheben. Wenn aber die Luft sich aufheitert, tritt nach Norden in dämmernder Ferne die Ebene des Niederrheins mit dem Kölner Dome hervor, und nach Süden erhebt sich der Hochwald blau und duftig, wie eine aufsteigende Wolkenschicht über die Berge der Vordereifel und Mosel. Aber in diesem großen Landschaftsbilde, welches die Hohe Acht beherrscht, ziehen immer wieder zwei Gebirgspartien unsere Blicke auf sich, nach Westen eine langgedehnte Kette hoher Kegelberge, nach Osten eine eng zusammengedrängte Gruppe stolzer Gipfel. Dies sind die beiden großen Vulkansysteme der Eifel.
Zwischen den Bergen des östlichen gewahrt man vom Gipfel der Hohen Acht aus trotz der Ferne eine bedeutende Senkung, dies ist das Becken des Laacher Sees, der Mittelpunkt für einen formenreichen vulkanischen Herd. Tief einsam liegt dieses geheimnisvolle Maar mitten im Schoße des Gebirges, umringt von einem waldbedeckten Bergkranze, über dessen hohen Wall stolze vulkanische Kegel emporragen. Mancher, der die innere Eifel nicht kennt, hat diesen seltsamen See gesehen, hat mit Erstaunen durch die grünen Buchenwipfel des umringenden Bergrandes hinabgeblickt auf die bläuliche, glitzernde Fläche, die so märchenhaft aus dieser Waldeinsamkeit aufschaut und auf das weltverlassene Kloster und die hohe Kirche, die einsam an ihrem Ufer stehen. In die Stille, die hier herrscht, tönt nur das leise Flüstern des Schilfs vom Ufer her und aus dem Walde das Rauschen des Laubes, des Kuckucks Ruf und das Girren der wilden Tauben. Kein Wunder, wenn hier seltsame Sagen gehen von dem hohen, glänzenden Zauberschloß, das in die Tiefe des Sees versank. Unergründlich ist er beim Volke noch heute; aus ihm schwamm unterirdisch der große Hecht in das Ülmener Maar, um den Grafen von Ülmen zukünftige drohende Ereignisse zu verkünden. Aber auch mit dem Rheine stellt die Sage den stillen See in Verbindung, kam ja doch richtig das Hecksel im Binger Loch wieder zum Vorschein, das man einst bei Laach versenkte. Die ahnungsvolle Bewunderung, die das Volk vor diesem Ort empfindet, teilt der Forscher. Einst lebten und wirkten jahrhundertelang in dem stillen Kloster die Mönche. Weit hinaus verbreitete sich der Ruf ihrer Gelehrsamkeit, aber die Rätsel des Sees wurden durch sie nicht gelöst. Die großen Naturforscher unseres Vaterlandes besuchten später fast alle diese Stätte, und mehr und mehr verbreitete sich Licht über den See und seine Herkunft und über die Entstehung der Berggruppe, welche ihn umgibt.
Zu einer Zeit, wo noch der Rhein das große Becken von Neuwied als See erfüllte und die enge Talspalte bei Andernach noch nicht durchbrochen war, ereigneten sich die großen vulkanischen Ausbrüche in diesem Teile des Schiefergebirges und weiter im Osten im Innern der Eifel. Hohe Schlackenkegel mit rauchenden, feuerspeienden Kratern wurden aufgeschüttet, und aus ihren Seiten ergossen sich glühende Lavaströme, flossen über das umliegende Land oder ergossen sich in die Schluchten der nahegelegenen Täler. Durch lange Zeiten hindurch muß sich das furchtbare Schauspiel an den verschiedensten Orten wiederholt haben, Ausbrüche erfolgten noch dann, als der See von Neuwied abgelaufen war und das Rheinbett und die ihm sich zuwendenden Seitentäler wesentlich ihre jetzige Gestaltung und Tiefe angenommen hatten; denn auf Lavaströme, welche noch die zwischen zwei Tälern gelegenen Bergrücken überdecken, also zu einer Zeit geflossen waren, als jene noch nicht sich gebildet hatten, folgen andere, die tief in den Tälern als hohe Felswände anstehen und sogar unterhalb Andernach zu dem Wasser des Rheines hinabsteigen. Neben der Lava drangen stellenweise heiße Schlammströme hervor, quollen zu hohen Tuff-Erhebungen an oder füllten die Sohle der Täler bis zu erstaunlicher Höhe. Vielleicht aber schlugen auch die mit den Ausbrüchen fast immer gleichzeitig auftretenden heftigen Gewitterregen die in der Luft schwebenden Staub- und Bimsteinwolken zu dem zähen, breiartigen Schlamme nieder, dessen erstarrte Massen der Wanderer mit Staunen besonders im Brohltale durchschreitet. Den Schluß für die ganze vulkanische Tätigkeit dieser Gegend bildete wahrscheinlich der Ausbruch einer ungeheuren Bimstein- und Aschenmasse, die vielleicht aus dem in sich zusammengestürzten Becken des Laacher Sees oder einem der ihm naheliegenden Krater hervorging und bei westlichen Winden das ganze Land, vornehmlich das Maifeld und das Neuwieder Becken überschüttete. Bis weit in den Westerwald, bis in die Gegend von Gießen und Marburg drang, luftgetragen, der feine Staub.
Längst ist nunmehr diese Tätigkeit erloschen, keine geschichtliche Kunde berichtet von ihr, aber noch heute sprudeln in dem ganzen vulkanischen Gebiete zahlreiche heilkräftige Sauerquellen, und für unbedeutende Erdbeben scheint der Laacher See noch heute der Mittelpunkt zu sein. Auch die verkohlten Pflanzenreste in dem Tuff des Brohltales, welche den nämlichen Bäumen und Sträuchern angehören, die noch heute dort wachsen, sprechen dafür, daß, mit geologischem Maßstabe gemessen, keine allzulange Zeit seit dem Erlöschen der Vulkane verflossen ist. Einen weiteren interessanten Beweis für diese Annahme liefern die Funde vom Martinsberge zu Andernach, die jetzt im Provinzialmuseum zu Bonn untergebracht sind. An der genannten Stätte, die ehemals das Ufer des damals viel höher dahinfließenden Rheinstromes gebildet haben mag, fand man die unzweifelhaften Spuren einer menschlichen Ansiedlung. Zahlreiche rohe Steingeräte, namentlich Beile, lagen umher, daneben fand man einfache Knochengeräte, wie Bohrer, mit Widerhaken versehene Harpunen zum Fischfang, durchbohrte Tierzähne zum Schmuck, bestimmt, an eine Schnur gereiht zu werden, und endlich auch an der Krone eines Hirschgeweihes als rohes Schnitzwerk einen Vogelkopf, die erste Spur erwachenden Kunstsinnes.
Zugleich lieferten diese Funde einen Beweis für das damals herrschende kältere Klima unseres Rheintales; denn neben den zum Zwecke der Markgewinnung zerschlagenen Knochen eines wilden Pferdes fand man Knochenreste vom Renntier, Polarfuchs und Schneehuhn. Was aber als das Fesselndste bei dieser prähistorischen Ansiedlung betrachtet werden muß, ist der Umstand, daß sie teilweise auf einem damals schon erkalteten Lavastrome errichtet war und daß über ihr eine Schicht von Bimstein und vulkanischer Asche ausgebreitet lag, Verhältnisse, die den untrüglichsten Beweis dafür liefern, daß während der Zeit jener vulkanischen Ausbrüche der Eifel und des Maifeldes schon Menschen an den Ufern des Rheines gewohnt haben, und daß jene Ausbrüche sich über weite Zeiträume ausgedehnt haben müssen.
Wichtigere Zeugen als die heute sprudelnden Quellen und Kohlensäure aushauchenden, mehr und mehr verschwindenden Mofetten sind die alten Vulkane selbst, die im Umkreise von mehreren Stunden zahlreich das Becken des Laacher Sees umgeben. Da steht bei Mayen der stolze Hochsimmer und sein Nachbar, der Forst. Näher dem See erheben sich der Veitskopf und der Kruster Ofen, nördlich von ihnen der Bausenberg mit gewaltigem Kraterwall, dessen scharfgeschnittene Ränder über das Vinxt- und Brohltal ansteigen, und der auf demselben Kamme gelegene Herchenberg mit seinem kahlen Aschen- und Schlackenkegel.
Bei letzterem watet der Fuß des Wanderers noch heute in der losen Asche, die einst der Vulkan glühend ausspie und in welcher beim Sonnenschein unzählige glatte Blättchen von Magnesiumglimmer flimmern, während auf dem Gipfel die düsteren Randwälle des Kraters und eines Gasausbruch-Trichters mit zusammengebackenen Schlackenmassen emporstarren.
Um den wohlerhaltenen Krater des Bausenberges dagegen überraschen den Gesteinskundigen deutlich erkennbare vulkanische Bomben und ein Reichtum an wohlausgebildeten Augitkristallen in der losen Asche des Vulkanes.
Im Süden dieser Vulkangruppe aber, wo das fruchtbare Maifeld sich zur Ebene von Neuwied und den sanften Gehängen der unteren Mosel abdacht, ragen der Plaidter und Krufter Hummerich, der Camillenberg und andere Kegel empor. An ihrem Fuße wohnten einst, länger vielleicht, als in irgendeinem anderen Teile der Gegend, keltische Volksstämme; denn noch heute weisen fast alle Ortsnamen dieses Gebietes, wie Plaid und Mendig, Pollig und Pillig, Kettig und Kerig, Wellirg und Collig und manche andere, auf keltischen Ursprung hin. Ja, selbst von der alten vulkanischen Vorzeit scheint der Name des Ortes Ochtendung, im Keltischen soviel wie »brennender Berg«, einen Nachklang zu geben. In späterer Zeit sahen diese erloschenen Vulkane auf die großen Volks- und Kriegsversammlungen der Franken herab, die auf dem Maifelde abgehalten wurden, und von denen die drei Tumben, Erdhügel bei Ochtendung, noch heute erzählen. Jetzt aber dienen die Gipfel dieser Berge allen denen als Wahrzeichen, die von Koblenz aus sich gegen die hohe Eifel wenden.
Mitten durch die hohen Bergmassen dieses Vulkangebietes hindurch brechen zwei größere Täler zum Rheine. Durch das eine fließt die Nette und bespült manchen alten Lavastrom, der ehemals ins Tal sich ergoß. In diesem Tale und auf seinen Bergen spielt eine der schönsten Legenden der Rheinlande. Hier lebte, wie durch ein Wunder dem Tode entgangen, in der Verbannung die fromme Genoveva, deren Andenken die Frauenkirche bei Mayen bewahrt. Im oberen Tale der Nette liegt als Mittelpunkt dieser Landschaft das gewerbreiche, frisch aufblühende Städtchen Mayen. Weiter abwärts aber, wo der Bach bei der »Rauschenmühle« die Lavablöcke der Wannenköpfe durchfließt, hat die Natur ein reizendes Idyll geschaffen, in dem duftiges Waldesgrün, Wasserrauschen und Nachtigallenschlag im Frühling den ermüdeten Wanderer wie ein schöner Traum umfangen.
Ähnliche Bilder bietet das Brohltal, aber ein reger Bergbau erfüllt es mit größerem Leben. Überall werden in ihm die hohen Tufflager abgebaut, deren stehenbleibende Reste in wunderlichen Formen, bald wie verwitterte Mauern oder düstere Klüfte, bald wie die engen Wohnungen eines seltsamen Troglodytengeschlechtes die Gehänge des Tales zieren. Da tönt tagaus, tagein das Sprengen der Gesteinsmassen, das Rollen der herabfahrenden Fuhrwerke und das Stampfen und Poltern der Mühlen, in denen der Tuff zu Traß gemahlen und dann als geschätzter wasserdichter Mörtel, namentlich nach Holland versandt wird. An anderer Stelle, fern von solchem Geräusche, liegen bescheidene Kurorte bei bewährten, kräftigen Heilquellen, deren Kohlensäuregehalt zum Teil so beträchtlich ist, daß bei Burgbrohl mehrere Gesellschaften das entströmende Gas zu flüssiger Kohlensäure verdichten und in jeder bestellten Menge in gußeisernen Zylindern zum Abzapfen des Bieres oder zu chemischer Verwendung in Versand bringen.
Bald wird auch durch dieses Tal eine Schmalspurbahn ins Innere des Gebirges dringen und außer den reichhaltigen vulkanischen Erzeugnissen des Brohltales selbst, auch die der inneren Eifel, namentlich der prächtigen Tuffsteine von Weibern, zum Rheine herab nach Brohl befördern helfen und den Wanderer in kurzer Zeit in jene hochgelegenen Gebiete führen, wo die turmgekrönte herrliche Olbrück, der Gänsehals und der Perlkopf als Hochwächter aufragen und von ihrer Höhe einen Ausblick vom Rheintale und Westerwald bis tief ins Innere der Eifel gewähren.
So sehen wir allerorts in dieser Landschaft jetzt einen lebhaften Verkehr, und einen regen Betrieb die Erzeugnisse des alten Vulkanismus verwerten. Wohl das interessanteste Schaffen aber spielt sich im Innern des großen Lavastromes ab, der, wahrscheinlich vom Forste ausgeflossen, in einer Mächtigkeit von 12 bis 15 m und hoch überlagert von Asche und Bimstein, unter dem Orte Mendig liegt. In ihm brachen schon die Römer, und noch heute liefert er die berühmten Mühlsteine, welche weit in alle Welt hinaus versandt werden und den Ruf von Niedermendig ebenso weit verbreitet haben. Enge Gänge mit schmalen Stufen führen hinab. Unten starrt das Auge im Halbdunkel durch weite, hohe Gewölbe, getragen durch einzelne stehengebliebene Riesensäulen. Weiter und weiter werden die Blöcke der glasigen, porösen Nephelinlava in diesen Kellern ausgebrochen, mit mächtigen Göpeln durch brunnenförmige Schachte heraufbefördert und die besten oben zu Mühlsteinen ausgehauen. In den ausgebeuteten unterirdischen Räumen aber hat sich eine neue Industrie angesiedelt. Hier, wo die Kälte bei der Verdunstung des Wassers im porösen Gestein so stark ist, daß selbst noch im späten Frühling Riesenzapfen von Eis vom Boden emporstarren und den Stalaktiten der Decke entgegenwachsen, hier lagert nun das Bier aus mancher Brauerei des Landes und erlangt seine Kälte und erquickende Frische im Schoße eines Gesteins, das einst glühend und feuerflüssig aus dem Innern der Erde drang. Freilich ist auch hier manches anders geworden. Seit vereinzelt Kühlschiffe und Gärungsbottiche hier unten stehen, hat sich die Kälte bedeutend vermindert und das Gestein vielfach mit einer schleimigen Alge überzogen, welche die kälteerzeugende Verdunstung hemmt. Für all diese Erzeugnisse der Industrie und des Bergbaues bildet das mächtig aufblühende Andernach am Nordrande des Neuwieder Beckens mit seinen herrlichen Baudenkmälern jetzt den Hauptstapel- und Verladeplatz.
Ähnliche Verhältnisse, wie die Vulkangruppe des Laacher Sees besitzt die lang ausgedehnte vulkanische Kette, welche im Innern des Gebirges vom Goldberg am Fuß der Schneifel sich bis zum Badeorte Bertrich hinzieht. Aber die abgeschlossene Lage dieses Gebirgszuges, seine größere Entfernung von dem Rheinstrom und der Mosel und das Zurücktreten des Pflanzenwuchses bei der durchweg hohen Lage dieses Gebietes haben dessen ursprüngliche Natur weniger verändert, die gewaltigen Spuren seiner Vulkane kaum verwischt. Hier finden wir noch Orte, an denen man glauben möchte, daß die verheerenden Ausbrüche erst seit kurzem aufgehört hätten und daß eine neue Eruption noch immer vor unsern Augen erfolgen könnte.
Überraschend ist der Anblick dieses Gebirgszuges von der Höhe der Schneifel aus, doppelt, wenn man vorher die öden, eintönigen Landschaften im Hohen Venn und in der nördlichen Eifel durchwandert hat. Aber auch derjenige, welcher auf der Köln-Trierer Bahn den Kalkrücken von Blankenheim überschritten hat, wird auf das angenehmste von diesen wechselvollen Bergformen berührt, zu denen das romantische Tal der Kyll den wirksamsten Vordergrund bildet. Das Erstaunen wächst, wenn man erst zwischen die alten Feuerberge hineingelangt ist. Da watet der Fuß noch stellenweise durch tiefe vulkanische Asche, die im Sonnenschein von unzähligen winzigen Kristallen glitzert und flimmert; da liegen auf den alten Kraterwällen unbedeckt noch immer die großen und kleinen Bomben, welche einst sausend aus dem tiefen Schlunde emporgeschleudert wurden. Im Innern sind's Brocken von Olivin oder einem anderen Gestein, die sich dann beim Auffliegen durch die im Krater brodelnde Lava mit einer Schlackenhülle umgaben. Diese noch weiche und glühende Masse erhielt später bei ihrer rollenden Bewegung in hoher Luft die runde oder kugelähnliche Gestalt, welche sie nun so leicht erkennbar macht. Da die großen Bimsteinüberschüttungen, welche die Gegend des Laacher Sees kennzeichnen, hier nirgendwo stattgefunden haben, so deckt oft nur eine dünne Schicht Dammerde die Oberfläche dieser Ströme, und ihre höheren Blöcke ragen flechtenbedeckt darüber hervor. Der ganze Ort Dockweiler an der Landstraße von Gerolstein nach Daun liegt auf einem solchen Strome. Seine rauhe Oberfläche bildet vielfach ein natürliches Pflaster zwischen den Häusern. Lavablöcke dienen als Einfriedigung für die kleinen Gärtchen des Ortes, und oberhalb desselben steht der Rand des Stromes als hohe Felswand an, zu deren Fuß die ehemals in zähflüssigem Zustande herabgefallenen Brocken der Lava noch heute als mächtige, von Buchen umklammerte Felsblöcke liegen. Mitten im Dorfe aber, aus der Tiefe des alten Gesteinsstromes, quillt nun stark und klar eine prächtige Quelle.
Wohl am großartigsten und mannigfaltigsten zeigen sich die Reste des alten Vulkanismus am Mosenberge bei Manderscheid, einem echten kleinen Eifel-Vesuv, dessen hoch über ein wellenförmiges Plateau aufgetürmte, mehrgipfelige Masse schon in meilenweiter Ferne als auffallende Erscheinung den Blick auf sich zieht. Nach Westen erhebt sich der Berg sanft ansteigend über ein fruchtbares Ackerland, nach Osten aber steht er majestätisch auf Bergstufen, die in steilem Sturze zu einem tiefen Felstale abfallen. Dorthin senkt sich auch der gewaltige Lavastrom des Berges, der an seinem Fuße hervorbrach. Den eigentlichen Vulkan bilden lose aufgeschüttete Schlackenblöcke, und auf seinem kahlen Gipfel, wo wir das weite innere Eifelgebiet überschauen, starren zwei mächtige, alte Krater mit steilen, oft überhängenden Randwällen. Der eine ist durchbrochen wie ein Tal, in dem anderen Krater aber liegt ein kleiner See, so still und schwarz, als sei er selbst noch die flüssige Masse, welche einst diesen Schlund erfüllte und dann verheerend in Rauch- und Flammensäulen zur Höhe stieg.
Das schönste in diesem Gebiete aber sind die zahlreichen Maare, größere oder kleinere rundliche Seen, welche die Tiefe alter Durchbruchskrater füllen. Wechselvolle Szenerien umgeben diese kleinen Becken. Aus dem Pulvermaar bei Gillenfeld schaut ein blauer Spiegel durch Waldesgrün, am Meerfelder Maar umgeben Wiesen und Äcker das Ufer, und am See von Ulmen steht einsam die alte Ruine. Drei solcher Maare besitzt in geringem Umkreis auch der merkwürdige Mäuseberg bei Daun: das eine, das Gemündener Maar, tief und lauschig versteckt im grünen Waldkranze, das andere, ein Bild der Fruchtbarkeit, mit dem Orte Schalkenmehren am wohlangebauten Ufer, und zwischen ihnen ein drittes einsam in schauerlicher Felseinöde, die in steilen Ringwällen nackt und unfruchtbar zum Wasserspiegel sich senkt. Dies ist das Weinfelder Maar. Etliche kümmerliche Äcker auf trockner vulkanischer Asche und eine graue Kapelle mit dem Kirchhofe sind das einzige, was in seinem Bereiche liegt. Kein Strauch steht an seinem Ufer, kein Nachen wiegt sich auf seiner tiefen Flut. Ja, nur die Frage nach einem solchen wird vielfach von den Umwohnenden schon als eine Vermessenheit betrachtet, welche zu sehr die geheimnisvolle Scheu durchbricht, die der See auf jeden Unerfahrenen ausübt. Ab und zu aber bringen muntere Vogelgeschlechter selbst bis in diese Einöde Geräusch und Leben. Schwärme von wilden Enten fliegen herbei und fallen mit lautem Schlage auf den ruhigen Spiegel des Sees, der nun in langen Wellenkreisen erzittert, Fische schnellen über seine blaue Fläche, oder ein Fischreiher zieht stolzen Fluges darüber hin.
Verlassen wir diese Hochfläche der Vordereifel mit ihren Vulkanen und Maaren und wenden uns nach Süden, so nehmen uns bald wechselvolle Täler auf, deren Bäche mit starkem Gefälle zur Mosel eilen. Hier rauscht die Prüm durch einsame Wald- und Felsgebiete, die Kyll durch die hohen Felspartien des Buntsandsteins, der Üßbach durch das warme Tal von Bertrich, in dem die heißen Quellen sprudeln und eine fast südländische Pflanzenwelt die Berge schmückt. Den Glanzpunkt in diesem ganzen Gebiete aber bildet das Liesertal bei Manderscheid. Wer nach der langen ermüdenden Wanderung von Daun und Gillenfeld her hier zum erstenmal von der Höhe des Belvedere aus unvorhergesehen in den zu Füßen gähnenden Talgrund schaut, die beiden zerfallenen Burgen sieht, die auf trotzigen Felsen einsam aus der düstern Tiefe ragen, und darüber das friedliche Örtchen dicht am steilen Abgrund erblickt, während noch grelles Sonnenlicht über alle Gipfel strahlt, aber aus der tiefen Schlucht schon blaue Schatten steigen, wer dann den mächtigen Mosenberg in erhabener Ruhe mit seinen Lavafeldern und Kratergipfeln hinaufragen sieht, die rötlich im letzten Sonnenstrahl leuchten, der muß gestehen, daß dieses Bild nicht den Vergleich mit den schönsten Partien der Alpentäler zu scheuen braucht, und er wird gern den Worten des großen Geologen Leopold v. Buch beistimmen: »Die Eifel hat ihresgleichen nicht in der Welt.«
Aus: Karl Kollbach, Rheinisches Wanderbuch. Bonn, Emil Strauß.
Von Sandkuhl, Königl. Polizei-Assessor in Köln.
»Der Dom zu Köln, das bitt' ich von Gott,
rage über diese Stadt, rage über Deutschland,
über Zeiten, reich an Menschenfrieden, reich
an Gottesfrieden, bis an das Ende der Tage!«
Was der große Meister Gerhard von Rile in den Tagen der Hohenstaufen kühn erdacht und mutig begonnen, was für Religion und Vaterland begeisterte Dichter in ihren seligsten Stunden geträumt und alle Kölner, ja alle Deutsche heiß ersehnt und erharrt, was zwanzig Menschengeschlechter erhofft: das steht jetzt endlich, nach jahrhundertelangem Stillstand zum Staunen der Welt als das erhabenste Werk deutscher Einigkeit da, von einem der kunstsinnigsten und hochherzigsten Könige Preußens mächtig gefördert, vom deutschen Kaiser Wilhelm I. und dem ganzen deutschen Volke vollendet zur Ehre Gottes, zum Ruhm der deutschen Kunst, zum Preis deutscher Ausdauer und Kraft!
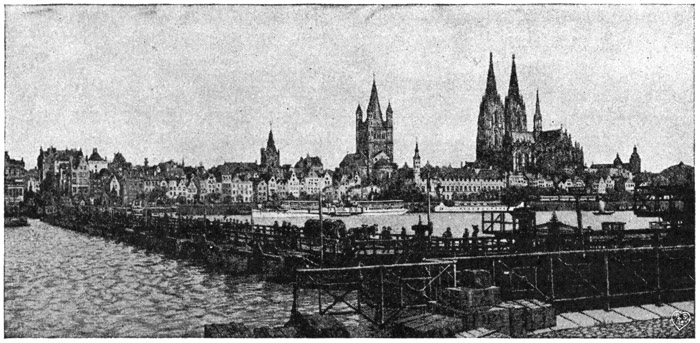
Köln. Nach der Radierung von Hans Wildermann.
Verlag von Eisner & Spieckermann, Köln.
Am 14. – oder nach neueren Forschungen am 15. – August, dem Tage des Festes Maria Himmelfahrt, im Jahre 1248 legte Konrad v. Hochstaden, der Salomo seiner Zeit, wie ihn die Chronisten nennen, den Grundstein zum Dome, im Jahre 1297 konnte bereits in den Chorkapellen Gottesdienst abgehalten werden, und am 27. September 1322 war der Chor selbst vollendet. Es wurde dann bis zu Ende des 15. Jahrhunderts an dem Dome noch weiter gebaut, nebst dem Chor ward nur das Langhaus ohne Kreuzflügel mit Nebenschiffen, von denen das nördliche bloß eingewölbt, bis zur Kapitälhöhe der Säulen ausgeführt. Gleichsam als ein für sich bestehender Bau ward von den Türmen der südliche bis zur Höhe von 50 m (1447 hatte man darin die alten Domglocken aufgehangen) und der nördliche etwa 6 m hoch fertiggestellt. Mit dem Beginne der Reformation stockte der Bau gänzlich, man versah ihn mit vorläufigen Dächern, deren höchst mangelhafte Beschaffenheit indes später nur den Verfall beschleunigte; im 16. und 17. Jahrhundert errichtete man im Innern zwar verschiedene Denkmäler, sonst aber geschah, wie auch im 18., nichts für den Dom, und das Palladium deutscher Kunst ging mehr und mehr seiner Vernichtung entgegen. Nur das Allernotdürftigste geschah zu seiner Unterhaltung, allerlei Behausungen wurden rings um die majestätische Ruine aufgeführt oder gleich Schwalbennestern an sie angeklebt; schon waren die Kirchenstürmer der ersten französischen Revolution mit dem Plane umgegangen, den Bau ganz niederzureißen, und später machte der französische Bischof Bertholet den Vorschlag, ihn wenigstens von der Ost- und Südseite dicht mit Pappeln zu umpflanzen, um die geschmacklose gotische Ruine (ruine gotique) den Blicken zu entziehen. Und um die Schändung vollständig zu machen, wurde 1796 nach der Besetzung Kölns durch die Franzosen das erhabene Bauwerk sogar zu einem Fouragemagazin eingerichtet und der Gottesdienst im Dome eingestellt! Wer war es denn nun, der zuerst die Augen der Mitlebenden wieder auf den Dom lenkte, um sie für dessen Wert und erhabene Schönheit zu öffnen?
Georg Forster war es, der berühmte Weltreisende, der geistvolle Schriftsteller. Ihm gebührt der Ruhm, als der erste in der Reihe der begeisterten Domfreunde zu stehen, deren Wirken es zu danken ist, daß die Deutschen wieder begreifen lernten, welch hehres Denkmal der Kölner Dom sei, und daß der kühne Gedanke einer Wiederherstellung und Vollendung in den Gemütern Platz greifen konnte.
Mit Recht sagt Fr. Blömer in seiner Schrift: »Zur Literatur des Kölner Domes«: Forster wurde für den Kölner Dom der Morgenstern, der nach langer trüber Nacht den wieder anbrechenden Tag verkündigte und bei dessen reinem Lichte die vielen Irrenden und die wenigen unsicher Strebenden die verschüttete Bahn der besseren Erkenntnis und des geläuterten Geschmackes wieder fanden; er wurde für Kölns Dom der Johannes in der Wüste, dessen erschütterndes Wort die nahe Erlösung anzeigte.
In den Frühlingsmonaten des Jahres 1790 kamen zu Schiff von Bingen her zwei junge Männer nach dem heiligen Köln. Jene beiden waren Alexander v. Humboldt und Georg Forster. »Wir gingen in den Dom,« schreibt Georg Forster, »und blieben darin, bis wir im tiefen Dunkel nichts mehr unterscheiden konnten. Vor der Kühnheit der Meisterwerke stürzt der Geist voll Erstaunen und Bewunderung zur Erde; dann hebt er sich wieder mit stolzem Flug über das Vollbringen hinweg, das nur eine Idee eines verwandten Geistes war.
Die Pracht des himmelan sich wölbenden Chors hat eine majestätische Einfalt, die alle Vorstellung übertrifft. In ungeheurer Länge stehen die Gruppen schlanker Säulen, wie die Bäume eines uralten Forstes; nur am höchsten Gipfel sind sie in eine Krone von Ästen gespalten, die sich mit ihren Nachbarn in spitzen Bogen wölbt, und dem Auge, das ihnen folgen will, fast unerreichbar ist. Läßt sich auch schon das Unermeßliche des Weltalls nicht im beschränkten Raume versinnlichen, so liegt gleichwohl in diesem kühnen Emporstreben der Pfeiler und Mauern das Unaufhaltsame, das die Einbildungskraft so leicht in das Grenzenlose verlängert. Die griechische Baukunst ist unstreitig der Inbegriff des Vollendeten, Übereinstimmenden, Beziehungsvollen, Erlesenen, mit einem Worte des Schönen. Hier indessen an den gotischen Säulen, die, einzeln genommen, wie Rohrhalme schwanken würden und nur in großer Anzahl, zu einem Schafte vereinigt, Masse machen und ihren geraden Wuchs behalten können, unter ihren Bogen, die gleichsam auf nichts ruhen, luftig schweben wie die schattenreichen Wipfelgewölbe des Waldes: hier schwelgt der Sinn im Übermut des künstlerischen Beginnens. Jene griechischen Gestalten scheinen sich an alles anzuschließen, was da ist, an alles, was menschlich ist; diese stehen wie Erscheinungen aus einer anderen Welt, wie Feenpaläste da, um Zeugnis zu geben von der schöpferischen Kraft im Menschen, die einen aus der Verbindung gelösten Gedanken bis aufs äußerste zu verfolgen und das Erhabene selbst auf einem überschwänglichen Wege zu erreichen weiß. Es ist sehr zu bedauern, daß ein so prächtiges Gebäude unvollendet bleiben muß. Wenn schon der Entwurf, in Gedanken ergänzt, so mächtig erschüttern kann, wie hätte nicht die Wirklichkeit uns hingerissen!
Ich erzähle dir nichts von den heiligen drei Königen und dem sogenannten Schatz in der Kapelle, nichts von den Hautelissetapeten und der Glasmalerei auf den Fenstern im Chor, nichts von der unsäglich reichen Kiste von Gold und Silber, worin die Gebeine des heiligen Engelbert ruhen, und ihrer wunderschönen ziselierten Arbeit, die man heutigentags schwerlich nachzuahmen imstande wäre. Meine Aufmerksamkeit hatte einen wichtigeren Gegenstand: einen Mann von der beweglichsten Phantasie und vom zartesten Sinne, der zum ersten Male in diesen Kreuzgängen den Eindruck des Großen in der gotischen Bauart empfand und bei dem Anblick des mehr als 30 m hohen Chores vor Entzücken wie versteinert war. O, es war köstlich, in diesem klaren Anschauen die Größe des Tempels noch einmal, gleichsam im Widerschein, zu erblicken! Gegen das Ende unseres Aufenthaltes weckte die Dunkelheit in den leeren, einsamen, von unseren Tritten widerhallenden Gewölben, zwischen den Gräbern der Kurfürsten, Bischöfe und Ritter, die da in Stein gehauen liegen, manches schaurige Bild der Vorzeit in der Seele.«
Wir haben diese Schilderung in ihrer ganzen Ausführlichkeit hier wiedergegeben, weil sie die erste volle Würdigung des wundersamen Bauwerks in der Literatur bildet, und weil es uns nur gerecht erschien, in diesem Augenblicke an das Verdienst Forsters zu erinnern, – des Mannes, dessen Irrtümer später manchen unbarmherzigen und sich sehr erhaben dünkenden Kritikern den willkommenen Vorwand boten, sein Andenken in den Staub zu treten, ohne an die schönen und edlen Seiten seines Charakters zu erinnern.
Was Forster begonnen, das setzten später Männer wie Friedrich Schlegel, Goethe, Görres und namentlich die Gebrüder Boisserée fort, die teils durch Wort und Schrift, teils durch Zeichnungen, teils durch Sammlungen der Erhaltung der Monumente förderlich waren. Zumal der ältere des Bruderpaares, Sulpiz Boisserée (geb. am 3. August 1783 zu Köln), machte es sich zur wahren Lebensaufgabe, wie er zuerst das so herrlich begonnene Denkmal deutscher Größe wenigstens im Bilde begonnen hatte, es nun auch in der Wirklichkeit ausgeführt zu sehen. Unablässig blieb er bemüht, dies kühne Unternehmen zu fördern, dem Dombau neue Gönner und Freunde zu werben, und ihm verdanken wir es in erster Linie, wenn wir die Feier der Vollendung des Kölner Domes, mit dem sein Name für alle Zeiten eng verknüpft sein wird, begehen konnten.
Nachdem S. Boisserée den »Alten in Weimar« ganz für seine großen Bestrebungen gewonnen, machte Goethe in den Jahren 1814 und 1815 eigens zu Kunstzwecken wiederholte Reisen an den Rhein, die, wie er sich in den Tag- und Jahresheften ausdrückt, seine Begriffe von der älteren deutschen Baukunst immer mehr und mehr erweiterten und reinigten, und die ihm die gewaltigen Eindrücke der großen Gemäldesammlungen Wallrafs und der Gebrüder Boisserée brachten. In der neu gegründeten Zeitschrift »Kunst und Altertum« erstattete Goethe von diesen Eindrücken öffentlich Bericht.
War diese Gewinnung Goethes ein großes Glück für die Boisseréeschen Bestrebungen, so fehlte es auch sonst nicht an glücklichen Umständen, welche diesen zugute kamen. Durch eine im 12. Hefte von Willemius monuments inédits erschienene Zeichnung des Mittelfensters aus dem Kölner Dome aufmerksam gemacht, veranlaßte Boisserée Nachforschungen, deren Ergebnis die Auffindung eines Originalrisses des Domes in Paris ergab; noch viel wunderbarer aber war die fast gleichzeitig erfolgte Auffindung der sogenannten Darmstädter Risse des Kölner Domes, welche dann vom Oberbaurat Moller herausgegeben wurden. Der Riß befand sich ursprünglich im Archiv des Domes, wie es hieß, in einer silbernen Kapsel. In den Wirren des Revolutionskrieges entführt, kam er auf der Rückkehr nach dem Luneviller Frieden, welcher das linke Rheinufer an Frankreich fallen ließ, nach Darmstadt und wurde hier von den Kommissarien der Fürsten den Partikularen vom Kurfürstentum Köln zugeteilt. Die französischen Kommissarien hätten den Riß als zum linken Rheinufer gehörig nehmen müssen, ließen ihn aber unter anderem Wust zurück, und so gelangte die kostbare Zeichnung endlich nach Kassel auf den Speicher des Gasthauses zur »Traube«. Hier nagelte sie der Hausknecht auf einen Rahmen, worauf sie 12 Jahre lang, bis zum Oktober 1814, dazu diente, um Bohnen zu trocknen. Bei einem Ball, welchen damals die Landwehr der freiwilligen Jäger gab, sollte der Maler Seekatz ein Transparent malen, entdeckte bei dieser Gelegenheit den Riß, ohne zu wissen, was er vorstellte, und gab ihn an Moller, der nun sofort den kostbaren Schatz erkannte und im Interesse der Kunst verwertete.
Vorgreifend sei hier gleich bemerkt, daß die ersten Blätter des großen Boisseréeschen Werkes 1822 erschienen, als die beiden Brüder bereits einige Zeit in Stuttgart wohnten. Die ganze Sammlung, aus 18 Blättern im größten Atlasformat bestehend, wurde 1831 vollendet, und 1842 veranstaltete Sulpiz eine kleinere Ausgabe in Royalfolio.
So war denn nun die Wiederherstellung des hehren Bauwerkes auf dem Papier und im Bilde vollendet, Sulpiz ermüdete aber nicht, mit einem wahren Feuereifer auch auf die Ausbesserung und – vorläufig wenigstens – die Erhaltung des wirklichen Bauwerkes, das, wie schon berichtet, als eine wahrhaft traurige Ruine dastand, zu dringen.
Napoleon hatte sich bei seinem Besuche von 1811 – glücklicherweise, können wir heute sagen! – geweigert, auf Boisserées Vorschläge zur Ausbesserung und Unterhaltung des Domes mittels eines jährlichen Zuschusses von 40 000 Franken einzugehen. Höchst folgenreich dagegen war der Besuch, den der damalige preußische Kronprinz Friedrich Wilhelm am 16. Juli 1814 mit Gneisenau, Knesebeck und Ancillon dem Dom abstattete, bei welcher Gelegenheit Sulpiz in dem kunstsinnigen Prinzen eine wahre Begeisterung für den Bau zu erwecken wußte, die dieser später als Friedrich Wilhelm IV. so erfolgreich betätigen sollte, daß er es vor allem ist, dem wir heute die Vollendung des Bauwerkes verdanken. Dieser Besuch bildete den Wendepunkt in der Geschichte des Domes. Dem Kronprinzen und dem Einflusse Schinkels, dessen Gutachten vom 3. September 1816 sich für die Erhaltung des Domes aussprach, gelang es, die Mittel flüssig zu machen, durch die zunächst wenigstens dem ferneren Verfalle des Bauwerkes vorgebeugt werden konnte. Die ersten Wiederherstellungsbauten begannen nach 1816, wurden dann aber seit 1821 reger betrieben, als Friedrich Wilhelm III. für dieselben eine jährliche Summe auswarf. Der Chorbau erhielt ein neues Dach, die Strebebögen und die wichtigsten dekorativen Teile des Chores wurden wieder hergestellt oder neu ausgeführt. Bis zum Jahre 1833 leitete Bauinspektor Ahlert (Ahlerti) diese Wiederherstellungsarbeiten. Erst 1834 erstand die Dombauhütte unter Zwirners Leitung in fester Gestalt. Zwirners Pläne und die bald großartigen Leistungen der Hütte trugen die Kunde vom Kölner Dome in weite Ferne, steigerten die Begeisterung des Volkes und vor allem des Protektors, nunmehrigen Königs Friedrich Wilhelm IV. Am 16. Februar 1842 nämlich trat der Zentral-Dombauverein ins Leben; die Männer, welche den ersten Vorstand bildeten, waren E. v. Groote, Dr. Ernst Weyden, J. M. Farina, Lenhardt, Roishausen, H. v. Wittgenstein; sie erkoren sich zum Wahlspruche: Eintracht und Ausdauer! König Friedrich Wilhelm IV., der begeisterte Dombaufreund, übernahm bereitwilligst das Protektorat des neuen Vereins und sagte dem Baue eine jährliche Summe von 50 000 Talern unter der Voraussetzung zu, daß der Dombauverein eine gleiche Summe jährlich aufbringe. Am 24. September 1842 wurde dann vom Könige selbst in feierlichster Weise am Südportale des Kreuzflügels der Grundstein zum Weiterbaue gelegt. Friedrich Wilhelm sprach die Worte:
»Hier, wo der Grundstein liegt, dort mit jenen Türmen zugleich, sollen sich die schönsten Tore der Welt erheben. Deutschland baut sie, mögen sie für Deutschland durch die Gnade Gottes Tore einer neuen, großen, guten Zeit werden.« …
Es kann nicht unsere Aufgabe sein, die Weiterführung des Werkes hier mit allen ihren Einzelheiten zu schildern. Am 27. und 28. Mai 1845 erfolgte das erste Dombaufest, im Jahre 1848 beging der Dom die 600jährige Feier der ersten Grundsteinlegung: die Seitenmauern des Langhauses bis zum Sims über dem Laufgange waren inzwischen vollendet und, wie auch die Kreuzflügel, mit einem Notdache ausgerüstet worden. Das südliche Nebenschiff, in dem die von König Ludwig I. von Bayern geschenkten neuen Glasfenster prangten, hatte Gewölbe erhalten. Die Feier fand am 13., 14. und 15. August statt, in Gegenwart Friedrich Wilhelms IV., des Erzherzogs Johann von Österreich, des damaligen Reichsverwesers, und vieler Fürsten und Bischöfe.
Mit den politischen Stürmen jenes Jahres minderte sich natürlich die Teilnahme am Dombauwerke, die Beiträge flossen spärlicher, und zu Ende des Jahres hätte der Bau wegen Mangels an Geldmitteln völlig eingestellt werden müssen, hätte nicht der damalige Regierungspräsident v. Moller aus eigener Verantwortlichkeit 12 000 Taler dafür angewiesen. Damit kam man über die schlimmste Zeit hinweg. Am 3. Oktober 1855 wurde die letzte Kreuzblume des Südportals in Gegenwart Friedrich Wilhelms IV. aufgesetzt; am 6. Dezember geschah dasselbe am Nordportale, und am 15. Oktober 1863 konnte man die Vollendung der Schiffe mit Einschluß des Dachreiters festlich begehen.
Seit Zwirners Tode hatte der Dombaumeister Voigtel, der schon 1855 bei dem Dombau eingetreten war, im Geiste des Dahingeschiedenen den Bau weiter geleitet; er hat den Dom fertiggestellt und namentlich durch die Vollendung der Turmriesen eine wohl kaum je dagewesene Aufgabe in vollkommenster Weise gelöst und sich selbst ein Ruhmesdenkmal geschaffen.
Bereits im Jahre 1861 hatte König Wilhelm, der nachmalige erste deutsche Kaiser, das Protektorat des Dombauvereins übernommen. Von ihm wurde 1863 der Plan einer jährlich zu veranstaltenden Dombau-Prämien-Lotterie genehmigt, welche von nun an in erster Linie reichliche Mittel zur Beendigung des Riesenwerkes, namentlich zum Ausbau der Türme gewährte. Tatsache ist es, daß mit Hilfe dieser Lotterie der Dom fertiggestellt worden ist.
Am 14. August 1880 wurde der letzten Kreuzblume des Domes der letzte Stein eingefügt, und der ehrwürdigen Colonia leuchtendste Krone, der Wunderbau war vollendet, der an Maria Himmelfahrtstage des Jahres 1248 begonnen worden. Zwei mächtige Fahnen, die preußische und die deutsche, entfalteten sich auf der Höhe der Riesentürme, und mit Fahnen schmückten sich die Häuser der freudig erregten Stadt.
Und wie der Riesenbau in seinem prachtvollen architektonischen Äußeren, so erhaben und wundervoll ist sein Inneres, und es gibt keine Kathedrale, die in ihrem Innern einen solchen Schatz, eine solche Mannigfaltigkeit bietet, wie der Kölner Dom. Neben den kunstvollen, himmelanstrebenden Säulen, Portalen und Gewölben, neben den zahllosen, von Künstlerhand errichteten Figuren ist es vor allem die Glasmalerei, die das Interesse aller, der Kunstkenner wie der Laien, erregt. An die älteren Glasmalereien bis 1600 reihen sich die neueren des neunzehnten Jahrhunderts an, unter denen die von dem Könige Ludwig I. von Bayern geschenkten in erster Linie prangen. Nicht minder muß auf die zahlreichen, oft einzig dastehenden Grabdenkmäler in den Kapellen, auf die herrlichen Chorstühle des 14. Jahrhunderts, sowie auf die Proben der Kölner Maler- und Bildhauerschule, nämlich die Altäre der Malermeister Wilhelm von Köln und Stephan Lochner hingewiesen werden. Mit Recht wurde daher der Gedanke laut, ein Fest, ein Jubelfest müsse gefeiert werden zu Ehren der Vollendung des hehrsten Gotteshauses, des nationalsten Werkes im erstandenen Deutschen Reiche, und dieser Gedanke erfüllte und entflammte die patriotischen Herzen aller Deutschen, die Freunde des Domes und des Reiches waren.
Es wurde daher auf das dankbarste begrüßt, als Se. Majestät der Kaiser Wilhelm I. den als Geburtstag Seines Hochseligen Bruders für den Dom bedeutungsvollen 15. Oktober 1880 zum ersten Tage der Feier bestimmte und sein Erscheinen, sowie das des Kaiserlichen Hauses und hoher Gäste in Aussicht stellte.
Viele Kölner aber beschlossen, den zweiten Tag neben den von der Stadt beabsichtigten Festlichkeiten der Verherrlichung des ersten Domprotektors und aller um den Dom verdienten Männer zu weihen, und sie glaubten dieses nicht besser tun zu können, als durch einen historischen Festzug. Diese Idee fand in einer Volksversammlung lebhaften Anklang, und es ging aus dieser ein Festausschuß hervor, in den die Stadtverordnetenversammlung und der Zentral-Dombauverein außerdem je 6 Mitglieder entsandten. Das durch die Spitzen der Behörden, Künstler und Schriftsteller verstärkte Komitee erließ einen Aufruf an die Bürgerschaft, der in den Worten gipfelte:
»Der Jubel über die Vollendung der hehren Gottesburg unserer Väter und das Erscheinen des geliebten Heldenkaisers in der Domstadt muß ein Fest hervorrufen, würdig des großen Werkes, würdig des hohen Herrn und dieser Stadt. Wie aber können wir schöner zur Feier beitragen, als durch eine glänzende Darstellung der drei großen Perioden der Bauzeit des erhabenen Gotteshauses? Ein historischer Festzug soll der Ausdruck des Dankes sein, den wir unserem Kaiser schulden!« …
Der historische Festzug, der ein halbes Jahrtausend Kölner und deutscher Geschichte in wenigen Stunden vorüberführte, gelang vortrefflich. Nicht minder die Vorfeier.
Majestätisch und feierlich zog am Vorabende des Festes das Geläute sämtlicher Glocken der Stadt in harmonischen Wellen über das Häusermeer der alten Colonia hin, weit über deren Weichbild hinaus verkündend, daß am kommenden Morgen des Domes höchster Ehrentag erscheinen werde. Wie von einem magischen Lichtglanze umflossen, stand der steinerne Riese in seiner stolzen Majestät da, übergossen von dem Lichte der elektrischen Beleuchtung. Rundum in der Nähe und Ferne schafften tausend fleißige Hände, um Kölns Festgewand den letzten Schmuck zu geben, um dem Ehrenkranze, der Colonias Haupt umwinden sollte, die letzten grünen Zweige, die letzten Blumen und farbigen Blätter einzuflechten.
Am Frühmorgen des Festes (15. Oktober), nachdem das Kaiserpaar und die geladenen hohen fürstlichen Gäste unter unbeschreiblichem Jubel der dicht gedrängten, die Straßen füllenden Menschenmenge im Regierungspalais eingetroffen, bewegten sich dort zunächst im stattlichen Zuge die Dombauhütten- und Dombaumitglieder vorüber: Zuerst ein Trompeterkorps, dann die Dombauhütte, ein prachtvoller Vorbeimarsch kräftiger Männergestalten in feiertäglichem Gewande, mit wallenden weißen, braunen und schwarzen Schurzfellen unter dem Rock, die blitzenden Werkzeuge, mit Schleifen in den Landesfarben geziert, stolz in den von treuer, ehrlicher Arbeit schwieligen Händen haltend. Das Domvereins-Banner, von 20 Ältesten geleitet, folgte, hierauf der Dombauvorstand, das Stadtbanner, Bürgermeister und Stadtverordnete Kölns. Nach einem zweiten Musikkorps erschienen die Dombauvereinsgenossen, ein nicht enden wollender dicht gescharter Zug. Wiederum folgte eine Musikkapelle; dann erschien, von den Lehrern geleitet, der Kinder-Sängerchor, eine überaus liebliche Schar, die Mädchen in weißen Kleidern, mit bunten Schleifen und blauen Kornblumsträußchen, das Haar in Locken; die Knaben im Festanzuge mit Sträußchen im Knopfloch. Ihnen schloß der Kölner Männergesangverein mit seinem Vereinsbanner sich an; dann folgten mit ihren samt- und seidengestickten Fahnen die Abordnungen des ersten geselligen Dombauvereins, des Männergesangvereins Ossian, die Maurer-, Zimmer-, Steinmetzmeister-Innung, die Kölner Baugewerke, die Kölner Liederkränze, Kölner Turnvereine, die Kölner Kriegervereine, Fabrik-, Schützen- und kameradschaftliche Bürgervereine, die Brüderschaften mit ihren Bannern, und zum Schluß abermals ein Musikkorps. Es folgte nun die festliche Auffahrt der Allerhöchsten Herrschaften zur Trinitatiskirche, woselbst ein kurzer Dankgottesdienst stattfand, sodann die mit wahrhaft kaiserlichem Pompe statthabende Auffahrt zum Dome. Straßen und Dächer waren Kopf an Kopf besetzt von Menschen. Vom Domkapitel am Eingange des Domes empfangen, begab sich der Kaiser nach dem feierlichen Te Deum, gefolgt von den Fürsten und Prinzen des Reiches und den Vertretern der freien Städte, durch das Südportal auf den Domhof, wo der Kaiserpavillon aufgeschlagen war und große Festtribünen die Gäste von nah und fern aufgenommen hatten. Tausend und aber tausend Stimmen der die Tribünen und alle Räume des Festplatzes, die umliegenden Gebäude und Dächer bis in weiteste Entfernungen hin besetzenden Festteilnehmer jubelten dem Kaiserpaare entgegen, während auf den Stufen des Südportals selbst eine Abteilung der Schuljugend aufgepflanzt stand, die das Lied der Vollendung des Domes anstimmte. Sichtbar erfreut von diesem überraschenden Anblicke, schritten die Majestäten nun durch die Schuljugend und die Spalier bildenden Werkleute der Dombauhütte über die ganze Länge des Platzes dem Kaiserpavillon zu, wo sie mit hohem Gefolge Platz nahmen.
Nachdem der Gesang der Schuljugend verklungen war, richtete der Dombaumeister Voigtel an den Kaiser einige Begrüßungsworte und verlas dann die Urkunde, die in die Kreuzblume eingesenkt werden sollte, und also lautet:
»Urkunde.
Der Dom zu Köln, das ehrwürdigste Denkmal deutscher Baukunst, auf dem Boden der alten Colonia Agrippina, an jener Stelle, wo Karls des Großen Erzkaplan Hildebold die dem Apostelfürsten Petrus geweihte Kirche errichtete, von Erzbischof Konrad von Hochstaden am 15. August 1248 in Gegenwart König Wilhelms von Holland gegründet und von Meister Gerhard von Rile begonnen, wurde, in seinem Chorbau vollendet, 1322 durch Erzbischof Heinrich von Virneburg geweiht. Nach feierlicher Übertragung der von Kaiser Friedrich I. dem Erzbischof Reinald von Dassel 1162 geschenkten Reliquien der heiligen drei Könige gedieh der Fortbau des südlichen Domturmes, durch blutige Fehden häufig unterbrochen, im Jahre 1447 bis zur Höhe von 50 m. Deutschlands Macht und Wohlstand tief erschütternde Ereignisse hemmten für die nächsten Jahrhunderte den Weiterbau. Verlassen und dem Verfall preisgegeben überragte drei Jahrhunderte hindurch der Domkranen, das alte Wahrzeichen Kölns, den in Trümmer sinkenden Wunderbau. Der Aufschwung neuen geistigen Lebens nach den glorreichen Befreiungskriegen 1813-1815, welche Köln und die Rheinlande mit Preußen vereinten, veranlaßten nach Auffindung der alten Dompläne Boisserée, Goethe, Görres und Schinkel zu erfolgreichem Wirken für des Domes Erhaltung.
König Wilhelm III. befahl 1824, im Jahre der Wiederbesetzung des erzbischöflichen Stuhles von Köln mit Ferdinand August Grafen Spiegel zum Desenberg, die Herstellung des Domchors. Ahlert und Zwirner haben diesen Bau bis zum Jahre 1840 vollendet. Die ewig denkwürdigen Worte Friedrich Wilhelms IV.: ›Hier, wo der Grundstein liegt, dort mit jenen Türmen zugleich, sollen sich die schönsten Tore der Welt erheben‹, am 4. September 1842, dem Tage der Grundsteinlegung zum Fortbau des Kölner Domes gesprochen, riefen die freudigste Begeisterung wach. Aus allen deutschen Ländern spendeten Fürsten und Volk reiche Gaben. Dombauvereine wirkten mit Ausdauer an des gottgeweihten Tempels Vollendung. Am 14. August 1848 weihte in Gegenwart Friedrich Wilhelms IV. der Erzbischof Johannes von Geissel, nachmals Kardinal, das von König Ludwig I. von Bayern mit kunstreichen Glasgemälden geschmückte Kirchenschiff, und am 3. Oktober 1855, bei der Feier der Vollendung des von Zwirner erbauten Südportals sah das dankbare Köln den königlichen Protektor und Schirmherrn des Dombaues zum letzten Male in seinen Mauern. König Wilhelm wohnte am 13. Oktober 1863 der Inauguration der mit Ausschluß der Türme in allen Teilen vom Dombaumeister Voigtel vollendeten, durch Wegnahme der seit 1322 bestehenden Trennungsmauer zwischen Chor und Langschiff zu einem Ganzen vereinigten Domkirche bei. Der Ausbau der beiden 157 m hohen Westtürme, unter dem Erzbischof Paulus Melchers begonnen und mit reichen, vom Staate und den Dombauvereinen gewährten Mitteln gefördert, wurden von dem Dombaumeister Voigtel in der zu hoher Kunstblüte herangebildeten Dombauhütte nach 13jähriger erfolgreicher Tätigkeit am 14. August 1880 vollendet. Zum ewigen Gedächtnis an den nach Verlauf von sechs Jahrhunderten glücklich beendeten Ausbau des größten deutschen Domes, des höchsten Bauwerkes der Erde, haben Seine Majestät der Deutsche Kaiser und König von Preußen, Wilhelm, und Ihre Majestät die Kaiserin und Königin Augusta, Ihre Kaiserlichen und Königlichen Hoheiten der Kronprinz und die Frau Kronprinzessin, die Prinzen und Prinzessinnen des preußischen Königshauses, nebst den von Seiner Majestät dem Kaiser geladenen deutschen Fürsten und Hohen Gästen diese Urkunde unterzeichnet, welche in den Schlußstein der Kreuzblume des südlichen Domturmes niedergelegt werden wird. So geschehen zu Köln am Rhein den 15. Oktober 1880, am Geburtstage des in Gott ruhenden Königl. Schirmherrn Friedrich Wilhelm IV., der den Plan zur Vollendung dieses herrlichsten Gotteshauses erfaßt und bis an sein Lebensende gefördert hat, im 20. Jahre der glorreichen Regierung Seiner Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm, dem 3. Jahre des Pontifikates Seiner Heiligkeit des Papstes Leo XIII. Soli Deo Gloria!«
Von Ludwig Feuth in Berlin.
Die Zeche »Königin Elisabeth« wird äußerlich durch einen in der Nähe des Dorfes Kray bei Essen belegenen größeren Gebäudekomplex gebildet, der auch die wesentlichsten über der Erde befindlichen Anlagen enthält: den Schacht »Joachim« nebst allen Dependenzen, die Kokerei, das Direktionshaus usw. In der Mitte erhebt sich der Schachtturm, ein massiges, rechteckiges, die ganze Gebäudegruppe hoch überragendes Bauwerk, dessen steiles Dach von einem Aussichtshäuschen gekrönt wird. Es lohnt sich, den mühsamen Aufstieg zu unternehmen, um dort oben den interessanten, weitgedehnten Rundblick auf die in ihrem Wechsel von Zechenanlagen, Schutthalden, Getreidefeldern, Wäldern, Arbeiterdörfern und Industriestädten so eigenartig belebte Landschaft zu genießen. An diesen Schachtturm schließen sich an allen vier Seiten niedrigere Anbauten an, von denen der östliche die zur Plattform der Schachtmündung führende Treppenanlage, der nördliche die über den Geleisen der Eisenbahn befindliche große Halle für die Entladung der Kohlenwagen enthält, während sich in dem westlichen Anbau die Fördermaschine und die Pumpenanlage, in dem südlichen u. a. der Zugang zu der Schutthaldenbrücke befinden. Besteigt man die genannte Plattform, so befindet man sich in einem riesigen Innenraum, dessen Mitte die hochaufragende Schachtzimmerung bildet. Holzgitter in Manneshöhe umgeben den Schacht; der Blick hinunter führt in einen unermeßlich scheinenden Abgrund. Sausend kommen die riesigen Fahrstühle herauf; die Gitter öffnen sich, und Wagen auf Wagen mit Kohlen gefüllt wird herausgezogen. Es ist ein fortlaufendes Kommen und Gehen, da der Schacht in zwei Abteilungen geteilt ist, in denen die Fahrstühle sich derart bewegen, daß der eine das Gegengewicht des andern bildet. Die Fahrstühle haben zwei bis drei Stockwerke. Das obere ist für den Transport der Bergleute bestimmt, während in den unteren, niedrigeren Stockwerken die Kohlenwagen eingeschoben werden, und zwar auf kleine Geleise, deren Fortsetzung oben und unten an den Schachtmündungen sich befindet. In dem oberen Stockwerk hat eine ganze Arbeiterkolonne Platz; in den unteren durchweg je zwei der kleinen Kohlenwagen, die Eisenbahnloren mit schräg gestellten Wänden gleichen. Kommen geförderte Kohlen herauf, die keiner weiteren Bearbeitung unterzogen zu werden brauchen, so fährt Wagen auf Wagen auf den schmalspurigen Geleisen in die große Halle über dem Schienenstrang, welcher den Schacht mit den Ferngeleisen der Eisenbahn verbindet. Dort laufen die Wagen in große, eiserne Radkästen (Kreiselwipper) ein, drehen sich mit ihnen, und polternd fällt die Kohle direkt in die darunter befindlichen Güterzüge.
Auf der anderen Seite des Schachtturms werden die Wagen mit dem unverwendbaren Gesteinsschutt nach der riesigen Schutthalde herübergefahren, und zwar auf einer den Zechenhof überschreitenden Brücke, an deren Ende sich ein Aufzugsgerüst für die Hebung der Wagen auf die Höhe der Halde befindet.
Mit geschwärzten Gesichtern und in nassen, schmutzigen Arbeitstrachten entsteigen die Bergleute dem Schacht, in den Händen die Sicherheitslampe und das »Gezähe«, das charakteristische Handwerkszeug der Häuer; andere Gruppen wiederum rüsten sich zur Einfahrt. Klingelsignale, Kommando- und Warnungsrufe durchschallen von allen Seiten den mächtigen Innenraum. Schweigen dagegen herrscht in dem unmittelbar daneben belegenen Raum der Fördermaschine. Eine riesenhafte Trommel, in Form eines radartigen, von den Achsenenden nach dem Rande konisch verlaufenden Gefäßes, wickelt die Drahtseile auf, an welchen die Fahrstühle hängen. Ungefähr in der Mitte des Raumes sitzt einsam der Maschinenleiter, von dessen Umsicht das Leben so vieler Menschen abhängig ist. Eine Tafel mit einem beweglichen Brettchen läßt den jeweiligen Aufenthaltsort der Fahrstühle erkennen; eine geringe Überschreitung der betreffenden Grenzlinien würde den Fahrstuhl am oberen Schachtrande zerschmettern oder unten in den Schachtsumpf hinabfallen lassen.
Daneben liegt der Raum mit der Wasserhaltungsmaschine; sie besteht aus einer riesigen, durch zwei Etagen durchgehenden, in der Höhe des ersten Stockwerks mit einer herumlaufenden Galerie versehenen Pumpe, deren Maße so gewählt sind, daß sie dem Grubenwasser das Gleichgewicht zu halten und diese kolossalen Wassermassen zu bewältigen vermag. Noch einige weitere Nebenräume schließen sich an, darunter die Leichenkammer, die leider ziemlich häufig belegt zu sein pflegt.
Rings um dieses hohe Mittelgebäude gruppieren sich niedrigere Baulichkeiten. Ein langgestrecktes, aus zwei rechtwinklig zusammenstoßenden Flügeln bestehendes einstöckiges Haus enthält in dem einen Flügel die Betriebsverwaltung, ferner die sehr praktisch und bequem eingerichteten Ankleide- und Baderäume für Bergleute, Beamte und Besucher, und endlich in dem andern, nach dem Zechenhof geöffneten Flügel die stets im vollsten Betriebe befindliche, großartig angelegte Schmiede. Von hier aus gelangt man zwischen der Halde und dem Schachtgebäude, unter der vorhin genannten Brücke hindurch, nach dem Kesselhaus, einem mächtigen Gebäude mit einer Anzahl Tag und Nacht in Betrieb befindlicher Kessel. Daran stößt die sogenannte Kokerei mit ihren zahllosen unmittelbar nebeneinander befindlichen Schamotteöfen und ihren sonstigen Baulichkeiten. Weiterhin schließt die Kohlenwäscherei nebst einigen Stapelplätzen, auf denen die Materialien für die unterirdische Streckenzimmerung usw. lagern, die Kette der rings um das Hauptschachtgebäude gruppierten technischen Anlagen. Eine erhebliche Strecke davon getrennt liegt nach Westen die Direktorwohnung mit Zier- und Gemüsegarten, Stallung usw., während nach Süden die ausgedehnte Arbeiterkolonie sich anschließt. Hier kann man am Sonntag die jungen Bergleute mit Gehrock, Zylinder, Zigarette und modernem Spazierstock flanieren sehen – es fehlt nur das Monokel, und der Großstadt-Dandy ist fertig. Andere, denen das weniger liegt, sitzen vor den Türen mit der Ziehharmonika, während ihre Frauen coram publico die in zahlreichen Exemplaren vertretene »Bergmannskuh«, die Ziege, melken. In den Kneipen spielt das Billard eine große Rolle, und die an den schweren Schlägel gewöhnte Hand scheint sich auch hier mit Geschick zu betätigen.
Doch wenn am Montag in aller Frühe die »Schicht« beginnt, so treten die Leute wieder an in ihrem kohlengeschwärzten Bergmannskittel, mit ihrem Licht und ihrem Gezähe, und hinunter geht es in die Finsternis des Schachtes. Sausend fährt die Schachtzimmerung vorüber, naß, glitschrig und modrig. Plötzlich ertönt ein Glockensignal, der Fahrstuhl hält, und man sieht in einen durch Holzgitter abgeschlossenen erhellten Raum, in dem sich Leute bewegen. Die Gittertür wird aufgerissen, und wir treten in eine niedrige gewölbte Halle, den sogenannten »Füllort«, ein, der den Eingang einer Sohle des Bergwerks bildet.
Voll Spannung setzen wir den Fuß auf den Boden dieser Unterwelt. Das Gittertor schließt sich hinter uns; der den Füllort leitende Vormann – der in steter Verbindung mit dem die Fördermaschine bedienenden Maschinisten steht, und dessen Posten nicht ohne erhebliche Verantwortung ist – erstattet dem uns begleitenden Betriebsführer seine Meldung, während wir die von Nässe triefenden, ungeputzten Steinwände und Backsteingewölbe der Halle betrachten und die großen von der Decke herabhängenden Tropfsteine bewundern. Gleich darauf wieder ein Klingelsignal; in der linken Abteilung kommt der zweite Fahrstuhl angesaust, welcher das Gegengewicht zum unsrigen hält. Das linke Gittertor wird zurückgeschoben, und die beiden unteren für Kohlenwagen bestimmten Stockwerke des haltenden Fahrstuhls werden sichtbar. Arbeiter ziehen die leeren Kohlenwagen heraus; andere schieben sie auf den Geleisen weiter und in die an den Füllort stoßende Strecke mittels Drehscheiben hinein. Gefüllte Kohlenwagen werden herangefahren und auf die Geleise des leeren Fahrstuhls heraufgeschoben. Auf ein weiteres Signal senkt sich der Fahrstuhl so weit, daß das obere Stockwerk in gleicher Weise entleert und gefüllt werden kann. Noch ein Signal, und der Mannschaftsraum des Fahrstuhls kommt zum Vorschein; Bergleute, deren »Schicht« abgelaufen ist, treten hinein; das Gitter wird geschlossen, und der Fahrstuhl steigt aufs neue empor. Wir aber treten, den Füllort verlassend, in die »Strecken« der Grube ein.
Um weiter auf die Einzelheiten einzugehen, ist eine kurze schematische Darstellung der ganzen unterirdischen Anlage notwendig. Die Kohle kommt nicht in starken, zusammenhängenden Komplexen, sondern in sogenannten »Flözen« vor, d. h. in ausgedehnten, mehr oder weniger dünnen, plattenartigen Schichten, welche jede für sich gewissermaßen den Extrakt einer besonderen Periode vorweltlicher Urwaldvegetation darstellen und nicht unmittelbar aufeinander aufliegen, sondern durch andere Gesteinsschichten von meist erheblicher Stärke getrennt sind. Im Ruhrkohlenrevier verlaufen die Flöze ziemlich parallel der Oberflächengestaltung und machen daher die wellenartige Faltung der sogenannten »Essener Mulde« mit. Auf dem Grubenfelde der Zeche »Königin Elisabeth« steigen die Flöze in ziemlich steilem Winkel auf. Der schematische Schnitt eines einzelnen Grubenfeldes diene zum besseren Verständnis der nachfolgenden Darstellungen.
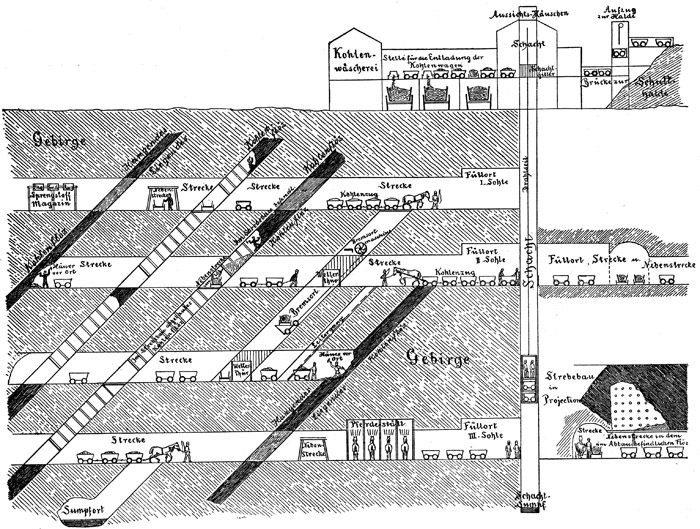
Schematischer Querschnitt durch ein Steinkohlenbergwerk
Der im allgemeinen parallele Verlauf der Flöze wird vielfach durch Verwerfungen gestört. Die Stärke der einzelnen Flöze ist sehr verschieden, sie schwankt zwischen Dezimetern und mehreren Metern. Von der Stärke der Flöze sowohl, wie von der Qualität ihrer Kohle hängt es ab, ob ein Flöz als abbauwürdig anzusehen ist. Die Methoden des Abbaus sind verschieden. Früher kannte man nur den Streckenbau, d. h. man trieb durch das ganze »Gebirge« horizontale Strecken unter- und nebeneinander, welche die verschiedenen Flöze an einer Anzahl von Punkten schnitten (vgl. die Schnittskizze). An diesen Schnittpunkten wurde so viel Kohle entnommen, als man ohne allzu große Schwierigkeit und Gefahr von dort aus wegsprengen und wegschlagen konnte, und man baute dann fortgesetzt immer weitere, tiefer und seitlich belegene neue Strecken. Das war ein ziemlich teures und wenig praktisches System. Auf der Zeche »Königin Elisabeth« wurde durch deren noch im Amte befindlichen Direktor der seit einer Reihe von Jahren bereits in Oberschlesien angewandte Strebebau eingeführt, der ungleich zweckmäßiger, billiger und ertragreicher ist. Während früher eine große Anzahl von verschiedenen »Sohlen«, d. h. durch besondere Füllörter mit den Schächten in direkter Verbindung stehende, mit Geleisen, Kohlenzügen, Pferden usw. ausgerüstete wagrechte Strecken notwendig waren, genügen jetzt deren einige wenige für die Ausbeutung des ganzen Grubenfeldes. Die Flöze werden nämlich gewissermaßen im ganzen herausgeschlagen. Man verlegt von einer Strecke aus Nebenstrecken in das Flöz selbst hinein und beseitigt von diesen aus von unten her den ganzen Inhalt des Flözes.
Die Flözstrecke mündet von oben in die Nebenstrecke und ist von dieser durch einen Holzverschlag, die »Deckenzimmerung« getrennt. Wird nun die Kohle aus dem höher liegenden Flöz entfernt, so rutscht die losgelöste Masse auf dem Liegenden Der Bergmann nennt das über der abgebauten Schicht liegende Gestein »das Hangende«, das darunter befindliche »das Liegende«. nach unten herunter und bleibt auf der Deckenzimmerung der Nebenstrecke liegen. Durch Öffnungen in dieser Deckenzimmerung läßt man dann die Kohle in die unmittelbar darunter stehenden Kohlenwagen fallen. An die Stelle der herausgenommenen Kohlen werden in kurzen Abständen reihenweise Holzpfosten eingesetzt, sogenannte Streben, daher denn der Name »Strebebau«. Ein solches von der Kohle entleertes, bis in die weitesten Fernen hin übersehbares, von unzähligen Streben erfülltes, steil aufsteigendes Flöz sieht ganz eigentümlich aus.
Wo angängig, werden auch die abgebauten Flöze mit dem bei Herstellung der Horizontalstrecken sich ergebenden Gesteinsschutt ausgefüllt, wodurch einerseits dessen Transport auf die oberhalb der Erde gelegenen Schutthalden erspart wird, andererseits die infolge Morschwerdens der Streben schließlich unvermeidlichen Gesteinseinstürze und die damit verbundenen Senkungen der Erdoberfläche vermieden werden. Die zahllosen Schadenersatzansprüche der von solchen Senkungen betroffenen Haus- und Bodenbesitzer bilden ein nie endendes, sehr kostspieliges Spezialleiden der Zechenverwaltungen.
Aus den innerhalb der Flöze liegenden Nebenstrecken werden die gefüllten Kohlenwagen durch jugendliche Arbeiter in die Hauptstrecke hineingeschoben und dort zu kleinen Kohlenzügen zusammengesetzt, welche dann durch Pferde zu den Füllorten gezogen werden. Es sind durch das Gestein durchgesprengte große, endlose Tunnels, welche dort, wo das Hangende nicht brüchig ist, die natürliche Struktur der bei den Sprengungen herausgeschlagenen Gesteinswölbung zeigen, durchweg aber ausgezimmert oder ausgemauert sind.
Von den Strecken aus findet an geeigneten Stellen auch noch in der alten Weise der Abbau der Kohlenflöze statt. Besonders bei Flözen, deren geringe Stärke den Abbau auf dem Wege des Strebebaues ausschließt, oder auch sonst an den in unmittelbarer Nähe der Strecken liegenden Teilen größerer Flöze sieht man noch die Häuer »vor Ort«, d. h. an dem anstehenden Kohlenflöz arbeitend, Schlägel und Eisen in der Faust, daneben das übrige »Gezähe«, das in die Wand eingeschlagene Beil, den Spaten usw., und über dem während der Arbeit abgelegten Rock die vorschriftsmäßig mit kaltem Kaffee gefüllte Feldflasche (Alkohol ist streng verboten). Das Ganze ist von der an der Streckenzimmerung hängenden Sicherheitslampe beleuchtet.
So scharf und gut auch das Handwerkszeug des Häuers und so kräftig auch seine schlaggewohnte Faust sein mögen, er würde doch nur langsam weiter kommen, wenn er darauf allein angewiesen wäre. Pulver und Dynamit spielen eine Hauptrolle, sowohl beim Durchbruch der Strecken, wie bei der Auslösung der Kohle aus den Flözen. Beinahe fortgesetzt hallt der Donner der Sprengungen durch die Strecken der Grube. Natürlich wird dadurch das Gesteinsgefüge vielfach so erschüttert, daß auch die Auszimmerung nicht mehr als hinreichende Sicherung erscheint und zur Ausmauerung der Strecke geschritten werden muß – ein nicht ungefährliches, nur unter sorgfältiger Abstufung des brüchigen Gesteins durchführbares Stück Maurerarbeit, für welches sich die an die verhältnismäßig sichere Arbeit über der Erde gewöhnten Kollegen der Zechenmaurer bestens bedanken würden. Aber Übung macht auch hier den Meister.
An einzelnen Stellen werden große Hohlräume ausgesprengt für Sprengstoffmagazine, für Füllörter, unterirdische Pferdeställe usw. Letztere sind in durch Holzwände getrennte Stände geteilt, und über jedem steht der Name des Pferdes; man liest »Hektor«, »Bleß«, »Stine« u. a. Im Stallgang läuft das Geleise, auf dem Wasser und Futter herbefördert werden. Ein Stalljunge hat die Wartung. Die Pferde leben und sterben in der Grube, befinden sich wohl, sind munter und gut aufgelegt und fressen vorzüglich. Sie besorgen den ganzen durchgehenden Verkehr in den verschiedenen Sohlen; ihre Beförderung in die Grube erfolgt im Mannschaftsraum der Fahrstühle, was allerdings eine ziemlich schwierige Sache ist.
Die großen, parallel laufenden oder sich kreuzenden Strecken, von welchen allseitig die in den Kohlenflözen liegenden Nebenstrecken für den Betrieb des Strebebaues ausgehen, sind durch ein Netz kleinerer, niedrigerer Strecken verbunden, welche zwar mit Geleisen versehen, aber für Pferde nicht passierbar sind. Kleine Jungen schieben hier die Wagenzüge und wissen ihnen, wenn die Wagen leer sind, einen solchen Anstoß zu geben, daß sie nebst den aufgesprungenen Begleitern mit einer für unachtsame Streckenpassanten gefährlichen Geschwindigkeit dahersausen. Manchmal teilt sich auch eine große Strecke in mehrere kleine Strecken und zweigt solche strahlenförmig nach mehreren Seiten ab.
Die Strecken sowie deren Verbindungen durch Nebenstrecken und durch die weiter unten erwähnten »Bremsorte« sind häufig durch sogenannte »Wettertüren« unterbrochen. Die Ventilation der Grube, die sogenannte »Wetterführung«, ist nämlich von der größten Bedeutung, und die Maße der auf dem Erdboden stehenden mit einem Drahtnetz zur Abhaltung der zahllosen hineingesaugten Gegenstände versehenen Trichtermündung des riesigen Ventilators und der zum »Wetterschachte« führenden Ventilationsstrecke lassen erkennen, in welchem Grade bei der Anlage für die Zuführung frischer Luft und die Entfernung der verdorbenen Grubenluft gesorgt ist. Zur Regulierung dieser Wetterführung innerhalb der Grube, ferner zu ihrer Verweisung auf bestimmte Strecken, endlich zur Abschließung wenig befahrener und in bezug auf die Zusammensetzung der Luft nicht zuverlässiger Grubenteile dienen die Wettertüren.
Man gelangt bei dem Durchwandern der Grube schließlich an Stellen, wo die Strecken aufhören, weil sie bei ihrer Weiterführung zu den Grubenfeldern der Nachbarzechen führen würden, oder weil ihre Fortsetzung aus irgendwelchen anderen Gründen aufgegeben wurde. An anderer Stelle folgt man einer fortgesetzt sich senkenden Strecke; steil geht es abwärts, überall hört man das Rauschen der von allen Seiten herabströmenden Grubenwasser. Ungeheure Schimmelpilzbildungen bedecken die Auszimmerung; die Holzpfosten sind in weiße, flockige Massen eingehüllt. Schließlich stehen wir an der tiefsten Stelle der Grube, einem modrigen, schwarzen Wassertümpel, dem sogenannten Sumpfort, einer Art von Reservoir, das bei zeitweiligem Versagen des Pumpwerks die Grubenwasser ansammelt und damit dem »Versaufen« der Zeche im Falle kürzerer Betriebsstörungen der Pumpmaschine vorbeugt.
Die einzelnen Sohlen stehen übrigens nicht durch die Schächte und deren Füllorte allein in Verbindung. Abgesehen davon, daß man, manchmal in den abgebauten Flözen auf dem festen Hosenboden über das »Liegende« herunterrutschend oder von Strebe zu Strebe aufwärts kletternd, von einer Sohle zur anderen gelangen kann, bestehen auch sonst noch direkte Verbindungen zwischen den einzelnen Sohlen. Es werden auch durch solche direkten Verbindungen Sohlen an den Bergwerksbetrieb angeschlossen, deren Anlage durch Verwerfungen der Flöze oder dadurch erforderlich wird, daß wegen der großen Entfernung der betreffenden Betriebsstelle von einem der Schachte oder wegen der geringeren Erheblichkeit ihres Betriebes die Anlage eines besonderen Schachtfüllortes nicht lohnend erscheint. Derartige Verbindungen werden hergestellt sowohl für den Personenverkehr, wie für die Förderung von Kohlen und Gestein. Die Verbindungen für Personen sind Leitergänge. In diesen engen, gerade zum Durchkriechen ausreichenden, schornsteinartigen, in abgebauten Flözen aufwärts laufenden Röhren, die rings umzimmert sind, steigen die Leitern, wie ein mittels Schwellen auf dem Liegenden aufliegendes und in der Art von Schienenstößen miteinander verbundenes Geleise empor. Für den Transport von Kohle und Gestein sind »Bremsorte« angelegt; es sind dies im abgebauten Flöz steil ansteigende, völlig ausgezimmerte Strecken, in welchen sich auf einem auf dem Liegenden aufgestellten Holzgestell ein Geleise befindet, auf dem sich, von einer besonderen Maschine gezogen, ein schweres Gestell bewegt, in welches die Kohlenwagen eingeschoben werden. Dieses Gestell füllt mit dem aufgeschobenen Kohlenwagen die ganze Höhe und Breite des Bremsortes aus. Daher ist das Betreten des letzteren durch Personen wegen der damit verbundenen Gefahr streng verboten; überdies ist dessen Bodenfläche auch an und für sich wegen des darauf aufgebauten Untergestells für die Schienen völlig ungangbar. Die Maschine für die Hebung des Fahrgestelles befindet sich im Bremsort selbst; es ist eine elektrisch betriebene kleine Fördermaschine, deren wesentlichsten Bestandteil ein großes, das Drahtseil tragendes Rad bildet. Auf einem Brettersitz hockt der jugendliche Maschinenwärter, für den dieser, die gewissenhafteste Aufmerksamkeit erfordernde Dienst eine gute Vorschule bildet.
Zur Ergänzung unserer Darstellung des bergbaulichen Betriebs mögen noch einige weitere Angaben über dessen Organisation dienen. An der Spitze der Zeche steht ein mit ziemlich diktatorischer Machtvollkommenheit ausgestatteter technischer Direktor, dem ein kaufmännischer Direktor untergeordnet ist. Der technische Direktor wohnt auf der Zeche in dem unmittelbar beim Schacht »Joachim« belegenen Direktionshause. Adjutant und Stellvertreter des Direktors ist ein Oberingenieur. Den eigentlich bergbaulichen Betrieb leitet unter dieser Oberbehörde ein Obersteiger mit dem Titel »Betriebsführer«. Unter diesem stehen die Steiger, deren jeder in einem bestimmten Revier die Leitung hat. Das Maschinenpersonal mit seinen verschiedenen Ingenieuren usw. untersteht direkt dem Oberingenieur. Die Kontrolle ist, so wenig man auch äußerlich von ihr bemerkt, äußerst genau. So sehr sich auch die eingefahrenen Bergleute in den weiten Strecken des Grubenfeldes, in seinen zahllosen Flözen und Arbeitsstellen verlieren mögen – man sieht bei den unterirdischen Wanderungen tatsächlich nur relativ wenig Leute trotz der großen, etwa 1500 Mann zählenden Belegschaft –, so genau weiß der einzelne Steiger, der Stunde für Stunde sein Revier durchwandert und durchkriecht, mit der Tätigkeit jedes einzelnen Bescheid, so genau achtet er auf die Innehaltung der strengsten Vorschriften bezüglich der ordnungsgemäßen Benutzung der Latrinen – keine Wetterführung vermag gegen die bei Übertretung dieser Vorschriften eintretende Verpestung der Grubenräume anzukämpfen, und daher trifft einen Übeltäter dieser Art die schroffste Entrüstung seiner Mitarbeiter und Vorgesetzten –, so sorgfältig achtet der Steiger auf die vorgeschriebenen Schließungen und Öffnungen der Wettertüren und auf die vorsichtige Handhabung des Bremsortbetriebes. Eine andere sehr wichtige Gruppe der Zechenbeamten bilden die sogenannten »Markscheider«, die Geometer der Grube, welche in unausgesetzter Tätigkeit sind, einerseits um den Gang der Flöze und der verschiedenen Gesteinsarten kartographisch aufzunehmen und der Direktion damit das Material für ihre Dispositionen zu verschaffen, andererseits um ein Eindringen in fremde Grubenfelder durch fortlaufende Messungen zu verhindern.
Weitere Zweige der Zechenverwaltung bilden die Organisation und die Fortentwicklung der Wohlfahrtseinrichtungen für Arbeiter und Beamte, die Verwaltung und der Ausbau der Arbeiterkolonien, welche dem Bergmann ein billiges und gesundes Wohnen und den Nebenbetrieb einer kleinen Landwirtschaft ermöglichen, die Einrichtung und Leitung der Konsumvereine usw. So intensiv und erfolgreich auch das Bestreben der Direktion sich auf die Erzielung einer möglichst hohen Förderung bei möglichst geringen Unkosten richtet – eine Aufgabe, von deren geschickter Lösung der Ertrag der Zeche, der Wert der Gewerkschaftsanteile (der sogenannten »Kuxe«) und damit das Blühen und Gedeihen der ganzen Zeche abhängen –, so sehr wird doch den Anstrengungen, Schwierigkeiten, Gesundheitsschädigungen und Gefahren des Bergmannsberufes sowohl durch die tunlichste Sicherung des Betriebes wie auch durch sonstige weitgehendste Fürsorge und Unterstützung in großem Stile Rechnung getragen.
Himmel und Erde. 15. Jahrg. 1902/1903. Leipzig, B. G. Teubner.
Bearbeitet von J. Deuster in Wetter (Ruhr).
Ein glänzendes Beispiel von hoch entwickelter Industrie im deutschen Vaterlande bietet das Bergische Land im Flußgebiet der mittleren Wupper mit seinen langgestreckten Höhenzügen und tief eingeschnittenen, wasserreichen Tälern. Dieser merkwürdige Landstrich umfaßt die Kreise Elberfeld, Barmen, Remscheid und Teile der angrenzenden Kreise Lennep, Solingen, Mettmann Die genannten Kreise liegen im Osten des Regierungsbezirks Düsseldorf in der preußischen Rheinprovinz, Schwelm in Westfalen. und Schwelm. Der stellenweise wenig fruchtbare Boden würde nur eine geringe Bevölkerung zu ernähren imstande sein; aber durch die eigentümlichen Bodenverhältnisse und ungemein zahlreichen Wasserkräfte hat die Natur die Bewohner gleichsam auf eine rege Gewerbstätigkeit hingewiesen, die es denn auch bei deren angeborenem industriellem Sinn möglich gemacht hat, daß in den bezeichneten Gegenden ausschließlich der Städte Elberfeld und Barmen eine Bevölkerung von gegen 40 000 Menschen auf jeder Quadratmeile ihren Unterhalt findet, eine Volksdichte, wie sie nur England in seinen Manufaktur-Bezirken aufzuweisen hat.
Der Hauptsitz der Bergischen Manufaktur, welcher an Bedeutung keine in Deutschland gleichkommt, ist das Wuppertal, worunter im engeren Sinne die Städte Elberfeld und Barmen mit einer Gesamtbevölkerung von mehr als 300 000 Einwohnern, und zwar die Stadt Elberfeld nach der neuesten Zählung mit 167 000 und Barmen mit 156 000 Einwohnern, verstanden werden. Wenden wir uns zu einem der höchsten Punkte der Höhenzüge, welche das Tal bald enger, bald weiter einschließen, so erblicken wir mit Staunen und Bewunderung eine gut drei Stunden lange Stadt, in der Hunderte dampfender Essen, das zu uns aufsteigende Gebrause eines lebhaften Verkehres in den Straßen, die fast ununterbrochen auf- und abwärts eilenden Güter- und Personenzüge uns einen Schauplatz mannigfaltiger und großartiger Gewerbstätigkeit ersten Ranges darbieten. Das von Osten nach Westen sich hinziehende Tal, in dem die Städte zu beiden Seiten der Wupper gebettet sind, ist bei deren raschem Anwachsen längst zu eng geworden, sie steigen immer weiter die Gehänge der Höhen hinan, von denen die zahlreichen, oft mit fürstlichem Luxus ausgestatteten Villen der Reichen, in parkartigen Gärten gelagert, schon früher Besitz genommen.
Beginnen wir nun von Osten her eine Wanderung durch die Städte selbst. Die Stadtgemeinde Barmen umfaßt die zu einem kompakten Ganzen zusammengewachsenen Ortschaften Heckinghausen, Rittershausen, Wichlinghausen, Wupperfeld, Gemarke und Unterbarmen. Folgen wir von Rittershausen der Hauptstraße abwärts nach Gemarke! Es ist um die Mittagsstunde. Welch ein Menschenstrom wälzt sich eilend nach allen Richtungen durch die Straßen! Es hält schwer, durch diesen dichten Schwarm von jung und alt, Männern und Frauen in entgegengesetzter Richtung sich durchzudrängen. All diese Menschen entströmen den Fabriken und Werkstätten, um in ihren Behausungen schnell Nahrung und Stärkung für die zweite Hälfte des Tages zu finden. Da überkommt uns denn eine weitere Ahnung von der Großartigkeit der hiesigen Gewerbe.
Die Stadt Barmen ist einer der Hauptsitze der Industrie im Deutschen Reiche. Sie verdankt ihr rasches Emporblühen – sie hat sich in 100 Jahren in ihrer Einwohnerzahl mehr denn verzehnfacht – der rastlosen Tätigkeit und Intelligenz ihrer Einwohner, welche es verstanden, zu rechter Zeit für Artikel, die durch irgendwelche Umstände lohnenden Betrieb nicht mehr gestatteten, neue Industriezweige hier einzuführen. – Das erste Vorkommen des Namens Barmen findet sich im Jahre 1200 in einem Heberegister des Klosters Werden. Die Grundlage zu der jetzt so vielgestaltigen Industrie Barmens bildeten die Naturleinen- und Garnbleichen, welche seit der Mitte des 15. Jahrhunderts urkundliche Erwähnung finden. 1606 wurden auf 77 Barmer und 33 Elberfelder Bleichen 5127 Zentner Garn gebleicht. 1611 werden in Barmen 88 Bleichen aufgeführt. Durch das 1527 von Herzog Johann III. den Bewohnern von Elberfeld-Barmen erteilte Privilegium, nach dem nur hier in seinem Lande Garn gebleicht werden durfte, wurde die Industrie befestigt und die Bleicherzunft – Garnnahrung – geschaffen. Die Zunft Garnnahrung wurde erst 1810 aufgelöst. Heute sind die Natur-Garnbleichen fast verschwunden. – Seit dem Anfange des 16. Jahrhunderts fand außer dem Bleichen von Garn die Verarbeitung zu Zwirn sowie Bins-(Hand)wirken und Tuch-(Leinwand)machen statt. Die Industrie wurde aber vielseitiger, als seit der Mitte des 16. Jahrhunderts viele Niederländer, darunter Posamentiere (Passementmakers) hierher flüchteten. Im 18. Jahrhundert wurde die Spitzenindustrie und die Seidenfabrikation, 1780 auch die Türkischrotgarnfärberei eingeführt. Die »Barmer Artikel« – Bänder, Kordeln und Litzen – gewannen den Weltmarkt und werden auch heute noch trotz der überall entstandenen Konkurrenzfabriken nach den entferntesten Gegenden ausgeführt. Die Industrie Barmens umfaßt jetzt: Bänder, Litzen und Besatzartikel aller Art, Tapisserie-, Möbel- und Dekorations-Fransen und Besätze, Posamentierwaren, Schnürriemen, Hutlitzen, gummielastische Waren, baumwollene Näh- und Eisengarne, Seiden- und Halbseidenwaren, Zanella- und sonstige Futterstoffe, Trikotwaren, Türkischrotgarnfärberei, Färberei und Appretur, Stoff- und Metallknöpfe, Knopf- und Konfektionsstoffe, Brüssel- und Tournay-Teppiche, chemische Fabrikate und Teerfarben, Messing- und Aluminium-, gold- und silberplattierte Kupfer- und fassonierte Tombakbleche, Zündhütchen, Schnürlochungen (Oeillets), Eisen- und Stahlwaren, Maschinenbau, Flechtmaschinen, Kesselschmiederei, Pianofortes, Militäreffekten, Chromo-, Bunt- und Luxuspapiere, Briefumschläge, Buch- und Steindruckereien, Bierbrauereien, Seifenfabrikation und Glyzerin-Raffinerie usw.
Werfen wir einen Blick in die Werkstätten! In langen, hellen Sälen reiht sich Maschine an Maschine – wahre Wunder der Mechanik – wo es walzt, stößt, hebt, schiebt, um die Fäden in den vielfachsten Verschlingungen zu Bändern usw. zu vereinigen. Hier steht ein Mann vor einem kunstreichen Webstuhl, den seine Hände in Bewegung setzen, und vor unseren Augen entstehen Bänder, bald schmal, bald breit, mit eingewebten Mustern in den brillantesten Farben. Treten wir noch in einen anderen Raum! Von der Kraft des Dampfes getrieben, bewegen sich hier eine Unzahl eiserner, durchbrochener horizontaler Scheiben, auf denen in wirbelndem Tanze Rollen mit Fäden sich bewegen, und vor unseren Augen entstehen Schnürriemen, Litzen, prachtvolle Spitzen usw. aller Art, ganz oder teilweise von Seide, Wolle, Baumwolle oder Leinen. Zu den bedeutendsten Nebenindustrien Barmens gehören die Eisengarn-Fabriken, ferner die neuerdings sehr in Aufnahme gekommenen Gewebe mit Gummifäden als Kette, die großartigen Färbereien und die Fabriken für die Herstellung von Glaubersalz, Salzsäure, Chlorkalk und anderen Präparaten für die Färberei, Druckerei und zum Beizen. Einen guten Ruf im In- und Auslande genießen auch die Knopffabriken Barmens, welche mit den sinnreichsten Maschinen Knöpfe in unendlicher Mannigfaltigkeit in Größe und Form, aus Holz, Horn, Perlmutter bis zu silber- und goldplattierten liefern.
Der Handel Barmens umfaßt außer dem Vertrieb der fabrizierten Artikel besonders Baumwollen- und Wollenwaren, sowie Rohseide und Farbstoffe, Kohlen und Koks.
Auf einer hochgelegenen Straße an der linken Wupperseite fällt uns ein Prachtbau von bedeutendem Umfange in die Augen; es ist das Lokal der niederen und höheren Gewerbeschule. Hier wird von tüchtigen Lehrern ein gründlicher Unterricht in allen Fächern gegeben, die dem Industriellen, der auf der Höhe der Zeit bleiben will, unentbehrlich sind. Ihr ist in neuerer Zeit, den besonderen Bedürfnissen des Wuppertales Rechnung tragend, die preußische höhere Fachschule der Textilindustrie zur Seite getreten. Zu den weiteren Prachtbauten zählen das Rathaus, das neue Stadttheater, das Gymnasium, die Königliche Baugewerkschule, die Badeanstalt, die in den städtischen Parkanlagen errichtete Stadthalle, das Luftkurhaus und vor allem die Ruhmeshalle – ein mächtiger Kuppelbau von hoher künstlerischer Wirkung, der die Standbilder der drei ersten Kaiser des neuen Deutschen Reiches, eine Gemäldesammlung und ständige Ausstellung des Barmer Kunstvereins, die Sammlungen des Geschichtsvereins und die Stadtbibliothek mit Lesesaal in seinem Innern birgt. In Gemarke führt uns eine der zahlreichen Brücken zum Bahnhofe »Barmen«, an dem das Realgymnasium und das in edlem Stil erbaute »Vereinshaus« liegen, letzteres eine überaus wohltätige Einrichtung, in dem eine jedem Stande, selbst dem ärmsten Arbeiter entsprechende billige Beköstigung und Herberge geboten wird. Wenige hundert Schritte weiter abwärts befinden wir uns auf der 18 m breiten schnurgeraden Straße, die mit ihren Nebenstraßen den Stadtteil »Unterbarmen« bildet. Diese Straße, fast durchgehends aus stattlichen, schönen Gebäuden bestehend, ist eine halbe Stunde lang, ihre breiten Fußsteige werden von stattlichen Linden beschattet, und auf ihr bewegt sich ein ununterbrochener Strom von Menschen und Fuhrwerken aller Art. – Am Ende Unterbarmens führt uns eine steinerne Brücke wieder auf die rechte Wupperseite und somit in das Elberfelder Gebiet. Hier haben wir gleich links das stattliche Landgerichtsgebäude mit seiner Säulenhalle und dem herrlichen Gemälde »das jüngste Gericht« von Albert Baur in Düsseldorf im Assisensaale, und rechts, steil ansteigend den Hardtberg, der sich in das Tal vordrängend gegen hundert Meter über dessen Sohle erhebt. Die ganze südwestliche Seite des Berges ist in einen städtischen Park umgewandelt, der sich in Terrassen bis zum Gipfel erhebt. Er bildet einen sehr beliebten Spaziergang und Vergnügungsort der Bewohner der beiden Schwesterstädte. Den höchsten Punkt der Anlagen ziert ein 24 m hoher massiver Turm, von dessen Galerie man eine überaus malerische Aussicht aus der Vogelperspektive auf das ganze lebensvolle Tal und seine anmutige Umgebung genießt. Hier erinnert auch das einfache Standbild des frommen und edlen Suidbert an die Zeit, da das Bergische Land zum erstenmal die Botschaft des Friedens vernommen.
An der Grenzmarke beider Städte nimmt uns zuerst die Berliner Straße auf, an die sich in westlicher Richtung die Kippdorf- und Hofkamperstraße schließen. Diese Straßen führen in das Zentrum der Stadt und bilden die Hauptverkehrsadern in ihrem östlichen Teil. Hier herrscht stets ein ungemein reges Leben; Fuhrwerke vom schwersten Frachtwagen mit kolossalen Rossen bespannt bis zum Esels- und Hundekarren und von der elegantesten Equipage der Reichen bis zur bescheidenen Droschke und dem menschengefüllten Straßenbahnwagen rollen unaufhörlich hin und her. Es ist ein Getöse, daß man kaum das eigene Wort zu hören vermag. Auch ist das Menschengewoge in den Hauptstraßen Elberfelds, besonders bei Beginn und Schluß der Fabriken, fast noch größer als in Barmen, wo die Bevölkerung auch weniger gedrängt wohnt.
Trotzdem erfreut sich Elberfeld eines ansprechenden Stadtbildes. Gelagert in einem langgestreckten Kessel, umrahmt von einem Kranze freundlich bewaldeter Höhen, von deren Gipfeln hochragende Aussichtstürme ins »Land der Berge« hinausschauen, machen selbst in den ältesten Stadtteilen die stets sauber in Ölanstrich gehaltenen Häuser mit ihren weißen Fenstereinfassungen und grünen Läden, die musterhafte Reinlichkeit der Straßen sowie die vielfachen Anzeichen eines verbreiteten Wohlstandes und Reichtums auf den Fremden einen freundlichen und wohltuenden Eindruck. Unter den Städten des Rheinlandes hat Elberfeld den größten Bestand an städtischen Park- und Waldanlagen und infolge seines gesunden Klimas und der vorzüglichen sanitären Einrichtungen eine der niedrigsten Ziffern in der Sterblichkeitsstatistik der deutschen Großstädte. Das Leben im Wuppertal ist völlig großstädtisch. Sind Adel und Militär auch fast gar nicht vertreten, so macht sich doch eine Scheidung der Kaufleute und Großfabrikanten von den eigentlichen Arbeitern, Handwerkern und gewöhnlichen Gewerbsleuten nach verschiedenen Abstufungen im geselligen Leben geltend.
Zu den bedeutendsten öffentlichen Gebäuden, die sich durch Großartigkeit und edlen Baustil auszeichnen, gehören die Handwerker- und Kunstgewerbeschule, das im Rundbogenstil erbaute Rathaus, die Kaiserliche Post, das städtische Krankenhaus, das mit einem Kostenaufwande von 1½ Mill. Mark erbaute Bahnhofsgebäude, das Verwaltungsgebäude der Bergisch-Märkischen Bahn, das Kasinogebäude, einige Kirchen, das Waisenhaus, das Neviandt-Stift; das Kriegerdenkmal vor der Laurentiuskirche bildet einen besonderen Schmuck Elberfelds. In neuerer Zeit ist hierzu – nach Niederlegung der häßlichen Baulichkeiten am linken Ufer der Wupper, zu den Füßen des Bahnhofs – ein herrliches Theatergebäude und eine musterhaft eingerichtete Badeanstalt gekommen. Ihnen schließen sich stromabwärts eine Reihe schöner Baulichkeiten an, von denen nur drei: das Thalia-Theater, das Gymnasium und die Stadthalle erwähnt seien. Hier befindet sich auch das herrliche Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. – Neben den bereits genannten Straßen bilden die Wall-, Herzogs- und Schwanenstraße die innere Stadt und vermitteln den Hauptverkehr. Hier reiht sich ein Prachtladen an den anderen, in denen hinter hohen Spiegelfenstern dem Auge alles geboten wird, was das gewöhnliche Bedürfnis erheischt und der ausgesuchteste Luxus nur wünschen kann.
Der westliche Hauptteil besteht aus der Auer- und der breiten langen Königsstraße mit ihren zahlreichen Seitenstraßen. An der letzten liegt außer der katholischen Kirche eine im romanischen Stile erbaute evangelische Kirche. Die Königsstraße besteht in ihrer ganzen Länge aus lauter massiven, oft palastartigen Privathäusern der reichen Kaufleute und Industriellen und gehört zu den schönsten und belebtesten der Stadt.
Elberfeld mit 167 000 Einwohnern ist der Hauptsitz der Fabrikation der Baumwollen-, Seiden-, leichten Wollen- und aus Baumwolle, Seide und Wolle gemischten Waren und der Färberei. Außerdem aber möchte es kaum einen Zweig der Fabrikation geben, der hier nicht in einem mehr oder minder bedeutenden Umfange betrieben wird. Nur wer die größten Fabrikstädte Englands und Frankreichs gesehen hat, kann sich einen Begriff von dem Bilde menschlicher Tätigkeit und regen Kunstfleißes machen, das uns hier überall begegnet. Fabrik reiht sich an Fabrik, besonders längs der Wupper, und die zahlreichen rauchenden Turmessen verraten die gewaltigen mechanischen Kräfte, die überall diesem Schaffen der mannigfaltigsten Art ihre Unterstützung leihen.
Die Erzeugung der Rohstoffe allein, deren die Industrie des Wuppertales bedarf, gibt bereits Hunderttausenden dürftiger Menschen in allen Himmelsstrichen Arbeit und Brot. Nie ruht der Spekulationsgeist des Fabrikherrn, um den Moden der fernsten Länder gerecht zu werden, neue geschmackvolle Muster von Web- und Druckwaren auf den Weltmarkt zu bringen. Aber überall begegnet ihm auch die Konkurrenz Englands und Frankreichs, er ist daher genötigt, sich beständig nach den neuesten Erfindungen und Verbesserungen in seinem Fabrikzweige umzuschauen. Fast jedes Jahr bringt auf dem Gebiete der Weberei, Spinnerei, Färberei und Druckerei unerwartete und folgenreiche Erfindungen der Mechanik und Chemie. Bei einer Wanderung durch die Werkstätten der großen Industriellen finden wir sie alle wieder. Wie kostspielig auch die Einführung der neuen oder verbesserten Maschinen oder Fabrikations-Verfahren sein mag, sie ist eine Notwendigkeit, weil oft durch die geringste Ersparnis an den Herstellungskosten die Konkurrenzfähigkeit des Artikels bedeutend erhöht wird. Die Zahl der in Elberfeld beschäftigten Fabrikarbeiter ist jedenfalls auf 50 000 anzuschlagen; außerdem aber sind meilenweit umher in den größeren und kleineren Ortschaften noch viele Hunderte Weber und Arbeiter für die Elberfelder Fabriken beschäftigt. Obenan steht die Weberei in Wolle und Baumwolle; die Seidenindustrie ist bedeutend, und die Kattundruckerei nimmt eine den Weltmarkt beherrschende Stellung ein. Die Fabrikation der seidenen und mit Seide gemischten Stoffe liefert hauptsächlich Modeartikel; künstlerisch gebildete Kompositeure und Zeichner sind stets beschäftigt, neue Muster in den schönsten Farbenzusammenstellungen zu erfinden und der stets wechselnden Mode Neues zu bieten. Diesen hat denn auch auf den großen Gewerbe-Ausstellungen die Anerkennung nicht entgehen können; wie denn überhaupt viele Fabrikate des Wuppertales durch die zuerkannten Prämien ihre Gleichberechtigung mit den englischen, französischen und schweizerischen vollständig nachgewiesen haben. Ja, wer mit den neuesten Erzeugnissen der Webkunst bekannt ist, kann getrost sagen, daß die Elberfelder Seiden- und Sammetweberei die französische überflügelt hat. – Die Handweberei wird fast nur von Meistern mit Gehilfen in ihren Wohnungen betrieben, und in den entfernteren Teilen der Stadt rasselt daher in meist drei- und mehrstöckigen Häusern durch alle Etagen der Web- und Wirkstuhl. Gestatten wir uns den Besuch einer Werkstätte; wir werden Wunder des Kunstfleißes entstehen sehen. Ein Prachtstoff bildet sich vor unserem Auge langsam auf dem Weberbaume. Auf prächtig himmelblauem Grunde von schwerster Seide entstehen vermittelst der angebrachten Jacquardmaschine prächtige Wappenbilder in leuchtenden Farben, selbst von echten Gold- und Silberfäden gebildet und mit Emblemen und Arabesken umgeben. Es ist ein breiter Stoff, bestimmt, in einem fürstlichen Prunkgemache zu Tapeten und Möbelüberzügen verwendet zu werden. Nebenan, in ebenfalls hohen und lichten Räumen, werden kostbare Tischdecken und Möbelstoffe in prächtigen Mustern aus feinster Wolle gewebt, die nicht selten nach Frankreich gehen, um als echtes Pariser Erzeugnis in die Läden der Großstädte zurückzukehren. Elberfeld ist auch der Mittelpunkt für die Plüschfabrikation. Eines Industriezweiges müssen wir noch besonders erwähnen: der Türkischrot-Färberei, der berühmtesten der Welt, durch Emigranten aus Rouen in Frankreich hierher verpflanzt; die Franzosen hatten das Geheimnis von morgenländischen Industriellen erworben. Diese Färbereien liefern, begünstigt, wie man annimmt, durch besondere Eigenschaften des Wupperwassers, Garne von einem lebhaften, prächtigen und dauerhaften Rot, welche durch ihre ausgezeichnete Qualität selbst nach England und Ostindien bedeutenden Absatz finden.
In letzter Zeit sind zwei neue Fabrikationszweige des Wuppertales zu hoher Blüte gelangt, die Erzeugung der Anilinfarben zur Färberei und Druckerei, die seit wenigen Jahren die Herrschaft auf dem Gebiete der Färbestoffe erlangten; im Anschluß hieran die des Phenacetins und ähnlicher medizinischer Körper, und dann die Herstellung eines neuen Futterstoffes, Zanella, der aus baumwollener Kette und Kammgarneinschlag hergestellt wird. Die chemische Industrie, durch einen Teil ihrer Produkte auf die Textilindustrie hingewiesen, hat sich bereits Weltruf erworben. Die größte Farbenfabrik des Wuppertales beschäftigt allein in Elberfeld mehr als 160 Chemiker und 2400 Arbeiter, d. i. ungefähr 1/25 der Zahl der in der Gesamtindustrie Elberfelds tätigen Fabrikarbeiter.
Der lebhaften Fabrikation entspricht ein über alle Teile der bewohnten Erde sich erstreckender Handel mit den für die Verarbeitung erforderlichen Rohstoffen und den einheimischen Industrieartikeln. In Manufakturwaren besitzt Elberfeld die bedeutendsten Lager innerhalb Deutschlands, und die großen Handelshäuser haben eigene Kontore und Vermittler auf allen größeren Handelsplätzen der Welt. Bei der Menge und Großartigkeit der Fabrik- und Handelsgeschäfte sind die im Ein- und Verkauf umgehenden Geldsummen von enormer Bedeutung. Von den zahlreichen angesehenen Bankinstituten hatte die Reichsbankstelle im Jahre 1903 einen Gesamtumsatz von 2387 Mill. Mark, während die Bergisch-Märkische Bank 1907 einen Umsatz von 9523 Mill. Mark aufzuweisen hatte. Über 50 Mill. Mark werden jährlich beim Hauptpostamt mit seinen sechs Nebenstellen auf Postanweisungen ein- und mehr als 70 Mill. Mark ausgezahlt. Ein Fernsprechnetz mit ca. 3000 Sprechstellen und weit über 100 Verbindungsanlagen nach anderen Orten sucht den Ansprüchen des Handels und Verkehrs zu genügen.
Aber auch die äußeren Verkehrsverhältnisse haben sich außerordentlich vervollkommnet. Die beiden Hauptbahnlinien – die Bergisch-Märkische und die Rheinische Strecke – weisen in den beiden Schwesterstädten allein 13 Bahnhöfe auf, von denen sieben in Elberfeld und sechs in Barmen liegen. Mehrere elektrische Straßenbahnen vermitteln den Personenverkehr innerhalb der beiden Städte, während die Verbindung zwischen ihnen – außer durch die Eisenbahn – durch eine seit 1896 elektrisch betriebene Straßenbahn hergestellt war. Seit 1903 ist ein neuer Schienenweg hinzugetreten, ein wahres Wunder der modernen Eisenbahntechnik, die zweigleisige Hochbahn Barmen – Elberfeld – Vohwinkel, die erste öffentliche Schwebebahn für Personenverkehr. In einer Länge von 13,3 km schlängelt sie sich zum größten Teil über der Wupper dahin und vermag infolge ihrer vorzüglichen Einrichtungen in einer Stunde je 6000 Personen nach beiden Richtungen zu befördern; im Jahre 1907 wurde sie von 12 Mill. Fahrgästen benutzt. – Kehren wir in einem Schwebebahnwagen zurück nach Rittershausen! Auch hier dasselbe Bild des riesigen Aufschwunges! Der früher winzige Bahnhof Barmen-Rittershausen, welcher die in das Bergische Reisenden zu einem mehrere Minuten währenden Marsche durch die Stadt zwang, um auf das nach Ronsdorf – Lennep – Remscheid führende Geleise zu gelangen, ist jetzt ein wichtiger Zentralpunkt geworden. Die hierfür geschaffenen Anlagen – Tunnels und Brücken – sind wahrhaft großartig. Sie stehen in Beziehung zu der Linie Barmen – Rittershausen – Hattingen, die ebenfalls, wie die Bahn Vohwinkel – Kupferdreh, das Bergische Land direkt mit dem Ruhrkohlengebiet verbindet. Einen ungeheuren Fortschritt hat der Verkehr mit der Nachbarschaft gemacht. Eine elektrische Bergbahn führt, an den berühmten Barmer »Anlagen« vorbei, zum Toelle-Turm, dessen früher wenig besuchte Umgebung, zu Luftkurstätten umgewandelt, jetzt einen beliebten Ausflugsort nicht nur für die Wuppertaler, sondern auch für die weiteren Bewohner des Bergischen Landes bildet und durch die Verbindung mit Ronsdorf (Schmalspurbahn) noch wesentlich gewonnen hat.
Rüsten wir uns nun zu einem Besuche des Gebietes der Eisen- und Stahlwarenfabrikation. Von Station Rittershausen winden sich die beiden Bahnen in weiten Bogenlinien aufwärts, um auf 17 km Strecke eine Steigung von stellenweise 1:40 m zu überwinden und die Höhen des Bergischen Landes zu gewinnen. Nach etwa 30 Minuten Fahrt erreichen wir Ronsdorf mit bedeutenden Band-, Litzen- und Agrementsfabriken. Die Stadt wurde zu Anfang des 18. Jahrhunderts von einer religiösen Sekte des Wuppertales gegründet und ist rasch emporgeblüht. Im Jahre 1729 noch aus vier Bauernhöfen und neun Wohnhäusern bestehend, zählt sie jetzt über 14 000 Einwohner. Als Gründer Ronsdorfs wird Elias Eller genannt, der Stifter der Sekte der Ellerianer oder Zioniten. Dieser gründete auch 1737 die erste Fabrik, zog Kolonisten herbei und legte so den Grund zur heutigen regen Industrie der Stadt, die sich um ihren schönen Marktplatz herumgruppiert. Zu der Verbindung mit Barmen über Rittershausen ist noch jüngst die über den Toelleturm getreten, den wir gelegentlich der elektrischen Barmer Bergbahn erwähnten, die dann andererseits nach Müngsten, einem lieblich an der Wupper gelegenen Orte, führt. – Weiter auf Lennep zu geht's nach Lüttringhausen mit etwa 12 000 Einwohnern, in dessen Umgebungen Weberei, Eisen- und Stahlwarenfabrikation betrieben wird. Links, auf einem höheren Gebirgsrücken, liegt das alte Rade vorm Wald, Sitz bedeutender Schloßfabriken und Strumpfwirkereien. Nach wenigen Minuten sind wir in »Station Lennep«, und von der Höhe des Bahnhofes aus liegt die Stadt in einem Talkessel zu unseren Füßen. Wie die meisten alten Städte ist sie unregelmäßig gebaut, aber auf den abgetragenen Stadtwällen liegen reihenweise die Wohnsitze der Großfabrikanten, von schönen Gärten umgeben. Lennep und das benachbarte Hückeswagen sind der Sitz der alten Bergischen Tuchmanufaktur. Die in großartigem Stile erbauten Fabrikanlagen liegen fast sämtlich an der Wupper und umfassen Spinnerei, Weberei, Färberei und die Walk- und Appreturanstalten. Auch in neuerer Zeit hat man bedeutende Fabriken in der Stadt selbst angelegt, unter denen die Kammgarnspinnerei von Johann Wülfing & Sohn den ersten Rang einnimmt. Die zahlreiche Arbeiterbevölkerung ist in vielen Ortschaften in der Nähe der Fabriken angesiedelt. Der jährliche Verbrauch an Wolle, die hauptsächlich Schlesien, Australien und Laplata liefern, wird zu 40-45 000 Zentnern im Werte von mindestens 14 Mill. Mark angenommen. Es werden von diesem Quantum etwa 34 000 Zentner zu feinen Tuchen und Buckskins verarbeitet, 1800 Zentner zu Streichgarn versponnen, teils an die anderen rheinischen Fabriken, teils nach Frankreich und Belgien abgesetzt. Die Streich- und Halbwollgarnspinnereien beschäftigen etwa 41 000 Feinspindeln, die Kammgarnspinnerei 35 000 Spindeln, sie liefert Garn von Nr. 40-80, d. h. 40-80 000 m das Kilo. An größtenteils feinen Tuchen und Buckskins, hauptsächlich für den amerikanischen Markt bestimmt, liefern die Fabriken etwa 50 000 Stück im Werte von 12 Mill. Mark. – In wenigen Minuten hält der Bahnzug in Remscheid, und wir betreten nun das Gebiet der Bergischen Werkzeugfabrikation. Doch halten wir vorab eine Rundschau von der Scheiderhöhe, auf welcher Remscheid teilweise gelegen ist. Welch ein prachtvolles Panorama bietet sich hier, wenn man den Blick südlich richtet, dem erstaunten Auge dar! Meilenweit alle Höhenzüge mit größeren und kleineren Fabrikdörfern und Ortschaften gleichsam besät, unter denen Solingen, Kronenberg und Wermelskirchen besonders hervorragen. Unwillkürlich aber schweift der Blick bald über die belebten Höhen hinweg in die Rheinebene, wo das vielgetürmte Köln an Deutschlands schönstem Strom sich hinzieht. Aus der Häusermasse erhebt der alte weltberühmte Dom seine wuchtige Gestalt, und das bewaffnete Auge erkennt bald die mächtigen Türme, die bis zu einer Höhe von 157 m emporsteigen. An mehreren Stellen blinkt der Silberspiegel des Rheins in der fruchtbaren Ebene. Weiter links begrüßen uns die bläulichen Kuppen des romantischen Siebengebirges. Der Hintergrund des unvergleichlichen Bildes wird von den Höhenzügen des Eifelgebirges geschlossen, während der Blick nach rechts in die große Fruchtebene des Jülicherlandes sich verliert. So übersieht unser Auge von einem Punkte, etwa 380 m über dem Meeresspiegel, ein herrliches Gebiet mannigfaltiger Kultur der heimatlichen Erde, das keinem Herzogtum nachstehen dürfte und von Hunderttausenden von Menschen bewohnt wird.
Remscheid, mit etwa 70 000 Einwohnern, dehnt sich über mehrere Höhenrücken aus und besteht außer dem Orte Remscheid aus zahlreichen Ortschaften, in denen überall die Dampfschlote emporsteigen, die Esse glüht, der Hammer dröhnt und Drehbank und Feile surren, um nicht weniger als etwa 900 Arten von Werkzeugen aus Eisen und Stahl herzustellen. Mit diesen Waren versorgt Remscheid nicht allein Deutschland und die Staaten des Kontinents, sondern auch die Märkte der fernsten Weltteile, und sie haben seinen Namen dort bekannter gemacht als manche Residenzen unseres Vaterlandes den ihrigen. Auch vertreiben die Remscheider Kaufleute massenhaft Waren anderer Städte nach dem Ausland, und man schätzt den so erreichten Export der Remscheider Häuser nicht viel geringer als den der Stadt Bremen. – Die Werkzeugfabrikation wird teils in größeren Fabriken, größtenteils aber in zahlreichen Werkstätten von selbständigen Meistern betrieben. Die Hauptfabrikate sind Feilen, Sägen, Meißel und Hobeleisen, dann folgen Bohrer, Kluppen, Ambosse, Klempnerwerkzeuge, Wagenschlösser, Schlittschuhe, Zangen und Zängelchen, Schlösser, Winden, Scharniere und eine große Zahl anderer Artikel. Nach einer statistischen Erhebung vom Jahre 1899 umfaßte die Remscheider Industrie 382 Exportgeschäfte für Eisen- und Stahlwaren, 256 Werkzeugfabrikanten, 153 Sägen- und Papiermesserfabrikanten, 151 Feilenfabriken, 804 Feilenhauer, 140 Bohrfabrikanten, 31 Agenten für Eisen- und Stahlwaren, 5 Amboßschmiede, 53 Beitel- und Hobeleisenfabrikanten, 26 Blechscherenfabriken, 12 Eisen- und Stahlgießereien, 26 Schlittschuhfabriken, 52 Hammerwerke, 43 Grobschmiede, 73 Kluppenschmiede, 167 Schleifereibesitzer, 47 Schlosser, 10 Schloß- und Schlüsselfabrikanten, 6 Tempereien, 2 Vernicklungsanstalten, 10 Verzinkereien, 10 Walzwerke, 4 Fabriken für Wellblech- und Eisenkonstruktionen, 14 Windenschmiede. Zu diesen 1059 Fabriken für Eisen- und Stahlwaren kommt die Textilindustrie mit 4 Seidenbandfabriken.
Mit der Erfindung des Dampfhammers und der Kaliberwalze ist die Werkzeugschmiederei in den letzten Jahrzehnten in ein neues Stadium getreten und die Handarbeit in den Werkstätten so vermindert worden, daß Hammer, Feile und Drehbank nun weit leichtere Arbeit haben. Blicken wir einmal in eine Werkstätte, in der Feuer und Hammer die Hauptrolle spielen. Es ist eine moderne Werkstatt Vulkans, in die wir uns versetzt sehen. Den schweren Dampfhammer, an der senkrechten Kolbenstange eines Dampfzylinders auf- und abgehend, sehen wir in verschiedenen Größen und Abstufungen in Wirksamkeit. Mittels einer sinnreichen Steuerung hat der Schmied den Hammer vollkommen in seiner Gewalt; es bedarf kaum einer Bewegung seines Kopfes, und der Mann an der Steuerung läßt ihn bald langsam und bedächtig, bald mit hohem Hub und voller Schwere arbeiten, jeden Augenblick die Bewegung unterbrechen oder beginnen. Hier werden die schweren Stahlkolben zu bald größeren, bald kleineren Stangen verarbeitet, um dann unter der Walze oder den leichteren Reckhämmern weiter ihren Zwecken zugeführt zu werden. Besuchen wir auch das Walzwerk nebenan. Von der Gewalt des Dampfes getrieben, sehen wir eine Reihe Doppelwalzen in rasender Schnelligkeit sich um ihre Achsen bewegen. An ihrer Oberfläche bemerken wir Vertiefungen mancher Art. Der Zweck wird uns bald klar. Glühende Stangen, von den Walzen erfaßt, laufen durch die Rillen hin und her unter gewaltigem Druck, bis sie die Gestalt angenommen, deren der Schmied bedarf, sei es mit oblongem oder quadratischem, dreieckigem oder halbrundem Querschnitt. Ein kleiner Hammer, der bald langsamer, bald mit rasender Schnelligkeit bis zu 400 Schlägen in der Minute arbeitet, liefert runde Stangen in einer Vollkommenheit, daß sie kaum noch der Weiterbearbeitung bedürfen. Neuerdings wird auch der Fallhammer, zwischen zwei senkrechten Schienen sich bewegend, zum Schmieden in Gesenken, d. h. stählernen Formen, die in Amboß und Hammer angebracht sind, verwendet, um die für die Handschmiederei schwierigen Gegenstände herzustellen. Ihm zur Seite geht die Temperei, ein Verfahren, das die schwierigsten Formen in weichem Eisen herzustellen gestattet. So haben auch auf diesem Gebiete der Industrie die Erfindungen der Mechanik und Metallurgie eine Produktion ermöglicht, die nach Menge und Güte früher zu den Unmöglichkeiten gerechnet wurde. – Aber auch der Freund der Natur wird sich reich belohnt finden, wenn er von Remscheids Höhen in die tiefen Täler des Esch- und Morsbaches, die sich stundenlang an den Grenzen Remscheids hinziehen, auf überall gangbaren Wegen hinabsteigt. Sie bieten mit ihren malerischen Felsenpartien, klaren Bergwassern und schönen Wiesengründen bei jeder Windung neue überraschende Ansichten und erinnern lebhaft an die Vorberge Tirols. Hier reiht sich bei dem starken Gefälle der Bäche fast ein Wasserspiegel an den andern, um das Element dem Gewerbe dienstbar zu machen. Überall widerhallt das Getöse der Hammerwerke und erinnert unwillkürlich an Schillers treffliche Schilderung im Gang nach dem Eisenhammer. Diesen in den Tälern befindlichen Wasserwerken, die einst die Grundlage der Remscheider Industrie bildeten, ist neuerdings eine Hilfe geschaffen worden, die jene wieder zu hoher Bedeutung gelangen ließ. Es ist die Remscheider Talsperre im Eschbachtale. Durch eine mächtige Mauer von 21 m Höhe, oben 4 und unten 14 m Dicke, wird das Tal abgeschlossen und so ein Becken geschaffen, das eine Million Kubikmeter faßt. Dieses Becken soll in erster Linie die Stadt Remscheid mit Wasser versorgen, aus welchem Grund mächtige Pumpwerke mit der Anlage verbunden sind, die 4500 cbm zum Teil auf eine Höhe von 170 m zu schaffen imstande sind. Dann aber auch liefert die Sperre den unterhalb liegenden Werken täglich 6000 cbm Wasser zum Betriebe, unabhängig von trockener Zeit und gesichert gegen Übermaß. Die Eschbach-Talsperre war das Muster der zahlreichen ähnlichen Anlagen im »Bergischen Lande«, unter denen sie hinsichtlich der Größe heute erst den fünften Platz einnimmt. Die größte der Bergischen Talsperren, die Ennepesperre, faßt 10 Mill. cbm Wasser. Aber Remscheid ist auf dem Gebiet der Wasserversorgung nicht zurückgeblieben. Eine zweite Sperre im Neyetal bei Wipperfürth, deren Becken 6 Mill. cbm faßt, ist durch eine zum großen Teil in einem langen Stollen geborgene Röhrenleitung mit der Eschbach-Talsperre verbunden worden, wodurch die Stadt voraussichtlich für lange Zeit vor Wassermangel geschützt ist. Wurde damit zugleich den Industriellen der Täler eine wertvolle Hilfe geschaffen, so war man auch auf andere Weise bemüht, die so wichtige und weitgreifende Werkzeugindustrie zu heben. Hierzu dient ein Institut, das in ganz Deutschland und darüber hinaus nicht seinesgleichen hat: die Fachschule mit ihren Lehrwerkstätten. Gegründet im Jahre 1882, hat sie sich nunmehr zu einer Anstalt entwickelt, die auf theoretischem Gebiete als technische Mittelschule den neuesten und weitestgehenden Ansprüchen genügt und dazu eine gründliche Ausbildung in allen Zweigen der Handfertigkeit erteilt. Die Schüler lernen in erster Linie feilen, schmieden und drehen; ferner, als mit zur Technik der Maschinenindustrie gehörend, Holzdrehen, Tischlerei, Klempnerei, Schleifen und Polieren, Feilenhauen, Galvanisieren; endlich erhalten sie einen gründlichen Unterricht im Formen, Gießen und Tempern, sowie im Gebrauch des Fallhammers zum Schlagen. Nebenher lernen sie noch den Kessel und die Maschine bedienen, die von den Schülern abwechselnd gewartet werden. So erteilt die Remscheider Fachschule einen Unterricht, wie er vielseitiger und vollkommener nicht gedacht werden kann.
Von Remscheids Höhen winkt uns, auf einem niedrigen Höhenzuge sich hinziehend, das benachbarte Solingen; es kündigt sich durch seine zahlreichen Dampfessen gleich als eine bedeutende Fabrikstadt an. Diese Stadt und die Nachbarorte Wald, Ohligs, Höhscheid und Gräfrath, mit einer Gesamtbevölkerung von etwa 120 000 Seelen, bilden den Fabrikdistrikt der sogenannten »Solinger Waren«. Der Fabrikation der blanken Waffen, die schon im 13. Jahrhundert in hoher Blüte stand, folgte später die Herstellung der Messer und Scheren. Die Waffenfabrikation liefert alle Arten Klingen mit ihren Zutaten: Säbel, Degen, Hirschfänger, Dolche, Bajonette, Lanzenspitzen, vom sogenannten Dulheuer (Plantagenmesser) bis zur fürstlichen Prachtklinge im Preise von 800-1000 Mark. Die kostbaren Klingen werden aus dem feinsten Gußstahl verfertigt und erreichen die berühmten Toledoklingen Spaniens an außerordentlicher Biegsamkeit, Härte und Schärfe, ja sie wandern in damaszierter, atlas- und wellenförmiger Bearbeitung nach dem Orient, um sich dort, mit Rubinen, Türkisen und anderen Edelsteinen bekleidet, mit echten Damaszenerklingen – und nicht zum Nachteil des Käufers – verwechseln zu lassen. Solingen versorgt bereits mit blanken Waffen fast alle Armeen der Welt, selbst die Frankreichs und Englands, und vermag nötigenfalls 800 000 Stück jährlich fertigzustellen. Die Lieferung der Waffen geschieht auf Kontrakte mit den Kriegsministerien, die fast beständig Offiziere kommissarisch in Solingen halten, um jede einzelne Waffe in bezug auf Härte und Elastizität der stärksten Probe zu unterwerfen. In die Beschäftigungen der Klingenfabrikation teilen sich der Hammerschmied, der den Stahl nach Gewicht und Größe liefert, der Klingenschmied, Härter, Schleifer, Ätzer und Vergolder für die Verzierungen auf den Klingen, der Damaszierer, Scheidenmacher, Gefäßmacher und Montierer, der die Waffe vollständig fertigstellt. Wenngleich die Schwertfegerei die älteste, so hat doch im Laufe der Zeit die Herstellung der Schneidewaren im engeren Sinne, der Tafel-, Küchen-, Taschen-, Feder-, Garten-, Rasier- und chirurgischen Messer, der Gabeln in ihren unendlichen Abstufungen nach Zweck, Größe, Form und Politur, jene an Umfang und Bedeutung weit überflügelt. Der Wert der Messerware ist sehr verschieden. Tafelbestecke sind das Dutzend Paar von 1,20 Mark bis 120 Mark, einzelne Messer von 10 Pfennig bis zu 50 Mark zu haben. Auch in diesem Zweige der Industrie findet die Arbeitsteilung in ausgedehntem Maße statt. Jeder Arbeiter ist auf eine einfache, mehr oder minder schwierige Leistung eingeübt, verrichtet diese dann aber schnell, vorzüglich und billig. Die sogenannten »Fertigmacher«, welche die letzte Hand an die Waren legen und sie nach Güte und Ausführung kontrollieren, sind die Mittelspersonen zwischen den Arbeitern und Kaufleuten, von denen sie die Bestellungen erhalten. Die Fabrikation der Scheren, die erst im vorigen Jahrhundert eingeführt wurde, liefert diese in allen Formen und Qualitäten; die gewöhnlichen Sorten werden in Tempereisen hergestellt. Die Schleif- und Polierwerkstätten, durch Wasser, Dampf oder Elektrizität getrieben, beschäftigen Tausende von Arbeitern. Um den Unterbrechungen möglichst zu begegnen, die mit der Waffenfabrikation notwendig verbunden sind, hat man mit Glück in neuerer Zeit der Herstellung von Revolvern und Luxus-Stahlwaren sich bemächtigt, zu denen täglich neue Artikel hinzutreten. Außer den Gegenständen der Hauptindustrien werden noch stählerne Regen- und Sonnenschirmgestelle, Helme und Kürasse, Geld-, Reise- und Zigarrentaschenbügel sowie eine Anzahl kleinerer Artikel in großer Menge hergestellt und finden überall ihren Markt. Bemerken wollen wir noch, daß die Gewerbe von Remscheid und Solingen in ergänzender Wechselwirkung stehen, indem die Remscheider Kaufleute sowohl Solinger als die Solinger Häuser Remscheider Artikel führen. Die bedeutendsten Geschäftshäuser des Wuppertals, sowie die in Remscheid und Solingen haben eigene Kontore oder Geschäftsagenten in allen Haupthandelsplätzen der Welt. Nach langem Ringen ist es denn nun auch gelungen, die Verbindung der beiden Schwesterstädte durch eine Bahn ins Werk zu setzen, obwohl das tief eingeschnittene Wuppertal ganz außerordentliche Schwierigkeiten bereitete. Die Brücke ist einer der größten Viadukte des Kontinents und erhebt sich 107 m über dem Wupperspiegel bei einer Spannweite von 170 und einer Länge von 500 m.
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Elberfeld nahe gelegene Velbert mit seiner Schloßfabrikation so sehr gehoben, daß es in seinen nahezu tausend größeren und kleineren Werkstätten jährlich etwa eine Million Schlösser in allen Größen liefert. Ebenso gewinnt Kronenberg – gegenüber Remscheid – sehr an Bedeutung. Namentlich die groben Schmiedewaren – Äxte, Beile, Hackmesser, Maschinenmesser – werden hier erzeugt.
Ist das Leben und Treiben in allen Orten des Bergischen Landes auch überwiegend dem materiellen Erwerb und Handel zugewendet, so bleiben doch auch Kunst und Wissenschaft nicht ohne die gebührende Anerkennung und Teilnahme. Insbesondere genießt die Musik, die Verschönerin des Lebens, einer ausgezeichneten Pflege, und jeder Winter bietet Gelegenheit, die Werke unserer großen Tonmeister in trefflicher Ausführung zu genießen. Eine besondere Erwähnung verdient hier das prächtige neue Theatergebäude in Elberfeld. Die Sangeslust auf den Bergischen Höhen findet in zahlreichen Vereinen, selbst in den kleinsten Orten, ihren Ausdruck. Auch hat das Bergische Land – abgesehen von einer großen Zahl intelligenter Kaufleute und Industrieller – eine nicht geringe Zahl Träger berühmter Namen aufzuweisen. Die Dichter Karl Siebel, Emil Rittershaus, A. Schults, Fastenrath, Röber usw. sind Söhne des Wuppertales, und die Maler Seel, Hasenclever, Köttgen haben das Bergische ebenfalls zur Heimat. Unter der Zahl bedeutender Techniker wollen wir nur den Geh. Admiralitätsrat Elbertzhagen nennen, der in Remscheid geboren wurde, und Alexander von der Nahmer, der als Gründer der »Bergischen Stahlindustrie« sich einen großen Ruf erworben hat.
Originalbericht 1909.
Wer sich, von Düsseldorf kommend, auf der kürzeren Bahnstrecke über Kettwig von Süden her dem Herzen des Rheinisch-Westfälischen Kohlengebietes, insbesondere der Stadt Essen, nähert, wird in der Landschaft die Anzeichen der Industriegebiete: Mangel an Pflanzengrün, dunstige, rauchgeschwängerte Luft und Kohlenstaub vermissen. Im Gegenteil, er wird, besonders von Kettwig an, längs der Ruhr durch freundliche Wiesengründe zwischen schön bewaldeten, in weichen Linien zu beiden Ufern ansteigenden Hügeln hindurchgeführt. Hinter Werden verläßt der Zug das Ruhrufer und arbeitet sich keuchend in scharfer Steigung einen Hügel hinauf. Oben angekommen, hält er auf einem hübschen, zierlich in buntem Holzwerk gehaltenen kleinen Bahnhof, »Station Hügel«. Unser Auge wird angezogen durch die bunte Fülle der an einer hohen Mauer emporrankenden Blumen, und durch ein breites Gittertor ist uns flüchtiger Einblick auf wohlgepflegte Kieswege, Gebüsche und Rasenflächen gestattet. Während der Zug sich aus der Station bewegt, sehen wir hinter Buschwerk allmählich die Form eines massiven, grauen Sandsteinbaues emporsteigen, Wirtschaftsbauten werden sichtbar, das ist »Villa Hügel«, die Residenz der Familie Krupp. Auf waldiger Höhe, fern von der Unruhe seiner Fabrik, hat Alfred Krupp 1870 hier seinen Wohnsitz aufgeschlagen. Von hier ritt er allmorgendlich zu seinen Werken dort unten bei Essen hinab, zu denen auch unsere Gedanken uns nun voraneilen.
Weitere 10 Minuten bringen uns in die Nähe der Stadt, die Häuserreihen werden dichter, aber auch hier bleibt das Bild freundlich, wir sehen vorwiegend hübsch in Grün gebettete Villen. Also auch hier vor den Toren Essens nichts von Ruß, Dunst und rauchgeschwärzten Dächern. Beim Aussteigen freilich zeigt uns die Menschenfülle auf den Bahnsteigen und im Ausgangstunnel und mehr noch das Treiben auf dem freien Platze vor dem Bahnhofsgebäude, daß wir uns in der Großstadt befinden. Mit seinen 275 000 Einwohnern nimmt Essen heute die 15. Stelle im Deutschen Reiche ein. Hohe Bauten, Straßenbahnen, Automobile erhöhen den Eindruck einer Stadt mit rege pulsierendem Leben.
In den Straßenzug rechts nach Norden abschwenkend, dringen wir in das Innere der Altstadt vor, bis wir uns auf dem »Markt« am Rathause befinden. Dieser anspruchslose Platz, auf den enge Gassen von allen Seiten einmünden, die schlichte alte Marktkirche im Hintergrunde, vereinzelte altmodische Giebelhäuser in Fachwerk, die aus den Gassen ringsum hervorlugen, lassen »Alt-Essen« in der Erinnerung aufleben. Als der Mann, dem »die dankbare Stadt« inmitten des Marktes ein ehern Standbild setzte, als 1812 Alfred Krupp geboren wurde, zählte es nicht ganz 4000 Seelen.
Wenn wir uns nun durch eine der Seitengassen westwärts schlagen, finden wir uns wieder auf einer sehr belebten Straße, in der alle modernen Kaufhäuser Essens sich Stelldichein gegeben zu haben scheinen. Aber zwischen den hohen Glas- und Eisenbauten, die abends in blendender Helle strahlen, steht gedrückt, wie aus alter Zeit vergessen, auch hier noch manches hinfällig geneigte Häuslein, den Gegensatz von Heute und Einst grell beleuchtend. Zweihundert Schritte die Straße abwärts ändert sich das Bild schnell, die Läden werden spärlicher und dürftig, bald hören sie ganz auf. Die Straße weitet sich, und der Blick verliert sich in eine Flucht rauchgeschwärzter Backsteinbauten; aus einer weithin über dem Ganzen ausgebreiteten Dunstwolke heben sich unbestimmt aufstrebende dunkle Umrisse ab. Wir stehen an der Grenze des Gebietes der Kruppschen Gußstahlfabrik.
Zur Linken öffnet sich ein kleiner freier Platz um ein Denkmal. Auf hohem Postament steht straff aufgerichtet die Gestalt Alfred Krupps, zu den Füßen rechts und links zwei Figuren, das Lebenswerk des oben stehenden Fabrikherrn symbolisierend. Auf der einen Seite erinnert ein Arbeiter mit Eisenbahnrad und Kanone an die Erzeugnisse, die den Kruppschen Werken vorwiegend zu Ruhm und Reichtum verhalfen; auf der anderen deutet eine trauernde Witwe mit einem Kinde auf die Fürsorge Krupps für die Hinterbliebenen seiner Arbeiter. Die Frau weist das Kind auf ein vor ihr aufgeschlagenes Buch, auf dessen Seiten die Worte eingegraben stehen: »Edel sei der Mensch, hilfreich und gut«. Der Sockel trägt die Inschrift: »Der Zweck der Arbeit soll das Gemeinwohl sein«. Hier am Eingange seiner Schöpfung haben die Angehörigen des Werkes im Jahre 1892 ihrem verstorbenen Fabrikherrn dieses Standbild errichtet. Den Blick geradeaus gerichtet, überschaut er das vor ihm ausgebreitete Werk.
Weit draußen »vor den Toren« lag damals, als durch des Vaters Tod die Sorge für Mutter und Geschwister und die Fortführung der Fabrik auf die noch so jungen Schultern des vierzehnjährigen Alfred gelegt wurden, die bescheidene Stahlschmelzerei. Zuerst langsam, sehr langsam, später immer schneller sah er die Bauten und Anlagen sich weiten, bis sie endlich ostwärts an die Stadt herangewachsen waren, wodurch ihnen nach dieser Seite hin Halt geboten wurde. Aber im Westen und auch im Norden und Süden war noch Raum. Dorthinaus hat sich denn auch nach Alfreds Tode unaufhaltsam und in steigendem Maße die Fabrik ausgedehnt, ins Gigantische wachsend, nicht nur in ihrer Flächenausbreitung, sondern auch in der Weite und Höhe der einzelnen Bauten. Gleich die zu unserer Linken, an der Seite des Denkmals aufragende Werkstatt, ein Produkt der jüngeren Ära, spricht von der Kühnheit und dem Schwung moderner technischer Bauten. Mit einer Längsseite von über 100 m an die Straßenflucht gelehnt, erhebt sich die Fassade zu etwa 22 m Höhe. Freundlich durch Gliederung belebt, zwischen flachen Pilastern breite Verglasungen zeigend, läßt der leicht und gefällig aufstrebende Kolossalbau kaum ahnen, daß in seinem Innern die schwersten Werkstücke bearbeitet werden. Gußstücke wie Steven, Ruderrahmen, Maschinenständer von 30, 40 und mehr Tonnen Gewicht, Schmiedestücke wie Schiffswellen ebenso hoher Gewichte erhalten hier ihre endgültige Form. Laufkräne bestreichen die zum Dach hinaufreichende 22 m breite Mittelhalle und heben die Stücke spielend von den in die Halle einfahrenden Eisenbahnwagen auf die dort aufgestellten schweren Hobel- und Drehbänke, und umgekehrt die fertigen wieder auf die Wagen, während in den Seitenschiffen und den darüber befindlichen Galerien Hunderte von kleineren Bearbeitungsmaschinen summen. Das sonst Werkstätten eigentümliche Bild, ein Wirrsal von kreuz- und querlaufenden surrenden Treibriemen, fehlt hier. Jede der größeren Werkzeugmaschinen – und es sind ganz gewaltige darunter, wir nennen nur eine Bohrbank von 46 m Länge – hat eigene elektrische Antriebsmotore. Nur die kleineren erhalten gruppenweise Antrieb durch einen gemeinsamen Motor. Für den Antrieb der Kräne und Maschinen sind hier insgesamt etwa 90 Motore mit zusammen 1400 Pferdestärken vorhanden.
So stark nun der Gegensatz zwischen den niederen, bescheidenen Werkstätten älterer Zeit und der eben geschilderten Arbeitsstätte ist, so erheblich tritt diese in den Abmessungen und der Leichtigkeit des Aufbaues wieder hinter den Konstruktionen aus allerjüngster Zeit zurück, die sich auf dem südwestlichen Gelände erheben und deren Hallen an Größe selbst die des Frankfurter Bahnhofes hinter sich lassen.
Doch suchen wir zunächst von der gerade vor uns sich hinbreitenden »Gußstahlfabrik« einmal eine Vorstellung im großen zu gewinnen. Leider gestatten es die topographischen Verhältnisse Essens und seiner Umgebung nicht, von einem erhöhten Standpunkte aus das ganze Werk zu überblicken. Nehmen wir also den Plan zur Hand und stellen unseren Standpunkt fest. Die Straße, auf der wir uns befinden, durchquert die Fabrik von Osten nach Westen. Mit leichter Abschwenkung nach Südwesten verläuft, etwas weiter südlich ansetzend, eine zweite. Beide öffentlichen Straßen teilen also das ganze Werksgebiet gewissermaßen in drei Streifen. Wenn wir nun auf unserer Straße ins Innere des Gebäudemeeres vordringen, so haben wir zur Rechten den eben umschriebenen nördlichen Streifen. Auf diesem befinden sich, besonders nach der Stadt Essen zu, vornehmlich ältere Anlagen, Schmieden, Walzwerke, ein Bessemerwerk und auch das Gebäude des Hammers »Fritz«. Auf unserer Linken, also auf der Nordseite des mittleren Streifens, folgen dem eingangs beschriebenen mächtigen Bau der mechanischen Werkstatt eine Reihe weniger bedeutender Bauten. Die hier liegende große Eisengießerei und die ausgedehnten Martinwerke reichen nicht bis an die Straße heran. Die Länge der Straße von unserem Ausgangspunkt bis zum anderen Ende des Geländes, also quer durch das Werk hindurch, beträgt mehr als 1? km, ungefähr in derselben Ausdehnung erstreckt sich die Anlage von ihrer Nord- bis zur Südgrenze; rund 2 Millionen qm oder 2 qkm mißt das ganze von den Anlagen der Gußstahlfabrik allmählich überflutete Gebiet.
Während wir so vorwärtsschreiten, bewegen wir uns wie zwischen zwei hohen Zäunen von Gebäuden und den sie verbindenden Mauern, die abweisend uns entgegenstehen. Zu unseren Häupten spinnt sich über die Straße hinweg ein Netz von Drähten und Röhren aller Art und von teilweise mächtigem Umfange. Wie das Gezweige des Adersystems im körperlichen Organismus das Blut, so tragen jene Drähte und Röhren in ihrem Innern die kraftspendenden Agentien: Strom, Gas, Dampf, Preßluft hinüber und herüber. Schienenstränge, über Kopf oder zu ebener Erde, überqueren die Straße, und kleine Lokomotiven schleppen pustend und schnaufend schwer mit Stahlblöcken oder Werkstücken beladene Züge darüber hin; so schwer sind ihre Lasten, daß die Erde unter der Wucht erzittert. Oder sind es die dumpf herüberhallenden Schläge des Hammers »Fritz«, die sie erbeben machen? Doch wir haben nicht Zeit, den einzelnen Eindrücken nachzuhängen; es sind ihrer so viele, immer wechselnde, neue. Es herrscht zwar nicht eigentlich ein bewegtes Leben auf der Straße, Menschen sind verhältnismäßig wenig zu sehen. Auch fehlt das Gedränge, der betäubende Lärm, der uns in Verkehrszentren einer Großstadt die Sinne befängt. Aber hier zwischen diesen abschließenden Mauern, die uns quer durch die gigantische Schmiede führen, und deren wenige Pforten uns nur flüchtige Einblicke gestatten, verwirrt uns die sich aufdrängende Ahnung der Macht, die da um uns wirkt und schafft. Über und um uns hören wir ein dumpfes Stampfen, Pochen und Rauschen. Hinter den Mauern hervor sehen wir plötzlich Feuerschein aufleuchten, Funkenregen aus Dächern sprühen, Ballen weißer Wasserdämpfe aus Hunderten von Röhren und Schornsteinen mit roten, braunen und schwarzen Dämpfen sich schieben und mengen. Wir stehen hier gebannt wie etwa vor den unheimlich im Schoße der Erde gärenden Kräften eines Vulkans. Da, ein langer schriller Ton reißt uns wieder in die Wirklichkeit zurück, es ist der langanhaltende Pfiff einer Sirene, der die Mittagspause ankündigt. In wenigen Minuten ist das Straßenbild gänzlich verändert. Die Tore haben sich geöffnet, in hellen Scharen enteilen ihnen die Arbeiter und mengen sich in den schnell anwachsenden Strom, der sich unsere Straße hinabwälzt. Wir treten zur Seite. Wie eine Erlösung nach dem Druck des Unheimlichen empfinden wir diesen Ausbruch frischen Lebens. Und in der Tat erfrischend ist der Anblick dieser Hunderten, ja Tausenden schmucker, sauber gekleideter, rüstig und fröhlich dem Heime zuschreitender Männer, erfrischend das Leuchten des Selbstbewußtseins, der Intelligenz auf den Stirnen, nichts von einer niederziehenden, verrohenden Wirkung der Arbeit. Maschinen haben mehr und mehr die brutale Kraftleistung dem Menschen abgenommen und so seine Tätigkeit sozusagen vergeistigt. Aber auch ein Gefühl der Ehrfurcht flößen die vorüberziehenden Scharen ein, wir fühlen uns in Gegenwart einer Macht, – einer Macht, die, wohlgeleitet, sich und der Allgemeinheit zum höchsten Wohle wirkt, die aber, gewissenlos aufgeregt, für sich und die Öffentlichkeit unsagbares Elend herbeiführen könnte. Zweiunddreißigtausend Mann, nahezu soviel, wie die Infanterieregimenter dreier Armeekorps, helfen durch ihrer Hände Arbeit an den Aufgaben der Kruppschen Gußstahlfabrik mit. Wie wohlbedacht muß die Organisation, die Leitung sein, daß alles zum Wohle des Ganzen so schön zusammenwirkt!
Wir nehmen unsern Weg wieder auf. Nach 700 Schritten von unserem Ausgangspunkt sind wir etwa bis zur Mitte gekommen. Wir sind hier beim »Hauptportier«, der rechts an der Straße den Haupteingang zu dem Verwaltungsgebäude bewacht. Nahe dem Eingang, etwa 100 Schritte von der Straße entfernt, steht das »Stammhaus«, ein schlichtes, einstöckiges, schiefergedecktes Giebelhäuschen. Vor 90 Jahren etwa wurde es zugleich mit der ersten Fabrikanlage erbaut, die Friederich Krupp 1818 von Altenessen, wo er 1811 die Gußstahlfabrik Friederich Krupp begründet hatte, hierher verlegte. Es sollte eine Wohnung für den Schmelzmeister werden. Das Glück wollte Friederich Krupp nicht wohl, sein Unternehmen, die Herstellung des »englischen Gußstahls«, gelang ihm wohl, aber der geschäftliche Gewinn blieb aus, und Vermögen und Gesundheit fielen seinen Bemühungen zum Opfer. So kam es, daß er selbst dieses bescheidene Häuschen beziehen mußte und dort 1826 starb. Alfred, der älteste seiner vier Kinder, war damals 14 Jahre alt. »Die Fabrik«, eine kleine Tiegelstahlschmelzerei, beschäftigte drei Arbeiter; das Anwesen war verschuldet, die Verwandten wollten von den unheilvollen Plänen des Vaters nichts wissen. Mutter und Geschwister blickten auf die Fortführung des Geschäfts als auf das einzige Mittel zum Lebensunterhalt. Das waren die wenig freundlichen Aussichten, unter denen der Knabe die Führung der Fabrik für seine Mutter übernahm. Heute, da das Auge ringsumher auf aufragende Bauten fällt, ist es schwer, sich zu vergegenwärtigen, daß dieses einstöckige Haus und die danebenliegende Schmelzerei damals einsam auf offenem Felde weit vor den Toren der Stadt lagen. Es ist ein langer, mühseliger Weg, auf den wir zurückblicken, der Werdegang dieses Werkes, und wunderbar erscheint der Gedanke, daß weniger als ein Jahrhundert genügt hat, um aus dem winzigen Anfange dieses Riesenwerk, das ringsum sich ausbreitet und dem sich Zechen, Erzgruben und viele Außenwerke angegliedert haben, zu schaffen. Die ersten 25 Jahre Alfred Krupps waren nur ein ganz langsames Fortschreiten, kleine, durch die stete Ausdehnung der Anwendung des Tiegelstahls, zum Beispiel für Walzen, seit 1847 auch für Gewehrläufe und Geschütze, errungene Erfolge, abwechselnd mit Geldnot. Da kam 1851 der glänzende Sieg seines Könnens auf der ersten Londoner Ausstellung, der der Essener Fabrik und dem Namen Krupp mit einem Schlage weitreichendes Ansehen schaffte. Bereits über 100 Arbeiter zählte zu Anfang dieses Jahrzehnts die Fabrik. Zu Anfang des nächsten waren es schon 2000 geworden. Nun hatten sich auch schon manche Bauten um das erste »Gußstahlwerk« gruppiert. Die Schmiede mit dem großen Hammer »Fritz«, der im September 1861 den ersten Schlag führte, war eingeweiht, Pläne zu Walzwerken waren gefaßt und das Bessemerwerk in Angriff genommen worden. Durch die Erfindung, Radkränze aus einem geschlossenen Ring ohne Schweißnaht herzustellen, ebenso wie durch Lieferung von Eisenbahnmaterial aller Art waren der Fabrik mit großen Aufträgen reiche Mittel zugeflossen. Auch hatte Alfred Krupp in seinem Bemühen, den Gußstahl gegen die Bronze als Kanonenmetall durchzusetzen, trotz allen Widerstandes obgesiegt und die erste große Bestellung auf 300 Gußstahlrohre von Preußen erhalten. Eine ganz außerordentliche Ausbreitung bringt das nächste Jahrzehnt. Die Ausstellung in Wien 1873 gibt Anlaß, zu zeigen, was unterdes aus der Essener Gußstahlfabrik geworden. Sie beschäftigt jetzt 12 000 Arbeiter, außerdem aber schon 5000 in den eigenen Kohlenzechen und Erzgruben, die inzwischen erworben worden waren. Gewaltige Schmiede- und Gußteile und Walzprodukte zeigen, welche Fortschritte nach Güte und Menge die Essener Schmieden und Walzwerke gemacht haben. Vollständig hat sich auch das Bild der Kruppschen Geschützfabrikation geändert. Alfred Krupp ist nicht mehr nur Stahlmann, der unübertroffenes Material für die Kanonen herstellt, er ist Konstrukteur geworden. Er verfügt über eigene Schießplätze, weist selbst voranschreitend der artilleristischen Welt daheim und im Auslande Wege und Möglichkeiten der Weiterentwicklung.
Die Kämpfe späterer Jahre vorausahnend, hatte Alfred Krupp auch früh schon manches zur praktischen Lösung der sozialen Frage durch Hebung der wirtschaftlichen Lage des Arbeiters getan. Neben Hilfskassen, deren erste er als Krankenkasse schon 1853 stiftete, hatte er Krankenhäuser und vor allem sehr zahlreiche Arbeiterwohnungen geschaffen. Über mehr als 3000 Familienwohnungen verfügte die Fabrik schon 1873. Durch die Errichtung der »Konsumanstalt« hatte er billige und gute Bezugsquellen der wichtigsten Lebensbedürfnisse geschaffen. Seinen eigenen Wohnsitz hatte er schon Mitte der sechziger Jahre aus der Fabrik nach den Höhen der Ruhr auf den Hügel verlegt und bewohnte nun die von ihm dort erbaute schloßartige »Villa Hügel«.
Vierzehn Jahre weiterer Tätigkeit waren dem nunmehr Einundsechzigjährigen noch beschieden. Es fehlte in dieser Zeit nicht an neuen Kämpfen und Schwierigkeiten. Die heftig auftretende Agitation sozialistischer Weltverbesserer drohte zeitweilig in die Arbeiterschaft der Fabrik überzugreifen. Der Niedergang der geschäftlichen Lage nötigte zur Aufnahme einer 30 Millionen-Anleihe. Aber aus allen Fährnissen gingen die Werke unter ruhiger, stetiger Fortentwicklung siegreich hervor. Als Alfred Krupp am 14. Juli 1887 die Augen schloß, hinterließ er seinem Sohne Friedrich Alfred die Essener Fabrik mit den erworbenen Kohlengruben und Erzbergwerken, dem angekauften früher Asthöwerschen Stahlwerk Annen, dem Schießplatz in Meppen an der Ems und einer Gesamtarbeiterschaft von 21 000 Köpfen. An der Stätte, wo er begonnen, in dem kleinen »Stammhaus«, wurde die Leiche des aus bescheidensten Verhältnissen zu den höchsten Ehrungen und Auszeichnungen, zu fürstlichem Reichtum durch eigene Tatkraft emporgestiegenen Mannes aufgebahrt. Von hier aus wurde er mit fürstlichen Ehren zu Grabe geleitet.
Fünfzehn Jahre nur war es dem Sohne Friedrich Alfred vergönnt, das väterliche Erbe fortzuführen. In pietätvoller Ehrung des Ursprungs der Fabrik hatte er in den Räumen des Stammhauses sein Privatbureau aufgeschlagen. Als am 22. November 1902 in ihm der dritte und letzte männliche direkte Sproß der Essener Krupps durch einen Herzschlag plötzlich von seiner Lebensarbeit abberufen ward, wurde auch er wie sein Vater im Sarge gebettet von dem »Hügel« in das Stammhaus überführt und von dort, von seinem Kaiser selbst geleitet, zur letzten Ruhestätte hinausgetragen.
Wie hatte sich unter seiner Leitung das ihm vom Vater überkommene Werk ausgedehnt, wie hatte gleichsam der vom Vater fest und sicher gewurzelte Stamm unter seiner weitsichtigen und großzügigen Auffassung seine Zweige weithin ausgebreitet. Neue Gebiete der Fabrikation, wie die der Panzerplatten, waren aufgenommen, die Quellen der Rohmaterialien, die Zechen, die Erzgruben, die Hochofenwerke waren vermehrt und entwickelt, ganze Werke, das Grusonwerk in Magdeburg-Buckau mit einer Hartguß-, Panzer- und Granatenfabrikation, die Schiffswerft und Schiffsmaschinenfabrik »Germania« in Kiel und Tegel waren angekauft worden. Aus den 21 000 waren 43 000 Arbeiter geworden. Die Gußstahlfabrik allein beschäftigte davon über 24 500. Hier hatte der Kreis der Werkstätten sich immer weiter gezogen. Zu den älteren Kanonenwerkstätten, die aus Alfred Krupps Zeit im nördlichen Teile links vom Haupteingang standen, waren am westlichen Ende dieses und auch des mittleren Geländestreifens neue, mehr und mehr in den Dimensionen wachsende hinzugekommen. Im Süden waren die Riesenanlagen für die Panzerplattenfabrikation errichtet, Stahlwerke, Gießereien, Schmieden ausgebaut worden. Neben dem Stammhause erhob sich nun, ein Zeichen einer neuen Zeit, ein vierstöckiger Gebäudeblock, der Sitz der Verwaltung, der geistigen Leitung dieses Kolosses menschlichen Unternehmungsgeistes.
So gewaltig nun der Aufschwung der 15 Jahre unter Friedrich Alfred Krupp war, so sicher man glauben durfte, es sei ein Höhepunkt erreicht, so brachten dennoch die nächsten Jahre noch eine ungeahnte, in der Geschichte industrieller Unternehmungen wohl einzig dastehende Entwicklung.
Ein neuer, immer weiter ins Riesenhafte strebender Zug scheint sich der neuesten Gestaltung der Werke aufgeprägt zu haben. Auf der anderen Seite des Stammhauses, dem Verwaltungsgebäude gegenüber, mit der Front nach der von uns beschrittenen Straße, erheben sich die Eisenkonstruktionen der ersten Stockwerke eines neuen Hauptverwaltungsgebäudes, das zur Jahrhundertfeier eingeweiht werden soll. In vier hohen Stockwerken aufsteigend, wird es mit seiner in düsterem Basalt in Rustika aufgeführten Fassade, flankiert von einem massig, nach Art der Bismarcktürme in demselben Gestein erbauten Turme, alles Bisherige überragen und als ein Wahrzeichen der Macht der Kruppschen Werke dastehen.
Wir deuteten anfangs schon flüchtig auf riesenhafte Werkstattbauten aus jüngster Zeit hin. Könnten wir aus der Vogelschau das Gelände überblicken, so würden wir vielerorts die Zeichen lebhaftester Bautätigkeit sehen. Hier würden wir auf weiten Flächen niedergelegter Gebäude Fundamente ausschachten, an anderen die eisernen Gerüste weitläufiger Hallen emporstarren, an noch anderen wieder äußerlich vollendete Gebäude dem inneren Verputze entgegenharren sehen. Überall rastlose Tätigkeit, Ausbau und Verjüngung, Entfaltung in die Höhe, in die Breite.
Nach dem Tode Friedrich Alfred Krupps gingen die Werke auf die älteste seiner beiden Töchter, Berta, über, und wurden dann, in Übereinstimmung mit einem letztwilligen Wunsche des Verstorbenen, seit dem 1. Juli 1903 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, deren Aktien jedoch geschlossen in Kruppschem Besitz geblieben sind. Seit Oktober 1905 ist Berta Krupp mit dem früheren Legationsrat Dr. Gustav von Bohlen und Halbach vermählt, der zufolge eines Gnadenaktes des Kaisers für sich und den männlichen Erben den Namen Krupp von Bohlen und Halbach führt.
Schon aus dem kurzen historischen Überblick geht zur Genüge hervor, daß die Essener Gußstahlfabrik allein den Begriff der Kruppschen Werke nicht ausmacht, sondern daß unter diesem noch eine große Anzahl von anderen Unternehmungen zu verstehen ist. Zunächst gehören zum Essener Werk selbst zahlreiche von diesem aus verwaltete Nebenwerke und Anlagen, nämlich die drei Kohlenzechen Sälzer-Neuack (im Bereiche der Essener Fabrik selbst), Hannover und Hannibal bei Bochum, ferner der Eisenerzgrubenbesitz in Deutschland und Spanien, die mittelrheinischen Hüttenwerke: Hermanns-, Mülhofener- und Saynerhütte, die Schießplätze in Meppen, Tangerhütte und Essen und endlich eine Reederei mit eigenen Dampfern zur Verschiffung der Erze aus Spanien in Rotterdam. Die Zahl der in diesen Werken Angestellten betrug gegen Ende des Jahres 1909 rund 52 000, hiervon entfallen auf die Gußstahlfabrik allein 36 000, unter diesen 4200 Beamte. Dann aber sind zu den Kruppschen Werken weiter die folgenden Außenwerke zu rechnen: das Stahl- und Hüttenwerk »Die Friedrich-Alfred-Hütte« in Rheinhausen-Friemersheim, das Stahlwerk »Annen« bei Annen in Westfalen, das »Grusonwerk« in Magdeburg-Buckau und endlich die »Germaniawerft« in Kiel. Die Gesamtzahl der in allen Kruppschen Werken Angestellten zu dem oben genannten Zeitpunkte war über 67 000, darunter 6750 Beamte.
Die Verwaltung dieses vielgliedrigen Körpers wird ausgeübt von einem Direktorium, das seinen Sitz in Essen hat und sich gegenwärtig aus 10 Herren zusammensetzt. Ähnlich wie die Minister eines Staates teilen sich diese das Arbeitsfeld nach Ressorts. Die Funktionen des Aufsichtsrats der Aktiengesellschaft werden von fünf Herren ausgeübt, unter denen Herr Krupp von Bohlen und Halbach die Stelle des Vorsitzenden einnimmt.
Kehren wir aber nach dieser Abschweifung wieder zur Gußstahlfabrik zurück und versuchen wir weiter, uns das Wesen und den Umfang dieses Unternehmens zu vergegenwärtigen, indem wir uns die Rohstoffmengen ansehen, die dem Werke täglich zugeführt werden müssen.
Da ist an erster Stelle die Kohle zu nennen. In der einen oder anderen Form braucht die Fabrik davon zwischen 2700 bis 3000 Tonnen täglich. Das Quantum ist dem menschlichen Vorstellungsvermögen nicht so leicht faßbar. Man versuche es einmal so: ein Eisenbahnwagen durchschnittlicher Tragfähigkeit faßt etwa 10 Tonnen; 50 Wagen wären schon das äußerste, was an Zuglänge zugelassen werden könnte, macht also 500 Tonnen pro Zug. Es bedürfte also fünf bis sechs solcher Züge, den täglich notwendigen Brennstoff herbeizuschaffen. Glücklicherweise liegt, wie wir schon sagten, eine der Zechen in der Fabrik selbst. Sie vermag aber nur einen Teil der nötigen Kohle zu liefern, der Rest kommt von den Zechen bei Bochum, die freilich außerdem noch ungeheuer viel mehr Kohle für die übrigen Kruppschen Werke zu fördern haben. Die Gesamtförderung aller Kruppschen Zechen jährlich ist etwa 2½ Millionen Tonnen. Nahezu die Hälfte hiervon wird verkokt und wandert in die Hochöfen, um aus den Erzen Roheisen gewinnen zu helfen.
Wohin geht nun die der Gußstahlfabrik täglich zugeführte Kohle? Einen ansehnlichen Teil davon verzehrt die Gasfabrik, denn sie muß täglich gegen 6000 cbm Gas herstellen. Mit ihrem Jahresverbrauch an Gas steht die Essener Fabrik in einer Reihe mit Städten wie Stuttgart oder Magdeburg, er beträgt nämlich über 18 Millionen cbm. Zur Beleuchtung allein freilich wird das Gas nicht verwandt; ein Teil, wenn nicht der größte, wird zur Oberflächenbehandlung der Panzerplatten benutzt. Aber es müssen immerhin rund 39 000 Flammen gespeist werden. Wie in den Städten, ist auch in der Essener Fabrik die Gas- und Wasserversorgung der Obhut eines Betriebes anvertraut; dieser hat täglich für eine Zufuhr von über 5000 cbm Wasser zu sorgen, also für eine solche von 16? Millionen cbm im Jahre. Dresden brauchte im Jahre 1907 rund 17½ Millionen cbm.
Sehen wir nun weiter, was aus den übrigen Kohlen wird. Davon wandert das größte Quantum in die Stahlwerke, Gießereien, Schmieden, kurz in die Feuerbetriebe, wie man in der technischen Sprache sagt. Das ist nicht etwa so zu verstehen, daß die Kohle direkt in Öfen oder Herden verheizt wird, das wäre viel zu unvorteilhaft, das geschieht nur noch in wenigen älteren Anlagen. Für alle neueren bestehen sogenannte Gasgeneratoren, d. h. Vorrichtungen, in denen die brennbaren Stoffe in der Kohle zunächst in Gasform übergeführt werden. Dieses Generatorgas wird dann in mächtigen Rohrleitungen den einzelnen Betrieben zugeführt. Hier wird es in nach dem Erfinder Siemens benannten Öfen mit Luft vermengt und verbrannt. Bei diesem Verfahren herrscht nicht nur in den Feuerungen gegen früher eine wohltuende Sauberkeit, sondern es werden auch große Ersparnisse an Brennstoff und weit höhere Temperaturen, wie sie die heutigen Stahlprozesse verlangen, erzielt. Weitere große Kohlenmengen endlich werden zur Erzeugung von Kraft in verschiedenster Form gebraucht. Da müssen Tausende von Maschinen, Hebezeuge und Transportmittel bewegt werden, sei es, daß sie direkt durch Dampf angetrieben werden, sei es, daß die Dampfkraft zunächst in elektrische oder hydraulische Energie umgewandelt wird. Einige Zahlen mögen uns auch hier wieder helfen, den Vorstellungen festere Gestalt zu geben. Unter beinahe 400 Dampfkesseln wird die Kohle verstocht und erzeugt in rund 570 Dampfmaschinen etwa 74 000 Pferdekräfte. Das Ungeheuere dieser Arbeitsleistung ist vielleicht nicht ohne weiteres klar. Man halte sich etwa vor Augen, daß die neuesten schweren Lokomotiven Leistungen bis zu 2000 Pferdekräften entwickeln; es würde also die Arbeit 37 solcher Lokomotiven hier hervorgebracht. Die Maschinen der Ozeankolosse »Kronprinz Wilhelm« und »Kaiser Wilhelm II.« des Norddeutschen Lloyd entwickeln 37 000, bzw. 43 000, die gewaltigen englischen Schnelldampfer »Mauretania« und »Lusitania« gar 70 000 Pferdekräfte, Leistungen, die durch den Vergleich mit der Gußstahlfabrik interessant beleuchtet werden.
Die erzeugten 74 000 Pferdestärken werden nun teils direkt, größtenteils aber in elektrische Energie umgewandelt, zum Antriebe von 17 Walzwerken von rund 190 Hämmern, unter denen der Hammer »Fritz« mit einem Einzelgewicht seines Fallbärs von fünfzig Tonnen für sich den Anspruch auf Berühmtheit machen kann, verwandt. Weiter stellen sie das für zahlreiche Betriebe erforderliche Druckwasser, insbesondere für die hydraulischen Pressen, von denen mehr als 80 vorhanden sind. Unter den schwersten können eine 10 000, zwei je 7000, eine 5000, zwei je 4000 und zwei endlich je 2000, bzw. 1800 Tonnen Druck ausüben. Es müssen ferner die in den Werkstätten aufgestellten Werkzeugmaschinen, Drehbänke, Hobel- und Fräsmaschinen, Stanzen und mancherlei andere Maschinen, im ganzen 7200 an der Zahl, in Betrieb gesetzt werden. Schließlich bleiben noch neben vielen anderen Vorrichtungen die schweren Krane zu bewegen. Diese, in verschiedenster Gestalt als Lauf- oder Brückenkrane, als Pfeilerkrane oder fahrbare Hebezeuge montiert, vermögen mit Sicherheit und Leichtigkeit die schwersten Lasten von Ort zu Ort zu bewegen. An diesen Vorrichtungen zählt die Gußstahlfabrik über 900 mit Einzelleistungen bis zu 150 Tonnen.
Aus vorstehenden Angaben können wir uns wohl ein Bild machen von der Macht und der unendlichen Vielfältigkeit der Kräfte, die in diesem gigantischen Werke zusammen wirken und von der Menge der Rohstoffe, die zu ihrer Erzeugung nötig ist. Betrachten wir nun weiter die eigentlichen Rohstoffe, d. h. die Stoffe, die zur Herstellung der Werkstücke und des Roheisens selbst verwendet werden.
Mit der Gewinnung des Roheisens aus den Erzen befaßt sich die Gußstahlfabrik nicht, diese vollzieht sich auf den Kruppschen Hüttenwerken, besonders auf der Friedrich-Alfred-Hütte. Dieses Hüttenwerk ist von der Firma Krupp zu seiner heutigen Ausdehnung erst seit wenigen Jahren ausgebaut worden. Das Werk liegt am linken Rheinufer gegenüber der Station Duisburg-Hochfeld und besitzt einen eigenen Hafen. In acht Hochöfen kann es täglich mehr als 2000 Tonnen Roheisen herstellen. Um die in den überschüssigen sogenannten Gichtgasen vorhandene Energie nutzbar zu machen, ferner um der wirtschaftlichen Vorteile teilhaft werden zu können, die daraus erwachsen, daß man das Eisen direkt aus den Hochöfen noch flüssig in die Konverter oder Martinöfen gibt und daß man die eben vergossenen Stahlblöcke noch in der eigenen Hitze auf die Walzenstraße legt, wurde der Hochofenanlage ein Stahlwerk und ein Walzwerk hinzugefügt. In ihrer heutigen Ausgestaltung gehört die Friedrich-Alfred-Hütte zu den bedeutendsten Werken ihrer Art in Europa, wenn sie nicht das bedeutendste ist. Von den täglich erzeugten 2000 Tonnen Roheisen wird wohl der größte Teil auf der Hütte selbst verarbeitet zu den üblichen Produkten der schweren Eisenindustrie, wie Schienen, Trägern, Profil- und Baueisen usw. Der Rest zusammen mit den von den kleineren Hüttenwerken am Mittelrhein kommenden Spezialroheisensorten wandert in der Hauptsache nach Essen. Da die Gußstahlfabrik nur Spezialstahlsorten fabriziert, d. h. solche, an deren Eigenschaften ganz besondere Anforderungen gestellt werden, so müssen häufig andere Metalle, wie Nickel, Chrom, Wolfram u. a. mit dem Eisen legiert werden. Infolgedessen spielen natürlich auch diese Metalle oder deren Erze in dem Rohproduktenbedarf der Gußstahlfabrik eine nicht unerhebliche Rolle.
Wenn man schlechthin von Kruppschem Stahl spricht, denkt man wohl meist an den Kruppschen Tiegelstahl, jenen edelsten aller Stahle, auf dem in der Hauptsache der Ruf und das Wachstum der Kruppschen Werke sich gründeten. Seine Vorzüge sind eine absolute Gleichartigkeit der Struktur und große zuverlässige Festigkeit. Kruppsche Geschützrohre sind in allen Teilen nur aus Tiegelstahl hergestellt. Zwar gibt es heutzutage viele Stahlwerke, die Tiegelstahl machen, aber um Blöcke bis zu den Gewichten zu gießen, wie sie zu schweren Geschützrohren gebraucht werden, reichen die Einrichtungen und vor allem die Erfahrungen keiner anderen Fabrik der Welt aus. Das Schauspiel eines Tiegelgusses von 80 000 kg kann man nur im »Schmelzbau« der Kruppschen Werke haben. Der Schmelzbau steht an der Stelle der allerersten Anlage aus dem Jahre 1818, d. h. er deckt die Stelle mit seinem äußersten südlichen Zipfel und hat sich nach Norden hin im Laufe der Jahre über ein Gelände von mehr als 18 000 qm ausgebreitet. Aus einer Anzahl aneinandergereihter Schuppen hebt sich eine breite, hohe Mittelhalle ab, die eigentliche Gießhalle. In der Richtung ihrer Längsachse zieht sich ein breiter Graben zur Aufnahme der Gießformen, meist mächtiger gußeiserner Zylinder. Der ganzen Länge nach wird die Grube von Laufkränen bestrichen. Über den Gußformen ist die Grube mit starken Blechen zugedeckt, auf diesen wird eine lange zweiteilige Gießrinne aufgestellt, die nach der Mitte zu sich senkt, so daß das an verschiedenen Stellen eingegossene Metall nach der Mitte zusammen und in die darunter stehenden Formen fließt. So finden wir die Halle vorbereitet, wenn wir sie kurz vor dem Guß betreten. Sie ist in Dämmerlicht getaucht, sodaß wir uns zunächst nur mühsam zurechtfinden. In dem Maße aber wie das Auge sich an das Halbdunkel gewöhnt, füllt sich der Raum mit Formen und Gestalten. Da steht in der Mitte die lange Rinne, zu beiden Seiten lassen grell weißleuchtende Linien, die Türspalten der Öfen, deren lange Reihen erkennen. Hunderte von Arbeitern stehen abteilungsweise gruppiert bei den Öfen. Auch das Ohr ist zunächst verblüfft durch die tiefe, feierliche Stille. Es herrscht die Stimmung der Ruhe, der letzten Sammlung vor einem großen Entschluß. Da kommt Bewegung in eine reckenhafte Gestalt mit wallendem rotblonden Bart, die einen langen eisernen Stab hoch aufgerichtet wie einen Speer im Arme hält. Nun hebt der Gießmeister den Stab, und laut klirrend stößt er ihn auf das Blech. Wie durch Zauberspruch ändert sich das Bild. Weitauf fahren plötzlich die Ofentüren, blendende Helle erfüllt die Halle und beleuchtet ihre Konturen bis zu den Dachsparren hinauf. Arbeiter, mit langen Zangen bewaffnet, holen die weißglühenden Tiegel aus der Glut der Öfen, andere kommen zu je zweien mit einer Zange, fassen die Tiegel und tragen sie zwischen sich zur Gießrinne. Von allen Seiten strömen sie nun herzu. Hunderte von glühenden Tiegeln gleich bunt schimmernden Lampions wogen wie im Fackeltanz durcheinander. Aber in dem, was ein wirres, schönes Durcheinander scheint, erkennen wir bald staunend genaueste Ordnung. In regelmäßigem Tempo tritt ein Paar nach dem anderen an die Rinne, seinen Tiegel zu entleeren. Sorgsam wacht der Gießmeister, daß der Strom des Stahles gleichmäßig fließe. Ein neuer Schlag mit dem Stabe auf die Bleche gibt durch die Halle das Signal: »Mehr Tiegel«, und sofort kommt schnelleres Leben in das Bild. So geht es fort, bis je nach der Größe des erforderlichen Blockes 1000 bis 1200, ja bis zu 1800 Tiegel entleert sind. Jeder Tiegel enthält etwa 45 kg Stahl. Die vorhandenen Schmelzöfen können rund 1800 Tiegel auf einmal aufnehmen, die Einrichtungen gestatten also Güsse von 80 Tonnen. Wohl eine halbe Stunde dauert ein solcher Guß, und annähernd 500 Mann sind dabei tätig. Da dieses eigenartige, fesselnde Schauspiel eines Tiegelgusses in keinem anderen Werk der Welt wieder zu sehen ist, haben wir etwas länger dabei verweilt.
Außer zu Geschützen findet der Tiegelstahl, da er ein sehr kostbares Material ist, verhältnismäßig geringe Anwendung, nur da, wo auf ganz besondere Zuverlässigkeit Wert gelegt wird, also etwa bei der Herstellung von Lokomotivachsen, Radbandagen und Schiffsschraubenwellen, weiter aber auch bei ganz besonderen Legierungen, wie sie bei Werkzeugstahlen und in der Automobilindustrie vorkommen.
Das für die allgemeine Stahlindustrie wichtigste und bei weitem in den größten Mengen hergestellte Produkt ist der nach dem Martinverfahren im Siemensofen erzeugte Stahl, der sogenannte Siemens-Martinstahl. Während täglich in Essen wenige hundert Tonnen Tiegelstahl hergestellt werden, dürfte das Tag für Tag erzeugte Quantum Martinstahl 1000 Tonnen weit überschreiten. Diesem Verhältnis entspricht auch die Ausdehnung der vorhandenen Martinwerke. Es sind ihrer sechs mit zusammen 42 Öfen, von denen einzelne bis zu 40 Tonnen Fassungsvermögen besitzen. Seine besondere Bedeutung hat der Martinprozeß dadurch, daß dabei »Schrott«, d. h. die Werkstattabfälle, wie Drehspäne, Gußköpfe usw. und Alteisen wieder als »Einsatz« verwendet werden kann, während der Bessemerprozeß, auch in seiner veränderten Form als basischer oder Thomasprozeß, von dem »Roheisen« ausgehen muß.
In den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, vor Einführung des Siemens-Martin-Prozesses, nahm das Bessemern bei Krupp einen sehr großen Raum ein. Alfred Krupp war einer der ersten auf dem Kontinent, die die umwälzende Bedeutung dieses Verfahrens erkannten und es einführten.
Seitdem aber in jüngerer Zeit der viel wirtschaftlichere Weg der Gewinnung des Stahles im Konverter durch Einsatz von flüssigem Eisen direkt vom Hochofen eingeschlagen wird, ist auch das einst in Essen so blühende »Bessemern« in der Hauptsache nach der Kruppschen Friedrich-Alfred-Hütte verlegt worden. Von den früheren zwei Essener Bessemerwerken ist nur noch eins mit einer, höchstens zwei Birnen im Gange, die aber immerhin noch mehrere hundert Tonnen Stahl täglich erzeugen. Erklärend möge hier noch eingeschaltet werden, daß es sich beim Konverter ebenso wie beim Martin-Verfahren um »Frischprozesse«, wie der Hüttenmann sagt, handelt, d. h., daß auf dem Wege eines chemischen Reduktionsprozesses das Rohmaterial in seinem Kohlenstoffgehalt herabgesetzt, zu Stahl »gefrischt« wird. Beim Tiegelstahl hingegen haben wir es nur mit einem Umschmelzen bereits gewonnenen Stahles zu tun. Da nun die Kruppsche Fabrik bisher daran festgehalten hat, ihren Rohstahl für die Tiegel aus besonders reinen Erzen durch das alte Puddelverfahren herzustellen, so finden sich in der Essener Fabrik Stahlpuddeleien, die auf anderen, für die allgemeine Industrie arbeitenden Werken wenig noch zu finden sind.
Verfolgen wir nun einmal, was aus dem erzeugten Stahle wird, und beginnen wir mit dem vornehmsten und bedeutendsten Kruppschen Erzeugnisse, dem Tiegelstahl. Im Schmelzbau hatten wir ihn in großen zylindrischen Blöcken vergießen sehen: aus diesen sollen Kanonenrohre werden. Zu diesem Zweck wandern sie aus der Gießerei zunächst in die Schmiede unter den Hammer oder die hydraulische Presse, sei es, um zu langen zylindrischen Stücken gestreckt, sei es, um gelocht und zu Ringen aufgeweitet zu werden. So roh vorgearbeitet, durchlaufen die verschiedenen Teile weitere Werkstätten, um auf Dreh-, Bohr- und Schmirgelbänken ihre endgültige Gestalt zu erhalten. Es ist ein langer Weg, den so die Elemente eines schweren Schiffs- oder Küstengeschützrohres von Werkstatt zu Werkstatt, von Hand zu Hand durchlaufen, ehe sie fest zusammengefügt sind und das schlanke Rohr blitzblank mit eingepaßtem Verschluß und mit haarscharf und genau in die »Seele« eingeschnittenen Zügen daliegt, harrend des Momentes, wo es in die Lafette gelegt wird und seine donnernde Stimme zum ersten Male ertönen soll. Einen ungleich schnelleren Werdegang machen mittlere oder gar Feld- und Gebirgsgeschütze durch, aber ihre Zahl ist auch unendlich viel größer.
Die Kruppsche Gußstahlfabrik stellt aber nicht nur Kanonenrohre her, sie baut fertige Geschütze mit allem Zubehör. Es bedarf einigen Nachdenkens, um sich zu vergegenwärtigen, welche Mannigfaltigkeit von Gegenständen, Materialien und Werkstätten hierfür in Frage kommen. Da sind die Lafetten und Fahrzeuge der fahrbaren Geschütze, zu deren Herstellung die Schmieden Achsen und andere im Gesenk geschmiedete Teile, die Walzwerke Bleche verschiedenster Größen und Sorten liefern: Preßwerke geben diesen die gewünschte Form. Aus schweren Blechen und aus Gußstücken bauen sich auch die mächtigen Lafetten und Türme der Festungs- und Schiffsgeschütze auf. Manche Tonne Martinstahl wird zur Bildung aller dieser Dinge verbraucht, und breit lagert sich vor unseren Augen Werkstätte neben Werkstätte, in denen sie hergestellt, verarbeitet und zusammengefügt werden. Aber noch haben wir erst das rohe Gebäude des Geschützes vollendet, das Rohr in der Lafette. Es kommen noch hinzu die Unmenge von kleineren Elementen: die Zylinder, Kolbenstangen, Federn der Rücklaufbremsvorrichtungen; die Wellen, Spindeln, Getriebe der Richt- und Zieleinrichtungen, die dem Geschütz erst Leben, Bewegung und Freiheit geben, es zu dem wunderbaren, vollkommensten Gebilde menschlichen Genies gemacht haben. Was könnte imposanter sein, als die wuchtigen Massen eines Panzerturmes, aus dem drohend das Paar der schlanken Kanonenrohre hervorlugt, was erstaunlicher als die Leichtigkeit und Sicherheit, mit der Turm und Rohre sich auf den Druck eines Fingers hin bald schnell, bald kaum dem Auge erkenntlich, bis zur Genauigkeit von Bogensekunden auf ihr Ziel einstellen. Die gewaltigsten Massen, bewegt mit der Präzision eines wissenschaftlichen Instrumentes.
Zu den Werkstätten für die Rohre, die Lafetten und Fahrzeuge, zu den Feinmechaniker-Werkstätten gesellen sich dann weiter noch die Geschoßdrehereien und die Zünderfabrik. Die mannigfachen Nebenbetriebe, wie Sattlerei, Gravier-, Brünieranstalten u. a. hinzugerechnet, wächst die Zahl der der Geschützfabrikation dienenden Werkstätten gewaltig an. Wer sie durchwandert, wird die Entwickelung der Fabrik nicht nur in ihrer allmählichen Flächenausbreitung verfolgen können, auch in der steigenden Ausdehnung in Breite und Höhe des einzelnen Werkraumes drückt sich der Fortschritt, der wachsende Weitblick, die größere Auffassung aus. Überwältigend geradezu sind die Eindrücke beim Betreten der Werkstatthallen aus neuester Zeit. Die Kühnheit und Leichtigkeit des Eisen- und Glasbaues, die Weite, Höhe und Helligkeit der Hallen wirken feierlich erhebend wie ein architektonisches Kunstwerk. Staunend stehen wir vor den gewaltigen Maschinen, vor den schnell in der Höhe dahinsausenden Kränen, die spielend mächtige Lasten von Ort zu Ort tragen. Die Wucht der Gewichte ist hier überwunden, die brutale Arbeit vergeistigt. So groß und weithin ausgedehnt der Ruf der Kruppschen Werke als der gewaltigsten Geschützfabrik der Welt ist, so groß und imponierend zeigen sich auch die diesem Zweig ihrer Tätigkeit dienenden Anlagen und Arbeitsstätten.
Aber die Kanonen und ihre Zubehörstücke bilden immer nur erst einen Teil des Arbeitsfeldes der Essener Gußstahlfabrik. Von den erzeugten Stahlmassen braucht der Geschützbau nur den geringeren Teil auf. Der Lokomotiv- und Eisenbahnwagenbau, der Schiffbau, die Konstruktionen der Schiffs- und anderen Maschinen mit ihren zum Teil ganz außergewöhnlich schweren Guß- und Schmiedestücken bilden, was Gewicht angeht, sicherlich die bedeutenderen Abnehmer der Blöcke, Brammen und Formstücke aus den Stahlwerken. Zu ihrer Verarbeitung stehen wiederum zahlreiche Schmieden, Preß- und Walzwerke, Formgießereien und mechanische Werkstätten bereit, unter denen die eingangs genannte eine der bedeutendsten ist.
Die außerordentliche Leistungsfähigkeit der Kruppschen Werke auf dem Gebiete der Erzeugnisse der allgemeinen Stahl- und Eisenindustrie, des »Friedensmaterials«, wie man im Essener Sprachgebrauch im Gegensatz zum »Kriegsmaterial« sagt, ist aber auch für sie als Geschützfabrik von hervorragendster Bedeutung, auf die hinzuweisen nicht unterlassen werden darf. Nur eine auf breitester Basis entwickelte Stahlindustrie kann den überaus schwankenden Bedürfnissen der Geschützfabrikation ein Gleichgewicht halten, kann in Zeiten geringerer Beschäftigung die ungeheuren Kosten der zum steten Fortschritt der Artillerie notwendigen Versuche aufbringen, kann endlich bei eintretendem plötzlichen Bedarf den höchsten Ansprüchen augenblicklicher Leistungsfähigkeit genügen.
Es bleibt noch ein großer, zum »Kriegsmaterial« gehöriger Kruppscher Fabrikationszweig zu erwähnen, die Herstellung der Schutzwaffen, der Panzerplatten. Wenn sie auch nicht die wichtigsten, so sind sie doch gewiß die gewichtigsten Kruppschen Erzeugnisse. Eine ausgedehnte, alle anderen wohl an Flächenraum übertreffende, geschlossene Anlage ist hierfür geschaffen worden. Sie liegt, wie schon gesagt, im südlichen Fabrikgebiet. Hallen in Glas- und Eisenkonstruktion, mehrere hundert Meter in Länge und Breite, gruppieren sich hier zusammen, in vielen weiten Schiffen angeordnet, die von den mächtigsten Kränen bestrichen werden, denn Werkstücke von 50 bis 60 Tonnen sind hier keine Seltenheit. Martinwerke zum Gießen, Walzwerke, Pressen zum Biegen der Platten, Wärmeöfen für die Wärmebehandlung der Platten, Hobel-, Fräs- und Drehbänke zu ihrer Formgebung, alles ist hier vereint, und zwar in Abmessungen, die den Größen und Gewichten der Werkstücke entsprechend sind.

Tiegelguß im Schmelzbau der Gußstahlfabrik von Friedr. Krupp A. G., Essen-Ruhr.
Das Martinwerk hat fünf Öfen. Wir kommen eben zurecht in dem Augenblick, da bei zweien die Vorbereitungen zum Guß getroffen werden. Zwei gewaltige Gießpfannen, an Laufkränen hangend, sind in die Gruben hinter den Öfen hinuntergelassen. Die Rinne vom Stichloch zur Pfanne ist gelegt und mit dem an einer Kette schwingenden schweren Hammer werden noch die letzten kräftigen Schläge geführt, um den Damm, der das wallende Metall zurückhält, endgültig zu durchstoßen. Plötzlich schießt ein rotbraun flammender Strahl hervor, schnell wächst er zu einem intensiv weiß leuchtenden Strom an, der sich sprühend und brodelnd in die Pfanne ergießt. Auch die zweite Pfanne füllt sich schnell. Nur das leise Vibrieren der Drahtseile, an denen die Motore der Kräne die Gießpfannen hochwinden, läßt die Schwere der Lasten erkennen, die, scheinbar leicht schwebend, nun zu der Gußform getragen werden. Ein Ruck an einem seitlichen Hebel der Pfanne lüpft den Stopfen, der die Ausflußöffnung an ihrem Boden schließt, und nun ergießt sich der Stahlstrom aus jeder Pfanne unter weitsprühendem Funkenregen in die Formen. Dreißig Tonnen Stahl in jeder Gießpfanne, das macht einen Block von sechzig Tonnen. Einen gleich schweren Block sehen wir eben in dem Schiff nebenan aus dem Ofen hervorgeholt werden. Während die Tür vorne sich hebt, fährt eine Lokomotive die bewegliche Ofensohle heraus. Der darauf liegende Stahlblock, eine Bramme von etwa 1 m Dicke, 3 m Breite und 5 m Länge, strahlt uns mit seiner blendenden Weißglut so heftig an, daß wir schleunigst in respektvolle Entfernung zurückweichen. Ein vierschenkliger Haken hat unterdes den Block von zwei Seiten gefaßt und auf die Walzenstraße gelegt, deren weitgeöffnete Walzen ihn nun in ihren eisernen Griff nehmen. Zwischen den Walzen, die sich bei jedem Gange enger stellen, hin und her gehend, streckt sich das Ungetüm mehr und mehr. Bei der Berührung mit der Luft hat sich die Oberfläche mit einer Schicht Hammerschlag bedeckt. Es treten jetzt Leute vor und werfen Reisig auf die Platte; unter Entwickelung einer hochaufschlagenden Lohe und mit einem Geknatter wie von einem Gewehrfeuer geht es mit der Platte unter der Walze durch, weithin einen Regen von sprühenden Funken und glühenden Holzstückchen entsendend. Doch bald sehen wir, daß diese Detonationen den Hammerschlag mit fortreißen und die blanke hellrote Oberfläche des Stahles wieder erscheint. Unterdes ist der ungefüge Block schon erheblich schlanker geworden. Aber noch oft muß er zwischen den Walzen hin und her gehen, ehe er auf das Maß von etwa 30 cm Dicke gebracht ist. Zur Platte ist der mächtige Block nun schon geworden, aber damit er ein echter Panzer wird, d. h. die Glashärte der Oberfläche erhält, welche die Kruppschen Panzerplatten so berühmt gemacht haben, muß die Platte noch manche Ofenerhitzung, manche Abschreckung in kalten Bädern erleiden. Gewaltige Biegepressen müssen ihr die nötige Rundung geben, damit sie sich an den Schiffskörper anschmiegt. Fräs- und Hobelmaschinen müssen die Kanten bearbeiten, damit sich Platte fest an Platte fügt. In keiner Werkstattanlage kann uns eindringlicher zu Gemüt geführt werden, welche Wärme- und Kraftenergien der Mensch in der modernen Eisenindustrie zu meistern gelernt hat. Die Mengen der zum Teil überwältigend mächtigen Stahlplatten, die hier unter der Walze, in den Öfen, auf den Bearbeitungsmaschinen sich befinden, auf den Richtplatten zu Türmen zusammengesetzt werden oder sonst in den weiten Hallen aufgestapelt liegen, zählen nach Tausenden von Tonnen. Man wundert sich nur, wie das Schiff das ungeheure Gewicht seiner Stahlhaut zu tragen vermag.
Nachdem so die wichtigsten Betriebe der Kruppschen Werke an uns vorübergezogen sind, haben wir zugleich Einblick in die Art und Menge der Erzeugnisse erhalten. Damit ist auf die Frage nach den Produkten der Kruppschen Werke, deren erschöpfende Einzelaufzählung nur ermüdend sein könnte, die Antwort gegeben. Sie soll im übrigen dahin zusammengefaßt werden, daß Krupp mit Ausnahme von blanken und Handfeuerwaffen alle Schutz- und Trutzwaffen für den Krieg anfertigt, an industriellen Erzeugnissen aber so ziemlich alles herstellt, was die schwere Industrie in sich begreift.
Zum Schluß sei noch eines Betriebszweiges Erwähnung getan, der geeignet ist, ein Streiflicht auf die ganz gewaltige Ausdehnung der Gußstahlfabrik zu werfen, nämlich der Tätigkeit der Probieranstalt und der chemischen und physikalischen Versuchsstation. Jedes Stück, groß oder klein, das der Besteller von der Fabrik entgegennimmt, wird, ehe es »abgenommen« wird, gewöhnlich von besonderen, hierzu entsandten Beamten, »Abnehmern«, genau auf Bearbeitung und Stahlqualität untersucht. Es werden den Stücken im Laufe der Bearbeitung Stahlproben entnommen, von denen kleine Teilchen einer chemischen Analyse unterworfen werden, während größere Stücke zu »Probierstäbchen« geschmiedet und abgedreht werden und dann mechanischen Beanspruchungen, wie Zug, Druck, Drehung, Biegung usw. ausgesetzt werden. Für solche Analysen werden täglich in der Gußstahlfabrik durchschnittlich mehr als 1000 chemische Einzelversuche gemacht, während in der mechanischen Probieranstalt täglich durchschnittlich 600 bis 700 Versuche angestellt werden. Es versteht sich, daß für die Abnahme, besonders, wenn es sich um Feinmessungen handelt, besondere ausgedehnte Abnahmeräume vorhanden sein müssen.
Nicht nur innerhalb einer Werkstatt, sondern auch von einer zur anderen müssen die Arbeitsprodukte hin und her geschafft und schließlich auch von der Fabrik auf die Gleise der Staatsbahn gebracht werden. Die Essener Gußstahlfabrik verfügt innerhalb ihres Gebietes über ein Netz von etwa 130 km teils normal-, teils schmalgleisiger Bahnstrecke, auf der mehr als 50 Lokomotiven und rund 2400 Wagen verkehren. Drei Stationen der Staatsbahn stehen mit diesem Netz in Verbindung, die Zu- und Abfuhr von täglich 50 Zügen charakterisiert den Verkehr an diesen Stellen. Fügt man zu diesem Bilde äußerer Verkehrsbewegung die täglich geführten 2700 bis 2800 telephonischen Gespräche hinzu, vergegenwärtigt man sich ferner das rastlose Getriebe in den Verwaltungs- und kaufmännischen Bureaus, in den Registraturen und Zeichensälen, denkt man weiter an die tausend und mehr täglich eingehenden Briefe, an die nahezu ebenso zahlreichen Erledigungen mit den dazu notwendigen Konferenzen, Einzelbesprechungen und Rückfragen, so dürfte nach und nach die Vorstellung von der schier unfaßbaren Menge menschlicher Betätigung, die trotz verschiedenster Form in wohldurchdachtem Zusammengehen, leitend und geleitet, für ein und dieselbe Sache wirkt, zu einem festen, inhaltsvollen Bilde sich gestalten, das die hohe wirtschaftliche und nationale Bedeutung dieses einzig dastehenden Unternehmens zum klaren Bewußtsein bringt.
Es ist selbstverständlich, daß ein so viele Tausende von Arbeitern beschäftigendes Unternehmen in hervorragendem Maße berufen ist, tätig mitzuwirken an der praktischen Lösung sozialer Fragen. Daß Alfred Krupp hier bahnbrechend vorging, lange Jahre, ehe Staat oder Gemeinde sich regten, ist schon angedeutet worden. Sein Sohn Friedrich Alfred tat mehr als nur den Spuren des Vaters folgen; die Beschäftigung mit Fragen der Arbeiterfürsorge war ihm ein Herzensbedürfnis. Eine Schilderung dessen, was er weit über das von den Staatsgesetzen Vorgesehene hinaus an Kassen, Stiftungen, Wohnungen getan, würde an sich ausreichenden Stoff zu einer längeren Betrachtung geben. Wir möchten jedoch unsere Darstellung nicht beenden, ohne wenigstens einer seiner Schöpfungen Erwähnung zu tun. Fern ab von dem Ruß und Rauch, dem Lärmen und Hasten der Fabrik, hart an den Waldungen, die auf dem Hügellande längs der Ruhrufer sich hinstrecken, liegt der »Altenhof«, eine Ansiedlung für die Alten, die Veteranen der Arbeit, die ausgedienten Kruppschen Arbeiter, die hier nach mühereichem Leben in idyllischem Frieden die Muße ihrer alten Tage genießen können. Dank einer Stiftung Friedrich Alfred Krupps wird den alten Ehepärchen freie Wohnung für den Rest ihrer Tage gewährt. Die kleinen Häuschen, die reizvoll bunt in ihrer schmucken Architektur an gewundenen Straßen gruppiert sind, die Gärtchen, von denen sie umgeben und die gegeneinander und nach der Straße hin durch hellgrün leuchtende Holzgitter abgetrennt sind, die Blumen auf den Beeten, die in allen Farben schimmern, die dicht mit Efeu oder wildem Wein bewachsenen Eingänge, die alten Mütterlein oder weißhaarigen Männer davor, das alles versetzt den Besucher des Altenhofs wie in ein Märchenland, so farbenprächtig, so unberührt, so heimlich friedvoll und weltentrückt ist alles umher. Der Eindruck dieser Stätte des wohlverdienten Genießens eines freundlichen Lebensabends zieht einen erheiternden Rahmen um das ernste Bild der Fabrik mit ihrer schweren, Geist und Körper anspannenden Arbeit.