
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
1. Der Nordostseekanal. – 2. Kiel und die Kieler Föhrde. – 3. Das Fischland und seine Bewohner. – 4. Die Insel Rügen. – 5. Fischerleben auf Hela. – 6. Die Kurische Nehrung. – 7. Die Küste von Samland und die Bernsteingewinnung. – 8. Königsberg.
»Zu Ehren des geeinigten Deutschland!
Zu seinem fortschreitenden Wohle!
Zum Zeichen seiner Macht und Stärke!«
Mit diesen Worten begleitete Kaiser Wilhelm I. seine drei Hammerschläge bei der Grundsteinlegung des Kanals am 3. Juni 1887. »Zu Ehren des geeinigten Deutschland!« In der Tat! Nur das unter seiner glorreichen Führung neuerstandene Reich war imstande, sich ein solches Ehrenmal zu setzen; was die Zeit der Kleinstaaterei geschaffen, zeigt uns der Eiderkanal, eine immerhin achtungswerte Leistung der Jahre 1777-84; er benutzte von Tönning an der Eidermündung bis Rendsburg den Lauf dieses Küstenflusses und strebte sodann im gegrabenen Bette der Kieler Bucht zu, war mit scharfen Krümmungen, 3½ m Tiefe, 31 m Breite und sechs Treppenschleusen ausgestattet, verschlang 9 Millionen Mark Baukosten, beschäftigte ein Arbeiterregiment von 3000 Mann und konnte wohl Schiffen aus dem Jahrgang 1800, aber nicht solchen Kolossen genügen, die das Jahr 1900 mit einer Wasserverdrängung von 14 000 t für zeitgemäß erachtet. Seine östliche Hälfte (von Rendsburg ab) ist geschwunden; die westliche kann auch heute noch von Kanonenbooten und anderen kleinen Kriegsfahrzeugen benutzt werden, da mittels einer neuen Schleuse dieser frühere Schiffsweg auf der Untereider nach der Nordsee erhalten geblieben ist.
Das Deutsche Reich hat unter den 16 Plänen, die im Laufe von fünf Jahrhunderten (1398-1886) über die geeignetste Verbindung zwischen Nord- und Ostsee ausgearbeitet worden sind, die ferner bezüglich der Lage das ganze Gebiet von Hamburg-Lübeck einerseits bis zur deutschen Nordgrenze andererseits umfassen, und die zu ihren Förderern auch den Admiral der Ostsee und Herzog von Mecklenburg, Wallenstein, ja den großen Cromwell zählen – denjenigen zur Ausführung gewählt, der auf Grundlage der Arbeiten von Oberbaurat Lentze und Großkaufmann Dahlström von einer kaiserlichen Kanalkommission unter dem Vorsitz des Oberbaurates Baensch ausgearbeitet worden ist. Am 16. Mai 1886 erteilte der Deutsche Reichstag diesem Projekte seine Genehmigung; es stellte im Interesse der Großschiffahrt Anforderungen in technischer wie in finanzieller Hinsicht, deren Erfüllung nur einem geeinigten Deutschland möglich war.
»Zu seinem fortschreitenden Wohle!« sollte nach des Kaisers Wort die neue Wasserstraße ebenfalls dienen. Daß ihm dabei die größere Annäherung des industriereichen Westens an den landwirtschaftlichen Osten, eine regere wirtschaftliche Berührung beider Hälften unseres Reiches und dadurch Mehrung des Wohlstandes und Emporblühen der nächstgelegenen Handelsplätze vor der Seele geschwebt, wer wollte das leugnen? Aber in seiner Erinnerung haftete zweifelsohne auch so manches schwere Unglück, das Mann und Schiff auf der Fahrt um Kap Skagen ereilt. Nennt man doch schon seit langer Zeit die jütische Westküste die »eiserne« und »den Kirchhof der Schiffe!« Zeigt doch die sog. » Kaviarkarte«, welche mit schwarzen Punkten und Ringeln Die in ihrer Häufung dem Kaviar nicht unähnlich sich ausnehmen. die Schiffsunfälle auf dem alten Seeweg um Jütland herum angibt, nicht weniger als 8215 Unfälle, die sich in den dänischen Gewässern auf 28, in den deutschen gar nur auf 15 Jahre verteilen! Und eine andere Statistik berechnet den jährlichen Durchschnittsverlust in jenen Gewässern auf 200 Schiffe und 14 Millionen Mark, ganz abgesehen von den unersetzbaren Menschenleben. Der Nordostseekanal sollte hierin Wandel schaffen.
»Zum Zeichen seiner Macht und Ehre!« Konnte der Begründer des neuen Deutschen Reiches auch nicht ahnen, daß sein kaiserlicher Enkel in Gegenwart der Repräsentations-Geschwader aller großen seefahrenden Nationen und in Anwesenheit der deutschen Bundesfürsten und der Volksvertreter die Eröffnung in den Tagen der Sommersonnenwende 1895 mit auserlesener Pracht vollziehen werde, so wollte er doch mit diesem letzten Weihworte der Überzeugung Ausdruck verleihen, daß die neue Wasserstraße die Konsequenz der seit 1867 begonnenen Entwickelung einer deutschen Marine und zugleich die Voraussetzung für ein militärisches Zusammenfassen der Streitkräfte zur See und eben dadurch eine Stärkung unserer Defensiv- und Offensivstellung in den Kriegen der Zukunft bedeutet. Daß der Kanal auch als eine Errungenschaft deutscher Geistes- und Willenskraft, als ein Sieg der Technik nach einer andern Seite hin die Macht und Stärke des Deutschen Reiches bekundet, mag nicht unerwähnt bleiben. Erklärt doch der berühmte belgische Ingenieur A. Dufourny das Unternehmen für das mächtigste maritime Werk seit Fertigstellung des Suezkanals und will mit seiner Bewunderung nicht hinter dem Berge halten in Anbetracht dessen, daß in außerordentlich kurzer Frist (1887-95), ohne jede Überschreitung der Voranschläge (156 Millionen Mark), unter trefflichst organisierter Fürsorge für die 7-8000 Arbeiter hinsichtlich der Unterkunft, Verpflegung, Krankenunterstützung, der Nüchternheit und Sittlichkeit – ein Werk zustande gekommen ist, das er als ein mustergültiges bezeichnet, und dem er ein besser geleitetes nicht an die Seite zu setzen weiß. In der Tat sind Nordostsee- und Panamakanal, besonders unter dem letzteren Gesichtspunkte, schreiende Gegensätze!
Treten wir nun der technischen Seite etwas näher! In einer Gesamtlänge von 98,65 km reicht der Kanal von der Unterelbe bei Brunsbüttel bis Holtenau nördlich von Kiel. Man wählte jene Stelle als westliches Eingangstor, weil dort auch zu Zeiten des niedrigsten Wasserstandes bei Ebbe eine Tiefe von 10-11 m vorhanden ist. In der Richtung Nord, bzw. Nordost durchschneidet die Kanallinie die tiefgelegene Elbmarsch, die durch Deiche vor den etwaigen Hochwasserständen im Kanal geschützt werden mußte, um bei Grünenthal die etwa 24 m über den Ostseespiegel emporragende Wasserscheide zwischen Elbe und Eider zu durchdringen. Die Schwierigkeiten, welche die Technik zu überwinden hatte, lagen also nicht sowohl in gewaltigen Durchbohrungen hoher Felsbarrieren, als vielmehr in den Ausschachtungen sandigen, mergeligen, besonders aber des moorigen Bodens, welcher bei dem Ausheben seitlich nachquoll und Sanddämme zu beiden Seiten nötig machte, die durch das weiche Moor bis auf den Untergrund hindurch sanken. Von Grünenthal ab tritt die Kanallinie in das Gebiet der Untereider ein, deren Hochwasser Schutzdämme für den Kanal erheischten; er umgeht sodann die Stadt Rendsburg im Süden, durchquert die Seen der oberen Eider und folgt nun bis Holtenau dem Bette des alten Eiderkanals, indem er die scharfen Kurven desselben sämtlich abschneidet im Interesse der modernen Riesenfahrzeuge.
Das Profil weist eine Sohlenbreite von 22 m, eine Spiegelbreite von 64 m, eine Tiefe in der Mitte des Bettes von 9 m auf und bedingte eine Bewegung von 80 Millionen cbm Boden; das ist eine so ungeheure Masse, daß das ganze Weichbild Berlins in Größe von 6400 ha etwa 1¼ m hoch damit beschüttet werden könnte. Man bediente sich dazu der neuesten und größten Bagger, die teils im Trocknen, teils schwimmend täglich Tausende von Kubikmetern aushoben und die Ausschachtungsmasse unmittelbar in die Erdtransportzüge ausschütteten, welche sie entweder nach den aufgekauften Flächen oder an die Stellen, wo Dammschüttungen stattfanden, beförderten. Überhaupt umfaßte der Park für Arbeitsmaschinen 70 Dampfbagger, über 120 Schleppdampfer und Wasserfahrzeuge, 90 Lokomotiven, 2500 Transportwagen, riesige Krane und zur Bereitung des Betons eine große Anzahl Mörtelwerke längs der fünf Sektionen der Strecke.
Etwas über und unter dem gewöhnlichen Kanalspiegel sind die Böschungen abgepflastert, damit der Wellenschlag nicht zerstörend einzuwirken vermag. Ein großes Panzerschiff nimmt die ganze Breite des Kanals in Anspruch, alle entgegenkommenden müssen daher Gelegenheit haben, zur Seite zu fahren, daher die Ausweichestellen in etwa 12 km Entfernung. Zwei Handelschiffe aber von 12 m Breite können bequem aneinander vorbei. Im Becken der Obereider-Seen ist Gelegenheit zum Wenden gegeben. Sowohl im Interesse einer raschen, sicheren Durchfahrt als auch in Rücksicht auf die ungeheure Größe der Kriegsschiffe geschah die Ausführung ohne Treppenschleusen im Niveau des mittleren Ostseespiegels, und die Kanalfurche ist durchgängig so tief in das Gelände eingeschnitten, daß der Kanalspiegel stets dieselbe Höhe besitzt wie die mittlere Ostsee und darunter mindestens 8½ m Wassertiefe. Naturgemäß treten an beiden Ausmündungen die Fluten der Endmeere herein, welche Niveauunterschiede bis zu 7 und 8 m aufweisen. Ließe man diese Flutwellen frei im Kanal spielen, so könnte der Fall eintreten, daß jede Uferbefestigung sich als unzulänglich erwiese und daß Schiffe vergeblich gegen die Gezeitenströme ankämpften. Diesem Umstande tragen die Riesenschleusen an beiden Einfahrten Rechnung.
Die Schleusenkammern sind beiderseitig doppelt und in riesigen Maßverhältnissen angelegt: 150 m lang, 25 m weit, ihr Boden ist eine mehrere Meter dicke Betonschicht. Eine 12½ m dicke Scheidewand trennt Ein- und Ausfuhrschleuse. Die größten Panzerfahrzeuge finden darin genügenden Raum; nur die Schnelldampfer der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrtgesellschaft (18,3 m breit und 158 m lang) würden, wenn sie je in die Lage kämen, nur bei geöffneten Toren die Schleusen durchfahren können. Die durchaus eisernen Schleusentore haben nicht weniger als 17 m Höhe, sind mit Luftkammern versehen, sodaß sie schwimmen und sich leichter drehen lassen. Übrigens sind die an der Kieler Bucht nur an etwa 25 Tagen jährlich, die von Brunsbüttel indessen fast dauernd zu schließen, da sie täglich nur zweimal zur Zeit der Ebbe auf drei bis vier Stunden geöffnet werden dürfen. Die maschinelle Bedienung der Tore erfolgt unsichtbar – in den Kammern der Schleusenmauern stehen die Maschinen – und durch hydraulische Kraft. Dieselben Maschinen liefern auch das elektrische Licht für die Leuchttürme wie für die Kanalstrecke, da der Betrieb Tag und Nacht ununterbrochen erfolgt. Vor und hinter den Schleusen entdeckt das Auge geräumige Hafenbecken mit Ladestellen an beiden Ufern für Handels- und Kriegsschiffe. Zur Fahrt der Dampfschiffe durch den Kanal stehen Lotsen, zum Bugsieren der Segler Schleppdampfer stets bereit.
Da der Kanal bei der Durchquerung der jütischen Halbinsel eine Menge Kommunalwege, Chausseen und Eisenbahndämme zerschneidet, so mußten selbstverständlich die zerschnittenen Teile durch Brücken wieder verbunden werden. Die Zusammenknüpfung der durchbrochenen Gemeindewege geschieht durch 16 Fähren, von denen jedenfalls die von Sehestadt die interessanteste ist, sofern sie die beiden Hälften des vom Kanal zerteilten Dorfes verbindet. Für die vier Eisenbahnen und die stark in Anspruch genommene Chaussee bei Rendsburg waren Brücken nötig, von denen weniger die drei niedrigeren, eisernen Drehbrücken – beim Nahen des Zuges schließt sich durch hydraulische Maschinen ihre 50 m weite Öffnung – unser Staunen herausfordern, als vielmehr die beiden kühnen Hochbrücken von Grünenthalim Westen (für die westholsteinische Bahn Neumünster-Heide) und die von Levensau im Osten (für die ostholsteinische Linie Kiel-Flensburg). Da die Segelschiffe mit stehenden Masten 42 m Höhe im Lichten erfordern, die Ufer an jenen beiden Stellen aber nur 20 m über den Kanalspiegel sich erheben, so mußten Anrampungen von 22 m Höhe geschaffen werden. Hierauf ruhen die massiven Widerlager, die durch kräftige Türme belastet sind. In einem einzigen kühnen Bogen von 156,5 m Spannweite bei Grünenthal und 163,4 m bei Levensau ist die Brücke von einem Ufer zum andern gespannt. Die letztere ist eine der größten Bogenbrücken der Welt und macht als Trägerin einer doppelgleisigen Bahn und Fahrstraße den Eindruck des Festen, Dauerhaften, indes die erstere, die nur für eine eingleisige Bahn bestimmt ist, schlank, zierlich, kühn vor uns aufragt.
Beide werden aber in den Schatten gestellt werden durch die in den nächsten Jahren auszuführenden drei neuen Hochbrücken, von denen die eine Kiel mit Holtenau verbinden, die zweite die jetzige Drehbrücke bei Rendsburg ersetzen wird. Die dritte, großartigste von allen wird den Kanal in der Niederung bei Taterpfahl unweit Brunsbüttel übersetzen und die Marschenbahn aufnehmen. Sie macht weit in das Land hineinführende Zufahrtsrampen nötig, und die Gesamtkosten ihrer Herstellung sind auf annähernd 20 Millionen Mark veranschlagt.
Was die Bedeutung des neuen Wasserweges anlangt, so wird man wohltun, bei deren Würdigung zuerst von der nationalen Aufgabe zu reden, welche er nach der klar ausgesprochenen Absicht der Erbauer in erster Linie erfüllen soll und wird. Kaiser Wilhelm I. und sein Generalstabschef Moltke stellten dem Nordostseekanal zunächst eine strategische Aufgabe auf Grund folgender Erwägungen: Schon in Friedenszeiten ist den in Kiel und Wilhelmshaven stationierten Geschwadern der deutschen Marine eine Vereinigung in der Kieler Bucht oder der Unterelbe erschwert zufolge der ungünstigen nautischen Verhältnisse des Seeweges um Jütland; wesentlich schwerer würde diese, falls in Kriegszeiten Dänemark auf Seite unserer Gegner stehen sollte, weil der Sund durch die Geschütze der neuen Seefrontbefestigung Kopenhagens und die Torpedosperre bei der Insel Sprogö, der große Belt durch die Batterien von Korsör und Nyborg, der kleine Belt durch den Panzerturm und die Geschütze bei Middelfahrt verschlossen werden würde. Ganz unmöglich aber würde sie werden, wenn eine mit Dänemark verbündete Macht, beispielsweise Frankreich, dort festen Fuß faßte. Heute kann sich die Vereinigung auf deutschem Boden ungestört in 13 bis 14 Stunden vollziehen. Die Küstenbefestigungen Cuxhavens und die Batterien von Westerdeich und Brunsbüttel an der westlichen, sowie diejenigen von Kiel an der östlichen Einfahrt bilden gesicherte »Debouchépunkte« für die vereinigte Flotte.
Kaiser Wilhelm II. weihte den Kanal aber nicht zuerst zu einem Werkzeug des Krieges, sondern des Friedens für alle Völker. Und in der Tat! Wenn er auch nicht als Seitenstück zum Suezkanal hinsichtlich der meer-, länder- und völkerverbindenden Kraft gelten kann, so bietet er doch den wirtschaftlichen, den Frieden fordernden und fördernden Bestrebungen erhebliche Vorteile, sofern er besonders dem Großverkehr einen kurzen und sichern Weg aus der Nordsee in die Ostsee und umgekehrt darbietet, um so mehr als die Kanalabgaben mäßig bemessen sind Für Schiffe bis zu 600 Tons 60 Pf. per Tonne und 40 Pf. Schleppgeld, bei Schiffen über 600 Tons für den überschüssigen Tonnengehalt 40 Pf. per Tonne und 40 Pf. Schleppgeld, für Registertonnen über 600 nur 30 Pf.. Den besten Aufschluß über die kommerzielle Bedeutung des Unternehmens gibt uns folgende kleine Tabelle, welche die Weg- und Zeitersparnis darlegt für die verschiedenen Nordseehäfen, sofern sie die neue Wasserstraße wählen. Das allgemeine Gesetz, das sich daraus ableiten läßt, läßt sich so fassen: Alle die Nordseehäfen, die südlich von Hull liegen, erfahren eine nennenswerte Wegverkürzung und sind für den Kanalverkehr ausschlaggebend, während die Plätze nördlich von Hull höchstens um der größeren Sicherheit der Durchfahrt willen den Weg durch den Kanal der alten Fahrstraße durch den Sund vorziehen werden.
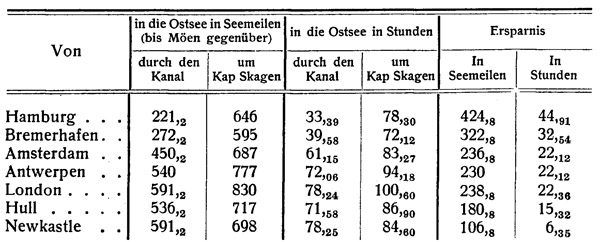
Es liegt auf der Hand, daß der Handel und die Reederei Hamburgs, das nach dem Ausspruche eines seiner Bürgermeister für sein Hauptorgan, die Elbe, eine zweite Mündung in die Ostsee erhält, und der Ostsee auf den Leib gerückt ist, den wesentlichsten Vorteil daraus ziehen wird; doch ebenso wird sich der Einfluß Bremens weit mehr als seither in der Ostsee geltend machen. Die Ostseehäfen werden sich nach dem Vorgange Stettins aufraffen müssen, ebenfalls in den transatlantischen Verkehr einzutreten, ebenfalls große Industrien zu schaffen, deren Rohmaterialien sie ein-, deren Halb- und Ganzfabrikate sie ausführen. Sie werden ferner Freihafenbezirke einrichten müssen, wo keine, auch noch so kulant gehandhabte Zollkontrolle Zeitverlust, Kosten, Hemmnisse herbeiführt; sie werden endlich Sorge zu tragen haben für einen Umschlagsplatz in der Kieler Bucht, der ihnen die Füglichkeit bietet, die Ladung großer Schiffe – denn nur solche lohnen in der transatlantischen Reederei – zu vervollständigen. In dieser Hinsicht kann ihnen Kopenhagen ein Muster sein. Diese Beherrscherin des Transitverkehrs zwischen den beiden deutschen Binnenmeeren hat alles aufgeboten, um sich seine Stellung nicht ohne weiteres entziehen zu lassen. Mit einem Aufwand von 20 Millionen Mark hat es Freihafenanlagen im größten Stil, und dazu ganz erhebliche Erleichterungen in der Zollbehandlung geschaffen. In der Tat hat es dadurch einen weit größeren Anteil, als man erwartete, von dem alten Nordostseeverkehr für sich gerettet. Indes hat doch der Vorteil, den der kürzere Weg und die größere Sicherheit insbesondere Schiffen größerer Abmessungen bietet, den Verkehr im Kanal seit seiner Eröffnung sich ständig steigern lassen. Während im Jahre 1896 insgesamt 20 068 Schiffe mit einem Tonnengehalt von rund 1,8 Millionen Registertonnen den Nordostseekanal passierten, waren es im Jahre 1908 deren 34 121 mit einem Raumgehalt von rund 6 Millionen Registertonnen. Demgemäß stieg auch die aus dem Durchgangsverkehr erzielte Summe der Abgaben, Schleppgebühren usw. von nicht ganz 1 Million Mark auf rund 3 Millionen Mark. Einem noch größeren Anwachsen des Verkehrs zeigte sich in steigendem Maße der Umstand hinderlich, daß den Fahrzeugen durch langes Liegen in den Ausweichstellen bedeutende Zeit- und damit auch Gewinnverluste entstanden und daß die Abmessungen sowohl der Kriegs- als auch der Handelsfahrzeuge in den letzten Jahren nach Tiefgang, Länge und Breite sehr bedeutend zugenommen haben. Man hat daher beschlossen, dem Kanal durch einen Erweiterungsbau Dimensionen zu geben, die ein freies Durchfluten des Verkehrs gestatten und auch Schiffen größter Abmessung die Durchfahrt ermöglichen. Mit einem Kostenaufwand von 223 Millionen Mark soll er in sieben bis acht Baujahren auf 11 m vertieft, seine Sohle auf 44 m, also auf das Doppelte, sein Spiegel auf 107 m verbreitert werden Vgl. damit den Suezkanal: 160 km lang, 75-90 m Sohlenbreite, 9½ m mittlere Tiefe, Bauzeit 10 Jahre, Kosten einschließlich der nachträglichen Erweiterungen 600 Mill. Mark, Tarif jetzt 7,75 Frank per Tonne Nettogewicht, 10 Frank Personentaxe für jeden Passagier, Durchfahrtszeit 18¾ Stunde.. Außerdem wird er, um den Schiffen das Wenden zu ermöglichen, an vier Stellen Ausbuchtungen von 220 m Spiegel und 164 m Sohlenbreite erhalten, und die Zahl der Weichen wird um 6 von je 1100 m Länge und 190:135 m Breite vermehrt werden. Endlich sollen die Seeschleusen an beiden Ausgängen der Wasserstraße um das Doppelte, nämlich auf 330 m Länge und 45 m Breite bei 13,77 m Tiefe vergrößert werden. Nach Vollendung all dieser Arbeiten wird der Kaiser-Wilhelm-Kanal, das großartigste Wasserbauwerk Deutschlands, in noch höherem Maße die dreifache Aufgabe erfüllen können, die Kaiser Wilhelm II. bei der Schlußsteinlegung am 21. Juni 1895 zuwies: »Im Namen des dreieinigen Gottes:
Zur Ehre Kaiser Wilhelms!
Zum Heile Deutschlands!
Zum Wohle der Völker!«
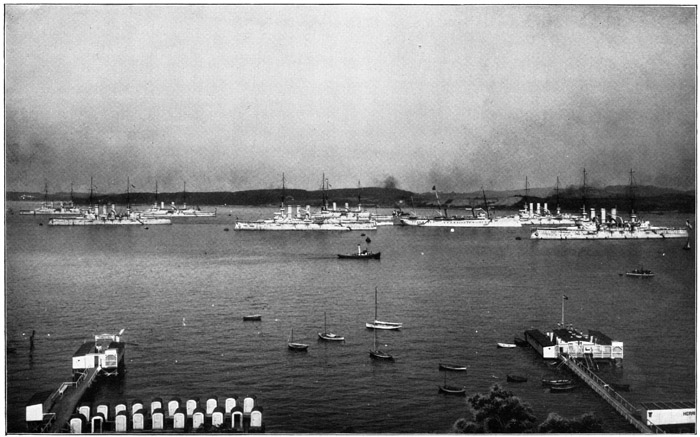
Deutsche Kriegsschiffe in der Kieler Föhrde. Nach einer Photographie von Arthur Renard, Kiel.
Unter Zugrundelegung der Arbeiten von Bauinspektor Eiselen, C. Beseke, A. Sartori, Der Nordostseekanal und die deutschen Seehäfen usw.
Von Dr. Alfred Mey in Hamburg.
An der Ostküste unserer meerumschlungenen nördlichsten Provinzen zeigt sich die innige Verbindung von Land und Meer besonders da, wo die für diese Küste so charakteristischen Föhrden tief in das Land hineingreifen. Gleichen Ursachen, der gemeinsamen Wirkung von Gletschereis, Schmelzwasser und Meerestätigkeit ihre Entstehung verdankend, erstrecken sie sich fast sämtlich in südwestlicher bis südsüdwestlicher Richtung als schmale Wasserzungen viele Kilometer weit ins Land hinein und bieten mit ihren erhöhten, vielfach bewaldeten Ufern eine Menge landschaftlicher Reize.
Die südlichste von ihnen hat in den letzten Jahrzehnten eine besondere Bedeutung für das deutsche Volk gewonnen, weil sie der erste Kriegshafen der in planmäßigem Baue zu einer stattlichen Macht heranwachsenden deutschen Flotte und dadurch zur Basis unserer Seemacht wurde. Ihren Namen führt die Föhrde nach der an ihrem innersten Teile liegenden Stadt Kiel, die zusammen mit der Flotte eine so rasche Entwicklung genommen hat, wie keine zweite Stadt Deutschlands. Bei seiner Einverleibung in Preußen zählte Kiel nicht ganz 25 000 Einwohner, zur Jahrhundertwende aber schon mehr als 100 000 und jetzt ungefähr 170 000.
Bei einer solchen Bevölkerungszunahme mußte sich um die alte Stadt Kiel, die in ihrer noch deutlich erkennbaren ursprünglichen Anlage sich an das Westufer der Innenföhrde anlehnt, ein weiter Gürtel neuer Stadtteile herausbilden, der heute schon um den innersten schmalen Teil der Föhrde, die sog. Hörn, herum an das Ostufer reicht.
Alt-Kiel hatte durch einen breiten Stadtgraben eine fast insulare Lage gehabt, heute ist dieser Wasserschutz fast völlig zugeschüttet und zeigt sich nur noch in dem Wasserbecken des »Kleinen Kiel« an, an dessen Westseite sich der Monumentalbau des neuen Stadttheaters erhebt.
Die alte Stadt ist aber noch immer das Herz von Kiel geblieben. Hier pulsiert in denselben engen Straßen, die frühere Generationen anlegten, ein reges Leben, das den Fremden fast in Verwunderung setzen kann: Auf den Fahrdämmen herrscht ein großer Verkehr von elektrischen Straßenbahnen und Wagen, auf den Bürgersteigen, besonders zur Sommerszeit, ein Gewoge von Menschen, in dem das blaue Tuch unserer Marineoffiziere und -mannschaften die Grundfarbe abgibt. Die Häuserzeilen haben freilich ein anderes Ansehen gewonnen, nur hier und da lugt zwischen modernen Geschäftsbauten noch ein alter Giebel hervor, und nur die kleinen Seitengassen lassen uns das Straßenbild ahnen, das Kiel vor 100 Jahren bot. Die Hauptstraßen münden in die Ecken des rechteckigen Marktes, dessen Südwestseite das alte turmlose Rathaus mit seinen Laubengängen einnimmt. Dicht daneben steht die alte Nikolaikirche, deren wuchtiger viereckiger Turm mit dem hohen spitzen Dache zusammen mit dem an der Peripherie, dicht am Wasser liegenden geräumigen Schlosse der Silhouette der Stadt noch das Ansehen aufprägt, das man auf alten Stichen betrachten kann.
In diesem Schlosse, das jetzt von dem Prinzen Heinrich von Preußen bewohnt wird, residierten einst die Herzöge von Gottorp, unter denen, sowie später unter den dänischen Königen, Kiel ein stilles, doch glanzvolles Dasein geführt hat. Besonders die Pflege der Wissenschaft verdankt es diesen Fürsten durch die Gründung (1665) und stetige Förderung der Universität, durch die Kiel noch heute der geistige Mittelpunkt von Schleswig-Holstein ist, und an die sich eng die Sternwarte, das Schleswig-holsteinische Museum vaterländischer Altertümer und das Provinzialkunstgewerbemuseum anschließen. Im neuen Deutschen Reiche wurde Kiel nun auch der Mittelpunkt für die theoretische Fortbildung unserer Seeoffiziere durch die Marineakademie.
Der im engsten Zusammenhange mit dem Ausbau der Kriegsflotte stehende wirtschaftliche Aufschwung Kiels zeigt sich naturgemäß am meisten in der ungeheuren Entwicklung der Schiffsbauindustrie. Am Ostufer der Innenföhrde liegen nebeneinander die Germaniawerft von Krupp, die Kaiserliche Werft und die Howaldtschen Werke. Die Privatwerften beschäftigen sich gleicherweise mit dem Bau von Kriegs- und Handelsschiffen; die Kaiserliche Werft baut zwar auch neue Kriegsschiffe, doch besteht ihre Hauptaufgabe darin, in ihren Docks für die Instandhaltung der fertigen Schiffe zu sorgen und im geschützten Hafen im Kriegsfalle beschädigte Schiffe auszubessern. Eine Unmenge von Arbeitern findet hier Beschäftigung, hat doch die Kaiserliche Werft z. B. allein schon fast 8000 Angestellte und Arbeiter. Erwähnenswert ist auch, daß es der Germaniawerft neuerdings gelungen ist, Sportsegelschiffe zu bauen, die den bisher unbestrittenen Vorrang Englands auf diesem Gebiete nicht mehr gelten lassen, denn die »Germania« und der neue »Meteor« des Kaisers, nach deutschen Plänen, aus deutschem Material gebaut, haben im Wettkampfe sich als gleichwertige Gegner in England gebauter Fahrzeuge erwiesen und Siege über die besten Renner errungen.
An sonstigen Industrien finden wir in Kiel die Müllerei in der weltberühmten Baltischen Mühlengesellschaft zu Neumühlen bei Kiel, die Goldleistenfabrikation, die Fabrikation von Spiritus, Likör und Seife, Holzbearbeitung und Holzsägerei.
Seine Größe und Bedeutung verdankt Kiel dem Hafen. Dieser gilt mit Recht als der beste und sicherste der deutschen Küste und hat dazu noch den großen Vorteil, von der Natur mit solchen Eigenschaften ausgestattet zu sein, daß es menschlicher Nachhilfe gar nicht bedurfte. Er wird gebildet von dem inneren Teile der Föhrde, die durch eine 1200 m enge Einschnürung bei Friedrichsort gegliedert wird. Die Länge des Hafens beträgt 9 km, die Breite bis zu 3000 m. Er ist fast gleichmäßig tief, in den breiten Teilen 12 bis 15 m und auch noch an der inneren Spitze 8-10 m, sodaß den Schiffen zum Ankern reichlich Platz gegeben ist. Ein Versanden ist nicht zu befürchten, da kein großer Fluß seine Sinkstoffe hier hineinführt.
Reizvoll und abwechselungsreich sind die Ufer. An der westlichen Seite erstrecken sich nach Norden bis an den Kaiser-Wilhelm-Kanal die Vororte der Stadt Kiel. Da sehen wir die schöne Villenvorstadt Düsternbrook sich an die Altstadt anschließen. Aus grünen Baumgruppen grüßen die Gebäude der Universität, der Marineakademie und des Kaiserlichen Jachtklubs. Die wunderbare Düsternbrooker Allee führt dicht am Ufer hin bis zum Stadtwäldchen, dem Düsternbrooker Gehölz mit Bellevue, dem ersten jener herrlichen Laubwälder, die so vielfach beide Ufer schmücken. Dann weitet sich der Hafen in der Wicker Bucht; aus der nördlichsten Vorstadt Wick hebt sich besonders das neue Garnisonlazarett hervor, das neben dem Eppendorfer Krankenhause bei Hamburg als das schönste und modernste in Deutschland gilt. Am innersten Punkte der Bucht aber zeigen uns ein kleiner Leuchtturm, zahlreiche Signalmasten und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Holtenau an, daß hier der Kaiser-Wilhelm-Kanal in die Ostsee mündet, an derselben Stelle, an der das östliche Ende des alten Eiderkanals lag. Über das Gehölz von Voßbrook führt dann der Weg zur Festung Friedrichsort, wo auch die Torpedowerkstatt und das Minendepot sich befinden, und zu dem Hafenausgange.
Einen anderen Anblick gewährt das Ostufer. Im innersten Teile des Hafens reihen sich die drei großen Werften aneinander, von denen uns die erste, die Germaniawerft, einen Blick in ihre glasbedeckten Hellinge werfen läßt, auf denen die großen Schiffe entstehen. Ein ohrenbetäubender Lärm, von dem Nieten der Eisenschiffe herrührend, tönt uns aus ihnen tagsüber entgegen. Die Howaldt-Werke kennzeichnen sich durch den Riesenkran, das neue Wahrzeichen Kiels gegenüber den Türmen des Westufers.
Über diese Werkstätten hinaus liegen an den noch recht waldreichen Ufern die alten Fischerdörfer Ellerbek, Heikendorf und Möltenort, von denen die letztgenannten jetzt vielbesuchte Badeorte sind.
Jenseits des auf einem Felsen sich erhebenden Friedrichsorter Leuchtturmes am Hafeneingange gehen die Ufer allmählich wieder auseinander. Hier liegen die Befestigungswerke, die die Aufgabe haben, den Hafen mit seinen Werften und Depots, sowie den Kanaleingang gegen feindliche Angriffe zu schützen. Da ist an der Westküste als Hauptwerk die Feste Friedrichsort und, ihr vorgelagert, Fort Falkenstein. Von dem hohen Ostufer grüßen die grünen Glacis von Körügen und Stosch. Noch einmal buchtet sich die Föhrde aus bei Strande und Schilksee, deren rotbedachte Häuser hinüberwinken nach dem Fischerdorfe und Badeort Laboe, dann gehen dort, wo der Leuchtturm von Bülk dem Meerfahrer den nahen Hafen anzeigt, und beim Fischerdorfe Stein auf der andern Seite die Ufer über in die Küstenlinie der weiten Ostsee.
Interessant und abwechselungsreich ist das Leben auf dem blaugrünen Wasser der Föhrde. Der innerste Teil des Hafens dient als Handelshafen. Hier machen an den Kais die Handelsschiffe fest, die den Verkehr mit den Ostseestaaten vermitteln, hier legen die schlanken Postdampfer an, die zweimal täglich nach Korsör auf der dänischen Insel Seeland fahren, und die großen Fischkutter, die von der hohen See ihren Fang nach Kiel bringen, aus dessen großen Räuchereien die weltberühmten Kieler Bücklinge und Sprotten hervorgehen.
Der übrige Teil des Hafens steht ganz unter dem Zeichen der Kriegsmarine. Da liegen während der größten Zeit des Jahres die Linienschiffe und Kreuzer unserer Hochseeflotte an den roten Bojen, von denen sie sich dann einzeln öfter zu kleinen Übungsfahrten nach der offenen See loslösen. Nur einmal im Jahre verschwinden sie sämtlich auf längere Zeit, wenn die gesamte Hochseeflotte zum Manöver durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach der Nordsee abdampft. Dann liegt der Hafen recht vereinsamt da.
Sonst aber herrscht reges Leben. Zwischen den einzelnen Schiffen und dem Ufer ist ein ständiger Verkehr von Dampfpinassen, besonders wenn an Urlaubstagen die Blaujacken scharenweise an Land kommen. Wenn wir mit einem der Hafenrundfahrtdampfer dicht an den schwimmenden Kolossen vorüberfahren, dann sehen wir auch, wie an Bord gearbeitet wird, um in straffem Dienste, auch wenn das Schiff scheinbar in Muße daliegt, die Mannschaft kriegstüchtig zu machen. Durch Wink- und Flaggensignale am Tage, durch Lichtzeichen nachts, stehen die Schiffe untereinander in ständiger Verbindung.
Einmal im Jahre trägt der Kieler Hafen und mit ihm die Stadt Kiel ein besonders festliches Gepräge. Das ist, wenn der Deutsche Kaiser zur sogenannten »Kieler Woche« kommt. Am Tage seiner Ankunft legen die Schiffe, die schon wochenlang vorher Toilette gemacht haben, um in tadellosem grauen Anstriche blitzsauber von der Wasserlinie bis zum Topp zu erscheinen, festlichen Schmuck an. Vom Bug über die Masten bis zum Heck zieht sich eine Kette bunter Signalflaggen. Wenn dann die kaiserliche Jacht aus der Schleuse bei Holtenau in den Hafen einfährt, da dröhnen die Salutschüsse, die Schiffskapellen spielen, die Mannschaft steht in Paradeaufstellung, während ihr oberster Kriegsherr stolz und freudig bewegt durch die stattliche Doppelreihe der schwimmenden Wehren, dem eigensten Werke seiner Regierung, hindurchfährt.
Die Kieler Woche entfaltet ein besonders lebhaftes Bild auf der Innen- und Außenföhrde. Die Kriegsschiffskutter messen sich im Wettrudern und entzücken durch die Gleichmäßigkeit des Ruderschlages, vor allen Dingen aber gleiten eine Unmenge von Segeljachten über die Wellen, mit ihren blendend weißen Fittichen den Wind fangend, um durch geschickte Ausnutzung seiner Kraft den Sieg zu erringen.
In dieser Woche bietet sich dem Auge an einem Abend noch ein besonders unvergeßlicher Anblick, wenn die Konturen der Kriegsschiffe durch Reihen von Glühbirnen in die Nacht gezeichnet werden, wenn Hunderte von weißen, roten und grünen Signalsternen mit einem Male emporschießen und die Scheinwerfer der Schiffe mit ihren weit in die Luft hineindringenden schlanken Lichtkegeln ein einzigartiges Mühlenspiel aufführen.
Der Wert aber und die Stärke unserer Flotte für mögliche ernste Stunden wird dem wenigstens andeutungsweise klar, der einmal bei einem Besuche an Bord die Kampfmittel, besonders die mächtigen Geschütze gesehen hat. Im Herbste hört er wohl auch von der offenen See dumpfen Geschützdonner, und zurückgebrachte, in sich zusammengesunkene Scheiben führen ihm vor Augen, was dieser Teil der deutschen Wehrmacht zu leisten vermag.
Auch das Land, in welches die Kieler Föhrde eingebettet liegt, ist schön. Es ist die typische holsteinische Landschaft, der leichtgewellte Boden ist reichgegliedert durch die charakteristischen Knicks, deren Weißdornhecken im Frühjahr so schön sind. Zahlreiche kleine Seen wechseln mit Wäldern und Dörfern. Besonders lohnend ist eine Wanderung an den hohen Böschungen des Kaiser-Wilhelm-Kanals bis zur Hochbrücke von Levensau oder an den reizenden Ufern der Schwentine, dem einzigen Flüßchen, das sein Wasser der Föhrde zuführt.
In der Tat, ein ärmliches Stück Land beim ersten flüchtigen Beschauen, jene geknickte Halbinsel, die ihr Knie bei Darßer Ort herausdrückt und ihre beiden Schenkel nach Vorpommern und Mecklenburg zu streckt. Jener größere östliche ist unter dem Namen der Halbinsel Zingst, dieser kleinere westliche als das » Fischland« bekannt. Diesem Landstreifen, der wie ein schmales Brett zwischen Ostsee und Ribnitzer Bodden nach Nordosten sich erstreckt, gilt unser Besuch, weil wir hier lernen können, was ein wetter- und willensfestes Geschlecht von etwa 2000 Seelen im Bunde wie im Kampfe mit der heimatlichen Landesnatur zu leisten imstande ist. Hohe Dünen, deren blendende Weiße einen lebhaften Gegensatz zu dem dunklen Grün des Meeres bildet, werden durch Strandhafer und dürftige Kiefern festgebunden an verschiedenen Stellen, an anderen erhebt sich der Sand in gewaltigem Wirbel in die Luft, sobald ein Windstoß brausend in die Dünen hineinfährt. Und Wind gibt es hier fast immer und von erster Güte. Zahllose Möwen aller Art bewohnen diese Dünen und beleben die sonst öde Küstenlandschaft. Wäre das widrige heisere Angstgeschrei dieser Vögel nicht, es wären sonst in jeder Weise schöne Tiere. Wie schneeweiß und dann wieder perl- oder isabellenfarbig ist ihr Gefieder; welche Leichtigkeit, ja selbst Anmut liegt in ihrem wilden Herumtummeln! Gleich einem Pfeil, so schnell taucht eine in die Flut, einen armen Fisch als Beute zu erhaschen, kreischend stürzt sich der Gefährtinnen Schar auf diese, um den Raub ihr streitig zu machen. Welche Wendungen macht nicht die Verfolgte, ihren Feindinnen zu entgehen, bald ist sie tief unter ihnen und scheint fast von den Wellen verschlungen, dann wieder hoch oben über den Dünen! So treiben sie es ganze Stunden, in immer neuer Abwechselung, nie im Fluge ermüdend, nie im Hunger gestillt, nie in der Kehle verstummt. Wenn aber gar ein Sturm im Anzuge ist, wenn dunkle Wolken den fernen Horizont bedecken, wie verdoppelt sich dann ihre Tätigkeit, wie schreien sie dann so gellend und kreischend, als ob eine innere Angst ihnen diese Klagetöne auspreßte! Und der kleine Fischländer Bube läuft dann zur Mutter und ruft: »Moder, et wat weihn, dee Meew de schriet so doull!« (Mutter, es wird wehen, die Möwe schreit so toll.)
»Swante-Wustrow« (heilige Insel) muß, wie aus dieser ältesten Bezeichnung des Fischlandes sich ergibt, in alter Zeit ein Eiland mit einem wendischen Heiligtum gewesen sein. Der brackige Ribnitzer Bodden an der Binnenseite der heutigen Halbinsel hat ehemals durch einen Mündungsarm der Recknitz Den Störtebeckshafen der alten Karten. mit dem offenen Meere in Verbindung gestanden; doch ist diese Durchfahrt schon längst durch Versandung gesperrt. Die Ribnitzer Bucht gewährte im Mittelalter Strandräubern, Vitalienbrüdern sicheren Versteck, sodaß einst Stralsund seinen Hauptmann Karsten Sarnow zur Bestrafung jener aussenden mußte. Mag immer dieses Raubrittertum zur See den und jenen Fischländer angelockt haben, so sind sie doch bald zu ehrlicher Hantierung zurückgekehrt, indem sie die Schätze des Meeres als Fischer sich nutzbar machten. Auch heute noch stechen ihre Zesenkähne hinaus in die Salzflut, jene großen Boote, die mit dem daran befestigten Schleppnetz (Zese) durch Segel vor dem Winde treiben, um besonders den Hering und Lachs zu fangen. In früheren Zeiten konnte man im Frühjahr Kärrner aus allen fünf oder sechs Dörfern des Fischlandes auf den Wegen sehen, die den Inhalt der Räuchereien nach Rostock führten. Tief bis an die Achsen sanken die Wagen in den Sand, und man konnte sich nur wundern, wie die kleinen, mageren, zottigen »Fischländer« bei einer Fütterung von Heu, Fisch, ja gestoßenen Fischgräten die Karren vorwärts brachten. Und doch sind diese Fischländer Pferde, die übrigens bei kräftiger Ernährung von Jugend auf den dänischen Stammeltern nicht nachstehen, von einer Flinkheit und Ausdauer, daß die Kosaken 1813 ihre Remonten gern aus dem Fischlande nahmen.
Die Fischerei ist heute ebensowenig die Haupterwerbsquelle, wie der Landbau, der zwar einen leidlichen Roggenboden zur Verfügung hat, aber durch den fliegenden Sand leidet, sodaß die Hafer-, Buchweizen- und Kartoffelfelder den Reisenden aus der Börde oder Marsch jedenfalls wenig erbauen werden. Daß es mit den Wiesen nicht viel besser bestellt ist, zeigt sich am klarsten bei einem ländlichen Fest, der sogenannten Morgensprache, der Verteilung des verauktionierten Grases auf den Ribnitzer Stadtwiesen. Alles, was Kühe besitzt, besonders hochgeschürzte, barfüßige Frauen und Mädchen machen sich in Scharen dorthin auf, lagern sich auf dem mit Erfrischungsbuden besetzten Sammelplatze in Gruppen und warten sehnsüchtig auf das Aufziehen der Flagge, das Zeichen der Ankunft des Magistrats, der die Verteilung vornimmt, und sofort gehen dann die aus dem Binnenlande angekommenen Mäher an die Arbeit.
Nein, die Orte wie Wustrow, Dierhagen, Dänendorf müssen andere Quellen des Wohlstandes haben; denn nicht die Bauerngehöfte machen den Eindruck der Wohlhabenheit, sondern andere Wohnungen, die schon von außen sorgfältig geputzte Backsteinmauern, rotes Steindach, hohe Zimmer, spiegelnde große Fensterscheiben aus bestem, zum Teil holländischem Glas mit grüngestrichenen Rahmen, Glastüren mit blitzblanken Klinken und zur Seite ein sauber gepflegtes Gärtchen mit Blumen und Obstbäumen erkennen lassen. Wir treten ein, um auch dem Departement des Innern unsere Aufmerksamkeit zu schenken: da stehen auf der mit Fliesen ausgelegten Hausflur die alten gebohnten Koffer von Eiche, welche die Leinenschätze der Hausfrau enthalten. Doch da öffnet sie selbst die Tür, sich entschuldigend, daß nicht der Gatte uns willkommen heißt, da er auf weiter Fahrt abwesend. Die Kinder kommen herzu und schließen sich dem Rundgange durch alle Räume des Hauses an, um so lieber, als während der Reise des Vaters nur das bescheidenste Hinter- oder Dachstübchen ihnen und der Mutter zum Aufenthalt dient. Doch schon hier steht ein Sofa, über ihm hängt das Ölbild mit Goldrahmen, das des Vaters Schiff darstellt, auf der Kommode tickt die Pendeluhr – umrahmt von schön geordneten Muscheln fremder Zonen, und an der Decke schweben ein ausgestopfter Delphin, Kokosnüsse und ein vollständiges Schiffsmodell. Wir betreten das Allerheiligste des Hauses: schöne Mahagonimöbel, ein großer Spiegel, Polsterstühle! Doch ohne ein Zeichen der Benutzung. Mit leuchtendem Auge aber öffnet die Fischländerin den nächsten Raum: ihre Küche, eigentlich ihren Küchensalon; denn alles, was hier steht und hängt: der Kochherd mit weißen Kacheln und blankem Messingrand, die Wände und Schränke voll des feinsten englischen Porzellans, ist nur zur Augenweide. Der Herd, auf welchem die Hausfrau die Tageskost bereitet, liegt in einem Anbau nach dem Hofe zu. Sie nötigt uns, ein Gläschen Rum anzunehmen, da der Sturm uns durchschüttelt hat; es ist echter Jamaika in feingeschliffenem Gläschen; doch so leichten Kaufes kommen wir in dem gastfreien Hause nicht davon; wir dürfen auch eine Tasse Kaffee nicht ausschlagen und sind nicht bloß überrascht von dem vorzüglichen Aroma und Geschmack, sondern auch von der Feinheit des Services, in dem er uns dargereicht wird; da ist alles: Präsentierbrett, Tasse, Kanne, Sahnengießer vom feinsten englischen Porzellan, die Zuckerdose kristallen und mit Silberrand eingefaßt, der Kaffeelöffel schwer und gediegen. Die Kinder erzählen mit Stolz, daß das der Vater von seinen Reisen mitgebracht und jedesmal etwas Neues hinzufügt. Es ist ein schöner Zug im Charakter dieser Fischländerinnen, daß sie während der Abwesenheit des Mannes in treuer Arbeit, zurückgezogen und in einfachster Lebensweise mit den Kindern die Tage zubringen, und erst nach der Wiederkunft des Hausherrn sich ihres Wohlstandes freuen. Am Tage nach der Heimkehr spricht der Neuangekommene bei den Nachbarn vor, überall begrüßt mit einem herzlichen: »Woll tau seihn!« (Eigentlich: Wir freuen uns, dich wohl zu sehen), und stattet an der »Börse«, dem täglichen Sammelpunkte der fahrenden und ausgedienten Seeleute, Bericht ab über die Fahrt und knüpft zugleich alle die Fäden über die Dinge der Heimat an, die mit seinem Weggange zerrissen wurden.
Schon aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß in der Seefahrt die hauptsächlichste Quelle des Wohlstandes zu suchen ist. Hier im Fischland quält die Eltern nicht die Frage über die Berufswahl des Sohnes: der Ahne, Großvater, Vater, Bruder, Onkel, Nachbar, die Kameraden – alle, die es zu etwas gebracht oder zu bringen gedenken, sind und werden Schiffer, also wird er es auch. Ist ihm nicht die Handhabung von Segel und Steuer ebenso leicht, ja leichter als diejenige von Griffel und Feder! Wie hat er leuchtenden Auges und fast mit verhaltenem Neide den älteren Bruder angestaunt, als er nach dem Examen an der Navigationsschule zu Wustrow hereintrat, mit dem Patent des Schiffers in der Tasche, von allen gelobt und gefeiert, der Stolz der Eltern! Von diesem Tage an steht auch sein Entschluß felsenfest. Er tritt mit 14 Jahren als Schiffsjunge in dieselbe Schule ein, bildet sich im Sommer praktisch im Seedienst, im Winter aber, wenn die Schiffe im Hafen liegen, theoretisch aus als Jungmann und Matrose. Will er seine Steuermannsprüfung ablegen, so werden 33 Monate Fahrt verlangt, wovon 12 im Matrosendienst. Bei eifriger Fortsetzung der Studien und nach 24 monatlicher Bewährung im Dienste kann er die letzte Prüfung ablegen: das eigentliche Schifferexamen, und nun liegt die Ehrenstaffel offen vor ihm.
Schon frühzeitig führten die Bauern des Amtes Ribnitz ihr Getreide selbst zu Wasser nach Lübeck, zum nicht geringen Verdruß von Rostock und Wismar, welche das alleinige Hafenrecht für Mecklenburg erworben hatten, und gar oft wurden die Fischlandsboote, die mit Gerste nach Lübeck fuhren, bei Warnemünde angehalten. Doch da Wustrow 1669 aus klösterlichem in den Besitz der Herzöge von Mecklenburg überging, so erfreute es sich von da ab gegen die fortgesetzten Belästigungen mächtigen Schutzes, und es tauchte sogar (1776) der Plan auf, den vorerwähnten Mündungsarm der Recknitz wieder zu öffnen, den Ribnitzer Bodden wieder in direktere Verbindung mit der Ostsee zu setzen und den Hafen von Ribnitz auszubauen. Dieser Gedanke ist zwar niemals zur Ausführung gekommen, aber trotzdem entwickelte sich die Schiffahrt des Fischlandes im 19. Jahrhundert fröhlich weiter. Man verfrachtete nicht mehr bloß Holz von Darß und Getreide von Ribnitz nach Kopenhagen, wie im vorigen Jahrhundert, sondern löschte die Ladungen für Rostocker, Hamburger und andere Firmen in den Häfen Preußens, Rußlands, Schwedens, Dänemarks, Hollands, Englands, Brasiliens, Westindiens, in Alexandria und Odessa, auch als Grönlandfahrer genossen die Fischländer eines ausgezeichneten Rufes. Das eigentlich Bewundernswerte dabei ist die Tatsache, daß die Fischländer nicht nur im Dienste fremder Reeder von Rostock, Wismar u. a. Hervorragendes leisteten, sondern auch auf dem Wege der Assoziation, des genossenschaftlichen Zusammentretens und Zusammenlegens von Kapital sich selbst in die Reihe der Reeder stellten.
In unserer Zeit freilich, da die Großunternehmungen der Dampfschiffahrtslinien den Seeverkehr beherrschen, sind die kleinen Genossenschaftsreedereien des Fischlandes verschwunden, seine meerfahrenden Männer und Jünglinge durchqueren den Ozean heute ausschließlich in fremden Diensten. Damit hat aber die Seefahrt als Erwerbsquelle für die Fischländer Gemeinden an Bedeutung verloren. Jedoch ließen sich die wackeren, den Geist des Fortschrittes begreifenden Bewohner durch diese betrübende Erfahrung nicht entmutigen. Sie traten fast alle zu einem Vereine zusammen, um ihrem Heimatlande neue Erwerbsquellen zu öffnen, und zwar durch Errichtung eines Seebades in Wustrow. Fünf bis zehn Minuten vom Strande entfernt, besitzt es am Meere schöne Promenaden und herrliche Fernsicht bis zu den Leuchttürmen von Warnemünde und Gjedser, durchsichtiges klares Wasser (Mitteltemperatur 16° C) auf festem Sandgrunde, vorherrschende Westwinde und kräftigen Wellenschlag. Man baute Badezellen und eine Warmbadeanstalt, legte Spazierwege an von Wustrow nach dem Strande und diesem entlang, errichtete hier einen Pavillon und brachte die Häuser in einen Stand, daß sie den Badegästen ein behagliches Heim boten; die Hotelwirte statteten ihre Räume mit Billards, Flügeln, Salons usw. aus, man sorgte ferner für Dampfschiffahrtsverbindung nach Ribnitz und Arenshop, und hatte die Freude, die Zahl der Badegäste von Jahr zu Jahr wachsen zu sehen. Gegenwärtig beträgt die jährliche Besucherzahl etwa 1500.
Daß den Leuten auch sonst das Herz auf dem rechten Fleck sitzt, zeigt sich gar manchmal in schöner Weise, zumal im Winter, wenn der größere Teil der Matrosen daheim ist und draußen ein pfeifender Nord die mächtigen Eisschollen durcheinandertreibt. Dunkle Wolken verkündigen ein nahes Schneegestöber. Da wird ein Schiff, zwischen den Eisschollen eingefroren, sichtbar, das durch Notzeichen andeutet, daß ihm der Mundvorrat ausgegangen. Sowie die Matrosen im Dorfe, die im Winter in großer Zahl zu Hause sind, dies sehen, bereiten sie sich vor, Hilfe zu bringen. Trotz Kälte und Sturm ziehen 20 bis 30 junge Burschen, jeder einen Sack mit Kohlen, Brot, Fleisch und Rumflaschen auf den Rücken gebunden, aus, um das Schiff zu erreichen. Mit Eissporen, die das Ausgleiten verhindern, an den großen Wasserstiefeln, müssen sie oft von Scholle zu Scholle springen, stets in Gefahr, abzugleiten oder den Sprung zu kurz zu machen. Sind die Schollen zu weit auseinander, um den Sprung zu wagen, so legen sie Bretter hinüber, deren sie zu diesem Zwecke stets einige mit sich führen. So erreichen sie oft erst nach vielen mühevollen Stunden das Schiff, bringen der Mannschaft darauf die ersehnte Zufuhr, wofür sie bloß den Preis, den sie selbst dafür bezahlt haben, nehmen, sprechen ihr Mut ein, wenn sie dessen bedarf, und treten dann getrost den Heimweg wieder an. Oft überfällt ein alles verdunkelndes Schneegestöber sie dabei, was die Gefährlichkeit des Weges, den sie dann nur vermittels ihrer Taschenkompasse zu finden vermögen, sehr erhöht. Mitunter hat es sich wohl auch ereignet, daß die Eismasse sich unterdes vom festen Lande trennte und so die Abgeschnittenen mehrere Tage darauf umhertrieben, bevor sie wieder die Heimat erreichen konnten. Alles dies wird aber die Fischländer nicht abhalten, eingefrorenen Schiffen im Winter alle mögliche Hilfe zu bringen, sobald nur irgendwie eine Aussicht vorhanden, die Gefährdeten zu erreichen.
Wir gedenken zum Schlusse eines eigentümlichen Sports, der zwar keineswegs auf das Fischland beschränkt ist, aber dort sich besonderer Gunst erfreut: es ist der Segelschlitten-Sport. Ein Segelschlitten sieht genau wie ein Boot aus, das auf zwei starken eisernen Schlittenkufen ruht. Die Takelage besteht aus dem Mast und gewöhnlich zwei Segeln. Von besonderer Wichtigkeit ist das Steuer, ein 1–1½ m langer, fingerdicker, mit scharfen Zähnen versehener Eisenstab, der in einem Scharnier läuft und durch Eindrücken ins Eis das Anhalten wie das Wenden bewirkt. Das Lenken erfordert dieselbe Geschicklichkeit, Umsicht und Kaltblütigkeit wie die Handhabung des wirklichen Bootes; unter geschulter Leitung saust man im Segelschlitten gefahrlos dahin wie ein Sturmvogel, unter ungeschickter Führung gibt es kaum etwas Gefahrvolleres. Folgende kleine Episode aus einer solchen Schlittenpartie möge das erhärten:
»Ich machte im stillen meine Betrachtungen über die heftige Steigerung des Windes. Da klopfte es an die Tür, und das verwitterte Gesicht Klaassens wurde sichtbar. Er mahnte zur Heimkehr und zwar dringend. Der Wind blase beinahe zu grob, und das Eis hätte bei Nienhagen eine ›Borst‹ bekommen. Das schien nun freilich allen bedenklich, und die Gesellschaft rüstete sich eiligst zum Aufbruch.
Die Kunde von dem Riß im Eise hatte der Steuermann eines nach uns eingelaufenen Schlittens unserem Klaassen gebracht und natürlich die Lage desselben genau angegeben; es handelte sich nun darum, mit dem Schlitten die Richtung des Risses rechtwinklig zu durchschneiden, weshalb Klaassen einen etwas anderen Kurs steuern mußte.
Klaassen hatte mit Genugtuung meine aufmerksame Beobachtung seiner Geschicklichkeit und meine Freude über solche Sturmfahrt bemerkt. Lächelnd bedeutete er mich, es solle erst recht losgehen; wenn wir vor den Wind kämen, dann wolle er zeigen, was ein guter Segelschlitten vermöge. Auf seinen Zuruf wurden alle Segel gewendet; kreischend drückte sich das Steuereisen in das Eis ein.
›Setten Se sick rittlings, Herr!‹ rief Klaassen; ich tat es widerstrebend, da faßte der Wind die Segel, und mit rasender Eile jagte der Schlitten dahin.
›Mit Gott! – Klaassen!‹ stöhnte die gute Frau Försterin, ›de Borst – de Borst!‹
›Ach wat, de het nicht Tid tau bräken!‹
›Klaassen, hollen S' vor de Borst an, un unnersöken S' dat Is!‹
Ein pfiffiges Lächeln war seine Antwort.
›De Borst in Sicht!‹ rief einer seiner Jungen.
›Treckt de Segels fast an!‹ schrie Klaassen.
Wie ein Pfeil schoß der Schlitten heran; hochauf spritzte die Flut aus dem Riß – wahrlich das Eis hatte keine Zeit zum Brechen. Die Frau Försterin atmete erleichtert auf. Klaassen lachte; der Förster zündete sich die Pfeife wieder an, und ich bedauerte das nahe Ende der Fahrt. Bald fiel das Hauptsegel; das Eisen kreischte im Eise und wir waren daheim.«
Von Professor Dr. W. Schütte in Stralsund.
Nordwestlich von den Odermündungen und von ihnen nur wenige Meilen entfernt liegt die größte deutsche Insel, das wegen seiner Naturschönheiten viel bewunderte und viel besuchte Rügen. Der Reisende, der aus der flachen, sandigen Mark, oder den Küstenebenen des nördlichen Pommern oder Mecklenburg kommend, den Strand des meerumschlungenen Eilandes betritt, wird auf das angenehmste überrascht und erfreut durch den Gegensatz, welchen die rügensche Landschaft mit den verlassenen Gegenden bildet. Zwar hat die Insel kein wirkliches Gebirge aufzuweisen, zwar sind die Höhen, die der Rügener als Berge bezeichnet, nur ansehnliche Hügel, dennoch aber tragen einzelne Partien mit ihren Tälern und Schluchten, ihren rasch strömenden Bächen, ihren rauschenden Bergwäldern entschieden den Charakter einer Gebirgslandschaft. Und selbst der Tourist, der die Gebirge Deutschlands durchwandert und die Schneeberge der Alpen erstiegen hat, wird nicht unbefriedigt von der Insel scheiden: denn hier begrüßt ihn die mächtige, brausende See, die sich bis in die weiteste Ferne dehnt und deren unbegrenzte Fläche nicht minder als die hohen Berggipfel den Eindruck des Erhabenen hervorruft. Rings umgürtet sie die Insel, dringt mit ihren Buchten und Busen tief in sie ein und zerspaltet sie in viele oft nur durch schmale Landengen miteinander verbundene Glieder, sodaß es keinen zweiten Punkt an den deutschen Küsten gibt, wo Meer und Land sich gegenseitig so durchdringen und sich zu einem so wunderbaren Bilde vereinigen wie hier. Der Blick in die tiefe Kreideschlucht von Stubbenkammer, mit der unendlichen See als Hintergrund, die Rundschau von dem Turme des Jagdschlosses in der Granitz über die Wipfel des Waldes auf die zahlreichen Landzungen und Meeresarme bieten im ersten Falle ein so erhabenes und im zweiten ein so liebliches Bild, daß auch ein durch die Schönheiten des Hochgebirges verwöhntes Auge sich befriedigt fühlen wird.
Auch der Altertumsfreund, der von den Schönheiten der Natur gern den Blick in die Vergangenheit zurückwendet und ihren Spuren nachgeht, findet hier mannigfache Ausbeute. Hier war die letzte Zuflucht des von den Germanen und dem Christentum immer weiter zurückgedrängten heidnischen Wendenvolkes; auf der nördlichsten Spitze der Insel stand der Tempel des Swantewit, nach dessen Zerstörung durch die Dänen das Heidentum auf Rügen zugrunde ging und die Wenden bald mit den Deutschen verschmolzen. Wer nicht allzu kritisch zu Werke geht, der kann hier den heiligen Hain der Hertha begrüßen und den See betrachten, der die Sklaven der Göttin verschlang, wie es Tacitus berichtet. Gelingt es ihm, den Insulanern Vertrauen abzugewinnen, und lernt er ihre Sprache verstehen, so kann er einen reichen Schatz von Sagen sammeln und seine Kenntnisse von Riesen und Kobolden, verzauberten Jungfrauen und argem Teufelsspuk auf das reichlichste erweitern. Kurz, die Insel bietet des Schönen und des Interessanten so viel, daß es sich schon der Mühe lohnt, einen Blick auf sie zu werfen.
Rügen wird im Westen von dem Festlande nur durch einen schmalen Meeresarm, den Strelasund, getrennt, dessen Breite zwischen Stralsund und Alte Fähre nur 2½ km beträgt und über den hinweg sich die pommersche Küste leicht erreichen läßt, auch der Greifswalder Bodden Bodden von »bodde« (vgl. Bottich) = offenes Faß, bezeichnet eine fast ganz geschlossene Bucht., der den Südrand bespült, hat nur eine Breite von wenigen Meilen, sodaß man von der Insel aus bei klarem Wetter die gegenüberliegende Küste deutlich am Horizonte erkennt. Dagegen sind die Nord- und Ostküste dem offenen Meere zugewendet und haben alle Unbill zu ertragen, die der ewige Anprall der Wogen mit sich bringt. Wie ein Sturmbock und Wellenbrecher stemmt sich hier die Insel dem Andrange des Meeres entgegen und bildet für das westlich gelegene Neuvorpommern ein schützendes Bollwerk gegen die zerstörende Tätigkeit der Wogen. Durch diese Lage ist ein wesentlicher Unterschied in der Gestaltung der rügenschen Küsten bedingt. Der dem offenen Meere zugewendete Ostrand der Insel hat nur zwei große, sanft geschweifte Busen, die Tromper und Prorer Wiek Wiek vom altnordischen »vik« (vgl. Wikinger) benennt einen offeneren Busen., aufzuweisen, während der Süd- und Westrand durch zahllose Buchten und Inwieken zerschnitten werden; dort liegt der Strand ganz frei, und keine kleineren Inseln schwächen die Kraft des Wogendranges, hier in dem ruhigen Binnenwasser haben sich mehrere Eilande abgelagert, Ummanz, Hiddensöe und andere kleinere Inselchen. An den Ufern der Ostküste nagen die Wellen unablässig, und große Steine, die von den unterwaschenen und weggespülten Wänden herabgestürzt sind, geben Kunde von dieser zerstörenden Tätigkeit des Meeres; an der Westküste dagegen lagern die Meeresströmungen mitgeführten Sand und Schlamm ab, sodaß das schmale Fahrwasser fortwährend versandet und durch Baggerungen für größere Schiffe offen erhalten werden muß.
Durch das Eingreifen des Meeres wird Rügen in viele einzelne Glieder gespalten, die zum Teil nur lose untereinander verbunden sind. An den Kern der Insel, das eigentliche Rügen, schließt sich im Südosten die Halbinsel Mönchgut, die selbst wieder von schmalen Meeresarmen in verschiedene Landzungen zerschnitten wird; der von Westen her tief eingreifende Jasmunder Bodden trennt von dem Hauptkörper der Insel im Norden und Nordosten die beiden großen Halbinseln Wittow und Jasmund, die durch zwei flache Dünen, die Schaabe und die Schmale Heide, untereinander und mit Rügen verbunden sind. Auch der Rand des Kerns selbst ist vielfach ausgezackt und sendet zahlreiche Halbinseln in das Meer und den Jasmunder Bodden hinaus, Zudar, Drigge, Liddow usw., sodaß von einem hochgelegenen Punkte, wie vom Rugard aus, von dem man die ganze Insel übersieht, sich dem Auge ein wunderbares Gemisch von Land und Wasser darbietet. Die einzelnen Glieder erheben sich zu sehr verschiedenen Höhen. Die flachen Bindeglieder zwischen Wittow, Jasmund und den einzelnen Teilen von Mönchgut überragen nur wenig das Niveau des Meeres, außer wo der Wind den losen Sand zusammengetrieben und zu Dünen aufgetürmt hat, während die Insel selbst zu ansehnlichen Hügeln aufstrebt und die östliche Halbinsel noch bedeutendere Höhen aufweist. Deutlich zeigt sich eine Erhebung des ganzen Bodens in der Richtung von Südwest nach Nordost. Auf dem eigentlichen Rügen, dessen Westküste keine nennenswerten Höhen aufzuweisen hat, liegen die höchsten Punkte sämtlich nach Osten hin, so der 102 m hohe Rugard bei der Stadt Bergen und der Fürstenberg in dem Bergwalde der Granitz, dessen 140 m hoher Gipfel das Jagdschloß des Fürsten Putbus trägt. Auch auf Hiddensöe, Wittow und Jasmund macht sich dies Aufschwellen nach Nordosten hin bemerkbar. Die Nordostspitze der ersteren Insel, der Dornbusch, erreicht eine Höhe von 80 m, das berühmte Vorgebirge Arkona, das sich weit nach Nordosten hin in das Meer hinausschiebt, strebt 54 m hoch auf, und endlich steigt das ebenfalls nach Nordosten gewendete stolze Kreidevorgebirge Stubbenkammer auf Jasmund 130 m hoch aus dem Meere empor. Der höchste Punkt der Insel ist der Piekberg in der Stubnitz mit 161 m Höhe, der aber leider infolge Bewaldung keinen freien Überblick gewährt.

Die Insel Rügen. Aus Baedekers Norddeutschland.
Diese einzelnen Glieder, in welche die Insel zerschnitten ist, gehören verschiedenen geologischen Formationen an. Auf Rügen selbst und auf Mönchgut herrschen diluvialer Lehm und Mergel vor; dagegen bestehen die Schaabe und die Schmale Heide ganz aus alluvialem Sand und Grus, während auf Wittow und Jasmund die Kreide frei zutage tritt oder doch in einiger Tiefe den Untergrund des Bodens bildet. Ursprünglich lag an der Stelle des jetzigen Rügens ein Archipel zahlreicher kleiner Inseln. Um deren größte, den jetzigen Hauptkern, gruppierten sich Wittow, Jasmund, die Lehmberge von Mönchgut, der Vilm, der Dornbusch von Hiddensöe und noch manche andere kleine Inselchen. Zwischen ihnen bildeten sich Meeresströmungen und lagerten mitgeführten Sand zu langgestreckten Bänken ab, die sich allmählich erhöhten, aus dem Meere emporwuchsen und als sandige Landengen die Verbindung zwischen den einzelnen Inseln herstellten.
Unzweifelhaft haben die Nord- und Ostküste früher sich weiter erstreckt als jetzt, wovon die Steinblöcke Zeugnis ablegen, die bis auf bedeutende Entfernung hin den Meeresboden bedecken. Der Wellenschlag unterhöhlt die Uferwände und spült allmählich so viel von ihnen los, daß die oberen Teile ihren Halt verlieren; so löste sich in den dreißiger Jahren bei Arkona eine gewaltige Kreidemasse von etwa 230 Kubikmeter Inhalt, die in einem schroffen Winkel überhing, los und blieb noch jahrelang am Strande sichtbar, bis die Wellen sie gänzlich zertrümmerten. Die zerstörende Wirkung der Wogen wird wesentlich durch den Regen unterstützt; heftige Güsse spülen den weichen Lehm und die erdige Kreide los, und man sieht die Kreideufer durch lange Rinnen gefurcht, die sich das Regenwasser nach und nach gegraben hat. Nicht minder verderblich wirkt der Frost: das in die Spalten der Kreide eingesickerte Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und zersprengt die wenig feste Masse ungleich leichter als die Felsen der Gebirge, die doch ebenfalls unter dem Einfluß der Kälte gespalten werden. Bei Lehmufern macht das in den Boden dringende Regenwasser die Tonschichten, die es nicht durchlassen, so schlüpfrig, daß sie, wenn ihre Lage nicht horizontal ist, aufhören, für die darüber lagernden Erdmassen eine sichere Unterlage zu bilden. Es entstehen in einiger Entfernung von dem steilen Küstenrande und mit ihm parallel kleine Risse, die sich allmählich erweitern, sodaß endlich das ganze Bruchstück in das Meer gleitet, dessen Wellen es bald zerkleinern und bis auf die größeren Blöcke wegwaschen. Auch heftige Stürme, die den Wogendrang ungewöhnlich steigerten, haben zerstörend eingewirkt. Die Südspitze Rügens reichte in früheren Zeiten bedeutend weiter als jetzt und stand mit der südlich gelegenen kleinen Insel Ruden in Verbindung. Im Anfange des 14. Jahrhunderts zerstörten die Wellen während einer Sturmflut jenes wahrscheinlich nur schmale Bindeglied, an dessen Stelle sich jetzt das sogenannte Neue Tief befindet. Auch in unseren Tagen hat die Insel eine ähnliche Heimsuchung durch die furchtbare Sturmflut erlitten, die am 13. November 1872 die deutschen und die dänischen Ostseeküsten so arg verwüstete. Fast 14 Tage lang hatte anhaltend starker Westwind geweht und das Wasser aus der Nordsee in das Ostseebecken gegen die russischen Küsten hin getrieben, sodaß in den östlichen Häfen ein hoher Wasserstand beobachtet wurde, während in dem westlichen Teile der Ostsee der Wasserspiegel unter den gewöhnlichen Stand sank. Als nun der Wind nach Ost umsetzte und zum heftigen Orkan anschwoll, da strömten die Wassermassen nach Westen zurück und stürzten sich mit unwiderstehlicher Gewalt über die Westküsten der Ostsee, wuschen die Dünen weg, zerstörten die Häuser, ertränkten die Herden und schleuderten Schiffe weit auf die Felder hinauf. Die Insel Hiddensöe wurde von der furchtbaren Kraft der Wogen zerrissen und der flache südliche Teil von der höheren nördlichen Hälfte abgetrennt. Als ob das Meer den armen Fischern, die jenes Eiland bewohnen, einen geringen Ersatz für die angerichtete Zerstörung bieten wollte, schwemmten die Wogen nahe bei der Stelle des Dammbruches ein kostbares, wunderlich gearbeitetes goldenes Geschmeide an den Strand, dessen einzelne Glieder nach und nach aufgefunden und von dem Museum in Stralsund erworben wurden. Ist es der Königsschmuck eines alten Wikings, der hier mit seinem Seedrachen zugrunde ging, oder stammt es aus dem Raube der kühnen Freibeuter Klaus Störtebeker und Michael Gödicke, die im Anfange des 15. Jahrhunderts an den Ostseeküsten ihr Unwesen trieben, und deren Schatzkammer die Sage zwischen die Kreideklippen von Stubbenkammer verlegt? Nachgewiesen ist, daß es sich bei diesem Schmuck um eine byzantinische Arbeit handelt, die wohl durch Tauschhandel nach dem Norden gekommen ist.
Die langsame aber stetige Einwirkung der Wellen und des Regens hat die hohen Kreideufer von Wittow und Jasmund in mannigfacher Weise umgestaltet und ihnen ein eigentümliches Aussehen verliehen. An manchen Stellen, wie z. B. bei Kleinstubbenkammer, bildet das Ufer eine lange, zusammenhängende Wand, anderwärts ist es auf das wunderlichste zerrissen und zerklüftet, indem große Säulen und Pyramiden, Klinken genannt, sich vor der zurücktretenden Wand erheben. Nirgends aber steigt das Ufer senkrecht vom Meere auf, vielmehr sind die unteren Teile stets erheblich geneigt, und erst die obere Hälfte erhebt sich bisweilen fast senkrecht wie eine Mauer. Selbst der so steil abfallende Königsstuhl bei Stubbenkammer ist noch so stark geneigt, daß man von seiner Höhe nur mit einem kräftigen Wurf einen Stein in das Meer schleudern kann, obschon nur ein schmaler Strand den Fuß der mächtigen Kreidemassen von dem Wasser trennt. Das etwa 15 km lange hohe Kreideufer Jasmunds hat ungefähr die Gestalt eines Halbkreises, dessen erhabene Seite dem Meere zugewendet ist, erleidet aber mehrfache Einbiegungen, während einzelne Spitzen, die »Orte«, weiter ins Meer hinaustreten. An einzelnen Stellen ist es durch größere Schluchten und kleinere Rinnen, die »Lithen«, unterbrochen; in ihnen ziehen kleine Waldbäche zum Meere hinab und schneiden ihr Bett tief in den Boden ein. Die Farbe der Kreidewände ist fast rein weiß, nur an einzelnen Stellen, an denen Regengüsse von oben her lehmiges Wasser herabspülen, zeigen sie ein schwach gelbliches Aussehen. Durch die ganze Masse ziehen sich horizontale dunkle Streifen von Feuersteinlagern, die in die Kreide eingebettet sind. Diese bestehen meist aus schwarzen und graugelben Knollen und bilden Schichten von einem halben Fuß Dicke. Der ganze Strand ist mit solchen Steinen bedeckt, die mit den losgetrennten Kreidemassen herabgestürzt und zurückgeblieben sind, als die Wellen die Hänge zerstörten. Bei hohem Wasserstande und bewegter See, wenn die Wogen bis an den Fuß der Kreidewände herantreten, werden diese Steine gegeneinander geschleudert, zertrümmert und endlich zu Grus zerrieben. Außer diesen Feuersteinen liegen am Strande und weit in das Meer hinein große Blöcke von Granit, Gneis, Diorit, silurischen Kalksteinen und anderen Mineralien, die ebenfalls auf der Höhe des Ufers, in den Mergelwänden eingebettet, lagerten. Bei der fortschreitenden Zerstörung stürzten sie herab und bilden jetzt an manchen Stellen eine Art Wall, der den Anprall der Wellen bricht und dem Ufer einigen Schutz gewährt. Solche Steinmassen, die in der ganzen norddeutschen Tiefebene vorkommen und als erratische Blöcke bekannt sind, finden sich in sehr großer Anzahl auf Rügen und fehlen nur auf den jüngsten, der Alluvialformation angehörigen Gliedern, wie auf der Schaabe und der Schmalen Heide. Sie stammen aus den Gebirgen Schwedens und wurden durch die Gletscher der Eiszeit hierher verfrachtet. Am zahlreichsten finden sie sich auf Jasmund, wo an manchen Stellen der Boden noch immer förmlich mit ihnen besät ist, obschon sie vielfach als Baumaterial verwendet werden. In der Dworside, einer malerischen von dem Tribber Bach durchflossenen Waldschlucht bei Krampas, lagert ein ungeheurer erratischer Block, dessen Inhalt auf mehr als 34 cbm geschätzt wird. Ein anderer noch weit größerer Felsblock wurde im Anfange dieses Jahrhunderts gesprengt und aus seinen Trümmern eine fast 300 m lange Mauer aufgeführt, die einen Raum von mehr als 120 cbm einnimmt. Einzelne solcher Blöcke werden als Opfersteine bezeichnet, und der Fremde wird auf flache Rinnen aufmerksam gemacht, die von dem oberen Teile hinabziehen, und in denen das Blut der geschlachteten Tiere abgeflossen sein soll, in Wirklichkeit aber durch Verwitterung entstanden sind.
Der Uferrand von Jasmund wird von einem Buchenwalde gekrönt, der an mehreren Punkten seine Bäume so dicht an den Rand herantreibt, daß einzelne Stämme über diesen hinüberhängen. An anderen weniger abschüssigen Stellen, an denen die Kreide mit einer Lehmschicht überdeckt ist, wie in der Schlucht zwischen dem Königsstuhl und Kleinstubbenkammer, ziehen die Bäume bis unmittelbar an den Strand herab, und von dort aus bilden ihre grünen Kronen einen eigentümlichen Gegensatz zu den vereinzelt zwischen ihnen hervortretenden weißen Kreideblöcken. Wittow dagegen ist fast ganz baumlos und hat kein zusammenhängendes Gehölz aufzuweisen. In letzter Zeit hat man allerdings am Nordstrande Anpflanzungen vorgenommen. Landeinwärts ist der kreidige Untergrund auf Wittow mit einer glatten Decke schwarzen, tiefgründigen Bodens überzogen. Das Erdreich ist daher für den Ackerbau vortrefflich geeignet, wofür die üppigen Weizenfelder zeugen, die im Sommer weit und breit hier wogen. Nur bei Arkona tritt die Kreide frei zutage. Auf Jasmund ist die Fruchtbarkeit geringer, da auf den höher gelegenen Stellen nur eine dünne Lehmschicht lagert, die oft in dürren Jahren versagt. Auch das eigentliche Rügen, namentlich der nordwestliche Teil, hat im allgemeinen einen sehr ergiebigen Boden und fette Wiesen, wenn auch einzelne sandige Heiden und kleine Moore sich zwischen dem fruchtbaren Ackerlande ausbreiten. Dagegen sind die Schmale Heide und die Schaabe, die fast ganz aus zusammengetriebenem Sande bestehen und deren dem Meere zugewendete Ränder von einer niedrigen Dünenkette eingefaßt werden, im höchsten Grade unfruchtbar, und erst nach langjährigen Bemühungen ist es der fürstlichen Forstverwaltung gelungen, auf der ersteren Landenge einen Wald von Kiefern und Fichten anzubringen.
Bis um die Mitte des 12. Jahrhunderts war Rügen ebenso wie Pommern ausschließlich von Wenden bewohnt, welche die früher hier seßhaften Germanen verdrängt hatten und seit dem 11. Jahrhundert mit den Dänen und den von Westen her andrängenden Deutschen in unaufhörlichem Kampfe lagen. Die Eroberung der Burgfeste Arkona, die das Nationalheiligtum der Ostseewenden, den Tempel des Swantewit in sich barg, und deren 14 m hoher Wall noch heute die Nordspitze Wittows nach dem Lande hin abschließt, machte diesem Kampfe und zugleich dem Heidentum auf Rügen ein Ende. Die Germanisierung der Insel, deren Fürsten bis 1325 unter dänischer Lehnshoheit standen, vollzog sich so rasch, daß nach 200 Jahren die wendische Sprache ausgetilgt war, und im Jahre 1404 als Merkwürdigkeit der Tod einer alten Frau gemeldet wird, die noch das Wendische verstanden habe. Heute erinnern nur noch die wendischen Namen vieler Dörfer, Höhen und Waldstrecken an die früheren Herren des Landes, wie beispielsweise der deutschklingende Name Stubbenkammer aus den wendischen Worten »stupien« und »kamen« vererbt ist und Stufenstein bedeutet. Die jetzigen Bewohner Rügens, deren Zahl etwa 50 000 beträgt, sind in überwiegender Mehrzahl in kleinen Dörfern und einzelnen Gehöften angesiedelt; die beiden Städte Bergen und Garz haben nur geringe Einwohnerzahl, ja eigentlich verdient nur das fast im Mittelpunkt der Insel gelegene Bergen den Namen einer Stadt.
Die Beschaffenheit des Bodens weist die Rügener auf den Ackerbau hin, und dieser ernährt nebst dem Fischfang den bei weitem größten Teil, während Handel und Industrie nur in sehr geringem Grade entwickelt sind. Die letztere beschränkt sich fast ganz auf den Betrieb einiger Kreideschlemmereien, in denen die Kreide von ihren sandigen Beimengungen gereinigt und zum weiteren Gebrauch fertiggestellt wird, und einiger Kreidebrüche, deren Rohkreide hauptsächlich in Zementfabriken Wolgasts und Stettins weitere Verarbeitung erfährt. Die Erzeugnisse des Ackerbaues werden meist nach der Hafenstadt Stralsund auf dem gegenüberliegenden Festlande geschafft, um von den dortigen Getreidehändlern ausgeführt zu werden. Außer einigen größeren Gütern haben wir auf Rügen im Verhältnis zu Neuvorpommern ziemlich viele Bauerndörfer, namentlich in der Putbuser Gegend. Da die Güter nicht allzu groß sind, erscheint das Land bunt mit Ortschaften übersät. Die Dörfer mit kleinen Parzellen sind Arbeiterdörfer, die nach den Freiheitskriegen parzelliert wurden. Die rügenschen Bauern besitzen meist nur wenige Morgen Feld und würden in Mittel- und Süddeutschland nicht einmal als Halbbauern angesehen werden. Die meisten Dörfer haben nur ein ärmliches Aussehen, die Häuser sind selten aus Stein gebaut, haben oft nur Lehmwände und tragen meist ein Strohdach. In den Dörfern, die am Strande oder doch nahe dem Meere liegen, erwartet und empfängt die ganze Einwohnerschaft ihren Lebensunterhalt von der See, und von jung auf tummeln sich die Knaben und wohl auch die Mädchen in den Booten auf dem Wasser umher. Indessen zählt die Bevölkerung dieser Seedörfer verhältnismäßig nur wenige Matrosen unter sich, die auf großen Seeschiffen fremde Meere und Länder besuchen; fast alle beschränken sich auf den Betrieb der Fischerei oder auf Fahrten nach den nahegelegenen Küsten Pommerns. Nur wenige Kapitäne größerer Schiffe leben auf der Insel, die Fahrzeuge sind fast sämtlich einmastige Küstenfahrer, sogenannte Jachten, oder Boote von verschiedener Größe. Der Grund dieser auffallenden Tatsache liegt nicht darin, daß es der Insel an guten Häfen fehlt und die Küsten von langgestreckten Sandbänken umzogen sind, die größeren Schiffen die Annäherung verbieten, sondern vielmehr darin, daß die Fischer und Schiffer zugleich Ackerbauer sind.
Infolge der abgeschlossenen Lage der Insel und des Verzichtes ihrer Bewohner auf weitere Seefahrten war der Gesichtskreis der Rügener in früheren Zeiten nur beschränkt und reichte nicht über die nahegelegenen Küsten hinaus. Die Pommern sind überhaupt zurückhaltender und schweigsamer Natur und lassen sich nicht leicht mit Fremden in ein längeres und lebhaftes Gespräch ein, wie es der bewegliche Mitteldeutsche liebt. Der Rügener namentlich ist im höchsten Grade phlegmatisch und war dem Fremden gegenüber ehedem verschlossen und ohne jede Zuvorkommenheit, ganz verschieden von dem dienstfertigen Thüringer und Schlesier. Er fragte wenig nach den Zuständen außerhalb seiner Heimat und wußte so gut wie nichts von den Verhältnissen anderer Länder. Es schlossen sich sogar die Bewohner der einzelnen Teile Rügens voneinander ab.
Die letzten Jahrzehnte aber haben in alledem eine gewaltige Änderung herbeigeführt. Den ersten Anstoß dazu gaben schon die Kriege, die Deutschland in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts geführt hat. Noch im Jahre 1848 erregte es ungeheures Aufsehen, als einige Kompagnien Infanterie und eine Schwadron Kürassiere nebst zwei Geschützen nach der Insel verlegt wurden, um einen etwaigen Landungsversuch der Dänen abzuwehren. Seit den französischen Kriegen 1806-15 hatte keine geschlossene Truppe Rügen betreten, und jetzt strömte alt und jung herbei, um die Panzerreiter anzustaunen und die in Putbus aufgefahrenen Geschütze zu betrachten. Kopfschüttelnd sahen damals die Rügener auf die schwerfälligen Ruderkanonenboote, die als schwacher Anfang der preußischen Marine in dem engen Fahrwasser kreuzten und der einen dänischen Korvette auswichen, die ganz allein alle Häfen Vorpommerns blockierte. Sechzehn Jahre später (1864) waren sie Augenzeugen des ersten Seegefechtes der deutschen Marine, das die Korvetten Arkona und Nymphe nebst dem Aviso Lorelei gegen fünf schwere dänische Schiffe auf der Höhe von Saßnitz bestanden, und sahen in demselben Jahre eine ganze Flottille von Dampfkanonenbooten sich bei Hiddensöe mit dänischen Fregatten herumschießen. Noch in den fünfziger Jahren betrachteten die Insulaner mit ungläubigem und mißtrauischem Auge den Fremden, der ihnen von mächtigen breiten Strömen oder von Bergen erzählte, die in die Wolken hineinragen und deren Gipfel auch im Sommer mit Schnee bedeckt ist; jetzt haben viele ihrer jungen Männer als Soldaten die Donau, den Rhein und die Seine gesehen und lernten die Schnee- und Eisberge aus eigener Anschauung kennen, als das pommersche Armeekorps im Februar 1871 die Scharen Bourbakis in die Schweiz hineindrängen half. So hat der Krieg, der arge Zerstörer, hier als Lehrmeister gewirkt! In den letzten Jahren hat überdies der Fremdenverkehr auf Rügen eine sehr bedeutende Höhe erreicht, und die Dörfer an der Ostküste empfangen jetzt selbst aus Mittel- und Süddeutschland zahlreiche Besucher, die hier während mehrerer Wochen die Seebäder benutzen. Infolge dieses Zuspruchs streifen diese Dörfer allmählich ihr altes einfaches Aussehen ab, und einige Plätze an der Südostküste, z. B. Göhren, Sellin, Binz, nehmen hierdurch im Sommer einen geradezu städtischen Charakter an und sind immer mehr im Aufblühen begriffen. Namentlich gilt dies von dem Doppelort Saßnitz-Crampas, der teils sich malerisch an der steilen, waldgekrönten Uferlehne aufbaut, teils in der grünerfüllten Schlucht des Steinbachs liegt. Obgleich ohne eigentlichen Badestrand, ist er mit seinen hübschen, in Gärten gebetteten Villen und großen Hotels das erste und vornehmste der rügenschen Bäder, insbesondere, seitdem durch die Einrichtung des Schnellverkehrs zwischen Berlin und Stockholm über Saßnitz-Trelleborg hier ein Verkehrspunkt ersten Ranges geschaffen wurde.
Hand in Hand mit dem steigenden Sommerbesuch ging die Entwicklung des Eisenbahnnetzes der Insel und die künstliche Schaffung besserer Landungsplätze an den Badeorten. Vor allem hat der Hafen von Saßnitz, um den erheblich gesteigerten Verkehrsbedürfnissen zu entsprechen, einen großartigen Ausbau erfahren, sodaß er jetzt selbst unseren Kriegsschiffen zugänglich ist und ihnen einen wertvollen Stützpunkt für Operationen in der Ostsee bietet.
Aber diese neuzeitliche Änderung der Verhältnisse hat auch manche Schattenseiten. Der starke Fremdenzustrom, der sich in materieller Beziehung als äußerst segensreich für die Insel erwies, hat eine derartig innige Berührung der Bevölkerung Rügens mit der Außenwelt zur Folge, daß jene unter der alles ausgleichenden und abschleifenden Wirkung dieser schon viel von ihrer alten Eigenart in Charakter, Anschauung und Sitte eingebüßt hat. So ist die heute wenigstens noch von den Mönchgutern bewahrte Nationaltracht immer mehr im Schwinden begriffen, und es ist fraglich, ob die Versuche, durch Aussetzen von Prämien diesem Rückgang Einhalt zu tun, erfolgreich sein werden. Das vorpommersche Platt, das früher dem Fremden den Verkehr mit den Rügenern ganz erheblich erschwerte, wird jetzt von den Gebildeten und den Kreisen, die viel mit den Fremden zu tun haben, nur noch selten gesprochen – eine Tatsache, die vom heimatlichen Standpunkte aus sehr zu bedauern ist. Daß die Insulaner außerdem überraschend schnell gelernt haben, den Badegästen für die Annehmlichkeiten, die sie ihnen bieten, nicht zu geringe Preise abzufordern, ist kaum zu verwundern. Schlimmer ist, daß heute schon ein gut Teil ihrer Natürlichkeit und Sitteneinfalt, wie es Riehl schon vor Jahren vorausgesagt hat, »fortgebadet« ist. –
Sowohl für die zu längerem Aufenthalt auf die Insel gekommenen Sommergäste als auch für die große Zahl der Touristen, die das schöne Eiland in wenigen Tagen durchstreifen wollen, bilden besonders drei Punkte der Insel das Ziel von Wanderungen und Ausflügen. Es sind dies Putbus, das fürstliche Jagdschloß und Stubbenkammer. Zwar bieten noch manche andere Teile der Insel sehenswerte Aussichten, wie der Rugard, Thiessow auf Mönchgut und Arkona, werden aber doch verhältnismäßig nur wenig besucht. Betrachten wir denn jene drei Punkte etwas näher und beginnen wir mit dem freundlichen Putbus.
Es liegt auf einer etwa 50 m hohen Bodenwelle, die sich langsam zu der 3000 Schritte entfernten Lauterbacher Bucht abdacht. Ein weiter, fast zum Kreise abgeschlossener Ring von prächtigen Häusern umgibt einen freien Platz, auf dem sich ein aus mächtigen Sandsteinblöcken errichteter Obelisk erhebt. Die freie nicht von Häusern besetzte Sehne des Kreises schließt der fürstliche Park ab, der sich von hier nach Süden und Westen bis auf eine bedeutende Entfernung erstreckt und zuletzt in einen Wald, die Medars, übergeht. Von jenem ringförmigen Platze, dem Zirkus aus, läuft eine lange Häuserreihe nach Westen neben dem Park hin und wird nur durch den Marktplatz unterbrochen, an den sich eine zweite Straße anschließt. Diese unmittelbare Nachbarschaft des herrlichen Parkes, dessen Betreten einem jeden freisteht, verleiht dem Orte seinen hauptsächlichsten Reiz. Die weißen Häuser leuchten zwischen dem Grün der mächtigen Lindenallee hervor, die diese ganze Seite des Parkes einfaßt und weit über die Häuserreihe hinausreicht. Ihre gewaltigen Bäume, schön wie man sie selten findet, streben zu bedeutender Höhe empor und verschlingen hoch über dem Boden ihre Zweige, sodaß man in dieser wundervollen Allee wie in einem Säulengange wandelt, der mit einem grünen Gewölbe überdacht ist. Der Park ist mit einem seltenen Geschmack angelegt und birgt eine Fülle der edelsten Baumgestalten in sich, die in einer für das Auge höchst wohltuenden Weise geordnet sind. Hier zieht sich eine Allee von prachtvollen Roßkastanien hin, dort schließen kräftige Weißbuchen einen gewundenen Gang ein. Uralte Eichen heben ihre Kronen hoch über die niedrigeren Bäume empor; ihre Stämme sind vom Alter gehöhlt und zerrissen, und man hat, um die Zerstörung aufzuhalten, diese Wunden künstlich geschlossen und dem Auge verdeckt. Auf den samtartigen Rasenplätzen erheben sich vereinzelte Tannen, Edelkastanien und Platanen, oder zeichnet sich das dunkle Laub der Blutbuche von dem grünen Hintergrunde ab. Eine erfrischende Luft, vermischt mit dem Duft der Lindenblüten, durchzieht diese Alleen und Gehölze, und selbst in dem heißesten Sommer vermögen die Strahlen der Julisonne nicht, die köstliche Kühle zu vertreiben, die unter dem kühlen Blätterdache waltet. In der Mitte des Parkes erhebt sich das neue Schloß und wendet seine prachtvolle Front mit den zierlichen, blumengeschmückten Terrassen einem seeartigen Teiche zu, aus dem ein Springbrunnen eine Wassergarbe emporschleudert. Vor der Rückseite dehnt sich ein weiter, rings von Bäumen umschlossener Rasenplatz und trägt die von Drakes Meisterhand gefertigte Marmorstatue des im Jahre 1854 verstorbenen Fürsten Malte, dem der Ort Putbus seine Entstehung verdankt.
Verleiht nun auch dieser Park, der sicher eine der schönsten Schöpfungen der Gartenkunst ist, Putbus den Hauptreiz, so wird dessen Schönheit doch wesentlich durch die herrliche Lage des Ortes erhöht. Überall, wo man aus dem Park hinaustritt und eine freie Übersicht nach Osten gewinnt, blickt man auf die Lauterbacher Bucht hinab, die sich wie ein großer tiefblauer See ausbreitet und durch eine waldige Insel, den Vilm, abgeschlossen wird. Über die niedrige Landenge, welche die beiden bergigen Teile dieser kleinen Insel miteinander verbindet, sieht man hinaus auf das Meer und die in dieses vorspringenden Landzungen von Mönchgut, die sich gelblich-rot aus der blauen Flut erheben; links erglänzen die weißen dorischen Säulen, welche die Vorhalle des Friedrich Wilhelmsbades zieren und werden von den buchengekrönten Höhen der Gora überragt. Schon mancher Reisende hat diese Aussicht mit dem Blick auf den Golf von Neapel und die Insel Capri verglichen. Ein nicht minder anziehendes Bild bietet sich vom Südrande des Parkes aus, von wo der Blick über die seeartige Wrechener Bucht und das Meer hinweg bis nach der pommerschen Küste schweift. Deutlich erkennt man das einfache Denkmal, das die Stelle bezeichnet, an der im Jahre 1678 der Große Kurfürst landete, um nach einem siegreichen Gefechte die Schweden nach Stralsund hineinzutreiben. Eine ähnliche Denksäule ist eine Meile südöstlich von Putbus bei dem Dorfe Stressow errichtet worden zur Erinnerung an die Landung der Preußen unter dem Alten Dessauer im Jahre 1715 und an den nächtlichen, siegreich abgeschlagenen Überfall, durch den die Schweden unter Karls XII. persönlicher Führung das preußische Lager zu überrumpeln hofften.
Putbus wird gewöhnlich als Seebad bezeichnet, verdient aber diesen Namen nur in beschränktem Maße. Zwar sind bei dem erwähnten Friedrich Wilhelmsbade alle nötigen Vorkehrungen getroffen, allein einerseits erschwert die weite Entfernung des Badeplatzes seine Benutzung, andererseits entbehrt das Wasser der ruhigen Bucht des Wellenschlages, da der Vilm den Wogendrang auffängt. Es finden sich daher auch nur wenige Badegäste in Putbus ein, und es herrscht dort nicht das bunt bewegte Treiben, wie man es in eigentlichen Badeorten sieht. Wer aber einige stille Wochen in einer paradiesisch schönen Natur verleben und eine gesunde erquickende Luft atmen will, der kann keinen schöneren Sommeraufenthalt wählen als dies freundliche Städtchen.
Eine Rundschau über die ganze Insel gewährt der Turm des fürstlichen Jagdschlosses, das auf einem der höchsten Hügel Rügens, inmitten eines herrlichen Buchenwaldes, der Granitz, von Schinkel erbaut worden ist. Der Turm erhebt sich 180 m hoch über den Spiegel der Ostsee und ist somit der höchste Standpunkt, den man auf Rügen einnehmen kann. Von seiner Galerie schweift der Blick über die Kronen der Buchen weg, zwischen denen, wie aus einem grünen Meere, seine Spitze inselartig aufstrebt, und umfaßt das ganze Rügen, das mit allen seinen Bodden, Buchten und Inwieken, seinen Halbinseln, Landzungen und Vorgebirgen wie eine Karte ausgebreitet daliegt. Aus dem flachen westlichen Teile heben sich die weißen Häuser von Putbus und der Rugard mit dem Städtchen Bergen hervor, im Norden ragen die weißen Kreideufer Jasmunds und jenseits dieser Halbinsel Arkona mit seinem Leuchtturm empor, während sich im Osten das Meer bis zum fernsten Horizonte ausdehnt und im Südosten das in viele Landzungen zerschnittene Mönchgut sich als ein wunderbares Gemisch von Land und Meer darstellt. Jenseits Mönchguts erkennt man die kleine flache Insel Ruden und die höher aus dem Meer aufsteigende Oie mit ihrem schlanken Leuchtturm und kann am Südrande des Horizonts den Zug der pommerschen Küste von der Peenemündung bis Stralsund verfolgen. Das weite Panorama, das sich hier entrollt, ist von einer seltenen, fesselnden Schönheit, die hauptsächlich auf dem Gegensatz beruht, welchen das Blau des Meeres, die weißen und gelblichroten Farbentöne der Ufer und das Grün des Waldes und der Felder bilden, zwischen denen die Spiegel einzelner Seen hervorblicken.
Der am meisten bewunderte Punkt Rügens, den so leicht kein Besucher der Insel unberührt läßt, ist das Vorgebirge Stubbenkammer, dessen Name wohl in ganz Deutschland bekannt ist. Im Gegensatz zu dem freundlichen und heiteren Rundgemälde, das sich auf dem Turm des Jagdschlosses entfaltet, stellen sich hier mehr ernste Bilder dar, die durch ihre einfache Erhabenheit wahrhaft ergreifend wirken. Der dichte Buchenwald der Stubbnitz, der den nordöstlichen Teil von Jasmund krönt, zieht sich über das hügelige, von Schluchten durchschnittene Gelände bis unmittelbar an den steil abfallenden Uferrand hinein. Etwa 1500 Schritte von diesem entfernt, liegt tief im Walde versteckt ein kleiner von Rohr und Binsen umkränzter See, an dessen östlichem Ufer sich hoch und steil ein halbmondförmiger Hügel erhebt. Es ist der bekannte Herthasee mit der Herthaburg. Auf ihn wird die bekannte Stelle des Tacitus bezogen, in der dieser erzählt, daß in einem heiligen Haine auf einer Insel des Ozeans die Göttin Hertha (Nerthus) verehrt werde, deren von Rindern gezogener Wagen, von den Priestern geleitet, zu gewissen Zeiten durch das Land fahre; nach der Rückkehr werde der Wagen in einem verborgen liegenden See von Sklaven abgewaschen, worauf der See letztere verschlinge. Erst im Anfange des 17. Jahrhunderts wurde zum erstenmale gemutmaßt, daß hier der von Tacitus erwähnte Hain mit dem versteckten See zu suchen sei, mit demselben Rechte, mit dem die Dänen den Schauplatz des Herthakultus nach Seeland verlegen und dort einen ähnlichen See als Herthasee bezeichnen. Der halbmondförmige Hügel ist ein alter wendischer Burgwall. Von seiner nördlichen Spitze, einem der höchsten Punkte Rügens, sieht man über den Wald hinweg auf die Tromper Wiek und das Meer hinaus nach Arkona und hat hier einen vorzüglichen Standpunkt, um den Sonnenuntergang zu bewundern.
Nähert man sich von der Herthaburg aus dem Uferrande, so lichtet sich zunächst der Buchenwald und umschließt halbkreisförmig einen freien Platz, indem die Bäume zu beiden Seiten bis unmittelbar an den Rand herantreten. Überschreitet man diese Lichtung, so steht man plötzlich an der berühmten Schlucht von Großstubbenkammer, ohne Zweifel dem reizendsten Punkte von ganz Rügen. Sie gleicht einem ungeheueren Trichter, der nach dem Meere hin nicht geschlossen, sondern teilweise geöffnet ist. Von rechts und links senken sich die Kreidewände jäh abwärts und streben demselben, tief unten liegenden Punkte zu, der durch zwei hoch aufragende Kreidepfeiler bezeichnet wird. Sie gleichen einem Tor und lassen zwischen sich einen schmalen Durchgang erkennen. Jenseits dieses Pfeilertores erhebt sich rechts die gewaltige Masse des Königsstuhls und zeichnet ihr zackiges Profil auf dem Hintergrunde der See ab. Auf der Uferhöhe drängen die Buchen bis hart an den Rand; die meisten steigen stolz und gerade empor, andere neigen ihre Stämme und Wipfel über den Rand weg als wären sie dem Sturze in die Tiefe nahe, alle aber bilden mit ihrem Grün einen wunderbaren Gegensatz zu der im Sonnenlichte rein weiß schimmernden Kreide und dem tiefen Blau der See. Denn weit, bis auf ungeheure Entfernung hin, dehnt sich das Meer, der Horizont reicht über die Kreideufer hinauf und scheint hoch in der Luft zu liegen, gleich als ob das Meer eine ansteigende Ebene bilde. Und wie tief liegt es doch unter uns! Von der Höhe des Königsstuhls aus gleicht das stolze Schiff, das in der Nähe der Küste ankert, einem Boote, die riesigen am Strande lagernden Felsblöcke kleinen Steinchen; selbst bei bewegter See erscheinen die Wogen, die in langen gleichlaufenden Zügen zum Ufer rauschen, wie unbedeutende Furchen auf der weiten Wasserfläche, bei schwachem Winde aber gleicht das Meer, von hier aus gesehen, einem vollkommenen Spiegel. Wie sehr sich das Auge bei der Abschätzung der Höhe täuscht, erkennt man recht deutlich, wenn man das Ufer vom Strande aus betrachtet. Ein schmaler Fußweg führt in vielfachen Windungen durch den Wald, der sich in einer schluchtenartigen Einsenkung zwischen dem Königsstuhl und der jähen Kreidewand von Kleinstubenkammer bis zum Meere hinabzieht. Von dem mit Steinen und Geröll bedeckten Strande aus sieht man, daß der Königsstuhl keineswegs senkrecht aufsteigt, wie es von oben den Anschein hatte, daß vielmehr seine Krone ziemlich weit zurücktritt; von dem Rande der Schlucht aus schien das Pfeilertor unmittelbar am Strande zu stehen und sich aus dem Meere zu erheben, dagegen scheint es von unten aus gesehen gar nicht weit von dem oberen Rande entfernt zu sein. Eine tiefe, vom Regenwasser ausgewaschene Rinne zieht von den Pfeilern zum Meere hinab und macht es leicht, bis zu jenem Tor vorzudringen; ein weiteres Emporklimmen ist sehr beschwerlich, da oberhalb der Pfeiler sich keine Rinnen finden; auch ist das Klettern auf der abschüssigen Kreidewand nicht ohne Gefahr. Übrigens ist der Blick von unten aus weniger großartig als die Ausschau vom Rande der Schlucht; auf dem schmalen Strande steht man der Kreidewand zu nahe, und diese erscheint bei dem Aufblick so stark verkürzt, daß ihre gewaltigen Ausdehnungen nicht ihre volle Wirkung auf das Auge ausüben. Überdies fehlt hier der Hintergrund, und man sieht über die weiße Kreide und den grünen Kranz der Bäume weg in die leere Luft, während bei dem Blick von oben herab das Bild seinen Abschluß findet in der weit hinausreichenden Meeresfläche.
So ruht dies in seiner Einfachheit so erhabene Vorgebirge inmitten der wogenden See. Die Wellen umspülen seinen Fuß und branden an den schützenden Felsriffen, die Wipfel der Buchen rauschen über seinem Scheitel, Mythe und Sage umweben es mit ihren Dichtungen. Mit geheimem Schauer blickt mancher gläubige Besucher auf den dunklen, im Walde verborgenen See und läßt sich den Opferstein zeigen mit dem steinernen Becken daneben, in welches das Blut rann; in der Johannisnacht sehen Sonntagskinder auf dem größten der am Ufer lagernden Blöcke ein bleiches, schönes Weib unter heißen Tränen blutiges Leinen waschen, versäumen aber stets, das erlösende »Helf Gott« zu sprechen. Doch unaufhaltsam schreitet die Zerstörung vorwärts, von Jahr zu Jahr weichen die Uferränder zurück, und die Zeit wird kommen, wo die unersättliche Flut diesen herrlichsten Punkt des ganzen Ostseegestades verschlungen haben wird.
Von H. Mankowski in Danzig.
Die Halbinsel Hela ist 33 km lang, nur wenige hundert Meter breit und erweitert sich nur am Südostende bis auf 3 km. Fast in ihrer ganzen Länge ist sie mit Wald bedeckt, und die Forstverwaltung läßt durch Strafgefangene fortgesetzt blanke Dünen aufforsten. Die fünf Dörfer der Halbinsel sind: Hela, Danziger Heisternest, Putziger Heisternest, Kußfeld und Ceynowa mit etwa 2300 Einwohnern. Alle diese Ortschaften besitzen nur 360 ha Acker- und Weideland, sodaß ihre Bewohner vom Ackerbau allein nicht leben können. Daß die Fischerei die Hauptnahrungsquelle der Bevölkerung ist, ergibt sich schon aus der insularen Lage. Der einzelne kann in seinem schwierigen Beruf gegenüber der Macht der Wogen und Stürme nicht viel ausrichten; deshalb haben sich die Fischer schon seit den ältesten Zeiten zu eigenartigen Verbänden zusammengeschlossen, die Maatschaperien oder Kompagnien heißen. Sie bedeuten eine hervorragende soziale Einrichtung, wie sie in Deutschland neuerdings durch die Alters- und Invalidenversicherung zum Wohle der erwerbenden Stände ins Leben gerufen worden ist. Diese Genossenschaften betreiben den Fischfang auf gemeinsame Kosten und verteilen den Erlös unter sich.
Woher die ersten Ansiedler auf Hela stammen, läßt sich nicht mit Bestimmtheit nachweisen. Man kann aber mit gutem Rechte behaupten, daß in der ersten geschichtlichen Zeit pommersche Fischer die Urbewohner auf Hela verdrängt haben. Als die Halbinsel Hela unter die Herrschaft des Deutschen Ritterordens geriet, wurde das Genossenschaftswesen durch besondere Verordnungen geregelt, und schon in der Willkür (Verordnung, Gesetz) vom Jahre 1450 werden die Maatschaperien genannt. Eine Maatschaperie oder Kompagnie wurde nach dem Namen ihres Obmanns benannt, also Kompagnie Otto, Heinrich, Werner usw. Die Verteilung der gefangenen Fische erfolgte derart, daß jeder Erwachsene einen Mannesteil und jede Frau, jedes Mädchen oder Kind einen halben Anteil oder den sogenannten Kindesanteil erhielt. Die Zugehörigkeit zu einer Fischerkompagnie berechtigte das Mitglied zum Empfange seines Anteils, auch wenn es durch Unfall oder Krankheit vorübergehend oder dauernd erwerbsunfähig war. Sogar die Witwen und Waisen wurden dieser Fürsorge teilhaftig, wenn ihre Männer oder Väter einer Kompagnie angehört hatten.
Auf Hela kann man drei Hauptarten der Fischerei unterscheiden: die Heringsfischerei mit dem großen Zugnetz und in »Manzen« sowie den Lachs- und Aalfang. Die gefangenen Heringe werden zunächst in flache Gruben am Strande geschüttet und entweder sofort verbraucht oder verschickt. Der Heringsfang zieht sich vom Frühjahr bis Sommer hin und beschränkt sich auf die Heringszüge oder Schwärme. Besonders große und dichte Schwärme kommen nur an wenig Tagen vor, und das Melden ihrer Ankunft bringt leicht das Fischerdorf in Bewegung. Sehr bedeutende Heringszüge erschienen im März 1905 dicht vor dem Eingange des Hafens zu Neufahrwasser. Aus einem einzigen Zuge konnte man acht Fischerboote füllen. Da gab es natürlich billige Fische, und ein Schock mittelgroßer Heringe war schon für 20 Pfennige zu haben. In kleineren Mengen erscheint der Hering fast zu jeder Jahreszeit an der Küste und wird in Stellnetzen, den »Manzen«, gefangen. Die Fische geraten mit ihren Köpfen in die Maschen und bleiben darin mit den Kiemendeckeln hängen. Im westlichen Teile der Danziger Bucht, dem Putziger Wiek, sind recht viel Heringe vorhanden, an deren Fang sich vorwiegend die vier ostwärts liegenden Dörfer der Halbinsel beteiligen.
Der Lachsfang gehört zur Hochseefischerei und wird mit größeren seetüchtigen Booten, den sogenannten Kuttern, betrieben. Zwei oder drei Männer bringen das Geld zur Beschaffung eines Lachskutters auf und betreiben den Fang gemeinsam. Beim Lachsfang fehlen leider die Kompagnien. Als vor mehreren Jahren in Hela ein Hafen gebaut wurde und Lachsfischer aus Pommern, Mecklenburg, Schweden und Dänemark erschienen, um im Winter die Lachsfischerei zu betreiben, die ihnen bisweilen hohen Gewinn brachte, waren die Helenser geradezu bestürzt. Bisher hatten sie geglaubt, die Lachsfischerei auf dem nahen Meere sei ihr Privileg. Doch nun? Da blieb nichts übrig, als konkurrenzfähige Lachskutter zu erbauen, wozu die Bezirksregierung zu Danzig bereitwilligst Darlehen hergab. Der Lachsfang hat von alters her eine bedeutende Rolle gespielt, und der Danziger Lachs ist überall ein begehrter Artikel, der gegenwärtig hoch im Preise steht und nur auf den Tischen wohlhabender Leute erscheint.
Argen Schaden richtet beim Lachsfang der Seehund an. Er ist ein Feinschmecker und zieht allen Fischarten den Lachs vor. Häufig findet der Fischer an den ausgelegten Angelschnüren nichts als den Kopf des Lachses. Das wohlschmeckende Fleisch ist vom Seehund verzehrt worden. Er schädigt die Fischer aber nicht dadurch allein, sondern er zerreißt auch die Fischnetze. Die vor einigen Jahren vom Deutschen Seefischereiverein für den Seehundsfang ausgesetzten Prämien sind aufgehoben worden, doch erhalten die Fischer Geldmittel zur Beschaffung von Fanggeräten.
Von hoher Bedeutung ist der Aalfang in Säcken. Diese sind über hölzerne Reifen gespannt und werden am Ufer aufgestellt. Die an dünnen Pfählen befestigten Netzwände versperren dem längs des flachen Ufers hinziehenden Aale den Weg und treiben ihn in den Sack, aus dem er nicht mehr entweichen kann. Zuweilen ist der Aalfang recht ergiebig, und es werden in einer einzigen Nacht mehrere Schock gefangen.
Im Jahre 1904 wurde zwischen Hela und Danzig eine Postdampfschiffverbindung eingerichtet. In den Sommermonaten fährt der Postdampfer täglich zweimal, und so ist für einen raschen Absatz der Fische bestens gesorgt. Natürlich werden sie größtenteils in Danzig verkauft. Neuerdings werden aber auch viele Fische in andere Großstädte verschickt, namentlich im Winter. Die Preise sind hoch, und die Fischhändler machen gute Geschäfte. Hat der Obmann den Fang verteilt, so kümmert er sich nicht weiter darum, wie der einzelne seinen Fang verwertet. Die beiden Pfarrer in Hela (evangelisch) und Putziger Heisternest (katholisch) werden auch beim Fischfang bedacht, und der Pfarrer in Hela erhält z. B. alle Jahre 10 kg Lachs, wenn möglich in einem einzigen Fisch. Wird ausnahmsweise ein besonders günstiger Fang gemacht, so wird er auch wohl im Kirchenbuche verzeichnet. Wenigstens war das in den früheren Jahrhunderten der Fall, als das Kirchenbuch fast die einzige öffentliche Urkunde war. So heißt es vom Jahre 1737: »Noch in diesem Jahre ist ein reicher Aalfang gewesen, daß die ältesten Leute auf unserm Lande nicht haben erdenken können.«
Auf den Fremden, der Hela zum ersten Male betritt, macht der Ort einen ganz eigentümlichen Eindruck. Es ist nur eine einzige ungepflasterte Straße, zu deren beiden Seiten die kleinen Häuschen aus Ziegelfachwerk wie Schmuckkästchen stehen. Alle sind mit den Giebeln nach der Straße gerichtet und haben auch hier ihren Eingang. Betritt man ein Haus, so erblickt man auf der Diele Regale mit Fayencewaren, die oft aus weiter Ferne stammen und vor altersgrauer Zeit hergebracht worden sind. Hinter der eigentlichen Wohnstube liegt die Fischräucherei. Über dem Herde erhebt sich ein nach oben sich verjüngender Rauchfang mit der Räucherkammer, in der die Fische auf Stäben aufgehängt werden. Zum Räuchern dienten früher Heidekraut und Kiefernholz aus den Wäldern der Halbinsel. Die drei Dörfer Heia, Danziger und Putziger Heisternest erhielten früher über 1500 Raummeter Klobenholz und Reisig. Da das Holz auf Heia nur langsam wächst, so waren die Wälder durch das Abtreiben solcher großen Holzmassen in Gefahr, und die Königliche Forstverwaltung erklärte, daß sie die bisherige Holzmenge nicht weiter liefern könne. Nach vorhergegangener Berechnung löste sie deshalb im Jahre 1899 das alte Waldrecht ab und zahlte an die drei genannten Dörfer rund 164 000 Mark als Abfindungssumme, deren Zinsgenuß ihnen zugute kommt. Zugleich wurde in der Nähe des Dorfes eine moderne Räucherei erbaut, wohin jetzt alle gefangenen Fische wandern, die nicht frisch verbraucht oder verkauft werden. Helaer Aale und Flundern sind stark begehrt und verschaffen den Bewohnern eine gute Einnahmequelle.
Eine wichtige Rolle spielen die Fischermarken auf Hela. Schneidet man mit einem Messer einen Strich in das Holz und fügt einen kürzeren schrägen Anstrich in Form einer 1 dazu, so ist die primitivste Art einer Marke da. Durch Zufügung von Strichen oder Kreuzen lassen sich mannigfache Formen herstellen. Trat etwa der Sohn neben dem noch lebenden Vater als selbständiger Fischer auf, so übernahm er für sein Geschäft nicht die Marke des Vaters, sondern veränderte sie durch Hinzufügen eines Strichs. Dasselbe tat auch wohl der Enkel oder ein anderer Verwandter; doch wurde die Grundform möglichst gewahrt, um die Zusammengehörigkeit einer Familie zu veranschaulichen. Die Fischermarken sind also die »Wappen« der Helaer Fischer, wenn sie auch keinen Namen nennen, der dieses Zeichen vor Jahrhunderten erfand. Manche Marken mit ihren Seitenlinien sind so charakteristisch, daß sie bei den Fischern eigene Namen haben, z. B. Groonwald-, Schmidt- oder Wedelmarken oder »Märke«. Wird ein junger Fischer selbständig und »wählt sein Mark«, so wird er von den übrigen Fischern als vollgültiges Mitglied betrachtet. Das neue Glied hat damit besondere Rechte und Pflichten übernommen, die von einem Geschlecht auf das andere übergehen. Durch ihre eigenartige Organisation üben die Fischer sogar eine Art Polizei- und Richtergewalt aus, und vor den ordentlichen Gerichten erscheinen sie wegen strafbarer Handlungen äußerst selten. Stirbt der Inhaber einer Marke oder setzt er sich zur Ruhe, so geht die Marke auf einen noch nicht selbständigen Schwiegersohn oder einen nahen Verwandten über. Sind solche nicht vorhanden, so erlischt sie, was aber höchst selten der Fall ist. Je einfacher eine Marke ist, desto höher wird sie im Alter stehen. Die Marke als Eigentumszeichen wird auf allen Fischereigeräten eingekerbt. Wirft sie einmal ein Sturm oder Wellengang durcheinander, so ist ihr Eigentümer bald ermittelt.
Die Fischereibehörden haben sich leider um dieses Markensystem weniger gekümmert und ordnen die Anbringung weniger lateinischer Buchstaben an. So bedeuten die drei Buchstaben H F K, die neben der eigentlichen Fischermarke mit einem Stempel eingebrannt sind, die Abkürzung für Helaer Fischerei-Kasse. Jüngere Fischer kümmern sich auch schon wenig um die uralte Markenbezeichnung und kerben in die Holzgeräte einfach die Anfangsbuchstaben ihres Namens ein. Auch die genossenschaftlichen Kompagnien geraten ins Wanken, weil die neuen sozialen Gesetze bei Alter und Invalidität Unterstützungen gewähren und namentlich jüngere Fischer die Verpflichtungen der alten sozialen Einrichtungen als Last betrachten.
Der Umgang mit den Insulanern ist angenehm. Die schweigsamen Leute sind ehrlich bis auf die Knochen, und Diebstähle kommen auf Hela nie vor. Aus alten Zeiten hat sich ein kerniges Geschlecht in die Gegenwart gerettet, das zähe an den Sitten und Gebräuchen der Vorfahren hält. Ordnung und Reinlichkeit gehören zum Grundzuge der Leute, und fast jede Familie besitzt ein eigenes Häuschen, sodaß Streitigkeiten zwischen Mietern und Vermietern, von denen gegenwärtig die Welt widerhallt, auf Hela ausgeschlossen sind. Jeder Fischer ist zugleich sein Maurer und Zimmerer, auch wohl Tischler, und erst neuerdings halten moderne Möbel ihren Einzug in die netten Häuslein. Seit den letzten Jahren wird namentlich Hela sehr stark von Fremden besucht. Manche Fischerfamilie vermietet deshalb ein Zimmer an einen Fremden und verschafft sich dadurch eine Nebeneinnahme. Die jungen Leute werden meist zur Marine eingezogen und kommen deshalb weit in der Welt umher. Gern kehren sie aber in ihre Heimat zurück, für die sie keinen Ersatz in der Welt finden. Die wettergebräunten Gesichter der Männer schauen ernst darein; denn wenn der Fischer am Abend auf die See fährt, weiß er nicht, ob er wieder glücklich heimkehren werde, und schon mancher fand im feuchten Wasserbette einen frühzeitigen Tod.
Die Grenzboten, 66. Jahrg. 1907.
Wir nehmen den Wanderstab zur Hand, um vom Bade Cranz aus eine der ödesten und doch auch interessantesten Stellen des deutschen Vaterlandes zu durchwandern: die Kurische Nehrung, die sich 96 km lang zwischen Cranz und Süderspitze bei Memel erstreckt. Wir benutzen die ehemalige Straße der Personenpost, welche die schmale Landzunge durchzog, um die Provinz Preußen mit Kurland zu verbinden, und deren Richtung nur hier und da noch einige Weidenbäume andeuten; übrigens wird man wohltun, von der Vorstellung dieser Poststraße alle nebensächlichen Merkmale wie Chaussierung, Pflaster usw. vollständig fernzuhalten. Über die schmale Landbrücke sind einst auch die litauischen Heerhaufen hereingebrochen ins alte Ordensland, bis ihnen die Deutschherren durch Gründung von Burgen wie Rossitten den Weg verlegten, und unmittelbar nach dem Aufhören der kriegerischen Berührungen sind die heutigen lettischen Einwohner eingezogen und haben die äußerste Scholle deutschen Bodens in ihrer ganzen Länge mit Siedelungen bedeckt.
Eine Urkunde vom Jahre 1258 gibt uns Aufschluß über die Entstehung des Namens »Nehrung«, sofern sie zwei Inseln erwähnt, nämlich Nergia (d. i. Nehrung) und Nestland; da die Frische Nehrung auch sonst Nergia (Nerga, Neria) genannt wird, so ist über die Bedeutung des ersten Namens kein Zweifel; ob aber unter Nestland die Kurische zu verstehen, bleibt eine offene Frage. Übrigens könnte auch der Name Nestland für unser Gebiet nie allgemein gewesen sein, weil man sonst die Übertragung von Nergia (woraus Nährung, Nehring) auf dasselbe nicht verstehen würde. Allerdings fügte man zur Unterscheidung hinzu: curisch, da sie in der Richtung nach Kurland zeigt, oder nannte sie Neria versus Memlam (nach Memel hinzeigend), Memelsche Nehrung, preußischen Strand oder auch kurz den »Strand«, eine Benennung, die noch heute im Munde der deutsch redenden Bewohner zu finden ist.
Wer durch das Studium der einschlägigen Literatur bereits aufmerksam geworden ist, wird etwa 2 km hinter Cranz eine leichte Senkung und bald darauf eine kleine Erhebung des Bodens bemerken; hier liegen die Massen des Dünensandes unmittelbar auf dem Moorboden. Diese Stelle deutet uns ein altes Tief an, eine ehemalige Wasserstraße, mittels deren Meer und Kurisches Haff in Verbindung standen; man kennt heute fünf bis sechs solcher Stellen, sodaß die lange Zunge der Kurischen Nehrung früher eine Reihe von Inseln dargestellt haben muß, die durch Versandung verkettet wurden. In 1½ Meile Entfernung von Cranz treffen wir das erste Dörfchen: Sarkau, das vom Haff aus wie in einer flachen Sandwüste zu liegen scheint, während man beim Wandern zu Fuß bemerkt, daß es an eine schöne grüne Anpflanzung, die sogenannte Plantage, die sich weithin nach Norden zieht, angeschmiegt ist. Bei 5 km hinter Sarkau, in dessen Nähe die Nehrung ihre geringste Breite (0,5 km) besitzt, ändert sich der Landschaftscharakter insofern, als hier die Hauptdüne einsetzt, jene weißen Berge, die wie eine stattliche Kette von 30 bis 60 m Höhe die ganze Länge der Nehrung durchziehen.
Ihr Querdurchschnitt zeigt an der westlichen Seite eine ganz allmähliche Steigung (5 bis 10°), nach der östlichen oder Haffseite hin dagegen steilen Abfall. Es ist daher selbstverständlich, daß nur nach der Seeseite hin ein größerer Raum übrig bleibt, an dessen äußerstem Rande die Vor- oder Schutzdüne, eine künstliche Schöpfung, nach Norden zieht. Hier bläst der Wind fast regelmäßig aus West, das Meer setzt das ganze Jahr hindurch längs unserer Landzunge seine Sandfracht ab, die nach dem Abtrocknen wie Nebel nach Osten treibt. Dieser Sand hat eine frühere Walddecke vollständig erstickt, was uns die im Sande begrabene Humusschicht deutlich beweist. »Mit dem Schwinden dieses alten Waldes bekam der Sand freieren Flug und überstrich ganze Berglehnen regelmäßig. So begann das Wandern der Dünen. Vom Winde bald horizontal, bald in der Diagonale getroffen, aufgerührt und getrieben, fegt der Sand des Strandes und der Dünen die Lehnen der Berge hinauf, der schwerere langsamer, der leichte rascher, und während dieser oft weit in das Haff fliegt, rieselt jener von den Bergkämmen, die er eben erreicht hat, ostwärts hinunter. Vom Haff aus gesehen, erinnert dieser Vorgang an das Dampfen der Wälder; jedoch ist hier das dem Dampfe Vergleichbare stets scharf begrenzt, und die Konturen der Berge sind, wenn auch verwischt, doch in voller Ausdehnung sichtbar. Geht man über eine im Wandern begriffene Düne – nichts Leichtes, denn man muß sich dabei gegen die volle Gewalt des Sturmes halten, und der fliegende Sand trifft Gesicht und Hände wie mit tausend Nadelstichen – so sieht man die Bodenoberfläche unter sich in deutlicher Bewegung: der feine Sand schwirrt, der grobe rollt gleichsam bergaufwärts, und die träge Bewegung des letzteren erfolgt in langgestreckten Wellenlinien, weil die feineren Mengen aus ihm herausgeweht sind. Kauert man sich dann, um etwas zu Atem zu kommen, hinter eine Kuppe, so merkt man bald, daß man versandet, und ist überrascht von der Schnelligkeit und Vollständigkeit, womit dies vor sich geht.« So schreitet die Wanderdüne alljährlich 5-6 m nach Osten vor. Wälder und Dörfer vermögen dieser Wanderung zwar eine Zeitlang Halt zu gebieten; ohne das tatkräftige Eingreifen der Menschen bleibt aber die wandernde Düne stets Sieger und wälzt sich allmählich über die gewaltigsten Baumriesen und größten Ortschaften hinweg. Die Dörfer Alt-Negeln, Negeln, Karwaiten, Neu-Pillkoppen, Preden, Kunzen u. a. sind solche unter Dünen begrabene Siedelungen. Die sogenannte Hirschwiese – zum Rittergut Götzhöfen bei Memel gehörig, aber auf der Nehrung gelegen – gab in früheren Zeiten bis 40 Fuder Heu, versandete aber in einigen Jahren dermaßen, daß man 1788 nur noch Sandhügel und -berge entdecken konnte. Da die Düne aber ohne Aufhören ostwärts weiter dem Haffe zu wandert, wird der verschüttete Boden im Laufe der Zeit an der Seeseite wieder frei, wenn der Wind nicht genügende Sandmassen nachtreibt. Das bekannteste Beispiel für diese Erscheinung bietet das Dorf Kunzen, das noch am Anfang des 19. Jahrhunderts am Ostabhang einer Wanderdüne stand. In den dreißiger Jahren türmte sich diese bereits in der ganzen Höhe darüber auf, und gegenwärtig ist sie so weit nach Osten vorgerückt, daß die verwehten Reste der Gebäude auf der Westseite wieder bloßgelegt sind. Man erwarte aber nicht, großartige Dorfruinen zu finden, die das Bild schreckhafter Zerstörung bieten. Bei dem langsamen Vorschreiten der Düne ist es den Bewohnern stets möglich, in voller Ruhe ihre Häuser abzubrechen und das brauchbare Material fortzuschaffen. Es kommen also nur Ziegelreste, Tennen, Scherben u. dgl. wieder zum Vorschein.
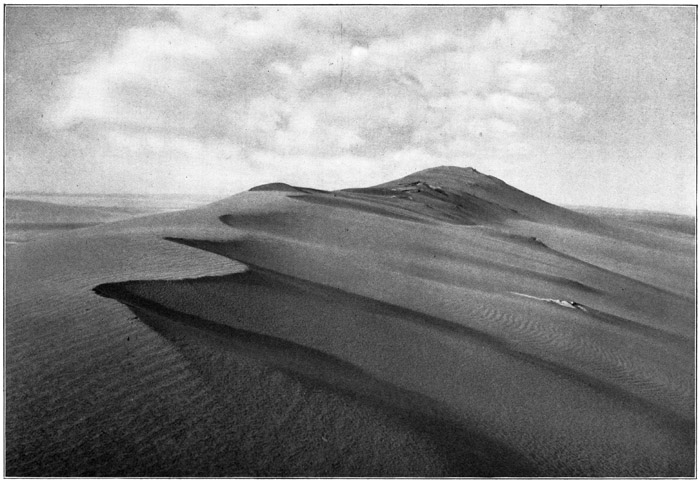
Wanderdünen auf der Kurischen Nehrung.
Nach einer Photographie von Gottheil & Sohn, Königsberg.
Wenn man auf der Kurischen Nehrung die Dinge ihren Lauf hätte gehen lassen, so wäre möglicherweise die Berechnung des Geologen unserer Nehrung (Berndt) eingetroffen, der in etwa 215 Jahren die Dünen im Haff liegen und dieses versandet sah. Aber die Dünenbefestigung hat, besonders in unserem Jahrhundert, den Naturgewalten mit Erfolg Halt geboten, indem sie Vordünen errichtete, um den vom Meere ausgeworfenen Sand festzubinden und als Schutzwehr zu benutzen, und indem sie die Bepflanzung einführte, um die Wanderdünen zur Seßhaftigkeit zu nötigen. Wohl meldete die Kriegs- und Domänenkammer bereits Friedrich II. von dem trefflichen Wachstum der Billionen Gewächse, welche sie ausgepflanzt, aber der große König, der seine Leute trefflich kannte, schrieb an den Rand des betreffenden Berichtes: »ist alles ser feyn und löplig zu lesen, wenn es nur nicht wider wirt gelogen seyndt, wie Jäger Art.« Was aber bis heute in dieser Hinsicht geschehen ist, verdient als ein Stück wertvollster Kulturarbeit, als ein Sieg des Menschen, dem die rohe Naturgewalt schon die Kehle zudrücken wollte, unsere volle Bewunderung.
Um die Hauptdüne festzulegen, teilte man einen für die Bepflanzung in Aussicht genommenen Bezirk in kleine Quadrate, die man rings mit Kiefernzweigen absteckte und so »beruhigte«. Nun wurde Lehm, Bagger- und Moorerde herbeigeschafft, um die kleine Fläche zu düngen; dann erst konnten die ein-, zwei- und dreijährigen Pflanzen von Strandhafer (Elymus arenarius), Strandroggen (Arundo arenaria) und später die Krüppelkiefer (Pinus montana, aus Dänemark) gesetzt werden. Besonders mit dieser Kiefernart sind treffliche Erfolge erzielt worden, da sie ebenso genügsam als wetterhart ist und sich armleuchterartig über große Flächen so ausbreitet, daß diese vollständig im Windschatten liegen.
Soll die Bepflanzung das Weiterschleppen, so die Vordüne die Anfuhr des Sandes von Seiten des allzu freigebigen Meeres erschweren. Der regelmäßig wehende West würde auch heute noch die Fracht des Meeres landeinwärts peitschen, wenn man nicht von Cranz bis Süderspitze durch die Anlage eines niedrigen Flechtzaunes parallel zur Küste und unmittelbar am Strande die eben flügge gewordenen lockeren Vögel festhielte, sodaß der Sand nach und nach an der Küste eine neue und zwar eine Schutzdüne bildet, deren Bepflanzung ebenfalls eifrig betrieben worden ist; teilweise sind diese Arbeiten an der Vordüne älter als diejenigen an der inneren Hauptdüne; war doch das Stück von Cranz bis 7 km hinter Sarkau schon 1829 fertiggestellt! Und um der Nehrung das alte Waldkleid vollends wiederzugeben, hat die Dünenverwaltung den Zwischenraum zwischen äußerer und innerer Düne zur Anlage von Plantagen, von Holzanpflanzungen, benutzt, so bei Sarkau, Rossitten, Nidden und Preil, die hoffentlich in einiger Zeit einen zusammenhängenden Waldstrich bilden werden, gegenwärtig sind an zwei Stellen noch kurze Zwischenräume vorhanden. Der Waldbestand weist zum größten Teil Kiefern, doch auch Birken, Erlen, Espen, Weiden auf und verträgt stellenweise schon die Durchforstung; ja auch Elchwild, Fuchs und Dachs, letzterer allerdings nur vereinzelt, haben sich eingestellt. Der Rindviehbestand der Nehrung findet in den Weiden am Haff und in den Plantagen ausreichendes Futter. Reich ist die Vogelwelt auf der Nehrung vertreten, vor allem die Sumpf- und Wasservögel, von den kleinen Strandläufern, Bekassinen und anderen schnepfenartigen Vögeln bis zu den wilden Schwänen und gravitätischen Kranichen. Hunderttausende von Möwen und Seeschwalben, von Wildenten und Tauchhühnern haben ihre Niststätten in dem »Bruch« bei Rossitten, einem etwa 80 Morgen großen, zum Teil mit Binsen und Schilf verwachsenen Sumpfgewässer. Da die Nehrung als schmaler Landstreifen zwischen zwei weiten Gewässern von den Zugvögeln mit Vorliebe zu ihrer Zugbahn benützt wird, so stellen sich in der Umgebung des Bruchs im Herbste ganze Scharen von nordischen Sumpfvögeln ein. Ebenso zeigt sich im Winter auf dem Meere eine Menge nordischer Schwimmvögel. So ist die Gegend von Rossitten ein Tummelplatz der verschiedensten und seltensten Vogelarten. Es sind bereits etwa 240 Spezies festgestellt worden, unter denen Gäste vom Himalaya, von Sibirien, vom Kaspischen Meer und von Island vertreten sind.
Das Dorf Rossitten, 20 km nördlich von Sarkau, ist auch in anderer Beziehung ein bemerkenswerter Punkt der Nehrung. Dort erreicht diese mit 3,5 km ihre größte Breite. Eine besondere Überraschung aber bietet dem Wanderer der Anblick von Getreidefeldern, sogar Weizenäckern, von ordentlichen Bauernhöfen mit Scheunen, Viehställen und Schuppen. Wie ist das alles möglich? Der Erdbohrer, welcher beispielsweise 1822 bei einer Brunnenteufung in Anwendung kam, ging durch eine Lehmschicht von etwa 18 m Mächtigkeit, dann folgte grauer Mergel mit Sandboden gemischt und endlich bis zu etwa 30 m Tiefe große Steine von vier und fünf Fuß Durchmesser, ehe man auf das Wasser stieß. Das Lehmlager erklärt aber nicht nur die landwirtschaftlichen Erscheinungen bei Rossitten, sondern weist uns auch als Diluvialbildung mit darauf ruhendem Dünensande hin auf die ganz ähnlichen geologischen Verhältnisse in der weiteren Umgebung des Haffs, an der ostpreußischen Küste. In der Tat ist die kurische Nehrung nichts anderes, als der alte Rand der preußischen Küste und das Haff eine Einbruchsstelle; kurz – es liegen hier im äußersten Osten Deutschlands dieselben geologischen Verhältnisse vor, die uns an der deutschen Nordseeküste mit ihren Inselreihen, ihren Watten und Einbruchsstellen in genügender Weise bekannt sind, und die wir um so mehr vergleichsweise anziehen dürfen, als wiederholte Senkungen und Hebungen des Bodens auch an der Kurischen Nehrung nachweisbar sind. Die Hauptdüne, die den Eindruck eines Sandgebirges macht, ist bei Rossitten das erstemal unterbrochen, wohl weil in alter Zeit hier ein Tief sich befand. Sie löst sich auf in sechs Einzelberge, tritt aber eine halbe Meile weiter nordwärts schon wieder geschlossen auf, um bei Pillkoppen zum letztenmal unterbrochen zu werden, und zwar ist diese Unterbrechung wohl eine Windkehle, nicht eine alte Wasserstraße.
Bei Nidden, einem verhältnismäßig wohlhabenden und von altem Walde überragten Fischerdorfe, eröffnet sich besonders dem Altertumsforscher ein lohnendes Arbeitsfeld. Wohl treten auf dem unter Dünensand ruhenden Waldboden einer früheren Vegetationsperiode die Wohnsitze (oder vielmehr deren Reste) einer längst abgestorbenen Bevölkerung in wenig unterbrochener Reihenfolge auf der ganzen Halbinsel hervor; aber die reichsten Funde liefern doch die vier Hügel an der Niddener Plantage: Urnen in grober und feiner Arbeit, gehenkelt, mit Verzierungen, die durch Fingereindrücke und in den weichen Ton gepreßte Schnüre und Bindfäden hervorgebracht sind, Steinhämmer, Pfeilspitzen, Netzsenker, Mühlsteine, Bernstein in rohen Stücken, aber auch geformt in Röhren und Ringen, ja sogar in eine kleine menschliche Gestalt, Geräte aus Stein und Knochen, Abfälle wie Knochen, Fischreste, Kohlen. Grabstätten sind nicht zu bemerken, da die Leichen in jener kulturgeschichtlichen Periode – der Steinzeit – nicht verbrannt, sondern beerdigt wurden, sodaß die Urnen einem anderen als dem sonst üblichen Zwecke gedient haben müssen. Bei Rossitten jedoch fand sich eine Leiche, die mit Streitaxt, Feuersteinmesser, stumpfer Knochennadel, Bernsteinring, runder Steinscheibe (sogenannter Imatrastein) und kleiner versteinerter Koralle begraben worden war. Ohne Zweifel war schon in der ostbaltischen Steinzeit die Nehrung von einer verhältnismäßig zahlreichen und geschickten Bevölkerung in einer Kette von Siedelungen bewohnt, die sich durch die ganze Halbinsel hindurchzog.
Sobald wir noch weiter nordwärts vordringen, begegnen wir in Preil und Perwelk den armseligsten Fischerdörfern, während sich das wohlhabendere Schwarzort eines Waldes aus alter Zeit, einer neuzeitlichen Industrie und eines regen Badelebens erfreut In den letzten Jahren hatte die Kurliste durchschnittlich 1700 Personen aufzuweisen.. Nördlich von diesem Ort aber ist die Düne unbewohnt, bis wir Memel gegenüber die letzten Vorposten unter den Besiedelungen antreffen: den Sandkrug, eine gut besuchte Sommerfrische, ferner eine Försterei, einige Fischerhäuser, einen Rettungsschuppen (für Schiffbrüchige), ein Fort, das aber seit dem Jahre 1897 als Festung aufgegeben ist, und ein Quarantänehaus; dies alles zusammengenommen bildet – mit alleiniger Ausnahme des Forts – den Gemeindebezirk Süderspitze oder Süderhaken.
Die Bevölkerung der Kurischen Nehrung setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen, aus Letten, Deutschen und Litauern. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts scheinen die Letten die überwiegende Mehrzahl der Bewohner gebildet zu haben. Heute sind die Dörfer südlich von Nidden vollständig germanisiert, im nördlichen Teile der Nehrung ist aber noch die lettische Mundart vorherrschend, in Rossitten und Sarkau bildet das samländische Plattdeutsch die Umgangssprache. In diesem Dialekt, den man auch in anderen Teilen der Nehrung hören kann, und in dem allgemein in der Schule gelernten Hochdeutsch, ist den drei Volkselementen ein Mittel der Verständigung gegeben. Was die Letten, die nach Beendigung der Kämpfe zwischen dem Deutschorden und den Litauern hier einwanderten, besonders anlockte, das war die Gelegenheit zur Fischerei, der sie denn auch mit wenig Ausnahmen obliegen, sei es in der See, wo diese freigegeben ist, sei es im Haff, wo nur die Realberechtigten und solche, die eine bestimmte Abgabe erlegen, Fischereigerechtigkeit besitzen. Der Fischfang wird hauptsächlich in der Nacht betrieben; bei starkem Winde auch am Tage. Ist das Haff mit Eis bedeckt, so wird das sogenannte Wintergarn mittels Reihen eingehackter Löcher durch das Wasser gezogen. Gefangen werden besonders Lachs, Bars, Zander, Aal, Neunauge, Stör, aber auch die weder gewogenen, noch gezählten, sondern mit Scheffeln gemessenen Weißfische. Hin und wieder gehen auch Seehunde in die Netze, die aber den Fischern wegen ihrer Räubereien verhaßt sind, zumal sie besonders den Lachsfang arg beeinträchtigen. Daß der Anbau von Körnerfrüchten in Rossitten und die unbedeutenden Kartoffelgärten bei Sarkau, Nidden und Schwarzort den Bedarf nicht zu decken imstande sind, leuchtet ohne weiteres ein; doch bietet er wie auch die Dünenkultur und besonders die große Bernsteinbaggerei in Schwarzort manchem Bewohner guten Erwerb. Die Firma Stantien & Becker arbeitet seit 1862 in Schwarzort, weil man dort beim Baggern im Interesse der Schiffahrt durch Zufall den Bernstein in beträchtlichen Mengen fand, die nach Vermutung der Sachverständigen einem alten Bernsteinlager entstammen mußten. Um in bestimmten Bezirken den Haffboden ausbaggern zu dürfen, schlossen die Firmeninhaber mit der Regierung einen Vertrag, nach welchem sie für jeden Arbeitstag (sie arbeiteten mit sechs Baggermaschinen) 30 Mark zu entrichten verpflichtet waren. Dieser ist später vielfach abgeändert worden, und gegenwärtig hat die Firma, die in Schwarzort Hunderte von Arbeitern, Beamte, Maschinenwerkstätte, Werft, große Küchen unterhält, mehr als 20 große Dampfbagger in Betrieb und erzielt eine Ausbeute bis zu 100 000 kg im Jahre. Sonst aber fand unser Gewährsmann von Industrie blutwenig: in Rossitten einen Schmied, und im Dienste des Krugwirtes von Nidden einen Schneider- und einen Bäckergesellen. Der Kramhandel ist mit dem Kruge verbunden, und das Hausieren besorgen polnische Juden.
Daß die unfreundliche Natur schwer auf den Gemütern lastet, das zeigt der schweigsame Ernst, der sich selbst im Kruge kaum verleugnet und weder hier noch in der Familie den Mund zu einem frischfrohen Liede sich öffnen läßt – nur drei Volkslieder sind in der Sprache dieser Letten vorhanden, – das zeigt auch ihre Neigung zum Aberglauben, der sich in unzähligen Bräuchen kundgibt: an Festtagen, am Johannistage und am Donnerstag abend darf man nicht auf den Fischfang fahren; wenn ein Kahn fertig gebaut ist, muß man ihn umgekehrt hinlegen und kreuzweise über seinen Boden schießen; ehe man neue Aalschnüre in Gebrauch nimmt, schlägt man im Hause heimlich das Kreuz über ihnen und speit auf sie, ehe man sie auswirft; will man ein Netz zum ersten Male im Jahr in Gebrauch nehmen, so legt man eine Axt auf die Schwelle und trägt es darüber; wenn einer wenig fängt, muß er seine Netze mit Schießpulverdampf räuchern oder aus dem Netz eines andern, der mehr fängt, Stücke herausschneiden und in die seinigen einsetzen usw. Tritt er dir entgegen, der Kure, auf der Schwelle seiner Hütte, so ist in dem bartlosen Gesicht eine gewisse gemessene Höflichkeit zu lesen; doch rede ihn in seiner Sprache an, und gastfreundlich wird er dich einführen in seine Familie, wo du den Ton ruhiger Freundlichkeit im Verkehr mit den Seinigen wohltuend empfinden wirst. Daheim trägt er in der Regel die Strickjacke (aus blau-weißer Wolle gestrickt) oder ein Jackett von dunkler Farbe, Drillichhosen und Mütze, und an den Füßen, sofern er nicht barfuß geht, die schweren Holzpantoffeln. Doch stattlicher sieht er aus, wenn er in Wasserstiefeln und grauer Frieskleidung, den Südwester auf dem kurzgeschorenen Kopfe aus dem Hause tritt, um seinem Gewerbe auf der sturmbewegten See nachzugehen. Die weiblichen Glieder der Familie tragen unter der Jacke ein buntes Mieder und gestreifte Röcke, deren Zahl zugleich den Maßstab für den Wohlstand bildet; die verheirateten Frauen trennen sich nie von ihrem Kopftuch, während man die Mädchen wenigstens im Hause ohne diese Hülle sieht.
Quellen: Dr. A. Bezzenberger, Die Kurische Nehrung und ihre Bewohner. Bd. III der Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde, herausgegeben von Prof. A. Kirchhoff. Stuttgart 1889 (Engelhorn). Dr. Albert Zweck, Litauen, eine Landes- und Volkskunde, in »Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen«, Bd. I. Stuttgart 1898 (Hobbing & Büchle).
Von Landesgeologe a. D. Prof. Dr. R. Klebs in Königsberg.
Die Umgegend von Königsberg bietet manche landschaftlichen Reize. Das Tal des Pregels, ganz unverhältnismäßig breit im Vergleich zu dem schmalen Bett des gegenwärtigen Stromes, verdankt seine Entstehung und Größe den Fluten eines der ehemaligen Urströme, die zum Schluß der Diluvialzeit den heutigen Flüssen ihre Konturen vorzeichneten.
Wie das ganze norddeutsche Tiefland, deckte auch Ostpreußen einst ein jedenfalls Hunderte von Metern mächtiger Eispanzer, der sich von Norden nach Süden langsam fortbewegte und dabei alles mit fortriß, was sich ihm entgegenstellte und was er vom Boden und von den Seiten losquetschte oder losscheuerte. Der Moränenschutt der damaligen Gletscher, sei es von ihrem Grunde – Grundmoräne, seien es die vor ihrer Stirn aufgeschütteten und aufgepreßten Massen – Endmoräne, seien es endlich die durch Schmelzwasser des Eises umgelagerten, eingeebneten Gesteinsarten, bilden den Boden des norddeutschen Flachlandes und bedingen seine landschaftlichen und wirtschaftlichen Verschiedenheiten.
Königsberg liegt auf dem Nordufer jenes Urstromes, der als Abfluß der Schmelzwasser das Memelbett etwa bis zum heutigen Ragnit benutzte, sich dann nach Südwesten wandte, den Pregel als Nebental aufnahm und die gesamten Wassermassen so lange dem Frischen Haff zuführte, bis nach Durchbruch des Rombinus bei Tilsit ihr Hauptteil in den heutigen Memelmündungen nach Norden geführt wurde und das Gelände dadurch allmählich seine heutige Gestalt annahm. Vertorfung und Abschlämmassen sorgten dafür, daß die Zusammengehörigkeit zwischen Memel und Pregel so verwischt wurde, daß eine aufmerksamere Beobachtung notwendig ist, um die meist in bleibenden Zügen dem Boden eingezeichnete Karte richtig zu deuten.
Infolge seiner Entstehung ist der Boden südlich und westlich von Königsberg sehr eben. Ersteigt man dann das Ufer des Urstromes, dessen Lage durch die Straßennamen: Bauernberg, Schloßberg, Mühlenberg usw. bezeichnet ist, und betritt das Samland, so ist der Boden anfangs, infolge von Abwaschungen der Gletscherwasser, bevor sie sich das eigentliche Bett wühlten, auch noch eben, bald aber befinden wir uns auf dem leicht welligen Lande der ehemaligen Grundmoräne, aus der verschiedene zum Teil landschaftlich recht anziehende höhere Berge aufsteigen, die ihren Ursprung der Endmoräne verdanken.
In einer dieser Endmoränenbildungen liegt der Galtgarben, der leicht von den Bahnstationen Drugehnen oder Powayen erreicht werden kann. In ihm steigt das Terrain in dem Rinauberge bis zu 110 m an. Es ist dies keine bedeutende Höhe, aber immerhin bietet der fast isolierte Bergzug mit seinen schönen, dichten Eichenbeständen, seinen reizenden Fernsichten, einen recht lohnenden Ausflug. Auf der höchsten Stelle erinnert ein großes eisernes Kreuz an die Befreiungskriege 1813 und 1814, und am Johannisabend loderten bis vor kurzem hier zahlreiche Feuer empor, ein Andenken der Begeisterung, die damals, von Osten ausgehend, das gesamte Vaterland ergriff, jeden neu belebte und den Schlachtruf: »Mit Gott für König und Vaterland« durch alle Gaue ertönen ließ. In unmittelbarer Nähe des Kreuzes ist jetzt ein hoher massiger Turm in Zyklopenbau aufgeführt, dem Andenken des großen Kanzlers geweiht.
Auf demselben Höhenzug liegt an schönem Kiefernwald das Kurhaus Dellgiehnen. Noch an verschiedenen Stellen des Samlandes hat die Endmoräne schöne Berge gebildet, die alle, jeder in seiner Art, sich durch landschaftliche Reize auszeichnen, Zu nennen wären der Große Hausen bei Palmnicken, der Kleine Hausen, gekrönt mit einer sehr schön erhaltenen heidnischen Burgwallanlage, der Karlsberg bei Rauschen und der Wachbudenberg bei Klein-Kuhren.
Die schönsten Landschaften der Provinz, vielleicht des ganzen Ostseestrandes, bietet jedoch die Nordküste des Samlandes. Die Ostsee hat hier seit Jahrtausenden an den hohen Ufern gezehrt, sie unterspült, abgerissen und äußerst mannigfaltig gestaltet. Hier treten neben dem Diluvium mit seinen Blöcken, Sanden, blauen und gelben Lehmen, die blendendweißen, rotbraunen oder schwarzen Schichten des Tertiärs in bunten Wechsellagerungen, meist in steilen, hohen Gehängen, zutage, an die sich Inseln von olivgrünem, im Herbst rotbebeertem, dichtem Gestrüpp von Strandweiden klammern.
Bei Cranz, an der Wurzel der Kurischen Nehrung, sind die Ufer noch niedrig. Die Gewalt der See ist daher so stark, daß die kostspieligsten Steinbauten aufgeführt sind, um dem Untergange dieses Ortes entgegenzuarbeiten. Cranz, vor kurzer Zeit noch ein Fischerdorf, das sich allein durch seine geräucherten Flundern, durch seinen äußerst kräftigen Wellenschlag, seine schlechten Wohnungen und seinen Mangel an landschaftlichen Schönheiten auszeichnete, hat sich zu einem Städtchen und gesuchten Badeort emporgeschwungen. Es besitzt seine großen Logierhäuser, seine Hotels, seine Plantage mit täglichen Konzerten, seine Uferpromenade. Von Königsberg aus in einer halben Stunde Eisenbahnfahrt erreichbar, wird Cranz von Tausenden zu ihren Ausflügen benutzt. Kurgäste weist Cranz etwa 10 000 auf, meist solche Leute, die neben dem Genuß heilkräftiger Seeluft und kräftigen Seebades auch den Glanz der großstädtischen Gewohnheiten nicht entbehren wollen.
Westlich von Cranz liegt der Badeort Neukuhren. Er ist hauptsächlich von kinderreichen Familien besucht. Der flache, breite, sandige Strand macht ihn für erholungsbedürftige Kinder besonders geeignet. Man lebt dort auch billiger und ungezwungener wie in Cranz.
Eine Perle des ganzen Ostseestrandes, die Küste von Rügen miteingerechnet, ist die Strecke Rauschen, Georgswalde, Warnicken.
Rauschen hat sich in neuester Zeit ungemein entwickelt. Während das alte, niedliche, an der östlichen Uferterrasse einer tiefen Schlucht, deren Grund ein tiefer Teich deckt, gelegene Dörfchen ziemlich das alte geblieben ist, hat sich auf der Düne, die den Ort von der See trennt, ein neues, vornehmes Rauschen ausgebaut. Schöne, moderne Villen und Gasthäuser, ein großes, monumentales Warmbad, Wasserleitung, elektrisches Licht und eine strenge Bauordnung, die für die möglichste Erhaltung der Naturschönheiten kräftig sorgt, machen Rauschen befähigt, mit verschiedenen vornehmen Seebädern den Vergleich anzustreben. Der tote Dünenboden ist zur Fruchtbarkeit angespornt, und hübsche gärtnerische Anlagen lassen Schönes erhoffen, das gerade durch den Kontrast zwischen dicht aneinander liegender urwüchsiger Natur und Kunst besonders reizt. In vieler Beziehung aber ist Rauschen das Gegenteil von Cranz geblieben. Die ländliche friedliche Stille, der Mangel an großstädtischem Getriebe und die herrliche Landschaft machen es auch jetzt noch zum Lieblingsaufenthalt der Gelehrten und Künstler, die hier Gesundung für angestrengte Nerven und Anregung zu neuer Schaffenskraft reichlich erhalten. Rauschen bietet alles, was zu einem friedlichen, erquickenden Sommeraufenthalt an der See gehört, schönen alten Wald, einen windgeschützten, träumerischen, großen Teich, von Heidekraut gerötete Dünen, hohe Seeufer und ein kräftiges, erquickendes Bad.
Hier rauscht der Wald, hier rauscht die See,
Hier rauscht's am Mühlenrade,
Es ist ein Rauschen, wo ich geh',
Im Tal, am Meergestade.
sang Ernst Wiehert, ein eifriger, begeisterter Besucher dieses Badeortes.
Ein Spaziergang durch die kleinen und großen Katzengründe, die unmittelbar hinter dem Rauschener Hochwald beginnen, bietet eine solche Fülle interessanter und ständig wechselnder, landschaftlicher Charaktere, wie man sie an anderer Stelle in einer kurzen Zeit von etwa zwei Stunden kaum durchwandern kann. Aus altem Kiefernwald tritt man unmittelbar in kuppiges Gelände, auf dem sich Gruppen üppiger, schlanker Birken über Wacholder und Erika oder blendend weißem Sande schaukeln. Weiter geht es durch ständig wechselnden Baumbestand, über pflanzenlose helle Sande, an wasserreichen Bächen entlang, an geheimnisvollen Mooren vorüber, auf denen Seidelbast und Moosbeere wuchern, über üppige Teppiche von grünem Sauerklee oder knietief im Farnkraut und Gras, durch Berg und Tal bis zu einem Eichwald, von dessen höchster Stelle man einen imposanten Blick auf die Kronen der Laubbäume und über den weitausgedehnten Warnicker Forst hat. Auf dem ganzen Marsche sieht man die See nicht und glaubt sich bald in finnischen Birken, bald in der Heide Lüneburgs, bald in einem typisch ostpreußischen Walde, bald in einer üppigen Gegend Thüringens.
Ganz andere Bilder zeigt ein Gang durch den Wald und die mächtigen bewaldeten Schluchten (Gausup und Detroischlucht) von Rauschen nach Warnicken, diesem Glanzpunkt des samländischen Strandes. Warnicken, eine Oberförsterei und ein Logierhaus, bietet bei beschränktem Raum nur wenigen Gästen einen ständigen Sommeraufenthalt. Dagegen durchschreiten viele Tausende jährlich von Rauschen oder Großkuhren aus diesen Ort und seine berühmte Wolfsschlucht. Die fast 50 m hohen Ufer, gekrönt mit einem herrlichen, wohlgepflegten Wald, fallen hier steil zur See ab. Die anfangs wenig tiefe Wolfsschlucht sinkt auf kurze Entfernung schnell mit ihrer Sohle fast auf die Höhe des Meeresspiegels herab. Ein kleiner Gießbach hat sich in die Höhen hineingewaschen und die zum Teil sehr großen Blöcke aus dem Erdreich freigespült und auf dem Grund der Schlucht als Zeichen seiner Tätigkeit zurückgelassen. Die Ufer der Wolfsschlucht sind mit üppigem Unterholz bestanden; die schönsten Partien durch Gänge und Treppen zugänglich gemacht. Die Höhen selbst, namentlich die Wolfsspitze, gewähren prachtvolle Fernsichten. Die Ufer bestehen hier zum Teil aus rotem und blaugrauem Diluvialmergel, der in seinen Farben, trocken – an die weiße Kreide von Rügen, feucht – an verschiedene harte Gesteine erinnert. Schon diese Färbung gibt den Abhängen ein eigentümliches Aussehen, das noch durch die Vegetation wechselvoller gestaltet wird. Eine meterdicke Esche hat sich weit über den Abhang geneigt. Dort hängt eine herabgestürzte Kiefer, dort wieder hat sich ein üppig grünes Erlengebüsch angesiedelt. Abgeschlossen wird dieses Bild durch die See, deren Wellen sich an den unzähligen erratischen Blöcken des Ufers brechen. Treten hierzu noch die Beleuchtungseffekte einer klar untergehenden Sonne, so bietet sich ein Naturgemälde dar, wie es erhabener und schöner nicht gedacht werden kann.
Hat man Rauschen, Georgswalde und Warnicken gesehen, so wird von den weiteren Strandpartien nur einiges besonders auffallen. Das Dörfchen Großkuhren bietet belehrende Belege für die durch Verwitterung und Erosion hervorgebrachten geologischen Erscheinungen. Der vollständig kegelförmige, sich 47 m über den Seespiegel erhebende Zipfelberg mit seiner gelb-braunen, turmförmigen Spitze, seiner schneeweißen Abdachung und seinem rotfarbenen Fundament, gewährt einen Anblick, der nie aus dem Gedächtnis schwindet.
Gewaltig ist der Eindruck, den man von der Endmoränenkuppe, dem Wachbudenberg bei Kleinkuhren empfängt. Man übersieht von ihr den Nord- und Westrand der samländischen Küste, den Leuchtturm von Brüsterort, fern im Norden die bleichen Dünen der Kurischen Nehrung, im Südwesten die saftigen Wiesen und Äcker des Samlandes.
Brüsterort oder das Vorgebirge zur Brust liegt auf der Scheitelspitze des Samländischen Nord- und Westrandes. Außer seinem Leuchtturm und den mannigfaltigen Wolkenbildungen, welche durch die sich hier begegnenden Luftströmungen beider Küsten erzeugt werden, bietet Brüsterort wenig Bemerkenswertes. Der Anprall der Wellen ist hier so groß, daß ganz bedeutende Strecken Landes abgerissen sind, deren Reste das Vorgebirge in einer tief in die See hineingehenden Steinklippe umlagern. Diese Klippe, den Schiffern äußerst gefährlich, bildet gegenwärtig den Schutzwall für Brüsterort und war durch ihren Reichtum an Bernstein berühmt und geschätzt. Die Gewinnung des Bernsteins im großen Maßstabe durch Taucher brachte ein schnelles Emporblühen von Brüsterort mit sich. Es entstanden in wenigen Jahren Baulichkeiten für Wohnungen, Fabriken und Lagerräume, die aber auch schnell verschwanden, als der Bernstein seltener zu werden anfing. Gegenwärtig ruht die Taucherei seit zehn Jahren dort gänzlich und dürfte nicht früher in Angriff genommen werden, als bis Sturm und Wellen im Laufe der Zeit wieder neue Bernsteinvorräte in den Steinklippen aufgespeichert haben. – Dagegen hat sich die Bernsteingewinnung am Weststrande des Samlandes bei den Ortschaften Groß-Kuhnicken, Kraxtepellen und Palmnicken in den letzten vierzig Jahren großartig entwickelt.
Soweit wir die Küste bis jetzt betrachtet haben, von Rantau am Nordstrand bis über Palmnicken am Weststrand hinaus, lagert im Niveau des Meeresspiegels, etwas darüber oder etwas darunter, eine grünblaue tonig-sandige Erde in einer Mächtigkeit von 1-6 m. Diese sog. Blaue Erde ist das einzig bekannte Muttergestein des Bernsteins. Lange vor unserer Weltperiode, zu einer Zeit, welche der Geologe Eozän nennt, war das Antlitz der Erde ein ganz anderes. In dem uns hier interessierenden Teil des Globus lag fast ganz Deutschland, weite Strecken Rußlands, Englands, Frankreichs, Belgiens unter Wasser, dagegen dehnte sich Skandinavien zum Teil inselartig nach Süden weit aus und berührte etwa die heutigen Grenzen unseres ostpreußischen Vaterlandes.
Auf den südlichen Teilen dieses Festlandes wucherte damals eine Vegetation, deren Charakter der heutigen nordamerikanischen und japanischen entsprechen dürfte. Wir finden in den erhaltenen Resten neben Kampher- und Lorbeerbäumen, zahlreichen Eichen, Zypressen, auch eine Anzahl Nadelhölzer, von denen eins in seinem Harz den Bernstein lieferte. In tausendjährigem Generationswechsel häufte sich das Harz dieser Bernsteinbäume in großen Mengen in dem damaligen Waldboden an, während die Bäume vermoderten. Bei einer Senkung dieses Festlandes kam der Waldboden in den Bereich der Wellen, wurde zerspült und seine Reste einschließlich des wohlerhaltenen Harzes als eine Schicht abgesetzt, die wir jetzt Blaue Erde nennen.
In späteren geologischen Perioden kamen noch mannigfache Veränderungen vor, welche Teile des damaligen Absatzes wieder umlagerten und dadurch den Bernstein mehr zerstreuten. Auch heute noch löst jeder Sturm dieses Material von den in der See ausstreichenden Partien blauer Erde los und wirft es als sogenannten Strandsegen den Bewohnern ans Ufer. Nicht »in den Schoß« will ich sagen, denn es erfordert die größte Ruhe und Wetterfestigkeit kerniger Strandbewohner, um das losgelöste ostpreußische Gold dem aufgeregten Meere abzuringen. Wenn der geeignete Wind recht braust und wütet und Bernstein zu erwarten ist, bemächtigt sich eine große Lebendigkeit der beteiligten Strandbewohner. Alles eilt mit Netzen bewaffnet den Uferbergen zu und sieht erwartungsvoll in die See hinaus. Jetzt zeigt sich die dunkelgrüne Tangmasse, die den Bernstein umhüllt und schwimmend erhält, als schmaler Streifen am Horizont; jetzt wirft die Brandung ihn näher und näher; sie kann nicht landen, weil die rückkehrenden Wellen sie immer wieder zurückziehen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. Beherzt gehen die Männer bis unter die Arme in die schäumende See, um mit den langgestielten Netzen (Kätschern) die schaukelnden Tangmassen ans Ufer zu werfen, woselbst Frauen und Kinder den Bernstein auslesen.
Außer durch dieses Fischen gewinnt man das versteinerte Harz bei ruhigem und klarem Wetter durch das sogenannte Stechen. Hierbei wird der aus den Tangmassen auf den Seegrund gefallene Bernstein mit langgestielten Kratzen von Booten oder vom Eise aus in die Höhe geholt.
Diese Gewinnungsarten waren früher die allein gebräuchlichen. Die ältesten Nachrichten über das Graben des Bernsteins aus der Erde der Uferberge stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. 1781 wurde das erste Bergwerk angelegt, das auch bis 1805 bestand und dann aufgegeben wurde. Seine Anlage beschränkte sich auf die Ausbeutung des in jüngeren Schichten vorkommenden Bernsteins, ohne daß die blaue Erde in wirklichen Angriff genommen wurde.
Seit alten Zeiten, unsere Nachrichten reichen bis ins 12. Jahrhundert, war der Bernstein in Ostpreußen Regal Staatliches Eigentum.. Er wurde vom Staate, indem dieser die Strandbewohner zum Sammeln zwang, selbst gewonnen und verkauft. 1811 entschloß man sich, die Ausnutzung des Regals an Privatpersonen und 1837 an die am Strande liegenden Gemeinden zu verpachten. Diesen räumte man auch die Rechte ein, den Bernstein aus der See zu schöpfen, am Strande zu lesen, in den Uferbergen zu graben und freihändig zu verkaufen.
Mit dieser pachtweisen Freigabe begann die Zeit der Tagebauten auf Bernstein. Zu diesem Zwecke wurden mehrere Morgen große Landstrecken der Uferberge, die stellenweise eine Höhe von 40 m erreichen, bis zum Seespiegel und unter diesem abgeräumt, um zur blauen Erde zu gelangen. Bedenkt man, welche hohen Kosten es erforderte, diese zu erreichen, so erhält man einen Begriff von dem Reichtum der blauen Erde an Bernstein, da dieser Abbau immerhin erträglichen Vorteil brachte.
Aus einem solchen Tagebau entstand auch 1875 das erste Bergwerk auf Bernstein in Palmnicken. Ganz in althergebrachter Weise hatte man hier 1874 zu graben angefangen und war tief unter dem Meeresspiegel bis zur blauen Erde vorgedrungen. Alle die wasserführenden Schichten über der blauen Erde, welche die Anlage eines anderen Bergwerkes bei Nortycken einige Jahre früher unmöglich machten, hatte man in Palmnicken möglichst abgedämmt. Das Wasser, welches bei Durchbrüchen sich doch ansammelte, floß in die ausgehobene Grube, die durch einen stehengebliebenen Damm gegen die See geschützt war, und wurde mit großen Schaufelwerken ausgepumpt. So gelang es, des Wassers Herr zu werden. In die fester stehende blaue Erde wurde dann ein Stollen getrieben, wodurch die gefährlichen Schichten unterfahren und ein Abfluß des Wassers nach der offenen Grube hergestellt werden konnte. Später stieß man Schächte nieder, deren Wasser denselben Weg nehmen mußte. Erst als im Inneren der ganze Bau mit Wasserhebemaschinen usw. so weit gesichert war, daß eine Verbindung mit der offenen Grube nicht mehr dringende Notwendigkeit war, wurden die offenen Stollen geschlossen und der Tagebau durch die geförderte blaue Erde zugeschlemmt.
Es ist interessant, in welcher Weise aus den Massen zutage gebrachten Erdbodens der Bernstein gesondert wird. Alles, was zutage gefördert ist, wird mit äußerst kräftig wirkenden Strahlen von Grubenwasser zerwaschen und fließt über lange Rinnen, deren Boden aus Sieben bestehen. Hier wird der Sand fortgespült und der Bernstein in Netzen gefangen. Nachdem dieser zur letzten Reinigung noch große, sich drehende Fässer durchlaufen hat, kommt er in die Sortierungssäle, wo er nach Größe, Farbe und Qualität in etwa 150 Handelssorten geteilt wird.
Aber nicht allein durch den Bergbau trat die Gewinnung des Bernsteins in ein anderes Stadium, auch die anderen alten Gewinnungsmethoden wurden durch neuere verdrängt. An Stelle des Stechens trat der Taucher.
Die Bernsteingroßhandlung Stantien & Becker, welcher der so großartige Aufschwung der Bernsteinproduktion allein zu verdanken ist, hat noch als drittes Arbeitsfeld das Kurische Haff in ihre Tätigkeit gezogen. Hier lagert unter dem Schutz der Düne bei Schwarzort etwa 4-5 m im Haffgrund Bernstein. Bevor wir näher auf die Gewinnung desselben eingehen, wäre es am Platz, wenigstens in Kürze eine dortige Landschaft zu skizzieren.
Die Kurische Nehrung, dieser schmale Landstreifen, welcher von Cranz bis Memel das Haff von der See trennt, bietet durch seine großartigen Dünenbildungen eine Naturerscheinung, wie sie einzig in der Welt dasteht. Die Dünen der Kurischen Nehrung übertreffen die der jütländischen und holländischen Küste fast um das Dreifache. Während diese eine durchschnittliche Höhe von 10 bis 16 m, im höchsten Punkt 34 m besitzen, hat die Düne der Kurischen Nehrung eine Kammhöhe von 40-50 m. Wer diese Nehrung gesehen, wird erstaunt begreifen lernen, welche wirklich unermeßlichen Sandmassen der durch die Wellen gerollte Kiesel liefert, welche gewaltige Umänderung der Erdoberfläche der Wind erzeugen kann. Unter spitzem Winkel von der See ansteigend, erhebt sich der Sandwall bis zu 70 m Höhe, steil zum Haff abfallend, ein frisch geschütteter Grabhügel, unter dem Flecken und Dörfer bedeckt liegen.
Großartig, aber schauerlich öde erscheint uns die Nehrung von ihrer Kammhöhe bei Nidden oder bei Schwarzort. Soweit das Auge reicht, können wir zwischen Haff und See den gelben, stellenweise grünlichen Sandstreifen verfolgen, der in der Niederung nach der Seeseite meist durch ein schmales Band von Birken eingefaßt ist. Wenig Leben herrscht hier auf der Höhe, so freundlich auch See und Haff herüberlachen. Früher einmal ist die Kurische Nehrung fast ganz bewaldet gewesen, aber eine zum mindesten unvorsichtige Hand hat diese Waldung zum großen Teil niedergelegt und dadurch den losen Sand freigegeben, der, jetzt ein Spielwerk des Windes, sich der jedesmaligen Stärke und Richtung desselben in seiner Lagerung anpassen und im ganzen haffeinwärts wandern muß, vermehrt durch Neubildungen am Seeufer. Die Wanderung der Düne war recht beträchtlich, da sie im Durchschnitt etwa 5 m jährlich betrug. Fast alle an der Haffseite gelegenen Ortschaften sind dem Untergange geweiht, und werden, gelingt es nicht, die Düne festzulegen, über kurz oder lang unter ihrem 50 m hohen Sandwalle begraben sein. So lag anfangs des 19. Jahrhunderts die Kirche des früheren Dörfchens Kunzen etwa 100 m von dem östlichen Abhange der Düne entfernt, 1839 bereits unter der Kammhöhe, heute ist die Düne lange darüber hinweggeschritten, die Ruinen der Kirche liegen etwa 600 m vom Westabhange. Es gibt unzählige Beispiele für die großartigen, sichtbaren Wanderungen dieser ungeheuren Sandmassen der Kurischen Nehrung. Nur an einer kleinen Stelle bei dem Badeort Schwarzort hat der ursprüngliche Urwald an der Haffseite dem Anprall der Düne standgehalten, weiter auf der Höhe allerdings fing auch er bereits an zu wanken. Vielfach sieht man dort Stämme, die bis zur Spitze von der Düne beschüttet sind. Zahlreiche, einst mächtige Kiefern strecken ihre zwar grünen, aber kranken Zweige wie verzweifelnd aus dem Sande empor; ein trauriges Bild des Kampfes um Leben oder sicheren Untergang.
Mit großer Kraft hat daher der Staat eingesetzt, um die Dünen wieder zu befestigen. Hunderttausende kosten die Anpflanzungen von Koniferen unter dem Schutz von Strandhafer. Schon macht sich der günstige Erfolg sehr bemerkbar, und vielfach sieht man jetzt hübsche Schonungen, die mit ihren Wurzeln die beweglichen Sandkörnchen festhalten und durch Blätterfall die Bildung einer Grasnarbe begünstigen.
In der Nähe von Schwarzort befindet sich, nur etwa 15 m unter dem Spiegel des Haffes, ein Bernsteinlager, das zu einer Zeit durch die See zusammengeschwemmt und aufgespeichert wurde, als die Nehrung vielleicht nur als Untiefe der See, von den Dünen selber wenig oder gar nichts vorhanden war. Die Ausbeutung dieses Bernsteinlagers begann aus kleinen Anfängen in den fünfziger Jahren und erreichte 1890 eine solche Ausdehnung, daß 22 große eiserne doppelte Dampfbagger, fünf Dampfer und etwa 300 Arbeiter dabei tätig waren. Durch die Bernsteingewinnung entwickelte sich Schwarzort aus dem kleinen, kaum bekannten Dörfchen zu einem ansehnlichen Badeort, der namentlich aus Memel und Königsberg seinen Zuzug hat.
Mitte der neunziger Jahre hob die Firma Stantien & Becker die Bernsteingewinnung in Schwarzort auf, und mit Anfang des neuen Jahrhunderts trat sie überhaupt ihre sämtlichen Werke an den preußischen Staat ab, der die Bernsteingewinnung und Verwertung vollständig auf Beckerscher Grundlage weiterführt, aber nur das Bergwerk bei Palmnicken in Betrieb hat.
Für die großartige Steigerung der Bernsteinproduktion sprechen am besten die Summen, die der Staat aus dem Regal gezogen hat. 1805 betrugen seine Einnahmen 3000 M., 1815: 24 000 M., 1865: 41 000 M., 1873 durch Entwickelung der Tätigkeit von Stantien & Becker 250 000 M., 1899: 826 000 M., 1905: 1 365 000 M. und 1906: 1 182 000 M.
Es ist einleuchtend, daß bei dieser in Hinsicht der Menge fast um das Vierzigfache gesteigerten Produktion des Rohbernsteins auch der Handel mit ihm ein ganz anderer geworden ist. Da in früheren Zeiten selten und dann auch nur ein ganz oberflächliches Sortieren des Rohbernsteins stattfand, war jeder Fabrikant gezwungen, die Ware meist so zu kaufen, wie sie gefunden wurde. Was er davon nicht für seine Fabrikation brauchen konnte, mußte er anderweitig zu verwerten suchen. Jetzt besteht ein nach Größe und Form so feststehendes Sortiment, daß jeder Industriezweig stets genau sein Material erhält. Hierauf kann er bauen und sein ganzes Geschäft einrichten. Sogar den Geschmacksrichtungen der verschiedenen Länder in bezug auf Farben des Bernsteins ist bei der gegenwärtigen Sortierung Rechnung getragen.
Die gesamte Bernsteinindustrie zerfällt in drei Zweige. Die Fabrikation der Rauchrequisiten verbraucht die größten flachen, die Fabrikation der Perlen und Bijouterien die mittleren runden, und die Fabrikation des Bernsteinlackes die kleinsten Bernsteinstücke.
Als Fabrikationsort für Rauchrequisiten nimmt Wien bei weitem die erste Stellung ein, weil es den Meerschaummarkt vollständig in Händen hat und eine sehr große Anzahl geübter Arbeiter und Schnitzer besitzt. Wien verarbeitet jährlich für 1 400 000 Mark Rohbernstein. In Deutschland will diese Industrie nicht festen Fuß fassen. Ruhla, Lemgo, Nürnberg, Danzig usw., überhaupt ganz Deutschland, liefert zusammen etwa ein Sechstel der Rauchrequisiten, die Wien herstellt. In den letzten Jahrzehnten fabriziert auch Rußland, namentlich Schitomir, Zigarrenspitzen; ebenso sind in Amerika Fabriken für Ansatzspitzen entstanden, die jährlich für 800 000 M. Rohbernstein verbrauchen. Auch Konstantinopel, mit 90 000 M. Rohbernstein, fängt an, selbst zu fabrizieren, und macht den Versuch, sich von Wien wenigstens etwas unabhängig zu machen.
Deutschland, das für 530 000 Mark Rohbernstein bezieht, beherrscht die Perlenfabrikation und verarbeitet etwa 75 Prozent der gesamten hierhergehörigen Bernsteinsorten. Die Hauptabsatzgebiete des deutschen Marktes sind: der Orient, Sibirien, Ostafrika, England und Japan. Kleinere Fabrikationsorte für Schmucksachen besitzen die russischen Ostseeprovinzen. Auch Paris liefert besonders fein geschliffene Perlen.
Zu Lack wird der Bernstein besonders in Deutschland verschmolzen.
Es ist in neuester Zeit gelungen, gereinigte, kleine, stark erhitzte Bernsteinstückchen durch hydraulischen Druck zusammenzupressen. Dieser Preßbernstein wird, wie der natürliche Stückenbernstein, besonders zu Rauchrequisiten vielfach verarbeitet; wenn er in bezug auf Schönheit und Wert diesen auch nicht erreicht, so besitzt er doch gerade für Zigarrenspitzen viele seiner guten Eigenschaften und ist in größeren Stücken bedeutend billiger.
Fast der gesamte Bernstein, der in der ganzen Welt verarbeitet wurde und noch verarbeitet wird, stammt aus Ostpreußen. Mit ihm schmückte sich der Mensch der Steinzeit, ihn holten die kundigen phönizischen Seefahrer in Triest ab. Die Prachtliebe eines Nero ließ Expeditionen nach dem Norden ausrüsten, damit das kostbare Harz seiner krankhaften Verschwendungssucht nicht entgehe. Im Mittelalter blühten die Gewerke der sogenannten Paternostermacher (Bernsteindreher) in Lübeck, Brügge, Antwerpen und Venedig. Gegenwärtig ist er in der ganzen Welt beliebt. Zigarrenspitzen oder Mundstücke aus Bernstein zieht jeder Raucher allem andern Material vor. Perlschnüre aus den reinsten, trüben, mattgelben Bernsteinsorten lieben besonders die Orientalen und Engländerinnen, die mehr knochigen, weißlichen Arten schmücken die Bewohner West- und Ostafrikas, die hellklaren bezieht der Kaukasus, die feinsten klaren gehen nach Frankreich, Braunschweig und der Tartarei, die minderwertigen verbrauchen Rußland und Afrika. Der Beamte Chinas und Koreas setzt wohl einen ebensolchen Stolz in den Besitz einer langen Mandarinenkette aus Bernstein, wie der Indianer in seine Ohrkolben aus demselben Material. Etwa 100 000 Betkränze aus Bernstein gehen jährlich in die Hände frommer Mohammedaner und eine noch weit größere Anzahl von Rosenkränzen nach Südfrankreich, Spanien und Italien. Der Krieger in Marokko trägt sein geweihtes Bernsteinamulett auf der Brust, ebenso wie der Krieger Chinas. Ja, viele Perser schmücken nicht nur sich und ihre Toten, sondern auch ihre Pferde mit Schnüren von klaren, rissigen, oft eiergroßen Bernsteinperlen. Kurz, zu allen Zeiten finden wir den Bernstein in der Geschichte der Völker erwähnt, sei es in wohlerhaltenen schriftlichen Dokumenten oder in Beigaben alter Kultur- und Grabstätten. Überall, wo er gefunden wird, deutet er mit Sicherheit auf seine nordische Heimat. Dadurch ist er zum beredten Zeugen geworden nicht nur für geologische Perioden, sondern auch für die Zeiten, in welchen Sage und Geschichte eng verquickt sind, und gibt durch seine Originalität Aufschlüsse über Beziehungen der Völker zueinander, wie es kein anderer Stoff imstande ist. Mit großem Recht nennt daher Alexander von Humboldt den Bernstein den Vater des deutschen Handels im höheren Sinne des Wortes.
Von A. W. Grube.
Nebst Berlin haben noch vier Städte der preußischen Monarchie die Ehre, den Titel einer Haupt- und Residenzstadt zu führen: Breslau, Hannover, Königsberg und Potsdam. Letztere Stadt ist die kleinste, eine ausschließliche Schöpfung seiner Könige; sie ist bevorzugt durch die Nähe von Berlin und durch den Glanz Friedrichs des Großen, der hier sein Sanssouci gründete. Breslau ist nach Größe und Einwohnerzahl die zweite Stadt des Königreichs, als Fabrik- und Handelsstadt wie als Universitätsstadt bedeutend; ihre geschichtliche Weihe erhielt sie im Jahre 1813, als König Friedrich Wilhelm III. in die Hauptstadt Schlesiens seine Residenz verlegte und von dort den Aufruf an sein Volk erließ, das sich wie Ein Mann wider die Zwingherrschaft Napoleons erhob. Hannover verdankt das Prädikat einer Haupt- und Residenzstadt König Wilhelm II. Königsberg ist im Laufe der Zeiten so herangewachsen, und hat an Einwohnerzahl so zugenommen, daß es heutigentags mit zu den größten Städten der preußischen Monarchie zu zählen ist; es ist eine der ansehnlichsten Handelsstädte des Nordens. An geschichtlichem Ruhm und Glanz übertrifft es Breslau, Potsdam und fast Berlin selber. Nicht unverdient ist ihm die Ehre zuteil geworden, die zweite Haupt- und Residenzstadt der Monarchie genannt zu werden. Denn wie die Provinz Preußen als echt deutsche Schöpfung des tapferen deutschen Ritterordens vorzugsweise die zivilisatorische Kraft des germanischen Geistes und seine Überlegenheit über den slawischen nahe der Grenze des großen Slawenreichs dargetan hat, so hat sich in ihrer Hauptstadt Königsberg eben dieser echt germanische Geist in seinen guten Eigenschaften, klarer Verständigkeit, praktischer Tüchtigkeit, unbestechlichem Rechtsgefühl und Freiheitssinn gleichsam verdichtet. Der Königsberger Weise, Immanuel Kant, welcher die Philosophie in neue Bahnen lenkte, indem er sie von leeren Hirngespinsten zur Untersuchung und Prüfung des Tatsächlichen führte und mit aller Strenge zugleich die sittliche Würde des Menschen ins rechte Licht stellte durch seine Lehre vom kategorischen Imperativ, d. h. vom unbedingten Gehorsam, den wir dem Pflichtgebote schuldig sind – er war ein Königsberger Kind und der reinste und klarste Ausdruck des Geistes, der die preußische Monarchie erhoben, groß und tüchtig gemacht hat.
Dieser preußisch-deutsche Geist war schon im Großmeister des deutschen Ritterordens, Albrecht von Brandenburg, lebendig. Seit 1457 hatten die Großmeister Königsberg zu ihrer Residenz gemacht, waren aber in Lehnsabhängigkeit vom Königreiche Polen geraten, und als Regenten eines katholischen Ordensstaates standen sie zugleich unter dem römischen Papst. Jener Albrecht aus einer Seitenlinie des Kurhauses Brandenburg begriff die neue Zeit, die mit der Reformation Luthers für Deutschland angebrochen war: er wurde evangelisch-lutherisch und verwandelte mit Bewilligung seines polnischen Lehnsherrn das Ordensland Preußen in ein weltliches Herzogtum. Das geschah im Jahre 1525. Vergebens protestierten die Ordensritter. Die Reformation verbreitete sich so schnell in Preußen, daß Luther in freudiger Anerkennung an seinen Freund Spalatin schrieb: »Siehe dies Wunder! In vollem Laufe und mit vollen Segeln eilet jetzt das Evangelium nach Preußen!« Ein neues frisches Leben und geistiges Streben war in die Gemüter gekommen; um es auf wissenschaftlicher Grundlage zu festigen, gründete Herzog Albrecht die nach ihm benannte Universität, 1544.
Hand in Hand mit dem geistigen Leben ging der Aufschwung Königsbergs als Handelsstadt trotz der Nebenbuhlerschaft Danzigs, der Hauptstadt von Westpreußen, die mit Neid auf ihre jüngere Schwester im Osten blickte. In früherer Zeit hatte Danzig allen Seeverkehr der Ostsee an sich gezogen; seine Lage an der Mündung der Weichsel war um so vorteilhafter, als sich nach Osten eine lange Dünenkette (die Frische Nehrung) bis an die vorspringende Küste von Samland zog, die keinen Hafenort hatte. Jedoch war die Nehrung immer durch ein oder mehrere sogenannte Tiefs unterbrochen, Wasserrinnen, die die Verbindung zwischen dem Haff und dem offenen Meere bildeten. Diese Tiefs wechselten nun infolge Versandung ihre Lage mehrfach, hier und da wurde auch wohl eins durch das Versenken eines Schiffes gesperrt. Als sich nun in verhältnismäßig später Zeit das jetzige Tief bei Pillau bildete, erhielt Königsberg einen freien Zugang zur See, den es sich bis heute, allerdings nur mit künstlicher Hilfe, erhalten hat. So konnte es sich zur Seestadt entwickeln, und es blieb ihm die Handelsblüte, als es aufhörte, die Residenz der Herzöge von Preußen zu sein.
Als nämlich im Jahre 1618 die Nachkommenschaft Albrechts ausstarb, fiel das Herzogtum Preußen an die Hauptlinie der Hohenzollern, an die Kurfürsten von Brandenburg. Damit war ein neuer Aufschwung gegeben. Der große Kurfürst erkämpfte die Unabhängigkeit Ostpreußens von polnischer Lehnsherrschaft und bahnte damit seinem Sohne den Weg, sodaß dieser 1701 als Friedrich I. auf Grund des Besitzes dieser preußischen, zum Deutschen Reiche nicht gezählten Landesteile in Königsberg sich die Königskrone aufsetzen konnte. So ward die Hauptstadt Ostpreußens die Weihestadt des preußischen Königtums. Von Preußen erhielt die ganze Monarchie Namen und Wappen – der schwarze Adler in Silber, an das weiße Ordensband mit schwarzem Kreuz der deutschen Ritter gemahnend, wurde das Abzeichen der preußischen Gesamtmonarchie. Schon unter dem Enkel des ersten Königs erhob sich diese zur europäischen Macht, und als sie nach der ruhm- und tatenvollen Regierung Friedrichs des Großen wieder sank und durch Napoleon der Vernichtung nahegebracht wurde, da zog sich der schwergebeugte König Friedrich Wilhelm III. nach Königsberg in sein letztes und äußerstes, aber auch festestes Bollwerk zurück, und in diesem Brennpunkte preußischer Ehrenhaftigkeit, Vaterlandsliebe und Zähigkeit glimmte der patriotische Funke fort, um, genährt von Männern wie Stein, Wilhelm v. Humboldt, v. York, v. Schön, Graf Dohna, Niebuhr, Nicolovius, bald wieder zu hellster, herrlichster Flamme emporzulodern. Und es war in derselben preußischen Königsstadt, wo unser Heldenkaiser, König Wilhelm I., am 18. Oktober 1861 sich abermals die Krone aufsetzte, die zehn Jahre später im Glanze der Kaiserkrone des wiedergeborenen Deutschen Reiches strahlte. Seit 1871 gehören Ost- und Westpreußen wieder zum Deutschen Reiche, von dem sie der frühere »Deutsche Bund« ausgeschlossen hatte.
So ist der Name »Königsberg«, den sie dem Böhmenkönig Ottokar verdankt, für die Stadt von Vorbedeutung geworden. Der mächtige Ottokar ward von den deutschen Ordensrittern zur Bezwingung des Samlandes zu Hilfe gerufen, und er unternahm mit dem Markgrafen Otto von Brandenburg die Kreuzfahrt wider einen Stamm des unbändigen heidnischen Volkes der Porussi oder Prussi (Preußen), der dort hauste, als ein Werk christlicher Frömmigkeit – im Jahre 1254. Das Land ward bezwungen und zur Sicherung der Grenze auf dem Bergwalde Twangste eine Burg angelegt, welche dem König Ottokar zu Ehren, vielleicht auch in Erinnerung an eine Burg gleichen Namens im Heiligen Lande, der Königsberg (polnisch Krolewiec, litauisch Karalauzus) genannt wurde. Auch das älteste Wappen der Stadt, ein geharnischter und gekrönter Ritter, soll wohl an den ritterlichen Böhmenkönig erinnern.
Wie vier Jahrhunderte früher die von Karl dem Großen angelegte Feste an der Niederelbe der Anfang für die mächtige Stadt Hamburg wurde, so legte sich an den befestigten Königsberg allmählich eine Stadt an, die wieder die nahen Dorfgemeinden und Vorstädte in ihr Weichbild zog. Die drei Hauptteile: Altstadt, Löbenicht und Kneiphof, die ihre besonderen Wappen und Magistrate hatten, verschmolzen zu einem Ganzen, und die Stadt breitete sich so aus, daß sie jetzt nahezu 20 km im Umfange und 224 000 Einwohner hat.
Sie liegt in überall offener Gegend an beiden Seiten des Pregel, dessen rechtes Ufer, an dem die Hauptmasse der Stadt gelegen, sich aber derart emporhebt, daß viele Straßen abschüssig sind und mit einiger Sorgfalt sogar sieben Hügel gezählt werden können, weshalb man denn Königsberg auch wohl eine Siebenhügelstadt genannt und mit Rom in scherzhaften Vergleich gesetzt hat. Aber ein nicht zu unterschätzender Vorzug der Lage bleibt eine solche hügelartige Erhebung in einer Tiefebene, sei sie an sich auch nicht bedeutend. Wer sich der Stadt von Westen her nähert, vor dessen Blick steigt mächtig genug ihre Häusermasse terrassenartig auf, und in gewaltiger Ausdehnung ragt fast in der Mitte das altersgraue Schloß mit seinem hohen gotischen Turme empor.
Der Pregel, obwohl er nur ein Küstenfluß ist, hat doch ansehnliche Wasserfülle und ist ein viel mächtigerer Strom als etwa die Nürnberger Pegnitz oder Leipziger Pleiße. Schon bevor er die Stadt erreicht, gibt der alte Pregel einen Arm ab, der an den südlichen Vorstädten vorüberzieht, in der Stadt vereinigen sich der alte und der neue Pregel und umschließen nebst zwei Verbindungsarmen die Insel Kneiphof, »die Stadt der Kaufleute«. Sie trägt in ihrer Mitte das neue Bankgebäude, dem alten Dome gegenüber, welcher im Jahre 1322 vom Großmeister Lothar von Braunschweig aufgeführt wurde.
Altstadt (»die Stadt der Handwerker«) und Löbenicht (»die Stadt der Brauer«) liegen auf dem ansteigenden nördlichen Ufer; sie haben enge, abschüssige Straßen mit hohen altertümlichen Häusern. Doch hat die neue Zeit sich auch hier Bahn gebrochen, Raum und Licht geschafft. Wir eilen zu dem ernst und düster sich erhebenden königlichen Schloß, der ehemaligen Ordensritterburg, von welcher jedoch nur der Nordflügel ein Rest ist, denn die anderen Teile wurden im 16. Jahrhundert neu gebaut. Einzelne Nachbesserungen haben dem Ganzen nicht eben eine vorteilhafte Gestalt gegeben. Nicht ohne lebhafte Erregung unserer patriotischen Gefühle betreten wir die Schloßkirche im Westflügel, in welcher der erste König Friedrich und 160 Jahre später der erste Kaiser-König, Wilhelm I., sich die Königskrone aufs Haupt setzten. An den Wänden hängen große, engbeschriebene Gedächtnistafeln; sie enthalten die Namen der 1813, 1866 und 1870/71 für das Vaterland in den Tod gegangenen Söhne der Provinz, deren Blut in Strömen geflossen ist. Königsberg stellte 1813 die ersten freiwilligen Jäger, als ersten den Sohn seines Bürgermeisters Heidemann; die Provinz Preußen war die Wiege der preußischen Landwehr. Über der Kirche dehnt sich in riesigen Maßverhältnissen (83 m lang, 18 m breit!) der Moskowitersaal, an die Zeiten erinnernd, da Peter der Große darin tafelte und fünfzig Jahre später russische Generäle in der Provinz die Herren spielten. Unter dem Nordflügel befindet sich das »Blutgericht«, von welchem jedoch nichts schrecklich ist als der Name, da es sich hier um das Traubenblut handelt, das in den weiten Kellerräumen geborgen ist. Es drängt uns aber zur Höhe, und wir besteigen den Turm, von dessen Galerie man die schönste Umschau und Überschau von Königsberg genießt. Wir sind nur etwa 100 m über dem Spiegel des Pregel, aber welche weite, umfassende, überraschend wechselreiche Aussicht bietet uns diese Höhe! Wir sehen über die hohen Giebelhäuser des Löbenicht weit hinaus und tief hinein in die Gassen, welche sie bilden. Die riesigen Speicher zu beiden Seiten des Pregels sind herabgesunken, wie auf einer Landkarte verzeichnet erblicken wir die Pregelarme, die Kneiphofinsel einschließend; der Spiegel des lang sich hinziehenden, von grünen Baumgruppen und Gartenanlagen eingefaßten Schloßteichs liegt malerisch zu unsern Füßen; auf entgegengesetzter Seite, im Süden und Südwesten des Kneiphofs, erstrecken sich am linken Ufer des Pregel die vordere und hintere Vorstadt, der Haberberg und Nasse Garten. Im Gegensatze zu dem dichten Häuserknäuel der Altstadt und der Enge des Löbenicht ist da alles freier und heller; langgezogene Straßen und breite Zwischenräume, nach Westen hin begrenzt durch den Ost- und Südbahnhof. Sie liegen ganz nahe dem Strome, sodaß Land- und Wasserstraße sich berühren und ineinandergreifen. Lange Wagenzüge fahren bis nahe ans Ufer heran, um ihren Inhalt in die ihrer schon harrenden Schiffe abzugeben. Das rege Handels- und Verkehrsleben in der Vorstadt, die großen und kleinen Schiffe, welche auf dem vereinigten Strome hinauf- und herabkommen und zum Teil in seine Arme eindringen, machen das Stadtbild zu einem der belebtesten und frischesten.
Die Schiffe, Dampfer und Segler, führen den Blick ins Weite. Wir folgen dem Strome, der beim Holländerbaum die innere Stadt verläßt, nachdem er die Vereinigung seiner Arme vollzogen, auf der kurzen, nur 7½ km langen Strecke, die er noch bis zur Mündung ins Haff braucht, und sehen die blinkende Wassermasse wie einen gewaltigen Binnensee sich dehnen. An seinem Ufer verraten mächtige Bauten und Schornsteine, wie die Industrie der Stadt sich hier an der Wasserstraße entlang bis fast an deren Mündung ausbreitete. Hier liegen die neue Gasanstalt mit ihren mächtigen Ladetürmen, dahinter die Speicher, hier Waggon- und Maschinenfabriken, wie auch der Holzhandel da seinen Hauptsitz hat. Wir erblicken dahinter den schmalen Landstreifen, auf welchem das befestigte Pillau, der Außenhafen Königsbergs, liegt, in dem die größeren Seeschiffe ihre Ladung löschen. Pillau liegt unmittelbar am Ausfluß des Haffs in die Ostsee und beherrscht somit das ganze Haff. Die Entfernung von Königsberg beträgt 53 km; das Dampfboot fährt in 6 Stunden, die Eisenbahn in 1 Stunde dorthin. Malerisch steigen vom Boote hier und Dampfwagen dort die Rauchwolken empor, in ihrem Zuge noch die verschiedene Geschwindigkeit des Wasser- und Landfahrzeuges kennzeichnend. Pillaus Bedeutung ist ganz gesunken, seit der Seekanal Königsberg mit dem Tief verbindet. Das ist ein von Dämmen eingefaßter Kanal im Haff, in dem die Tiefe auf 6 m leicht gehalten werden kann, während die ältere Fahrrinne im offenen Haff gar zu oft zugeschwemmt wurde. Auch im Winter wird der Seekanal durch Eisbrecher dauernd offen gehalten, ist er doch durch seine Dämme gegen die Eisschiebungen im Haff geschützt.
Überaus wohltuend ist der Blick auf das fruchtbare, mit Wäldern und Seen bedeckte hügelige Samland, das im Norden von Königsberg und dem Frischen Haff sich halbinselartig ins Meer schiebt. Wir wünschen Königsberg Glück, daß es sich einer solchen Mannigfaltigkeit der Bodengestaltung, eines solchen Reichtums landschaftlicher Reize, die bis in das Weichbild der Stadt selber dringen, erfreut.
Welch ein großes und schönes, erquickliches und friedliches Bild stellt sich uns dar, wenn wir zu einem einfachen Landhause in der Vorstadt, der »Hufen« genannt, pilgern! Als nach den Unglücksjahren 1806-1807 das schwergeprüfte Königspaar Friedrich Wilhelm III. und seine Gemahlin Luise sich in die alte Königsstadt zurückgezogen hatten, erwählten sie dies bescheidene Sommerhäuschen zu ihrer Residenz. In dem dazu gehörenden Garten verweilte die unvergeßliche Königin mit ihren Kindern am liebsten. Stundenlang saß sie auf einem etwas erhöhten Platze, mit weiblicher Handarbeit beschäftigt, auf einer einfachen hölzernen Bank. Von dort konnte sie über die weite Ebene hinweg den Lauf des Pregelstromes bis zum Frischen Haff verfolgen, wo Land und Wasser ineinander verschwimmen. Im Jahre 1872 hat Kaiser Wilhelm I. das Busoltsche Grundstück käuflich erworben, und in dem reizenden, dem Publikum geöffneten Parke ward, nachdem schon zuvor auf der »Luisenwahl« (wie das Volk jenes durch Erinnerung geweihte Plätzchen nannte) ein Lindenbaum gepflanzt worden, am 2. September 1874 das Denkmal enthüllt: die Marmorbüste der edlen Königin, der unglücklichen und doch glücklichen Mutter des siegreichen Kaiser-Königs Wilhelm – eingefügt als Medaillon in eine monumentale halbkreisförmige Ruhebank.
Doch wir haben noch viel Merkwürdiges und Schönes in der Stadt selber zu betrachten, bevor wir Ausflüge in die Umgegend unternehmen können. Wir steigen von unserer Turmhöhe herab, betrachten vor dem östlichen Schloßportal das lebensgroße Standbild Friedrichs I. – »dem edlen Volke der Preußen zum immerwährenden Denkmal gegenseitiger Liebe und Treue den 18. Januar 1801 gewidmet von Friedrich Wilhelm III.« Am Südwestende des Paradeplatzes machen wir der dort aufgestellten Bronzestatue des großen Königsberger Weisen einen Besuch. Sie ist auf hohem Granitsockel in einer Halbrotunde aufgestellt und zeigt uns den Denker und Gelehrten in seinem 30. Lebensjahre, auf dem Höhepunkte seines Lebens. Bei einer solchen geistigen Größe bedurfte es nur des einfachen Namens »Kant« als Unterschrift. Die Anlagen verleihen dem Denkmal eine freundliche Umgebung. In der nahen Prinzessinnenstraße besuchen wir die Wohnung des Philosophen. Eine Marmortafel über der Tür seines Hauses trägt die Inschrift: Hier wohnte und lehrte I. Kant von 1783-1803. Das Grab Kants befindet sich in dem Dom von Königsberg. Gegenüber der Prinzessinnenstraße steht das prächtige, in den Jahren 1848-49 aufgeführte und seit 1905 sehr erweiterte Postgebäude, daneben die nach Schinkels Plan erbaute Altstädtische Kirche. Diese Bauten, aus festgebrannten Ziegeln aufgeführt, machen den Königsberger Baumeistern alle Ehre; sie vereinen unter trefflicher Benutzung des Baumaterials Festigkeit mit Zierlichkeit, Sicherheit mit gefälligem Schwung. Die Altstädtische Kirche stand früher auf dem Altstädtischen Kirchenplatze. Noch jetzt bezeichnet ein großer Granitblock die Stelle des ehemaligen Altars, gleichzeitig das Grab eines Sohnes von Luther. Auf demselben Platze steht auch das Bismarckdenkmal, während zu Füßen des Schlosses ein Denkmal Kaiser Wilhelms I. sich erhebt.
Die kurze Theaterstraße führt uns von der neuen Altstädtischen Kirche zum Prachtstück von Königsberg, nämlich auf den großen stattlichen Paradeplatz, auch Königsgarten genannt, mit reizenden Gartenanlagen, nordöstlich vom Theater, nordwestlich vom neuen Universitätsgebäude begrenzt. Letzteres ist ein in der Tat großartiger, nach Stülers Entwürfen ausgeführter Renaissancebau mit schöner Bogenhalle. In der Mitte der Hauptfront steht in Hochrelief das Reiterbild des Herzogs Albrecht, des Stifters der Königsberger Hochschule; weiter unten in Nischen die Standbilder Luthers und Melanchthons, hindeutend auf den protestantischen Geist, der die Hochschule ins Leben rief und durch mehr als 300 Jahre beseelte. Hoch oben unter dem Fries erinnern 14 Medaillonbilder an berühmte Lehrer, treu dem Leben nachgebildet. Das Innere enthält 62 größere und kleinere Säle und Zimmer; die große Aula, von einem Sternengewölbe bedeckt, zeigt an ihren Seitenwänden interessante Freskobilder, welche die verschiedenen Seiten der Kunst und Wissenschaft allegorisch darstellen. Der Grund zu diesem Prachtgebäude ward vom kunstsinnigen König Friedrich Wilhelm IV. 1844 bei der dreihundertjährigen Jubelfeier der Albertina gelegt. König Wilhelm I. vollendete den Bau und sein Sohn, der damalige Kronprinz Friedrich Wilhelm, weihte als Rektor im Jahre 1862 die neue Universität ein.
Die Mitte des Platzes ziert ein 5 m hohes Erzbild, die Reiterstatue Friedrich Wilhelms III., mit Reliefbildern geziert, welche die innere und äußere Erhebung Preußens, die sich in den Jahren 1808-15 vollzog, bildlich darstellen. Die Inschriften auf den vier Seiten lauten:
»Ihrem Könige die dankbaren Preußen 1841. Sein Beispiel, seine Gesetze machten uns stark zur Befreiung des Vaterlandes. Ihm verdanken wir des Friedens Segnungen.«
Der Künstler (Bildhauer Kiß) hat den König als heimkehrenden sieg- und ruhmgekrönten Feldherrn mit lorbeerbekränztem Haupte in wallendem Königsmantel dargestellt.
Am Schauspielhause, das auf architektonische Schönheit gar keinen Anspruch machen darf, halten wir uns nicht länger auf, sondern eilen dem nahen Schloßteiche zu. Fast 2 km lang ist er von schönen Gärten mit herrlichen, mehrhundertjährigen Linden eingefaßt. Die Königsberger sind auf dieses liebliche Idyll inmitten ihrer Stadt nicht wenig stolz und mit Recht. Die grünen, in kleinen Terrassen aufsteigenden Ufer, deren Bäume und Gebüsche sich anmutig im Wasser spiegeln und an lauen Sommerabenden ihren Lichterglanz auf den Spiegel senden, der, belebt von einer kleinen Flottille schmucker Bote, aus seiner Tiefe die Lichtpunkte heraufzuzaubern scheint – das ist, wenn auch nicht ganz so prachtvoll wie das Alsterbassin in Hamburg, doch ein hübsches Stück Poesie im staubigen, mühevollen Alltagsleben. An drei durch ihre Stille sich auszeichnende Logengärten grenzt der belebtere, geräuschvollere Börsengarten, an Konzerttagen der Korso, der die ganze schöne Welt Königsbergs sehen läßt. Im Winter zieht der Eisspiegel die bewegungslustige Welt an, und es wimmelt dann von Schlittschuhläufern und -läuferinnen, von Zuschauern, Schenkbuden, die es an Erwärmungsmitteln in fester und flüssiger Gestalt nicht fehlen lassen.
Da der Schloßteich viel länger als breit ist, so konnte ohne große Unkosten eine Brücke für Fußgänger darüber geschlagen werden. Seine Oberfläche mißt 47 Morgen oder etwa 10 Hektar; seine Höhe über dem Pregel beträgt 12 m, und noch 11 m höher liegt der Oberteich, der ihn speist.
Wir gehen, vom Schloßteiche kommend, über den Roßgärtnermarkt in die schnurgerade lange Königsstraße und verfolgen diese bis zur hohen eisernen Spitzsäule, welche dem Oberpräsidenten und Staatsminister v. Schön zu Ehren errichtet wurde. Sie steht vor der Malerakademie mit dem Stadtmuseum, das eine gewählte Sammlung neuerer wertvoller Bilder enthält, u. a. die Bartholomäusnacht von P. Delaroche. Am Ausgange der Straße stehen als würdige Zierden des Königstores die Standbilder des Königs Ottokar von Böhmen, des Herzogs Albrecht von Preußen und des ersten Preußenkönigs Friedrich I.
Königsberg ist eine Festung ersten Ranges und von Wall und Toren umgeben. Diesen Torbauten hat man auch architektonischen Wert zu verleihen gewußt. Vor den vierziger Jahren war Königsberg noch ohne alle Befestigung, mit Ausnahme eines kleinen Forts am Holländerbaum. Seit 1843 begannen die Befestigungsarbeiten, die bis auf die Gegenwart fortgesetzt wurden. Die Stadt hat einen starken Hauptwall erhalten mit 5 detachierten Forts und 72 Blockhäusern; auch sind in den letzten Jahren um Königsberg eine Anzahl großer Außenforts angelegt worden, welche die Stadt in einem Abstand von 5-10 km umgeben. Außer dem oben genannten Königstor sind noch andere ähnliche ausgezeichnete Bauten zu nennen: das Sackheimer Tor mit den Bildnissen von York und Bülow, das Roßgärtnertor mit den Bildnissen von Scharnhorst und Gneisenau, das Steindammer Tor mit der Statue Friedrich Wilhelms IV., des Gründers der Festung. Auch die Türme Dohna und Wrangel sind schöne Bauten. Allerdings leidet Königsberg jetzt unter der Einschnürung durch die Wälle und Forts.
Auf Verbesserung und Verschönerung der Bauten zu beiden Seiten des Pregel wirkten die großen Speicherbrände von 1839 und 1845 sehr ein. Anstatt des form- und stillosen Riegelbaues der alten Zeit entstanden massive Bauten von einfachen, aber edlen Formen, so das neue Kornmagazin. Der große, ziemlich plumpe Holzkran mit einem Trittrade früherer Zeit ist längst durch viele eiserne mit elektrischem Antrieb arbeitende ersetzt. Auch die Bildungs- und Wohltätigkeitsanstalten sind nicht zurückgeblieben und bilden eine nicht kleine Zahl stattlicher Gebäude. Einen durchaus modernen prächtigen Stadtteil aus einem Guß, wie ihn z. B. Hamburg in seinem alten und neuen Jungfernstieg besitzt, hat Königsberg nicht, aber dafür hat es auch kein Brandunglück von solcher Ausdehnung zu beklagen wie Hamburg. Und was ihm an einheitlicher architektonischer Wirkung abgeht, das wird ihm wieder reichlich ersetzt durch die Gunst der Lage, durch seinen Wasserreichtum, durch die malerischen Fernsichten, die ganz besonders auf den vielen Brücken, die über die Pregelarme geschlagen sind, in überraschend eindringlicher Weise sich darbieten.
Stellt man sich auf die sogenannte Grüne Brücke, die breiteste und ansehnlichste von allen – sie ist das Bindeglied zwischen der vorderen Vorstadt und dem Kneiphof – so liegt linker Hand vor uns die Börse. Dieser Prachtbau in italienischer Renaissance wurde 1875 nach dem Plane von Müller in Bremen vollendet und ist das großartigste Gebäude Königsbergs. Wenden wir uns von der Grünen Brücke dem Haffe zu, so ist der Blick wahrhaft überwältigend. Durch die Vereinigung der Pregelarme, die sich um die Kneiphofinsel schlingen, wird der Strom zu einer breiten Wasserfläche, der die Tiefe keineswegs fehlt. An beiden Ufern erheben sich in stattlicher Reihe die hohen Speicher, die auf der linken Seite in den Festungsbauten, auf der rechten im Zollhaus des Holländerbaumes ihren Abschluß finden. Durch die Packhofs- oder Lizentgebäude, durch die Balkone des Dampfschiffahrtslokals, durch das neue Prachtgebäude der Börse hat dieser Stadtteil eine größere Mannigfaltigkeit gewonnen, die eiserne Drehbrücke ist sehr stattlich. Den größten Reiz behält aber die Fläche des ruhig und sicher nach Westen ziehenden Stromes; sie wechselt mit jeder Minute das Bild, und im ganzen genommen bleibt dieses sich dennoch gleich. Zu beiden Seiten der Brücken liegen Holzschiffe aus Elbing und anderen Orten. Die Schiffer haben runde Hüte, große, lange Westen und über enge Tuchhosen noch weite leinene Pluderhosen gezogen. Zwischendurch drängen sich kleinere Fahrzeuge mit Käse, Kartoffeln, weißem Sand. Sobald sie anlegen, ist auch ihr Publikum da, aus kauflustigen Köchinnen und Hausfrauen der unteren Volksklasse bestehend. Die Bordinge hängen schwarze Tafeln aus, auf denen der Name des Schiffers und der Ort, wohin er fährt, zu lesen ist. Hier geht die Dampffähre über den Pregel hin und her, dort fliegt ein elektrisches Fährboot pfeilschnell über den Fluß. Größere Segelschiffe und Dampfer mit voller Ladung kreuzen ihren Lauf, lange und tiefe Kähne legen bei den Speichern an, um deren Schätze zur See zu führen. Andere liegen hinter dem Holländerbaum vor Anker, um ihren Ballast auszukarren, der den Boden Amerikas, Norwegens, Dänemarks, Hollands mit preußischer Erde mischt. Deutsch, englisch, holländisch, polnisch, dänisch wird durcheinander gesprochen, und die Brückenwärter und Aufseher am Bohlenwerk wissen sich mit allen zu verständigen. Neben zierlich gebauten Schiffen erscheinen die plumpen Wittinnen, welche die Rohprodukte des großen Nachbarreiches: Getreide, Holz, Hanf vom oberen Pregelgebiete herabbringen. Ihre Mannschaft sind die originellen »Dschimken« (Polen), rohe, aber lustige Naturkinder, deren Kleidung in Hemd und bauschiger Hose von grauer, grober Leinwand besteht. Auf ihrem Kopfe tragen sie eine pelzverbrämte Mütze oder auch einen abgetragenen Zylinderhut, der ihnen irgendwo geschenkt wurde. Ein Kessel mit dampfender Erbsen- oder Mehlsuppe, die womöglich mit Speckstücken und Brotschnitten gewürzt ist, wird auf einer Stange herbeigetragen, der Inhalt desselben in ein trogartiges Gefäß geschüttet, und nun beginnt die fröhliche Mahlzeit. Ist Feierabend, dann läßt eine Geige ihre dünnen und schrillen Töne hören, jauchzend springt das Völklein empor und beginnt den Tanz, mit Händen und Füßen, Augen und Mienenspiel arbeitend, sodaß jeder Muskel am Tanze teilnimmt. Es ist eine Lust, dieser überströmenden Freude zuzuschauen. Nur der Befehlshaber und oft auch zugleich Eigentümer des Fahrzeugs, vom Stamme Juda, schaut ernst und finster drein; er berechnet indessen seine Prozente, welche die Ladung ihm eingebracht hat.

Königsberg. Blick auf den Pregel vom Weidendamm.
Nach einer Photographie von Gottheil & Sohn, Königsberg i. Pr.