
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
An deutschen Küsten und auf deutschen Meeren.
1. Die Halligen. – 2. Hamburg. Hamburgs Freihafen. – 3. Helgoland. – 4. Bremerhaven. – 5. Aus der deutschen Marsch: Das Alte Land. – 6. Borkum. – 7. Die deutsche Hochseefischerei.
Von Dr. Häberlin, Wyk auf Föhr.
Die Inselwelt an der Westküste Schleswig-Holsteins birgt mancherlei Eigentümliches und Fremdartiges. Das Merkwürdigste aber an Natur- und Kulturerscheinungen zeigen uns jene Zwergeilande, in die der südliche Teil der nordfriesischen Inseln aufgelöst ist, die Halligen. Etwa zwölf an der Zahl, umfassen sie gegen 2500 ha Bodenfläche und bergen wenig mehr als 500 Einwohner.
Es ist Etwas in der weltabgeschiedenen Stimmung dieser Inseltrümmer, das auch dem modernsten Kulturmenschen ans Herz greift, wie ein Wiegenlied aus der Menschheit Jugendtagen, – der überall sichtbare und greifbare Kampf mit der Natur, die Einfachheit der Lebensbedürfnisse, die völlige Abgeschlossenheit vom Verkehr. –
Die größte Hallig, Langeneß-Nordmarsch, hat gegen 200 Einwohner und liegt etwa eine Stunde Bootsfahrt von dem Badeort Wyk entfernt. Wenn wir sie von Wyk aus besuchen wollen, müssen wir bedacht sein, zur Zeit der höchsten Flut abzufahren. Sonst hat die Landung ihre Schwierigkeiten. Kilometerweit vor der Halligkante erstreckt sich das »Watt«, früher fruchtbares Weideland, seit Jahrhunderten aber unter den Meeresspiegel gesunken, ist es immer noch ein strittiges Gebiet, bei Ebbe trocken, bei Flut vom Wasser bedeckt, leider nur 1-2 Fuß tief. – Während wir zwischen unserem Boot und dem Halligufer noch weithin Wasser, nichts als Wasser sehen, knirscht der Kiel unseres Kutters am Grund, und der Schiffer erklärt uns, daß wir nun zu Fuß das Meer durchschreiten müssen. Nach kurzer Verblüffung bemerken wir, daß dies Wagnis nicht viel Schwierigkeit bereitet; barfuß bis zum Knie, waten wir im seichten Wasser wohl einen Kilometer weit; allmählich kommen wir aufs Trockne, aber beileibe noch nicht auf die Hallig; noch einen ganzen Kilometer geht es übers trockene Watt: Sandboden, vom Spiel des Wassers mit Rippeln in langen Linien gezeichnet und mit unzähligen kleinen Sandhäufchen besät, die wir manchmal, o Wunder, wie von Miniaturvulkanen ausgeworfen vor unsern Füßen aus dem Boden steigen sehen: es ist der Sandpier (Arenicola marina), der Regenwurm des Watts, der den unverdaulichen Rest des Sandes, den er aufgesaugt, wieder ausstößt. Es geht sich angenehm auf dem festen, sandigen Grunde, nur ab und zu machen Kolonien von Miesmuscheln ihre scharfen Schalen an unseren Fußsohlen unangenehm fühlbar. Auf den Muscheln solcher Kolonien sehen wir massenhaft Seesterne, die Blutsauger der armen Schaltiere; der tödlichen Umarmung der Sterne vermag die Muschel nicht lange zu widerstehen, sie öffnet ihre Klappen und wird nun bei lebendigem Leibe aufgefressen. Noch allerhand anderes Getier belebt unsern Weg, Taschenkrebse und Krabben tummeln sich in seichten Tümpeln, Tausende von Seevögeln erfüllen mit melancholischem, unheimlichem Getön die Luft. – Der Meeresboden, über den wir schreiten, kündet uns durch mancherlei Zeichen, daß er einst bewohntes Land war: Reste von Bäumen, vertorftes Wiesenland, Baumwurzeln finden wir hier und da, und wir erkennen unzweideutig, daß hier ein großes, zusammenhängendes Landgebiet bis auf kärgliche Überreste vom Meere verschlungen wurde. Immer näher kommen wir dem zerrissenen, zackig gebuchteten Ufer. Hier wächst schon der »Queller« (Salicornia herbacea), ein merkwürdiger, dickfleischiger Gesell, eine »Verlandungspflanze«. Wo dieser »Mehrer des Reichs« Fuß gefaßt, befestigt er den losen Schlick, hält die im Wasser schwimmenden Erdteilchen fest und bewirkt so ein immer höheres Steigen des Landniveaus und – gräbt sich damit selbst sein Grab. Denn sobald das Salzwasser ihn nicht mehr erreicht, muß er sterben. –
Endlich erreichen wir die Halligkante. Wenige Fuß ragt sie aus dem sandigen Watt empor, ohne jeden Schutz durch Damm und Deich, nackt und wehrlos. Deutlich zeigt sie die nagende Wirkung der Meereswellen, mit denen sie seit Jahrhunderten in zähem Ringkampfe sich erschöpft. Und sie hat sich brav gehalten, die arme, unbewehrte Erdscholle: schon 1788 haben die Gelehrten ausgerechnet, daß in hundert Jahren von unserer Hallig Langeneß nichts mehr übrig sei, und noch steht sie da und hat sich 200 ha Landes ertrotzt. – Wir betreten endlich den Boden der Hallig; kein Mensch weit und breit – Schafe und Kühe weiden den dürftigen Graswuchs ab. Da und dort zeigen Massen von Muscheln und anderem Seeauswurf, daß die Nordsee hier sich öfter ungebeten breit macht. Schlammige »Priele« (Wassergraben, siehe Bild) durchziehen überall das Land und machen es für den Unkundigen zu einer Art Labyrinth; wollte er geraden Wegs auf sein Ziel losgehen, so würde er unfehlbar in den Sumpf dieser Priele geraten. Man muß schon einen Führer haben, um eines der Hallighäuser zu erreichen. – Die Häuser stehen auf Hügeln, sogenannten »Werften« (siehe Bild), künstlich von Menschenhand aufgeworfen. Während die Hallig selbst nur wenige Fuß über dem gewöhnlichen Flutniveau liegt und bei jedem höheren Anwachsen desselben unter Wasser läuft, ragen die Werften 4-5 m hoch empor. Schon Plinius erwähnt diese Siedelungsart, die uns einigermaßen an Pfahlbauten erinnern kann.

Eine Werft auf Hallig Hooge (bei Ebbe). Nach einer Photographie von Woldemar Lind, Wyk auf Föhr.
Auf jeder Werft liegen ein bis sechs Häuser zusammen, niedrig, strohgedeckt, Wohnraum und Stall unter einem Dach vereinend, alle nach dem gleichen Plan gebaut, jeder einzelne Teil des Hauses aufs Praktischste den Bedürfnissen angepaßt und mit größtem Scharfsinn bis auf den letzten Winkel ausgenützt. Während sonst auf der Hallig nicht Baum, nicht Strauch zu sehen, wachsen hier im Schutze der Bauwerke allerhand Bäume, selbst geschützt und wieder schützend; bei jedem Hause ein Gärtchen, eng an die Mauer geschmiegt, wenige leuchtende Blumen, Kartoffeln, Wurzeln, Rüben, wenig Gemüse – ein rührender Anblick. Inmitten der Werft eine große, tiefe, wassergefüllte Grube, »Feeting« genannt, die Lebensader der Halligwirtschaft, die das Süßwasser fürs Vieh birgt. Quellen gibt es nicht, so muß für Mensch und Vieh das Regenwasser helfen, das durch Kanäle aus den Feldgräben in den »Feeting« geleitet wird. Für die Menschen sind besondere Brunnen angelegt, die das Regenwasser vom Dach auffangen. Goldgelb schimmert es im Glase, und nur schwer entschließt sich der Gast, es für trinkbar zu halten. In besonders trockenen Zeiten, wenn die Zufuhr des Regenwassers vom Felde ausbleibt, helfen tiefere Brunnen am Grunde des Feeting, die das Grundwasser heraufpumpen. Dies erscheint aber selbst dem Halligmann nicht genießbar. Wehe, wenn eine Sturmflut ihr salziges Wasser in den Feeting ergießt; dann ist sein Inhalt verdorben und muß schleunigst ausgepumpt werden. Gelingt es nicht, ihn schnell genug mit trinkbarem Wasser zu füllen, so muß das Vieh unter die Nachbarn auf anderen Werften verteilt werden.
Der Halligbauer ist ein echter Friese und spricht unter seinesgleichen nur friesisch. Diese noch wenig erforschte Sprache scheint die Mitte zwischen Altenglisch und Plattdeutsch zu halten. Die Haupterwerbsquelle der Halligbewohner ist die Viehzucht, die Kälber, Lämmer, Wolle, Butter liefert. Getreide gibt es auf der Hallig nicht. Sammeln und Verkaufen von Möweneiern und die Krabbenfischerei spielen daneben keine wesentliche Rolle. Früher war jeder Halligmann Seemann; die Zeiten sind längst vorbei; zwar sind die Halligfriesen auch heute noch auf ihren kleinen Booten in der Küstenfahrt ausgezeichnete Schiffer, aber die hervorragende Rolle, die sie einstmals auf den Schiffen der deutschen, holländischen, englischen, dänischen Marine gespielt haben, ist leider zu Ende. – Ein bescheidener Wohlstand herrscht überall, bei dem knappen Erwerb aber nur durch die äußerste Anspruchslosigkeit ermöglicht. Auf den Besucher macht jeder Halligmann in seinem Hause den Eindruck eines Fürsten; stattliche Gastfreundschaft, ruhige Würde, wie sie dem ganzen friesischen Volksstamm eigen, durch und durch gediegene, heimatstolze Ausstattung, frei von städtischem Bettelprunk, berühren wohltuend, Freude und Behagen dem Gaste bereitend, der über die Schwelle des Hauses tritt. – Handwerker gibt es auf der Hallig nicht. Jeder kann jedes, sogar Schwefelhölzer werden im Hause gemacht. –
Die Ernährung ist in mancher Beziehung mangelhaft; frisches Fleisch ist höchst selten; fast das ganze Jahr hindurch wird Gepökeltes oder Geräuchertes gegessen. Zum Frühstück gibt es Kaffee; zum zweiten Frühstück Tee; mittags ein Gericht Pudding mit Fleisch, oder Pfannkuchen usw.; zum Vesper Kaffee und Brot; abends wieder Tee oder Grütze; Gemüse werden so gut wie nie genossen. Doch ist der Gesundheitszustand dadurch nicht merklich beeinflußt.
Vor nicht allzu langer Zeit war die Hallig Langeneß noch jeden Winter 1-2 Monate völlig vom Verkehr abgeschnitten. Der Stürme und des Eises wegen konnte kein Boot fahren. Jetzt hat die Regierung Dämme gebaut, die einerseits selbst begehbar sind und es ermöglichen, zu Fuß nach dem Festland zu kommen, andererseits das Treibeis in außerordentlichem Maße zurückhalten und so den Bootsverkehr viel leichter offen lassen. Auf vielen Inseln aber ist bei Treibeis der Verkehr mit dem Festland auch heute noch nur durch die nicht ungefährlichen Eisbootfahrten aufrechtzuerhalten.
Was an der Halligwirtschaft am meisten in Erstaunen setzt, ist der Umstand, daß alles Land Kommunalbesitz ist und jedes Jahr aufs neue verteilt wird, eine schwierige Aufgabe. Zum Teil ist diese Besitzform mitbedingt durch die alljährlichen unvermeidlichen Landverluste, die ohne das obige Regulierungsmittel die einzelnen Einwohner oft zu hart treffen würden. –
Die gegenseitige Hilfsbereitschaft ist unbeschränkt; gewisse Verrichtungen, wie das wichtige Bereiten des Brennmaterials, können nur durch Zusammenhelfen vieler geschehen. Das einzige Brennmaterial der Halligleute ist getrockneter Kuhmist. Den Winter über wird er in einer großen Grube gesammelt, im Frühjahr auf den Hängen der Werft ausgebreitet in einer Schicht, deren Dicke mit dem eingetauchten Zeigefinger abgemessen wird, nachdem die Düngermasse zuvor durch Treten mit den Füßen geknetet wurde. Ist diese Schicht etwas getrocknet, so wird sie mit dem Spaten in viereckige Stücke gestochen und, kunstvoll aufgebaut, weiter getrocknet.
Das Leben der Halligfriesen ist noch vielfach an feste Daten gebunden. Am 12. Mai (»Altmai«) wird das Vieh aus dem Stall auf die Weide gebracht; am 24. Juni beginnt die Heuernte; am 24. August muß sie unweigerlich beendet sein, denn an diesem Termin wird das Vieh, das vorher auf bestimmte Fennen beschränkt war, überallhin getrieben. – Eigentümliche Verhältnisse bieten die Schulen: auf einer Anzahl Halligen ist ein eigener Lehrer für ein bis zwei Kinder; auf Habel zahlte vor kurzem noch der Staat an die Eltern schulpflichtiger Kinder eine bestimmte Summe, damit diese im nächsten Schuldorfe in Pension gegeben werden konnten.
Es gibt einige Halligen, die nur ein Haus und eine Familie halten. Auf Norderoog, wo in Massen die Brandseeschwalbe nistet, haust den ganzen Sommer über als einziger Bewohner ein Vogelwärter in einer Hütte, dem alle acht Tage seine Lebensmittel gebracht werden – ein herrliches Robinsonleben!

Eisbootfahren im Wattenmeer.
Früher gehörte zum Begriff der Hallig, daß sie unbedeicht und ungeschützt war. Seit etwa 15 Jahren ist der Staat in großartiger Weise bemüht, durch Erbauen von Dämmen, Buhnen und Steindeckungen der Ufer nicht nur die Zerstörung des vorhandenen Landes zu hindern, sondern auch neues Land durch Anschlickung zu gewinnen. Oland-Langeneß, Hamburger Hallig, Pohnshallig-Nordstrand sind durch Steindämme, die im ganzen etwa 15 km Länge haben, mit dem Festland verbunden worden; diese Dammbauten allein haben etwa eine Million Mark gekostet. Das Wiedergewinnen des vom Meere verschlungenen Landes gelingt auf diese Weise sehr gut. Große Massen Schlick lagern sich ab und geben fettes, fruchtbarstes Marschland; 5-6 ha sind bei Oland, 7-8 ha am benachbarten Festland schon zur Weide gewonnen; für die nächste Zukunft darf ein beschleunigtes Anwachsen des Landes angenommen werden.
In einer Beschreibung der Halligen erwartet der Leser wohl sicherlich die Erwähnung grausiger Sturmfluten, bei denen das Wasser die Särge der Toten aus der Erde wühlt und sie den grausenden Bewohnern durchs Fenster ins Zimmer wirft, oder ähnliches. – In der Tat ist auch jetzt noch die Lage der Halligbewohner bei hohen Sturmfluten eine unheimliche, und fast jedes Jahr einmal steigt das Wasser fast bis zur Höhe der Werften hinan. Katastrophen, wie das Fortschwemmen ganzer Häuser, sind stets möglich. Die letzten Opfer dieser Art forderte die große Sturmflut des Jahres 1825. Doch ist deutlich erkennbar, daß die Arbeit, die ein kräftiges Staatswesen im Kampfe mit dem »blanken Hans« leistet, der jahrhundertelangen Zerstörungswut der See ein Ende bereiten und neues Land aus dem Schoße des Meeres heben kann.
Von Dr. H. Michow, Hamburg.
Hamburg mit seinen mehr als 872 000 Einwohnern (1908 Der Hamburger Staat umfaßte im gleichen Jahre 951 000 Bewohner.), nach Berlin die größte Stadt des Deutschen Reiches, ist nicht nur die bedeutendste Handelsstadt Deutschlands, sondern auch der erste Fluß- und Seehafen des ganzen europäischen Festlandes. Denn sein Gesamthandel steht in Europa nur dem von London nach. Sein Handel übertrifft den von ganz Holland, sowie bedeutend den von Spanien, das doch auf drei Seiten vom Meere bespült wird.
Der Seeschiffsverkehr im Hamburger Hafen bezifferte sich im Jahre 1908 trotz des ungünstigen Einflusses der letzten amerikanischen Krisis auf 16 330 ankommende Seeschiffe von ca. 12 Millionen Reg.-Tons Raumgehalt (1 Reg.-Ton = 2,38 cbm). Für die im gleichen Jahre von Hamburg ausfahrenden Schiffe gelten im großen und ganzen dieselben Zahlen (16 262 Seeschiffe von 11¾ Millionen Reg.-Tons Raumgehalt).
Im Warenverkehr betrug die Einfuhr seewärts 1907 über 3½ Milliarden Mark (gegen 2¼ Milliarden im Jahre 1900), die Ausfuhr seewärts über 2,8 Milliarden (gegen 1,8 Milliarden). – Beteiligt sind daran vom Auslande vornehmlich Großbritannien, dann ganz Amerika und die übrigen Erdteile, sowie Skandinavien, die Mittelmeerländer u. a. Doch auch mit dem Binnenlande hat Hamburg einen so bedeutenden Verkehr, teils zu Wasser, teils zu Lande, daß der Warenumsatz hier dem zur See in der Einfuhr nur wenig nachsteht, in der Ausfuhr ihm fast gleichkommt. Landwärts bezifferten sich sowohl Ein- wie Ausfuhr auf ca. 2? Milliarden Mark (gegen 1½ Milliarden 1900). – Auf der Elbe kamen im Jahre 1908 zu Tal wie auch zu Berg je ca. 26 000 Schiffe mit über 9 Millionen Tonnen Tragfähigkeit.
Auch die eigene, d. h. im Besitz Hamburger Reeder befindliche Handelsflotte ist sehr zahlreich; Ende 1907 zählte sie 327 Segler, 700 Dampfer, ca. 150 Leichter, im ganzen gegen 1200 Schiffe mit fast 30 000 Mann Besatzung und rund 1½ Millionen Reg.-Tons Raumgehalt. Dazu kommen ca. 120 Finkenwärder Fahrzeuge für Hochseefischerei und über 7000 Flußschiffe.
Die Hamburger Seglerflotte besitzt in den Fünfmastern »Potosi« und »Preußen« (ersterer mit über 6000 t, letzterer mit ca. 8000 t Tragfähigkeit) die größten Segelschiffe der Welt. Sie gehören der Reederei F. Laeisz, die 16 Segelschiffe von zusammen ca. 40 000 netto Registertons hat.
Regelmäßige Dampferverbindungen unterhält Hamburg nach allen europäischen Seestaaten, wie auch nach den fremden Erdteilen. Im Jahre 1908 wurden 124 regelmäßige Linien befahren, auf denen mit 1054 Dampfern 8087 Reisen gemacht wurden.
Die Hamburg-Amerikanische Paketfahrt-Aktien-Gesellschaft (abgekürzt HAPAG), die größte Schiffahrtsgesellschaft der Welt, hat 378 Schiffe mit 950 000 Reg.-Tons Raumgehalt, darunter die mit Doppelschrauben versehenen Schnelldampfer, mit denen sie den Passagierverkehr nach Nordamerika beherrscht, gewaltige Frachtdampfer, mehrere Vergnügungsdampfer, die nach Skandinavien und dem Mittelmeer fahren. Auch einen eigenen »Seebäderdienst« nach den Nordseebädern unterhält die Gesellschaft, mit dem Turbinendampfer »Kaiser« und mehreren eleganten Salon-Schnelldampfern.
Die Hamburg-Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft unterhält mit 43 Schiffen den Verkehr mit Brasilien und den La-Plata-Staaten; die Gesellschaft Kosmos fährt mit 37 Dampfern nach der Westküste Südamerikas. Eine andere Linie führt nach Australien und der Südsee; die Levante-Linie mit 27 Dampfern nach dem Orient.
Die Erwerbung von Kolonialgebieten seitens des Deutschen Reiches hat die Schiffahrt nach Afrika belebt. Dorthin fährt die »Deutsche Ost-Afrika-Linie« mit 22 Schiffen, und zwar rund um Afrika, während die »Woermann-Linie« mit 48 Schiffen den regelmäßigen Verkehr mit der Westküste unterhält.
Nach Hamburg, Bremen und Bremerhaven sollte jeder Süddeutsche und deutsche Binnenländer wenigstens einmal in seinem Leben wallfahrten, um der Tüchtigkeit und ausdauernden Kraft des niederdeutschen Volkes sich zu freuen, um die Macht und Herrlichkeit dieser alten Hansestädte, die ihre Freiheit und Selbständigkeit bis zur Gegenwart erhalten haben, zu bewundern, um das Leben und Weben in den Häfen in all seiner Größe und Mannigfaltigkeit anzuschauen und über die weit ausgreifende Tätigkeit dieser Hansestädte zu staunen. Hamburg und Bremen sind in noch höherem Maße zur See, was Frankfurt und Leipzig im Binnenlande sind und Augsburg und Nürnberg waren.
Ihre Lage ist aber auch höchst günstig. Beide liegen an Flüssen, die in die Nordsee münden, unfern der Mündung da, wo diese Flüsse sich weiten, dem Ozean sich zu öffnen beginnen, sodaß sie an dessen Gezeiten Anteil haben. Bremen, an der kleineren Weser gelegen, welche von Natur eine für Seeschiffe nicht ausreichende Tiefe hatte, besitzt bei Bremerhaven vortreffliche Hafenanlagen nahe dem Meere, auch ist in den letzten Jahren das Fahrwasser der Weser genügend vertieft worden, um größeren Seeschiffen den Zugang zu Bremen zu ermöglichen. Für die nötige Vertiefung des Fahrwassers in der Elbe hat Hamburg schon früher gesorgt, sodaß die Handelsschiffe aus dem Weltmeere jederzeit weit in den geschützten Unterlauf des Stromes einlaufen können. Hamburg liegt 135 km von der See entfernt, noch im Gebiet der Gezeiten, aber doch genau an der natürlichen Grenze von Fluß- und Seeschiffahrt, sodaß gerade hier und nur hier die Überladung der Waren aus Seeschiffen in die Flußkähne und umgekehrt vor sich gehen kann; denn über Altona hinaus können die Flußkähne wegen des Wellenganges schon nicht mehr sicher verkehren, und über Hamburg hinaus finden die Seeschiffe im Flußlaufe nicht mehr die nötige Tiefe. Die Flußschiffahrt wird auf der Elbe bis Österreich-Ungarn hinein, auf der Havel und Spree bis Berlin und darüber hinaus ausgeübt. Dazu münden in Hamburg am rechten Ufer zwei Flüßchen, die Alster und die Bille, in die Elbe und bilden dort sehr günstige Buchten, den Binnenhafen und den Oberhafen, welche seit dem Zollanschluß Hamburgs durch den das Freihafengebiet umgehenden Zollkanal in bequemere Verbindung miteinander gesetzt sind, aber nur durch die Flußschiffahrt von ober- und unterhalb Hamburgs belebt werden. Für die meisten in Hamburg verkehrenden Seeschiffe sind die Lösch- und Ladeplätze jetzt weiter ab von der Wohnstadt ins Freihafengebiet verlegt worden.
Zwar ist die ganze Nordseeküste von der Mündung des Rheins bis zum Ausfluß der Elbe von der Natur keineswegs begünstigt. Die lange Dünenkette, die einst das Meer aufgetürmt hatte, und welche einen Schutz für das tiefliegende Küstenland bildete, ward von den Sturmfluten desselben Meeres wieder durchbrochen; es bildeten sich Düneninseln, die zum Teil wieder fortgeschwemmt oder überflutet wurden, und an vorteilhafte Hafenanlagen war an dieser Flachküste nicht zu denken. Dennoch bildete sich der friesische Volksstamm, der das Küstenland des Deutschen Meeres inne hatte, unter diesem beständigen Kampfe mit Ebbe und Flut, mit Versandung und Überschwemmung, zu tüchtigen Schiffern und Lotsen aus, zu seegewohnten und kühnen Männern, mit denen eine deutsche Handels- und Kriegsflotte Ehre einlegen kann. Und an der Weser und Elbe konnten, was an der Küste Frieslands nicht möglich war, Hafenanlagen zustande gebracht werden, die mit den besten in Europa wetteifern.
So überaus leicht wurde es auch den Hamburgern nicht gemacht; es war auch ihnen vorbehalten, zu zeigen, daß zu der Gunst der Lage, zu dem, was die Natur bietet, die Tatkraft und Ausdauer, die Entschlossenheit und Rührigkeit der Menschen hinzukommen muß, wenn etwas Großes geschaffen und die Größe behauptet werden soll. Zuerst galt es, die verschiedenen Arme, in welche sich die Elbe teilt, bevor sie Hamburg erreicht, einzudeichen und manche Durchstiche zu machen, um die Norderelbe (den nördlichen Arm) der Stadt zu sichern. Ein planmäßiger Ausbau des Elbstromes und eine Korrektion seiner Uferlinien, wie sie zur Erlangung günstiger Gefällverhältnisse und verstärkter Wasserzufuhr erforderlich waren, konnten erst ins Werk gesetzt werden, nachdem infolge der Annexion Hannovers durch Preußen die Interessenstreitigkeiten Hamburgs mit jenem Staate aus der Welt geschafft waren. Besonders die Norderelbe hat durch die Regulierung gewonnen und oberhalb Hamburgs sowohl eine kräftigere Flutströmung wie auch überall eine Mindesttiefe von 2 m erhalten.
Eine definitive Regulierung der seewärts laufenden Wasserstraße, wodurch allen berechtigten Wünschen Rechnung getragen und die gedeihliche Weiterentwickelung der Hamburger Schiffahrt gewährleistet wird, ist durch den neuerdings zwischen Hamburg und Preußen geschlossenen »Köhlbrand-Vertrag« von 1908 in Aussicht gestellt worden. Durch diesen werden auch in freundnachbarlicher Weise nicht nur die Interessen Altonas berücksichtigt, sondern es ist auch der Nachbarstadt Harburg durch Vertiefung des Köhlbrands, der Hauptwasserstraße zwischen Harburg und Hamburg, auf eine seinen neuen Hafenanlagen entsprechende Tiefe von 10 m ein bequemer Zugang zum Meere garantiert worden.
Durch geschickt konstruierte Eisbrecher hat man auch die winterlichen Hindernisse wenigstens für die Seeschiffahrt beseitigt; sie dienen der Aufeisung in den Häfen und Kanälen, und kleinere Eisbrechdampfer halten das Eis fortwährend in Bewegung.
Zur Förderung des Hamburger Seehandels sind jetzt auch in Cuxhaven die übrigens im Zollausland befindlichen Hafenanlagen in gehöriger Weise erweitert und vertieft worden, um einesteils den nach der Elbe bestimmten Seeschiffen jederzeit Zuflucht und Schutz zu bieten, andernteils den tiefgehenden Schnelldampfern die direkte Verbindung mit dem Lande daselbst zu ermöglichen.
Eine neue und leichtere Verbindung, nach den Häfen des Ostseegebietes ist für Hamburg erwachsen seit der Eröffnung des Kaiser-Wilhelm-Kanales, der, von der Kieler Föhrde ausgehend, Holstein in südwestlicher Richtung kreuzt, um oberhalb Cuxhavens bei Brunsbüttel die Elbe zu erreichen. Die bedeutende Abkürzung des Weges und die größere Sicherheit der Fahrt ist nicht ohne Einfluß geblieben auf den Verkehr Hamburgs mit Dänemark, Schweden, Rußland und sämtlichen deutschen Ostseehäfen.
Der Anschluß ans Zollgebiet, der sich 1888 vollzog, erforderte eine besondere Rücksicht auf die Flußschiffahrt, um ihr die natürlichen Häfen und Ladestellen zu belassen. Diesem Zwecke dient der oben genannte Zollkanal, der jetzt Bille und Alster in sich aufnimmt. Von diesem ziehen sich zur Alster sogenannte Fleete, das sind teils Abschnitte des alten Alsterlaufes, teils künstliche Kanäle, welche, an die Wasserstraßen von Venedig erinnernd, den Transport der Waren auf großen Flachbooten, sogenannten Schuten, aus den Häfen bis mitten in die Wohnstadt ermöglichen.
Die aus dem holsteinischen Binnenlande kommende Alster bildet infolge doppelter Aufstauung, die bereits vor Jahrhunderten innerhalb der Stadt durch Deichanlagen bewerkstelligt wurde, eine seenartige Erweiterung von ca. 2 qkm Flächeninhalt, welche durch zwei vorspringende Landzungen und die diese verbindende Lombardsbrücke in zwei ungleiche Becken, die ca. ? qkm fassende Binnenalster und die ca. 7/4 qkm fassende Außenalster, geschieden wird. Die Wasserfahrt und der Schutenverkehr zwischen der oberen Alster und der Elbe wird demgemäß an jenen beiden Stadtdeichen durch Schleusenwerke ermöglicht.
Auf jenem echt holländischen Terrain, auf einem von Flußarmen und Kanälen durchschnittenen, nur noch wenige Fuß über dem Meere liegenden Niederlande, teils Sumpfboden, teils Sandfläche, die einem früheren Elbbette angehörte, hat sich eine der reichsten und mächtigsten, schönsten und prächtigsten Städte erhoben. Kaum bietet eine andere Stadt in Deutschland dem Auge, das landschaftliche Stimmung zu fassen versteht, so viel reine Freude, wie Hamburg mit seiner Umgebung; die Eindrücke sind der mannigfaltigsten Art.
Da ist vor allem jenes prächtige Wasserbecken der Binnenalster, auf einer Seite umgeben von den Palästen des Alten, auf der anderen Seite von denen des Neuen Jungfernstieges, auf der dritten von denen des Alsterdammes, und eingefaßt von Spaziergängen, die durch eine doppelte Reihe schöner Lindenbäume beschattet werden. Bezaubernd, ja feenhaft ist der Anblick dieses Stadtteiles, wenn des Abends die Hunderte von Gasflammen und die sie weit überstrahlenden elektrischen Lampen sich in der dunkeln Wasserfläche spiegeln.
Im bewußten Gegensatz zu dieser städtischen Umgebung der Binnenalster werden die Ufer der Außenalster mehr ländlich gehalten. Mit ihren Rasenplätzen und Buschpartien leiten sie wirkungsvoll über zu den schattigen Gärten und stolzen Landsitzen Hamburger Kaufherren, von denen das ganze Alsterbecken umrahmt ist. Letzteres bietet ein besonders anziehendes Bild, wenn es an schönen Sommertagen von Schwänen, Ruder- und Segelbooten belebt ist, während eine förmliche Dampferflotte den Verkehr mit der Stadt und zwischen beiden Ufern aufrecht erhält. Schwäne werden etwa 400 auf der Alster gehalten, zu deren Fütterung im Sommer monatlich, im Winter wöchentlich, etwa 1000 kg Hafer und Gerste benötigt werden.
Auch abseits der Alster haben sich innerhalb des Wohngebietes größere offene Grasplätze mit schattigen Baumgängen erhalten; und auf ihnen ist stets zur Anlegung von Kinderspielplätzen Gelegenheit genommen worden. Im Nordosten der Stadt ist aber die Herstellung eines umfangreichen Stadtparkes beschlossen worden, der allen Bevölkerungsschichten eine Stätte der Erholung und Freude sein und auch für Volksspiele geeignete Plätze und Wiesenflächen bieten soll.
Die früheren Festungswälle und Gräben, die die innere Stadt auf der Landseite umgaben, sind teils abgetragen, teils in städtische Anlagen verwandelt, in denen einzelne Punkte geradezu überraschende malerische Ansichten bieten. Vor allem läßt sich dies sagen von dem Botanischen Garten, in den ein Teil jener Anlagen hineinbezogen ist und der wie eine Ideallandschaft im kleinen dem Beschauer Vegetationsbilder vorzaubert, wie sie schöner und stimmungsvoller kaum gedacht werden können.
Und nun erst der Hafen! Freilich mußte Hamburg im Herbst 1888 Abschied nehmen von dem unvergeßlichen Hafenbilde, das, vom Stintfange gesehen, wo sich jetzt die Deutsche Seewarte erhebt, jeden mit Entzücken erfüllte. Weithin am Ufer entlang erstreckte sich der majestätische Wald von Masten und Raen; bunte Flaggen und Wimpel flatterten im Winde. Dies alles mußte elbaufwärts in weitere Ferne rücken, denn Zollpalisaden scheiden jetzt den früheren Hafen in Zollinland und -ausland. Doch landschaftlich hat das Bild nicht verloren, es ist nur erweitert und vervielfacht worden; die Elbe erscheint mächtiger und die Perspektive zu den neuen Häfen großartiger; ja das Bild hat auch an Leben gewonnen, denn alles zieht jetzt elbaufwärts zu den neuen Kaianlagen oder kommt daher; viel majestätischer lagern sich jetzt in dem geräumigen Segelschiffhafen die Kolosse, und vornan erhebt sich wie eine endlose Burg, von Zinnen gekrönt, die stolze Reihe der Freihäfenspeicher. In seinem malerischen Reichtum und vollem Glanze zeigte sich das Hafengebiet bei der Kaiserfahrt, als am 29. Oktober 1888 für die Freihafenbauten vom Deutschen Kaiser der Schlußstein gelegt wurde.
Außerhalb der Wallanlagen, nach Altona zu, erhebt sich auf erhöhtem Terrain der Stadtteil St. Pauli, eine frühere Vorstadt; im Volksmunde wohl heute noch »der Hamburger Berg« genannt, in Erinnerung an frühere Zeiten, wo hier noch keine Wohn- und Geschäftshäuser, sondern nur Vergnügungslokale standen und ländliche Lustbarkeiten die Gegend belebten. St. Pauli wäre allein schon groß genug, um die Haupt- und Residenzstadt eines deutschen Fürstentums vorzustellen, denn es zählte 1908 gegen 75 000 Einwohner. Es ist, im Gegensatz zu dem eleganten und vornehmen Viertel der beiden Jungfernstiege, das plebejische Viertel, wo noch heute das »gemeine Volk« sich erlustigt und die Matrosen ihr Geld möglichst schnell verprassen, auch wohl aus anderen Ständen mancher lockere Vogel einfliegt; Volkstheater und Schaubuden aller Art üben noch heute auf Fremde wie Einheimische ihre Anziehungskraft aus. Einige in dem letzten Jahrzehnt hier erstandene Konzerthäuser sind übrigens in so großartigem Maßstabe angelegt, daß auch die vornehme Welt nicht nur zur Zeit des Weihnachtsmarktes, hier »Dom« genannt, den dort gebotenen vortrefflichen Schaustellungen gern folgt, sondern auch schon als ständigen Gast sich eingeführt hat.
Nur ein 2 m breiter Graben trennt St. Pauli von der Stadt Altona. Die Häuserreihen und Häusermassen nehmen kein Ende, nach welcher Richtung man sich auch wendet. Bis Blankenese sind's von Altona noch zwei Stunden. Dort haben sich die Norder- und Süderelbe wieder zu dem einen breiten und herrlichen Strom vereinigt, dessen Breite schon gegen 3 km beträgt: vom hohen Uferrande schaut man wie von einem Vorgebirge zur Linken nach Altona und Hamburg hinüber, auf die von Gärten, Villen und Palästen eingefaßten Ufer, zur Rechten auf den golfartig erweiterten Strom mit seinen zahllosen Dampfern und Seglern, geradeaus über den Strom hin auf die saftigen Wiesen, auf die korn- und obstreiche Niederung der hannöverschen Marsch – es ist ein Bild landschaftlicher Größe und Pracht und von einem so bewegten Leben, wie es der Süden unseres deutschen Vaterlandes trotz seiner Seen und Alpenherrlichkeit nicht zu bieten vermag.
Auch auf der Nord- und Ostseite dehnt und reckt sich die Stadt und wachsen Straßen empor, wo vor ein paar Jahrzehnten nur erst vereinzelte Landhäuser standen. Stattliche Häuserketten erstrecken sich von der Binnenalster, als dem Mittelpunkte aus gerechnet, schon wohl eine Stunde weit mehrfach bis an die Landesgrenze, so in den Stadtteilen Eimsbüttel und Eppendorf im Nordwesten, Hamm und Horn im Osten. Diese wie alle früheren Vororte sind seit 1894 in die Stadt hineinbezogen worden, sodaß das jetzige Stadtgebiet, mit einer Fläche von rund 77 qkm, im ganzen 20 Stadtteile umfaßt, von denen drei, nämlich Steinwärder, Kleiner Grasbrook und die Veddel, südlich der Norderelbe liegen.
Nach der Elbe zu breitet sich auf niedrigem Sumpflande die Altstadt aus. Die Bauart der Häuser daselbst hat wenig Anziehendes, verrät aber sehr deutlich ihren Ursprung, den auch Straßenbenennungen wie »Holländischer Brook« andeuten. Die Bauart ist holländischer Herkunft, wie es denn überhaupt sehr begreiflich ist, daß just hier zwischen Wasser und halbem Sumpf Holländer auf den Einfall kommen konnten, zu bauen und Handel und Wandel zu treiben.
Ein Fremder, dem Hamburg vielleicht als eine schöne, ja prächtige Stadt geschildert worden ist, findet sich in diesem Stadtteile sehr getäuscht. Hier ist nichts schön, hier ist nichts, was Glanz und Luxus vermuten läßt. Die Häuser, größtenteils auf einem Unterbau von Holz stehend, hocken krumm und schief nebeneinander. Wie an der Vorderseite der gepflasterte Weg fortläuft, so schlängelt sich an der Hinterseite ein bald breiterer, bald schmälerer Kanal, in Hamburg Fleet genannt, durch das Häuserlabyrinth; über diese Fleete neigen die Häuser ihre Giebel in oft bedenklicher Weise. Da jedoch eines das andere stützt und trägt, so hält das schreckhaft anzusehende Gerumpel doch aus und trotzt allen Stürmen der Elemente.
Beim Anschwellen der Flut, der Segenspenderin Hamburgs, füllen sich die Kanäle rasch mit lebendigem Wasser, auf dessen Wellen zahllose kleine Schiffe, Kähne, Ewer und Schuten heranschwimmen, befrachtet mit allen möglichen Schätzen der Erde. Hoch oben aber an den schwarzen überhängenden Giebelenden der Hinterhäuser öffnen sich verschlossene Luken, ein Tau, eine Kette schnurrt oder klirrt herab zum Kanal, und geschäftige Hände sind bemüht, die Erzeugnisse ferner Erdstriche emporzuheben auf die Lagerböden der geräumigen Speicher. So war es bis vor kurzem ausschließlich hier. Jetzt hat sich dieses ameisenartige Treiben des Entlöschens und Ladens teilweise ins Freihafengebiet gezogen, wo stattliche moderne Speicherbauten die zollfreie Lagerung der Waren gestatten, während jene in der Wohnstadt belegene Speicher nur noch fürs Zollinland bestimmte Waren aufnehmen. Auch sind die neuerdings angelegten Kanäle, besonders der das Freihafen-Speichergebiet in ganzer Länge durchschneidende Kanal, so tief angelegt, daß sie jederzeit für Schuten und Schleppdampfer passierbar sind.
Es läßt sich leicht denken, daß der Kaufmann Wohnungen, die für sein Geschäft so vorteilhaft gelegen sind, ungeachtet ihres wenig anziehenden Äußern, sehr hoch schätzt. Der Straße zugewendet ist sein Kontor, oft genug ein unscheinbares, dunkles Zimmer; im Hinterhause, unmittelbar an dem Fleet, befindet sich der Speicher, auf dessen Böden seine Vorräte lagern. Darum wimmelt es auch in diesem Straßenknäuel von geschäftigen Menschen, wie in einem Bienenkorbe. Ja selbst in die Erde hinein hat sich das Leben gewühlt, um halb unter der Straße, in gleichem Niveau mit dem von der Flutwelle gefüllten Fleete, zu handeln und vom Gewinn dieses Handels zu leben und selbst Reichtümer zu sammeln. Man muß sich wundern, daß viele Tausende ihr ganzes Leben in diesen Kellerwohnungen verbringen, die keine andere Annehmlichkeit besitzen, als daß sie ihre Inwohner gut ernähren. Es fehlt in den meisten dieser Keller alles, was die moderne Welt unter dem Namen Komfort versteht. Der Raum ist unglaublich beschränkt, finster, modrig, feucht, und die Vergünstigung, in solchen Räumen wohnen zu dürfen, obendrein kostspielig. Bei heftigen Weststürmen aber rollen die ungeheuren Flutwellen der Nordsee gegen die flachen Küstenlande der Niederelbe; dann stauen sich die Wassermassen des Stromes zurück, bäumen sich hoch auf und dringen durch die Fleete in diese Kellerwohnungen, sie oft meterhoch mit trübem, schmutziggelbem Wasser füllend. Und dennoch verläßt der Inhaber des Kellers sein Haus nicht, es müßte denn infolge einer Springflut seinem Leben Gefahr bei längerem Verweilen drohen. Fälle dieser Art werden durch das Lösen der Lärmkanonen angezeigt.
Die Häuser in diesem Stadtteile sind mit sehr wenigen Ausnahmen schlecht gebaut; ein hölzernes Gerippe, mit Ziegelsteinen ausgesetzt, ist so ziemlich die ganze verschwendete Architektur. Gewöhnlich fehlt es an sogenannten Brandmauern, welche die Nachbarhäuser voneinander trennen. Hier lehnt sich Haus an Haus ohne solche Schutzmauer, woraus großenteils die Verheerungen der Feuersbrunst von 1842 sich erklären. Brände in diesem eng und leicht gebauten Häusergewirr müssen, finden sie gleich beim Entstehen viel Nahrungsstoff, und treibt ein ungünstiger Wind die Flamme über die Satteldächer der Nachbarhäuser, immer gefährlich werden.
Nicht viel besser gebaut ist die westlicher gelegene Neustadt. Auch dieser Teil Hamburgs trägt den Stempel altholländischer Bauart; nur hat er seiner höheren Lage wegen von den Flutbewegungen des Meeres und dem Hochwasser der Elbe nichts zu leiden. Der Verkehr ist ebenso stark, und auf einzelnen Straßen, wie auf den Steinwegen und der Wexstraße, übertrifft er sogar noch den in der Altstadt. An Werkeltagen wogt auf diesen Straßen, welche den Verkehr mit Altona vermitteln, ein solcher Strom von Menschen, Pferden und Wagen, daß dieses ununterbrochene Gewühl hin und wider Drängender nur in wenigen Städten des Erdenrundes seinesgleichen finden dürfte.
Den beiden letztgenannten Stadtteilen zugehörig und deren nördlichen Teil bildend ist aber auch der Neubau, den die auflodernde Flamme des 5. Mai 1842 geschaffen hat. Der große Brand, welcher 1749 Wohnhäuser, 1508 Sähle, 488 Buden In den älteren Etagenwohnungen der ärmeren Klassen heißt das Unterhäuschen »Bude« und ist von den übrigen Wohnungen des Hauses abgetrennt. Zu den über der Bude gelegenen und von ihr gänzlich getrennten Wohnungen der oberen Stockwerke führt eine direkt von der Straße eingehende und selten durch eine Haustür von dieser abgeschlossene, äußerst steile und schmale Holztreppe hinauf. Diese Etagenwohnungen haben den Namen »Sahl«, zum Unterschiede von Saal meist mit h geschrieben. Die Treppe heißt also Sahltreppe. Solche Sahlwohnungen finden sich noch massenhaft auf den schmalen Gängen und Höfen hinter der Niedern- und Steinstraße in der Altstadt. Zu diesen Höfen führen kaum 1 m breite, oft zur Hälfte unterirdische Durchgänge unter den großen Wohnhäusern der Straßenfronten hindurch., 474 Kellerwohnungen verzehrte, hat von der alten Stadt die krummen, engen Straßen und Schlupfwinkel zum großen Teil hinweggenommen und auch die ungesunden Kellerwohnungen getilgt oder doch zur Verbesserung genötigt, und so ist jener Neubau entstanden mit großer Eleganz und Regelmäßigkeit, Schönheit und Bequemlichkeit. Freilich auch in den vom Brande verschonten Teilen der Alt- wie der Neustadt ist in den letzten Jahren aus hygienischen Rücksichten mit jenen engen Wohnungen im sogenannten »Gängeviertel« gründlich aufgeräumt worden, und in absehbarer Zeit werden sie wohl gänzlich verschwinden. So ist in dem untern Teile der Neustadt ein ganzer Stadtteil niedergelegt worden, und breite Straßen mit luftigen Wohnungen sind daselbst erstanden. Ebenso sind in der Altstadt zwischen Rathausmarkt und Schweinemarkt große Häusermassen, die ebenfalls ein Gängeviertel bildeten, niedergelegt worden, um in der neu anzulegenden »Mönckeberg-Straße« eine direkte Verbindung zwischen Rathausmarkt und Hauptbahnhof zu gewinnen.
Zugleich mit der Sanierung dieser ärmeren Stadtteile sind aber auch für die Großkaufmannschaft überall in der Stadt großartige Geschäftshäuser entstanden, die im Gegensatz zu früherer Anspruchslosigkeit mit allen Bequemlichkeiten der Neuzeit versehen sind und auch schon durch ihr stilvolles Äußere erfreuen. Wir nennen als ältestes den »Dovenhof« mit 130 Kontoren, das ganz neue »Kaufmannshaus« mit 200 Kontoren, das zu Ehren eines Hamburger Architekten benannte »Semperhaus« und das Verwaltungsgebäude der Hamburg-Amerika-Linie.
Die ehrwürdigen alten Kirchen St. Petri und St. Nikolai, letztere am Hopfenmarkt, die mit abbrannten, sind durch Neubauten im gotischen Stil ersetzt worden. Sie machen der Stadt alle Ehre und zeigen, daß der Hamburger nicht bloß für Gelderwerb Sinn hat, sondern seinen Reichtum auch würdig anzuwenden weiß. Namentlich die aus hartem Sandstein, der eine ins feinste ausgearbeitete Ornamentik erlaubt, aufgeführte Nikolaikirche ist mit ihrem schönen 144,2 m hohen Turme unter allen kirchlichen Bauten im Norden Deutschlands wohl der schönste und einer der großartigsten und prächtigsten Europas. Ihr Inneres ist mit schwarzem und weißem Marmor belegt, Chor, Altar und Kanzel sind mit Säulen von farbigem Marmor geschmückt, über dem Altar ist ein Christus am Kreuz und unter ihm ein Reliefbild, Christus am Ölberge betend, aus weißem Marmor ausgeführt. Die größte Kirche von Hamburg war die Große Michaeliskirche, auf dem höchsten Punkte der Stadt gelegen und deshalb mit ihrem 131 m hohen Turme für die Ankommenden weithin sichtbar; dieses alte Wahrzeichen Hamburgs, vom Volke der »Große Michel« genannt, ward ganz kürzlich (wie auch schön früher, im 18. Jahrhundert) ein Raub der Flammen, wird aber genau in alter Gestalt wieder aufgebaut, nur wird die frühere Holzkonstruktion des Turmes durch eine eiserne ersetzt.
Die einzigen aus dem Mittelalter erhaltenen und auch im großen Brande von 1842 verschont gebliebenen Bauwerke Hamburgs sind die Katharinen- und die Jakobikirche. Der Turm der letzteren war im 18. Jahrhundert das erste mit einem Blitzableiter versehene Gebäude Deutschlands.
Weitere etwa 30 verschiedene kleinere Gotteshäuser sind in der Stadt verteilt, darunter 5 katholische Kirchen, 3 jüdische Synagogen, 2 englische, 1 französische und 1 dänische Kirche. –
Von den Denkmälern, die Hamburgs Straßen und Plätze zieren, sei zuerst des 1890 errichteten, des Kaiser-Karl-Brunnens, gedacht. Er ist ein herrliches Monumentalwerk im Stile strenger Gotik, welches das kupferne Standbild Karls des Großen, des Gründers von Hamburg, trägt und darunter die in Mosaik ausgeführten Bildnisse von vier um Hamburg verdienten Männern der Vorzeit zeigt. Er steht auf dem Fischmarkte, in dessen Umgebung die ersten Ansiedelungen stattgefunden haben. Es legt dieser Brunnen zugleich ein schönes Zeugnis ab für den selbständigen Geist, mit dem das freie Hamburger Bürgertum idealen Zwecken zu dienen weiß; denn er ist erdacht und vollendet von Hamburger Künstlern und geschaffen aus den Mitteln eines Vereines Hamburger Bürger, der sich die Verschönerung seiner Vaterstadt zur Aufgabe gestellt hat.
Für die Kinderwelt bedeutsam ist ein einfacher Denkstein, zur Erinnerung an J. H. Campe am Ufer der Bille in Billwärder errichtet, wo dieser in den Jahren 1778-1783 lebte und seinen »Robinson« schrieb.
Vor dem Maria-Magdalenen-Kloster, jetzt protestantischen Damenstift, steht in der Richardstraße ein ebenfalls schlichtes Denkmal – Erzplatte mit Inschrift –, dem Grafen Adolf IV. von Schauenburg geweiht, der im Jahre 1227 bei Bornhövede die Hamburger gegen Waldemar von Dänemark zum Siege führte und einem Gelöbnis gemäß jenes Kloster, freilich an anderer Stelle, wo jetzt die Börse steht, stiftete.
Seinem Vorgänger, Adolf III., der die dem Weltverkehr bestimmte damalige Neustadt, das Nikolai-Kirchspiel, gründete und von Barbarossa einen Freibrief erwirkte, der Hamburg erst zu einer Seehandelsstadt machte, ist auf der Trostbrücke, die jene Neustadt mit der ehemaligen bischöflichen Altstadt verbindet, ein Standbild gesetzt worden; ihm gegenüber steht das Standbild des ersten Hamburger Erzbischofs, Ansgar.
Während an den Dichter des Messias, Klopstock, der die letzten Jahrzehnte seines Lebens in Hamburg wohnte, außer seinem in dem benachbarten Ottensen (Stadtteil Altonas) befindlichen Grabe eine Büste an dem von ihm bewohnten Hause (jetzt Neubau) in der Königsstraße erinnert, hat Lessing nahe der Stätte, wo er in den Jahren 1767-69 als Theaterkritiker wirkte, auf dem Gänsemarkt, ein Standbild in Erzguß erhalten, das Schaper modelliert hat. Der Granitsockel des Denkmales trägt den Dichter in sitzender Stellung und zeigt unten die Reliefbildnisse zweier Hamburger Zeitgenossen, des Schauspielers Eckhoff und des Philosophen Reimarus. Wie dieses ist auch das Schiller-Denkmal, in den Anlagen vor der Kunsthalle, aus Anregung und freien Beiträgen der Bürger hervorgegangen.
Vor dem Millerntor, bei der ehemaligen Sternwarte, steht das Repsold-Denkmal, dem Techniker Repsold († 1830) gewidmet, der nicht bloß die Seewarte gegründet, sondern sich auch um das Hamburger Feuerlöschwesen verdient gemacht hat.
Dem Hamburger Dichter Hagedorn (1708-54) ist in dem uralten Eichenpark an der Krugkoppel in Harvestehude, am Fuße des Lizentiatenberges, auf dem die Hagedornlinde steht, ein Reliefdenkmal errichtet worden.
In der Altmannstraße, nahe der Gewerbeschule, erinnert ein schlichter Obelisk an einen Hamburger Fabrikherrn, H. C. Meyer, Stockmeyer genannt († 1848), der sich um das Wohl des Arbeiterstandes große Verdienste erworben hat; und ebenda, in den Anlagen, ein anderes – Bronzebüste auf Granitsockel – an den in öffentlicher wie in wissenschaftlicher Wirksamkeit gleich ausgezeichneten Bürgermeister Kirchenpauer († 1887).
Von Hamburgs Seetüchtigkeit in früheren Jahrhunderten reden die vier Standbilder, mit denen die Kersten Miles-Brücke geschmückt ist, die den ehemaligen Wallgraben, die jetzige Helgoländer Allee, bei der Seewarte in einem 37 m weiten Bogen überspannt. Es sind die Standbilder des Kersten Miles († 1420), der im Kampf mit den seeräuberischen damaligen Besitzern Ritzebüttels dieses Amt mit dem heutigen Cuxhaven für Hamburg erwarb; ferner des Simon von Utrecht († 1437), des Ditmar Koel († 1563) und des Jakob Karpfanger († 1683), welche sämtlich im Kampfe mit den Seeräubern und Korsaren sich rühmlichst hervortaten und die gefürchtetsten Seeräuber sogar zur Stelle brachten.
An spätere kriegerische Zeiten, und zwar an die Belagerung Hamburgs durch die Franzosen im Jahre 1813, erinnert das Kugel-Denkmal auf dem Gertrudenkirchhof, durch die Zusammenstellung vieler vom Feinde in die Stadt geworfenen Kugeln aufgebaut; ebenso auf dem Terrain der alten Friedhöfe in der Jungiusstraße ein Sarkophag für 1138 Hamburger, die mit vielen Tausenden ihrer Mitbürger von Marschall Davoust im kalten Winter 1813 zu 14 aus Hamburg vertrieben und ansteckenden Krankheiten erliegend, ein Opfer der Franzosenzeit wurden.
Der Wiedererstehung des Deutschen Reiches sowie den Helden, die es geschaffen, und den Männern, die daran mitgearbeitet haben, sind die folgenden Denkmäler gewidmet: das Krieger-Denkmal auf der Esplanade für die im Kriege 1870/71 gefallenen Hamburger; modelliert von Schilling-Dresden und in Bronzeguß ausgeführt. Die Hauptfigur ist ein Engel, der, über das Schlachtfeld gleitend, die sterbenden Krieger mit der Siegespalme berührt und in die Ewigkeit aufnimmt. Steinerne Bänke umrahmen das Ganze und laden zu andächtiger Betrachtung ein.
Vor dem Rathause ist im Jahre 1903 ein kolossales, ebenfalls von Schilling geschaffenes Reiterstandbild Kaiser Wilhelms I. enthüllt worden. Als Reliefs schmücken den Granitsockel die »Einigung von Nord und Süd« auf der einen Seite, und der »Seehandel unter deutscher Flagge« auf der andern. Weite Balustraden mit Ruhebänken umgeben den Denkmalsplatz. Über den Bänken sieht man zwei große Reliefs, die »Kaiserproklamation in Versailles« und den »Einzug des Hamburger Infanterie-Regiments Nr. 76«. Zwischen den Bänken sitzen vier allegorische Figuren, die die Friedenstätigkeit des großen Kaisers versinnbildlichen sollen: das einheitliche Reichsgesetz, das einheitliche Maß, Geld und Gewicht, die Arbeiterfürsorge-Gesetzgebung und die Ausgestaltung des Weltverkehrs. Mächtige Flaggenmaste, ebenfalls mit symbolischen Figuren an den Sockeln, schließen die Balustraden nach vorn ab.
Während das Standbild des um Hamburgs Einlebung in die neuen Reichsverhältnisse hochverdienten Bürgermeisters Dr. Petersen (1890-92) in bescheidenster Weise auf niedrigem Sockel sich nur wenig über das Straßenniveau erhebt, erscheint um so gewaltiger auf der Elbhöhe am Hafen das Denkmal Bismarcks, nach den Entwürfen des Bildhauers Lederer und des Architekten Schaudt, ganz in Schwarzwald-Granit geformt. Als reckenhafter Rolandriese, in übernatürlicher sagenhafter Größe, wie er als Nationalheld bei den Deutschen fortlebt, auf wirkungsvoll abgestuftem wuchtigen Unterbau ist der Reichsbegründer dargestellt, weithin sichtbar und selbst das Antlitz in die Ferne gerichtet, dem Meere zugewandt.
An Bildungsanstalten für Wissenschaften und Künste fehlt es der großen Hansestadt nicht. Ihr Johanneum ist eine seit der Reformation hervorragende Lateinschule gewesen, die sich jetzt in eine » Gelehrtenschule« (Gymnasium) und ein Realgymnasium gliedert. Dem Gründer desselben, dem Reformator Bugenhagen, ist an dessen 400jährigem Geburtsfeste 1885 von ehemaligen Schülern der Anstalt auf dem Schulhofe ein Standbild errichtet worden. Außerdem hat Hamburg das Wilhelms-Gymnasium, 2 Realgymnasien, 4 Oberrealschulen, 9 Realschulen, 4 Lehrer- und Lehrerinnen-Seminare. Von anderen wissenschaftlichen Anstalten seien genannt die Sternwarte (jetzt in Bergedorf), ein Chemisches und ein Physikalisches Staatslaboratorium, ein sehr reichhaltiges Museum für Kunst und Gewerbe, eine Kunsthalle, deren Gemäldesammlung hauptsächlich Werke deutscher, niederländischer und englischer Meister enthält, ein Naturhistorisch-Zoologisches Museum, dem ein 1891 fertig gewordener Kolossalbau vor dem Steintore gewidmet ist, ein Botanisches Museum, verbunden mit einem Laboratorium für Warenkunde, die vom Deutschen Reiche unterhaltene Seewarte, ein Museum für Völkerkunde, ein Mineralogisch-Geologisches Institut, das Museum Hamburgischer Altertümer, das die Aufgabe hat, die kulturgeschichtliche Entwicklung Hamburgs darzustellen und zugleich Überreste althamburgischer Architektur und Plastik, sowie häusliche Einrichtungen älterer Zeit für die Nachwelt zu erhalten, ein Botanischer und ein Zoologischer Garten, welch letzterer durch die Opferwilligkeit Hamburger Bürger stets mit interessanten fremden Tieren versorgt wird.
Ihm ist in letzter Zeit ein gefährlicher Konkurrent erwachsen, auf preußischem Boden freilich, aber hart an der Hamburger Grenze bei Stellingen und in einer halben Stunde von Hamburg aus auf der Straßenbahn zu erreichen; er gilt heute als eine Hauptsehenswürdigkeit Hamburgs. Das ist Hagenbecks Tierpark, hervorgegangen aus einer Handelsmenagerie und deshalb stets mit reichem Tierbestand versehen. Aus einem ebenen Kartoffelfelde hat der Besitzer einen herrlichen Park von mehreren Hektar Umfang mit künstlichen Felsen bis zu einer Höhe von 27 m emporwachsen lassen, in welchem sein sogenanntes »Tierparadies« untergebracht ist. Dies besteht aus vier hintereinander staffelartig aufsteigenden Abteilungen. Zu unterst liegt ein mit unzähligen Wasservögeln und Uferläufern bevölkerter Teich, dann folgt ein für allerlei Grasfresser, wie Antilopen, Büffel, Zebras, Kamele usw. bestimmtes Gehege, drittens eine Felsenhöhle als Tummelplatz mehrerer Dutzend größter Raubtiere wie Löwen und Tiger, nur durch einen tiefen, aber unsichtbaren Graben vom Publikum getrennt; und darüber als letzte Staffel eine für Alpentiere wie Adler, Geier, Gemsen, Steinböcke bestimmte Felsengruppe. Zur Seite befindet sich ein ähnliches Panorama für nordische Tiere, mit künstlichen Eisbergen und Tümpeln, in denen sich Eisbären, Walrosse und Robben tummeln und Pinguine ein beschauliches Leben führen. Alle Tiere bewegen sich hier in ihren natürlichen Lebensgewohnheiten und haben Gelegenheit, nicht nach vorgeschriebenen Stunden, sondern nach eigenem Bedürfnis gegen Wind und Witterung in geeigneten Unterschlüpfen Schutz zu suchen. Außer diesen Tierparadiesen befinden sich im Parke stattliche Gebäude und Gehege zur Aufnahme des stets überreichen Tierbestandes, wie auch eine große Dressurhalle, wo täglich Vorstellungen mit abgerichteten wilden Tieren gegeben werden. Auf einem besonderen Terrain ist eine Straußenfarm mit über 100 lebenden Tieren eingerichtet, wie überhaupt die Zähmung und Aufzucht tropischer Tiere betrieben wird. Ein besonderer Abteil des weiten Terrains wird zur Schaustellung fremder, in ihren nationalen Ansiedelungen lebender Völkergruppen benutzt. – Neuerdings wird die Aufstellung prähistorischer Tiere in lebensgroßen Nachbildungen betrieben, von denen die erste der vier projektierten Abteilungen bereits 1910 fertig sein wird.
Durch Vermächtnis eines der angesehensten Schiffsreeder, des 1901 verstorbenen C. H. Laeisz und seiner noch lebenden Gemahlin, ist die von den Musikkreisen Hamburgs sehnlichst herbeigewünschte Musikhalle – Laeiszhalle – gestiftet und darin das geniale Werk Klingers, ein Standbild des Hamburger Tondichters Brahms, aufgestellt worden.
In ähnlich großzügiger Weise ist durch freiwillige Spenden mehrerer Millionen Mark im Jahre 1907 die » Hamburgische Wissenschaftliche Stiftung« begründet worden. Sie bezweckt die Berufung von hervorragenden Gelehrten, um im Verein mit den wissenschaftlichen Anstalten und dem seit Jahren blühenden staatlichen Vorlesungswesen den erwachsenen Hamburgern eine den örtlichen Bedürfnissen angepaßte höhere Bildungsstätte zu bieten, zugleich auch weitergehende wissenschaftliche Unternehmungen und Forschungen zu unterstützen und zu fördern.
Im Anschluß an diese wissenschaftlichen Bestrebungen sei auch des im Jahre 1908 eröffneten Kolonial-Institutes gedacht, das vom Hamburger Staat und mit dessen Mitteln im Einvernehmen mit dem Reichskolonialamt gegründet ist. Es hat den Zweck, den Kolonialbeamten und solchen Kaufleuten, Industriellen und Pflanzern, die in den deutschen Kolonien sich betätigen wollen, eine theoretische Vorbereitung zu bieten, und zugleich als Zentrale für wissenschaftliche und wirtschaftliche Kolonialinteressen zu dienen, wozu Hamburg wegen seiner weitverzweigten überseeischen Beziehungen und praktischen Erfahrungen besonders geeignet erscheinen muß. Letzteres findet seinen Ausdruck in dem jenem Institute beigegebenen kaufmännischen Beirate.
Ähnlich belehrenden und wissenschaftlichen Zwecken, nur in allgemeinerer Art, dienen verschiedene wissenschaftliche Vereine, wie die Geographische Gesellschaft, der Naturwissenschaftliche Verein und andere. – Neben der in mehreren Wissenschaften sehr reichhaltigen Stadtbibliothek ist die Kommerz-Bibliothek zu erwähnen, die eine äußerst reichhaltige Sammlung von weit über 100 000 Bänden aus all den Wissenschaften bildet, die in irgendeiner Beziehung zum Handel stehen, die Bibliothek des Vereins für Hamburgische Geschichte, also reich an Hamburgensien, die Bibliothek der Patriotischen Gesellschaft, wichtig wegen ihres Reichtums an technischer Literatur; die Bibliothek der Deutschen Seewarte u. a.
Als ein Hauptzug des hamburgischen Charakters ist mit Recht oft der Wohltätigkeitssinn hervorgehoben worden. Dieser offenbart sich u. a. durch eine sehr große Zahl milder Stiftungen, deren älteste seit dem 12. und 13. Jahrhundert segensreich wirken. Teils sind es staatliche Wohltätigkeits-Anstalten, wie das Waisenhaus und mehrere Armenhäuser, teils Privatstiftungen, von denen das mit mehreren Millionen Mark begründete, zur Versorgung bedürftiger Personen bestimmte Schröderstift und das von Wichern begründete, der inneren Mission dienende Rauhe Haus genannt sein mögen.
Auch den gesundheitlichen Bedürfnissen der volkreichen Stadt wird seitens der Regierung in vollem Maße Rechnung getragen. Außer dem älteren, in St. Georg gelegenen und jetzt vollständig nach modernen Grundsätzen neugestalteten Allgemeinen Krankenhause hat Hamburg, abgesehen von Privat-Krankenhäusern, in Eppendorf noch ein zweites Staats-Krankenhaus, das, aus 72 isolierten massiven Gebäuden bestehend, als Musteranstalt anerkannt wird; ferner ein drittes, das sogenannte Seemanns-Krankenhaus, das besonders erkrankten Seeleuten und an Tropenkrankheiten leidenden Personen gewidmet ist. Mit dieser Anstalt ist das Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten verbunden, das die praktische Ausbildung von Tropenärzten und die Erforschung von Tropenkrankheiten sich zur Aufgabe stellt.
Zwei Irrenanstalten, Friedrichsberg und Langenhorn, sind vom Staate gegründet, während eine für Lungenkranke bestimmte Heilanstalt, Edmundstal bei Geesthacht, durch die Freigebigkeit eines Hamburger Bürgers, Edmund Siemers, gestiftet worden ist.
Von größtem Einfluß auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung muß deren Wasserversorgung sein. Hierfür ist eine Zentralanlage mit Sandfiltration geschaffen, die das Wasser der Elbe entnimmt und in 18 offenen Filtern von zusammen 13 ha Bodenfläche ein kristallklares Produkt liefert. Seit 1905 wird außerdem auch Grundwasser für die Versorgung der Stadt verwendet, und dieses wird, vermischt mit jenem filtrierten Elbwasser, durch das Pumpwerk Rotenburgsort von einem 66 m hohen Turm in alle Stadtteile befördert.
Der Beseitigung der häuslichen Verbrauchswasser samt allen Abfuhrstoffen dient eine unterirdische Sielanlage, die mit ihrem verzweigten Netz von 460 km Siellänge zur Elbe entwässert.
Für eine gesunde und bequeme Fleischversorgung hat der Staat Vieh- und Schlachthöfe großen Maßstabes angelegt, beide in St. Pauli, in naher Verbindung mit der Eisenbahn. Auf dem Schlachthofe sind im Jahre 1907 ca. 65 000 Rinder, 53 000 Kälber, 380 000 Schweine, 90 000 Schafe und fast 5000 Pferde geschlachtet worden.
Die für die Volksernährung wichtige deutsche Seefischerei, die im Jahre 1908 ca. 160 Millionen Pfund Fische auf den Fischauktionen zum Verkauf brachte und dafür ca. 19 Millionen Mark erlöste, hat freilich ihren Hauptabsatz in Geestemünde, dem größten Fischereihafen Deutschlands, immerhin hat aber Hamburg mit 31½ Millionen Pfund und einem Erlös von 4½ Millionen Mark etwa die Hälfte des Geestemünder Umsatzes zu verzeichnen, wobei die zum Teil aus den Isländer Gewässern stammenden Schellfische und Kabeljaus die Hauptmasse ausmachen. –
Ebenfalls aus Gesundheitsrücksichten sind die alten, jetzt im Stadtgebiet belegenen Friedhöfe geschlossen worden. Dafür wurde ein für alle Konfessionen bestimmter Zentralfriedhof, etwa 10 km vom Mittelpunkte der Stadt entfernt, auf freiem Felde angelegt, auf luftigem, lockerem Boden, der die Verwesung beschleunigt. Auf mehreren Seiten von erfrischendem Buschwerk umgeben, und auch im Innern, um die Grabstellen, mit reichern Pflanzenschmuck versehen, überall landschaftlich gehalten und mit Teichen geschmückt, die das durch Drainage gewonnene Wasser sammeln und zugleich eine Wasserleitung speisen, die blumengärtnerischen Zwecken dient, macht die ganze Anlage einen überaus wohltuenden Eindruck.
Daß in einer so mächtigen und tätigen Handelsstadt wie Hamburg eben der Handel den Lebensnerv bildet, daß alle Energie seiner Bewohner sich auf den Handel und die mit ihm zusammenhängende Industrie vorzugsweise richtet, ist selbstverständlich. In einer kleinen Landstadt, die eine Universität hat und von den Studenten lebt, dreht sich alles um das Universitätsleben; in der Hauptstadt eines kleinen Königreichs oder Herzogtums bildet der Hof des Fürsten den Mittelpunkt, wenn auch, wie das in unserer Zeit nicht anders sein kann, die Industrie sich gleichfalls geltend macht. In der Haupt- und Residenzstadt Berlin ist zwar der Hof immer ein Mittelpunkt, aber es vereinigen sich alle übrigen Lebensinteressen der Industrie und des Handels, der Kunst und Wissenschaft mit den politischen und militärischen, regierungs- und verwaltungsmäßigen, sodaß weder der Hof allein, noch die Universität allein, noch die Industrie allein, noch die parlamentarische Tätigkeit allein auf bevorzugte Geltung Anspruch machen kann. In Städten aber wie Hamburg und Bremen ist das ganze Leben sozusagen in den Handel eingetaucht. Wie sehr trotzdem die Industrie zu Hamburgs Lebenselementen gehört, ergibt sich aus der statistisch festgestellten Tatsache, daß von der Gesamtbevölkerung Hamburgs etwa 45 Prozent der Industrie und nur etwa 30 Prozent dem Handel und Verkehr dienen. Was auf dem Gebiete der Industrie Hamburg zu leisten vermag, zeigte die große Industrie-Ausstellung von 1889. Immerhin bildet der Welthandel die Haupteigentümlichkeit Hamburgs, und die rege Industrie verdankt jenem großenteils ihre Existenz. Der Handel bildet den belebenden Odem, den nie aussetzenden Pulsschlag, der nicht minder im Zentrum als auf der äußersten Peripherie zu spüren ist. Hamburg würde seinen Charakter, seine Macht, seine Bedeutung verlieren, wenn es anders wäre. Das Bewußtsein davon durchdringt jeden Hamburger, und nicht am wenigsten die Karrenführer und Lastenträger, die, gut bezahlt, den umherschlendernden Reisenden fast verächtlich wie einen Müßiggänger betrachten, und, wohl wissend, daß Zeit Geld ist, ihm kaum Rede stehen. Eine Stadt wie Hamburg gibt auch dem Handwerker und tüchtigen Arbeitsmann Verdienst genug, sodaß, wer Kraft, Fleiß und guten Willen hat, auch eine ehrbare Existenz gewinnen kann. So durchdringt das stolze republikanische Selbstgefühl, das Bewußtsein, ein freier Hamburger zu sein, nicht minder den Holzhauer wie den Millionär.
Das seelische Zentrum dieses Lebens ist in der Börse auf dem Adolfsplatze. Hamburgs Börse ist in ihrer Art einzig, indem in ihr die verschiedensten Geschäftszweige vertreten sind, die sonst getrennte Börsen haben, und hier die Börsenversammlung die Gesamtheit des Hamburger Handelsverkehrs darstellt. Das Hauptgebäude der Börse, im italienischen Renaissancestil 1836-42 erbaut, blieb bei dem großen Brande von 1842 durch todesmutiges Eingreifen einiger Bürger von der Feuersbrunst verschont; seitdem ist es mehrfach vergrößert worden, und auch jetzt wieder mußte behufs Unterführung der städtischen Untergrundbahn ein Flügel des Gebäudes abgerissen werden, um demnächst als erweiterter Neubau wieder zu erstehen.
Der für das Börsenpublikum bestimmte Saal ist durch Liniierung des Fußbodens und Numerierung der Säulen in so viel Fächer geteilt, daß jeder regelmäßige Börsenbesucher oder Vertreter von ca. 7000 Firmen, einen bestimmten Platz zugewiesen erhält, wo er während der Börsenzeit, von 1¾ Uhr an, eventuell mit Hilfe eines Börsen-Adreßbuches, zu finden ist. Der Saal ist von einer oberen, inneren Galerie umgeben, welche dem Publikum auch während der Börsenzeit gestattet, einen Rundgang um den Saal zu machen. Welch ein Bild, von oben gesehen, bietet sich dann dem Beschauer! Ein Meer von Köpfen in steter wogender Bewegung, und über 7000 Besucher, sämtlich mit den Nachbarn leise flüsternd, erzeugen ein dröhnendes Brausen, dem des Meeres nicht unähnlich. Da wimmelt es von Käufern und Verkäufern, welche ihre Waren: Zucker, Südfrüchte, Kaffee, Gewürze, Holz, Seiden- und Wollstoffe, Kunstgegenstände aus aller Herren Länder anbieten oder verlangen. Selbst Gold und Papiere werden zu Waren, mit denen spekuliert und Handel getrieben wird. Die Makler sind besonders rührig und in steter Bewegung, schreiben stehend oder auch im hastigen Schritt ihre Schlußnoten, suchen hier zu überreden, dort zu schlichten, sind aller Aufträge gewärtig und haben für alle Fragen eine Antwort. Das Hamburger Adreßbuch weist über 60 verschiedene Arten Makler auf, die nicht bloß die Geschäfte anderer vermitteln, sondern auch auf eigene Rechnung oft ganze Schiffsladungen ankaufen, mitunter schon, bevor noch das betreffende Schiff den Hafen erreicht hat. Die für Beschaffung von Wertpapieren und Waren zu entrichtenden Abgaben (Schlußnotenstempel) entsprachen im Jahre 1908 zusammen einem Werte von über 4 Milliarden Mark.
Wer mit einem geistigen Blicke all die Geschäfte, die in den zwei Börsenstunden von 1-3 Uhr abgemacht werden, überschauen könnte, der würde sich eine ungefähre Vorstellung von der Bedeutung einer Handelsstadt wie Hamburg bilden können. Was sich aber hier dem nicht geschäftskundigen Auge entzieht und hinter hieroglyphenartigen Ziffern und Zeichen verbirgt – im Hafen mit seinem Gewimmel von großen und kleinen Schiffen tritt es ihm anschaulich, sozusagen in handgreiflicher Größe, entgegen. Wer aus dem Innern Deutschlands sich hier zum ersten Male der Nordsee nähert und den Odem des Ozeans spürt, obwohl er noch weit von der Küste entfernt ist, dem weitet sich auch mit dem sich verbreiternden Elbstrome, der die gewaltigen Dampfer und Hunderte von Segelschiffen heimführt, das Herz. Und wenn er auf einer Rundfahrt durch den Freihafen Tausende von Masten und zierlichen Wimpeln erblickt, und wenn er diese unabsehbaren Massen von Waren aus allen Erdgürteln, dieses Getümmel und Gewimmel von Matrosen, Kaufleuten, Reisenden und Auswanderern, die in allen Zungen reden, erschaut, dann wird er nicht nur von einem Gefühl des Staunens und der Bewunderung, sondern auch vom stolzen patriotischen Gefühle erfüllt werden, daß diese Welthandelsstadt Hamburg eine deutsche Stadt, eine Perle des Deutschen Reiches ist.
Hamburg hat die Macht und Herrlichkeit der freien Hansestadt bis in die Gegenwart sich gerettet, wenn ihm auch noch im vorigen Jahrhundert die härtesten Prüfungen nicht erspart wurden; das Vordringen der Franzosen hatte 1803 die Blockade der Elbe durch die Engländer zur Folge, wodurch der Handel Hamburgs gelähmt ward. Dazu kamen die Opfer, die es den Franzosen durch erzwungene Anleihen bringen mußte, und nach unaufhörlichen Gelderpressungen und Bedrückungen ward es 1810 dem französischen Kaiserstaat einverleibt. Die Handelsverbindung mit England hörte auf, der ganze überseeische Handel lag darnieder. Sobald aber die Kunde von der Vernichtung des französischen Heeres im russischen Feldzuge 1812 anlangte, schüttelten die Hamburger (1813) das französische Joch ab. Doch die Freude war vorläufig nur kurz, denn neue französische Heerhaufen unter Davoust drangen ein, besetzten die Stadt und übten neue grausame Erpressungen. Erst 1814, Ende Mai, räumten die Franzosen die Stadt, deren Verluste auf 210 Millionen Mark berechnet wurden. Dennoch erhob sich Hamburg nach langem Druck um so elastischer; und wenn auch der große Brand vom 5. bis 8. Mai des Jahres 1842 eine neue Störung und schwere Schädigung brachte, so war auch dieses Unglück für den kräftigen kleinen Freistaat nur ein vorübergehendes Gewitter. In den letzten Kriegen Preußens gegen Österreich und Deutschlands gegen Frankreich hat die alte und stets junge Hansestadt wacker auf deutscher Seite gestanden, und im neu erstandenen Deutschen Reiche unter dem glorreichen Zepter der Hohenzollern hat sie den kräftigsten Schutz und die vollste Gewähr ihrer Freiheit gefunden.
Als Wahrzeichen ihrer Kraft und als Sinnbild ihres stolzen Selbstbewußtseins erhebt sich das neue Rathaus, auf dem Platze, der nach dem großen Brande von 1842 bei Anlegung des neuen Stadtplanes für diesen Zweck bereit gehalten wurde. Bei jenem Brandunglück hatte man das ehrwürdige alte Rathaus, das länger als ein halbes Jahrtausend der Stadt gedient hatte, mit Pulver sprengen müssen, um dem herannahenden Flammenmeere die Nahrung zu nehmen; aber infolge des gewaltigen Wachstums der Stadt bedurfte es einer vierzigjährigen Vorbereitungszeit, ehe ein Einverständnis darüber erzielt werden konnte, wo und in welchem Umfange das neue Rathaus ausgeführt werden sollte. Erst im Jahre 1886 ward für das neue Rathaus der Grundstein gelegt, und im Jahre 1897 wurde es eingeweiht. Es ist ein Sandsteinbau in deutschem Renaissancestil, mit granitnem Unterbau, nach einem von neun Hamburger Architekten gemeinsam entworfenen Plane aufgeführt, an Dach und Fassaden mit reichem Figurenschmuck versehen und von einem 111 m hohen Turme überragt, dessen Spitze den deutschen Reichsadler trägt. Damit der Bau, dem Platze entsprechend, in seiner Ausdehnung beschränkt werden konnte, hat in ihm nur ein kleiner Teil der Staatsverwaltung Aufnahme gefunden; so das Staatsarchiv und die Geschäftsräume für die Finanz-Deputation und die Deputation für Handel und Schiffahrt. Sonst enthält es außer den Sitzungssälen für die regierenden Körperschaften nur die für die Stadt unentbehrlichen Repräsentationsräume.
Auf der Rückseite des Rathauses ist durch zwei Flügel die bauliche Verbindung mit der Börse hergestellt, sodaß Rathaus und Börse einen gemeinsamen Hofraum umschließen, den sogenannten Ehrenhof, der wieder durch einen der Hygiea geweihten Brunnen geziert ist. Dieser versinnbildlicht in seinen Erzfiguren die segensreichen Wirkungen des Wassers und dient zugleich als Kühlungsfilter für die frische Luft, welche von hier aus durch Ventilatoren in alle Rathausräume verteilt wird.
Trotz seiner damaligen Unfertigkeit im Innern hat das Gebäude bereits 1896 seine politische Weihe empfangen, als der Kaiser bei Eröffnung des Nordostseekanales Hamburg zum Ausgangspunkte der Feier bestimmt hatte. Da ließ der Hamburger Senat es sich nicht nehmen, den Kaiser samt den an der Kanalfeier teilnehmenden deutschen Fürsten und Vertretern der seefahrenden Nationen zu einem Festmahle im Rathause und einem Abendfeste auf der Alster einzuladen. Zu diesem Zwecke war in der Binnenalster eine Felseninsel künstlich geschaffen worden, die im Glanze tausender elektrischer Lichter einem Feenreiche glich; und die unfertigen Festräume des Rathauses waren vorübergehend einer Ausschmückung unterworfen worden, die einer so erlauchten Festversammlung durchaus würdig war. Die huldvolle Annahme der Einladung sowie die begeisterte Teilnahme aller Schichten der Hamburger Bevölkerung an Empfang und Begrüßung der hohen und seltenen Gäste machten diesen Tag zu einem der denkwürdigsten Festtage, die die Hansestadt erlebt hat. Inzwischen ist nun auch der große Festsaal definitiv mit einem Zyklus von Wandgemälden geschmückt worden, in denen Professor Hugo Vogel die verschiedenen Kulturepochen dargestellt hat, wie sie sich von Anfang an bis in die Gegenwart auf hamburgischem Boden mögen abgespielt haben. Es sind fünf Bilder, die, nur durch Pilaster voneinander getrennt, durch ihren gemeinsamen Horizont ein geschlossenes Ganzes bilden, das, von einer idealen Urlandschaft und von der ersten Besiedelung des Gebietes durch Fischer und Hirten ausgehend, über die in der Zeit Karls des Großen gewonnene Kultur und die Blüte der Hansa fortschreitet bis zur Vollentwickelung der modernen Industrie und des heutigen Schiffsverkehrs, – ein Gemälde, das der Größe Hamburgs und seines die Welt beherrschenden Hafens gerecht wird.
Wie die wohlgelungene Durchführung jener Kaiserfeier wieder beweist, ist das Leben der Stadt ein gesundes, frisches, volles, dem noch eine große Zukunft bevorsteht. Es ist diese Gesundheit und Kraftfülle vom Palast des reichen Senators bis zur Kellerwohnung des Diensthelfers zu spüren, sie umschlingt alle Stände, die als handeltreibendes Volk solidarisch miteinander verbunden sind. Hungerleider sind in Hamburg eine Seltenheit. Der Hamburger lebt gut und läßt gern, wie man sagt, etwas draufgehen. Der Wohlhabende und Reiche will seines Reichtums auch froh werden, er gefällt sich im Luxus und liebt eine reichbesetzte Tafel.
Die Lage und der Schiffsverkehr Hamburgs kommen seinem Markte zustatten. Die Elbe spendet Aale, Lachse und Störe, Holsteins und Mecklenburgs Seen Karpfen und andere Edelfische, die Nordsee Steinbutt, Zungen, Austern, Hummer und Krabben, Holstein feinste Butter und zartesten Schinken, die Länder Nordeuropas und Norddeutschland selber Wildbret, Rußland den feinsten Kaviar, Westindien Schildkröten, Ostindien eßbare Vogelnester, Frankreich und die Mittelmeerländer köstliche Weine und Früchte. Speziell im Handel mit Südfrüchten bildet Hamburg den Einfuhrhafen für ganz Mittel- und Nordeuropa.
Charakteristisch für die in Hamburgs Nähe gelegenen Marschdörfer ist die Obstkultur. So erzeugen die Vierlande, oberhalb Hamburgs zwischen Elbe und Bille belegen, und schon im Mittelalter von Holländern eingedeicht, deren Nachkommen ihre fremdartige Tracht bis heute bewahrt haben, außer Blumen und Gemüsen, eine große Menge Obst-, Erd-, Johannis- u. a. Beeren. Vor allen anderen Landschaften berühmt durch seine Obstkultur ist aber das hannoversche Alte Land Siehe den Aufsatz auf S. 64 ff., am Südufer der Elbe oberhalb Stades meilenweit sich hinziehend, in Hamburg meist das Kirschenland genannt, weil es im Sommer monatelang täglich viele Kahnladungen von Kirschen liefert, aber auch Äpfel und Zwetschen. Dieses Ländchen ist ein förmlicher Wald von Obstbäumen, die nicht bloß in den Gärten hinter den Häusern, sondern auch auf den Wegen und Höfen und, wo ein wenig Ackerbau betrieben wird, auch an den Ackerrändern wie auf den Deichen gepflanzt sind. Zur Zeit der Blüte erscheint das ganze Land wie in einen weißen Schleier gehüllt, ein Anblick, aus dessen Zauberbanne man sich jedesmal nur ungern losreißt.
Wie sich der Vertrieb der ungeheuren Massen von Obst und Gemüsen abspielt, die in Hamburg täglich eingebracht werden, zeigt ein Besuch des Hopfenmarktes und des Meßbergs. Unter freiem Himmel werden auf diesen beiden Plätzen die Waren für den Zwischenhandel wie auch für direkten Verkauf an die Konsumenten feilgehalten, und zwar an bestimmten Tagesstunden, sodaß nach jedesmaligem Schluß des Marktverkehrs eine gründliche Reinigung des Marktes erfolgen kann. Die Benutzung von Markthallen, wie sie in andern großen Städten beliebt sind, hat hier keinen Anklang gefunden. Um nun die innere Stadt zu entlasten und zugleich den Marktverkehr zu konzentrieren, ist jetzt eine großartige Zentralmarkt-Anlage in Ausführung begriffen; diese wird den Platz, welcher durch Beseitigung des alten Berliner Bahnhofs und anderer Baulichkeiten frei geworden ist, umfassen und durchschnitten werden von der Deichstraße. Dem am Wasser (Zollkanal) liegenden Teile wird eine Uferstrecke von 500 m Länge für die Landung der Marktwaren zur Verfügung stehen, auch werden für den Landverkehr die Eisenbahnanlagen mit dem Marktplatze in Verbindung gebracht werden. Ausgedehnte Kasematten unter dem Platze sollen der Aufbewahrung von Wagen und Gerätschaften dienen und, wie auch der Platz selber, elektrisch beleuchtet werden.
Hamburgs Freihafen.
Die Frage, welche Stellung die Hansestädte zum deutschen Zollverbande einnehmen sollten, ist schon damals aufgeworfen worden, als im Jahre 1833 Preußen und die süddeutschen Staaten den Deutschen Zollverein gründeten. Bei jedem weiteren Schritte aber, welcher auf dem langen, endlich zur Begründung deutscher Einheit führenden Wege getan wurde, ist sie von neuem lebhaft erörtert und die Wichtigkeit des Zutritts der Hansestädte betont worden. Auch in der politischen Aufregung zu Ende der vierziger Jahre dachte man ernstlich an Gründung eines einheitlichen deutschen Zollverbandes, und brennend wurde die Frage für die Hansestädte, als in den fünfziger Jahren durch Zutritt Hannovers das deutsche Zollvereinsgebiet sich bis an die Nordsee erweitert hatte. Die großartigen politischen Ereignisse der Jahre 1866 und 1871 waren zu überrumpelnd, als daß für endgültige Erledigung der hanseatischen Frage Raum gewesen wäre. Daher wurde in der Verfassung des Norddeutschen Bundes es den Hansestädten überlassen, so lange Freihafen und außerhalb der gemeinsamen Zollgrenze zu bleiben, bis sie ihren Einschluß in diese selbst beantragen würden.
Seitdem erfolgte nun der nationale Zusammenschluß, und damit erhielt auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu einem deutschen Wirtschaftsganzen im Reiche immermehr die Oberhand. Schon die Reichsverfassung von 1871 sprach im Artikel 33 das Prinzip des einheitlichen Zoll- und Handelsgebietes aus. In Hamburg selber war man über die Rätlichkeit des Zollanschlusses sehr geteilter Meinung; jedenfalls war man der Ansicht, daß die auf historischer Entwickelung beruhende Freihafenstellung der Hansestädte dem ganzen Reiche nicht minder förderlich sei als den Städten selber. Im Binnenlande jedoch herrschte sowohl in der Volksvertretung als auch im Publikum die Meinung vor, daß die politische Einheit auch die wirtschaftliche zur Folge haben müsse, der Eintritt der Hansestädte ins Zollgebiet nur eine Frage der Zeit sei. Nachdem dann auch von seiten der Reichsregierung der Zollanschluß für eine hervorragende Frage des deutschen Reichsinteresses erklärt worden, konnte Hamburgs Interesse nur noch darauf gerichtet sein, sich mit dem Deutschen Reiche über jene Frage in dauerndes Einvernehmen zu setzen.
Den ersten in dieser Hinsicht seitens der Reichsregierung im Jahre 1879 gestellten Anfragen folgten Verhandlungen auf Grund der unerläßlichen Bedingungen, die die Vertreter der Hamburger Handelsinteressen für die Ausführung des Zollanschlusses stellen zu müssen glaubten. Diesen Bedingungen – Belassung eines ausreichenden Freihafens, d. h. des nötigen Raumes, in welchem die Seeschiffe sich bewegen und der Transithandel wie die Exportindustrie auch ferner ohne jede Zollkontrolle betrieben werden können; Übertragung der Zollverwaltung auf den Hamburger Staat und Zuschuß des Reiches zu den Kosten der Anschlußbauten – wurde seitens der Reichsregierung in so vollem Maße Rechnung getragen, daß Hamburgs Welthandelsstellung dabei gesichert schien. Demgemäß trat in Hamburg ein Umschwung in der öffentlichen Meinung ein, und allmählich vollzog sich auch die Zustimmung aller maßgebenden Faktoren in diesem Sinne. Aus den dann folgenden Beratungen der Hamburger Behörden erstand ein Projekt, das von den Reichsbehörden gutgeheißen und in den sieben Jahren von 1881 bis 1888 zur Ausführung gebracht wurde. Die staatsseitig nach diesem Projekte durchgeführten Bauten erforderten einen Aufwand von 120 Millionen Mark, wovon beinahe die Hälfte auf den nötigen Grunderwerb verwandt werden mußte. Zu jener Summe steuerte das Reich 40 Millionen Mark bei.
Ein einheitliches Freihafengebiet konnte nur geschaffen werden, wenn außer den auf beiden Elbufern bereits bestehenden Häfen und Kaianlagen ein Teil der Norderelbe und ein genügend großes Gebiet südlich davon hineinbezogen wurde. Nur so konnte ein freier Verkehr zwischen den verschiedenen Hafenanlagen ermöglicht und zugleich Raum beschafft werden für Exportindustrie und Lagerung von Massengütern.
Demgemäß ward ein Areal von ca. 10 qkm als Freihafengebiet vereinbart, welches die Wohnstadt ausschließt und von dieser durch die Zollgrenze getrennt ist. Nach Herstellung der nötigen Kai- und Speicherbauten sowie Schaffung neuer Verkehrswege für das zollangeschlossene Gebiet wurde jenes am 15. Oktober 1888 seinem Zwecke übergeben und für die Wohnstadt der Zollanschluß vollzogen. Erst am 29. Oktober 1888 aber fand die feierliche Einweihung des Freihafens statt, indem Kaiser Wilhelm II. den Zollanschlußbauten den Schlußstein einfügte und dadurch die Teilnahme des Reiches an diesem geschichtlichen Ereignisse kundgab. Jener Stein befindet sich in dem westlichen Turm des Südportales der Brooksbrücke und trägt folgende Inschrift: »Kaiser Wilhelm II. setzte diesen Stein am 29. Oktober 1888 bei dem Anschluß Hamburgs an das deutsche Zollgebiet.«
Das später noch bedeutend erweiterte Freihafengebiet wird im Westen begrenzt vom Köhlbrand, der Hauptwasserstraße zwischen Norder- und Süderelbe. Im Osten reicht es bis zur Eisenbahnbrücke, der oberen Grenze der Seeschiffahrt auf der Elbe. Nach Norden, also nach der Stadt zu wird es begrenzt durch den Niederhafen, den Binnenhafen, jenen Zollkanal, den Oberhafen und den Oberhafen-Kanal; doch ist das Terrain des Hannöverschen Bahnhofes, der noch gelegentlich zum Personenverkehr benutzt wird, im Zollinlande belassen worden. Das Freihafengebiet umfaßt 10,85 qkm, wovon etwa die Hälfte auf die Wasserfläche kommt. Die Südgrenze fällt nahezu mit der Territorialgrenze des Hamburger Gebietes zusammen, durchschneidet, der Elbe parallellaufend, die Elbinseln vom Harburger Eisenbahndamm im Osten bis zum Köhlbranddeich im Westen, um an diesem entlang die Norderelbe zu gewinnen und diese dann zu durchqueren.

Situationsplan des Hamburger Hafens.
Sollte den rings um das Freihafengebiet belegenen Wohnplätzen auch zu Lande freier Verkehr miteinander ohne Überschreitung der Zollgrenze ermöglicht werden, so mußten außer jenem Zollkanal ganz neue Verkehrswege geschaffen werden.
Der Wagenverkehr zwischen Hamburg und Harburg wurde früher mitten durch den jetzigen Freihafen mittels einer Dampffähre über die Elbe geleitet. Zum Ersatz dafür wurde nun im Zollinlande oberhalb der Eisenbahnbrücke eine neue Straßenbrücke für Wagen und Fußgängerverkehr erbaut, die die Wohnstadt mit dem Südufer der Elbe verbindet und dadurch die Besiedelung des zollinländischen Stadtteiles Veddel wesentlich erleichtert. Ihrer Bedeutung als einzigem städtischen Verkehrswege über die Elbe entsprechend, sind die Endportale der Brücke architektonisch den älteren norddeutschen Stadttoren, wie sie in Lübeck, Stendal und sonst sich noch finden, nachgebildet und mit den Wappen der drei Hansestädte geschmückt worden.
Die durch und nach Hamburg führenden, für den Personenverkehr bestimmten Eisenbahnen laufen jetzt sämtlich in dem großen Hauptbahnhofe zusammen, der im Zollinlande liegt; die Güterbahnhöfe sind jedoch in geeigneter Weise mit den Kaibahnen des Freihafengebietes verbunden und auch den dortigen industriellen Anlagen zugänglich gemacht worden. Der besseren landfesten Verbindung der Stadt bei den St.-Pauli-Landungsbrücken mit dem Südufer der Norderelbe (Steinwärder) soll ein Tunnel dienen, der jetzt im Bau begriffen ist.
Das Nordufer des Zollkanals wird von einer neuen, bedeutend erhöhten, sturmflutfreien Straße gebildet, die dem Ringstraßenverkehr um die Wohnstadt dient und teilweise von einem tiefer liegenden Landungskai begleitet ist. Belebt sind die langen, die Straße stützenden Kaimauern durch Kasematten, Kräne und Landungstreppen.
Der Zollkanal selber, bei 45 m Minimalbreite und 2 m Niedrigwassertiefe, die sich bei Flut durchschnittlich um 2 m erhöht, dient einesteils dem zollinländischen Verkehr zwischen Ober- und Unterelbe wie auch dem beider mit der Wohnstadt und bietet in seinem oberen Ende unweit der Billmündung dem lebhaften Flußschiffsverkehr der Oberelbe Lösch- und Ladeplätze; andernteils dient er der Zollabfertigung für die aus dem Freihafen nach der Zollstadt bestimmten Güter. Fünf Fleetenzüge führen von ihm aus unter Brücken hindurch zur inneren Stadt, während drei neue stattliche Straßenbrücken, die Brooks-, Kornhaus- und Kehrwiederbrücke, sowie ein Fußgängersteg, die Jungfernbrücke, den Straßenverkehr zwischen Wohnstadt und Freihafengebiet vermitteln. Zollinländische Seeschiffe, also aus anderen deutschen Seehäfen stammend, die die freie See unter Zollverschluß passiert haben, können ihres Tiefganges wegen nur unterhalb des Freihafengebietes bei St. Pauli anlegen.
Überschreiten wir, von Norden kommend, eine jener Brücken, so treffen wir zunächst auf dem schmalen Inselstreifen, welcher zwischen dem Zollkanal und dem nächstgelegenen, bereits früher vorhandenen Elbhafen, dem Sandtorhafen, sich hinzieht, die großartigen Freihafenspeicher-Bauten.
Diese Anlage soll einen Ersatz bieten für jene vielen in der Wohnstadt zerstreut liegenden Einzelspeicher, die fortan nur zu zollinländischen Zwecken benutzt werden. Durch einen Kanal, Kehrwiederfleet und Brooksfleet genannt, wird das Speichergebiet der ganzen Länge nach in zwei Speicherreihen geteilt, deren Gebäude je eine Wasser- und eine Landfront haben. Da der ganze Transport der für die Speicher bestimmten Waren von den Seeschiffen her oder aus den Kaischuppen nur durch Schuten, das sind flachbodige Fahrzeuge von 20-25 Reg.-Tons Tragfähigkeit, erfolgt, so genügte für diesen Kanal eine geringe Breite und Tiefe.
Das Speicherterrain ist Staatsgrund, aber von einer Aktiengesellschaft gepachtet und bebaut worden. Von dieser werden die einzelnen Speicher an Private vermietet. Die sämtlichen Speicher, mit wasserdicht abgeschlossenen Kellerräumen und im Erdgeschoß meist mit Kontoren versehen, sind einfache Backsteinbauten mit schmiedeeisernen Stützen und Balkenlagen, deren ganze Eisenkonstruktion deutschen Eisenwerken entstammt. Es können hier nicht bloß die seewärts eingeführten Waren frei zur Wiederausfuhr lagern, sondern es wird hier auch ihre Sortierung und Bearbeitung erledigt, die je nach den Bedürfnissen der verschiedenen Konsumtionsplätze sehr verschiedenartig ist.
Hervorgehoben mag der Kaiserkai-Speicher werden, der allein eine Fläche von ca. 2½ ha bedeckt. Er trägt auf einem das Westende zierenden Turme ein 10 m hohes Eisengerüst und auf diesem einen weithin sichtbaren Zeitball. Dieser wird täglich kurz vor 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit, das ist Greenwicher Mittagszeit, um 3 m gehoben und dann zur genauen Mittagszeit durch einen auf der Sternwarte bedienten elektrischen Apparat zum Fallen gebracht. Auch trägt der Turm vier Zifferblätter, die den jeweiligen Elbwasserstand in Metern und Zentimetern angeben. Die Zeiger werden durch einen in der Elbe befindlichen Schwimmer in Bewegung gesetzt.
Dem Zollkanal und diesem Speichergebiet mußte ein bedeutender Teil der inneren Stadt geopfert werden; etwa 500 Grundstücke mit 1000 Häusern mußten erworben und gegen 20 000 davon betroffene Bewohner ins Zollinland übergeführt werden, was übrigens allmählich und ohne Schwierigkeiten sich vollzog.
Inmitten des Speichergebietes sind für die Bedienung der verschiedenen Bewegungsvorrichtungen wie zur Erzeugung von elektrischem Licht mehrere Zentral-Maschinenstationen errichtet. Um den großen Anforderungen an Kraft, die in den Schuppen und Lagerräumen gemacht werden, zu genügen, wurden zunächst hydraulische Werke angelegt, aber in neuerer Zeit sind diese durch ein ausgedehntes Verteilungssystem elektrischer Kraft teilweise beseitigt oder ersetzt und zugleich vergrößert worden. Überall werden die Speicherkontore wie der Zollkanal und seine Zollabfertigungsstellen elektrisch beleuchtet. Zum Befrachten und Löschen der Schiffe sind mehrere Hundert Kräne aufgestellt, darunter ein Riesenkran von 150 t = 3000 Zentnern Tragkraft. Nach Fertigstellung aller projektierten Anlagen werden im ganzen Freihafengebiet gegen 500 elektrische Kräne in Gebrauch kommen.
Der in seinem Mastenwalde nahe der Stadt früher so stattliche Niederhafen hat durch Abscheidung des Zollkanales einen großen Teil seiner Ankerplätze verloren. Ersatz dafür wie für den in einen Seeschiffhafen umgewandelten Baakenhafen, der früher den Oberländer Kähnen als Winterhafen diente, konnte im Freihafengebiet nur auf dem Südufer der Norderelbe beschafft werden. So entstanden auf dem Kleinen Grasbrook der sehr geräumige, fast 1½ km lange und in der Breite für sechs Reihen größter Schiffe bemessene Segelschiffhafen, und neben ihm der Moldau- und der Saalehafen für diejenigen Oberländer Kähne, d. h. Flußschiffe, die zwischen Zollinland und Freihafen verkehren. Durch den an der Südgrenze des Freihafengebietes entlang führenden Veddelkanal mit dem Spreehafen stehen jene in Verbindung mit dem Reiherstieg, an dessen Ufern durch Aufhöhung allmählich Boden für neue Industrieanlagen gewonnen worden ist.
Für weiteren Bedarf an Anlegeplätzen ist ein geräumiger See- und Flußschiffhafen, genannt Hansahafen, bestimmt, in welchem die nördliche, tiefere, für Seeschiffe bestimmte Hälfte nur durch eine auf der Sohle entlang laufende Steinböschung von der südlichen seichteren, für Flußschiffe geeigneten Hälfte geschieden ist, um so eine direkte Umladung von Gütern aus den Flußschiffen in die Seeschiffe zu ermöglichen. Der letztgenannte Hafen hat mit dem älteren Petroleumhafen und den zwischen beiden gelegenen Indiahafen eine gemeinsame Einmündung in die Elbe.
Der mittlere Teil des Freihafengebietes, Steinwärder und teilweise der Kleine Grasbrook, sind fast vollständig ausgebaut und in Anspruch genommen zur Anlegung von Fabriken, die entweder der Schiffahrt direkt dienstbar sind, Schiffswerften und Maschinenfabriken, oder für den Export arbeiten. Für letzteren ist das Freihafengebiet insofern von größter Bedeutung, als hier ausländische Stoffe zollfrei verarbeitet werden und infolgedessen solche Fabrikate erfolgreicher, als dies vom Zollinlande aus möglich wäre, auf dem Weltmarkte konkurrieren können. Von solchen Betrieben finden sich dort bereits Spritrektifikationsanstalten, Hefe- und Guanofabriken, Ölraffinerien und Reisschälmühlen. Auch aus diesem früher teilweise dicht bevölkerten Gebiete, dessen Grund dem Staat gehört und von der Bevölkerung zu Wohnzwecken gemietet war, mußten alle Wohnungen, soweit sie nicht zu Betriebs- und Aufsichtszwecken dringend nötig waren, sowie alle Betriebsgeschäfte für den Einzelverkauf ausgeschlossen werden.
Im westlichsten Teil des Freihafengebietes sind seit 1898 mehrere sehr weite Häfen angelegt worden, so der Kuhwärderhafen, der Kaiser-Wilhelms-Hafen, der Ellerholzhafen, jeder mit mehr als 20 ha Wasserfläche. Die beiden letztgenannten sind allein an die Hamburg-Amerika-Linie verpachtet, die damit 3½ km lange Kais mit etwa 150 elektrischen Kränen zu ihrer Verfügung hat.
Besonders kräftig entwickelt hat sich infolge des aufblühenden Handels Hamburgs Schiffsbau-Industrie. Die Schiffswerft von Blohm & Voß, die stets mehrere Tausend Arbeiter beschäftigt, hat sich bereits einen Weltruf erworben. Kauffahrteischiffe wie Kriegsschiffe werden hier neu gebaut, ältere Fahrzeuge ausgebessert oder umgebaut. Etwa von der Stelle aus, wo die Altonaer Grenze das Nordufer der Elbe berührt, sieht man am jenseitigen Elbufer im Freihafengebiet die gewaltigen Schwimmdocks jener Werft mit ihren in der Luft schwebenden Schiffskolossen und dahinter auf ansteigendem Ufer die im Bau begriffenen Schiffskörper. Diese Firma hat ein Riesenschwimmdock, das bei einer Ausdehnung von 36 bei 170 m Schiffe bis zu 17 500 Reg.-Tons aus dem Wasser heben kann, und ebenfalls einen Riesenkran von 150 t Tragfähigkeit. Etwas weiter im Hintergrunde, seitwärts hinter dem Kuhwärderhafen, hat jetzt auch die Stettiner Schiffsbaugesellschaft » Vulkan« eine Filiale errichtet.
Der Grenzschutz des Freihafengebietes wird je nach örtlichen Verhältnissen verschieden bewerkstelligt, teils durch Gräben mit Grenzpfählen, teils durch eiserne Drahtgitter oder, wo die Grenze im Fahrwasser der Elbe entlang läuft, durch schwimmende Zollpalisaden. Die offenen Einfahrten in der Elbe werden durch eine große Zahl Zollbarkassen bewacht; der Zollkanal selber aber, soweit er die Grenze zwischen Zollinland und -ausland bildet, ist der ganzen Länge nach mit Zollabfertigungsschuppen besetzt und wird zur Erleichterung der nächtlichen Kontrolle elektrisch beleuchtet. Die ganze Zollverwaltung liegt in den Händen des Hamburger Staates, wodurch ihre sachgemäße Handhabung sowie eine tunlichst erleichterte Verbindung des Freihafengebietes mit der Wohnstadt gewährleistet wird.
Da sowohl das Wohnen als auch der Betrieb von Kleingeschäften vom Freihafengebiete ausgeschlossen ist, so mußte für die leibliche Verpflegung der Tausende von Arbeitern und Beamten, die dort in Tätigkeit und Anstellung sind, gesorgt werden. Dies geschieht in trefflichster Weise von Seiten einer humanitären Gesellschaft in einer größeren Zahl von Volksspeise- und Kaffeehallen. Da jene Gesellschaft die Waren im großen bezieht, ist sie in den Stand gesetzt, verhältnismäßig billig zu wirtschaften und zu liefern; anderseits verwendet sie sämtliche Überschüsse ihrer Speisewirtschaft wieder im Interesse ihres Publikums und dessen Bewirtung.
Vorstehende kurze Skizze der Hamburger Freihafenanlagen dürfte ersichtlich machen, daß der Bestand und die gedeihliche Weiterentwicklung der Handelsstellung, die Hamburg groß gemacht hat, sowohl im überseeischen Großhandel als auch im internationalen Zwischenhandel für die Zukunft gesichert sind; und was das Verhältnis Hamburgs zum Deutschen Reiche betrifft, so wird die deutsche Industrie in immer weiterem Umfange in der ersten Handelsstadt des Reiches eine natürliche Vermittlerin ihres Absatzes gewinnen.
Von Dr. med. Woltersdorff, Helgoland.
Jeder von uns, der in seinen Jugendjahren eifriger Briefmarkensammler gewesen ist, wird noch mit Freude der schönen Helgoländer Briefmarken gedenken, die wegen ihrer Farbenpracht das Herz des jugendlichen Sammlers entzückten. In den Farben des Landes, grün-rot-weiß gehalten, bildeten diese Marken den schönsten Teil unserer Sammlung. Ganz unvermerkt zog damit die Sehnsucht nach jenem eigenartigen Lande in die Brust des Knaben, der von der Insel nichts weiter wußte, als daß sie eine kleine dreieckige Felseninsel vor der Elbmündung sei, welche sich in englischem Besitz befand. Damals ahnte ich noch nicht, daß ich im späteren Leben noch manches Jahr auf dem sturmgepflügten Eilande zubringen sollte.
Obgleich Helgoland nicht gerade an der allgemeinen Verkehrsstraße liegt, so bin ich doch niemals so viel von Freunden und Verwandten aufgesucht worden, wie gerade hier. Häufig war das Wiedersehen auf der Insel ein zufälliges. Als aber Ende Mai vorigen Jahres ein alter Studienfreund, mit dem ich in einer mitteldeutschen Musenstadt so manche frohe Stunde verlebt hatte, mir seinen Besuch anzeigte, da ließ ich es mir nicht nehmen, ihn schon in Hamburg zu begrüßen. Tags darauf, gegen acht Uhr morgens, befanden wir uns schon auf der »Silvana«, einem Dampfer der Hamburg-Amerika-Linie, der an den St. Pauli-Landungsbrücken angelegt hatte, klar zur Reise nach Helgoland. Noch lag auf dem Hafen und seiner Umgebung ein feiner Nebel, der die Fernsicht hinderte; kurze Zeit jedoch, nachdem das Schiff in Fahrt war, schwand er. Bei blauem Himmel und frischer Brise ging es die Elbe abwärts, vorbei an dem schön gelegenen Blankenese, dessen Villen, vom saftigsten Grün umschlossen, ein prächtiges Bild gewährten. Nach vierstündiger Wasserfahrt, die bei dem gewaltigen Schiffahrtsverkehr auf der Elbe für den Binnenländer sehr viel Neues und Interessantes bot und die wir deshalb der Bahnfahrt Hamburg-Cuxhaven vorgezogen hatten, kamen wir gegen Mittag in Cuxhaven an. Nach einem halbstündigen Aufenthalt, währenddessen die mit der Bahn angekommenen Passagiere und die Post an Bord genommen wurden, ging es weiter. Auch die Seefahrt versprach schön zu werden, denn von Helgoland war nur Windstärke 4 gemeldet worden. Zunächst befanden wir uns drei Viertelstunden lang noch im Fahrwasser der Elbe, das durch die Feuerschiffe Elbe I-V und durch Baken, Tonnen und Bojen als solches kenntlich gemacht ist. Nachdem wir Elbe I passiert haben, kommen wir ins offene Meer und nehmen direkt Kurs auf Helgoland. Jetzt merken wir auch an unserem Dampfer, daß wir in freie See kommen, denn er fängt an, etwas zu stampfen und zu rollen. Der Wind, der von Nordwest weht, hält die Luft frei von Dunst und Nebel, sodaß der Blick weithin reicht. So kommt es denn, daß wir kaum 20 Minuten nach dem Passieren des letzten Feuerschiffes Helgoland bereits erkennen können. Die Insel zeigt sich unseren Blicken wegen der Entfernung noch ganz flach, die senkrechten Felswände treten gar nicht hervor, während Leuchtturm und Kirche deutlich emporragen. Von Minute zu Minute wird das Bild klarer. Wir begeben uns, da die frische Seeluft einen kräftigen Appetit hervorgerufen hat, in den Speisesalon, um auch den inneren Menschen zu seinem Recht kommen zu lassen. Als wir nach drei Viertel Stunden uns wieder an Deck begeben, bietet sich uns ein herrlicher Anblick. Klar, zum Greifen nahe, liegt das schroff und unvermittelt aus den grünen Wogen emporragende Felseneiland. Die Strahlen der Sonne lassen die roten Felswände in wundervoller Beleuchtung erscheinen. Die grüne Decke des Oberlandes, der rote Felsen der Insel, die weiße Farbe des Dünensandes, diese drei Farben drängen sich gewissermaßen dem Auge auf. Was Wunder, wenn der Helgoländer, der diese drei Farben seines Landes bei jeder Bootsfahrt schaut, sie zu seinen Landesfarben erkoren hat! Für jeden, der Helgoland in dieser Weise zum erstenmal schaut, wird der Anblick unvergeßlich sein.
Grönn is det Lunn (Land),
Road is de Kant,
Witt is de Sunn (Sand),
Deet is det Woapen (Wappen)
Van't Hillige Lunn.
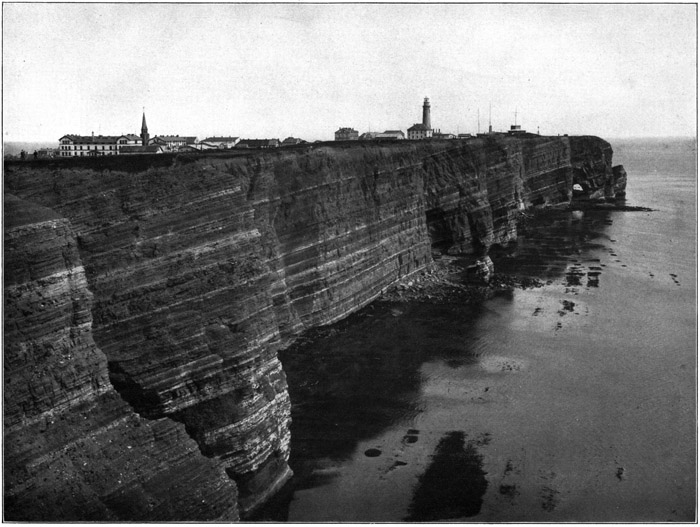
Helgoland (Südwestkante).
Nach einer Photographie von B. Botter, Helgoland.
Haben wir heute Helgoland gewissermaßen in seiner Sonntagsstimmung gesehen und bewundert, so ist doch sein Bild nicht weniger interessant, wenn man es im Kampfe mit den empörten Wogen der Nordsee sieht; wenn der Sturm heult, die Wolken in eiliger Flucht am Himmel dahinjagen, wenn die Sturzseen über das Schiffsdeck schlagen, wenn weiße Schaumkronen auf jeder Welle tanzen, wenn alles grau in grau gemalt ist, dann ist die Grundstimmung des Bildes eine vorwiegend düstere. Man kann es sehr wohl verstehen, wenn den umwohnenden Völkern in heidnischer Zeit die Insel Helgoland verehrungswürdig erschienen ist, sodaß sie hier eine Kultstätte errichteten; bedeutet doch auch der Name »Helgoland« heiliges Land. Diesen Charakter einer heiligen Insel hat Helgoland in den späteren christlichen Zeiten verloren; wegen der schwer zugänglichen Lage diente es vielmehr im Mittelalter Seeräubern zum Unterschlupf: Einer der berüchtigsten, Claus Störtebecker, wurde hier im Jahre 1402 von den Hamburgern unter Simon von Utrecht besiegt und gefangen genommen. Nach mancherlei Kämpfen um die Herrschaft über Helgoland zwischen Dänemark und Schleswig-Holstein kam die Insel am 9. August 1714 für nahezu 100 Jahre in dänischen Besitz. Am 5. September 1807 entrissen die Engländer sie den Dänen, nachdem sie zuvor mitten im Frieden sich der gesamten dänischen Flotte bemächtigt hatten. In den nun folgenden Jahren erlebte Helgoland seine Blütezeit: Während der Kontinentalsperre wurde Helgoland zum Hauptstapelplatz für den englischen Schmuggelhandel. Noch heute erinnern kostbare Gegenstände in manchen Helgoländer Familien an das für sie goldene Zeitalter der Kontinentalsperre. Als mit der Beendigung der Napoleonischen Kriege normale Verhältnisse wieder eintraten, hörte natürlich mit einem Schlage der Schmuggelhandel auf. Es traten nun trübe Zeiten für die Helgoländer ein. Um der zunehmenden Verarmung der Insulaner zu steuern, gründete der Schiffsbauer Jacob Andreas Siemens 1826 eine Aktiengesellschaft, welche den Zweck verfolgte, aus Helgoland ein Seebad zu machen. Allmählich nahm die Anzahl der Besucher der Insel zu, sodaß im Jahre 1880 die Zahl der Badegäste bereits 8320 betrug. Seit dem Jahre 1890, in dem Helgoland in deutschen Besitz überging, hat eine wesentliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage Helgolands stattgefunden: Die Zahl der im Jahre 1908 die Insel besuchenden Fremden und Badegäste ist bereits auf 30 000 gestiegen.
Aus dieser historischen Betrachtung werden wir durch das Rasseln der Ankerkette gerissen, welches uns daran gemahnt, daß wir am Ziel unserer Reise sind. Auf Ruderbooten oder kleinen Dampfern wird die Verbindung mit dem Lande hergestellt. Nach fünf Minuten Fahrt legt unser Boot an der neuen Landungsbrücke an – die alte Brücke war am 8. November 1904 einer gewaltigen Sturmflut zum Opfer gefallen –, wo wir von den Anwesenden auf unsere Seefestigkeit hin prüfenden Auges angeschaut werden.
Nachdem wir das Gepäck besorgt haben und uns an einer Tasse zollfreien Kaffees (Helgoland ist Zollausland geblieben) gelabt haben, treten wir unsere Wanderung an. Zunächst der Hauptstraße, der Kaiserstraße, folgend, gelangen wir an den sogenannten Markusplatz, einer platzartigen Erweiterung der Treppenstraße, auf dem sich in der Saison bei Bier und »Wellen«, einem grogähnlichen Getränk, ein reges Leben entwickelt. Die Scylla und Charybdis in Gestalt von zwei gut ausgestatteten Restaurants, welche den Markusplatz flankieren, vermögen diesmal nicht, uns von unserem Plane, baldigst ins Oberland zu gelangen, abzubringen. Mit Hilfe eines Aufzugs befinden wir uns nach einer halben Minute 30 m höher, das heißt auf dem Oberlande. Die an dieser Stelle nach dem Oberlande führende Treppe mit ihren 180 Stufen benutzen wir lieber beim Hinabsteigen ins Unterland.
Oben angekommen, genießen wir erst die prachtvolle Aussicht: Zu unseren Füßen liegt malerisch das Unterland mit seinen meist Ziegeldächer tragenden Häusern und Häuschen. Auf dem Wasser in der Nähe des Strandes schaukeln jetzt etwa 80 Boote verankert, während sie zur Winterszeit auf den Strand hinaufgezogen werden. In einiger Entfernung seeeinwärts von den Booten gewahren wir schwarze Kästen, die lebende Hummern enthalten. Es ist Helgoland meines Wissens die einzige Stelle in den deutschen Gewässern der Nordsee, an der Hummern gefangen werden, da diese Tiere als Wohnsitz felsigen Boden verlangen. Doch über den anatomischen Bau des Hummers und seine Verwertung können wir ja während des Abendessens uns weiter unterhalten, jetzt wollen wir erst einmal einen Blick nach der Düne hinüberwerfen.
Östlich von uns in einer Entfernung von 1850 m liegt die sogenannte Düne von Helgoland, nur wenig über die Wasserfläche hinausragend. Ihre Größe ist häufigen Schwankungen unterworfen, bei mittlerem Wasserstande hat sie eine solche von etwa 14 ha. Nur die eigenartigen Strom- und Windverhältnisse machen es verständlich, daß dieser kleine Sandhügel mitten im Ozean so lange dem Ansturm der Fluten hat trotzen können. In früheren Zeiten war die Düne mit der Insel durch den sogenannten »Wal« verbunden, den jedoch im Jahre 1721 eine Sturmflut zerstörte. So geringfügig diese Düne auch erscheinen mag, so ist sie doch von sehr großer Bedeutung für die Insel als Badeort. »Sie ist für das Bad Helgoland die Henne, welche die goldenen Eier legt,« hörte ich einen alten Helgoländer treffend bemerken. Denn während sich bei der Insel kein Badestrand findet, da der ganze Küstensaum aus Geröll besteht, hat die Düne einen schönen sandigen Strand. Das eigentliche Badeleben spielt sich deshalb auch auf der Düne ab, wohin der Verkehr durch Segel- und Motorboote vermittelt wird. Um die Düne zu schützen sind unter deutscher Herrschaft mächtige Buhnen, die mehrere hundert Meter weit von der Düne ins Meer ragen, unter großen Geldopfern angelegt worden.
Sobald das Auge sich von diesem idyllischen Stückchen Erde losgemacht hat, gewahrt es nur überall das unendliche Meer. Ein Gefühl der eigenen Nichtigkeit zieht damit in unsere Brust ein. Da gleitet der Blick von der unendlichen Wasserfläche zurück und bleibt auf dem frischen Grün einiger Bäume haften, die an der Treppe und die Siemensallee entlang stehen. Man ist verwundert, daß diese Felseninsel auch Bäume und zwar teilweise in stattlichen Exemplaren hervorbringt, denn vielfach bin ich der Ansicht begegnet, daß die Insel ohne Baum und Strauch sei. Rüstern, Kastanien, Linden, Goldregen gedeihen hier sehr gut, wenn sie auch nicht in Menge vorhanden sind; dagegen sind Versuche mit Koniferen stets fehlgeschlagen. Trotzdem das Oberland den Stürmen viel mehr ausgesetzt ist wie das Unterland, finden sich auch hier ganz hübsche Bäume. So besitzt der auf dem Oberlande gelegene Pfarrgarten neben anderen Bäumen einen stattlichen Maulbeerbaum; an verschiedenen anderen Stellen finden sich Feigenbäume, die teilweise reife Früchte bringen. Auch die Eiche kommt in einigen Exemplaren vor. Eines derselben ist aus einer Eichel gezogen worden, die sich im Kropfe einer geschossenen Holztaube fand. Ein im Besitze eines hiesigen Gärtners befindlicher Garten zeigt hohe Kultur: es gedeihen dort alle Blumen, und im Monat Juli ist der Garten mit Tausenden von schönsten Rosen übersät. Sehr gut kommt hier auch Spalierobst fort, vorausgesetzt, daß ihm der nötige Schutz gegen die Winde gewährt wird. Von den Feldfrüchten gedeihen am besten die Kartoffeln, die auch den Hauptbestandteil der Feldernte bilden. Klee und Gemenge erreicht nicht den Wuchs wie auf dem Festlande, doch werden diese Pflanzen der Grünfütterung wegen von dem hiesigen Molkereibesitzer, der 15 Milchkühe sein Eigen nennt, angebaut. Der Boden ist an und für sich gut ertragsfähig, doch zerstört der Wind sehr viel. Wenn ein Sturm über die im saftigsten Grün prangenden Bäume und Büsche dahinbraust, sind die Blüten nach zwei bis drei Tagen schwarz und zerschlagen, als ob ein starker Nachtfrost sie vernichtet hätte.
Doch nun treibe ich meinen Freund, der noch ganz im Anschauen versunken ist, den geplanten Rundgang um das Oberland zu beginnen. Wir gehen am Falm, der schönsten Straße des Oberlandes, welche am Felsrande an der Südostseite der Insel sich hinzieht, entlang, um nach der Südspitze zu gelangen. Auf diesem Wege kommen wir an der Kommandantur, dem früheren Gouvernementsgebäude vorüber. Hier stieg am Morgen des 10. August 1890 zum erstenmal die deutsche Marineflagge allein empor, nachdem sie tags zuvor gemeinschaftlich mit der englischen Flagge geweht hatte.
An der Südspitze angelangt, sehen wir zu unsern Füßen den im Bau begriffenen Torpedobootshafen. Große Granitmauern, welche sich zwei Kilometer weit ins offene Meer erstrecken sollen, bilden die Umfassungsmauern des Hafens. Gleichzeitig finden gewaltige Sandaufschüttungen statt, um Land zu gewinnen. Der hierzu nötige Sand ist mit vieler Mühe teils von der Elbmündung, teils von der Loreleybank, einer Sandbank, welche einige Kilometer östlich von der Düne liegt, in großen, 200 Kubikmeter fassenden Schuten herbeigeschafft worden. In unmittelbarer Nähe des Torpedobootshafens findet sich die Marinemole, an welcher militärische Fahrzeuge gelöscht werden. Von dort führt ein unter deutscher Herrschaft gebauter Tunnel ins Oberland. Mole wie Tunnel dienen fast ausschließlich militärischen Zwecken. Durch diesen Tunnel pflegt auch der Kaiser bei seinen Helgolandbesuchen vermittels einer Drahtseilbahn nach dem Oberland zu gelangen. Seitdem die Insel in deutschen Besitz übergegangen ist, hat man sie stärker wie unter englischer Herrschaft befestigt. Jetzt, wo der Bau des Torpedobootshafens in Angriff genommen ist, wird auch das Oberland mit Geschützen schwersten Kalibers ausgerüstet. Daß die Insel nicht durch das Schießen aus großkalibrigen Geschützen beschädigt wird, zeigen die Untersuchungen, welche mit dem hier aufgestellten Seismographen während des Schießens vorgenommen worden sind.
Verlassen wir nun die Südspitze, um an der Westseite, der längsten der drei Inselseiten, entlang nach der Nordspitze zu gelangen. Auf etwa halbem Wege steht der große Leuchtturm, der ebenso wie die in der Nähe befindliche Station für drahtlose Telegraphie, unter deutscher Herrschaft erbaut worden ist. Dieser Leuchtturm ist einer der größten seiner Art, denn das von ihm ausgehende Feuer hat eine Lichtstärke von 39 Millionen Normalkerzen. Er wird elektrisch betrieben und hat ein sich drehendes Feuer, dessen drei in einem Winkel von 120 Grad zueinander geneigte Strahlen bei günstigem Wetter 64 Kilometer weit gesichtet werden. Und doch ist diese enorme Lichtquelle bei starkem Nebel kaum 100 m sichtbar.
Auf unserer weiteren Wanderung werden wir in der Nähe der Nordspitze durch ein hundertstimmiges Geschrei auf eine Vogelart aufmerksam gemacht, die zu dieser Jahreszeit auf einem vorspringenden Felsen dem Brutgeschäfte obliegt. Es sind Lummen, welche nur auf diesem einen Felsen brüten und dabei in fortwährender Unterhaltung begriffen sind. Wie bei einem Bienenstande ist ein fortwährendes Zu- und Fortfliegen zu beobachten, wobei ein unangenehmes Geschrei ausgestoßen wird. Ende Juli, wenn das Brutgeschäft der Lummen erledigt ist, beginnt die allerdings nur zwei bis drei Tage dauernde Jagd auf diese Vögel, die sich dann sehr bald von dem Felsen entfernen, um erst wieder im Februar zum Brutgeschäft zurückzukehren. Außer diesen Lummen kommt nur noch der Sperling als Brutvogel hier vor. In den letzten Jahren haben allerdings auch einige Stare in Nistkästen gebrütet. Die erbeuteten Lummen werden von den Insulanern, besonders zur Winterszeit, wo sie sehr fett sind, gern gegessen, wie denn der Helgoländer alles, was Flügel hat, verspeist: Krähen, Möwen, selbst Eulen und Habichte. Als besondere Delikatesse gilt der Wanderfalke.
Während wir uns der Nordspitze nähern, bemerken wir, wie sich die Spazierwege mehr und mehr mit Fremden füllen, deren Ziel die Nordspitze ist, um von hier den Sonnenuntergang zu genießen. Heute tut uns allerdings die Sonne nicht den Gefallen, als feuriger Ball in die Fluten hinabzusinken, sondern sie begnügt sich damit, Himmel und Wasser in wundervolle Farben zu tauchen.
Es fängt bereits an zu dunkeln, und wir müssen an den Heimweg denken. Die sogenannte Kartoffelallee, ein die ganze Länge der Insel in ihrer Mitte durchziehender, mit roten Backsteinen gepflasterter Weg, bringt uns an das Dorf hinan. Während wir die Treppe nach dem Unterland hinabsteigen, lassen wir die Blicke noch einmal über die See, welche heute ruhig wie ein Ententeich daliegt, schweifen. Nachdem wir noch mit einem bekannten Schiffer für morgen früh eine Rundfahrt um die Insel verabredet haben und uns durch ein kräftiges Abendessen gestärkt haben, begeben wir uns zur Ruhe. Um sechs Uhr morgens befinden wir uns bereits im Boote mit zwei Helgoländer Schiffern, echten Seemannsgestalten, welche den friesischen Typ nicht verleugnen. Mein Freund versucht, etwas von ihrer Unterhaltung zu verstehen. Aber trotzdem er die plattdeutsche Sprache völlig beherrscht, ist es ihm nicht möglich, ein Wort zu verstehen, so eigentümlich ist das Helgoländer Idiom, eine Mischung aus Plattdeutsch, Englisch und Dänisch. Das Hauptinteresse bei der Rundfahrt nimmt die wild zerklüftete Westseite in Anspruch. Überall hat das Wasser tiefe Höhlen in den 56 m hohen, senkrecht aufragenden Felsen gefressen; an manchen Stellen zeigen sich große Torbogen, die mit besonderen Namen belegt sind; an anderen Stellen sind diese Tore bereits eingestürzt, und ein von der Insel getrennter Fels ragt in die Luft empor: der Mönch, der Predigerstuhl, der Hengst sind die bekanntesten. Bei dieser Rundfahrt um die Insel kann man sich auch am besten über die geologischen Verhältnisse der Felsen unterrichten: Die Grundplatte des roten Felsens besteht aus Zechstein, welcher in einzelnen Lagen schieferförmig übereinander geschichtet ist. Zwischen den einzelnen Schichten lagern 20 cm starke Schichten eines weißen, zerreiblichen Sandes. In dem Gestein finden sich Kupfersalze in kleinen Nestern und Drusen eingesprengt. Über dieser Grundplatte liegt eine Schicht von grünlich-grauem Kalksandstein von 1 m Stärke. Die Hauptmasse des Felsens besteht aus rotem Buntsandstein, der zwischen sich Lagen von grünlich-grauem Kalksandstein enthält. Im Unterschied zu der Hauptmasse des Felsens bestehen die die Insel umgebenden Felsenriffe aus Muschelkalk und Kreide.
Das Felsgestein der Insel ist Witterungseinflüssen gegenüber nur sehr wenig widerstandsfähig. Besonders an der Hochwassergrenze, da wo Luft und Wasser den Felsen gleichmäßig berührt, geht der Zerfall am schnellsten vor sich. Durch Schutzmauern, durch kostspielige Plombierungen der einzelnen Höhlen mit Beton hat man den Zerfall aufhalten wollen. Jetzt hat man sich zu einem Radikalmittel entschlossen: im kommenden Frühjahr beginnt man damit, in einer Entfernung von 50 m von der Insel an der ganzen Westseite entlang eine Granitmauer zu errichten, sodaß das Meer nicht mehr an den Felsen herankommen kann und bei Sturm der Anprall der Wogen gebrochen wird.
Doch nun wieder zurück zum Unterland, da wir noch das Aquarium besichtigen wollen. Es bildet einen Teil der auf Helgoland bestehenden biologischen Station, an welcher fast alle bedeutenden Zoologen wissenschaftliche Studien getrieben haben. Das Aquarium bietet eine Auslese der Pflanzen- und Tierwelt der Nordsee. Da sind die niedlichen Einsiedlerkrebse, welche neugierig aus ihren Muschelwohnungen herauslugen. Hier sieht man die einzelnen Entwickelungstadien des Hummers vom Ei an. Die mächtigen sieben- bis achtpfündigen Hummern im großen Bassin erregen das Interesse sämtlicher Besucher. Auffallend ist auch die Farbenpracht der unterseeischen Pflanzenwelt.
Jedoch es wird Zeit, sich zur Abreise zu rüsten, da der Dampfer bereits um ½1 Uhr geht. Noch einen Abschiedstrunk – der Salzgehalt der Seeluft ist verantwortlich für den stets vorhandenen Durst – dann geht's auf die Landungsbrücke. Fast wären wir zu spät gekommen, denn schon heißt es: letztes Boot nach Cuxhaven. Rasch entführt das Boot den Freund an den Dampfer; Tücher winken hüben und drüben. Auf Wiedersehen!
Von Ernst Fricke in Bremerhaven.
Wenn uns der Dampfer von Bremen aus stromabwärts trägt, wenn längst die Türme der alten, ehrwürdigen Hansestadt dem Auge entschwunden sind, auch der freundliche Hafenort Vegesack mit seinen Schiffswerften und gartenumgebenen Landhäusern, das waldgrüne Blumental und die Fabrikschornsteine Rönnebeks hinter uns liegen, dann tritt plötzlich das hohe und steile, in den Fluß abfallende Sandufer zur Rechten ins tiefere Land zurück; aber davor legt sich nun niedriges, toniges und üppigbegrüntes Schwemmland, das von jetzt an hüben wie drüben den Fluß einfaßt und ihn begleitet bis zu seiner Mündung.
Die reichen Marschen sind es, zwischen denen nun der Dampfer hinrauscht. Da folgen der Reihe nach am rechten Weserufer die alten Bezirke Osterstade, das Land Wührden, das Vierland und zuletzt, wo schon salzige Wogen rollen und eine echte Meerstrandflora die Ufer schmückt, das Land Wursten; am linken dagegen haben wir das Stedingerland, das Stadland und endlich Butjadingen.
Voll prächtiger Kornfelder, voll üppiger Weiden und Wiesen, belebt von Tausenden und Tausenden mächtig schwerer Rinder, reich besäet mit freundlichen Kirchtürmen, Windmühlen und großen stattlichen Bauerngehöften, vor allem aber bewohnt von einem freien, wackern Bauernvolke friesischen Stammes, dem eine ruhm- und sturmvolle Geschichte, ein vielhundertjähriges Kämpfen und Ringen für Recht und Freiheit, für Herd und Heimat, sei's mit Menschen oder Naturkräften, allmählich jenes Gepräge echten Selbstbewußtseins und echten Stolzes aufdrücken mußte, wie wir es wohl bei wenigen anderen deutschen Volksstämmen wiederfinden: so liegen sie da zu beiden Seiten, diese reichen und so vieles Interesse bietenden Marschen. Aber dennoch werden sie nur selten von Fremden besucht, selten geschildert, fast gänzlich unbekannt sind sie der großen Menge des übrigen Deutschland.
Indes wenn man auch mitten zwischen diesen gesegneten Landen den Strom hinabschwimmt, man sieht von all dem Reichen, Schönen und Stattlichen so gut wie nichts; denn viele Meilen lang zieht sich wie ein starker Festungswall der hohe Deich schützend vor ihnen her, und höchstens sieht man hier und da einige Häusergiebel, Baumkronen, eine Turmspitze oder ein Windmühlenkreuz darüber emporragen.
Die drei kleinen Hafenorte Elsfleth, Brake und Nordenham, am oldenburgischen linken Ufer gelegen, unterbrechen noch einmal die Szenerie recht angenehm, sonst fährt der Dampfer nur zwischen jenen hohen Deichen, den einzelnen grünen Inseln, den gelben Sandbänken und längs den mächtigen Rohr- und Binsenfeldern der Ufer hin.
Ist man endlich auch an der letzten Insel, der sogenannten Lunenplatte, vorübergefahren, dann erweitert sich plötzlich das Flußbild, und es ändert sich nun der ganze Naturcharakter; man merkt, der Strom schickt sich an, sich dem alten Ozean in die Arme zu stürzen. Eine frischere Luft weht uns entgegen, mächtiger und in langgezogenen Linien rollen die grauen, schaumgekrönten Wogen; die weiße Möwe, die zierliche, langbeschwingte Seeschwalbe bevölkern die Luft oft in ungeheuren Scharen, hier und da tauchen aus den Fluten seltsame schwärzliche Körper, fast wie eine Tonne anzusehen, und sinken schnell wieder unter. Es sind Delphine, oder wie sie hier genannt werden, Tummler; selbst der runde Kopf eines Seehundes schaut wohl einzeln aus dem Wogenschaum, und noch manch andere Erscheinung läßt die Nähe des Meeres ahnen.
Vor allem aber fesselt uns das Bild, welches sich auf dem rechten Ufer ausbreitet. Eine Menge roter Ziegeldächer leuchtet uns von dort entgegen, Türme steigen auf, ein paar Molos greifen in den Strom und endlich – ein wahrer Mastenwald bildet den bedeutsamen Mittelpunkt des reichen Bildes.
Der neu aufgeblühte Ort Geestemünde und die jüngste Seestadt Deutschlands, Bremerhaven, liegen vor unseren Blicken, und nun lenkt in wenigen Minuten der Dampfer in die Geeste ein, jenes Binnenflüßchen, dessen Mündung die beiden Orte voneinander trennt. Wir sind am Ziel unserer Fahrt.
Geestemünde, gerade im äußersten Winkel gebaut, den der Zusammenfluß der Weser und Geeste bildet, hat eine für Handel und Schiffahrt ausgezeichnet treffliche Lage. Dennoch wollte der Ort anfangs nicht so recht aufblühen. Zwar hatte schon länger die hannoversche Regierung das Ufer der Geeste durch ein tüchtiges Bollwerk zum Anlegen der Seeschiffe in einen Kai verwandelt und Geestemünde zu einem Freihafen erklärt; indes nur sehr wenige Schiffe löschten und überwinterten hier, denn Kapitäne und Reeder fürchteten mit Recht diesen noch allen Sturmfluten und Eisgängen ausgesetzten Ankerplatz. Erst mit der Anlage eines gegen alle Fluten gesicherten Hafenbeckens und der aus dem Binnenlande herabführenden Eisenbahn hob sich Geestemünde, und in kurzer Zeit entstanden die stattlichsten Gebäude neben den kleinen einstöckigen Giebelhäusern.
Ungleich rühriger und lebhafter ist jedoch der Nachbar drüben – Bremerhaven. Kaum haben wir die stattliche Drehbrücke, die über die Geeste führt, überschritten, als auch schon das ganze rege und bunte Treiben und Lärmen einer echten Seestadt uns entgegenwogt. Alles rund um uns her arbeitet, schleppt und rennt in geschäftiger Eile durcheinander; die nahen Schiffswerften und Trockendocks hallen und dröhnen früh bis spät von fortwährendem Sägen, Lärmen und lautem hundertfachem Hammergepoch, während vom Hafen her aus dem Dickicht der Masten und Taue buntes Flaggengeflatter leuchtet und das »Ho i ho« und der eigentümlich melancholisch klingende Gesang arbeitender Matrosen zu uns herüberschallt.
Bremerhaven ist der Mittelpunkt und unstreitig die bedeutendste der Ortschaften, welche zusammen die preußisch-bremische Niederlassung an der Geeste bilden und in ihrem Äußeren den Eindruck einer einzigen ungeteilten Stadt machen. Außer ihm gehören dazu die Stadt Geestemünde und der Flecken Lehe. Die Einwohnerschaft dieser drei Orte beläuft sich jetzt auf rund 95 000. Lehe und das seit 1. April 1889 mit Geestemünde vereinigte Geestendorf sind alte Ansiedlungen, während Geestemünde und Bremerhaven zu den jüngsten Städtegründungen Deutschlands zählen.
Das kleine Fleckchen Erde, auf dem Bremerhaven entstanden ist, hat eine von der Natur außerordentlich begünstigte Lage, die nicht allein dem Handel und der Schiffahrt Vorteile bietet, sondern auch für die in der Weser liegenden und erst in der neuesten Zeit entstandenen Befestigungswerke von der größten militärischen Bedeutung ist. Schon unter schwedischer Herrschaft hatte der Platz, wo die Geeste in die Weser einmündet, die Aufmerksamkeit der damaligen Regierung auf sich gezogen. Karl XI. ließ daher im Jahre 1673 auf dem rechten Mündungswinkel eine kleine Festung, die Karlsburg, anlegen. Hinter ihr sollte unter dem Schutze ihrer Kanonen eine Handelsstadt erstehen, für die der Name »Karlsstadt« bestimmt war. Schon waren mehrere Häuser errichtet, als Burg und Stadt nach einer vierteljährigen Belagerung durch die vereinigte brandenburgisch-holländische Flotte sich ergeben mußten und teilweise zerstört wurden. Die Weihnachtsflut des Jahres 1717 vollendete das Zerstörungswerk und spülte die letzten Häuser und Wälle vollends hinweg, sodaß die Stelle, wo sich früher die Karlsburg erhob, nur noch durch eine geringe Erderhöhung zu erkennen war. Für ein ganzes Jahrhundert hindurch fiel alles der völligsten Verlassenheit und Vergessenheit anheim, bis im Jahre 1827 der Gedanke des Bremer Bürgermeisters Johann Smidt, dem damals sehr bedrohten Handel seiner Vaterstadt einen neuen Aufschwung zu geben, seiner Verwirklichung entgegenging. Die stetig fortschreitende Versandung der Weser und die von Jahr zu Jahr größer gebauten und tiefer gehenden Schiffe machten es unmöglich, auf bremischem Gebiete ferner zu löschen; die Anlage eines Hafens an der Mündung des Flusses wurde daher zu einer zwingenden Notwendigkeit. Trotz aller Schwierigkeiten, die sich dem Unternehmen entgegenstellten, gelang es endlich den langjährigen und unablässigen Bemühungen Smidts, von der hannöverschen Regierung für Bremen ein Gebiet an den Ufern der Geeste und Weser käuflich zu erwerben. Am 1. Mai 1827 wurde auf diesem neu erworbenen Boden zum ersten Male die bremische Flagge gehißt und zwei Monate später die Herstellung des Hafens unter Leitung holländischer Ingenieure in Angriff genommen. Von allen Seiten strömten Unternehmungslustige herbei; der neue Hafenort blühte ungemein schnell empor, und wenige Jahre später standen bereits ganze Straßen. 1853 wurde Bremerhaven zur Stadt erhoben und hat seitdem auch in seinem äußeren Gepräge nach und nach den Charakter einer solchen angenommen.
Der Fremde, der Bremerhaven besucht, muß von Erstaunen und Verwunderung erfüllt werden, wenn ihm gesagt wird, daß auf einem Platze, wo sich noch vor 80 Jahren sumpfige Wiesen ausdehnten und über den zur Flutzeit die Wasserwogen hinwegspülten, heute ein blühender, von Jahr zu Jahr mehr aufstrebender Handelsort entstanden ist, der 26 000 Einwohner zählt. Wie alle neuen Städte, ist auch Bremerhaven regelmäßig angelegt und wird von breiten, vortrefflich gepflasterten und sehr sauber gehaltenen Straßen durchschnitten. Da infolge der schnellen Entwickelung der Stadt der Grund und Boden einen fast unverhältnismäßig hohen Wert erreicht hat, so wird auch das kleinste Stückchen Erde möglichst ausgenutzt. Abgesehen von dem Kirchenplatze, auf dem sich die schöne Kirche der vereinigten evangelischen Gemeinde erhebt, hat der Ort nur einen größeren freien Platz, den Markt. Dieser liegt im südlichen Teile der Stadt und ist vollständig mit gußeisernen Pflastersteinen gepflastert. Unter sämtlichen Straßen zieht sich ein Kanalnetz hin, durch das die bei der niedrigen Lage Bremerhavens ohne Maschinenkraft schwerlich mögliche Entwässerung der Stadt in der denkbar wünschenswertesten Weise erreicht wird, und zwar durch ein sinnreiches System, das auf der Ausnutzung von Ebbe und Flut beruht. Das bei Hochwasser durch die geöffneten Schleusentüren in die Häfen eindringende Wasser wird dort nach Schließung derselben gehalten. Sobald nun die Ebbe eingetreten und der Wasserspiegel der Weser sich wieder gesenkt hat, wird der entstandene Niveauunterschied benutzt, um die Kanäle zu durchspülen. Die Spülung erfolgt nach dem ostwärts der Stadt fließenden Geestefluß zu.
Die Versorgung mit gutem und gesundem Trinkwasser, die anfangs der höchst ungünstigen Bodenverhältnisse wegen außerordentlich schwierig und mangelhaft war, wird seit 1885 durch das neue städtische Wasserwerk bewirkt. Es entnimmt das Wasser aus einem Terrain, welches mehr als 8 km in nördlicher Richtung von Bremerhaven gelegen ist.
Die kleinen, einstöckigen Häuser, aus welchen zuerst der ganze Ort bestand, sind bis auf wenige völlig verschwunden und haben hohen, stattlichen Gebäuden, von denen mehrere architektonischen Wert haben, Platz gemacht. Unter diesen verdienen die drei Kirchen, das frühere Auswandererhaus, die verschiedenen Schulgebäude, das Stadthaus, die Krankenhäuser, das Seemannsheim, das Gerichtsgebäude, das Hauptzollamtsgebäude, das Agenturgebäude des Norddeutschen Lloyds sowie mehrere Privathäuser besondere Aufmerksamkeit. Allerdings finden sich in den Nebenstraßen auch noch gar manche nüchterne, geradezu geschmacklose Bauten, welche die verschiedensten Bauformen in unsinnigster Zusammenstellung in sich vereinigen. Doch diese Erscheinung wird sich überall da zeigen, wo neue Städte gleichsam über Nacht aus der Erde emporwachsen, nur dem nächsten Bedürfnis Rechnung getragen und einem schnell zunehmenden Wohlstande Ausdruck gegeben wird. Das Aufführen größerer Bauwerke verursacht bei den Bodenverhältnissen große Schwierigkeiten und bedeutende Kosten, da eine feste Grundlage erst durch Einrammen und Legen von Rosten bereitet werden muß und auch von allen Seiten her beständig Wasser durchsickert. So ist z. B. die Gründung für die Hauptkirche durch Pfähle, welche 16 m tief in den Boden eingetrieben sind, hergestellt worden. Die Stadt dehnt sich namentlich nach Norden zu aus. Die Chaussee, welche zur Zeit der Gründung Bremerhavens in nördlicher Richtung nach dem eine halbe Stunde entfernten Flecken Lehe führte, ist im Laufe der Jahre gänzlich bebaut worden, sodaß beide Orte vollständig zusammenhängen und der Fremde nicht weiß, wo die Grenze zwischen beiden zu ziehen ist, wenn er nicht auf den viereckigen Pflasterstein mitten im Straßenzuge, der sie bezeichnet, aufmerksam gemacht wird. Enge Straßen mit den dunklen, ungesunden Wohnungen älterer Städte gibt es in dem jungen Bremerhaven natürlich nicht. Die Hauptstraße (Bürgermeister Smidtstraße), welche sich von Süden nach Norden in einer Länge von mehr als einem Kilometer hinzieht, würde mit ihren durchweg schönen und stattlichen Häusern der Stolz jeder Großstadt sein. Sämtliche Erdgeschoßräume der Häuser sind zu Läden verwandt, in deren großen Schaufenstern alle Herrlichkeiten der Stadt ausliegen und den Vorüberwandelnden zum Kauf einladen. Die Schaufenster in den Nebenstraßen erinnern den Fremden sogleich daran, daß er sich in einer Hafenstadt befindet. In echt amerikanischer Weise wird hier alles feilgeboten, was der Seefahrer zu seiner Ausrüstung bedarf: Kleidung, Schuhzeug, Wäsche, Pfeifen, Tabak, Zigarren, Messer, Gabeln, Löffel, Musikinstrumente, die verschiedensten Eßwaren, Getränke und andere Sachen. Alles ist in ein und demselben Schaufenster oft in wirrem und geschmacklosestem Durcheinander aufgestapelt. Zwischen diesen Läden haben zahlreiche Speditions- und Geldwechslergeschäfte ihre Kontore eingerichtet, und Schlaf- und Heuerbase halten ihre Räume den Schiffern geöffnet. Schilder in den verschiedensten Größen und auffallendsten Farben bedecken die Häuser und tragen außer den deutschen fast durchgängig englische sowie auch schwedische, holländische, spanische und italienische Aufschriften.
Obwohl zuzeiten sich gegen tausend Fremde und Seeleute in der Stadt aufhalten, die fast sämtlich bestrebt sind, sich nach Möglichkeit zu vergnügen, so herrscht doch im großen und ganzen tagsüber wie auch nachts anständige Ruhe und musterhafteste Ordnung. Der Matrose gibt sich oft wirkliche Mühe, sein während einer langen Seereise sauer verdientes Geld in wenigen Tagen durchzubringen, und durchzieht dann taumelnd und singend die Straßen; aber er ist dabei ein harmloser und gutmütiger Mensch, der etwaigen Anordnungen der Polizei willigen Gehorsam leistet. Auf der Seereise ist er nach seiner harten und gefahrvollen Arbeit ausschließlich auf den Verkehr und die Unterhaltung mit seinesgleichen angewiesen, hat sich nur in seltenen Fällen eines eigenen Familienglückes zu erfreuen, und es ist daher wahrhaft rührend zu beobachten, in welch liebevoller, zutraulicher und zarter Weise er sich an Land mit Kindern zu schaffen macht und sie durch Geschenke aller Art zu erfreuen sucht. Ausnahmen kommen natürlich auch hier vor; aber es sind dann meistens nichtdeutsche Matrosen, welche sich Ausschreitungen roher Art zuschulden kommen lassen.
Eine herrliche und bemerkenswerte Zierde besitzt Bremerhaven neben dem Krieger-, Kaiser-Wilhelm- und Jahndenkmale in dem von Werner Stein entworfenen und ausgeführten Smidtdenkmale, das auf dem Marktplatze errichtet und dem Andenken des Bürgermeisters Smidt, des Gründers von Bremerhaven, gewidmet ist. Es besteht in dem Standbilde Smidts und zwei Figurengruppen am Sockel, von denen die eine – ein Schiffer mit einem seinen Erzählungen lauschenden Knaben – die Schiffahrt, die andere – ein Kaufmann, dem ein Negerknabe die Erzeugnisse ferner Länder darbietet – den Handel versinnbildlicht.
Der Handel der jungen Stadt erstreckt sich vorzugsweise auf Spedition, Baumwolle, Petroleum, Korn, Fettwaren, Seefische, Holz und Zement. Ein bedeutender Anteil an dem Aufschwunge des Waren- und Personenverkehrs während der letzten 50 Jahre muß unbestritten dem Norddeutschen Lloyd zugeschrieben werden. Dieses großartige Unternehmen wurde im Jahre 1857 unter der Leitung des umsichtigen und weitschauenden Bremer Kaufherrn H. H. Meyer gegründet und hat sich im Laufe der Zeit die erste Stelle unter den deutschen Schiffahrtsanstalten, wenn nicht sogar die erste Stelle unter denen der ganzen Welt zu erringen gewußt. Heute führen die Kontorflagge des Norddeutschen Lloyds außer 2 Schulschiffen nicht weniger als 156 große atlantische und 20 kleinere Dampfer, welch letztere den Verkehr auf der Unterweser und nach den Nordsee-Inseln vermitteln, ebenso eine Anzahl Schleppdampfer und über 200 Schleppkähne. Nach allen Erdteilen hin werden durch seine vorzüglichen und schnellen Dampfer Verbindungen unterhalten. – Unter den gewerblichen Anlagen dienen die größten dem Schiffsbau und der Schiffsausrüstung. Die bemerkenswertesten sind neben den Seebeckschen Dockanlagen und Werkstätten die des Norddeutschen Lloyds, welche sich an der Westseite des Neuen Hafens ausdehnen und in denen mehr als 2000 Arbeiter beschäftigt werden. Von besonderem Interesse ist das Trockendock. Dasselbe ist derart eingerichtet, daß darin zwei der größten Dampfer zu gleicher Zeit »docken« können. Da diese Anlage aber für den Tiefgang der neuen Dampfer nicht mehr genügte, so wurde im Jahre 1888 mit großem Kostenaufwande ein Pumpwerk hergestellt, mit dessen Hilfe man für den Fall, daß die Flut nicht hoch genug aufläuft, den Wasserspiegel des Docks, sowie den des Hafens zu steigern vermag, und zwar um 0,3 m in einer Stunde. – Die niedrigen, langen Petroleum-Lagerschuppen mit ihren weißen Dächern, welche früher ein weites Terrain an der Nordseite der Stadt bedeckten, sind sämtlich niedergerissen und durch neue Tankanlagen ersetzt worden. Das von Amerika und Rußland eingeführte Petroleum wird nicht mehr in Fässern, sondern mittels sogenannter Tankdampfer befördert. Diese haben riesige eiserne Behälter, in welche das Petroleum unmittelbar eingefüllt und aus denen es nach der Ankunft in Bremerhaven durch lange Röhrenleitungen in die großen Tanks übergepumpt wird. Aus diesen wieder wird es in die Zisternen-Eisenbahnwagen oder auch in Fässer geführt und so der Eisenbahn zur Weiterbeförderung übergeben. Die weiten Schuppen und Hallen an der Westseite des Alten Hafens gehören der Stadt Bremerhaven und dienen dem stetig zunehmenden Handel mit Seefischen. Zahlreiche Fischdampfer liefern täglich ihre Fänge hier ab, wo sie sogleich versteigert und wohl in Eis verpackt der Eisenbahn zur schleunigen Beförderung in das Binnenland übergeben werden.
Das Sehenswerteste und Interessanteste Bremerhavens für den Binnenländer sind jedoch die ausgezeichneten Hafenanlagen, die sich parallel mit der Stadt zwischen dieser und der Weser in einer Länge von etwa 4½ km ausdehnen. Sie haben im Laufe der Entwickelung mannigfache Veränderungen erfahren und bestehen aus drei großen Hafenbassins, dem Alten Hafen, dem Neuen Hafen und dem Kaiserhafen. Die beiden ersteren sind durch einen Fahrweg getrennt, während die letzteren durch eine Verbindungsschleuse, über welche zwei Drehbrücken führen, eine für den Fuß- und Fahrverkehr und die andere für die Eisenbahn, miteinander verbunden sind. Ungeheure Geldsummen hatte der kleine Bremer Staat auf die Herstellung dieser Anlagen verwenden müssen; aber trotzdem genügten sie den sich fortwährend steigernden Bedürfnissen nicht, da sich die Bauart der Dampfschiffe derart entwickelt hatte, daß die vorhandenen Bassins nicht mehr ausreichten und eine Erweiterung und namentlich Vertiefung unabweislich erheischten. Daher ging man im Jahre 1892 an eine bedeutende Erweiterung des Kaiserhafens, deren völlige Fertigstellung einschließlich eines Trockendocks, des größten auf dem Kontinente, erst gegen Ende des vorigen Jahrhunderts erfolgte. Doch alsbald stellte es sich heraus, daß auch diese neuen Anlagen keineswegs den sich von Jahr zu Jahr steigernden Bedürfnissen der Schiffahrt genügten. Es kam nicht selten vor, besonders zu den Zeiten der Baumwolleinfuhr, daß die einlaufenden Schiffe nicht sogleich den erforderlichen Raum am Kai zum »Löschen« erhalten konnten, sondern oft mehrere Tage warten mußten, bis andere ihnen Platz gemacht hatten. Bremen sah sich deshalb genötigt, den Kaiserhafen nochmals nach Norden zu erweitern. Da jedoch das dazu erforderliche Terrain nicht vorhanden war, so erwarb der Staat nach langen Verhandlungen von Preußen ein Gebiet in der Größe von 516 ha. Diese neuesten Hafenbauten, die im Jahre 1906 begonnen wurden, werden erst im Jahre 1918 vollendet sein und zusammen mit der Herstellung eines zweiten Riesendocks von 260 m Länge die ungeheure Summe von 40 Millionen Mark verschlingen. Gewiß ein sprechender Beweis für den Unternehmungsgeist der Bürger und den mehr und mehr aufblühenden Handel der alten Hansastadt Bremen und ihrer Tochterstadt Bremerhaven. – Bevor jedoch die einkommenden Schiffe in die Häfen gelangen, müssen sie die Vorhäfen durchfahren. Diese sind nach Süden zu gebogen und durch starke, etwa 3 m dicke Mauern eingefaßt. Mit den in den Strom vordringenden Molos, die auf ihrer Spitze weitleuchtende Laternen tragen, dienen sie dazu, bei stürmischem Wetter die von der Seeseite heranrollenden Wogen abzuhalten und so das Ein- und Auslaufen der Schiffe zu sichern. Vorhäfen und Häfen sind durch Schleusen getrennt, welche aus zwei Paar mächtigen Toren, einem Flut- und einem Ebbetor, bestehen. Sie sind in Schmiedeeisen hergestellt und im Innern hohl, sodaß ihr Gewicht durch die innen eingeschlossene Luft fast völlig getragen wird und sie sich in ihren Angeln mit größter Leichtigkeit bewegen lassen. Auf der Nordmole des Neuen Hafens erhebt sich ein hoher, in gotischen Formen erbauter Leuchtturm, der mit seinen der See zugekehrten Lichtern den Schiffern den Weg weisen soll.
Gehen wir nun einmal die Häfen entlang und beobachten hier das Leben und Treiben. Schiff reiht sich an Schiff, und ein wahrer »Wald von Masten« mit tausendfach sich kreuzenden Raaen, Wanten und Tauen dehnt sich vor dem erstaunten Auge aus. In langen Reihen und in schönster Ordnung liegen die Schiffe, von deren Mastspitzen die Wimpel und Flaggen aus aller Herren Ländern lustig im Winde flattern, an Pfählen und an starken, in die Kaimauern eingelassenen eisernen Ringen wohl »vertäut« da, verschieden an Gestalt und Farbe, Größe und Bauart. Vor allen anderen erregen unsere Aufmerksamkeit die überaus sauber und stets in bester Farbe gehaltenen Bremer Schiffe, besonders aber die prächtigen Schnelldampfer des Norddeutschen Lloyd. Letztere haben durchweg eine Länge von 130-226 m und sind mit jeder nur erdenklichen Pracht und Bequemlichkeit im Innern ausgestattet, sodaß sie in dieser Beziehung auch den Ansprüchen der verwöhntesten Menschen genügen. Laute und Mundarten der verschiedensten Völker des Weltalls dringen an unser Ohr; dazwischen erklingt der einförmige und melancholische Gesang der auf dem Deck und in den Wanten und Raaen arbeitenden Matrosen; Ruf und Gegenruf erschallt mit lauter Stimme; Dampfpfeifen ertönen, und Krane rasseln. Überall herrscht eine sich nie erschöpfende Tätigkeit, ein fortwährendes Kommen und Gehen, Hin- und Hereilen, ein ununterbrochenes Hasten und Treiben, denn das englische »time is money« gilt auch hier. Da werden Schiffe mit einheimischen Produkten befrachtet; dort werden andere mit Hilfe der gewaltigen Dampfkräne ihrer kostbaren Ladung entledigt. Was der Erdball dem Menschen an Schätzen darbietet, das liegt und steht in den großen Lagerschuppen und Speichern in Fässern, Kisten, Körben und Ballen aufgestapelt; ja, sogar auf den Straßen und Plätzen lagern unter freiem Himmel oft Waren, deren Wert sich auf Millionen beziffert, und harren der Weiterbeförderung durch die Eisenbahn oder die kleinen Flußschiffe. Man wird nicht müde, tagelang an den Häfen zu weilen, denn immer wieder und wieder wird das Auge durch etwas Neues gefesselt.
Es ist bald Hafenzeit, d. h. wenige Stunden vor Hochwasser. Einer der großen Passagierdampfer des Norddeutschen Lloyd liegt »segelfertig« da und trifft die letzten Zurüstungen zur Fahrt über den weiten Ozean. Hunderte von Händen regen sich emsig und geschäftig, um die letzten Güter an Bord zu bringen; aber die Passagiere fehlen noch. Doch da fährt schon der Extrazug, der sie von Bremen herbeiführt, auf dem Bahnsteig vor. Eilig entsteigen die Reisenden, zum größten Teile Auswanderer aus Deutschland, Österreich-Ungarn, Rußland, Schweden und Norwegen, mit den verschiedensten Gepäckstücken, wie Koffern, wollenen Decken und allerlei Blechgeschirr beladen, den geöffneten Wagentüren, um sich sofort auf den Dampfer zu begeben. Die meisten von ihnen erblicken jetzt mit Staunen und Zagen zum ersten Male ein Seeschiff, das bestimmt ist, sie über die Wogen des Weltmeeres zu führen, entgegen einer neuen Heimat, einer ungewissen und zweifelhaften Zukunft. Drängend, stoßend und lärmend steigen sie die Schiffsbrücke hinauf, um alsbald in dem Riesenleibe des Schiffes zu verschwinden, hier ihr Gepäck unterzubringen und ihre engen Lagerstätten aufzusuchen. Man kann sich leicht eine Vorstellung von dem eigenartigen Leben und Treiben auf solchen Auswandererdampfern machen, wenn man bedenkt, daß manche von ihnen 1500, ja bis 3000 Menschen aufzunehmen vermögen. Dem aufmerksamen Beobachter, welcher den Auswanderern auf das Schiff folgt, werden bald einige als schlichte Bürger gekleidete und sich harmlos benehmende Herren auffallen, die sich besonders den jüngeren Männern im Alter von 17 bis 23 Jahren nähern und diese zum Vorweisen ihrer Legitimationspapiere veranlassen. Es sind Geheimpolizisten, und ihre Aufgabe ist, jeden, der sich durch Auswanderung dem Militärdienste entziehen möchte und sich schon in Sicherheit wähnt, anzuhalten und ihn von den eben erst betretenen Schiffsplanken auf den vaterländischen Boden zurückzuführen. Da spielen sich denn gar oft erschütternde Familienszenen ab. Eltern und Geschwister des Flüchtlings bitten, flehen, weinen und machen Versprechungen, um den Beamten seiner Pflicht abwendig zu machen; aber alles ist vergeblich. Jetzt ertönt die Schiffsglocke, das Zeichen, daß das Schiff »klar« ist. Die Arbeiter und alle, die nicht mitfahren wollen, verlassen schnell den Dampfer; die Schiffsbrücken werden aufgezogen; Ketten und Taue werden gelöst und »übergeholt«; dann ein mehrmaliges Ertönen der Dampfpfeife, dumpfes Ächzen und Stöhnen der Maschine, einige Umdrehungen der gewaltigen Schrauben, und der Meereskoloß setzt sich langsam in drehender Bewegung in Fahrt und verläßt unter Führung des Lotsen durch die geöffneten Schleusen den sicheren Hafen. Kommandorufe erschallen; die Schiffskapelle läßt Abschiedsweisen erklingen; Freunde und Angehörige rufen den Scheidenden die letzten Grüße und »glückliche Fahrt!« zu; hier lautes Jauchzen und Singen, dort bitteres Schluchzen und Weinen. Sobald der Dampfer die Weser erreicht hat, verläßt ihn der Lotse, und unter dem Kommando »vull Spriet!« fährt das mächtige Schiff stolz und majestätisch dem Meere zu und ist in kurzer Zeit unsern Blicken in nebelgrauer Ferne entschwunden.
Auf dem linken Ufer der Unterelbe zwischen Harburg und Stade dehnt sich eine mit dem Meeresspiegel fast in gleicher Höhe gelegene, vollkommen ebene Fläche aus, ohne Quellen und Wälder, ohne Sandstrecken und jegliches Steinchen: es ist die Marsch, und zwar das alte Land, eine einzige weite, grüne, fruchtbare, fast waldbaumlose Ebene. Die fette, dunkle Humusschicht ist ein Geschenk des Elbstroms, der, ermattend in seinem kaum geneigten Bette, die ihm beigemengten Schlammteilchen, seine letzte Fracht, seit alters hier niedersetzt, weil in den Übergangszeiten zwischen Ebbe und Flut (den sogenannten Stauzeiten) die tragende Kraft des Stromes vollständig aufgehoben wird. Es mag übrigens auch durch chemische Ausscheidung, herbeigeführt durch Vermischung von Süß- und Salzflut, sowie durch das Absterben kiesel- und kalkgepanzerter Infusorien im Brackwasser eine wesentliche Vermehrung der Niederschläge, des Bodensatzes herbeigeführt werden. Aus diesen Vorgängen aber erklärt sich die Höhe, die Schichtung in den feinsten schiefrigen Blättchen und die rein erdige Beschaffenheit des Marschbodens. Ein wildwachsender, ein Waldbaum gehört hier zu den größten Seltenheiten; die Gehöfte beschattend und die Wege besäumend, finden wir nur den Fruchtbaum. Daß von diesem köstlichen Boden jegliches Winkelchen ausgenutzt wird, darf uns nicht wundern; da reiht sich Wiese an Wiese, Acker an Acker; nach der Schnur gezogene Gräben, Kanäle und Wege teilen die üppige, mit Dörfern und Höfen übersäte Landschaft; ein riesenhoher Damm bezeichnet am Horizonte die Grenze der Marsch gegen den Strom hin; er ist Schutz- und Trutzwall, er ist dem Marschbewohner Berg und Burg, er ist die Lebensfrage der hinter ihm wohnenden Siedler.
In einer Höhe von 5-10 m begleitet er die Flußufer, gegen die Mündung des Stromes hin seine Stärke verdoppelnd, nach innen zu steil, nach außen hin sanft geböscht. Die Böschungen sind in der Regel mit einem filzartigen Rasen bekleidet, der den Erdwall sowohl gegen die gierige Flut als auch gegen die Abbröckelung zur Zeit der Dürre schützt; kein Mausloch, kein Maulwurfshaufen darf die Rasennarbe verunzieren; denn auch derartige kleine Unebenheiten können der Flut Angriffspunkte darbieten. Ist die Rasendecke, die zugleich gute Viehweide gibt, bei heftigem Wogendrang abgeschürft, so wird durch jährliches »Besticken« oder »Benähen« eine dauerhaftere Bekleidung geschaffen: man breitet langes Schilf oder Stroh auf der schadhaften Stelle der Böschung aus und heftet dasselbe durch querüber gelegte Strohreifen, die man vermittelst der Deichnadel in kurzen Zwischenräumen fußtief in die Erde drückt, fest an den Boden. Falls auch diese Mattenverkleidung noch nicht zum gewünschten Ziele führt, wird die Böschung mit Granit- und Sandsteinquadern oder sehr hart gebrannten Ziegeln (holländischen Klinkern) belegt, denen man durch Zement die nötige Verbindung gibt.
Eine Wanderung auf der Kappe (dem 2-4 m breiten, etwas erhabenen Rücken) des Deiches zeigt uns überraschende Gegensätze: auf der einen Seite die neuesten Anschwemmungen des Meeres mit Binsen, nickendem Schilf, leckender Flut, brausenden Wellen, kreischenden Möwen, und in der Ferne geblähte Segel und rauchende Schlote; und auf der anderen eine große, gesegnete Ebene, übersät mit schattigen Dörfern, ragenden Turmspitzen, mit wogenden Saatfeldern und im Grase sich streckenden Rinderherden, mit Wagengerassel, mit blinkenden Sensen, mit Taubenschwärmen und Lerchengetriller. Unter dem Deiche hinweg sind Stollen geführt, die entweder mit Balken oder Sandstein ausgekleidet sind. Diese Stollen, auch Schleusen oder Siele genannt, sollen das Wasser aus den Gräben und Kanälen der Marsch ins Meer führen, aber auch die Verbindung mit dem Meere für die Bewohner des Marschgebietes offen halten. An jedem dieser Siele sind Tore angebracht, die sich nur nach außen öffnen, also durch das ausmündende Wasser aufgestoßen, durch die andrängende Flut aber geschlossen werden.
Die eigenartigste der Marschen ist das alte Land, eigenartig durch das Aussehen und die Benutzung des Bodens, durch die Bauart der Häuser, durch die Sitten, die Tracht und den Gesichtsschnitt seiner Bewohner. Während im allgemeinen die Marsch nichts besitzt, was den Horizont beengen könnte, so ist im alten Lande ein freier Ausblick vom Deiche aus ein Ding der Unmöglichkeit, da ein Wald von Obstbäumen die ganze Marsch bedeckt; nicht bloß die Gärten hinter dem Hause, sondern auch die Wege, die Ränder der Äcker, die Höfe und die Deiche der kleinen Binnenflüsse sind besetzt mit Kirschen-, Äpfel- und Zwetschenbäumen, zwischen denen hier und da auch ein Riese von einem Walnußbaum aufragt. Die Baumblüte hüllt die ganze Landschaft in einen weißen oder rotangehauchten Schleier, in welchem Legionen summender und schwirrender Insekten Nektar aus den Blütenkelchen trinken, und wenn zur Zeit der Obstreife die Kirschbäume unter der Last von Tausenden rubinroter Früchte sich neigen, die rotbackigen Äpfel wie gemalt aus dem grünen Laube hervorschauen, die violetten, mit zartem Schmelz überhauchten Zwetschen uns verführerisch anblicken, während in ihrem Schatten Ährenfelder wogen und wohlgenährte Rinder dem Geschäfte des Wiederkäuens obliegen, da faßt uns Erstaunen über die Freigebigkeit, mit welcher die Natur über diese Gegend ihr Füllhorn ausgeschüttet. Der gute Boden, die Milde des Klimas – stehen doch die Deiche wie Windfänge vor der Marsch – machen die Obstzucht neben der Schiffahrt zur Hauptnahrungsquelle der Altländer. Im ganzen sind etwa 3000 ha, das ist ein Drittel der gesamten Kulturfläche des alten Landes, mit Obst bepflanzt. Der Hektar Obststand hat einen Wert von 4500 bis 12 000 Mark, je nach dem Alter der Bäume. Ein mittelgroßer Hof erntet etwa 400 Zentner Kirschen, 400 Zentner Äpfel, 150 Zentner Zwetschen und Pflaumen, 100 Zentner Birnen. Während der Hektar Weizenboden zu 420 Mark Ertrag geschätzt wird, rechnet man bei Obstpflanzung auf 1300 Mark. So lebt hier manchmal eine Familie von wenigen Bäumen auf ½ ha Landes. Hier ist die nördlichste Stelle eines großzügigen Obstbaues. Schwerlich wird viel an 1¼ Million Bäume fehlen. So erblickt man überall zwischen den Bäumen die »Appelschur« und auf dem Flusse die strohgepolsterten Ewer und Kähne. Doch ist der Obstbau einem Lotteriespiel vergleichbar, da nicht nur der Ertrag wechselt, sondern auch die Preise um das Zehnfache abweichen. Um diese Schwankungen nicht noch zu erhöhen, verzichten die Altländer darauf, besonders feines, aber leicht verderbliches Obst zu bauen, sondern suchen möglichst haltbare Dauerware zu erzielen. Da sie in obstarmen Jahren zukaufen mußten, so wurden sie allmählich zu Obstgroßhändlern. Der beste Abnehmer ist noch immer England, das namentlich Altländer Zwetschen und Pflaumen, als Marmelade verarbeitet, in seine Kolonien ausführt. Doch geht bei dem neuerlichen scharfen Wettbewerb des Auslandes der auswärtige Handel des alten Landes zurück. Dagegen wird der inländische immer wichtiger. – Der ärgste Feind des Altländers sind die Vögel, namentlich die Stare, und wie sonst etwa für getötete Kreuzottern, zahlt die Ortskasse für Starköpfe ein Entgelt. Daher fehlt hier der fröhliche Vogelsang. In der Reifezeit ist der Kampf am heftigsten. Dann kommen die Stare aus dem Holsteinischen zu Tausenden herüber, bergen sich nachts im Schilfufer, um sich im frühesten Morgengrauen auf die süße Kirschfrucht zu stürzen. Wer etwa um diese Zeit den Elbdeich entlang geht, der sieht an jedem Baum eine Vogelscheuche neben der andern, immer seltsamer und grotesker, mit drohend emporgehobenem Arm, ein ganz merkwürdiger Anblick. Überall ertönt das Rasseln der Klapper, der dumpfe Ton der Trommel, dazwischen das ängstliche Flattern der gescheuchten Vögel und entfernte Flintenschüsse, wie von feindlichen Vorposten. Gesungen wird hier bei der Obstlese nicht, wie etwa am Rhein bei der Weinlese. Die Frucht ist nicht kostbar genug, daß es Zweck hätte, wie dort durch Singen die Pflücker am Verzehren der wertvollen Kreszenz zu hindern.
An den mit Obstbäumen besetzten Wegen ziehen sich in langen Zeilen die bunten Häuser hin, sodaß man stundenlang zwischen den menschlichen Wohnungen hinwandert, ohne den Übergang eines Dorfes ins andere zu merken. Daß der Altländer von den friesischen Bewohnern der benachbarten Marschgebiete wesentlich verschieden ist, das zeigt uns zunächst seine Wohnung; im Gegensatz zu den friesischen und niedersächsischen Häusern liegen bei ihm das große, doppelflügelige Tor zum Einfahren des Kornes, die Dreschdiele oder Tenne, sowie die Stallungen nach dem Hofe zu, an der Straße dagegen befinden sich die Wohnräume. Massive Mauern sucht man vergebens; die Hauswände haben zur Grundlage weiß oder hellgrün gestrichenes Fachwerk, dessen einzelne Felder mit künstlichem Gemäuer ausgefüllt sind; in diesem Fach sind ineinander geschachtelte Quadrate, in jenem Rauten oder Zickzackfiguren, auch Kreuze, Dreiecke oder eine Windmühle zu sehen. Man meint, vor Mosaikarbeit zu stehen. Im Erdgeschoß bildet die große, hellgrüne Türe mit dem Prachtfenster darüber das Hauptstück; das Fenster zeigt in der Mitte auf blauem Grunde den goldenen Namen des Besitzers, umrankt von künstlerisch geschnitzten Arabesken, die durch ihre reiche Vergoldung sowie durch die verschiedenen grünen, roten, blauen, weißen Farbentöne den besten Eindruck machen und zugleich Zeugnis ablegen von dem sicheren Reichtum, der sich hinter Tür und Fenster birgt, nämlich in den Schränken, Bettkisten und Leinenkoffern der Vorratskammer. Merkwürdig ist aber der Umstand, daß die Tür ohne Schloß und Klinke und von außen weder zu öffnen, noch zu schließen ist; sie ist nämlich nur eine Nottür, bestimmt, die schnelle Rettung jener Schätze bei Feuersgefahr zu ermöglichen: daher ist sie nur von innen durch Zurückschieben des Doppelriegels zu öffnen. Über dem Prachtfenster läuft der Hauptbalken hin, welcher Giebel und Unterbau scheidet, und der gleichfalls durch Schnitzerei und Malerei auffällt; er weist außer der Jahreszahl der Erbauung und dem Namen des Bauherrn auch die Devise der Inwohner auf, häufig in Form eines kindlich frommen Spruches: »Dat ewige Got (Gut) maket rechten Mot«, oder: »Wat frag' ik nah de Lü (Leute), Gott helpet mi«. Die schrägen Balken, welche den Giebel umfassen, sind über den First hinaus verlängert, und diese Verlängerungen bilden das sogenannte Schwanenzeichen.
Alle Holzteile des Hauses sind zum Schutz gegen Wind und Wetter mit einem Ölanstrich versehen. Und da in den Marschländern monatelang ein trüber Nebelhimmel alles Grau in Grau kleidet, so quoll das Bedürfnis nach bunter Farbe naturgemäß hervor. Aus dieser doppelten Ursache erklärt sich die Farbenliebhaberei, die nicht bloß an der Außenseite des Hauses, sondern auch an der Decke, den Wänden – sofern diese nicht mit Fayencefliesen belegt sind –, den Fensterrahmen, Türen und den geschnitzten Türeinfassungen Gelegenheit gesucht hat, sich zu betätigen. Der Künstler ist der Bauer selbst, der kein größeres Vergnügen zu kennen scheint, als mit Pinsel und Farbentopf das Innere seines niedrigen Wohnraumes immer mit neuem Kleide auszustatten.
Ihrer äußeren Erscheinung nach bilden die Altländer einen auffallenden Gegensatz zu den herkulischen Gestalten mit rotem, vollem Gesicht, reckenhaften Gliedern und fleischiger Fülle, wie wir sie in den übrigen deutschen Marschen antreffen. Nur mittelgroß, schlank, mit schmalem, durchgearbeitetem Gesicht, gerader oder schwach gebogener Nase, buschigen Brauen und schlauen Augen tritt uns der Mann entgegen, während an Frauen und Mädchen das Ebenmaß der Gestalt, die Zierlichkeit der Glieder, der schwebende Gang, die rosige Frische der Haut, das feingeschnittene Profil und die Klarheit des hellblauen Auges den Beschauer mit stillem Entzücken erfüllen. Und in der Kinderwelt würde jeder Maler Typen genug zu Engelsgesichtern finden. In späteren Jahren stellt sich bei dem weiblichen Geschlecht wohl eine Neigung zu größerer Körperfülle ein; erstaunlich aber wird es immer bleiben, wie jugendlich und mädchenhaft schlank sich die meisten Frauen erhalten.
Gegen Fremde ist der Altländer zunächst mißtrauisch, zurückhaltend; erst wenn man ihn bei seiner schwachen Seite zu fassen versteht, indem man sein Heim und seine Heimat bewundert, verschwinden die Wolken des Mißtrauens von seinem Gesicht; ein selbstgefälliges Schmunzeln zuckt um die Mundwinkel; Küche und Keller, sowie die Schleusen seiner Beredsamkeit tun sich auf, und gern schreitet der Bauer in Jacke und Manchesterhose seinem Gaste voran, um ihm Obstgarten, Scheune, Viehstand, besonders den reich geschnitzten, bunt bemalten Schlitten, zu zeigen, und die geschäftige Hausfrau geleitet ihn durch die Abteilung des Innern, wo er die scharlachroten, zierlich gedrechselten Stühle mit goldverzierter Rücklehne und bunten Sitzkissen aus Teppichstoff, die lange Reihe der messingbeschlagenen Leinenkoffer mit Rädern, die großen Kachelöfen, die uralten, braunen Kleiderschränke bewundern muß. Jeder dieser ehrwürdigen, oft kunstvoll geschnitzten Spinde hat seine Geschichte; der eine ist von der jungen Frau ins Haus gebracht worden, der andere von der Schwieger- und der dritte von der Urgroßmutter. Die Farbenliebhaberei des Altländers hat namentlich auch in den Kirchen ihren Ausdruck gefunden, sofern diese in ihrem buntscheckigen Gewande an die japanischen Tempel erinnern.
Die eigentliche Gabe des Altländers ist sein Handelsgeist. Man muß einmal zur Kirchzeit, etwa in Jork, diese Bauern zwischen den Beeten im Vorgarten sehen im peinlich sauberen schwarzen Rock, viel kluge, scharfgeschnittene Gesichter darunter, die man sich am liebsten am Kontorbock über das Hauptbuch gebeugt denken mag. Es ist bezeichnend, daß uns unter den Altländer Sippennamen viele Hamburger Firmen, darunter Namen ersten Klanges, begegnen. Sie gelten als verschlagen und listig, geborene Geldleute, auch den kleinsten Vorteil wahrnehmend, rührig und äußerst sparsam, mit heller bäuerlicher Freude am Einhamstern. Der Erwerbssinn steigert sich zur Erwerbslust. Den Arglosen im Handumdrehen tüchtig einzutunken, halten sie für gutes Recht. Die zierlichen Mädchen wachsen zu vortrefflichen sparsamen Hausfrauen. So herrscht hier große Wohlhabenheit. Auf vier bis sechs Millionen mag man das jährliche Einkommen aus dem Obstbau schätzen. Die Sparkasse wies einen Bestand von sieben Millionen auf, dabei wird überaus stark in Papieren spekuliert. Drei Viertel Argentinier und Griechen, und ein Viertel deutsche Staatspapiere ist gewöhnlicher Besitz. Der jüdische Zwischenhändler, der bei der hohen Intelligenz der Bewohner in den Elbmarschen überhaupt wenig vertreten ist, fehlt hier völlig: »Wi köpt nix von Juden, de sün all Bedreigers,« pflegen sie zu sagen. Sie vergessen dabei, daß sie selber in gutem und schlechtem Sinne allgemein als die Juden der Niederelbe gelten. »Swarte Juden gift nicht in Oland, aber witte de heele Menge.«
Mit ihren Stammesverwandten in Holland teilen die Altländer das Phlegma des ganzen Behabens, sind aber trotzdem gerade wie jene Freunde der Lebenslust, des Gesanges und Tanzes; sie haben ferner teil an dem stark konservativen Zuge der Niederländer und bekunden diesen in der Verbannung alles modischen Luxus, in bezug auf Hausgerät, Bauart, Kleidung, auch darin, daß der Altländer nur eine Altländerin heimführt und nichts anderes sein will als ein Bauer. Hier und da finden sich noch uralte Gebräuche, so jener, daß der Bräutigam bei der Verlobung statt des Ringes – der Braut die sogenannte »Echte« überreicht, die meist in großen, alten Münzen oder eigens zu diesem Zweck geprägten Medaillen besteht, worauf die Symbole der Liebe und Ehe geprägt sind: ineinander gelegte Hände, flammende Herzen, kosende Tauben usw. Diese Münzen sind Familienschätze und vererben sich von Geschlecht zu Geschlecht. Auch die Feier der Hochzeit wird noch vielfach nach altehrwürdiger Sitte begangen. Unter 500-800 Hochzeitsgästen kann sich der Altländer keine rechte Hochzeit denken. Die Feier nimmt drei Tage in Anspruch und findet nicht im Hause der Braut, sondern in dem des Bräutigams statt. Der erste Tag vereinigt die Gäste zum »Ochsenschlachten«; natürlich kommen sie nur zum Probieren der Speisen und Getränke und dehnen schon diese Vorfeier bis in die Nacht aus. Am zweiten Tage, dem des »Brotbackens«, tragen die Gäste Milch und Butter ins Hochzeitshaus, um sich dann an dem von Rosinen strotzenden, schweren Hochzeitsgebäck zu erlaben. Am Abende dieses zweiten Tages bringen vierspännige, hochgetürmte Wagen im Galopp unter Peitschenknall, Musik und Pistolenschießen die Aussteuer der Braut angefahren, stattliche, schwere Leinenkoffer, stilvolle, mächtige Kleiderschränke, Berge von Bettzeug, altertümliche rote Tische und zierlich gedrechselte Stühle, und obenauf thronen Besen und Spinnrad, sinnig die Bestimmung der wirtlichen Hausfrau andeutend. In bestimmt vorgeschriebener Form beginnt der Bräutigam mit dem anfahrenden Knecht um die Mitgift zu handeln, und endlich wird sie ihm ausgehändigt, nachdem er versprochen, seine Verlobte hoch in Ehren zu halten und den kundigen Rosselenker durch Trunk und Trinkgeld zu befriedigen.
Am dritten Tage, dem eigentlichen Hochzeitstage, wird die Braut in festlichem Zuge aus dem Elternhause abgeholt; die Landessitte schreibt ihr schwarze Kleidung vor an ihrem Ehrentage, und auf dem Kopfe trägt sie die vom Prediger verwahrte und gegen Leihgebühr überlassene Brautkrone, einen Kopfputz aus unzähligen künstlichen Blumen, Früchten, Zitternadeln, Gold- und Silberkugeln; das Merkwürdigste an ihm sind aber die beiden aufrecht stehenden Flügel aus Goldbrokat. Der kirchliche Akt der Trauung ist auch hier der kürzere Teil der Feier, während Schmausen, Zechen, Tanzen und Jubeln den übrigen Teil des Tages und die Nacht in Anspruch nehmen. Die Braut legt den steifen Brautanzug ab und stellt sich den Gästen im zierlichen Mützchen aus Goldbrokat, im Jäckchen von feinem schwarzen Tuch mit echten Goldtressen, im kurzen Faltenrock vom schönsten kirschroten Tuche, in hochhackigen Schuhen mit großen Silberschnallen, in feiner weißer Spitzenschürze, mit der sechsfachen Halsschnur aus Silberperlen und der zwölf Ellen langen Silberkette um die Taille vor, und Sachverständige haben diesen Schmuck, den übrigens auch die anderen als Gäste geladenen Frauen tragen, auf 1800-2000 Mark geschätzt. (Die Silberketten gehören nicht zum allsonntäglichen Schmuck, sondern an ihre Stelle treten für gewöhnlich solche von mächtigen Bernsteinperlen, aber auch der Wert solcher Ketten wird auf 200 und mehr Mark angegeben.) Gegen das Ende der Feier wählen Braut und Bräutigam noch einmal ihre liebsten Jugendfreunde zum Tanz und nehmen auf diese Weise gewissermaßen Abschied von Jugend und Jugendlust. Die Musik spielt sodann die althergebrachte Weise: »Nu gewt de Gaw«, worauf die Braut an der Spitze des Tisches Platz nimmt, ein weißes Tuch auf dem Schoße ausbreitet und die Hochzeitsgeschenke in Geld oder Silberzeug entgegennimmt. Am Ende der Feier wirft sie das Tischtuch von sich und erkennt aus der Richtung der Zipfel, welche ihrer Freundinnen die nächste ist, die Hochzeit machen wird.
Quellen: Allmers, Marschenbuch (Oldenburg, Schulze). – R. Linde, Die Niederelbe. 3. Aufl. Leipzig 1909 (Velhagen & Klasing).
Das Ziel meiner diesjährigen Ferienreise sollte die See, und zwar nicht die gelinde, mehr dem weiblichen Charakter entsprechende Ostsee sein, sondern die männlich rauhe Nordsee, in deren Antlitz die Grundzüge eines wirklichen Meeres viel kräftiger ausgeprägt sind, als im Baltischen Meer. Die Eisenbahnfahrt nach Emden in glühender Julihitze war allerdings geeignet, die Reiselust abzudämpfen; doch sobald Emden erreicht war, jene in ihrem ganzen Gepräge schon holländische Stadt mit zahlreichen Kanälen, stieg die Aufmerksamkeit mit jeder Minute. Im Wasser der Westerems stach ich in See, und mit Wollust sog die Brust die frische, kräftige Seeluft ein. Dem Schiffe war durch zahlreiche farbige Schwimmtrommeln der Weg durch das seichte Wattenmeer genau angegeben, und schon nach drei Stunden war die Überfahrt glücklich bewerkstelligt. Man landet in der Nähe des Südostrandes der Insel. Von der Landungsstelle führt eine etwa 5 km lange Eisenbahn nach dem Orte selbst. Der Bahnhof ist mit allen großstädtischen Einrichtungen und Bequemlichkeiten versehen, die die Bewältigung des in den letzten Jahren gewaltig angewachsenen Sommerverkehrs erheischt. Die Wohnungsfrage konnte ich um so schneller erledigen, als mir ein »Führer des Nordseebades Borkum« mit Ortsplan und Einwohnerverzeichnis zur Verfügung stand. Der Preis für ein sauberes Stübchen mit Kämmerchen und Bedienung war mäßig zu nennen, und sehr bald fühlte ich mich heimisch. Die ersten Ausgänge galten dem Zurechtfinden auf dem kleinen Eilande, das die westlichste der deutsch-friesischen Inseln darstellt. Die Insel Borkum ist 8 km lang, im Mittel 4 km breit und nimmt eine Fläche von 25 qkm ein. Sie ist zwischen beiden Mündungsarmen der Ems, der Oster- und Westerems, gelegen und wird durch einen tiefen Meereseinschnitt, das sogenannte Hogg, in ein größeres West- und ein kleineres Ostland geteilt. Wie alle friesischen Inseln, ist Borkum den Angriffen des Meeres ständig ausgesetzt. Glücklicherweise hat die Natur selbst den Fluten der Nordsee eine mehrfache Kette von Dünen entgegengesetzt, und der Mensch sucht diesen natürlichen Schutz durch den künstlichen starker Deichbauten und sonstiger Befestigungen und durch Bepflanzung der Dünen mit geeigneten Gräsern (Strandhafer) und Sträuchern zu erhöhen. An der schmälsten Stelle des Strandes ist der Dünenfuß durch eine starke Strandmauer in einer Länge von 4 km geschützt, von der in gewissen Abständen 25 etwa 200 m lange Buhnen ins Meer hinausgebaut sind. Durch die Sturmflut vom 12. und 13. März 1906 wurde das Nordende der Strandmauer in einer Länge von 300 m vollständig zertrümmert, ist inzwischen aber in einer neuen, zweckmäßigeren Form wieder aufgebaut worden.
Das von den Badegästen besuchte Inseldorf liegt im Westland, während im Ostlande nur eine aus wenig Gehöften bestehende, einsame Ortschaft zu finden ist, auf deren Umgebung sich der geringe Getreidebau der Insel beschränkt.
Auf diesem Vorposten Deutschlands leben einige Tausende unserer Landsleute vom nervigen, sturmfesten Stamme der Friesen, meist blond, stets rotwangig und wetterbraun, zwar ohne nationale Tracht – man müßte denn die holländische Kopfbedeckung der Frauen als Rest derselben ansehen –, aber doch in Gestalt, Gesichtszügen und Sprache sofort von den Zugewanderten unterscheidbar. Im Verkehr untereinander gebrauchen sie das gemütliche Platt, während sie den Badegästen gegenüber der hochdeutschen Sprache sich bedienen. Land- und Viehwirtschaft, vor allem aber Seefahrt und Fremdenverkehr, bieten ihnen die Mittel zum Lebensunterhalt. Die Reicheren unter ihnen treiben Reederei, die Ärmeren verdingen sich als Matrosen; mein eigener Hauswirt war 23 Jahre hindurch als Matrose auf den verschiedensten Meeren gefahren und hatte sich nun mit den Ersparnissen das kleine Grundstück für die Tage des Alters erworben. Der früher lebhaft betriebene Fischfang auf Heringe, Kabeljaue und Schellfische wird heute nur als Nebenbeschäftigung angesehen und vermag zu Zeiten starken Besuches nicht einmal den Bedarf der Insel selbst zu decken, ehemals allerdings müssen die Borkumer sogar nordwärts zum Walfischfang ausgezogen sein; die zahlreichen Walfischknochen in den Gartenzäunen erzählen von mancher erfolgreichen Fahrt. Gegenwärtig bietet die beste, leichteste und sicherste Erwerbsquelle der Fremdenverkehr, der in den letzten Jahren die gewaltige Zahl von etwa 30 000 Besuchern erreicht hat.
Das Hauptdorf der Insel besteht in der Hauptsache aus roten Backsteinhäuschen; das Material zu den einstöckigen Gebäuden muß aus der Gegend von Leer geholt werden. Neben den Wohnräumen liegen Zelte, Lauben, Gartenhäuschen für die Sommergäste, hinter ihnen die aus Brettern gefügten Ställe für einige Kühe, Schafe oder ein Schweinchen. Der häufig hier noch vorhandene Ziehbrunnen zur Gewinnung des Süßwassers konnte außer Betrieb gesetzt werden, da eine neuerdings angelegte Wasserleitung den einzelnen Häusern ein klares und gutes Trinkwasser liefert. Die Dorfgassen sind sauber mit roten Klinkersteinen gepflastert, nur bei den entlegeneren beschränkt sich diese Pflasterung auf einen schmalen Fußsteig, während die Fahrstraße noch Dünensand aufweist. Über die niedrigen Wohnhäuser erheben sich als besonders hervorstechende Züge im Bilde der Ortschaft der alte Leuchtturm, der jetzt außer Betrieb gesetzt ist, aber noch immer als Vermessungs- und Seezeichen dient, ferner der stattliche neue Leuchtturm, das weithin sichtbare Wahrzeichen des neuen Borkum, sodann die neue, mitten im Orte gelegene evangelisch-reformierte Kirche – die alte, nunmehr abgebrochene hatte sich den alten Leuchtturm als Kirchturm zunutze gemacht –, die katholische Kapelle »Stellamaris«, die einfach gehaltene lutherische Kirche und einige im großen Stil angelegte Hotels.
So ruhig und friedlich der Ort selbst während der meisten Stunden des Tages liegt, so lebhaft ist ständig der Verkehr an zwei Stellen, am Bahnhof, wo das lebhafte Treiben der ankommenden und abreisenden Badegäste den ganzen Tag über dauert, und auf der prachtvollen Kaiserstraße, die auf dem hier 10 m hohen Dünenrand an palastartigen Hotels und Logierhäusern sich entlang zieht und im Verein mit den Hotelveranden eine großartige Meeresterrasse bildet.
Üppige Gärten als Einfassung der Straßen sucht man vergebens; der Boden läßt in den kleinen Hausgärtchen wohl wenige sorglich gepflegte Zierblumen, meist aber nur Kraut, Rüben, Kartoffeln, Möhren (»Wurzeln«) und grobe Bohnen aufkommen. Obst und die feineren Gemüse müssen vom Festlande bezogen werden. Der Sandboden ist ebensowenig geeignet, einen üppigen Baumwuchs zu befördern; Alleen, Laubgänge, Parks sind nicht zu finden. Immerhin weist Borkum mehr hohe Laubbäume auf, als alle anderen Nordseeinseln. Einen herrlichen Schmuck des Eilandes aber bilden die weitausgedehnten, reichen Wiesengelände, die in dieser Schönheit auf keiner anderen deutschen Nordseeinsel zu finden sind und die mit Recht Borkum den Namen der »grünen Insel« eingetragen haben; hier weiden tagsüber, manchmal sogar die Nacht hindurch, über 800 Rinder, Schafe und Pferde und verleihen dem eigenartigen Landschaftsbilde noch besonderes Leben und besonderen Reiz.
Das Meer mit seiner Unendlichkeit und Erhabenheit, seinem schmeichelnden Gekose und seinem Löwengebrüll, seinen bald leichtfüßig heranrollenden, leicht sich kräuselnden, bald wie eine Wand sich auftürmenden Wellen, seinen langen Atemzügen – der Ebbe und Flut: ja es wird nie alt und langweilig. Und dort auf einer Anhöhe an der Strandstraße ragt der 60 m hohe neue Leuchtturm, der höchste an der deutschen Küste, in Gestalt eines abgestumpften Kegels auf. In Zwischenräumen von je 30 Sekunden werfen nachts die auf seinem höchsten Punkte angebrachten Blinkfeuer einen grellen Lichtschein auf die dunklen Meeresfluten, 38 km im Umkreis sichtbar, um vor Untiefen und dem Borkumer Riff zu warnen. Das Besteigen des Turmes, von dem aus man eine prächtige Rundsicht genießt, ist, seitdem die Insel Befestigungen erhalten hat, leider nicht mehr gestattet. Am Südstrande wurde ein zweiter, etwas kleinerer Leuchtturm errichtet, dessen elektrisches Bogenlicht weithin die Dunkelheit durchbricht und der im Zusammenhang mit mehreren anderen an der ostfriesischen und holländischen Küste errichteten Feuern auch zur Nachtzeit die Einfahrt in die Ems ermöglicht. Neben dem elektrischen Leuchtturm erhebt sich ein hoher Mast. Er trägt das Auffangenetz der funkentelegraphischen Station, die eine Verbindung mit dem etwa 35 km seewärts an einer gefährlichen Sandbank verankerten Feuerschiff »Borkumriff« herstellt. Unten am Strande aber stehen mehrere die Fahrrichtung angebende Seezeichen, sogenannte »Baken«, und Rettungsboote liegen für den Notfall in eigens dazu erbauten Häuschen bereit.
Einen eigenen Reiz, eine eigene Poesie haben auch die Dünen Borkums, die »Alpen des norddeutschen Flachlandes«, mit ihren bis zu 60 m Höhe ansteigenden Kämmen und Gipfeln, ihren Parallelketten, Längstälern, Einsattelungen, Pässen oder auch Quertälern. Freilich erfordert das Vordringen in diese eigentümliche Welt starke Schenkel, da der Sand dem Watenden fast unter den Füßen hervorquillt; aber schon ein Erklimmen niedriger Hügelzüge gestattet oft überraschende Ausblicke auf Meer und Insel. Zwei Punkte in den Dünen sind von besonderem Interesse, die Kiebitzdelle in den südöstlichen und die Vogelkolonie in den nördlichen Ketten des Ostlandes. Die erstere ist ein schönes breites Längstal, berühmt durch seinen Reichtum an lieblichen Blumen, besonders an wohlriechenden Pyrolas, die früher oft in Äschen mit nach der Heimat der Badegäste wanderten, jetzt aber durch das Verbot der Badeverwaltung vor dieser zwangsweisen Auswanderung geschützt sind. Die Vogelkolonie dagegen liegt in den äußersten Dünen des kleinen Ostlands. Der Weg zu ihr führt uns zunächst 20 Minuten auf bequemen Wiesenpfaden zur Meierei und Kaffeewirtschaft Upholm, die in schattigem Garten liegt, und dann durch tiefen Dünensand bis zu den einsamen Gehöften des Ostlandes. Von dort aus geleitet uns der Wärter gegen Aushändigung der Karte in die Kolonie selbst. »Tausende von Möwen, Brand-Enten und Seeschwalben umschwärmen uns von allen Seiten und geben durch ihren hastigen Flug und ängstlichen Ruf zu erkennen, daß ihnen an der Störung gar nichts gelegen ist. Überall sieht man in den Dünenhügeln die kunstlosen Nester mit einigen graugrundierten und schwarzgesprenkelten, großen Eiern oder Jungen. Die Möwe legt nie mehr als drei Eier ins Nest. So oft ihr aber eins vom Wärter genommen wird, ergänzt sie die Dreizahl wieder. Da trifft man Junge in allen Entwickelungsstadien, und – wenn uns das Glück begünstigt – kann man wohl auch eins gerade mit seinem Schnäblein das Ei durchstoßen und ausschlüpfen sehen. Nicht selten sah ich auch tote umherliegen und erfuhr, daß dies Unerfahrene gewesen seien, die sich fremden Vogelfamilien genähert und von diesen totgehackt worden waren.«
Außerhalb der Dünen liegt jener Landstreifen, der unter dem Einflusse von Ebbe und Flut steht, der Strand. Er erscheint uns als schöne, ebene, langsam zum Meere sich neigende Sandfläche, die das Meer bei jeder Ausatmung mit buntgefärbten, zierlich gestalteten Muscheln, mit Tangen und Algen überschüttet; doch auch Äste von Nadelholz und Birke, aus Pfahlrosten ausgespülte Pfähle, Reste von gestrandeten Schiffen wirft das Meer aus. Der Strand von Borkum ist auffallend arm an tierischen Bewohnern des Meeres: Krebse, Quallen, einige zwischen den Steinen festgeklemmte Seesterne: das ist alles. Und doch ist er trotz dieser Armut der eigentliche Reichtum von Borkum; denn des Strandes wegen sucht man die Insel auf, um sich in Wasser und Luft gesund zu baden. Jeder Tag ist für den gewissenhaften Kurgast verloren, den er nicht zum guten Teil badend, laufend oder im Strandkorbe sitzend am Strande zugebracht. Am meisten besucht ist der Weststrand, der einzige übrigens, an dem gebadet wird. Man steigt von den hohen Dünen auf Holztreppen hinab zu dem durch ein unbenutztes Gebiet getrennten Herren- und Damenstrande. Auf beiden Abteilungen bemerken wir die Badekutschen zum Auskleiden; in ihnen wird man bis in die Nähe des Wassers geschoben. Man weilt nicht lange im Seebad, da dieses sonst zu sehr angreifen würde; das größte Vergnügen besteht darin, die ankommenden Wellen mit dem Rücken aufzufangen. Jedem Bade folgt eine tüchtige Abreibung und – gleichfalls um dem Körper wieder zu höherer Temperatur zu verhelfen – ein kurzer Spaziergang im feuchten Sande.
Kinder suchen und finden ihr Glück weniger im Bad als auf dem Strande. Im Wasser zu waten, den feuchten Sand zu formen, zu schaufeln, Löcher zu graben, mit Wasser zu füllen und Blech- und Holzschiffchen darauf schwimmen zu lassen, Gräben zu ziehen und abzudämmen, im Sande sich wälzen und doch nicht schmutzig zu werden: was kann es für ein Kind wohl Köstlicheres geben? Da hat eine Anzahl von ihnen eine lange, schmale Grube ausgeschachtet, an dem einen Ende wird der Spaten mit wehendem Tuche aufgepflanzt, und die kleine Gesellschaft steigt nun ein in den Bauch ihres Schiffes, die Schaufeln werden wie Ruder verwendet, und so beginnt in ihrer kühnen Phantasie die Fahrt nach Norderney. Andere haben unmittelbar am Wasser Burgen und Festungen aus Sand gebaut, auf denen sie stolz ihr Banner wehen lassen und die sie gegen die Angriffe der Wogen ebenso tapfer verteidigen wie gegen die feindlicher Nachbarn. Gelegenheit zur militärischen Betätigung bieten übrigens den Kindern der Badegäste die in Borkum eingerichteten Knaben- und Mädchenkompagnien, deren Übungen und Paraden eine gern benutzte Quelle körperlicher Kräftigung und anregender Unterhaltung bilden und sich gelegentlich zu allgemein vom Badepublikum mitgefeierten Tagesereignissen gestalten.
Am Strande von Borkum wechseln ruhige, sonnenklare Tage mit stürmischen Regentagen. Jede Art hat ihre Verehrer, die letztere zählt zu den ihrigen vor allem die alten Seemannsnaturen, während dann die verwöhnten Landratten unstet auf und ab eilen, in Überrock und Plaid gehüllt, um in die Wärme zu kommen. Für sie sind mehr die warmen, ruhigen Sonnentage, wo sie auf den grünen Ruhebänken vor den Strandhotels und in den Hunderten von Zelten und Strandkörben ein beschauliches Dasein führen. Eine richtige kleine Stadt solcher luftiger Häuschen ist unten am Strande zwischen dem Fuß der Dünen und den netzenden Wogen entstanden.
Borkum ist trotz seines starken Besuches kein Weltbad, keins von denen, die alles andere bieten, nur keine Erholung. In heiterer Ruhe und Sorglosigkeit fließt das Leben der Badegäste während der nur zu kurzen Zeit ihres Inselaufenthaltes dahin. Gleichgesinnte treffen sich am Strande oder bei den Klängen der Kurkapelle zu einem Plauderstündchen, gelegentlich wohl auch bei einer der geselligen Vereinigungen und Abendunterhaltungen, die in verschiedenen Hotels stattfinden. Andere unternehmen mutig eine magenumwälzende Segelfahrt nach der holländischen Insel Rottum. Nimrode jagen auf Seevögel und Seehunde oder liegen dem edlen Weidwerk an den zahlreichen Bauen wilder Kaninchen ob, die in den Dünen massenweise hausen. Das ist das Programm der Vergnügungen, die das freundliche Borkum seinen Besuchern bietet. Möchte es immer das friedliche Eiland bleiben, auf dem die von den Stürmen eines uns rastlos aufpeitschenden Lebens arg Mitgenommenen die Ruhe über den Wellen wiederfinden!
Unter Zugrundelegung von R. Arnim, Borkum (Wiss. Beil. d. Leipziger Zeitung 1888) bearbeitet.
Die Hochseefischerei zählt im Deutschen Reiche zu den jüngsten Zweigen der Volkswirtschaft, da sich, vom Herings- und Walfang abgesehen, ihre Anfänge kaum weiter als zwei Dezennien zurückverfolgen lassen. Bis zu Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurden in der Nordseefischerei ausschließlich Segelfahrzeuge, Ewer, Buysen und Kutter verwendet, deren Heimat überwiegend an der Unterelbe, Hamburg-Finkenwerder, Altona-Blankenese, Kranz-Glückstadt, in zweiter Linie im Gebiet der Unterweser und Ems sowie der friesischen Inseln zu suchen war.
Weil Einrichtungen für den Frischfischversand selbst in den größeren Nordseeplätzen gänzlich fehlten, mußten die eingebrachten Fänge entweder unter der der Küste unmittelbar benachbarten Bevölkerung zum Absatz gebracht oder durch Pökeln, Marinieren, Räuchern usw. in Dauerware umgewandelt werden. Dadurch waren der Ausdehnung des Seefischereibetriebes Schranken gesetzt, deren Hinwegräumung erst durch Ausgestaltung der Verkehrsmittel und -wege erstrebt und allmählich erreicht werden konnte. Die rapide Zunahme der Bevölkerungsziffer der binnenländischen Großstädte und Industriezentren forderte ja auch gebieterisch die Zufuhr billiger Fischnahrung.
Von entscheidender Bedeutung wurde die im Jahre 1886 erfolgte Gründung des Deutschen Seefischereivereins (Sitz in Hannover), der nicht nur in Rede und Schrift an zuständiger Stelle für die stetige Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in bezug auf die Versorgung des Inlandes mit Seefischen eintrat, sondern auch die Bestrebungen unternehmender Männer zwecks Ausdehnung der Seefischerei tatkräftig unterstützte. Zu letzteren gehörte vor allem der in Geestemünde an der Weser wohnende Fischhändler Busse, der es trotz der auf diesem Gebiete noch mangelnden Erfahrung mit weitschauendem Blick als erster gewagt hatte, in der Seefischerei vom Segel- zum Dampfbetriebe und damit zur eigentlichen Hochseefischerei überzugehen. Im Jahre 1884 erschien sein Fischdampfer »Sagitta«, das erste derartige Fahrzeug unter deutscher Flagge, auf der Nordsee.
Dieser Schritt Busses mußte um so mehr als ein Wagnis angesehen werden, als es auch in England und Holland an Erfahrung über die Rentabilität des Fischdampferbetriebes noch mangelte, und es weder jenseits noch diesseits des Kanals an gewichtigen Stimmen fehlte, die sich mit aller Entschiedenheit gegen jede weitere Ausdehnung dieser »kostspieligen Versuche« aussprechen zu müssen glaubten. Allein die Erfolge der ersten Fangreisen der »Sagitta« waren überraschend; denn das von Wind und Wetter weniger abhängige Fahrzeug konnte nicht nur fernerliegende, ergiebigere Fanggründe aufsuchen, sondern erwies sich auch durch Einführung des Scher- statt des Baumnetzes den Segelfahrzeugen als weit überlegen. Dennoch vergingen drei Jahre, bevor Busses Vorgehen in Geestemünde und Nordenham Nachahmung fand und die Einstellung von vier weiteren deutschen Fischdampfern erfolgte. Unter diesen befand sich auch ein Fahrzeug der Firma Busse, das dem Vorsitzenden des Deutschen Seefischereivereins zu Ehren den Namen »Präsident Herwig« erhielt und als erstes die deutsche Flagge in die Gewässer Islands zu tragen und damit den mächtigen Aufschwung der deutschen Hochseefischerei zu begründen berufen war. Denn seitdem begann die Gründung kapitalkräftiger Hochseefischerei-Gesellschaften mit Dampferbetrieb. Die Zahl der Fischdampfer unter deutscher Flagge beläuft sich jetzt für das Weser-, Ems- und Elbgebiet bereits auf mehr als 160 mit einer Besatzung von rund 2000 Mann. Die Gesamtzahl der in der Hochseefischerei beschäftigten Fahrzeuge einschließlich der Heringslogger aber stellte sich am 1. Januar 1909 auf 634 und 6540 Mann Besatzung.
Diese Ausdehnung der Hochseefischerei wäre nicht möglich gewesen, wenn nicht die Umgestaltung der Verkehrsmittel mit ihr gleichen Schritt gehalten und die Landesregierungen in Preußen, Oldenburg, Bremen und Hamburg auf die stetig erneute Anregung des deutschen Seefischerei-Vereins hin sich zu einer kräftigen Förderung der Angelegenheit entschlossen hätten. So entstanden die mit großartigen Verkehrsanlagen ausgestatteten Fischmärkte von Hamburg, Altona, Cuxhaven, Geestemünde usw., von denen der letztere seit der Einführung der regelmäßigen Frischfischauktionen für die Fischversorgung des Inlandes den ersten Rang einnimmt, da an ihm täglich mehr als 20 Dampfer und eine Reihe von Seglern ihre Ladung löschen.
Wie erwähnt, wird die Hochseefischerei sowohl mit Segelfahrzeugen wie mit Dampfern betrieben, und wenn auch der Zahl nach die Segler noch heute überwiegen, so ist den Fischdampfern doch die weitere Fortentwickelung des Hochseebetriebes vorbehalten. Die modernen Fischdampfer sind aus Stahl erbaute, mit starken Maschinen ausgerüstete Fahrzeuge von 35-45 Metern Länge, die eine Besatzung von 12-15 Personen führen, zusammengesetzt aus dem Kapitän, dem Steuer- oder Bestmann, zwei Maschinisten und Heizern, dem Koch und einer Anzahl Matrosen bzw. Fischereiarbeitern. Der größere Teil des Schiffsraums dient zur Aufnahme der Ladung und ist zur Verstauung der verschiedenen Fischgattungen in verschiedene Verschläge eingeteilt. Neben den Laderäumen befinden sich die Eisräume, die zur Mitnahme von vielen tausend Kilogramm Blockeis ausreichen müssen.
Als Fanggeschirr dient ein Grundnetz von 25-26 m Länge und 10-12 m Breite, das durch zwei Platten aus Eichenholz, den sogenannten Scherbrettern, mittels sinnreich angebrachter Ketten gespannt wird. Dabei tritt der obere Netzrand gegen den unteren etwas zurück, wodurch es den aufgeschreckten Fischen unmöglich gemacht wird, sich über die Netzöffnung hinweg zu schnellen. Die Ketten der Scherbretter sind verbunden mit Drahtseilen von mehreren hundert Metern Länge, die über Leitrollen und -gestelle zu der mittschiffs stehenden Dampfwinde führen. Das aus Manilahanf hergestellte Netz verengert sich nach rückwärts zu dem sogenannten »Neert«, einem 3 m langen, engmaschigen Beutel, der am Ende durch ein sinnreich geknotetes Ringseil zusammengehalten wird. Natürlich besitzt ein Fischdampfer mehrere solcher Netze, so daß er beliebig über Steuer- oder Backbord fischen kann. Grundschleppnetze der beschriebenen Art können natürlich nur dort zur Verwendung gelangen, wo der Meeresgrund verhältnismäßig eben und frei von großen Steinen ist. Da diese Bedingungen für die Ostsee nicht zutreffen, ist für dieses ohnehin relativ fischarme Meer ein Hochseefischereibetrieb der vorgenannten Art völlig ausgeschlossen. Das Gros der deutschen, jütischen und englischen Fischdampfer verbleibt in der Nordsee und deren Nebenteilen; unsere größeren Fahrzeuge aber suchen die norwegischen, isländischen und neuerdings mit anscheinend günstigen Erfolgen auch die spanisch-marokkanischen Gewässer sowie die des Weißen Meeres auf.
Da die Führer der Fischdampfer außer ihrer festen Heuer in der Regel noch einen bestimmten Prozentsatz aus dem Erlös der Fänge beziehen, so haben sie ein erklärliches Interesse daran, die Zeit aufs beste auszunutzen. Sobald daher der in Aussicht genommene Fangplatz erreicht ist, wird mit dem Aussetzen des Netzes begonnen. Auf die Tageszeit oder auf die Witterung wird dabei wenig Rücksicht genommen, doch machen anhaltende Stürme das Fischen unmöglich, weil unter solchen Umständen Havarien und Netzverluste nicht zu vermeiden wären. Zum Aussetzen des Netzes werden alle verfügbaren Leute an Deck beordert. Während die Leitung des Unternehmens dem Bestmann obliegt, verbleibt der Kapitän in dem Ruderhause, um die Bewegungen des Schiffes zu regeln, damit nicht das Netz oder die Trossen in die Schraube geraten und das Schiff manöverierunfähig machen. Ist endlich der letzte Rest des Garns in den Fluten verschwunden, so geht's mit voller Kraft vorwärts, das Bugwasser schäumt auf, die Trossen beginnen sich zu strecken; die mächtigen Führungsbretter des auf dem Grunde ruhenden Netzes scheren infolge des Wasserdruckes in schräger Richtung auseinander und spannen das in beträchtlicher Entfernung nachschleifende Netz, das alles auf und nahe an dem Grunde hausende Getier aufscheucht und in seinem weiten Rachen aufnimmt. Nun wird ein bestimmter Kurs gesetzt und die Maschine auf halbe Kraft gestellt. Diese Ermäßigung der Fahrt ist nötig, weil sonst bei einem etwaigen Festgeraten des Netzes Havarien gar nicht zu vermeiden wären. Gerade in der Nordsee ist ein Festhaken der Netze am Grunde eine häufig wiederkehrende Kalamität wegen der vielen halbversandeten Wrackstücke. Treten solche Fälle ein, so bedarf es stets einer äußerst umständlichen und sorgfältigen Navigierung, um Netzverluste zu vermeiden.
Eine Schleppfahrt dauert, sofern keine Störungen eintreten, sieben Stunden. Dann wird das Netz eingeholt und entleert. Dieses Einholen des Fanggeschirrs bietet die interessantesten Momente des Fischens. Wieder werden alle Mann an Deck beordert, und die Fahrt wird so weit ermäßigt, daß der Dampfer eben noch die See hält. Nun tritt die Dampfwinde in Tätigkeit. Faden um Faden der Trosse legt sich um die Welle, näher und näher kommt das Netz, bis endlich die Scherbretter an der Bordwand auftauchen. »Stopp!« ertönt das Kommando in den Maschinenraum, die Winde steht. In Seestiefeln und Schurzfellen, die Ärmel weit aufgekrempt, beugen sich die wetterharten Männer weit über die Reeling, daß sich das Schiff unter ihrer und des Netzes Last auf die Seite neigt. Derbe Fäuste packen die schweren Bretter und zerren sie mit vereinter Kraft an Deck, wo sie sicher befestigt werden. Doch eine noch schwierigere Arbeit, das Anbordheben des Netzes selbst, steht bevor. Die Winde muß vorderhand außer Tätigkeit bleiben. Mit Fäusten und Zähnen greifen die Leute in die Maschen, stoßen, heben, zerren, daß ihnen der Schweiß von der Stirn rinnt. Zoll um Zoll steigt das triefende Fanggeschirr über die Bordwand empor. Vom Ruderhause aus feuert der Kapitän zu immer neuen Anstrengungen an, denn die Zeit ist kostbar. Hier und da zappelt ein feister Plattfisch in den Maschen, ohne beachtet zu werden; denn die Augen aller sind auf die Stelle des Wassers gerichtet, wo der Steert auftauchen muß. Schon kündet er sein Erscheinen durch ein Heer aufsteigender Blasen an, deren reiche Zahl den Leuten ein vergnügtes Grinsen entlockt.
»Junge, dat ward 'n Tog«, ruft einer.
»Kiek, de Ohl grint nich ümsonst,« bestätigt ein anderer.
»Hal noch bi din En an, Hein, gliek hebbt wi em,« ruft der Bestmann, »so … dor is he, stopp.«
Der Steert taucht auf, versinkt – und erscheint von neuem, unter der Wirkung einer unsichtbaren Kraft auf und, nieder, hin und her wogend.
»Jan, dat Reep!« Der Gerufene springt mit einem starken Seil, das von der Dampfwinde aus über einen am Maste hängenden Flaschenzug herabführt, herbei und schlingt es nach mehreren vergeblichen Versuchen endlich glücklich um das Netz; denn den gefüllten Steert mit Menschenkraft heben zu wollen, würde ein zweckloses Bemühen sein; nur die Maschine kann helfen. Schon ist auf dem Deck aus Bohlen und Brettern ein kastenartiger Verschlag hergerichtet, der den Fang vorläufig aufnehmen soll.
»Los!« ertönt das Kommando in den Maschinenraum, die Dampfwinde schlägt an; knarrend streckt sich die Trosse, und, einem riesigen Knäuel vergleichbar, entsteigt der wohlgefüllte Steert der See. Zischende Wasserstrahlen, Schlick- und Tangmassen prasseln in diese zurück. Nun schwebt der Steert über dem Deck; ein Matrose bückt sich tief unter ihn, löst schnellen Griffes das Ringseil und schnellt wie eine Feder zur Seite, um nicht unter der lebendigen Last begraben zu werden, die nun polternd und klatschend in den Verschlag fällt. Welcher Anblick! Das wogt, wühlt und windet sich durcheinander, schnellt jach empor und sinkt schwerfällig nieder, eine sich bäumende, zuckende, jappende – sterbende Masse.
Hat die flüchtige Untersuchung des Netzes ergeben, daß es ohne nennenswerten Schaden geblieben ist, so wird es sofort wieder zu Wasser gelassen und die Schleppfahrt fortgesetzt. Dann erst beginnt die Bearbeitung des Fanges, der mit einer Sortierung nach Arten beginnt. Denn im Verschlage liegen Kabeljaus, Schellfische, Seebarsche, Zungen, Schollen, Steinbutt, Kleiße, Makrelen, Seehechte, Lachse, Dorsche, Quappen, Knurrhähne, Heilbutt und Katzenhaie und andere durcheinander gewürfelt, aber auch mißgestaltete Rochen, Cat- und Igelfische finden sich vor. Was zum Verspeisen nicht geeignet erscheint, wird für die Fischmehlfabriken zurückgelegt. Die Fische werden ausgenommen, wobei die Leber der Schellfischarten sorgsam gesammelt, in bereitstehende Fässer getan und später an die Lebertranfabrikanten abgegeben wird. Der Erlös aus diesem Artikel fällt der Mannschaft zu und stellt sich nach einigen günstigen Fängen nicht selten so hoch, daß die einzelnen Leute einen monatlichen Zuschlag von 30-40 Mark zu ihrer Heuer haben. Sobald die Fische ausgenommen sind, werden sie korbweise dem Strahl der Maschinenpumpe ausgesetzt, der so nachdrücklich wirkt, daß sie in wenigen Augenblicken daliegen, als ob sie eben erst ihrem Elemente entnommen wären. Nun kann die Beute im Wechsel mit Eisschichten in den Laderäumen verstaut werden. Nach der Verstauung wird »klar Deck« gemacht, wobei der Strahl der Maschinenpumpe ebenfalls in der ausgiebigsten Weise zur Reinigung aller benutzten Geräte und des schlüpfrig gewordenen Decks herangezogen wird. Die Einlieferung der Fänge geschieht, falls nicht besondere Konjunkturen oder widrige Witterungsverhältnisse eine Ausnahme bedingen, im Heimatshafen. Unter den Nordseemärkten zeigt Geestemünde die stärkste Frequenz, sodaß von diesem Platze täglich drei Extra-Fischzüge in der Richtung Köln, Frankfurt a. M. und Leipzig abgelassen werden. Altona und Hamburg treten zwar gegen Geestemünde etwas zurück, doch ist auch die Bedeutung dieser Märkte in stetigem Wachsen begriffen und ihre Ausfuhr ins Innere Deutschlands bedeutend. Augenblicklich wird auch Cuxhaven zu einem Fischereihafen ausgebaut.
Wohl ist die deutsche Hochseefischerei bisher in erfreulicher Entwicklung begriffen, aber sie ist einer noch viel größeren Ausdehnung fähig. Das beweist die Tatsache, daß von den 120 Millionen Mark, die Deutschland jährlich für Fischereiprodukte ausgibt, noch 90 Millionen Mark ins Ausland fließen; das beweisen uns auch die Erfolge unserer Nachbarländer Holland und Jütland, vor allem die riesige Steigerung der Hochseefischerei in England, wo z. B. die Fischdampferflotte einer einzigen Stadt, wie Grimsby oder Hull, die ganze deutsche um das Doppelte an Zahl und Tonnengehalt übertrifft, obwohl die englischen Städte nicht annähernd ein so großes Hinterland haben, wie es den deutschen Nordseehäfen zur Verfügung steht.
Von C. Lund in der Magdeburger Zeitung 1905.