
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Schüler des holländischen Großmeisters. – W. Martin und die »Rembrandt-Rätsel«. – W. Bode und das Thema, »Die Rembrandt-Forschung in Gefahr?« – »Der Architekt« in Kassel. – Rembrandts Graphik. – Frans Hals und der Prozeß des Hofstede de Groot.
Das Jahr 1669, das Sterbejahr des Rembrandt, bedeutet für die Geschichte der Malerei die vielleicht wichtigste Phase, für die Geschichte der Kunstfälschung die vielleicht schwierigste. Zunächst aber wirkt sich das Jahr 1669 überhaupt nicht aus. Man weiß: Rembrandt wurde schon kopiert, als er noch nicht 30 Jahre alt war (von Jac. Koninck, C. A. van Beyeren), und die Forschung bekundet es, daß Orlers, als Rembrandt die 35 hinter sich hatte, – die Saskia gebar ihm damals den Titus –, niederschrieb, der Künstler sei bereits einer der berühmtesten Maler des Jahrhunderts, den man bitten müßte, wenn man sich von ihm malen lassen wollte.
Dies also wußte man schon anno 1641. Und das Jahr nachher, 1642 ist das Schöpfungsjahr der »Nachtwache«, dieses Bildes der Bilder, das ein Europäer wie Fromentin ein »unbegreifliches Werk« nennt, und von dem er sagt, daß eben darin, daß es unbegreiflich sei, »eine seiner hohen Zauberkräfte« beruhe. Von diesem Jahre 1642, an, in dem die »kabbalistische Glorie« der »Nachtwache« des Amsterdamer Rijksmuseums aufleuchtet, für deren 16 Einzelporträts der Meister je 100 holl. Gulden, im ganzen also 1.600 erhält, bis zu dem Jahre 1656, da Rembrandt bankerott ist, erstehen imposante malerische Darstellungen des Alten wie des Neuen Testaments. Aber just in diesem Jahre der Bankerott-Erklärung, in dieser Zeit der größten Sorgen und tiefsten Erniedrigung malt das einzigartige Genie Rembrandt drei Werke von unvergänglicher künstlerischer Vollkommenheit: »Jakob segnet die Söhne Josefs« (Kassel), den »Bürgermeister Six« und die »Anatomie des Dr. Deymann«, diese sogenannte verbrannte »Anatomie« von Amsterdam. Sie heißt deshalb die verbrannte Anatomie, weil ein Teil des von Mantegna beeinflußten Gemäldes 1723 einem Feuer zum Opfer fiel. Und 1931 hat ein Geisteskranker diesen Rembrandt des Rijksmuseums in Amsterdam durch Beilhiebe schwer verletzt. Es dürfte aber nebenher auch interessieren, daß die verbrannte Anatomie 1841 für 600 Pfd. an den Londoner Kunsthändler Chaplin kam und 1882 wieder nach Amsterdam zurückwanderte (für – 100 engl. Pfd.). Die populäre »Anatomie des Dr. Tulp« aus der Kgl. Gemäldegalerie im Mauritshuis im Haag, die Rembrandt für die Gilde der Chirurgen von Amsterdam gemalt hatte, wurde 1828 von Willem I. für 32.000 holl. Gulden erworben.
Aber nach diesem neuen kleinen Ausflug ins Marktliche, der, wie ich meine, bei einer Besprechung der Riesenmaterie der Kunstfälschung nicht minder wichtig ist als ein Ausflug in das rein künstlerisch-kritische Gebiet, wende ich mich wieder dem Hauptwerk des Jahres 1656 zu, dem Bilde »Jakobs Segen«. In »Jakobs Segen« verewigt der Prophet Rembrandt die Seele seines hohen Menschentums. Der Holländer Jan Veth spricht darüber das richtige Wort aus: »Vielleicht mehr, als bei irgendeiner anderen Gestalt aus Rembrandts Werken, findet man in seiner sibyllenhaften Asnath des Kasseler Gemäldes »Jakobs Segen« diesen wunderbaren Blick der Augen, welchen man den von Rembrandts eigenster Kunst nennen möchte, der tiefer und weiter scheint als unsere armen, vom Schein verblendeten Menschenaugen – der jedes Ding im Raume und jede Handlung, jede Bewegung des Gemüts wie ein Glied des Einigen und Unteilbaren fühlen läßt – der im Eminent-Sichtbaren das Unsichtbare, im Scharfgedeuteten das Übersinnliche verdolmetscht« …
Ein Maler aber, der mit seiner Kunst die Menschen so beglücken und gefangen nehmen kann, daß sie sein heiligstes Wissen um Gott und die Welt aus seinen Bildern herausfühlen, ist kein Objekt für die Fälscher, und er kann es nicht sein, und wären es selbst die kühnsten und raffiniertesten Künstler-Fälscher. Aber das ist es wohl auch, was die Maler der Nach-Rembrandt-Zeit davon abgehalten haben mag, die Werke des Unvergleichlichen nachzuahmen. »Welcher Maler wäre fähig gewesen, ein Porträt wie dieses zu malen?«, fragt Fromentin vor dem »Bildnis des Six« aus dem Jahre 1656. Jene Schüler Rembrandts freilich, die ihren Lehrmeister überlebt haben, arbeiteten gewissermaßen nach seinem geistigem »Diktat«, das fortlebte. Und da fast jeder von ihnen, trotz allem Rembrandteskem, das lange noch nicht »Rembrandt« war, was sie sicher auch empfanden, irgend ein Persönliches besaß, so konnten und durften sie alle, trotz Rembrandt, für sich selbst und vor der Welt bestehen, alle die Gerard Dou und Nicolas Maes, Ferdinand Bol und Govaert Flinck, Aert de Gelder und Gerard van Eeckhout. Doch im 18. Jahrhundert gingen bereits manche von ihren Bildern unter dem Namen des Rembrandt, und erst in den letzten drei Jahrzehnten steuerte die neue Generation der Rembrandt-Forschung intensiv darauf los, das Werk des holländischen Großmeisters zu revidieren.
Man darf bei der Berührung dieser außerordentlich interessanten Frage nicht übersehen, daß seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, seit dem Beginn der Forscher- und Museumstätigkeit Wilhelm Bodes, die Wärme für Rembrandt sowie überhaupt für die Malerei seiner Heimat und seiner Epoche immer stärker wurde und daß auch die Marktpreise für die holländischen Meister immerzu in die Höhe gingen. In England wertete man den Besitz an Rembrandt und dessen Kreise höher, in Amerika wurde es lebendiger um die Kunst, – denn seit Pierpont Morgan wuchs die Zahl der kunstfreudigen Milliardäre –, und auch in Deutschland erweiterte sich, dank Bode, die Gemeinde jener Kunstsammler, die auf die Qualität der Werke sahen. Bodes Blick, der einzig war, ging in die gesamte internationale Kunstwelt, und die Folge war, daß einerseits jene, welche Rembrandt besaßen, ihre Schätze anders zu bemessen vermochten, und daß andererseits der Kunsthandel, bei all dem vielen Geld, das er verdiente, nicht so viel Material heranschaffen konnte, als die »neuen Sammler« zu brauchen schienen.
Man sprach zwar von 60 bis 70 » verschollenen« Rembrandts, von zahlreichen Repliken (Wiederholungen), die der Meister eigenhändig ausgeführt habe, aber das Pech war, daß man sie nicht auf der Stelle zur Stelle schaffen konnte. Und darum stieg auch der Respekt vor der Rembrandt-Schule. Was durchaus verständlich ist. Indem man Rembrandt-Schüler kaufte, hoffte man, selbst ein kleines Stückchen Rembrandt mitzukaufen. Denn mit dem Fälschen des Rembrandt ging es weniger leicht und lebhaft als mit dem Abstempeln von echten Schulbildern zu »echten« Rembrandts. Das aber ist kaum zu bestreiten, daß eine derartige Prozedur zu einer Anhäufung von Gemälden führen mußte, die zwar etwas Rembrandteskes hatten, aber weil sie nicht für durchaus echte Rembrandts galten, ein Ballast für die Forschung wurden. Abraham Bredius öffnete der Sammlerwelt die Augen, und Wilhelm Martin, der abgesehen davon, daß ihm der Kennerblick angeboren ist, von seinem Lehrer und seinem Vorgänger Bredius in der Leitung des Mauritshuis im Haag gelernt hat, wie Rembrandt zu sehen ist, wuchs bald zu dem Rembrandt-Forscher von internationalem Ruf heran. Und Bredius und Martin bildeten sozusagen die neue Partei, während Bode, Hofstede de Groot und Bodes Schüler Valentiner auf der »alten« Seite standen. So spielten sich, als Valentiners Neubearbeitung des Rembrandt-Werkes erschien, heftige Kämpfe ab, und man focht sie, zum Hauptteil, in Donaths »Kunstwanderer« (Berlin) von 1921 bis 1923 aus.
Martin veröffentlichte in meiner Kunstzeitschrift, die von 1919 bis 1933 erschienen ist, eine Reihe von Aufsätzen unter dem Titel »Rembrandt-Rätsel«. Er beschäftigte sich mit Valentiner, sagte frei heraus, was er meinte, und das hatte die Wirkung, daß sich Hofstede de Groot gegen Martin stellte und daß Bode im »Kunstwanderer«, deren eifrigster Mitarbeiter er vom ersten Hefte an war und bis zu seinem letzten Atemzug (1. März 1929) blieb, einen Aufsatz schrieb »Die Rembrandt-Forschung in Gefahr?«. Bode trat hier für die »Alten« ein und legte den jüngeren Kollegen nahe, vor allem nicht an die Stelle der alten Benennungen von Schulbildern wie »Flinck«, »Eekhout« usf. neue noch zweifelhaftere Namen zu setzen, wenn ein glücklicher Fund ein oder zwei Bilder eines van der Pluym oder Jouderville zutage gefördert hat. Und einige Monate darauf veröffentlichte wieder Martin im »Kunstwanderer« einen Beitrag »Zur Rembrandt-Forschung«, der überall Aufsehen erregte. Er betonte nämlich, daß auch »das System der Rembrandt-Forschung« eine Entwicklung durchmacht. »Das Bestimmen ausschließlich nach dem impulsiven Empfinden wird«, sagt der holländische Kenner, »ebensowenig mehr als richtig betrachtet wie die Methode, um nur graphologisch, d. h. nach den Pinselstrichen und der Malweise zu bestimmen. Man beginnt – und das mit Recht – es stets lauter zu tadeln, daß nicht auch immer ein genaues Abwägen des rein künstlerischen Gehaltes stattfindet. Ob einer Arbeit genügend individuelle Kraft und das Temperament innewohnt, um dieselbe einem bestimmten Meister zuschreiben zu können, ob sie den Schönheitsbegriffen und den wechselnden Idealen des Meisters entspricht oder nicht, ob sie geistig seiner würdig ist – auf dies alles sollte dauernd mehr Wert gelegt werden, und das Gefühl dafür sollte unser historisches und graphologisches Wissen leiten und beherrschen«.
Die Erkenntnis der künstlerischen Gestaltung, die Martin dann erwähnt, hatte auch schon das Ergebnis, daß inzwischen zahlreiche Bilder »ent-Rembrandt'et« worden sind, z. B. der berühmte »Neger« der Wallace-Collection in London, der jetzt als »Schule Rembrandt« etikettiert ist. Auch ein anderer Rembrandt der Wallace Collection (Valentiner, Nr. 146, und hier ebenfalls ohne jeden Vorbehalt als echt verzeichnet) wurde Martin zur Prüfung vorgelegt, und der Rembrandt-Forscher erkannte darin eine Fälschung, die »von demselben einstweilen noch unbekannten Nachahmer« stammt, von dem W. Martin »auch früher schon flüssig und barock hingeworfene Bilder vorgekommen sind«. Und ein dritter Rembrandt, der weder im großen Bode- de Groot- Sedelmeyer-Werk, noch bei Valentiner mit irgendwelchem Vorbehalt erwähnt wird, ist der sogenannte »Architekt« der Gemäldegalerie Kassel. (Abb. 10.)
Aber schon in dem von Georg Gronau, dem langjährigen Leiter der Galerie Kassel bearbeiteten Katalog von 1913 heißt es wörtlich: »Die Urheberschaft Rembrandts wird von maßgebenden Kennern bestritten«. Und der Kenner Gronau selbst ist gegen die Echtheit, denn in seiner Schrift »Meisterwerke in Kassel« meint er von dem »Architekten«, eine »gewisse Flauheit im Ganzen« lasse sich nicht übersehen; Rembrandts Pinsel »sonst von markiger Hand fest und bewußt geführt, erscheint hier etwas unbestimmt; man vermißt die klare Sicherheit des Materiellen. Am ehesten läßt sich das bei der Wiedergabe des Bartes klarmachen, der nicht aus Haaren, sondern wie aus Watte gebildet zu sein scheint. Gronau weist schließlich auf »Jakobs Segen« und das gleiche Jahr der Entstehung 1656 hin und meint, daß »unmöglich ein und derselbe Maler diese beiden Greisenfiguren gemalt haben kann«. Die Signatur verschwand übrigens nicht lange nachher von dem Bildnis.
Martin ist auch, als er den Beitrag »Zur Rembrandt-Forschung« verfaßte, von Hans Schneider, seinem ersten Assistenten in der Kgl. Gemäldegalerie im Haag und dem jetzigen Direktor des »Rijksbureau voor kunsthistorische en ikonographische Documentatie« im Haag auf Karl Neumanns Urteil über den Kasseler »Architekten« aufmerksam gemacht worden. Der Heidelberger Rembrandt-Biograph verschweigt nicht, daß wir »nicht hinsichtlich der Erfindung, aber in der farbigen Durchführung die Zweifel so vieler teilen, ob dieser Kasseler sogenannte »Architekt« eigenhändig von Rembrandt herrühre. Martin kommt nun zu dem Schlusse, daß der »Architekt« kein Rembrandt ist, sondern eine »alte Kopie nach einem verschollenen Original«, die auf Grund der Erwähnung des Bildes im Kasseler Inventar (1749) spätestens aus dem 18. Jahrhundert sein kann. Und schon das Beispiel dieses Architekten zeigt, wie notwendig die Revision des Rembrandt-Oeuvre ist, die der Forscher fordert, und daß man jene Fälle studieren muß, wo man nicht mit historisch belegten oder ganz typischen Bildern zu tun hat. Natürlich gibt es, schreibt dann W. Martin noch in seinem grundlegenden Buche »Altholländische Bilder« (Berlin, 1922), einige Museumsleitungen, die es »geradezu für ein Unglück ansehen würden, wenn »der« Rembrandt ihrer Galerie keiner sein sollte, und die sich deshalb ängstlich an den Namen klammern und, – mitunter noch von der öffentlichen Meinung gestützt –, sich einreden, daß die Kritik im Unrecht sei«.
Aber Rembrandt ist ein solcher Koloß, daß er selbst beim einfachen künstlerischen »Schreiben«, ich will damit sagen: in seiner einfachsten Handzeichnung als Rembrandt zu erkennen ist. Und wenn Leonardo behauptet, daß jedes Bildnis bis zu einem gewissen Grade zu einem Selbstbildnis des Künstlers wird, so trifft das auf jedes einzelne gezeichnete Blatt des holländischen Großmeisters zu. Selbst den Leonardo und alle die Großen der italienischen Malerei übertrifft er hier an beseelter Schlichtheit und Lebendigkeit, ebenso auch den Dürer, den er gesammelt hat, weil er ihn liebte, und nicht zu reden von seinen zeitgenössischen holländischen und flämischen Kollegen (Frans Hals wie Rubens). Aber weil uns eben in seiner Zeichnung schon die sparsamste Linie wie ein Bildvorgang vorkommt, nicht etwa wie eine Arabeske, sondern wie ein kulturdurchströmter Organismus, können wir die Nachahmer seiner künstlerischen Handschrift schnell herausfinden. Wer Zeichnungen von Samuel van Hoogstraten oder Philipps Koninck sieht, in denen der Rembrandtsche Ductus (Zug) virtuos imitiert ist, weil er den Schülern in Fleisch und Blut übergegangen war, merkt sofort die Unterschiede. Und das gleiche Gefühl haben wir bei jenen Blättern, die zwar heute zum Teil unter dem Namen Rembrandts gehen, doch kaum mehr bedeuten als zeitgenössische Kopien nach eigenhändigen verschollenen Arbeiten des Meisters. Aber Friedrich Lippmann, der Prager, und Hofstede de Groot, der Holländer, haben das Zeichnungswerk Rembrandts geordnet, und auch Valentiner in Detroit (in U. S. A.), der sich an Hofstede de Groot hält, bringt in seinem Werk »Rembrandts Handzeichnungen« Hinweise auf die Kopisten und Fälscher, die sich in erster Linie aus der künstlerischen Sphäre des Rembrandtschen Ateliers rekrutierten.
Naturgemäß wagten sich die routiniertesten und besten Schüler des großen Holländers auch an seine Graphik heran. Rembrandts Graphik ist allerdings ein Gebiet für sich. Sie ist ebenso einzigartig, wie seine Malerei, wie seine Zeichnung. Obgleich er aber graphische Blätter seiner Schüler öfter signiert hat, werden manche von den Platten angezweifelt. Denn wer sich in der Graphik Rembrandts auskennt, d. h. wer den Blick hat für die unzähligen Feinheiten und Tiefen der Blätter, wird auch hier klar sehen können. Machen wir doch ein paar Stichproben! Der unter B. 102 = Bartsch 102 beschriebene »Heilige Hieronymus im Gebet« ist zwar »Rembrandt f. 1635« signiert, entfernt sich aber durch die etwas gezwungene Haltung des Kopfes von der üblichen Rembrandtschen Natürlichkeit. Und geht man auf die Details ein, dann findet man, daß z. B. die Barthaare etwas wirr angedeutet sind. Auch der Löwe im Hintergrund hat nicht die Spur des Plastischen im Rembrandtschen Körper. Oder »Der Reiter«, B. 139: er ist bezeichnet: RHL und dürfte um 1632 entstanden sein. Doch selbst wenn es nur um ein paar eigenhändige Linien des Meisters ginge, würde uns allein schon der Rembrandtsche Geist im Umriß fesseln. So aber, wie in dem von Bartsch unter Nr. 139 beschriebenen Blatt, hat Rembrandt niemals ein Pferdchen gesehen; der Reiter ist schlapp fixiert und seine Linke, in der die Lanze baumelt, sieht wie verkümmert aus.
Derlei Blätter müssen in die Abteilung der Fälschungen eingereiht werden, aber es sind, trotz allen Mängeln, Künstler-Fälschungen, weil sie nur von den Schülern Bol, Lievens usw. ausgeführt worden sein können. Selbstverständlich soll der Sammler auch die Struktur des Papiers kennen, das für die der Kupferplatte genommenen Drucke verwendet worden ist. Von den Originalplatten Rembrandts, die das Cabinet de Basan in Paris aufgekauft hatte, sind schon 1786 zahlreiche Neudrucke hergestellt worden, 12 Jahre später wiederholte sich die Drucklegung, und 1809 erschienen nicht weniger als 85 Neudrucke. Und zum 300. Geburtstage Rembrandts (1906) kamen in Paris 78 Abzüge heraus, die mitunter schärfer aussahen als die Basan-Drucke. Allerdings konnten sich die neuen Rembrandt-Blätter in keiner Weise mit den Originaldrucken messen, die sich noch ihre alte unvergängliche Frische bewahrt haben. Dennoch gab es eine Menge von Graphiksammlern, die sich dupieren ließen. Jeder, der die Graphik Rembrandts sammelt, muß sich schließlich mit der einschlägigen Literatur beschäftigen, und er muß auch immer wieder die Originalblätter mit den neueren Drucken vergleichen. Nur so kommt man zu jenem augenblicklichen Erkennen von Rembrandts Künstlerhandschrift, das vor Fälschungen schützen kann.
Immun sind freilich selbst die besten Kenner nicht. Das bestätigt z. B. der besondere Fall einer Frans Hals-Fälschung. Über Frans Hals, diesen zweiten holländischen Großmeister, und sein enormes Künstlertum sind die Akten längst geschlossen. Wer die holländischen Maler des 17. Jahrhunderts kennt und mit offenen Augen durch die Galerien geht, weiß, wie stark der große Harlemer auch auf die moderne Kunst, besonders auf die französische und deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts eingewirkt hat. »Wenn man Frans Hals sieht«, sagte einmal Max Liebermann, als er vor Rembrandts Nachtwache stand, »bekommt man Lust zum Malen, wenn man Rembrandt sieht, möchte man es aufgeben«.

Abb. 10.
Rembrandt: Der sogenannte »Architekt«, Kassel, Gemäldegalerie. D
ie Eigenhändigkeit ist von Martin, Gronau, Neumann angezweifelt.

Abb. 11. Die Signatur des holländischen Großmeisters auf seiner »Nachtwache«.
Amsterdam, Rijksmuseum.

Abb. 12. Rembrandts Signatur auf dem Bilde des Berliner Kaiser-Friedrich-Museums »Moses die Gesetzestafeln zertrümmernd«
(nach A. Heppner: »Moses als Bringer des Gesetzes«).
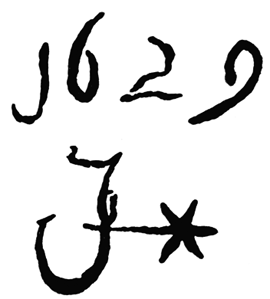
Abb. 13. Die Frans Hals-Schülerin und -Nachahmerin Judith Leyster signiert mit einem Stern, dem Leitstern, holländisch: Leijster.

Abb. 14. Barent Fabritius: kaligraphische Signatur mit der Feder.
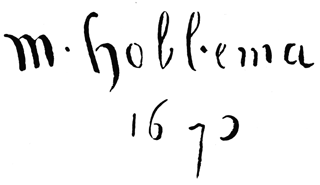
Abb. 15. Signatur auf dem Meindert
Hobbema »Eine westfälische Wassermühle«, ehemals Sammlung Consul Weber, Hamburg.
Das Bild, das Bredius 1886 für echt erklärt hat, wurde von W. Martin (Alt-Holländische Bilder, 2. Aufl., Berlin 1921) als falsch bezeichnet.
Im Falle Rembrandt sagte ich schon, man könne Rembrandt eigentlich nicht fälschen, aber mit Frans Hals steht es doch anders. Dieser holländische Meister nutzt den Augenblick. Und da er der stärkste Vorläufer des Eduard Manet ist, der Maler der impressionistischen Wucht, mit der er den Farbfleck neben den Farbfleck setzt und hinwirft, und da er nebenher ein Künstler ist, den man »marktlich« sehr hoch einschätzt, versuchen es die Könner unter den Fälschern, die auch mit den Techniken des modernen französischen Impressionismus vertraut scheinen, mit dem alten Holländer Frans Hals. Und so tritt eines Tages bei einem Sammler ein »Lächelnder Kavalier« auf, den C. Hofstede de Groot als »authentisches« Bild des Frans Hals bestimmt und den dann ein Kunsthändler für 50.000 holl. Gulden ankauft. Als sich aber nach einiger Zeit herausstellt, daß man es hier mit einer modernen Fälschung zu tun hat, nicht etwa mit einem Bild der Judith Leyster, die eine Schülerin des großen Harlemers gewesen ist und mitunter so überraschend impulsiv gemalt hat »wie« Frans Hals, wurde dem Sammler der Prozeß gemacht. Der Sammler wollte nämlich zunächst die besagten 50.000 Gulden nicht zurückzahlen, weil Hofstede de Groot an seinem Urteil festhielt.
In dem Prozeß, der sich aus der Geschichte ergab, wurden drei Sachverständige gehört: der Direktor der Kgl. Gemäldegalerie im Mauritshuis im Haag, Professor Dr. W. Martin, der Direktor der National Gallery in London Sir Charles Holmes und Dr. E. C. Scheffer, der Chemiker der Delfter Technik. Martin und Charles Holmes hatten aber ihr Gutachten, das auf eine moderne Fälschung lautete, noch vor der Erstattung des chemischen Berichtes abgegeben. Der chemische Bericht nun ergänzte und stützte das stilkritische Gutachten der beiden Kunstkenner, indem er feststellte, daß in der Malerei des »Lächelnden Kavaliers« z. B. Ultramarin und Kobaltblau mikroskopisch festgestellt worden sind, die erst nach 1820 in Gebrauch gekommen waren und Zinkweiß, das man erst seit dem Jahre 1780 verwendet hat. Auch mit dem Röntgenapparat wurde gearbeitet. Er deckte unter der Farbschicht Drahtnägel auf, die man ja erst seit dem 19. Jahrhundert kennt. Kunstwissenschaft und Technik gingen hier also Hand in Hand. Hofstede de Groot, der hervorragende Holländer-Kenner, – Irren ist eben menschlich –, war diesmal »hereingefallen«. Womit aber seine großen Verdienste um die Kunstforschung nicht geschmälert werden sollen! Sie werden bleiben!