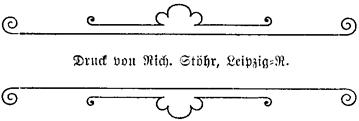|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Zersprengung des größten seiner Geschütze hatte den General Miller der Verzweiflung nahe gebracht; ein Gefühl vollkommener Machtlosigkeit hatte ihn ergriffen. Die ohnehin schon entmutigte Armee gewann nach diesem Vorfall den festen Glauben an die Uneinnehmbarkeit der Veste. Er berief seine Stabsoffiziere zu einer Beratung am nächsten Morgen, nach der Auslieferung Kmiziz's an Kuklinowski. Sie erschienen vollzählig, nur die drei Polen fehlten. Anstatt zu den Beratungen überzugehen, ließ Miller Glühwein in reichlicher Menge bringen, um die Frierenden zu erwärmen, vielleicht auch, um die Sinne der Beteiligten etwas zu benebeln und auf diese Weise von den später gesprächig werdenden leichter zu erfahren, was jeder von ihnen wirklich dachte.
Endlich begann er:
»Ihr habt wohl schon bemerkt, meine Herren, daß keiner von den polnischen Herren Hauptleuten meinem Rufe gefolgt ist.«
»Ew. Liebden ist sicherlich bekannt,« versetzte einer der Herren, »daß die polnischen Troßbuben beim Fischen einen eisernen Kasten mit dem Silberzeug des Klosters gefunden haben und daß deswegen eine Schlägerei zwischen ihnen und unseren Soldaten stattgefunden hat, wobei etliche Menschen das Leben eingebüßt haben.«
»Ich weiß,« entgegnete Miller. »Es gelang mir noch, ihnen einen, und zwar den größeren Teil desselben, zu entreißen. Wahrscheinlich hat das die Polen gegen uns verstimmt. Nach reiflichem Ueberlegen habe ich beschlossen, das Silberzeug den Mönchen zurückzugeben. Vielleicht erreichen wir durch Güte und Entgegenkommen etwas bei diesen Geizkragen; sie sollen wissen, daß es uns nur um die Veste und nicht um ihre Reichtümer zu thun ist.«
Die Offiziere machten bei dieser Großmutsäußerung des Generals ganz verblüffte Gesichter. Endlich sagte Sadowski:
»Das ist das Beste, was damit geschehen kann; denn gleichzeitig wird den polnischen Hauptleuten der Mund gestopft und im Kloster ein guter Eindruck gemacht werden.«
»Den nachhaltigsten Eindruck werden sie durch die Kunde von dem Tode Kmiziz's erhalten,« versetzte Wrestschowitsch. Kuklinowski muß ihn schon abgelodert haben.«
»Auch ich denke, daß er schon tot sein muß,« sagte Miller. »Dieser Name erinnert mich wieder an unseren großen Verlust. Ich hatte meine ganze Hoffnung auf dieses eine Geschütz gesetzt, die anderen taugen alle nichts. Je länger ich darüber nachdenke, desto größer erscheint mir die erlittene Niederlage, und das alles hat ein einziger Mensch zu Wege gebracht ... dieser Hund! ... Es ist zum Verrücktwerden.«
Miller hatte sich so in Zorn geredet, daß er auf den Tisch aufschlug und eines der Krystallgläser herunterwarf. Das Glas zersprang in kleine Splitter.
»Ratet mir, meine Herren!« rief er. Aber keiner der Herren wollte das erste Wort sprechen, welches so leicht verhängnisvoll werden konnte. Endlich, nach längerer Pause sagte der Fürst von Hessen:
»Gebt uns einen Gegenstand der Beratung, Herr General. – Sollen wir darüber beraten, ob wir die Belagerung fortsetzen, oder darüber, ob wir sie aufgeben sollen.«
Der General umging absichtlich die direkte Antwort auf dieses Entweder, Oder.
»Herr Sadowski,« wandte er sich an diesen. »Eure Reputation sichert euch vor jeder Verdächtigung. Sprecht offen; ihr waret es ja auch, weicher zuerst riet, die Belagerung aufzugeben.«
»Mit Verlaub, Ew. Liebden! Ich riet nur, sie überhaupt nicht anzufangen. Das ist ganz etwas anderes. Von da ab überließ ich dem Grafen Wrestschowitsch das Wort und lasse es ihm auch heute.«
Miller fluchte wie ein Heide. »Wrestschowitsch muß für die ganze Expedition verantwortlich gemacht werden,« rief er.
»Ich lehne diese Verantwortung ab,« entgegnete Wrestschowitsch, »man hat nicht alle meine Anordnungen befolgt, sondern lieber die Stimme derjenigen gehört, welche stets zur Milde gegen die Mönche rieten. Wäre man energisch vorgegangen, so säßen wir längst hinter jenen Mauern. Aber ich weiß noch ein Mittel, die dort drinnen zur Kapitulation zu zwingen.«
»Welches ist das? Sprecht, Graf!« riefen gleichzeitig mehrere Stimmen.
»Wir müssen noch einmal einen Parlamentär hinaufschicken mit der Benachrichtigung, daß es unserem Ingenieur gelungen ist, eine Mine in den Felsen zu legen, welche in einen Gang mündet, der bis unter das Kloster führt, aber von oben vermauert ist. In diesen Gang sind eine Menge Pulverfäßchen gebracht worden, mittels welcher die Kirche und das Kloster in die Luft gesprengt werden sollen, wenn die Uebergabe nicht sofort stattfindet. Wenn diese Nachricht von einem unserer Polen hinauf gebracht wird, dann wird er selbst im Namen aller Polen zur Uebergabe raten.«
»Der Gedanke ist gut,« sprach Miller, welcher wie der Ertrinkende nach dem Strohhalm griff. »Ob aber Kalinski oder Sbroschek die Botschaft übernehmen werden?«
»Wenn keiner von beiden, dann Kuklinowski bestimmt,« meinte Wrestschowitsch. »Freilich wäre es gut, wenn man auch ihn überzeugen könnte, daß die Mine wirklich vorhanden ist.«
In diesem Augenblick hielt ein Reiter vor dem Quartier.
»Herr Sbroschek ist angekommen!« sagte der Fürst von Hessen, welcher zum Fenster hinausgesehen hatte.
Gleich darauf stürmte der Angekommene in die Versammlung. Sein Gesicht war vor Erregung kreideweiß und ehe noch die Offiziere nach der Ursache dieser Bestürzung fragen konnten, rief der Hauptmann: »Kuklinowski ist tot!«
»Was? Wie? Was ist geschehen? Ist er ermordet? Von wem?« rief es entsetzt durcheinander.
»Ermordet! Wahrscheinlich von Kmiziz!« sprach Sbroschek. Und nun erzählte er stockend und in Pausen, wie er am Morgen mit zwei Sekundanten ausgeritten sei, um Kuklinowski zum Zweikampf zu fordern für den Fall, daß er eine widerrechtliche Handlung mit Kmiziz vorgenommen habe. Er sei dies seiner Reputation als polnischer Edelmann schuldig gewesen, da man ihm sonst hätte nachsagen können, er habe Anteil an dem Verbrechen eines Schuftes. Kuklinowski war aber weder im Lager, noch in seinem Quartier aufzufinden gewesen. Endlich habe ihm ein Soldat gesagt, daß der Hauptmann gestern Abend mit Kmiziz zu der einsamen Feldscheune geritten sei. Als er mit den Sekundanten dort angelangt und eingetreten war, da habe sich ihnen ein Anblick geboten, der aller Beschreibung spotte. Zuerst hatten sie gemeint, Kmiziz dort hängen zu sehen, doch als sie die drei getöteten Soldaten auf der Tenne der Scheune erblickt, da hatten sie den Hängenden naher betrachtet und – Kuklinowski in ihm erkannt. Seine Seite war verbrannt; der Schnurrbart und die Augenbrauen versengt, seine eigene Mütze steckte ihm im Munde, man wußte nicht, war er erstickt oder erfroren.«
Entsetzen machte die ganze Gesellschaft verstummen. Miller raufte sich die Haare. Endlich wandte er sich an die Offiziere:
»Wer von den Herren begleitet mich auf die Unglücksstätte?« frug er.
Es erklärten sich alle bereit, denn die Neugier trieb sie hin. Als sie sich der Scheune näherten, erblickten sie einige polnische Reiter, welche sich verstreut um dieselbe herumdrückten.
»Was sind das für Leute?« frug Miller.
»Sie müssen von Kuklinowskis Abteilung sein,« antwortete Sbroschek, »die Mannschaften sind ganz toll vor Aufregung ...«
Miller winkte einen der Reiter heran. »Seid ihr von der Abteilung Kuklinowski?« frug er.
»Jawohl!«
»Wo befindet sich die Abteilung?«
»Sie hat sich vollständig aufgelöst. Keiner von ihnen mag mehr den Kampf gegen das Kloster weiterführen; sie sind nach Schlesien geflohen und beabsichtigen sich unter das Kommando Kmiziz zu stellen.«
Als Miller diese Aussage verdolmetscht wurde, blickte er besorgt vor sich hin. Das konnte eine bedrohliche, ernste Sache werden; die Gefahren häuften sich um ihn. Unterdessen waren sie in der Scheune angelangt. Man hatte den Toten zugedeckt. Miller befahl, die Hülle fortzuziehen.
Der Anblick war ein so entsetzlicher, daß die Offiziere sich voll Ekel abwandten und Miller am ganzen Leibe zitterte. Düsteres Schweigen bemächtigte sich aller.
Plötzlich erschollen Gewehrschüsse, Pferdegetrappel kam näher und eine Stimme vor der Scheune rief:
»Herr General! Die vom Kloster haben einen Ausfall gemacht. Die Ingenieure, welche an der Mine arbeiteten, sind alle tot, die Abteilung versprengt!«
»Ich werde noch wahnsinnig,« schrie Miller und sprang auf das Pferd. Seine Offiziere folgten ihm; im Galopp gings zurück. Sie fanden das ganze Lager im Aufruhr und Unordnung und selbst diejenigen Schanzen verlassen, welche gar nicht gefährdet waren. Sie kamen noch rechtzeitig, um zu sehen, wie die Sieger ruhig in das Thor der Veste einzogen und dasselbe hinter sich schlossen.
Der General Miller war wie gelähmt; er ritt nach seinem Quartier, schloß sich daselbst ein und blieb den ganzen Tag unsichtbar. Statt seiner ergriff Wrestschowitsch das Kommando. Er ließ sehr energische Vorbereitungen zur Erstürmung der Veste treffen, an Stelle der Ingenieure mußten Soldaten an den Sprengarbeiten weiterarbeiten. Vor allem aber verbreitete er im ganzen Lager die Nachricht von der Entdeckung des geheimen Zuganges zum Kloster, durch welchen man demselben das Verderben bereiten wolle. Im Lager wurden Friedensäußerungen laut. Man sang, lachte und auf allen Schanzen hörte man Rufe:
»Wir haben Tschenstochau! Endlich wird die Veste unser!«
Binnen kurzem war die Kunde davon auch in das Kloster gedrungen und hatte sich dort mit Blitzesschnelle verbreitet. Die Wirkung war eine niederschmetternde; selbst die Mutigsten überkam ein Angstgefühl und die Furchtsamsten bedrängten den Pater Prior arg. Besonders aber waren es die Frauen, welche seine Wohnung förmlich belagerten, um Erbarmen und Mitleid für sich und ihre Kinder flehend. Die Aufregung war unbeschreiblich. Man glaubte schon das Geräusch der an der Mine Arbeitenden dicht unter sich zu hören und zu spüren.
Die schwersten und schmerzreichsten Stunden seines Lebens hatte Pater Kordezki jetzt durchzumachen, denn auch ein großer Teil der Mönche erschien, der Pater Stradomski an der Spitze, bei dem Prior, um ihn zur sofortigen Uebergabe der Veste zu drängen. Der größte Teil der Soldaten und einige Edelleute hatten sich ihnen angeschlossen.
Es war mittlerweile, seit der ersten Kenntnisnahme der Kunde von der Unterminierung des Klosters und der drohenden Gefahr, der dritte Tag verflossen. Als der Pater Prior die aufgeregte Versammlung vor seinem Zellenfenster sah, trat er hinaus in den Klosterhof und dicht umringt von einem großen Kreise angstvoller Bittsteller hub er also zu sprechen an:
»Haben wir uns denn nicht gelobt, diesen heiligen, gottgeweihten Ort bis zum letzten Blutstropfen zu verteidigen? Wahrlich! ich sage euch! Sollte es wahr sein, daß die Feinde bis unter das Gewölbe der Kirche vorgedrungen sind, selbst dann – was haben wir zu verlieren? Sind es denn nicht nur unsere Leiber, welche zerschmettert zur Erde zurückkehren, während unsere Seelen zum Himmel emporsteigen, wo Christus, unser Heiland, mit seiner gnadenreichen Mutter unser wartet? Gott hat mich auf diesen Platz gestellt; ich darf ihn also nicht verlassen und er, der mir dieses Amt verliehen, er wird mir auch die Kraft geben, dieses Heiligtum zu schützen. Ich sage euch! Und wären dort unten Hunderte von Pulvertonnen zusammengetragen und in Brand gesetzt, um uns in die Luft zu sprengen – ich fühle die Kraft des Geistes in mir, durch den Segen meiner Hand die Flamme zu verlöschen, die sie entzünden sollen. Der heilige Geist hat mich erleuchtet; er spricht durch mich zu euch: Es ist nicht wahr. Die Feinde lügen! Es giebt gar keine Mine unter dem Kloster, es ist nichts dort, was unser Leben und dieses Heiligtum bedroht! Und wenn ich nun im Namen Gottes zu euch spreche, wer wagt es noch zu zweifeln und mir dagegen zu reden?«
Er schwieg. Seine Stimme war fest, während er gesprochen, sein ehrwürdiges Antlitz durchleuchtet vom überirdischen Glanze eines felsenfesten Glaubens. Kein Mensch in der ganzen Versammlung sprach; Totenstille herrschte, die Gemüter begannen sich zu sammeln. Endlich ertönte aus der Mitte des Gedränges die Stimme eines schlichten Bäuerleins, welches rief:
»Gelobt sei der Name des Herrn! ... Sie drohen uns seit drei Tagen, uns in die Luft zu sprengen, warum thun sie es nicht?«
»Ja, warum nicht?« riefen einige andere Stimmen.
Plötzlich, wie eine Antwort auf diese Fragen, hörte man in der Luft ein leises Rauschen. Ueber den Köpfen der Versammelten erschien eine dunkle Wolke und eine Menge Wintervögel aller Gattungen schwebte flügelschlagend erst einen Augenblick über ihnen, senkten sich nieder und setzten sich furchtlos auf die Dächer, die Mauern und den Hof des Klosters.
Erstaunt blickte die Menge auf die Ankömmlinge. Pater Kordezki aber faltete die Hände und sagte:
»Sehet! Die Vögel des Waldes kommen zu uns; sie flüchten sich unter den Schutz der heiligen Jungfrau, wie wollt ihr da an ihrer Macht zweifeln?«
Trost und Zuversicht kehrte in die Herzen zurück. Die Frauen eilten, Körner für die Ankömmlinge zu holen und sie ihnen hinzustreuen.
Ein Soldat aber sagte, auf die Vögel weisend:
»Wenn diese da bis hierher geflogen kommen, so muß sehr viel Schnee draußen liegen, und daß sie nicht unten bei den Schweden geblieben sind, ist der beste Beweis davon, daß sie im Lager nichts mehr zu beißen haben.«
»Ist das wahr?« fragen mehrere Stimmen.
»So wahr, wie das Amen im Vaterunser.«
Noch am Abend desselben Tages kam ein Brief von Miller, der ihnen androhte, das Kloster in die Luft zu sprengen. Der Konvent wurde einberufen, aber die ehrwürdigen Väter hatten wieder Mut gefaßt. Sie antworteten darauf: »Warum schont ihr uns noch? Je eher wir in den Himmel kommen, desto besser für uns!« Nachdem wieder ein ganzer Tag verstrichen war, ohne daß Miller seine Drohung wahr machte, da waren alle im Kloster überzeugt, daß der Pater Prior recht gehabt hatte.
Nur das Bombardement dauerte fort.
Unterdessen war der Weihnachts-Heilig-Abend herangekommen. Die alte Konstantia, die Klosterbettlerin, war mit einem Briefe des Pater Prior an Miller in das Lager gegangen, welcher die Bitte enthielt, die Beschießung des Klosters wenigstens am ersten Weihnachtsfeiertage einzustellen. Sie wurde von den Wachen mit Hohn und Gelächter empfangen, aber sie machte sich nichts daraus und antwortete ihnen dreist:
»Da ihr Gesandte wie Raubmörder behandelt, so wollte niemand zu euch kommen, und ich erbot mich für ein Stückchen Brot, hierherzugehen. An mir ist nichts gelegen; ich fürchte euch nicht, thut mit mir, was ihr wollt.«
Sie thaten ihr aber nichts, sondern ließen sie unbehelligt gehen. Der General wollte noch einmal in Güte eine Auseinandersetzung versuchen. Er gewährte die Bitte, entließ für ein Lösegeld einen zu Tote gemarterten Bürger Tschenstochaus, Namens Brschuchanski, weichen die Schweden gefangen hatten, als er in Verkleidung Fische ins Kloster brachte, und sandte ihnen das aufgefischte Silbergerät zurück.
Der heilige Abend war angebrochen. Während die Schweden draußen auf den Schanzen froren und an die warmen Mooshütten ihrer skandinavischen Heimat dachten, saßen oben im Kloster die Mönche an Tischen, welche statt des Leinenzeuges mit Heu überstreut waren, und brachen die Oblaten. Sie beglückwünschten sich gegenseitig der Sitte gemäß, waren guter Dinge und voll froher Hoffnung, daß die Belagerung bald ihr Ende erreicht haben werde. Neben dem Platze des Priors war ein Platz freigelassen. Ein Teller stand davor, auf welchem ein Päckchen mit blauem Bande zusammengehaltene Oblaten lag.
Als alle Platz genommen hatten und der Herr Schwertträger Samojski den leeren Stuhl gewahrte, sprach er:
»Wie ich sehe, habt ihr, ehrwürdiger Vater, alter Sitte gemäß einen Platz für die Herren vom Berge freigelassen.«
»Doch nicht!« antwortete der Pater Prior. »Nicht für die Herren vom Berge, sondern zum Gedächtnis jenes Jünglings ist der Platz frei gelassen, welchen wir alle lieben wie einen Sohn, und dessen Seele vielleicht jetzt freundlich auf uns herniederblickt, weil wir ihm ein dankbares Andenken bewahren.«
»Bei Gott! ihm ist wohler als uns,« sagte Herr Samojski. »Wir sind ihm großen Dank schuldig.«
Dem Pater Kordezki stauden die Thränen in den Augen.
»Es werden weniger verdienstvolle Männer als er in den Annalen der Geschichte genannt,« sprach Herr Tscharniezki. »Ich will dafür Sorge tragen, daß als größter Held bei der Verteidigung Tschenstochaus Babinitsch genannt wird.«
»Er heißt nicht Babinitsch,« versetzte der Pater Kordezki. »Ich kannte seinen wahren Namen schon lange; er hat ihn mir unter dem Beichtgeheimnis bekannt. Erst als er vor seinem Ausgange zu seiner letzten Heldenthat Abschied von mir nahm, sagte er zu mir: ›Wenn ich falle, dann kann die Welt meinen wahren Namen erfahren, damit, wenn meine letzte That die früheren Sünden ausgetilgt hat, derselbe in Ehren genannt werden kann.‹ Er ist gegangen und im Dienste Gottes und des Vaterlandes gefallen, nun kann ich es euch sagen: – er hieß Kmiziz!«
»Wie? Jener litauische Kmiziz?« rief Herr Tscharniezki außer sich. »O, hätte ich doch das gewußt!«
»Mich nimmt nur Wunder,« sagte Herr Samojski ebenso überrascht, »daß die Schweden sich seines Todes nicht gerühmt haben.«
Der Pater Prior seufzte.
»Der Luftdruck muß ihn auf der Stelle zerrissen und unkenntlich gemacht haben,« sprach er.
»Ich gäbe meine rechte Hand darum, wenn er noch lebte,« sagte Herr Tscharniezki.
»Er hat sein Leben für uns zum Opfer gebracht,« versetzte Pater Kordezki, »denn läge jenes Geschütz noch dort oben auf der Schanze, dann säßen wir hier nicht so fröhlich in Erwartung des kommenden Tages.«
»Morgen wird uns Gott einen neuen Sieg bescheeren,« setzte Pater Kordezki hinzu, »denn die Arche Noah ging in der Sintflut auch nicht unter.«
Die Nacht war feierlich. Ganze Schwärme Sterne leuchteten am Himmel, der Mond warf einen blaßgrünlichen Schimmer über die Schneeflächen, welche sich zwischen dem Kloster und dem Lager hinzogen. Kein Lüftchen wehte, eine tiefe Stille waltete ringsum, ein Friede, wie er seit dem Beginn der Belagerung nicht mehr dagewesen war.
Um Mitternacht hörten die schwedischen Wachen die Klänge der Orgel und den Gesang der Andächtigen sanft herunter klingen. Die polnischen Soldaten von dem Kommando Sbroscheks und Kalinskis kamen bis dicht unter die Mauern, um aus der Ferne die Andacht mitzugenießen. Sie waren niedergekniet und lauschten den frommen Weihnachtsliedern, welche Erinnerungen an bessere Zeiten in ihnen wachriefen. Thränen liefen an den bärtigen Wangen herunter über das eigene und das Elend des ganzen Landes, während sie heiße Gebete zum Himmel entsandten. Auch die Wachen auf den Mauern, welche nicht mit in der Kirche sein konnten, stimmten in den frohen Weihnachtshymnus ein:
Ein Kind geboren zu Bethlehem.
Am Nachmittag des ersten Feiertags donnerten wieder die schwedischen Geschütze; das Bombardement hatte wieder begonnen. Kugeln und Granaten flogen dichter denn je in die Veste, aber die Belagerten waren schon so an dieses Schießen gewöhnt, daß sie nichts mehr fürchteten. Ein jeder von ihnen wußte genau, was er zu thun hatte, die Verteidigung ging fast ohne Kommando von statten.
Gegen Abend ritt Miller aus, um beim blitzenden Schimmer der sinkenden Sonne den Erfolg der Beschießung festzustellen. Zähneknirschend blickte er auf die Kirche mit dem vom blauen Himmel sich scharf abzeichnenden Turm.
»Dieses Kloster wird in Ewigkeit noch stehen,« rief er wütend.
»Amen!« setzte Sbroschek ruhig hinzu.
Abends trat wieder der Stab zusammen, um noch eine letzte Beratung zu halten.
»Das heutige Bombardement ist wieder erfolglos geblieben,« sagte der General. »Unser Pulver geht zu Ende, die Hälfte unserer Armee ist vernichtet, die andere Hälfte entmutigt. Auch unsere Lebensmittel sind zu Ende und Zufuhr können wir in der nächsten Zeit nicht erwarten.«
»Und das Kloster steht noch fest, wie am ersten Tage der Belagerung,« setzte Sadowski hinzu.
»Und uns bleibt die Schande!« sagte der Fürst von Hessen.
»Wir müssen unsere Ehre retten!« rief Wrestschowitsch.
Ein höhnisches Lachen folgte diesen Worten.
»Der Herr Graf will uns lehren, wie man Tote erweckt,« sagte Miller zähneknirschend.
»Nur unsere Toten haben ihre Ehre gerettet!« versetzte Sadowski.
»Und dieser Hühnerstall steht noch immer dort oben? Ist er denn uneinnehmbar?« schrie Miller wütend.
»Und dieser Hühnerstall steht noch immer,« äffte der Fürst von Hessen nach, »er ist uneinnehmbar und wir? – wir müssen abziehen ... als Besiegte! ...«
Tiefe Stille herrschte im Gemach; niemand mehr hatte Lust zu reden. Da ergriff Wrestschowitsch noch einmal das Wort:
»Es kommt in jedem Feldzuge wohl zuweilen vor, daß eine belagerte Festung sich von der Belagerung durch ein Lösegeld freimacht. Vielleicht thuen es die Mönche auch. Es könnte dann niemand sagen, daß wir Tschenstochau nicht einnehmen konnten, sondern es nicht wollten,« sagte er.
»Wer weiß, ob sie darauf eingehen?« meinte der Fürst von Hessen.
»Ich stehe mit meinem Kopfe, nein, – mit meiner Ehre dafür ein, daß sie es thun,« versicherte Wrestschowitsch.
»Es wäre möglich!« sagte plötzlich Sadowski. »Wir haben die Belagerung satt, sie aber müssen sie auch satt haben.« Miller wandte sich an Wrestschowitsch:
»Ich habe euch die schwersten und kummervollsten Stunden meines Lebens zu verdanken. Wenn diesmal euer Rat sich bewähren sollte, dann will ich euch zeitlebens dankbar sein.«
Alle atmeten erleichtert auf, denn ein jeder von ihnen hatte keinen anderen Wunsch, als einen ehrenvollen Rückzug.
Der folgende Tag war das Fest des heiligen Stephanus. Die Offiziere versammelten sich wieder, um die Antwort aus dem Kloster auf den Brief Millers, mit dem Vorschlag der Lösung, zu erwarten. Sie mußten sehr lange warten. Die Herzen aller schlugen unruhvoll. Der Fürst von Hessen stand am Fenster und plauderte mit Sadowski.
»Wie viel Lösegeld hat er verlangt?« frug der Fürst.
»Ich fürchte, er hat zu viel verlangt« antwortete Sadowski. »Vierzigtausend Thaler für die Mönche und zwanzigtausend für die Edelleute. Sie werden handeln wollen! Doch hoffe ich auf ein Uebereinkommen.«
»Und ich sage euch, daß ich vor Zorn fiebere und viel tausendmal lieber jetzt einen Sturm auf die Mauern unternehmen wollte, als hier zu warten, obgleich ich den Rat des Wrestschowitsch gut finde,« sagte der Fürst, »dieser Mensch kann noch einmal hochsteigen ...«
»Ja, bis auf den Galgen!« versetzte Sadowski.
In demselben Augenblick donnerten die Geschütze vom Kloster. Die Offiziere eilten wie besessen hinaus.
»Um Gotteswillen, was soll das bedeuten? Ich verstehe nicht,« rief Miller.
»Ich kann Aufklärung geben, Herr General,« antwortete Sbroschek. »Es ist heute Stephanstag; die beiden Herren Tscharniezki, Vater und Sohn feiern heute ihr Namensfest. Die Schüsse dort oben sind Vivatschüsse.«
Da ertönten auch Vivatrufe vom Kloster her und eine neue Salve folgte.
»Sie müssen viel Pulver haben; ein Fingerzeig für uns,« sprach der General.
Doch es folgte gleich ein zweiter. Die schwedischen Soldaten waren so erschreckt durch die unerwartete Eröffnung des Feuers, daß sie alles hinwarfen und die, auf den den Mauern zunächst liegenden Schanzen befindlichen Mannschaften die Flucht ergriffen und bis zum Quartier Millers zurückwichen. Miller sah das, und hörte auch, wie die Offiziere sagten:
»Es ist die höchste Zeit, ein Ende zu machen.«
Allmählich beruhigte sich alles wieder, die Offiziere kehrten in das Haus zurück, und endlich, endlich wurde auch Sporenklirren im Flur laut. Ein Trompeter mit bereiftem Bart und vom Frost roten Wangen trat ein.
»Die Antwort aus dem Kloster,« sprach er, indem er ein ziemlich großes Päckchen an den General aushändigte.
Mit zitternden Händen begann Miller die Hüllen zu entfernen. Etliche Augenpaare waren mit gespanntester Aufmerksamkeit auf das Päckchen gerichtet, die Offiziere hielten den Atem an.
Der General entfernte eine Hülle nach der anderen; endlich fiel ein Päckchen Oblaten auf den Tisch.
Miller erbleichte. Er wußte genug.
»Nichts weiter?« frug eine Stimme.
»Nichts weiter!« antwortete der General dumpf. Gleich darauf schrie er mit fürchterlicher Stimme:
»Er ist schon fort!« sagte einer der Offiziere.
Dann trat Totenstille ein.
Während der Nacht darauf herrschte reges Leben im Lager. Man hörte bis oben im Kloster Kommandorufe, ein Hinundherreiten größerer Reiterabteilungen, den regelmäßigen Marschschritt der Füsiliere, Schnaufen von Pferden, Knarren von Wagenrädern, das Rasseln von Ketten, dumpfes Rollen, kurz, ein Gewirr von Stimmen vermischt mit allerhand Lauten.
Die Wächter auf den Mauern horchten hinunter.
»Bereiten sie einen neuen Angriff vor, oder was sonst?« frugen sie einander.
Es schneite. Man konnte nichts sehen. Gegen fünf Uhr morgens verstummten die Geräusche, aber der Schnee fiel immer dichter; er bildete auf den Dächern neue Dächer, an den Mauern neue Pfeiler, er bedeckte das Kloster, die Kirche, die Veste, als wollte er sie ganz einhüllen und vor drohenden Gefahren schützen.
Endlich begann der Morgen zu grauen. Die Morgenglocke läutete eben zum Frühgebet, da horten die Wachen am Südthor plötzlich das Schnaufen eines Pferdes. Sie erblickten in der Dämmerung vor dem Thore einen ganz mit Schnee bedeckten niedrigen Schlitten, mit einem elenden Klepper bespannt. Daneben stand ein Bauer, welcher eben begann seine Arme warm zu schlagen und von einem Beine auf das andere tretend, rief:
»Menschen, macht doch auf.«
»Wer da?« wurde von oben gefragt.
»Einer von den eurigen,« kam die Antwort zurück. »Aus Dsbowa; ich bringe Wild für die frommen Väter.«
»Haben euch denn die Schweden durchgelassen?« frug die Wache.
»Welche Schweden?«
»Nun die, welche die Kirche belagern.«
»Oho, die giebt es hier nicht mehr; sie sind alle fort,« rief das Bäuerlein.
»Alle guten Geister loben den Herrn! Sie sind fort?« scholl es von der Mauer.
»Keine Spur mehr von ihnen!«
Da tauchten in der Ferne noch mehrere dunkle Gestalten auf der weißen Schneedecke auf; es waren Städter und Bauern. Sie kamen zum Teil geritten, zum Teil zu Fuß, Männer und Frauen. Schon von weitem riefen sie:
»Sie sind nach Wielun gezogen!«
»Oeffnet die Thore! Es ist kein Mensch mehr im Lager!«
»Die Schweden sind fort! Die Schweden sind fort!« riefen nun auch die Wachen auf den Mauern. Der Ruf wurde fortgepflanzt und machte mit Blitzesschnelle die Runde durch das Kloster. Die Soldaten liefen zum Glockenturm und begannen zu läuten, als gelte es ein Alarmsignal. Wer und was lebte stürmte aus den Zellen, den Wohnungen und aus der Kirche. Einer rief dem andern die frohe Kunde zu; der Klosterhof wimmelte von Mönchen, Edelleuten, Soldaten, Frauen und Kindern. Freudenrufe wurden laut. Die einen rannten auf die Mauern, um das leere Lager anzusehen, manche lachten, andere schluchzten, viele wollten die Nachricht erst nicht glauben.
Aber immer neue Häuflein Bürger und Bauern strömten herbei, die Wahrheit zu bestätigen. Sie kamen aus den umliegenden Dörfern, aus der Stadt Tschenstochau, aus den Wäldern, fröhlich singend und plaudernd, den Berg herauf. Immer neue Nachrichten kreuzten sich; ein jeder hatte abziehende Schweden gesehen und erzählte, wohin sie gegangen waren.
Ein paar Stunden später waren die Wege und Stege den Berg herauf mit Menschen bedeckt. Die Thore des Klosters waren weit geöffnet wie vor der Belagerung. Alle Glocken wurden ohne Unterlaß geläutet; ihr Schall trug die Kunde vom Siege Tschenstochaus weit hinaus in die Republik. Der Schnee fiel noch immer und verschüttete jede Spur der Schweden.
Gegen Mittag war eine nach Tausenden zählende Menschenmenge in der Kirche und im Kloster versammelt. Pater Kordezki zelebrierte selbst das Hochamt und betete das Dankgebet. Der Menge erschien er in dem weißen Gewande wie ein Engel. Sein Angesicht war verklärt und im Gesange schien seine ganze Seele zum Himmel zu steigen, während seine weiße Gestalt mit den Weihrauchwolken, die den geschwungenen Silberkesseln entstiegen, zu entschweben schien.
Nichts störte die Andacht, kein Kanonendonner erschütterte mehr die Mauern, ungehindert und weithin vernehmlich konnte der Dankpsalm ertönen, welchen jetzt der Prior unter den Freudenthränen der begeisterten Menge anstimmte:
» Te deum laudamus!«
Ende des ersten Bandes.