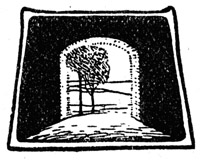|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

 Waffen und Gasthöfe von Eisenach waren voll Menschen. Das ließ sich an, als wollte die große Stimmung der Wartburg-Sängerkriege und Hermanns des Freigebigen, wiederum in die thüringische Welt Einzug halten. Aber es war über ein Jahrhundert her seit dem Wettkampf im Sängersaal; die Stimmung der Zeit hatte sich geändert.
Waffen und Gasthöfe von Eisenach waren voll Menschen. Das ließ sich an, als wollte die große Stimmung der Wartburg-Sängerkriege und Hermanns des Freigebigen, wiederum in die thüringische Welt Einzug halten. Aber es war über ein Jahrhundert her seit dem Wettkampf im Sängersaal; die Stimmung der Zeit hatte sich geändert.
Es war der 24. April 1322. Der ungewöhnliche Zulauf galt einem künstlerischen Feste. Mit der Kunst hatte sich die Kirche verbündet, die sich auch hier ihres erzieherischen Berufes zu bemächtigen gedachte. Der bedeutungsvolle und in seinen Folgen verhängnisvolle Tag war Sonnabend vor Misericordias Domini, vierzehn Tage nach Ostern. Die Eisenacher Dominikanermönche führten »auf der Rolle« zwischen St. Georgenkirche und Barfüßerkloster vor ungezählten Zuschauern ein geistlich Schauspiel auf: das Spiel von den zehn Jungfrauen.
Solche Osterfestspiele, verwandt mit den Mysterien, Moralitäten und Autos des ganzen Mittelalters – wovon z. B. noch Calderons »großes Welttheater« einen guten Begriff gibt – knüpften an Volksfeste der naturfrischen Heidenzeit an, etwa an das Winteraustreiben und ähnliche Volksspiele. Nunmehr aber verband man mit dem geistlich geleiteten Schauspiel kirchliche Belehrung, und ganz besonders zogen Reliquien und Ablaß an, die tags darauf, am Sonntag, ausgestellt und ausgegeben wurden.
Wo war die überschüssige Kraft, die vor hundert und zweihundert Jahren aus allen Löchern und Flicken auch der schäbigsten Kittel und Schuhe durchzubrechen pflegte, wenn das kriegerische Zeitalter zum Kreuzzug auszog und kraftvoll verwildert wieder heimkehrte?
Jene großzügige Verwilderung war zu schwungloser Roheit ermattet. Waren die Verwegenen und Idealisten im Kreuzzug gefallen? Die Kraft war versprüht und mit ihr die ritterliche Zucht. Das Tier im Menschen hatte zu tun, das Edelmenschliche zog sich zurück. Für die Bürger, Kaufleute, Bauern waren die Stegreifritter der kleinen Bergnester eine Landplage, ebenso schlimm wie die häufigen Teuerungen. Zahlreiche kleine Fehden und Händel trugen Mord und Brand und Plünderung von Gau zu Gau. Dazu gesellte sich alle paar Jahre der düstere Gast: der schwarze Tod, die Pest, die 1348 ganz besonders furchtbar hauste.
So war der Werktag freudlos geworden. Darum hatten die Geplagten auch zu einem rechten Sonntag keine Spannkraft mehr. Ein Fürst, der es mit seiner Pflicht ernst nahm, mußte vom Kriegsroß in den Gerichtssessel und vom Gerichtssessel stracks wieder in den noch warmen Sattel zu neuer Fehde. Und ob sich das auch nicht wesentlich unterschied von dem Gepräge vorhergehender Jahrhunderte, so mangelte doch den Derbheiten dieser Zeit eine Hauptsache: Frische, Schwung und Geist.
Nur das Bürgertum der geschlossenen Städte begann sich langsam in die tüchtige Epoche der Reichsstädte und der Hansa Umzuwandeln.
Als einflußreichste geistige Macht jener Zeit waren die Dominikaner, die Predigermönche, tätig. Man muß bedenken, daß die damalige Kirche, seit Franz von Assisi und Dominikus verjüngt, alle geistigen Kräfte mit bedeutender Anstrengung aufs neue in sich sammelte, alle Weisheit und Wissenschaft, die sich ja seitdem wieder abgesplittert hat. Die Mystiker jenes Jahrhunderts, die Dominikaner Johannes Tauler, Heinrich Suso, Meister Eckehart, den unbekannten Verfasser von »Ein teutsch Theologia«, die noch von Luther herzlich geschätzt ward, lauter Männer voll Persönlichkeitsgehalt, darf man als feinste Stimmen des damaligen Geistes betrachten.
Das dogmatische Gerät der Kirche, Ablaß, Fürbitte der Heiligen, Almosenspenden und derlei Hilfsmittel, die einem noch ungeschulten Volke den Weg zu Gott erleichtern sollten, wurden von dieser innerlichen Richtung zwar nicht verworfen. Aber das alles wurde doch als minder wichtig erachtet. Ihrem Gottschauen und Gotterleben war der persönliche seelische Zustand die Hauptsache.
Auf das verhängnisvollste offenbarte sich diese strenge Auffassung im geistlichen Musikschauspiel »von den zehn Jungfrauen«. Der Verfasser war, der sprachlichen Eigenart nach, ein Thüringer. Die theologische Auffassung verrät den Dominikaner, auch wenn man nicht wüßte, daß die Eisenacher Predigermönche – Eisenach hatte außerdem ein Franziskanerkloster – das Spiel am Fuße der Sängerburg veranstaltet haben.
Fu dieser » operia seria« kam nun auch der bedeutende Landgraf herab, der in so freudloser Feit den stolzen Namen Friedrich der Freudige führte. Die Zeitgenossen hatten ihn mit dem Namen geehrt um des freudigen Mutes willen, mit dem er in seine vielen Fehden ritt.
Und hier war es, wo der ungebrochene Mann durch ein leider zu hoch gespanntes Spiel bis ins Mark, ja zu Tode getroffen wurde.
* * *
Auf dem Marktplatz drängt sich das Volk. Die Bretterbühne umfaßt die ganze mittelalterliche Welt: Himmel, Erde, Hölle. Ein Fegefeuer, jener Läuterungsort, auf den sich gedankenlose Sünder zu verlassen pflegten, war vielleicht absichtlich nirgends angedeutet. Himmel oder Hölle – entscheide dich, Kind der Erde!
Die Leiter des Stückes waren Mönche; die Darsteller, auch der Frauenrollen, Schüler.
Der Landgraf hat mit seinem Hof Platz genommen; das summende Gewoge der Neugier legt sich; Posaunen hallen in die bunt-unruhige mittelalterliche Volksmenge. Schlichte Musik beginnt, Chorgesang quillt hervor. Christus, Maria und Engel wandeln feierlichen Schrittes über die erste Bühne, die den Himmel andeutet. Im Wechselgesang singen sie das » Testimonium Domini«, ein Psalmwort, das mit bedeutungsvoller Warnung das unwandelbare Gottesgesetz ins Gemüt ruft. Christus allein wiederholt in gesprochenem Wort den Leitgedanken und stellt sich so gewissermaßen als Richter vor:
Vor mir ist kein Gott gewesen,
Nach mir wird keiner sein.
Ach bin, ich bin der Herr,
Kein Heiland ist außer mir!
Nach so machtvoller Verkündigung höchster Gewalt, die ihres Eindrucks auf die empfängliche, bedingungslos gläubige Zuschauerschaft nicht verfehlen konnte, nimmt die Himmelsgruppe ihren Platz ein.
Nun sehen wir auf der Mittelbühne, die den Marktplatz einer Stadt andeutet, die »zehn Jungfrauen« auftreten, ihre Lämpchen tragend, geteilt in zwei Halbchöre. Diese fünf klugen und fünf törichten Jungfrauen sind – nach dem bekannten Gleichnis Matth. 25 – zur Hochzeit des göttlichen Bräutigams geladen. Singend bekennen sie sich zu den vorhin so eindrucksvoll vernommenen Worten, gleichsam in irdischem Widerhall des himmlischen Chores:
Es sind die Reiche der Welt
Unsres Herrn und seines Christus worden.
Und er wird regieren
Von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Antwort der Engel hallt diesem Bekenntnis nach: »Amen! Halleluja!«
Damit haben sich die zehn Menschenkinder ausdrücklich dem überirdischen Gerichtshöfe unterstellt. Himmel und Erde sind in Verbindung.
An so ahnungsvolle Eröffnung gliedert sich nun sofort die Handlung. Zwei Engel treten vor und gebieten von ihrem himmlischen Standort aus besondere Stille, denn vom lieben Gottessohn Jesus werde Bedeutsames verkündet. Und der Himmelschor singt: »Es war ein Mensch, der machte ein groß Abendmahl.« Jesus fährt mit segnend erhobenen Händen im Gesang fort:
Saget den Geladenen:
Siehe, meine Mahlzeit hab' ich bereitet …
Kommet zur Hochzeit!
Zwei Engel übernehmen den Befehl und tragen ihn auf die Erde. Auf einer Treppe, die Mittel- und Oberbühne verbindet, steigen sie nieder, schon von ferne singend:
Wachet und betet! Umgürtet die Lenden!
Tragt brennende Lampen in euren Händen!
Und zu den Gruppen der Jungfrauen gewendet spricht einer der Engel die deutlichen und ausdrücklichen Einladungsworte:
Euch entbeut vom Himmel der reiche Gott,
Unser Schöpfer, zur Stunde
Gar liebliche Kunde:
Daß ihr alle seiet bereit
Zu seiner großen Hochzeit,
Es sei Tag oder Nacht …
Es soll sein eine jede Gemeine
Gar keusch und gar reine.
Sie soll tragen gewiß und schlicht
In rechtem Bekenntnis brennendes Licht.
So will Gott, der Bräutigam der Frommen,
Ans Liebe zu euch selber kommen.
Wenn er bereit euch sieht,
Ach wie wohl euch geschieht!
Doch wer die Bereitschaft verzaubert und spart –
Weh ihm, daß er geboren ward!
Man sieht: alles ist wunderbar plastisch; ein Volksspieldichter kann daraus lernen.
Die Himmelsboten haben gesprochen und kehren heim. Alle Jungfrauen stehen staunend und verarbeiten in lebhaftem Gebärdenspiel die vernommene Botschaft.
Rasch ist der Frommen Entschluß gefaßt. Singend geloben sie:
Wir wollen lassen nunmehr,
Worin wir sündigten vorher.
Daß wir, überfallen vom Todestage,
Nit stehn in Angst und Plage,
Nit suchen vergebens Raum zur Buße.
Dir, o Herr, fallen wir zu Fuße:
Erbarm' dich unser, wasch uns rein!
An dir wir sündigten allein!
Die erste der klugen Jungfrauen verstärkt diese Weise in längeren gesprochenen Worten: »Ei, nun wollen wir uns besinnen« … Und die zweite stimmt freudig bei: »Wohlauf, die Lampen begossen!« Das ist ihr anschaulich zusammengefaßter Entschluß. Sie werden dem ewigen Licht entgegenwandern mit dem eigenen treu gepflegten Lichtlein.
Nicht so die Törichten. Das sind leichtfertige Spötterinnen, diesseitige Genußnaturen, die für solchen fernsichtigen Idealismus wenig übrig haben. Es ist künstlerisch und seelisch fein, daß diese vernünftelnden Zweiflerinnen nicht singen. Die erste Törichte hebt vielmehr gleich zu sprechen an, eine besserwissende Schlange im Paradiese:
Liebe Schwestern, folgt meinen Lehren:
Wir wollen uns an den Rat nit kehren.
Ich will uns einen beßren geben …
Gottes Gnad' ist so groß und viel,
Daß ich mich fest drauf verlassen will.
Woll'n uns des jungen Lebens freu'n,
Gott wird ja wohl geduldig sein!
Für Hochzeit kommen wir alle noch! …
Wir wollen verspielen unsre Leiden,
Wollen uns von diesen Betschwestern scheiden,
Wollen gehen anderswohin …
Wir kommen wie sie zum Abendmahl
Grad so geschwind!
Schlagt ihre Bitten in den Wind!
Willig stimmt die zweite diesem Leichtsinnsvorschlag bei:
Wollen tanzen und wollen reihen
Mit Pfaffen und mit Laien!
So freun wir uns noch dreißig Jahr',
Bis uns ergraut das helle Haar.
Wenn unser niemand mehr achtet dann,
Seht, so fangen wir ein frommes Leben an.
Tanzend und die Frömmlerinnen verspottend entschwinden die Leichtfertigen in die Gassen der Stadt. Die fünf anderen bleiben in Wehmut zurück. Leis beginnt ihr Gesang:
Selig seid ihr, so euch die Menschen hassen
Und euch verfolgen und schelten euch
Und verwerfen euren Namen
Als einen boshaftigen um des Menschensohns willen.
Freuet euch alsdann und hüpfet,
Denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel!
Der Trostgesang setzt sich fort in Trostworten. Sie bestärken sich im Beharren.
Der nächste Auftritt führt wieder zu den Törichten hinüber. Hier ward jedenfalls der Pantomime viel Spielraum gelassen. Sie tanzen, werfen Spielsteine, schlafen endlich ein. Doch langsam reckt und erhebt sich eine von ihnen, eine Kassandra in nächtlich gefährdeter Stadt. »Wehe über Wehe!« hallt ihr Ruf über die schlummernden Schwestern.
Wie lange wollen wir müßig gehen?!
Wir wissen nit, wann des Bräutigams Zeit!
Wir haben – seht doch – nit bereit
Unser Hochzeitsgerät!
Wer hilft uns, wenn es zu spät?!
Die Schwestern kauern schlaftrunken, ermuntern sich aber allmählich, betrachten ihre erloschenen Lampen – diesen rasch vergeudeten Vorrat an ewigem Lebenslicht – und kommen zur Besinnung. Sie ziehen vor, mit der bisherigen Säumigkeit ein Ende zu machen und die klugen Jungfrauen um Öl zu bitten. Und so wandeln sie flehend hinüber. »Gebt uns von eurem Öle, da unsre Lampen erloschen sind!«
Aber ihre Bitte wird abgewiesen; die Klugen kommen selbst nur knapp mit dem eigenen Vorrat aus. Auch die Krämer, spät aus ihren Häusern herausgeklopft, versagen achselzuckend. Die Angst der lichtlosen Mägde steigt. Aber wieder weiß eine zu beruhigen.
Wenn jene ziehen zum Saal hinein,
So folgen ganz nahe wir hintendrein.
Kommen wir dann hinein durchs Tor,
So stößt man uns nimmer davor.
Wer dann nur den guten Willen hat,
Des Willen nimmt man für die Tat …
Da uns das Öl nun nit mag werden,
Ei, so setzen wir uns hier auf die Erden,
Ruhen wohl eine gute Weile,
Wir haben ja noch keine große Eile! …
Leichtsinn siegt: sie verscherzen und verspielen die Zeit!
Und jetzt naht das Verhängnis. Vom Himmel her, von vielen Engeln begleitet, zieht in erhaben-schönem Zuge herab der göttliche Bräutigam. Freudig empfangen den Sohn Gottes die fünf klugen Jungfrauen unter dem bedeutsam, ja furchtbar wiederholten Leitmotiv, das wir zu Anfang vernommen haben:
Es sind die Reiche der Welt
Unsres Herrn und seines Christus worden,
Und er wird regieren
Von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Unter reichlichen Wechselgesängen, wobei sich Christus und Maria beteiligen, steigen die Seligen empor in den Himmel, wo sie sich zum großen Abendmahl an die Tafel setzen.
Und die Törichten? Die sind so vertieft in ihr Treiben, daß sie den ganzen Vorgang kaum bemerken. Jetzt erst werden sie inne, daß die Klugen fort sind! Sie rennen in den Vordergrund, sie erblicken auf der oberen Bühne das himmlische Mahl, sie sehen die Tore nach oben verschlossen! Da erhebt sich erschütternde Wehklage. Die ganze Wucht der Dichtung liegt auf dem nun folgenden Teil des gefühlstiefen Schauspiels.
Tue auf, o Herr, dein Tor!
Wir gnadenlosen Jungfrauen stehn davor!
Wir bitten dich, lieber Herr, auf den Knieen,
Wollest deine Gnade uns nit entziehen!
Unbarmherzig aber antwortet von oben die Stimme des Heilands, der nunmehr aus einem gütigen Gastherrn zum strengen Richter geworden:
Wer die Zeit der Reue versäumet hat,
Nie Buße für seine Sünden tat –
Kommt der vor mein Tor zu stehen,
Einlaß kann ihm nimmer geschehen.
Wieder Wehklage von unten, diesmal an Maria:
Weil Gott uns Gnade hat versagt,
So bitten wir die reine Magd,
Mutter aller Barmherzigkeit,
Daß sie sich erbarm' über unser Herzeleid!
O bitte deinen Sohn für uns Armen,
Daß er sich über uns wolle erbarmen!
Ihr Flehen wird Gesang; sie liegen ausgestreckt an der Erde und singen:
Jungfrau, Mutter, nimm zu Herzen
Unser Leid und unsre Schmerzen!
Und Maria, die Mutter Gottes, wird von so viel Seelenschmerz bewegt. Zaghaft naht sie sich dem göttlichen Sohne, kniet vor ihm nieder und spricht:
Herr und Sohn, da ich dich gebar,
Weder Palast noch Haus mir war –
Nichts als Armut.
Das litt ich alles dir zu gut.
Ich hatte um dich Sorgen, das ist wahr,
Mehr denn dreiunddreißig Jahr.
Sieh, liebes Kind, das lohne mir:
Erbarme dich der Armen hier!
Christus aber – »Kämst du auch mit allen Engeln überein, so könntet ihr doch keinen Sünder befrein!« – Christus bleibt unerbittlich.
Hier machen wir Halt. Ist denn das noch mittelalterliche Theologie?! Wie, auch die Fürbitte der Engel und der heiligen Jungfrau vermögen nichts? – Und auch rein menschlich sehen wir des Ergreifenden mehr als genug. Da sind bitterlich weinende Mädchen, deren Schlechtigkeit uns nur andeutungsweise oder sinnbildlich, daher nicht eigentlich abstoßend, bekannt geworden. Ihr Leiden aber und ihre Strafe erleben wir nun in ganzer gegenwärtiger Stärke. Und oben sehen wir triumphierende und fröhliche Jungfrauen, von deren Tugend wir gleichfalls nur sinnbildlich Kunde bekamen. Und so wirken Lohn und Strafe viel zu unmittelbar und heftig. Und vollends Jesus, den Bringer verstehender und verzeihender Liebe, der so groß und gut vor jener todbedrohten Ehebrecherin stand: ihn sehen wir unerbittlich hart.
Schon ist unser religiöses Empfinden bis an die Grenze auf die Probe gestellt. Schließt jetzt euer Spiel! Entlaßt uns mit heilsamer Mahnung – und wir gehen ernst und besinnlich unserer Wege.
Aber der Dominikanerdichter, der unleugbar über dichterische Kraft verfügte, setzte jetzt erst mit der schauerlichsten Wirkung ein.
Eine dritte, jedenfalls tiefliegende Bühne wird lebendig: die Hölle tobt hervor! Die Teufel Luzifer und Beelzebub springen heraus und rufen in den Himmel hinauf: Herre, du gelobtest, daß du recht wollest richten!
Tu's nun, daß die verfluchte Schar
Ohn' Urteil in die Hölle fahr'!
Und der Herr bestätigt die Forderung:.
Recht Gerichte soll geschehen,
Die Verfluchten müssen von mir gehen!
Drob freut sich die höllische Sippschaft. Nach einem Zwiegespräch zwischen Himmel und Hölle – wobei Christus mit Zorn feststellt, daß der Teufel es ist, der die armen Jungfrauen verblendet hat: eine geschickte Ablenkung des Dichters! – tauchen die höllischen Gesellen auf der Erdenbühne auf. Noch einmal ergreifende Bitten der Jungfrauen, noch einmal Fußfall Marias – aber Christus bleibt unerweicht. Es klingt wie eine Bußpredigt jener derberen Zeit, wenn nun der Heiland aus den Himmeln ruft:
Geht, ihr Verfluchten an Seel' und an Leibe!
Von mir hinweg ich euch vertreibe.
Geht in das Feuer, das bereitet ist
Dem Teufel und seinem Genist!
Sünder, hinweg von mir!
Trost und Gnade versag' ich dir.
Von meisten Augen dich abkehr',
Mein Antlitz leuchtet dir nimmermehr.
Von meinem Reiche scheide,
Das du zu großem Leide
Aus eigner Schuld verloren hast:
Trage nun selbst der Sünden Last!
Geh hin und Ach und Wehe schrei,
Heil heut' und nimmermehr dir sei!
Mit Ketten klirren die Teufel; die Jungfrauen reißen sich die Kränze vom Haar, zerschlagen die Brust, werden gepackt und gefesselt. Und nun klingt, wuchtig und wortreich, das Stück in langen, langen Klagen aus – in Klagen an die Zuschauer, denen die Teufel die Verfluchten vorführen, in gesprochenen Klagen, und zuletzt, in umfassendem Finale, in wehklagendem Chorgesang, dessen mächtige Strophe an die Nibelungenstrophe erinnert.
Nu hebet sich groß Schreien und Weinen immerdar.
Gott hat uns verfluchet, er stieß uns von sich gar.
Wir haben ihn erzürnet, uns wird nimmer Rat.
Drum laßt euch Lieben unsrer Not erbarmen, wir ziehn
des Kummers Pfad.
So die erste; und der Chor antwortet:
O wehe und o weh!
Daß wir Jesum Christum schauen nimmermeh'!
Und weiter singen sie, einzeln, in großem Umzug, mit dem einen wehen Grundton: »Nu traget alle Leiden, die noch auf Erden sind! Es will uns keine Sühne geben Marien Kindl« Bis die Schlußstrophe hallt:
Ihr Freunde und Verwandten, gebt nur kein Sühngeld her,
Nicht Spenden und nicht Gaben – das alles hilft nicht mehr!
Was man uns Gutes tat, das wäre gar verloren.
Der Tod mehr hülfe als ein Seelgerät' – wir han verdienet Gottes Zorn.
Und der Chor antwortet in verhallendem Gesang aus der Tiefe der Hölle:
Drum sind wir ewiglich verlor'n! …
* * *
So verklang das furchtbare Spiel …
Da sprang der Landgraf Friedrich der Freudige von seinem Sessel auf – und mit lauter Stimme rief der erschütterte und vor ratlosem Zorn bebende Fürst auf die Bühne: »Was ist denn alsdann der Christen Glaube, was ist dann unsere Hoffnung, hilft es nichts, daß die Gottesmutter Maria und alle Heiligen Gottes für uns bitten? Wozu dienen wir ihnen denn?! Warum sollen wir sie denn ehren, wenn wir nicht Gnade durch ihre Fürbitten erwerben?!« Und verließ den Platz und ritt in höchster Erregung auf die Wartburg zurück und »war zornig wohl fünf Tage«. Und die Gelehrten kamen und konnten den gradsinnigen Fürsten nicht beruhigen, und die Kapläne und Mönche deuteten ihm die Schrift, daß ja das alles erst vom Jüngsten Tage gelte. Es war umsonst. Am fünften Tage traf den erbitterten Recken der Schlag. Halbseitig gelähmt und der Sprache beraubt lag er eines Morgens auf seinem Lager.
Zweiundeinhalb Fahre dauerte das qualvolle Siechtum Friedrichs des Freudlosen. Dann erlöste ihn ein sanfter Tod, am 16. November 1324.
* * *
Friedrich der Freudige! … Man hat den Südlandsflug der Hohenstaufen, die sich mit der Kulturwelt des Mittelmeers so hartnäckig auseinandergesetzt haben, viel bewundert und viel gescholten. Landgraf Friedrich der Freudige, der mit herrlicher Ausdauer nur um sein angestammtes Thüringen stritt, war ein letzter Hohenstaufe, ein Enkel des Kaisers Friedrich II., dessen Tochter Margareta Friedrichs Mutter war.
Sonderbar feindseliges Geschick, unbarmherzig wie der Christus dieses Spiels, verfolgte die Staufen und rottete sie aus. Barbarossa war im Kalykadnos ertrunken; Heinrich VI. verwelkte frühe; Philipp von Schwaben ward ermordet; Friedrich II. starb nach gewaltigen und nutzlosen Kämpfen im Sarazenenbezirk, den Deutschen entfremdet; Enzio verkam im Kerker zu Bologna; Konradin auf dem Schafott zu Neapel.
Schon Friedrichs Mutter hatte nur Leid erfahren. Nach fünfjähriger Ehe mußte die junge Landgräfin in einer Juninacht von der Wartburg fliehen, weil sie den Roheiten ihres ehebrecherischen und verschwenderischen Gatten (Albrechts des Entarteten) nicht länger gewachsen war. Sie starb zwei Monde danach an gebrochenem Herzen. Bei ihrem Abschied soll die Mutter ihren Liebling Friedrich so krampfhaft geküßt haben, daß ihm ein Mal in der Wange blieb. Der Volksmund nannte ihn darum auch »Friedrich mit der gebissenen Wange«.
Unter solchem Stern stand dieses Hohenstaufen Lebenswerk. Sein erster Feind war der eigene Vater. Diesem galten die frühesten Fehden der verbündeten Söhne. Kaum übersehbare Gefechte, Hinterhalt und Überfall, Gefangenschaft und Loskauf, Verträge und Vertragsbrüche lassen durch Jahrzehnte diese Ritter nicht zur Ruhe kommen. Thüringen ist – wie ganz Deutschland – heillos zerrüttet. Einmal wird Friedrichs Bruder Diezmann in das Wartburgverlies geschleppt; ein andermal gerät der Vater in Gefangenschaft der Söhne. Dann mischt sich der deutsche Schattenkönig in diese inneren Händel, und zwar mit Rechtsgründen: denn der alte Landgraf hat ihm, über die erbberechtigten Söhne hinüber, sein Thüringen verschachert. Raubzüge des Königsheeres werfen Schrecken über Dörfer und Klöster: – bis in blutiger Schlacht bei Luka Friedrich und Diezmann die königlichen Söldner zerschmettern und sich ihr angestammtes Erbrecht erkämpfen. Aber gleich danach wird Diezmann meuchelmörderisch erstochen. Friedrich kämpft allein weiter. Fast unglaublich sind die abenteuerlichen Wechselfälle dieses Heldenlebens. Einmal reitet er nur mit einem Knecht und drei Pferden, als ein Fürst ohne Land, eine Zeitlang über die Heide; um seine gefangenen Ritter zu retten, hat er auf seine Markgrafschaft verzichtet. Ein andermal wird er vom Landgrafen von Brandenburg abgefangen und nach Tangermünde verschleppt. Mit Erfurt, mit Eisenach setzt es Rauferei und Hader. Aber zuletzt darf er, siegreich auf der Wartburg thronend und als alleiniger Herrscher geachtet, nachdem sich der schlaffe Vater nach Erfurt zurückgezogen hat, sein »Landgraf von Thüringen und Markgraf von Meißen« als Unterschrift unter seine Verfügungen setzen.
Über alledem war Friedrich ein alter Mann geworden. Fünfundsechzig Sommer hatte der Necke hinter sich, als er zu jenem anscheinend harmlosen Festspiel hinunterritt, das man füglich als eine abschließende Dank- und Siegesfeier hätte betrachten sollen. Die Zeitgenossen stimmen überein im Lobe dieses Landgrafen, als eines unerschütterlich tapferen, frommen und gerechten Herrn.
Doch statt einer Jubelfeier empfing den grauen Kämpfer, der zu religiöser Vertiefung wohl nie viel Zeit gehabt, jenes »Ewig verloren«, dem seine Heldennatur erlag.
* * *
Dem Mönchlein, das jene dramatische Bußpredigt geschrieben, mag angst und bange worden sein ob der unerwarteten Wirkung seines »Spiels«. Jedenfalls geriet die Handschrift in Vergessenheit, bis sie mehr als 500 Jahre später (1846) zufällig wieder entdeckt wurde. Und so ist uns eine treffliche Urkunde aus dem damaligen geistlichen und künstlerischen Leben Thüringens wieder zugänglich geworden.
Das war nicht mehr der Geist Walthers von der Vogelweide oder des Nibelungenliedes. Einfalt und Vertrauen auf die Seele der Welt, auf die alles durchwehende und belebende Gottheit waren dahin: der Kindersinn großen Stils war dahin.
Seltsam wehmütig klingt daher der sonderbar und unbewußterweise höchst tiefsinnig gewählte Spruch, der auf dem Grabstein Friedrichs des Freudigen zu lesen ist. Auf dem Denkstein dieses dergestalt an Gottes Vaterliebe irre gewordenen Mannes steht – ein Kinderlied, ein schlichter Reim kindlich-guten Vertrauens, den in etwas veränderter Fassung unsere Kinder heute noch beten und singen:
Ich will heint schlafen gehn,
Zwölf Engel sollen mit mir gehn:
Zween zu Häupten, zween zur Seiten,
Zween zu Füßen,
Zween die mich decken,
Zween die mich wecken,
Zween die mich wisen
Zu den himmlischen Paradisen.