
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die letzte Familie unserer Ordnung führt uns bekannte und befreundete Gestalten aus der Kinderzeit vor. Die Bären ( Ursidae ) sind so ausgezeichnete Thiere, daß wohl Jeder sie augenblicklich erkennt; seltener zu uns kommende Arten weichen jedoch in mancher Hinsicht von dem allgemeinen Gepräge ab, und bei einzelnen Sippen muß man schon einiges Verständnis der thierischen Verwandtschaften besitzen, wenn man zurechtkommen will.
Der Leib der Bären ist gedrungen oder selbst plump, der Kopf länglichrund, mäßig gestreckt, mit zugespitzter, aber gewöhnlich gerade abgeschnittener Schnauze, der Hals verhältnismäßig kurz und dick; die Ohren sind kurz und die Augen beziehentlich klein; die Beine sind mäßig lang, die Vorder- und Hinterfüße fünfzehig und mit großen, gebogenen, unbeweglichen, d. h. nicht einziehbaren, deshalb an der Spitze oft sehr stark abgenutzten Krallen bewaffnet, die Fußsohlen, welche beim Gehen den Boden ihrer vollen Länge nach berühren, fast ganz nackt. Das Gebiß besteht aus 36 bis 40 Zähnen, und zwar oben und unten sechs Schneidezähnen, den Eckzähnen, oben und unten zwei bis vier Lückzähnen oder zwei Lückzähnen oben, drei unten, sowie endlich zwei bis drei Backenzähnen. Die Schneidezähne sind verhältnismäßig groß, haben oft gelappte Kronen und stehen im Einklange mit den starken, meist mit Kanten oder Leisten versehenen Eckzähnen; die Lückzähne dagegen sind einfach kegelförmig oder nur mit unbedeutenden Nebenhöckern versehen; der Fleisch- oder Reißzahn ist sehr schwach, fehlt sogar einigen Sippen vollständig und ist bei anderen nur ein starker Lückzahn mit innerem Höcker; die Kauzähne sind stumpf und die des Unterkiefers stets länger als breit. Am Schädel ist der Hirntheil gestreckt und durch starke Kämme ausgezeichnet; die Halbwirbel sind kurz und stark, ebenso auch die 19 bis 21 Rückenwirbel, von denen 14 oder 15 Rippenpaare tragen. Das Kreuzbein besteht aus 3 bis 5 und der Schwanz aus 7 bis 34 Wirbeln. Die Zunge ist glatt, der Magen ein schlichter Schlauch, der Dünn- und Dickdarm wenig geschieden; der Blinddarm fehlt gänzlich.
Soweit die Vorwesenkunde uns Aufschluß gewähren kann, läßt sich feststellen, daß die Bären schon in der Vorzeit vertreten waren, wie es scheint, sich aber allgemach vermehrt haben. Gegenwärtig verbreiten sie sich über ganz Europa, Asien und Amerika, ebenso auch über einen Theil von Nordwestafrika. Sie bewohnen ebensogut die wärmsten wie die kältesten Länder, die Hochgebirge wie die von dem eisigen Meere eingeschlossenen Küsten. Fast sämmtliche Arten hausen in dichten, ausgedehnten Wäldern oder in Felsengegenden, zumeist in der Einsamkeit. Die einen lieben mehr wasserreiche oder feuchte Gegenden, Flüsse, Bäche, Seen und Sümpfe und das Meer, während die anderen trockenen Landstrichen den Vorzug geben. Eine einzige Art ist an die Küsten des Meeres gebunden und geht niemals tiefer in das Land hinein, unternimmt dagegen, auf Eisschollen fahrend, weitere Reisen als alle übrigen, durchschifft das nördliche Eismeer und wandert von einem Erdtheile zum anderen. Alle übrigen Arten schweifen innerhalb eines weniger ausgedehnten Kreises umher. Die meisten Bären leben einzeln, d. h. höchstens zur Paarungszeit mit einem Weibchen zusammen; einige sind gesellig und vereinigen sich zu Gesellschaften. Diese graben sich Höhlen in der Erde oder in dem Sande, um dort ihr Lager aufzuschlagen, jene suchen in hohlen Bäumen oder in Felsklüften Schutz. Die meisten Arten sind nächtliche oder halbnächtliche Thiere, ziehen nach Untergang der Sonne auf Raub aus und bringen den ganzen Tag über schlafend in ihren Verstecken zu.
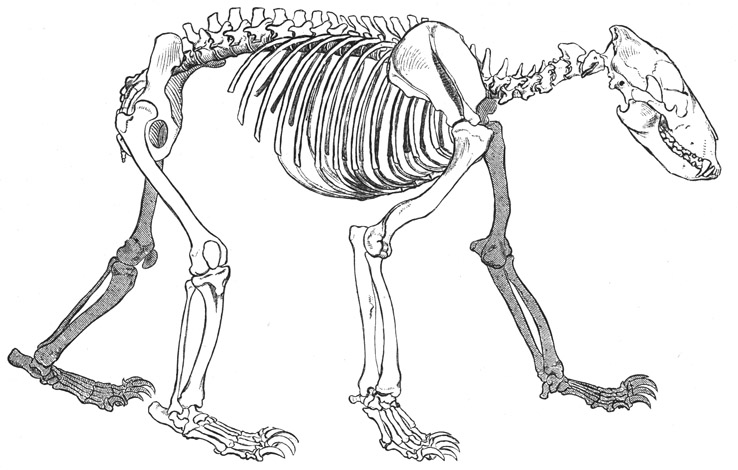
Geripp des Bären. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Mehr als die übrigen Raubthiere scheinen die Bären, Allesfresser im vollsten Sinne des Wortes, befähigt zu sein, lange Zeit allein aus dem Pflanzenreiche sich zu ernähren. Nicht nur eßbare Früchte und Beeren werden von ihnen verzehrt, sondern auch Körner, Getreide im reifen und halbreifen Zustande, Wurzeln, saftige Gräser, Baumknospen, Blütenkätzchen etc. Gefangene hat man längere Zeit bloß mit Hafer gefüttert, ohne eine Abnahme ihres Wohlbefindens zu bemerken. In der Jugend dürften sie ihre Nahrung ausschließlich aus dem Pflanzenreiche wählen, und auch später ziehen sie Pflanzennahrung dem Fleische vor. Sie sind keine Kostverächter; denn sie fressen fast alles, was genießbar ist: außer den angeführten Pflanzen auch Thiere, und zwar Krebse und Muscheln, Würmer, Kerbthiere und deren Larven, Fische, Vögel und deren Eier, Säugethiere und Aas. In der Nähe menschlicher Wohnsitze fügen sie dem Haushalte Schaden zu, und die stärkeren Arten werden zuweilen zu höchst gefährlichen Raubthieren, welche, wenn der Hunger sie quält, größere Thiere anfallen und namentlich unter unserem Viehstande bedeutende Verwüstungen anrichten können. Einzelne sind dabei so dreist, daß sie bis in die Dörfer hineinkommen, um Hausgeflügel zu würgen und Eier zu verzehren oder Ställe aufzubrechen, und dort sich mit leichter Mühe Beute zu holen. Dem Menschen werden die größten bloß dann gefährlich, wenn er sich mit ihnen in Kampf einläßt und ihren Zorn reizt.
Man irrt, wenn man die Bewegungen der Bären für plump und langsam hält. Die großen Arten sind zwar nicht besonders schnell und auch nicht geschickt, aber im hohen Grade ausdauernd und demnach fähig, den Mangel an Beweglichkeit zu ersetzen; auf die kleinen Arten aber leidet jene Meinung gar keine Anwendung, denn diese bewegen sich außerordentlich behend und rasch. Der Gang auf der Erde ist fast immer langsam. Die Bären treten mit ganzer Sohle auf und setzen bedächtig ein Bein vor das andere; gerathen sie aber in Aufregung, so können sie tüchtig laufen, indem sie einen absonderlichen, jedoch fördernden Galopp einschlagen. Die plumperen Arten vermögen außerdem auf den Hinterbeinen sich aufzurichten und, schwankenden Ganges zwar, aber doch nicht ungeschickt, in dieser Stellung eine gewisse Strecke zu durchmessen. Das Klettern verstehen fast alle ziemlich gut, wenn sie ihrer Schwere wegen es auch nur in untergeordneter Weise ausüben können. Einige meiden das Wasser, während die übrigen vortrefflich schwimmen und einige tief und anhaltend tauchen können. Den Eisbären trifft man oft viele Meilen weit vom Lande entfernt, mitten im Meere schwimmend, und hat dann Gelegenheit, seine Fertigkeit und erstaunliche Ausdauer zu beobachten. Eine große Kraft erleichtert den Bären die Bewegungen, läßt sie Hindernisse überwinden, welche anderen Thieren im höchsten Grade störend sein würden, und kommt ihnen auch bei ihren Räubereien sehr wohl zu statten: sie sind im Stande, eine geraubte Kuh oder ein Pferd mit Leichtigkeit fortzuschleppen oder aber einem anderen Thiere durch eine kräftige Umarmung alle Rippen im Leibe zu zerbrechen. Unter ihren Sinnen steht der Geruch oben an; das Gehör ist gut, das Gesicht mittelmäßig, der Geschmack nicht besonders und das Gefühl ziemlich unentwickelt, obwohl einige in ihrer verlängerten Schnauze ein förmliches Tastwerkzeug besitzen. Einige Arten sind verständig und klug; doch fehlt ihnen die Gabe, listig etwas zu berechnen und das einmal Beschlossene schlau auszuführen. Sie lassen in gewissem Grade sich abrichten, erreichen jedoch nicht entfernt die geistige Ausbildung, welche wir bei unserem klügsten Hausthiere, dem Hunde, zu bewundern gelernt haben. Einzelne werden leicht zahm, zeigen jedoch keine besondere Anhänglichkeit an den Herrn und Pfleger. Dazu kommt, daß das Vieh im Alter immermehr sich herauskehrt, d. h. daß sie tückisch und reizbar, zornig und boshaft und dann äußerst gefährlich werden. Die unbedeutenden Kunststücke, zu denen sich die eine oder die andere Art abrichten läßt, kommen kaum in Betracht, und bei vielen ist von einer Abrichtung überhaupt keine Rede. Gemüthsstimmungen geben die Bären durch verschiedene Betonung ihrer an und für sich merkwürdigen, aus dumpfem Brummen, Schnauben und Murmeln oder grunzenden und pfeifenden, zuweilen auch bellenden Tönen bestehenden Stimme zu erkennen.
Alle nördlich wohnenden größeren Bärenarten schweifen bloß während des Sommers umher und graben sich vor dem Eintritte des Winters eine Höhle in den Boden oder benutzen günstig gestaltete Felsenspalten und andere natürliche Höhlungen, um dort den Winter zuzubringen. Immer bereiten sie sich im Hintergrunde ihrer Wohnung aus Zweigen und Blättern, Moos, Laub und Gras ein weiches Lager und verschlafen hier in Absätzen die kälteste Zeit des Jahres. In einen ununterbrochenen Winterschlaf fallen die Bären nicht, sie schlafen vielmehr in großen Zeiträumen, ohne jedoch eigentlich auszugehen. Dabei erscheint es auffallend, daß bloß die eigentlichen Landbären Winterschlaf halten, während die Eis- oder Seebären auch bei der strengsten Kälte noch umherschweifen, oder sich höchstens bei dem tollsten Schneegestöber ruhig niederthun und sich hier durch den Schnee selbst ein Obdach bauen, d. h. einfach einschneien lassen.
Das trächtige Weibchen zieht sich in eine Höhlung zurück und wirft in ihr, gewöhnlich frühzeitig im Jahre, ein bis sechs Junge, welche blind geboren und von der Mutter mit aller Sorgfalt genährt, gepflegt, geschützt und vertheidigt werden. Sie gelten, nachdem sie einigermaßen beweglich geworden sind, als überaus gemüthliche, possirliche und spiellustige Thierchen.
Der Schaden, welchen die Bären bringen, wird durch den Nutzen, den sie uns gewähren, ungefähr aufgehoben, zumal sie theilweise nur in dünn bevölkerten Gegenden sich aufhalten, wo sie den Menschen ohnehin nicht viel Schaden zufügen können. Von fast allen Arten wird das Fell benutzt und als vorzügliches Pelzwerk hochgeschätzt. Außerdem genießt man das Fleisch und verwendet selbst die Knochen, Sehnen und Gedärme.
Die Bärenfamilie zerfällt naturgemäß in drei Hauptabtheilungen, denen man den Rang von Unterfamilien zusprechen darf. Eine derselben umfaßt die Großbären ( Ursina), die massigsten Gestalten der Gesammtheit, mit langschnauzigem Kopfe, kleinen Augen und Ohren, mäßig langen Beinen, fünfzehigen, nacktsohligen Füßen, stumpfen, nicht zurückziehbaren Krallen, stummelhaftem Schwanze und dichtem Zottelpelze. Das Gebiß besteht aus vierzig Zähnen, und zwar sechs Schneidezähnen oben und unten, den Eckzähnen und drei kleinen, oft ausfallenden Lückzähnen vor, sowie zwei stark entwickelten Höckerzähnen hinter dem Fleischzahne. Die Unterfamilie zählt eine einzige, in mehrere Untersippen zerfällte Gattung.
Während Jedermann den Bären zu kennen vermeint, muß der Thierkundige sagen, daß es noch fraglich ist, ob man in den verschiedenen Formen, welche man bald vereinigt, bald getrennt hat, Spielarten eines und desselben Geschöpfes oder selbständige Arten zu erkennen hat. Ständige Rassen darf man, wie auch alle erfahrenen Bärenjäger thun, gewiß annehmen, andererseits aber ebensowenig außer Acht lassen, daß ein weit verbreitetes Thier innerhalb seines mannigfach abwechselnden Wohngebietes ebenfalls abändern müsse und werde. Doch kommen auch wiederum sogenannte Braun- oder Ameisenbären neben Schwarz- oder Aasbären in einem und demselben Lande vor, und treten andere Abweichungen so ständig auf, daß mau sich nicht verwundern darf, wenn noch in den neuesten naturwissenschaftlichen Arbeiten über den Bären mehrere Arten aufgeführt werden.
Nehmen wir nur eine Bärenart an, so haben wir festzuhalten, daß diese, der Landbär, gemeine oder Aasbär ( Ursus arctos ), ungemein abändert, nicht allein, was die Behaarung und Färbung, sondern auch was die Gestalt und zumal die Form des Schädels anlangt. Der im allgemeinen dichte Pelz, welcher um das Gesicht, an dem Bauche und hinter den Beinen länger als am übrigen Körper ist, kann aus längeren oder kürzeren, aus schlichten oder gekräuselten Haaren bestehen; seine Färbung durchläuft alle Schattirungen von Schwarzbraun bis zu Dunkelroth und Gelbbraun, oder von Schwärzlichgrau und Silbergrau bis zum Isabellfahl; das bei jungen Thieren oft vorhandene weiße Halsband erhält sich bis ins hohe Alter etc. Die Schnauze ist mehr oder minder gestreckt, die Stirne mehr oder weniger abgeplattet, der Rumpf bald sehr gedrungen, bald etwas verschmächtigt, die Beine sind höher oder niedriger. So unterscheidet man denn zunächst zwei in Europa lebende Formen als verschiedene Arten, den hochgestellten, langbeinigen, gestreckten, hochstirnigen, langköpfigen und langschnauzigen Aasbären ( U. arctos, U. cadaverinus), dessen schlichter Pelz ins Fahle oder Grauliche spielt, mit seinen Spielarten ( U. normalis, U. grandis, U. collaris), und den niedriger gestellten, dickbeinigen, gedrungen gebauten, breitköpfigen, flachstirnigen und kurzschnauzigen Braun- oder Ameisenbären ( U. formicarius ), verwechselt aber auch wohl die Namen des einen und des anderen und vermehrt dadurch die Verwirrung. Außerdem betrachtet man den Isabellbären ( U. isabellinus ) aus Nepal und Tibet wie den Fahlbären ( U. syriacus ) aus Kleinasien und ebenso den Atlasbären ( U. Crowtheri ) als besondere Arten. Ein bestimmtes Urtheil über diese Frage zu fällen, halte ich gegenwärtig noch für unmöglich: die Angelegenheit ist noch nicht spruchreif.
An Länge kann der Bär, bei 1 bis 1,25 Meter Höhe am Widerrist, 2 bis 2,2 Meter erreichen, wovon 8 Centim. auf das Stumpfschwänzchen kommen. Das Gewicht schwankt zwischen 150 bis 250 Kilogramm.
In der Weidmannssprache unterscheidet man Haupt-, Mittel- und Jungbären; die Füße heißen Branten oder Tatzen, das Fell Decke oder Haut, das Fett Feist, die Augen Seher, die Ohren Gehör, der Schwanz Pürzel. Ferner sagt man: der Bär geht von oder zu Holze, verläßt oder sucht sein Lager oder Loch, erhebt sich, wenn er sein Lager verläßt oder sich aufrichtet, erniedrigt sich, wenn er aus seiner aufrechten Stellung niederfällt oder sich zur Ruhe begibt, schlägt seine Feinde, schlägt sich ein, indem er sich im Winterlager niederlegt, bäret, setzt oder bringt Junge, wird erlegt, aufgeschärft, seine Haut abgeschärft etc. Uebrigens gebraucht man dieselben Ausdrücke wie bei Erwähnung anderer großen Raubthiere.

Landbär ( Ursus arctos). [1/15] natürl. Größe.
Sieht man in den genannten Formen nur Spielarten des Landbären, so hat man dessen Verbreitungsgebiet von Spanien bis Kamtschatka und von Lappland und Sibirien bis zum Atlas, Libanon und dem nördlichen Himalaya auszudehnen. In Europa bewohnt er noch gegenwärtig alle Hochgebirge: die Pyrenäen, Alpen, Karpathen, transsylvanischen Alpen, den Balkan, die skandinavischen Alpen, den Kaukasus und Ural, nebst den Ausläufern und einem Theile der Umgebung dieser Gebirge, ebenso ganz Rußland, ganz Nord- und Mittelasien, mit Ausnahme der kahlen Steppen, Kaukasien, Syrien, Palästina, Persien, Tibet und endlich den Atlas. Er ist häufig in Rußland, Schweden und Norwegen, Siebenbürgen und den Donautiefländern, der Türkei und Griechenland, nicht selten in Krain und Kroatien, in dem gebirgigen Spanien und Italien, schon sehr selten geworden in der Schweiz und Tirol, fast gänzlich ausgerottet in Frankreich wie in den österreichisch-deutschen Ländern und gänzlich vertilgt in Deutschland, Belgien, Holland, Dänemark und Großbrittanien. Einzelne Ueberläufer erscheinen dann und wann im bayerischen Hochgebirge, in Kärnten, Steiermark, Mähren und vielleicht noch im Böhmerwalde. Bedingung für seinen Aufenthalt sind große, zusammenhängende, schwer zugängliche oder doch wenig besuchte, an Beeren und sonstigen Früchten reiche Waldungen. Höhlen unter Baumwurzeln oder in Baumstämmen und im Felsengeklüfte, dunkle, undurchdringliche Dickichte und Brüche mit trockenen Inseln bieten hier ihm Obdach und Ruhe vor seinem Erzfeinde, dem Menschen.
Der Bär, das plumpeste und schwerste Raubthier Europas, ist wie die meisten seiner engeren Verwandten ein tölpelhafter und geistloser Gesell. Doch sehen seine Bewegungen ungeschickter aus, als sie wirklich sind; denn er läuft, trotz seines gemächlichen Ganges auf Streifzügen, sehr schnell, sofern er beunruhigt wird, und ist jedenfalls im Stande, einen Menschen bald einzuholen, wie er ja auch ein langsameres Wild oft erst nach längerer Verfolgung erbeutet. Bergauf geht sein Lauf verhältnismäßig noch schneller als auf der Ebene, weil ihm seine langen Hinterbeine hier trefflich zustattenkommen; bergunter dagegen kann er nur langsam laufen, weil er sich sonst leicht überschlagen würde. Bloß im Februar, in welcher Zeit sich seine Sohlen häuten, geht er nicht gut. Außerdem versteht er vortrefflich zu schwimmen und geschickt zu klettern. Schon ganz junge Bären werden von ihren Müttern gelehrt, die Bäume zu besteigen; sie lernen diese Fertigkeit aber auch ganz von selbst, wie ich an Gefangenen vielfach beobachten konnte. Es ist spaßhaft anzusehen, wie sie von Bäumen rücklings wieder herunterkommen: sie klammern sich beim Klettern mit wahrer Angst an die Aeste und zeigen eine lebhafte Furcht vor dem Herunterfallen. Die gewaltige Kraft und die starken, harten Nägel erleichtern dem Bären das Klettern ungemein; er vermag selbst an steilen Felsenwänden emporzusteigen, falls er nur irgend einen Anhaltspunkt an denselben findet. Vor dem Wasser scheut er sich gar nicht; er sucht es häufig im Sommer auf, um sich zu kühlen, und verweilt dann lange Zeit und gern darin. Bei Verfolgung wirft er sich dreist in einen Strom und setzt schnurgerade über. Unter seinen Sinnen scheint der Geruch am vorzüglichsten zu sein; wahrscheinlich dient dieser ihm auch am besten beim Aufsuchen der Beute. Einen sich ihm nähernden Menschen soll er auf zwei- bis dreihundert Schritte Entfernung wittern und eine Fährte sicher verfolgen können. Auch das Gehör ist trotz der kurzen Lauscher scharf, das Gesicht dagegen ziemlich schlecht, obschon die Augen nicht blöde genannt werden dürfen; der Geschmack endlich scheint recht gut ausgebildet zu sein.
Das geistige Wesen des Bären ist von jeher sehr günstig beurtheilt worden. »Kein anderes Raubthier«, sagt Tschudi, »ist so drollig, von so gemächlichem Humor, so liebenswürdig, wie der gute Meister Petz. Er hat ein gerades, offenes Naturell ohne Tücke und Falsch. Seine List und Erfindungsgabe ist ziemlich schwach. Was der Fuchs mit Klugheit, der Adler mit Schnelligkeit zu erreichen sucht, erstrebt er mit gerader, offener Gewalt. An Plumpheit dem Wolfe ähnlich, ist er doch von ganz anderer Art, nicht so gierig, reißend, häßlich und widerwärtig. Er lauert nicht lange, sucht den Jäger nicht zu umgehen oder von hinten zu überfallen, verläßt sich nicht in erster Linie auf sein furchtbares Gebiß, mit dem er alles zerreißt, sondern sucht die Beute erst mit seinen mächtigen Armen zu erwürgen und beißt nur nötigenfalls mit, ohne daß er am Zerfleischen eine blutgierige Mordlust bewiese, wie er ja überhaupt, als von sanfterer Art, gern Pflanzenstoffe frißt. Seine ganze Erscheinung hat etwas edleres, zutraulicheres, menschenfreundlicheres als die des mißfarbigen Wolfes. Er rührt keine Menschenleiche an, frißt nicht seines Gleichen, lungert nicht des Nachts in dem Dorfe herum, um ein Kind zu erhaschen, sondern bleibt im Walde, als seinem eigentlichen Jagdgebiete. Doch macht man sich öfters von ihm, in Bezug auf seine Langsamkeit, unrichtige Vorstellungen, und namentlich wenn er in Gefahr geräth, verändert sich sein ganzes Naturell bis zur reißendsten Wuth.«
Ich vermag nicht, mich dieser Charakterzeichnung anzuschließen. Der Bär erscheint allerdings komisch, ist aber nichts weniger als gutmüthig oder liebenswürdig, auch nur dann muthig, wenn er keinen anderen Ausweg sieht, vielmehr geistig wenig begabt, ziemlich dumm, gleichgültig und träge. Alle Katzen und Hunde sind gescheiter als er. Seine Gutmütigkeit ist einzig und allein in seiner geringen Raubfertigkeit begründet, sein drolliges Wesen vorzugsweise durch seine Gestalt bedingt. Die Katze ist muthig, der Hund listig fein, der Bär dumm, grob und ungeschliffen. Sein Gebiß weist ihm beschränkte Nahrung an; er raubt daher nur selten und bloß in beschränktem Grade. Dieses Verdienst ist gering und nicht ihm zuzurechnen. Lehre und Unterricht nimmt er nur in geringem Maße an; wirklicher Freundschaft zu dem Menschen ist er nicht fähig. Den Fraß liebt er mehr als seinen Pfleger. Er bleibt auch diesem gegenüber immer grob und gefährlich. Der Wolf steht ganz entschieden höher als er, muß also edler genannt werden.
Ein einziger Blick auf das Gebiß des Bären lehrt, daß er Allesfresser und mehr auf pflanzliche als auf thierische Nahrung angewiesen ist. Am besten läßt er sich mit dem Schweine vergleichen: wie diesem ist ihm alles Genießbare recht. Für gewöhnlich bilden Pflanzenstoffe seine Hauptmahlzeit, kleine Thiere, namentlich Kerfe, Schnecken und dergleichen die Zukost. Monatelang begnügt er sich mit solcher Nahrung, äst sich wie ein Rind von jung aufkeimendem Roggen oder von fettem Grase, frißt reifendes Getreide, Knospen, Obst, Waldbeeren, Schwämme und dergleichen, wühlt nebenbei Ameisenhaufen auf und erlabt sich an den Larven wie an den Alten, deren eigenthümliche Säure seinem Gaumen behagen mag, oder wittert, zumal im Süden, einen Bienenstock aus, welcher ihm dann leckere und höchst willkommene Kost gewährt. Im südlichen Kärnten trägt man die Bienenstöcke im Sommer ins Gebirge, um sie, je nachdem die Blüte der Alpenpflanzen eintritt, niedriger oder höher an den Bergen aufzustellen. Hier findet sich zuweilen ein aus Krain herübergekommener Bär ein und thut dann großen Schaden, indem er die Stöcke zerbricht und ihres Inhaltes entleert. Vor einigen Jahren zog ein solcher Irrling von einem Bienenstande zum anderen und vernichtete über hundert Stöcke, unter ihnen acht meines Gewährsmannes, des Försters Wippel. Auch in Sibirien und Turkestan wird er den Immenzüchtern sehr schädlich. In den Waldungen des Burejagebirges kehrt er im Juni und Juli, wenn es ihm noch an Beeren fehlt, vom Winde umgebrochene Bäume um, deren Mulm er nach Käfern und ihren Larven durchsucht. An solchen umgewälzten Windfällen und an den zerwühlten Ameisenhaufen erkennt man überall im Gebirge sein Vorhandensein. Sobald die Reife der Beeren beginnt, zieht er diesen nach, biegt auch junge, beerentragende Bäume, namentlich Traubenkirschenstämme, zum Boden herab, um zu deren Früchten zu gelangen; wenn das Getreide, insbesondere Hafer und Mais, Körner ansetzt, findet er in den Feldern sich ein, läßt sich nieder und rutscht, in einer einzigen Nacht manchmal einen ganzen Acker verwüstend, sitzend auf und ab, um in aller Bequemlichkeit die Aehren und Rispen zum Maule führen zu können; in den Herbstmonaten geht er den abfallenden Bücheln oder in den Waldungen Sibiriens den Zirbelnüssen nach, soll auch, nach Radde gewordenen Mittheilungen, die Zirbelfichten besteigen und deren Wipfel abbrechen, um zu den körnerreichen Zapfen zu gelangen. In den ostsibirischen Gebirgen unternimmt er weite Wanderungen von einem Waldtheile zum anderen oder von der Höhe zur Tiefe, einzig und allein der schossenden Alpenpflanzen, reifenden Beeren und Wildäpfel halber. So lange er Pflanzenkost in reichlicher Menge zur Verfügung hat, hält er sich an diese; wenn die Noth ihn treibt oder wenn er sich an thierische Nahrung gewöhnt hat, wird er zum Raubthiere in der eigentlichen Bedeutung des Wortes. Nunmehr stellt er allen größeren Thieren, am liebsten Schafen, doch auch Ochsen, Pferden und verschiedenem Wilde nach. Größeres Vieh greift er von hinten an, nachdem er es durch Umherjagen ermüdet hat, oder sucht dasselbe, zumal wenn es auf höheren Bergen weidet, durch das schreckerregende Brüllen zu versprengen und es zu vermögen, sich freiwillig in den Abgrund zu stürzen, klettert sodann behutsam nach und frißt sich unten satt. Glückliche Erfolge mehren seinen Muth oder seine Dreistigkeit. Er unternimmt größere und immer weitere Streifzüge und kommt nachts kühn selbst bis an die Dörfer oder einzelnen Ställe heran, um dort mit noch größerer Bequemlichkeit zu rauben. Einzelne Alpenbären sollen mit bemerkenswertem Geschick einen Ort zum Hinterhalte wählen, von welchem aus sie eine Weide überblicken und den günstigsten Zeitpunkt wahrnehmen können, auf sie herunterzustürzen. Hat sich ein Herdenthier von den übrigen getrennt, so wird es gewöhnlich die Beute des lauernden Bären, welcher plötzlich hervorkommt und das Thier, es mag so behend sein als es will, so lange umherjagt, bis es ermüdet ihm sich hingibt oder in den Abgrund springt.
Im Ural gilt der Bär als der schlimmste Feind der Pferde. Fuhrleute und Postkutscher weigern sich zuweilen, nachts durch einen Wald zu fahren, und scheinen hierzu alle Ursache zu haben, so selten es auch vorkommen mag, daß ein Bär Pferde vor dem Wagen angreift. Solche aber, welche frei im Walde weiden, sind niemals vor ihm sicher. Ein mir befreundeter Bärenjäger, von Beckmann, erzählte mir als Augenzeuge, wie das Raubthier bei seinem Angriffe verfährt. In der Nähe eines sumpfigen Dickichts weideten mehrere Pferde, angesichts des auf dem Anstande regungslos verharrenden Jägers. Da erschien, aus dem Dickicht kommend, ein Bär und näherte sich, langsam schleichend, den Pferden mehr und mehr, bis diese ihn wahrnahmen und in höchster Eile die Flucht ergriffen. Mit mächtigen Sätzen folgte der Bär, holte das eine der Pferde in überraschend kurzer Zeit ein, schlug es mit der einen Brante auf den Rücken, packte es mit der zweiten vorn im Gesichte, warf es zu Boden und zerriß ihm die Brust. Als er sah, daß unter den geflüchteten Thieren eines lahm war und nicht zu entkommen vermochte, lief er, die geschlagene Beute verlassend, auch dem zweiten Opfer nach, erreichte es rasch und tödtete es ebenfalls. Beide Pferde schrien entsetzlich; der Bär antwortete mit lautem Gebrülle.
Ist Meister Braun einmal dreist geworden, so kommt er auch an Ställe heran, und versucht, deren Thüren zu erbrechen oder, wie in Skandinavien mehrmals geschehen sein soll, deren Dächer abzudecken. Gelangt er glücklich in den Viehstall, so schlachtet er hier eine Kuh ab, reißt sie vom Stricke los, umklammert sie mit einem Vorderlaufe, faßt mit der anderen Tatze in das Dachgebälk hinein und ist stark genug, um auf diese Weise die Kuh durch die Oeffnung zu ziehen. Dann wird das Opfer mit Leichtigkeit weiter geschafft. Hierbei überwindet er Hindernisse aller Art, überklettert, wie man vielfach beobachtet hat, mit einem erwürgten Pferde oder Rinde im Arme sogar jene gefährlichen Alpenstege, zwei neben einander liegende Baumstämme, welche über einen Abgrund führen. In den Alpen wird er, namentlich an nebeligen Tagen, sehr gefährlich, weil er sich dann der Herde unbemerkt nähern und, ohne daß es die anderen Thiere merken, einer Kuh auf den Rücken springen kann. Hat er ein Rind gepackt und wird er von den anderen bemerkt, so sammelt sich die ganze Herde schnaubend und brüllend um ihn her, und die muthigen Stiere gehen mit niedergebeugten Hörnern wohl auf ihn los und schlagen ihn in die Flucht.
Hirsche, Rehe oder Gemsen entgehen ihm, Dank ihrer Schnelligkeit, fast regelmäßig; gleichwohl jagt er auch im Norden Skandinaviens den Renthieren längere Zeit eifrig nach. Selbst den Fischen stellt er nach und verfolgt, ihnen zu gefallen, den Lauf der Flüsse auf weite Strecken.
In der Regel frißt der Bär nicht sogleich von einer größeren Beute, welche er schlug, läßt das Opfer vielmehr erst einige Zeit liegen und umgeht es, schnüffelnd und leise brummend, mehrere Male, deckt es auch wohl mit aufgerafftem Moose zu und kehrt später zu ihm zurück, um sein Mahl zu halten. In den Wäldern des Ural findet man nicht selten Pferde, deren Kopf, Hals, Schenkel und Schwanz in dieser Weise verhüllt sind, vergräbt hier auch, um Bären anzulocken, verendete Pferde bis auf ein Bein und setzt sich, oft mit gutem Erfolge, nebenbei auf den Anstand. Daß der Bär unter Umständen Aas angeht, ist durch die reichen Erfahrungen russischer Jäger hinlänglich verbürgt. Wenn Viehseuchen wüthen und die sibirischen Bauern zwingen, die gefallenen Stücke einzugraben, wühlen Bären diese wieder hervor, um an ihnen sich zu sättigen; es erscheint deshalb auch glaublich, daß Meister Braun zuweilen zum Leichenräuber wird. So erlegte man in dem sibirischen Dorfe Makaro einen Bären auf dem Friedhofe, als er gerade beschäftigt war, einen kurz vorher beerdigten Leichnam auszugraben.
Mit der hier oder da bevorzugten Nahrung steht, wie erklärlich, das Wesen des Thieres vollständig im Einklange: der pflanzenfressende Bär ist ein feiger und furchtsamer Gesell, der räuberisch auftretende wird zu einem gefährlichen Gegner der Menschen und der von ihm bedrohten Thiere. »Auf Kamtschatka«, erzählt Steller, »gibt es Bären in unbeschreiblicher Menge, und man sieht solche herdenweise auf den Feldern umherschweifen. Ohne Zweifel würden sie längst ganz Kamtschatka aufgerieben haben, wären sie nicht so zahm und friedfertig und leutseliger als irgendwo in der Welt. Im Frühjahre kommen sie haufenweise von den Quellen der Flüsse aus den Bergen, wohin sie sich im Herbste der Nahrung wegen begeben, um daselbst zu überwintern. Sie erscheinen an der Mündung der Flüsse, stehen an den Ufern, fangen Fische, werfen sie nach dem Ufer und fressen zu der Zeit, wenn die Fische im Ueberflusse sind, nach Art der Hunde nichts mehr von ihnen als den Kopf. Finden sie irgend ein stehendes Netz, so ziehen sie solches aus dem Wasser und nehmen die Fische heraus. Gegen den Herbst, wenn die Fische weiter in dem Strome aufwärts steigen, gehen sie allmählich mit denselben nach den Gebirgen. – Wenn ein Itällman einen Bären ansichtig wird, spricht er ihn von weitem an und beredet ihn, Freundschaft zu halten. Mädchen und Weiber lassen sich, wenn sie auf dem Torflande Beeren aufsammeln, durch die Bären nicht hindern. Geht einer auf sie zu, so geschieht es nur um der Beeren willen, welche er ihnen abnimmt und frißt. Sonst fallen sie keinen Menschen an, es sei denn, daß man sie im Schlafe stört. Selten geschieht es, daß der Bär auf einen Schützen losgeht, er werde angeschossen oder nicht. Sie sind so frech, daß sie wie Diebe in die Häuser einbrechen und, was ihnen vorkommt, durchsuchen.«
Vor dem Eintritte des Winters bereitet sich der Bär eine Schlafstätte, entweder zwischen Felsen oder in Höhlen, welche er vorfindet, sich selbst gräbt, beziehentlich erweitert, oder in einem hohlen Baume, oft auch in einer dunkeln Dickung, wo er entweder unter einem Windbruche sich verbirgt oder die um das zu erwählende Lager stehenden Stämme abbricht, auf sich herabzieht und so ein Obdach bildet, unter welchen er sich einschneien läßt. Das Lager der Bärin wird sorgfältig mit Moos, Laub, Gras und Zweigen ausgepolstert und ist in der That ein sehr bequemes, hübsches Bett. In den galizischen Karpathen, woselbst man diese Winterwohnung »Gaura« nennt, zieht die Bärin, laut Knaur, Höhlen in sehr starken Bäumen anderen Lagerplätzen vor, falls das »Thor«, das heißt die Eingangsöffnung, nicht zu groß ist. Noch vor dem ersten Schneefalle ordnet sie ihr Winterlager, indem sie die Gaura von Erdthcilen, faulem Holze und anderen unsauberen Stoffen reinigt und sodann das Innere mit Reisig auspolstert, welches sie, unter sorgsamer Auswahl der Zweigspitzen, von dem Unterwuchse der nächsten Umgebung abbricht. Mit Eintritt strengerer Kälte bezieht der Bär seinen Schlupfwinkel und hält hier während der kalten Jahreszeit Winterschlaf. Die Zeit des »Einschlagens« oder Beziehens der Wohnung richtet sich wesentlich nach dem Klima der betreffenden Gegend und nach der Witterung. Während die Bärin meist schon anfangs November sich zurückzieht, schweift der Bär, wie ich in Kroatien durch Abspüren einer Fährte selbst erfuhr, noch Mitte Decembers umher, gleichviel ob Schnee liegt und strenge Kälte herrscht oder nicht. Nach Versicherung russischer Bärenjäger soll er vor dem Schlafengehen die Umgebung seines Lagers genau untersuchen und dasselbe mit einem anderen vertauschen, wenn er nach verschiedenen Seiten hin auf menschliche Spuren stößt. Tritt mitten im Winter Thauwetter ein, so verläßt er sogar in Rußland und Sibirien zuweilen sein Lager, um zu trinken oder auch Nahrung zu nehmen. Gleichmäßige Kälte und tiefer Schnee fesseln ihn an das Lager, und er kann so fest und tief schlafen, daß ihn selbst das Fällen von Bäumen in der Nähe seines Lagers nicht stört. »Kurz nach Beginn seiner Winterruhe«, schreibt mir Löwis, »scheint er zum Verlassen des Lagers weit mehr geneigt zu sein als im Hochwinter. Daß er in Livland während drei bis vier Monaten gänzlich unter dem Schnee begraben liegt, durchaus keine Nahrung zu sich nimmt, um diese Zeit auch nur mit gänzlich leeren Eingeweiden gefunden wird, ist ganz sicher«. Bei gelinder Witterung dagegen währt seine Winterruhe vielleicht nur wenige Wochen und unter milderen Himmelsstrichen denkt er wahrscheinlich gar nicht an einen derartigen Rückzug. Hierauf deuten Beobachtungen, welche ich und andere an gefangenen Bären angestellt haben. Sie halten keinen Winterschlaf, benehmen sich im Winter überhaupt kaum anders als im Sommer. Solange ihnen regelmäßig Nahrung gereicht wird, fressen sie fast ebensoviel wie sonst, und in milden Wintern schlafen sie wenig mehr als im Sommer. Die Bärin ist, wenn die Zeit des Gebärens herannaht, vollständig wach und munter, schläft aber im Freien vor und nach der Geburt der Jungen ebenso tief und fest wie der Bär und frißt, wie ich durch eigene Beobachtungen mich überzeugt habe, während der eben angegebenen Zeit, selbst in der Gefangenschaft, nicht das geringste. Da der Bär im Laufe des Sommers und Herbstes gewöhnlich sich gut genährt hat, ist er, wenn er sein Winterlager bezieht, regelmäßig sehr feist, und von diesem Fette zehrt er zum Theile während des Winters. Im Frühjahre kommt er wie die meisten anderen Winterschläfer in sehr abgemagertem Zustande zum Vorscheine. Die Alten, denen dies bekannt war, bemerkten auch, daß der ruhende Bär, wie es seine Gewohnheit überhaupt ist, zuweilen seine Pfoten beleckt, und glaubten deshalb annehmen zu müssen, daß er das Fett aus seinen Tatzen sauge. Daß letzteres unwahr ist, sieht jedes Kind ein; gleichwohl werden selbst heutigen Tages noch diese Märchen gläubig weiter erzählt. Zum endlichen Verlassen seines Winterlagers zwingt ihn immer und überall das Thauwetter, welches sein Bett mit Wasser füllt und dadurch ihn aus dem Schlafe schreckt.
Ueber die Fortpflanzungsgeschichte des Bären bekunden selbst die neuesten naturwissenschaftlichen Werke noch eine um so auffallendere Unsicherheit, als der Bär ja doch zu den Raubthieren gehört, welche oft zahm gehalten werden. Es liegt jetzt über die Bärzeit, die Begattung und Geburt unseres Thieres eine Reihe von Beobachtungen vor, welche allerdings sämmtlich an gefangenen Bären angestellt wurden, aber unter sich so übereinstimmend sind, daß sie es rechtfertigen, wenn man von ihnen auf das Freileben schließt. Die Bärzeit ist der Mai und der Anfang des Juni; denn die Aufregung der Geschlechter währt einen ganzen Monat lang. Von mir gepflegte Bären begatteten sich zum ersten Male anfangs Mai, von nun ab aber täglich zu wiederholten Malen bis zur Mitte Juni; andere Beobachter erfuhren genau dasselbe. Nur wenn man ein lange getrenntes Bärenpaar erst später zusammenbringt, kann es vorkommen, daß die Brunst auch noch im Juli, August und September eintritt. Die Paarung geschieht nach Hundeart. Gänzlich falsch ist es, wenn gesagt wird, daß der Bär in strenger Ehe lebe und eine Untreue gegen die einmal gewählte Bärin sich nicht zu Schulden kommen lasse. Unter den vorstehend erwähnten Bären herrschte scheinbar ein sehr treues und zärtliches Verhältnis; als ich jedoch ein zweites Bärenpaar in den Zwinger bringen ließ, welchen bisher das erste eingenommen hatte, entstand zwischen den Männern sofort ein ernsthafter Kampf, keineswegs aber um die Liebe einer Bärin, sondern einzig und allein um die Herrschaft über beide zusammen. Der stärkere Bär, welcher den anderen bald besiegte, begattete auch die zweite Bärin und zwar vor den Augen seiner rechtmäßigen Gemahlin, welche, oben auf dem Baume sitzend, dem Schauspiele zusehen mußte.
Die Kämpfe zwischen den beiden Bären bewiesen deren Feigheit schlagend genug. Beide Recken gingen vorsichtig gegeneinander los, beschnüffelten sich mit zur Seite gesenkten Köpfen, schielten bedenklich auf einander hin und zogen sich gleichzeitig zurück, sobald einer die Tatze erhob. Das Gefecht selbst wurde durch einige blitzschnell gegebene Brantenschläge eröffnet, bei welchen der empfangende Theil sich jedesmal scheu zur Seite bog, dann aber ebenso rasch zum angreifenden wurde. Hierauf erhoben sich beide Bären, packten sich wie zwei ringende Männer und brüllten sich mit weit geöffneten Rachen an, ohne sich jedoch zu beißen. Nach einigem Hin- und Herschütteln ließen sie wiederum los, und das Kampfspiel begann von neuem.
Linné gab die Tragzeit der Bärin zu hundertundzwölf Tagen an, weil er den Oktober für die Bärzeit annahm. In Wirklichkeit beträgt die Trächtigkeitsdauer mindestens sechs Monate, wahrscheinlich noch etwas mehr. Knaur fand in den Karpathen am 11. März in einer nach dem Tode der Bärin von ihm untersuchten »Gaura« zwei Junge von Kaninchengröße und sprach ihnen ein Alter von fünf bis sechs Wochen zu, bestätigt damit aber nur die obige Angabe über die Geburtszeit der Jungen, welche anfänglich so langsam wachsen, daß selbst ein tüchtiger Weidmann über ihr Alter um einige Wochen sich täuschen kann. Pietruvsky beobachtete an seinen gefangenen Bären, daß die Mutter in den ersten zwei Wochen nach der Geburt ihrer Jungen diese gar nicht verließ, nicht einmal, wenn der Hunger oder Durst sie quälte. Erst nach vierzehn Tagen trank sie etwas Milch, welche ihr jedoch sehr nahe gestellt werden mußte. Sie legte ihre vier Tatzen um die kleinen Bären, deckte sie auch mit der Schnauze zu und bildete ihnen so eine sehr warme Wiege. Drei Wochen nach der Geburt richtete sie sich öfters auf, und von nun an ging sie auch einige Schritte von den Jungen weg. Diese blieben vier Wochen lang blind und begannen erst nach Verlauf von zwei Monaten langsam umherzugehen. Im April spielten sie auf dem Hofe, im Mai hatten sie die Größe eines, jungen Pudels erreicht und sprangen hurtig umher.
Auch eine von mir gepflegte Bärin brachte in der vorletzten Woche des Januar zwei Junge. Wir bereiteten ihr im Inneren des Zwingers ein weiches Strohlager, und sie nahm dies dankbar entgegen. Das eine der Jungen starb kurz nach der Geburt an Nabelverblutung, das andere war ein kräftiges und munteres kleines Thier von 25 Centimeter Länge. Ein silbergrauer, sehr kurzer Pelz bekleidete es; die Augen waren dicht geschlossen; das Gebaren deutete auf große Hülflosigkeit; die Stimme bestand in einem kläglichen, jedoch kräftigen Gewinsel. Die Bärin, welche von ihrem Eheherrn getrennt wurde, legte sehr wenig Zärtlichkeit gegen das Junge an den Tag, zeigte dagegen eine um so größere Sehnsucht nach ihrem Bären. Sobald dieser der Thüre ihrer Zelle sich nahte, verließ sie ihr Junges augenblicklich und schnüffelte und schnaufte den Herrn Gemahl an. Ihren Sprossen behandelte sie mit beispiellosem Ungeschick, ja mit förmlicher Roheit. Sie schleppte ihn in der Schnauze wie ein Stück Fleisch umher, ließ ihn achtlos ohne weiteres zu Boden fallen, trat ihn nicht selten und mißhandelte ihn, so daß er schon am dritten Tage starb. Dies geschah einzig und allein aus überwiegender Hinneigung zu dem Bären; denn sie wurde, als beide Thiere wieder zusammengebracht werden konnten, augenblicklich ruhig, während sie früher im höchsten Grade unruhig gewesen war.
Zwei Jahre später brachte dieselbe Bärin wieder Junge und zwar bereits am 5. Januar. Diesmal benahm sie sich im wesentlichen ganz so, wie Pietruvsky es geschildert. Schon etwa drei Wochen vor der Geburt zog sie sich in ihre Zelle zurück, ordnete das Stroh zu einem Lager, war träge und unlustig und fraß kaum noch. Einige Tage später nahm sie keine Nahrung mehr zu sich und ließ selbst das ihr gereichte Wasser unberührt. Die neugeborenen Jungen schützte sie in der angegebenen Weise, legte sich jedoch manchmal auf die andere Seite, immer so, daß sie den Rücken der Thüre ihrer Zelle zukehrte. Um den Bären im benachbarten Raume bekümmerte sie sich nicht, beschäftigte sich überhaupt nur mit ihren Jungen. Am 17. Februar verließ sie, so viel beobachtet werden konnte, zum ersten Male ihr Lager, um zu trinken; gefressen hatte sie bis dahin nicht, nahm von nun an aber wieder etwas Nahrung an. Ein Junges war gestorben; das überlebende hatte um diese Zeit die Größe eines halbwüchsigen Kaninchens erreicht. Im Alter von etwa fünf Wochen öffneten sich seine Augen; Ende Februar begann es sich zu bewegen, war aber noch ungemein täppisch und ungeschickt, Ende März spazierte es in der Zelle auf und ab, im April versuchte es weitere Ausflüge zu machen. Die Alte hielt den Sprößling in strenger Zucht, achtete auf jeden seiner Schritte und holte ihn mit der Brante gewaltsam herbei, wenn er sich entfernen wollte; für seine Reinigung sorgte sie dadurch, daß sie ihn zuweilen in das Wasserbecken warf und, nachdem er sich gebadet, wieder mit der Brante herauszog. Der erste gegen den Willen der Mutter gelungene Ausflug kostete dem niedlichen Geschöpfe das Leben: es verirrte sich beim Zurückkehren in den Zwinger der Eisbären und wurde von diesen sofort zerrissen. Die Alte bekundete wenig Kummer über den Verlust des Jungen, benahm sich wenigstens gegen den Bären, zu welchem sie gebracht worden war, ebenso zärtlich oder hingebend wie je.
Von denen, welche Bären in der Freiheit beobachteten, wird nun ferner angegeben, daß die Alte ihre Jungen bis zur nächsten Bärzeit mit sich umherführe, dann aber verstoße und sie zur Selbständigkeit zwinge. Ich bin überzeugt, daß die freilebende Bärin nicht alljährlich, sondern nur ein Jahr um das andere Junge bringt. Im Mai, der auf die Geburt der letzteren folgenden Bärzeit, sind die Jungen noch zu klein, als daß die Mutter sie verstoßen könnte, und läßt sich kaum annehmen, daß die Bärin sich dann schon wieder paaren sollte. Beobachtungen an gefangenen Bären sprechen für meine Behauptung, obschon auch mehrere Fälle des Gegentheils in Erfahrung gebracht wurden. Aber immer hatte man dann der Bärin die Jungen genommen, oder es waren diese bei oder bald nach der Geburt zu Grunde gegangen. Unter solchen Umständen werden alle Säugethiere früher brünstig als sonst. Eine Bärin, welche Forstmeister Soucha gefangen hielt, brachte innerhalb vier Jahren viermal Junge, im Laufe des Jahres 1869 sogar zweimal, am 6. Januar und am 29. December nämlich. Aber sie erdrückte diese Jungen das erste und das zweite Mal, und die des dritten Wurfes wurden künstlich aufgezogen. Das sind unnatürliche Verhältnisse, welche für das freilebende Thier nicht maßgebend sein können. Erfahrene russische Bärenjäger, welche ich befragte, waren mit mir derselben Ansicht, verwunderten sich sogar, als ich ihnen sagte, daß man noch nicht wisse, ob die freilebende Bärin alljährlich oder nur ein Jahr um das andere gebäre.
Die von der Alten endlich verstoßenen jungen Bären sollen sich hierauf während des Sommers in der Nähe des alten Lagers umhertreiben und dieses bei schlechtem Wetter so lange benutzen, als sie nicht vertrieben werden, auch gern mit anderen Jungen ihrer Art vereinigen. Eine zuerst von Eversmann veröffentlichte Beobachtung der russischen Bauern und Jäger läßt solche Vereinigungen in eigenthümlichem Lichte erscheinen. Jene haben erfahren, daß die Bärenmutter ihre älteren Kinder zur Wartung der jüngeren benutzt und bezüglich preßt, weshalb auch solche zweijährige, mit der Mutter und Geschwistern umherlaufende Büren geradezu » Pestun«, das heißt Kinderwärter, genannt werden. Von einer Bärenfamilie, welche die Kama durchkreuzt hatte, erzählt Eversmann folgendes: »Als die Mutter am jenseitigen Ufer angekommen, sieht sie, daß der Pestun ihr langsam nachschleicht, ohne den jüngeren Geschwistern, welche noch am anderen Ufer waren, behülflich zu sein. Sowie er ankommt, erhält er von der Mutter stillschweigend eine Ohrfeige, kehrt sofort nach eröffnetem Verständnisse wieder um und holt das eine Junge im Maule herüber. Die Mutter sieht zu, wie er wieder zurückkehrt, um auch das andere herbeizuholen, bis er dasselbe mitten im Flusse ins Wasser fallen läßt. Da stürzt sie hinzu und züchtigt ihn aufs neue, worauf er seine Schuldigkeit thut und die Familie in Frieden weiter zieht.« Unter den Bauern und Jägern Rußlands und Sibiriens ist allgemein bekannt, daß jede Bärin ihren kleinen Jungen einen Pestun zugesellt. Ihm fällt unter anderem die Aufgabe zu, die im Dickicht verborgenen Jungen zu überwachen, während die Alte eine Beute beschleicht oder an einem erschlagenen Opfer, welches sie nicht wegschleppen mag, sich sättigt; er theilt im Winter mit ihr dasselbe Lager, wird auch erst dann seines Dienstes entlassen und freigegeben, wenn ein anderer zu seinem Ersatze gefunden wurde. Daher sieht man unter Umständen auch wohl einen vierjährigen Pestun in Gesellschaft einer Bärenfamilie.
Junge, etwa fünf bis sechs Monate alte Bären sind höchst ergötzliche Thiere. Ihre Beweglichkeit ist groß, ihre Tölpelhaftigkeit nicht geringer, und so erklärt es sich, daß sie fortwährend die drolligsten Streiche ausführen. Ihr kindisches Wesen zeigt sich in jeder Handlung. Sie sind spiellustig im hohen Grade, klettern aus reinem Uebermuthe oft an den Bäumen empor, balgen sich wie muntere Buben, springen ins Wasser, rennen zweck- und ziellos umher und treiben hunderterlei Possen. Ihrem Wärter beweisen sie keine besondere Zärtlichkeit, sind vielmehr gegen jedermann gleich freundlich und unterscheiden nicht zwischen dem einem oder dem anderen. Wer ihnen etwas zu fressen gibt, ist der rechte Mann; wer sie irgendwie erzürnt, wird als Feind angesehen und womöglich feindlich behandelt. Sie sind reizbar wie Kinder; ihre Liebe ist augenblicklich gewonnen, ebenso rasch aber auch verscherzt. Grob und ungeschickt, vergeßlich, unachtsam, täppisch, albern, wie ihre Eltern, sind auch sie; nur treten bei ihnen alle diese Eigenschaften schärfer hervor. Wenn sie allein gelassen werden, können sie sich stundenlang damit beschäftigen, unter sonderbarem Gebrumme und Geschmatze ihre Tatzen zu belecken. Jedes ungewohnte Ereignis, jedes fremde Thier erschreckt sie; entsetzt richten sie sich aus und schlagen ihre Kinnladen klappend aufeinander. Schon
im zweiten Halbjahre ihres Lebens nehmen sie das Wesen der Alten an, werden roh und bissig, mißhandeln, so feig sie sind, schwächere Hausthiere, beißen oder kratzen selbst den Gebieter und können nur durch Prügel in Ordnung gehalten werden. Mit zunehmendem Alter werden sie ungeschickter, roher, freßgieriger, raublustiger und gefährlicher. Man kann auch sie lehren, ihnen etwas beibringen, sie zu einfachen Kunststücken abrichten, darf ihnen jedoch niemals trauen; denn sie sind, wie alle geistlosen Geschöpfe, unberechenbar und ihre gewaltige Stärke, Bosheit und Tücke stets zu fürchten. So eignen sie sich wohl für den Zwinger im Thiergarten oder, so lange sie noch nicht vollständig erwachsen sind, zum Schauthiere eines umherziehenden Bärenführers, niemals aber zu einem innigeren Verkehre mit dem gesitteten Menschen. Diese Erfahrung haben alle gemacht, welche den Versuch wagten, das ungebärdige und unverläßliche Thier zu erziehen, und mehr als ein Lehrmeister hat dabei Gesundheit und Leben verloren.
Wir wissen nicht bestimmt, wie lange das Wachsthum des Bären währt, dürfen aber annehmen, das mindestens sechs Jahre vergehen, bevor er zum Hauptbären wird. Das Alter, welches er überhaupt erreichen kann, scheint ziemlich bedeutend zu sein. Man hat Bären fünfzig Jahre in der Gefangenschaft gehalten und beobachtet, daß die Bärin noch in ihrem einunddreißigsten Jahre Junge geworfen hat.
Die Bärenjagd gehört zu dem gefährlichen Weidwerke; doch werden gerade neuerdings von geübten Bärenjägern die schauerlichen Geschichten, welche man früher erzählt hat, in Abrede gestellt. Ruhige und kalte Jäger behaupten, daß für sichere Schützen die Jagd fast gefahrlos ist.
Gute Hunde bleiben unter allen Umständen die besten Gehülfen des Jägers. Sie suchen den Bären nicht bloß auf, sondern stellen ihn auch so fest, daß er gar nicht Zeit gewinnt, sich mit dem Jäger zu beschäftigen. Nur, wenn er in die Enge getrieben ist, wird er zum furchtbaren Gegner der Menschen; sonst trabt er, selbst verwundet, eilig seines Weges. Anders verhält es sich, wenn man die Jungen einer Bärin angreift; denn angesichts der letzteren zeigt sie wirklich erhabenen Muth.
Im südöstlichen Europa erlegt man den Bären hauptsächlich während der Feistzeit auf Treibjagden, seltener auf dem Anstande und nur ausnahmsweise in oder vor seinem Winterlager; in Rußland dagegen sucht man ihn gerade hier mit Vorliebe auf. Da der Bär sich treiben läßt und seinen Wechsel einhält, kann man, nachdem er durch kundige Jäger bestätigt worden ist, bei Treibjagden ebensowohl wie auf dem Anstande mit ziemlicher Sicherheit auf Erfolg rechnen, vorausgesetzt natürlich, daß man die Wechsel kennt. Kühles Blut und sichere Hand sind unerläßliche Eigenschaften, gute und erprobte Waffen unerläßliche Erfordernisse eines Bärenjägers; denn Meister Petz verlangt einen wohlgezielten, sofort und unbedingt tödtlich wirkenden Schuß und kämpft, wenn er nicht anders kann und vielleicht schmerzhaft verwundet wurde, mit Todesverachtung um sein gefährdetes Leben, läßt sich auch, nachdem er einmal den Schützen angenommen hat, durch die muthigsten und bissigsten Hunde, welche ihn sonst sehr behelligen, nicht beirren, sondern erhebt sich auf die Hinterbeine, geht wackelnden Ganges auf den Gegner zu und versucht, ihn durch Umarmen zu erdrücken oder mittels einiger Tatzenschläge zu fällen. Oft ist unter solchen Umständen das Weidmesser die einzige Rettung des Jägers, nicht allzu selten aber gibt es für diesen überhaupt keine Rettung mehr. Aus diesem Grunde zieht man ebensowenig oder doch ebenso selten allein zur Bärenjagd aus, wie man ohne erprobte Jagdgenossen eine Löwen- oder Tigerjagd unternimmt, während man in Gesellschaft solcher wenig zu fürchten hat. In den meisten Fällen rettet der Nachbarschütz einen vom Bären bedrohten Jäger, und schon das Bewußtsein, nicht ohne Hülfe zu sein, verleiht jedem einzelnen Jagdgenossen Ruhe und Muth. Unglücksfälle sind allerdings auch bei Treibjagden nicht ausgeschlossen, in der Regel aber doch nur Folge der Ungeschicklichkeit und Unachtsamkeit von Schützen oder der Voreiligkeit von Treibern, welche für die Bärenjagd nicht taugen.
Vor oder in seinem Winterlager erlegen die Russen den Bären entweder kurz nachdem er sich eingeschlagen hat, oder im Spätwinter, wenn eine harte Schneekruste das Eindringen in die Wälder gestattet. Der Bauer, welcher ein Winterlager aufgefunden hat, verkauft den in ihm schlafenden Bären zum Preise von zwanzig bis hundert Rubel an ihm bekannte Jäger. An einem bestimmten Tage begeben sich diese an Ort und Stelle, verwahren zwei oder drei Seiten des Dickichtes durch Treiber, besetzen eine Linie und senden sodann den »Besitzer« des Bären nebst mehreren Hunden zu dem Lager, um den Schläfer zu wecken und aufzutreiben. Zuweilen liegt der Bär so fest, daß man ihn nur mit Hülfe von Stangen oder mittels eines in das Lager geworfenen und hier sich entladenden Kanonenschlages zum Aufstehen zwingen kann. Ist er minder hartnäckig, so verläßt er bei Ankunft der Hunde sofort das Lager, schleicht im Dickichte hin und her, versucht hier und da durchzubrechen, wird, durch lautes Geschrei überall zurückgescheucht, furchtsam, entleert sich vor Angst und läuft satzweise von einer Stelle zur anderen, geräth auch wohl in Wuth, hebt sich, um Umschau zu halten, rennt, nachdem er wiederum sich erniedrigt, auf einen Treiber zu, um diesen anzugreifen, kommt endlich aber doch einem der Jäger zum Schusse und endet sein Leben, bevor es ihm gelang, Unheil zu verüben.
Neben weidgerechter Jagd betreibt man überall noch andere, wendet überhaupt alle Mittel an, um des Raubthieres da, wo es lästig wird, sich zu entledigen. Kühner Mannesmuth und Hinterlist vereinigen sich zur Erreichung dieses Zieles. In Galizien und Siebenbürgen legt man schwere Schlageisen auf seine Wechsel, befestigt an ihnen eine Kette, und an dieser mittels eines längeren, festen Strickes einen schweren Klotz. Der Bär tritt gelegentlich in eines der Eisen, versucht vergeblich, von ihm sich zu befreien oder die Kette zu zerbeißen, hängt sich schließlich an einem Baume fest, mattet sich ab und geht elendiglich zu Grunde. Dem Jäger, welcher alle zwei Tage die Wechsel begeht, zeigt das geschleppte Eisen, die Kette oder der Klotz den von dem gefangenen Bären genommenen Weg deutlich genug an, um ihn sicher aufzufinden. »Die Asiaten«, erzählt Steller, »machen ein Gebäude von vielen aufeinander liegenden Balken, welche alle zusammenstürzen und die Bären erschlagen, sobald sie auf die vor ihnen leise aufgestellten Fallen kommen. Sie graben eine Grube, befestigen darin einen spitzen, geglätteten und gebrannten Pfahl, welcher einen Fuß hoch aus der Erde emporsteht, die Grube aber bedecken sie mit Gras. Vermittels eines Strickes stellen sie jetzt ein biegsames Schreckholz auf, welches, wenn der Bär mit dem Fuße auf den Strick tritt, losschlägt und das Thier dergestalt erschreckt, daß es heftig zu laufen anfängt, unvorsichtigerweise in die Grube fällt, sich auf den Pfahl spießt und selbst tödtet. Auch befestigen viele eiserne und spitze Fußangeln und Widerhaken in einem dicken, starken und zwei Schuh breiten Brete, legen solches auf des Bären Weg und stellen, eben wie vorher, ein Schreckholz auf. Sobald dieses losschlägt und den Bären erschreckt, verdoppelt er seine Schritte, tritt mit dem Fuße heftig in die Angel und ist also angenagelt. Daraus sucht er den Fuß herauszubringen und tritt mit dem anderen auch darein. Steht er nun gleich eine Weile auf den Hinterfüßen, so verdeckt er mit dem Brete den Weg und sieht nicht, wo er hingehen soll. Endlich, wenn er genug spekulirt und grimmig geworden ist, tobt er so lange, bis er auch mit den Hinterfüßen angenagelt wird. Nach diesem fällt er auf den Rücken und kehrt alle vier Füße mit dem Brete in die Höhe, bis er bei der Leute Ankunft erstochen wird. Noch lächerlicher fangen ihn die Bauern an der Lena und dem Ilmflusse. Sie befestigen an einen sehr schweren Klotz einen Strick, dessen anderes Ende mit einer Schlinge versehen ist. Dies wird nahe an einem hohen Ufer an den Weg gestellt. Sobald nun der Bär die Schlinge um den Hals hat und im Fortgehen bemerkt, daß ihn der Klotz hindere und zurückhalte, ist er doch nicht so klug, daß er die Schlinge vom Kopfe nehmen sollte, sondern ergrimmt dergestalt über den Klotz, daß er hinzuläuft, denselben von der Erde aufhebt und, um sich davon zu entledigen, mit der größten Gewalt den Berg hinunterwirft, zugleich aber durch das andere Ende, welches an seinem Halse befestigt ist, mit hinuntergerissen wird und sich zu Tode fällt. Bleibt er aber lebendig, so trägt er den Klotz wieder den Berg hinauf und wirft ihn nochmals hinab; dieses Spiel treibt er so lange, bis er sich zu Tode gearbeitet oder gefallen hat. Die Koräken suchen solche Bäume aus, welche krumm wie ein Schnellgalgen gewachsen sind. Daran machen sie eine starke, feste Schlinge und hängen Aas darin auf. Wenn der Bär solches ansichtig wird, steigt er den Baum hinauf und
bemüht sich, das Aas zu erhalten, wodurch er in die Schlinge kommt und bis zu der Koräken Ankunft bleibt, entweder todt oder lebendig, nachdem er mit dem Kopfe oder den Vorderfüßen in die Schlinge geräth. Wenn die Kamtschadalen einen Bären in seinem Lager ermorden wollen, versperren sie denselben darinnen zu mehrerer Sicherheit auf folgende Weise. Sie schleppen vieles Holz vor das Lager, welches länger, als der Eingang breit ist, und stecken ein Holz nach dem anderen hinein. Der Bär erfaßt dasselbe sogleich und zieht es nach sich. Die Kamtschadalen aber fahren so lange damit fort, bis die Höhle des Bären so voll ist, daß nichts mehr hineingeht, und er sich weder bewegen noch umwenden kann. Alsdann machen sie über dem Lager ein Loch und erstechen ihn darinnen mit Spießen.«
Wäre es nicht Steller, welcher diese Dinge erzählt, man würde ihm keinen Glauben schenken; die Wahrheitstreue dieses Beobachters ist aber so gewiß erprobt, daß uns kein Recht zusteht, an seinen Mittheilungen, bevor das Gegentheil erwiesen, zu mäkeln.
In Gegenden, wo viel Waldbienenzucht getrieben wird, hängt man an Bäumen mit Bienenstöcken einen schweren Klotz an einem Stricke auf, so daß derselbe dem Bären den Zugang zum Honige versperren muß. Dadurch, daß der Bär mit seiner Tatze den Klotz zur Seite drückt, dieser aber von selbst wiederkehrt, gerathen beide miteinander in Streit. Der Bär wird zuerst heftig und infolge dessen der Klotz auch, bis endlich der Klügste nachgibt und betäubt herunter fällt.
Hier und da tritt man dem Bären mit der Lanze und dem Weidmesser entgegen und kämpft mit ihm auf Tod und Leben. So sagen einzelne Russen, Skandinavier, Siebenbürger und namentlich die spanischen »Oseros« oder zünftigen Bärenjäger, deren Gewerbe vom Vater auf den Sohn erbt. Unter Mithülfe von zwei starken und tüchtigen Hunden sucht der Osero sein Wild in den fast undurchdringlichen Dickichten der Gebirgswälder auf und stellt sich ihm, sobald er es gefunden, zum Zweikampfe gegenüber. Er führt ein breites, schweres und spitziges Weidmesser und einen Doppeldolch, welcher in zwei sich gegenüberstehende, dreiseitig ausgeschliffene und nadelscharfe Klingen ausläuft und den Griff in der Mitte trägt. Den linken Arm hat er zum Schutze gegen das Gebiß und die Krallen des Bären mit einem dicken, aus alten Lumpen zusammengenähten Aermel überzogen; der Doppeldolch wird mit der linken Hand geführt, das Weidmesser ist die Waffe der rechten. So ausgerüstet tritt der Jäger dem von den Hunden aufgestörten Bären entgegen, sobald dieser sich anschickt, ihn mit einer jener Umarmungen zu bewillkommnen, welche alle Rippen im Leibe zu zerbrechen pflegen. Furchtlos läßt er den brummenden, auf den Hinterbeinen auf ihn zuwandelnden Bären herankommen; im günstigen Augenblicke aber setzt er ihm den Doppeldolch zwischen Kinn und Brust und stößt ihm denselben mit der oberen Spitze in die Gurgel. Sobald der Bär sich verwundet fühlt, versucht er, das Eisen herauszuschleudern, und macht zu diesem Zwecke mit dem Kopfe eine heftige Bewegung nach unten. Dabei stößt er sich aber die zweite Klinge in die Brust, und jetzt rennt ihm der Osero das breite Weidmesser mehrere Male in den Leib. In dem Dorfe Morschowa im Ural lebt zur Zeit ein Bauermädchen, welches in ähnlicher Weise über dreißig Bären erlegt und durch ihre kühnen Heldenthaten einen weitverbreiteten Ruf sich erworben hat.
Der Nutzen, welchen eine glückliche Bärenjagd abwirft, ist nicht unbeträchtlich. Des von den Regierungen festgesetzten, sehr niedrigen Schußgeldes halber würde freilich kein Jäger sein Leben wagen, übte die Jagd nicht an und für sich selbst einen unwiderstehlichen Reiz auf den muthvollen Mann, und verschaffte sie ihm nicht Nebeneinnahmen, welche ungleich bedeutender sind als jene, welche die Regierungen aus Nützlichkeitsrücksichten zu zahlen sich bewogen finden. Die zweihundert Kilogramme Fleisch geben einen hübschen Ertrag; die Decke ist ihre dreißig bis hundert Mark werth;, das Bärenfett wird sehr gesucht und gut bezahlt. Dieses Fett ist weiß, wird nie hart, in verschlossenen Gefäßen selten ranzig, und sein in frischem Zustande widerlicher Geschmack verliert sich, wenn man es vorher mit Zwiebeln abgedämpft hat. Das Wildpret eines jungen Bären hat einen feinen, angenehmen Geschmack; die Keulen alter, feister Bären gelten, gebraten oder geräuchert, als Leckerbissen. Am meisten werden die Branten von den Feinschmeckern gesucht; doch muß man sich erst an den Anblick derselben gewöhnen, weil sie, abgehärt und zur Bereitung fertig gemacht, einem auffallend großen Menschenfuße in widerlicher Weise ähneln. Ein mit Champignons zubereiteter Bärenkopf endlich gilt als ein vortreffliches Gericht.
Die Bäuerinnen im Ural legen der Klaue, die Ostjaken dem Reißzahne geheimnisvolle Kräfte bei. Ein Bärenjäger im Ural muß die Decke eines von ihm erlegten Bären wohl in Acht nehmen, will er nicht erleben, daß die jungen Mädchen alle an ihr haftenden Klauen stehlen. Denn solche Klaue, insbesondere die vierte der rechten Vorderbrante, zwingt jeden Jüngling, das Mädchen, welches ihn heimlich mit ihr kratzte, inbrünstig zu lieben, ist deshalb auch wohl einen bis drei Rubel werth. Der Bärenzahn aber wird dem rechtlichen Ostjaken zu einem Talisman, welcher vor Krankheit und Gefahr schützt und Falschheit und Lüge an das Licht bringt. Kein Wunder daher, daß der Ostjake, welcher einen Bären erlegte, das glückliche Ereignis durch einen absonderlichen Tanz verherrlicht.
Noch zu Anfange des vorigen Jahrhunderts galt es als ein fürstliches Vergnügen, gefangene Bären mit großen Hunden kämpfen zu lassen. Die deutschen Fürsten fütterten jene bloß zu diesem Zwecke in eigenen Gärten. »August der Starke«, so erzählt von Flemming, »hatte deren zwei, und es ereignete sich, daß einstmals aus dem Garten zu Augustusburg ein Bär entsprang, bei einem Fleischer ein Kalbsviertel herunterriß und, da ihn die Frau verjagen wollte, diese sammt ihren Kindern erwürgte, worauf Leute herbeieilten und ihn todtschossen.« Auf den Platz wurde der für den Kampf bestimmte Bär in einem Kasten gefahren, welcher durch einen Zug aus der Ferne so geöffnet werden konnte, daß er sich nach allen Seiten niederlegte und den Bären dann plötzlich befreite. Hierauf ließ man große, schwere Hunde gegen ihn los. Packten ihn diese fest, so konnte er ohne besondere Schwierigkeiten von einem Manne abgefangen werden. Im Dresdener Schloßhofe wurden im Jahre 1630 binnen acht Tagen drei Bärenhetzen abgehalten. In den beiden ersten mußten sieben Bären mit Hunden, im dritten aber mit großen Keulern kämpfen, von denen fünf auf dem Platze blieben; unter den Bären war nur einer von acht Centner Gewicht. Die Bären wurden noch außerdem durch Schwärmer gereizt und vermittels eines ausgestopften rothen Männchens genarrt. Gewöhnlich fingen die großen Herren selbst die von den Hunden festgemachten Bären ab; August der Starke aber pflegte ihnen den Kopf abzuschlagen.
Selbst in der Neuzeit werden noch hier und da ähnliche Kämpfe abgehalten. Auf dem Stiergefechtsplatze in Madrid läßt man bisweilen Bären mit Stieren kämpfen, und in Paris hetzte man noch im Anfange dieses Jahrhundertes angekettete Bären mit Hunden. Kobell, welcher einem derartigen Schauspiele beiwohnte, erzählt, daß der Bär die auf ihn anstürmenden Hunde mit seinen mächtigen Branten rechts und links niederschlug und dabei fürchterlich brummte. Als die Hunde aber hitzig wurden, ergriff er mehrere nacheinander, schob sie unter sich und erdrückte sie, während er andere mit schweren Wunden zur Seite schleuderte.
Die Römer erhielten ihre Bären hauptsächlich vom Libanon, erzählen aber, daß sie solche auch aus Nordafrika und Libyen bezogen. Ihre Beschreibungen der Lebensgeschichte des Thieres sind mit Fabeln gemischt. Aristoteles schildert, wie gewöhnlich, am richtigsten; Plinius schreibt ihm nach, fügt aber bereits einige Fabeln hinzu; Oppian gibt einen trefflichen Bericht über die herrlichen Bärenjagden der Armenier am Tigris, Julius Capitolinus endlich einen solchen über die Kampfspiele im Cirkus, gelegentlich deren er erwähnt, daß Gordian der Erste an einem Tage eintausend Bären auf den Kampfplatz brachte.
Der nächste Verwandte des Landbären ist der über ganz Nordwestamerika verbreitete Grau- oder Grislibär ( Ursus cinereus, U. ferox, griseus, horribilis und canadensis). Im Leibesbau und Aussehen ähnelt er unserem Bären, ist aber größer, schwerer, plumper und stärker als dieser. Dunkelbraune, an der Spitze blasse Haare, welche an den Schultern, der Kehle und dem Bauche, überhaupt am ganzen Rumpfe länger, zottiger und verworrener als bei den Landbären
sind, hüllen den Leib ein, kurze und sehr blasse bekleiden den Kopf. Die Iris ist röthlichbraun. Lichtgraue und schwärzlichbraune Spielarten kommen ebenfalls vor. Von den europäischen Bären unterscheidet sich das Thier sicher durch die Kürze seines Schädels und durch die Wölbung der Nasenbeine, die breite, flache Stirn, die Kürze der Ohren und des Schwanzes, und vor allem durch die riesigen, bis 13 Zentimeter langen, sehr stark gekrümmten, nach der Spitze zu wenig verschmälerten, weißlichen Nägel. Auch die bedeutende Größe ist ein Merkmal, welches Verwechselungen zwischen den beiden Arten nicht leicht zuläßt; denn während unser Bär nur in seltenen Fällen 2,2 Meter an Länge erreicht, wird der graue Bär oder, wie ihn die Jäger scherzhafterweise nennen, der » Ephraim«, regelmäßig 2,3, nicht selten sogar 2,5 Meter lang und erreicht ein Gewicht von 7 bis 9 Zentnern.

Grau- oder Grislibär: ( Ursus cinereus) 1/18 natürl. Größe.
In seiner Lebensweise ähnelt der Graubär so ziemlich dem unseren; sein Gang ist jedoch schwankender oder wiegender, und alle seine Bewegungen sind plumper. Nur in der Jugend soll er im Stande sein, Bäume zu ersteigen und von dieser Fähigkeit Gebrauch machen, um Eicheln, sein Lieblingsfutter, abzustreifen, im Alter dagegen solche Künste nicht mehr auszuführen vermögen: wenigstens wollen sich mehr als einmal die von ihm gefährdeten Jäger durch rasches Ersteigen von Bäumen gerettet und dabei bemerkt haben, daß er trotz der höchsten Wuth niemals gewagt hat, sie dahin zu verfolgen. Dagegen schwimmt er mit Leichtigkeit selbst über breite Ströme und verfolgt im Zorne auch im Wasser seinen Feind. Er soll ein furchtbarer Räuber und mehr als stark genug sein, jedes Geschöpf seiner Heimat zu bewältigen. Sogar der starke Bison, dessen Vetter Wisent unser Bär behutsam aus dem Wege geht, soll ihm zur Beute fallen, und von ihm abwärts jedes Säugethier. Vor dem Menschen soll er keine Furcht zeigen. Seine Sippschaftsverwandten, sagen die Amerikaner, weichen, von angeborenem Gefühle getrieben, dem Herrn der Erde aus und greifen ihn bloß dann an, wenn sie der rasende Zorn oder der Drang nach Rache übermannt; nicht so der graue Bär. Er geht ohne weiteres auf den Menschen los, sei er zu Pferde oder zu Fuß, bewaffnet oder nicht, habe er ihn beleidigt oder gar nicht daran gedacht, ihn zu kränken. Und wehe dem, welcher sich nicht noch rechtzeitig vor ihm flüchtet oder, wenn er ein ganzer Mann ist, im rechten Augenblicke eine tödtende Kugel ihm zusenden kann! Der rasende Bär umarmt ihn, sobald er ihn eingeholt hat, und zerpreßt ihm die Rippen im Leibe oder zerreißt ihm mit einem einzigen Tatzenschlage den ganzen Leib. Palliser, welcher glücklich genug war, fünf von diesen furchtbaren Geschöpfen zu tödten, ohne mit ihren Zähnen und Klauen Bekanntschaft zu machen, bestätigt die Erzählung der Indianer von der Wuth dieser Thiere und gibt eine Beschreibung der gefährlichen Jagden, von denen schließlich eine regelmäßig den Tod des Jägers herbeiführt; denn die Lebenszähigkeit des Ungeheuers ist ebenso groß wie seine Kraft, und jede nicht augenblicklich tödtende Wunde, welche es erhält, für den Jäger weit gefährlicher als für das Raubthier.
Aus allen diesen Gründen erringt der Jäger, welcher sich erwiesenermaßen mit Ephraim gemessen hat, die Bewunderung und Hochschätzung aller Männer, welche von ihm hören, der Weißen ebensowohl wie der Indianer, von denen die Erlegung des Bären geradezu als das erste Manneswerk gepriesen wird. Unter allen Stämmen der Rothhäute im Norden Amerikas verleiht der Besitz eines Halsbandes aus Bärenklauen und Zähnen seinem Träger eine Hochachtung, wie sie bei uns kaum ein Fürst oder siegreicher Feldherr genießen kann. Nur derjenige Wilde darf die Bärenkette tragen, welcher sie sich selbst und durch eigene Kraft erworben. Selbst mit dem sonst so tief gehaßten Weißen befreundet sich der Indianer, wenn er gewißlich weiß, daß das Bleichgesicht ruhmvoll einen Kampf mit dem gewaltigen Urfeinde bestanden hat. Auch die Leiche des von Rothhäuten getödteten Bären wird mit der größten Ehrfurcht behandelt; denn sie sehen in dem gewaltigen Geschöpfe kein gemeines, gewöhnliches Thier, sondern vielmehr ein gleichsam übernatürliches Wesen, dessen entseeltem Leibe sie noch die nöthige Ehre geben zu müssen glauben.
Berichtet wird, daß das Ungeheuer, welches auf den Menschen, den es sieht, dreist losgeht, um ihn zu vernichten, vor der Witterung desselben augenblicklich die Flucht ergreift. Dies wird als Thatsache von den meisten Jägern behauptet, und man kennt Beispiele, wo ein unbewaffneter Mann diese unerklärliche Furchtsamkeit des Bären benutzte und ihm dadurch entrann, daß er nach einem Orte hinlief, von welchem aus der Luftzug dem Bären seine Witterung zuführen mußte. Sobald der Bär den fremdartigen Geruch verspürte, hielt er an, setzte sich auf die Hinterbeine, stutzte und machte sich endlich furchtsam auf und davon. In ebendemselben Grade, wie er die Witterung des Menschen scheut, fürchten alle Thiere die seinige. Die Hausthiere geberden sich genau so, wie wenn ihnen die Ausdünstung von einem Löwen oder Tiger wahrnehmbar wird, und selbst das todte Thier, ja bloß sein Fell flößt ihnen noch gewaltigen Schreck ein. Einzelne Jäger behaupten, daß auch die sonst so gefräßigen Hundearten Amerikas, welche so leicht keine andere Leiche verschonen, ihre Achtung vor dem Bären bezeigen und seinen Leichnam unangetastet lassen.
Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn ich annehme, daß alle diese Angaben zum guten Theile übertrieben sind. Der Grislibär wird sich, so darf ich glauben, wohl in jeder Beziehung entsprechenden Falls ebenso benehmen wie sein europäischer Verwandter, also in der Regel ebenso feig und, wenn unbedingt nöthig, ebenso muthig benehmen wie dieser, ihn aber schwerlich erheblich überbieten.
In jüngeren Jahren ist auch der Grislibär ein gemüthliches Thier. Sein Fell ist, trotz seiner Länge und Dicke, so fein und so schmuck von Farbe, daß es den kleinen Gesellen sehr ziert. Wenn man einen jungen Graubären einfängt, kann er leidlich gezähmt werden. Palliser, welcher einen Grislibär mit nach Europa gebracht hatte, rühmt seinen Gefangenen sehr. Er aß, trank und spielte mit den Matrosen und erheiterte alle Reisende, so daß der Kapitän des Schiffes später unserem Jäger versicherte, er würde sehr erfreut sein, wenn er für jede Reise einen jungen Bären bekommen könnte. »Eines Tages«, erzählt dieser Gewährsmann, »trieb ein Regenschauer alle Reisenden einschließlich des Bären unter Deck. Da wurde meine Aufmerksamkeit durch ein lautes Gelächter auf dem Deck rege. Als ich nach oben eilte, sah ich, daß der Bär die Ursache desselben war. Er hatte sich aus dem geschlossenen Raume durch Zerbrechen seiner Kette befreit und war weggegangen. Immer noch konnte ich mir die Ursache des Gelächters nicht erklären. Die Leute standen um die Kajüte des Steuermannes herum und beschäftigten sich mit einem Gegenstande, welcher auf des Steuermannes Bett lag und sich sorgfältig in die Laken gehüllt hatte. Ihre Scherze wurden plötzlich mit einem unwilligen Geheule beantwortet, und siehe da, mein Freund Ephraim war es, welcher, ärgerlich über den Regen, sich losgemacht, zufällig den Weg nach des Steuermannes Bett gefunden, dasselbe bestiegen und sich dort höchst sorgsam in die Decken gehüllt hatte. Der gut gelaunte Steuermann war nicht im geringsten erzürnt darüber, sondern im Gegentheile auf das äußerste erfreut.«
Dasselbe Thier hatte eine merkwürdige Freundschaft mit einer kleinen Antilope eingegangen, welche ein Reisegenosse von ihm war, und vertheidigte sie bei einer Gelegenheit in der ritterlichsten Weise. Als die Antilope vom Schiffe aus durch die Straßen geführt wurde, kam ein gewaltiger Bulldogg auf sie zugestürzt und ergriff sie, ohne sich im geringsten um die Zurufe und Stockschläge der Führer zu kümmern, in der Absicht, sie zu zerreißen. Zum Glück ging Palliser mit seinem Bären denselben Weg, und kaum hatte letzterer gesehen, was vorging, als er sich mit einem Rucke befreite und im nächsten Augenblicke den Feind seiner Freundin am Kragen hatte. Ein wüthender Streit entspann sich; der Bär machte anfangs keinen Gebrauch von seinen Zähnen oder Krallen und begnügte sich mit einer Umarmung des Bullenbeißers, nach welcher er ihn mit Macht zu Boden schleuderte. Der Hund, darüber wüthend und durch den Zuruf seines Herrn noch mehr angeregt, glaubte, es nur mit einem ziemlich harmlosen Gegner zu thun zu haben, und versetzte dem Bären einen ziemlich starken Biß. Doch hatte er sich in seinem Gegner getäuscht. Durch den Schmerz wüthend gemacht, verlor Ephraim seinen Gleichmuth und faßte den Hund nochmals mit solcher Zärtlichkeit zwischen seine Arme, daß er ihn beinahe erdrosselte. Zum Glücke konnte sich der Bullenbeißer noch freimachen, ehe der Bär seine Zähne an ihm versuchte, hatte aber alle Lust zu fernerem Kampfe verloren und entfloh mit kläglichem Heulen, dem Bären das Feld überlassend, welcher seinerseits nun, höchlich befriedigt über den seiner Freundin gegebenen Schutz, weiter tappte.
In der Neuzeit sind Grislibären öfters zu uns gebracht worden. Die gefangenen unterscheiden sich in ihrem Wesen und Betragen nicht merkbar von ihrem europäischen Verwandten. In dem Londoner Thiergarten befinden sich zwei von ihnen, welche auch einmal in der Thierheilkunde eine große Rolle spielten. Sie wurden in ihrer Jugend von einer heftigen Augenentzündung befallen, welche ihnen vollkommene Blindheit zurückließ. Aus Mitleid ebensowohl als auch, um die Wirkungen des Chloroforms bei ihnen zu erproben, beschloß man, ihnen den Staar zu stechen. Nachdem man beide Kranken von einander getrennt hatte, legten die Wärter jedem derselben ein starkes Halsband an und zogen an Stricken den Kopf des Riesenbären dicht an das Gitter heran, um ihm ohne Furcht den mit Chloroform getränkten Schwamm unter die Nase halten zu können. Die Wirkung war eine unverhältnismäßig rasche und sichere. Nach wenigen Minuten schon lag das gewaltige Thier ohne Besinnung und ohne Bewegung wie todt in seinem Käfige, und der Augenarzt konnte jetzt getrost in denselben eintreten, das furchtbare Haupt nach Belieben zurecht legen und sein Werk verrichten. Als man eben die Verdunkelung des Käfigs bewirkt hatte, erwachte das Thier, taumelte noch wie betrunken hin und her und schien um so unsicherer zu werden, je mehr es zu Besinnung kam. Mit der Zeit aber schien es zu bemerken, was mit ihm während seines Todtenschlafes geschehen war, und als man es nach wenigen Tagen wieder untersuchte, war es sich seiner wiedererlangten Sehfähigkeit bewußt geworden und schien sich jetzt sichtlich an dem Lichte des Tages zu erfreuen oder wenigstens den Gegensatz zwischen der früheren dauernden Nacht und dem jetzigen hellen Tage zu erkennen.
Der bekannteste Bär Amerikas ist der Baribal, Muskwa oder Schwarzbär ( Ursus americanus ), ein weit verbreitetes und verhältnismäßig gutmüthiges, wenigstens ungleich harmloseres Thier als Grau- und Landbär, erreicht eine Länge von höchstens 2 Meter bei einer Schulterhöhe von etwa über 1 Meter. Vom Landbären unterscheidet er sich hauptsächlich durch den schmäleren Kopf, die spitzere, von der Stirn nicht abgesetzte Schnauze, die sehr kurzen Sohlen und durch die Beschaffenheit und Färbung des Pelzes. Dieser besteht aus langen, straffen und glatten Haaren, welche nur an der Stirn und um die Schnauze sich verkürzen. Ihre Färbung ist ein glänzendes Schwarz, welches jedoch zu beiden Seiten der Schnauze in Fahlgelb übergeht. Ein ebenso gefärbter Flecken findet sich oft auch vor den Augen. Seltener sieht man Baribals mit weißen Lippenrändern und weißen Streifen auf Brust und Scheitel. Die Jungen, welche lichtgrau aussehen, legen mit Beginn ihres zweiten Lebensjahres das dunkle Kleid ihrer Eltern an, erhalten jedoch erst später die langhaarige Decke ihrer Eltern.

Baribal ( Ursus americanus) [1/16] natürl. Größe.
Der Baribal ist über ganz Nordamerika verbreitet. Man hat ihn in allen waldigen Gegenden von der Ostküste bis zur Grenze Kaliforniens und von den Pelzländern bis nach Mejiko gefunden. Der Wald bietet ihm alles, was er bedarf; er wechselt seinen Aufenthalt aber nach den Jahreszeiten, wie es deren verschiedene Erzeugnisse bedingen. Während des Frühlings pflegt er seine Nahrung in den reichen Flußniederungen zu suchen und deshalb in jenen Dickichten sich umherzutreiben, welche die Ufer der Ströme und Seen umsäumen; im Sommer zieht er sich in den tiefen, an Baumfrüchten mancherlei Art so reichen Wald zurück; im Winter endlich wühlt er sich an einer den Blicken möglichst verborgenen Stelle ein passendes Lager, in welchem er zeitweilig schläft oder wirklichen Winterschlaf hält. Ueber letzteren lauten die Angaben verschieden. Einige sagen, daß nur manche Bären wochenlang im Lager sich verbergen und schlafen, während die übrigen auch im Winter von einem Orte zum anderen streifen, ja sogar von nördlichen Gegenden her nach südlichen wandern; andere glauben, daß dies bloß in gelinderen Wintern geschieht und in strengeren sämmtliche Schwarzbären Winterschlaf halten. Sicher ist, daß man gerade im Winter oft zur Jagd des Baribal auszieht und ihn in seinem Lager aufsucht. Laut Richardson wählt das Thier gewöhnlich einen Platz an einem umgefallenen Baume, scharrt dort eine Vertiefung aus und zieht sich dahin bei Beginn eines Schneesturmes zurück. Der fallende Schnee deckt dann Baum und Bär zu; doch erkennt man das Lager an einer kleinen Oeffnung, welche durch den Athem des Thieres aufgethaut wird, und an einer gewissen Menge von Reif, welcher sich nach und nach um diese Oeffnung niederschlägt. In den südlicheren Gegenden mit höherem Baumwuchse kriecht der Bär oft in hohle Bäume, um hier zu schlafen. In diesem Winterlager verweilt er, solange Schnee fällt. Auch im Sommer pflegt er sich ein Bett zurecht zu machen und dasselbe mit trockenen Blättern und Gras auszupolstern. Dieses Lager ist aber schwer zu finden, weil es gewöhnlich an den einsamsten Stellen des Waldes in Felsspalten, niederen Höhlungen und unter Bäumen, deren Zweige bis zur Erde herabhängen, angelegt wird. Nach Audubon soll es dem Lager des Wildschweines am meisten ähneln.
Auch der Baribal ist, so dumm, plump und ungeschickt er aussieht, ein wachsames, reges, kräftiges, bewegungsfähiges, geschicktes und ausdauerndes Thier. Sein Lauf ist so schnell, daß ihn ein Mann nicht einzuholen vermag; das Schwimmen versteht er vortrefflich, und im Klettern ist er Meister. Jedenfalls ist er in allen Leibesübungen gewandter als unser brauner Bär, dessen Eigenschaften er im übrigen besitzt. Nur höchst selten greift er den Menschen an, flieht vielmehr beim Erscheinen seines ärgsten Feindes so schnell als möglich dem Walde zu, und nimmt selbst verwundet nicht immer seinen Gegner an, während auch er, wenn er keinen Ausweg mehr sieht, ohne Besinnen der offenbarsten Uebermacht sich entgegenwirft und dann gefährlich werden kann.
Seine Nahrung besteht hauptsächlich in Pflanzenstoffen, und zwar in Gräsern, Blättern, halbreifem und reifem Getreide, in Beeren und Baumfrüchten der verschiedensten Art. Doch verfolgt auch er das Herdenvieh der Bauern und wagt sich, wie Meister Braun, selbst an die bewehrten Rinder. Dem Landwirt schadet er immer, gleichviel, ob er in die Pflanzung einfällt oder die Herden beunruhigt, und deshalb ergeht es ihm wie unserem Bären: er wird ohne Unterlaß verfolgt und durch alle Mittel ausgerottet, sobald er sich in der Nähe des Menschen zu zeigen wagt.
Ueber die Bärzeit des Baribal scheinen die amerikanischen Naturforscher nicht genau unterrichtet zu sein. Richardson gibt die Dauer der Trächtigkeit des schwarzen Bären zu ungefähr fünfzehn bis sechszehn Wochen an, und Audubon scheint dies ihm nachgeschrieben zu haben. Als Wurfzeit setzen beide übereinstimmend den Januar. Die Anzahl der Jungen soll nach Richardson zwischen eins und fünf schwanken, nach Audubon dagegen nur zwei betragen. Ich glaube, daß Beobachtungen an gefangenen Baribals auch hier entscheidend sein dürften. Ein mir bekanntes Paar dieser Bären hat sich zweimal in der Gefangenschaft fortgepflanzt, und die Jungen sind schon im Januar geworfen worden. Von mir gepflegte Baribals bärten am 16. Juni zum ersten Male und sodann wie der braune Bär beinahe einen ganzen Monat lang alltäglich. Daß die wildlebenden Bären hohle Bäume zu ihrem Wochenbette auswählen, wie dies Richardson angibt, ist wahrscheinlich. Ueber die erste Jugendzeit der neugeborenen Jungen scheinen Beobachtungen zu fehlen. Von größer gewordenen weiß man, daß die Alte sie mit warmer Zärtlichkeit liebt, längere Zeit mit sich umherführt, in allem unterrichtet und bei Gefahr muthvoll vertheidigt.
Die Jagd des Baribal soll, hauptsächlich wegen der merkwürdigen Lebenszähigkeit des Thieres, nicht gefahrlos sein. Man wendet die verschiedensten Mittel an, seiner sich zu bemächtigen. Viele werden in großen Schlagfallen gefangen, die meisten aber mit der Birschbüchse erlegt. Gute Hunde leisten dabei vortreffliche Dienste, indem sie den Bären verbellen oder zu Baum treiben und dem Jäger Gelegenheit geben, ihn mit aller Ruhe aufs Korn zu nehmen und ihm eine Kugel auf die rechte Stelle zu schießen. Audubon beschreibt in seiner lebendigen Weise eine derartige Jagd, bei welcher mehrere Bären erlegt, aber auch mehrere Hunde verloren und die Jäger selbst gefährdet wurden. Hunde allein können den Baribal nicht bewältigen, und auch die besten Beißer unterliegen oft seinen furchtbaren Brantenschlägen. In vielen Gegenden legt man mit Erfolg Selbstschüsse, welche der Bär durch Wegnahme eines vorgehängten Köders entladet. Auf den Strömen und Seen jagt man ihm nach, wenn er von einem Ufer zu dem anderen schwimmt oder von den Jagdgehülfen in das Wasser getrieben wurde.
Sehr eigenthümlich sind manche Jagdweisen der Indianer, noch eigenthümlicher die feierlichen Gebräuche zur Versöhnung des abgeschiedenen Bärengeistes, welche einer gottesdienstlichen Verehrung gleichkommen. Alexander Henry, der erste Engländer, welcher in den eigentlichen Pelzgegenden reiste, erzählt folgendes: »Im Januar hatte ich das Glück, einen sehr starken Kieferbaum aufzufinden, dessen Rinde von den Bärenklauen arg zerkratzt war. Bei fernerer Prüfung entdeckte ich ein großes Loch in dem oberen Theile, welches in das hohle Innere führte, und schloß aus allem, daß hier ein Bär sein Winterlager aufgeschlagen haben möchte. Ich theilte die Beobachtungen meinen indianischen Wirten mit, und diese beschlossen sofort, den Baum zu fällen, obgleich er nicht weniger als drei Klaftern im Umfange hielt. Am nächsten Morgen machte man sich über die Arbeit, und am Abend hatte man das schwere Werk zur Hälfte beendet. Am Nachmittage des folgenden Tages fiel der Baum, wenige Minuten später kam zur größten Befriedigung aller ein Bär von außergewöhnlicher Größe durch die gedachte Oeffnung hervor. Ich erlegte ihn, ehe er noch einige Schritte gemacht hatte. Sofort nach seinem Tode näherten sich ihm alle Indianer und namentlich die »Alte Mutter«, wie wir sie nannten. Sie nahm den Kopf des Thieres in ihre Hände, streichelte und küßte ihn wiederholt und bat den Bären tausendmal um Verzeihung, daß man ihm das Leben genommen habe, versicherte auch, daß nicht die Indianer dies verübt hätten, sondern daß es gewißlich ein Engländer gewesen wäre, welcher den Frevel begangen. Diese Geschichte währte nicht eben lange; denn es begann bald das Abhäuten und Zertheilen des Bären. Alle beluden sich mit der Haut, dem Fleische und Fette und traten darauf den Heimweg an.
»Sobald man zu Hause angekommen war, wurde das Bärenhaupt mit silbernen Armbändern und allem Flitterwerk, welches die Familie besaß, geschmückt. Dann legte man es auf ein Gerüst und vor die Nase eine Menge von Tabak. Am nächsten Morgen traf man Vorbereitungen zu einem Feste. Die Hütte wurde gereinigt und gefegt, das Haupt des Bären erhoben und ein neues Tuch, welches noch nicht gebraucht worden war, darüber gebreitet. Nachdem man die Pfeifen zurecht gemacht hatte, blies der Indianer Tabaksrauch in die Nasenlöcher des Bären. Er bat mich, dasselbe zu thun, weil ich, der ich das Thier getödtet habe, dadurch sicher dessen Zorn besänftigen werde. Ich versuchte, meinen wohlwollenden und freundlichen Wirt zu überzeugen, daß der Bär kein Leben mehr habe, meine Worte fanden aber keinen Glauben. Zuletzt hielt mein Wirt eine Rede, in welcher er den Bären zu verherrlichen suchte, und nach dieser endlich begann man von dem Bärenfleische zu schmausen.«
Alle von mir beobachteten Baribals unterschieden sich durch ihre Sanftmuth und Gutartigkeit wesentlich von ihren Verwandten. Sie machen ihren Wärtern gegenüber niemals von ihrer Kraft Gebrauch, erkennen vielmehr die Oberherrlichkeit des Menschen vollkommen an und lassen sich mit größter Leichtigkeit behandeln. Jedenfalls fürchten sie den Wärter weit mehr als dieser sie. Aber sie fürchten sich auch vor jedem anderen Thiere. Ein kleiner Elefant, welcher an ihren Käfigen vorbeigeführt wurde, versetzte von mir gepflegte Baribals so sehr in Schrecken, daß sie eiligst an dem Baume ihres Käfigs emporklimmten, als ob sie dort Schutz suchen wollten. Zu Kämpfen mit anderen Bären, welche man zu ihnen bringt, zeigen sie keine Lust; selbst ein kleiner, muthiger ihrer0 eigenen Art kann sich die Herrschaft im Raume erwerben. Als ich einmal junge Baribals zu zwei Alten setzen ließ, entstand ein wahrer Aufruhr im Zwinger. Die Thiere fürchteten sich gegenseitig wie die alten Weiber in Gellerts Fabel. Dem erwachsenen Weibchen wurde es beim Anblick der Kleinen äußerst bedenklich; denn es eilte so schnell als möglich auf die höchste Spitze des Baumes. Aber auch die Jungen bewiesen durch Schnaufen und ihren Rückzug in die äußerste Ecke, daß sie voller Entsetzen waren. Nur der alte Bär blieb ziemlich gelassen, obwohl er fortwährend ängstlich zur Seite schielte, als ob er fürchte, daß die Kleinen ihn rücklings überfallen könnten. Endlich beschloß er, seine Hausgenossen genauer in Augenschein zu nehmen. Er näherte sich den Neuangekommenen und beschnüffelte sie sorgfältig. Ein mehr ängstliches, als ärgerliches Schnaufen schien ihn zurückschrecken zu sollen. Als es nichts half, erhob sich das junge Weibchen auf die Hinterfüße, bog den Kopf tief nach vorn herab, schielte höchst sonderbar von unten nach oben zu dem ihm gegenüber gewaltigen Riesen empor, schnaufte ärgerlich und ertheilte ihm, als er sich wiederum nahete, plötzlich eine Ohrfeige. Dieser eine Schlag war für den alten Feigling genug. Er zog sich augenblicklich zurück und dachte fortan nicht mehr daran, den unhöflichen Kleinen sich zu nähern. Aber deren Sinn war ebenfalls nur auf Sicherstellung gerichtet. Der Hunger trieb die alte Bärin vom Baume herab, und augenblicklich kletterten beide Jungen an ihm empor. Volle zehn Tage lang bannte sie die Furcht an den einmal gewählten Platz; die leckerste Speise, der ärgste Durst waren nicht vermögend, sie von oben herabzubringen. Sie kletterten nicht einmal dann hernieder, als wir die alten Bären abgesperrt und somit den ganzen Zwinger ihnen zur Verfügung gestellt hatten. In der kläglichsten Stellung lagen oder hingen sie auf den Zweigen Tag und Nacht, und zuletzt wurden sie so müde und matt, daß wir jeden Augenblick fürchten mußten, sie auf das harte Steinpflaster herabstürzen zu sehen. Dem war aber nicht so, der Hunger überwand schließlich alle Bedenken. Am zehnten Tage stiegen sie aus freien Stücken herab und lebten fortan in Frieden und Freundschaft mit den beiden älteren. Der letzte Baribal, welchen ich in denselben Käfig bringen ließ, benahm sich genau ebenso, obgleich er weit weniger zuzusetzen hatte als die beiden ersten Jungen, welche sehr wohlgenährt angekommen waren.
Gefangene Baribals geben fortwährend Gelegenheit, zu beobachten, wie leicht und geschickt sie klettern. Wenn sie durch irgend etwas erschreckt werden, springen sie mit einem Satze ungefähr zwei Meter hoch bis zu den ersten Zweigen des glatten Eichenstammes empor und steigen dann mit größter Schnelligkeit und Sicherheit bis zu dem Wipfel hinauf. Einmal sprang die alte Bärin über den Wärter, welcher sie in die Zelle einzutreiben versuchte, hinweg und auf den Baum. Die ganze Familie sieht man oft in den verschiedenartigsten, scheinbar höchst unbequemen Stellungen auf den Aesten gelagert, und einige halten in Astgabeln oft ihren Mittagsschlaf.
Die Stimme hat mit der unseres Landbären Aehnlichkeit, ist aber viel schwächer und kläglicher. Ein eigentliches Gebrüll oder Gebrumm habe ich nie vernommen. Aufregungen aller Art drückt der Baribal, wie sein europäischer Verwandter, durch Schnaufen und Zusammenklappen der Kinnladen aus. Im Zorn beugt er den Kopf zur Erde, schiebt die Lippen weit vor, schnauft und schielt unentschieden um sich. Sehr ergötzlich ist die Haltung dieser Bären, wenn sie aufrecht stehen. Die kurzen Sohlen erschweren ihnen diese Stellung entschieden, und sie müssen, um das Gleichgewicht herzustellen, den Rücken stark einwärts krümmen. Dabei tragen sie die Vorderarme gewöhnlich so hoch, daß der Kopf nicht auf, sondern zwischen den Schultern zu sitzen scheint, und so nimmt sich die Gestalt höchst sonderbar aus.
Durch Freigebigkeit wohlwollender Freunde können Baribals sehr verwöhnt werden. Sie wissen, daß sie gefüttert werden, und erinnern denjenigen, welcher vergessen sollte, ihnen etwas zu reichen, durch klägliches Bitten an die Güte anderer. So gewöhnen sie sich eine Bettelei an, welcher niemand widerstehen kann; denn ihre Stellungen mit den ausgebreiteten Armen sind so drollig und ihr Gewinsel so beweglich, daß es Jedermanns Herz rühren muß. Baribals, welche Graf Görtz besaß, untersuchten die Taschen der Leute nach allerhand Leckereien und belästigten den Unglücklichen, welcher nichts für sie mitgebracht hatte, auf das äußerste.
Als asiatischen Vertreter des Baribal darf man den Kragenbären oder Kuma der Japanesen, Wiógene der Birar-Tungusen ( Ursus torquatus, U. tibetanus und japonicus ?) betrachten. Er kommt zwar jenem in der Größe nicht ganz gleich, ähnelt ihm aber sehr in der Färbung. Seine Gestalt ist verhältnismäßig schlank, der Kopf spitzschnäuzig, auf Stirn und Nasenrücken fast geradlinig, die Ohren sind rund und verhältnismäßig groß, die Beine mittellang, die Füße kurz, die Zehen mit kurzen, aber kräftigen Nägeln bewehrt. Behaarung und Färbung scheinen ziemlich bedeutenden Abänderungen unterworfen zu sein, falls sich die Angaben wirklich auf ein und dasselbe Thier und nicht auf zwei verschiedene Arten beziehen. Cuvier, welcher den von Duvaucel in Silhet entdeckten Bär zuerst beschrieb, gibt an, daß der Pelz, mit Ausnahme einer zottigen Mähne am Halse, glatt und bis auf die weißliche Unterlippe und die weiße Brustzeichnung sowie die röthlichen Schnauzenseiten gleichmäßig schwarz sei. Die Brustzeichnung wird mit einem Y verglichen; sie bildet ein Querband in der Schlüsselbeingegend, von welchem sich in der Mitte nach der Brust zu ein Stiel oder Streifen abzweigt. Wagner sah einen anderen Kuma lebend in einer Thierschaubude, welcher von der eben gegebenen Beschreibung insofern abwich, als bei ihm fast die ganze Schnauze bräunlich gefärbt erschien und ein gleichgefärbter Flecken über jedem Auge sich zeigte. Auch fehlte der Brustbinde jener nach dem Bauche zu verlaufende Stiel. Unsere Abbildung stellt ein Paar dieser Bären dar, welche aus Japan stammten, im Thiergarten zu Rotterdam lebten und im ganzen mit der Wagner'schen Beschreibung übereinstimmten.
Es ist immerhin möglich, daß sich die »Mondfleckbären« der Japanesen von jenen des Festlandes unterscheiden, bis jetzt fehlen jedoch genügende Beobachtungen, daß wir ein richtiges Urtheil hierüber fällen könnten. Gefangene aus Japan, welche ich sah, wichen nicht unwesentlich von den festländischen Verwandten ab, keinesfalls aber mehr als die Landbären, über deren Arteinheit oder Artverschiedenheit die Meinungen, wie wir sahen, auch noch getheilt sind. Wenn wir alle Kragenbären als zu einer Art gehörig betrachten, ergibt sich, daß diese Art weit verbreitet ist. Bald nach Duvaucels Entdeckung fand Wallich unseren Bären in Nepal auf, Siebold sagt in seinem Werke über die Thierwelt Japans, daß der Kuma nicht bloß in China und Japan, sondern auch in den meisten Gebirgen des Festlandes und der Inseln Südasiens häufig vorkomme, und Radde endlich lernte ihn als Bewohner Südostsibiriens kennen. In Tibet dagegen scheint er, trotz seiner lateinischen Nebenbenennung, nicht gefunden zu werden.
Ueber Lebensweise und Betragen verdanken wir Adams und Radde Mittheilungen. In Nordindien und Kaschmir bewohnt der Kragenbär am liebsten Walddickichte in der Nähe von Feldern und Weinbergen, in Südostsibirien dagegen die hochstämmigen Waldungen. Als vorzüglicher Kletterer erklimmt er mit Leichtigkeit die höchsten Bäume; die Birar-Tungusen versicherten Radde, daß er überhaupt selten zum Boden herabkomme, im Sommer in den Baumkronen durch Aneinanderbiegen und Verschlingen von Zweigen sich kleine Lauben mache und im Winter in sitzender Stellung in hohlen Bäumen schlafe. Die Lauben selbst hat Radde wiederholt gesehen, von den Eingeborenen jedoch auch erfahren, daß sie nur als Spielereien, nicht aber als Wohnungen zu betrachten seien. Im Himalaya scheint über solche Bauthätigkeit nichts bekannt zu sein, wohl aber stimmt Adams darin mit Radde überein, daß der Kragenbär zu den besten Kletterern innerhalb seiner Familie zählt; denn wenn in Kaschmir die Wallnüsse und Maulbeeren reifen, besteigt er die höchsten Bäume, um diese Früchte zu plündern. Außerdem erscheint er als unliebsamer Besucher in Maisfeldern und Weingärten und thut hier oft so großen Schaden, daß die Feldbesitzer sich genöthigt sehen, Wachtgerüste zu errichten und diese mit Leuten zu besetzen, welche durch lautes Schreien die sich einstellenden Bären in die Flucht zu scheuchen versuchen. Wohl nur, wenn der größte Hunger ihn treibt, vergreift sich ein Kragenbär gelegentlich auch an Kleinvieh und bloß im
äußersten Nothfalle an einem Menschen. Die Birar-Tungusen erzählten Radde, daß er feige und gefahrlos sei, weil er einen kleinen Rachen habe und nur beißen, nicht aber reißen könne wie der Landbär; Adams aber erfuhr auch das Gegentheil und versichert, daß er, plötzlich überrascht, zuweilen zum Angriffe schreitet. Bei seinen nächtlichen Ausflügen flüchtet er regelmäßig vor dem Menschen. Sobald er einen solchen wittert, und er soll dies auf große Entfernung vermögen, schnüffelt er in die Luft, bekundet sein Erregtsein, geht einige Schritte in der Richtung, aus welcher der Wind kommt, weiter, erhebt sich, bewegt das Haupt von einer Seite zur anderen, bis er von der ihm drohenden Gefahr sich vergewissert zu haben glaubt, macht dann Kehrt und eilt davon mit einer Schnelligkeit, welche demjenigen unglaublich dünkt, der ihn nur im Käfige kennen gelernt hat. Wird er auf einem Felsenpfade plötzlich erschreckt, so rollt er sich zu einem Ballen zusammen und über den Abhang hinab, wie Adams selbst gesehen zu haben versichert, manchmal über dreihundert Yards weit. Bei Begegnungen mit dem Landbären soll übrigens nicht er, sondern dieser zuerst den Rücken kehren, ob gerade aus Furcht, muß dahingestellt bleiben, da die Eingeborenen auch von einem nicht feindschaftlichen Verhältnisse zwischen beiden zu berichten wissen. Wenn beide Bären, so erzählen sie, im Herbste gemeinschaftlich die tieferen Waldungen bewohnen, folgt der Landbär seinem Verwandten und wartet, da er selbst nicht gut klettert, bis dieser einen Fruchtbaum bestiegen hat, um sodann die abfallenden oder von dem Kragenbären abgestreiften Früchte zu verzehren. Die Jungen des letzteren, zwei an der Zahl, werden im Frühjahre geboren und bleiben während des Sommers bei der Alten. Das Fleisch gilt bei den Japanern wie bei den Birar-Tungusen für wohlschmeckender als das des Landbären.
Gefangene Kragenbären, welche gegenwärtig in allen größeren Thiergärten zu sehen sind, ähneln in ihrem Betragen am meisten dem Baribal, haben so ziemlich dessen Eigenheiten und Gewohnheiten, stehen geistig ungefähr auf derselben Stufe mit ihm und zeichnen sich höchstens durch die Zierlichkeit ihrer Bewegungen vor ihm aus.
Ein von den bisher erwähnten Arten der Familie merklich abweichender, zwar gestreckt, aber doch plump gebauter, dickköpfiger Bär, mit breiter Schnauze, kleinen Ohren, sehr kleinen blöden Augen, verhältnismäßig ungeheueren Tatzen, langen und starken Krallen und kurzhaarigem Fell, Vertreter der Untersippe der Sonnenbären ( Helarctos), ist der Bruan, wie er in seiner Heimat genannt wird, oder der Malaienbär ( Ursus malayanus, Helarctos und Prochilus malayanus). Seine Länge beträgt etwa 1,4 Meter, die Höhe am Widerrist ungefähr 70 Centimeter. Der kurzhaarige, aber dichte Pelz ist mit Ausnahme der fahlgelben Schnauzenseiten und eines hufeisenförmigen Brustfleckens von gelber oder lichter Grundfärbung, glänzend schwarz.
Der Bruan, ein Bewohner Nepals, Hinderindiens und der Sundainseln ist mehr noch als die verwandten Pflanzenfresser; vor allem liebt er süße Früchte. In den Kakaopflanzungen richtet er oft bedeutenden Schaden an; zuweilen macht er sie unmöglich. Er lebt ebensoviel auf den Bäumen wie auf dem Boden. Unter allen eigentlichen Bären klettert er am geschicktesten. Ueber Fortpflanzung und Jugendleben fehlen Berichte.
Man sagt, daß er in Indien oft gefangen gehalten werde, weil man ihn, als einen gutmüthigen harmlosen Gesellen, selbst Kindern zum Spielgenossen geben und nach Belieben in Haus, Hof und Garten umherstreifen lassen dürfe. Raffles, welcher einen dieser Bären besaß, durfte ihm den Aufenthalt in der Kinderstube gestatten und war niemals genöthigt, ihn durch Anlegen an die Kette oder durch Schläge zu bestrafen. Mehr als einmal kam er ganz artig an den Tisch und bat sich etwas zu fressen aus. Dabei zeigte er sich als ein echter Gutschmecker, da er von den Früchten bloß Mango verzehren und nur Schaumwein trinken wollte. Der Wein hatte für ihn einen unendlichen Reiz, und wenn er eine Zeitlang sein Lieblingsgetränk vermissen mußte, schien er die gute Laune zu verlieren. Aber dieses vortreffliche Thier verdiente auch ein Glas Wein. Es wurde im ganzen Hause geliebt und geehrt und betrug sich in jeder Hinsicht musterhaft; denn es that nicht einmal dem kleinsten Thiere etwas zu Leide. Mehr als einmal nahm es sein Futter mit dem Hunde, der Katze und dem kleinen Papagei aus einem und demselben Gefäße.

Bruan ( Ursus malayanus). [1/12] natürl. Größe.
Ein anderer Bruan war mit ebensoviel Erfolg gezähmt, aber auch gewöhnt worden, ebensogut thierische wie Pflanzennahrung zu sich zu nehmen. Letztere behagte ihm jedoch immer am besten, und Brod und Milch bildeten entschieden seine Lieblingsspeise. Davon konnte er in einem Tage mehr als zehn Pfund verbrauchen. Die Speisen nahm er auf sehr eigenthümliche Weise zu sich, indem er sich auf die Hinterfüße setzte, die lange Zunge unglaublich weit herausstreckte, den Bissen damit faßte und durch plötzliches Einziehen in den Mund brachte. Während dies geschah, führte er die sonderbarsten und auffallendsten Bewegungen mit den Vordergliedern aus und wiegte seinen Körper mit unerschöpflicher Ausdauer von der einen Seite zur anderen. Seine Bewegungen waren auffallend rasch und kräftig und ließen vermuthen, daß er im Nothfalle einen umfassenden und wirksamen Gebrauch seiner starken Glieder machen kann.
Meine Erfahrungen stimmen mit dieser Schilderung nicht überein. Ich habe den Bruan mehrfach in der Gefangenschaft gesehen und wiederholt gepflegt. Das Thier ist dumm, sehr dumm, aber nichts weniger als gutmüthig, eher verstockt und tückisch. Der besten Pflege ungeachtet befreundet er sich selten mit seinem Wärter. Er nimmt das ihm vorgehaltene Brod scheinbar mit Dank an, zeigt aber durchaus keine Erkenntlichkeit, sondern eher Lust, dem Nahenden gelegentlich einen Tatzenschlag zu versetzen. Störrisch im höchsten Grade, läßt er sich z. B. durchaus nicht aus einem Raume in den anderen treiben und läuft, wenn er vorwärts nicht durchkommen kann, trotzig und blindlings rückwärts. Strafen fruchten gar nichts. Sehr widerlich ist seine Unreinlichkeit, nicht minder unangenehm seine unbezähmbare Sucht, alles Holzwerk seiner Käfige zu zernagen. Er zerfrißt Balken und dicke Eichenstämme und arbeitet dabei mit einer Unverdrossenheit, welche einer bessern Sache würdig wäre. Sein Betragen unterhält höchstens den, welcher ihn nicht kennt: seinen Pflegern macht er sich verhaßt.
In Gestalt und Wesen auffallender noch als der Sonnenbär, erscheint der Lippenbär ( Ursus labiatus, Bradypus ursinus, Melursus und Prochilus labiatus, P. ursinus und M. lybius). Ihn kennzeichnen ein kurzer, dicker Leib, niedere Beine, ziemlich große Füße, deren Zehen mit ungeheueren Sichelkrallen bewehrt sind, eine vorgezogene, stumpfspitzige Schnauze mit weit vorstreckbaren Lippen und langes zottiges Haar, welches im Nacken eine Mähne bildet und auch seitlich tief herabfällt. Alle angegebenen Merkmale verleihen der Art ein so eigenthümliches Gepräge, daß sie in den Augen einzelner Forscher als Vertreter einer besonderen Sippe gilt. Wie merkwürdig das Thier sein muß, sieht man am besten daraus, daß es zuerst unter dem Namen des bärenartigen Faulthieres ( Bradypus ursinus) beschrieben, ja in einem Werke sogar »das namenlose Thier« genannt wurde. In Europa wurde der Lippenbär zu Ende des vorigen Jahrhunderts bekannt; anfangs dieses Jahrhunderts kam er auch lebend dahin. Da stellte sich nun freilich heraus, daß er ein echter Bär ist, und somit erhielt er seinen ihm gebührenden Platz in der Thierreihe angewiesen.
Die Länge des Lippenbären beträgt, einschließlich des etwa 10 Centimeter langen Schwanzstumpfes, 1,8 Meter, die Höhe am Widerrist ungefähr 85 Centimeter. Unser Thier kann kaum verkannt werden. Der flache, breit- und plattstirnige Kopf verlängert sich in eine lange, schmale, zugespitzte und rüsselartige Schnauze von höchst eigenthümlicher Bildung. Der Nasenknorpel nämlich breitet sich in eine flache und leicht bewegbare Platte aus, auf welcher die beiden in die Quere gezogenen und durch eine schmale Scheidewand von einander getrennten Nasenlöcher münden. Die Nasenflügel, welche sie seitlich begrenzen, sind im höchsten Grade beweglich, und die langen, äußerst dehnbaren Lippen übertreffen sie noch hierin. Sie reichen schon im Stande der Ruhe ziemlich weit über den Kiefer hinaus, können aber unter Umständen so verlängert, vorgeschoben, zusammengelegt und umgeschlagen werden, daß sie eine Art Röhre bilden, welche fast vollständig die Fähigkeiten eines Rüssels besitzt. Die lange, schmale und platte, vorn abgestutzte Zunge hilft diese Röhre mit herstellen und verwenden, und so ist das Thier im Stande, nicht bloß Gegenstände aller Art zu ergreifen und an sich zu ziehen, sondern förmlich an sich zu saugen. Der übrige Theil des Kopfes zeichnet sich durch die kurzen, stumpf zugespitzten und aufrecht stehenden Ohren sowie die kleinen, fast schweineartigen, schiefen Augen aus; doch sieht man vom ganzen Kopfe nur sehr wenig, weil selbst der größte Theil der kurzbehaarten Schnauze von den auffallend langen, struppigen Haaren des Scheitels verdeckt wird. Dieser Haarpelz verhüllt auch den Schwanz und verlängert sich an manchen Theilen des Körpers, zumal am Halse und im Nacken, zu einer dichten, krausen und struppigen Mähne. In der Mitte des Rückens bilden sich gewöhnlich zwei sehr große, wulstige Büsche aus den hier sich verwirrenden Haaren und geben dem Bären das Aussehen, als ob er einen Höcker trüge. So gewinnt der ganze Vordertheil des Thieres ein höchst unförmliches Aussehen, und dieses wird durch den plumpen und schwerfälligen Leib und die kurzen und dicken Beine noch wesentlich erhöht. Sogar die Füße sind absonderlich, und die außerordentlich langen, scharfen und gekrümmten Krallen durchaus eigenthümlich, wirklich faulthierartig. Im Gebiß fallen die Schneidezähne in der Regel frühzeitig aus, und der Zwischenkiefer bekommt dann ein in der That in Verwirrung setzendes Aussehen. Die Färbung der groben Haare ist ein glänzendes Schwarz; die Schnauze sieht grau oder schmuzigweiß, ein fast herzförmig oder hufeisenförmig gestalteter Brustflecken dagegen weiß aus. Bisweilen haben auch die Zehen eine sehr lichte Färbung. Die Krallen sind in der Regel weißlich hornfarben, die Sohlen aber schwarz. Geringere Ausbildung der Mähne an Kopf und Schultern und die deßhalb hervortretenden, verhältnißmäßig großen Ohren sowie die dunkleren Krallen unterscheiden die Jungen von den Alten; auch ist bei ihnen gewöhnlich die Schnauze bis hinter die Augen gelblichbraun und die Hufeisenbinde auf der Brust gelblichweiß gefärbt.
Die Heimat des Lippenbären oder Aswail ist das Festland Südasiens, ebensowohl Bengalen wie die östlich und westlich daran grenzenden Gebirge, nebst der Insel Ceilon. Besonders häufig soll er in den Gebirgen von Tetan und Nepal gefunden werden. Als echtes Gebirgsthier steigt er nur zuweilen in die Ebenen herab, in den Gebirgen jedoch findet er sich überall ziemlich häufig und zwar nicht blos in einsamen Wäldern, sondern auch in der Nähe von bewohnten Orten; auf Ceilon dagegen verbirgt er sich, wie Tennent berichtet, in den dichtesten Wäldern der hügeligen und trockenen Landschaften an der nördlichen und südöstlichen Küste und wird ebenso selten in größeren Höhen wie in den feuchten Niederungen angetroffen. Im Gebiet von Karetschi auf Ceilon war er während einer länger anhaltenden Dürre so gemein, daß die Frauen ihre beliebten Bäder und Waschungen in den Flüssen gänzlich aufgeben mußten, weil ihnen nicht nur auf dem Lande, sondern auch im Wasser Bären in den Weg traten, – hier oft gegen ihren Willen; denn sie waren beim Trinken in den Strom gestürzt und konnten infolge ihres täppischen Wesens nicht wieder aufkommen. Während der heißesten Stunden des Tages liegt unser Bär in natürlichen oder selbst gegrabenen Höhlen. Wie es scheint, im höchsten Grade empfindlich gegen die Hitze, leidet er außerordentlich, wenn er genöthigt wird, über die kahlen, von der Sonne durchglühten Gebirgsflächen zu wandern. Englische Jäger fanden, daß die Sohlen eines Lippenbären, welchen sie durch ihre Verfolgung genöthigt hatten, bei Tage größere Strecken in den Mittagsstunden zu durchlaufen, verbrannt waren, und ich meinestheils glaube diese Angabe durchaus verbürgen zu können, weil ich ähnliches in Afrika bei Hunden bemerkt habe, welche nach längeren Jagden während der Mittagszeit wegen ihrer verbrannten Sohlen nicht mehr gehen konnten. Die Empfindlichkeit der Füße wird dem Aswail gewöhnlich verderblich; man erlegt oder bekämpft ihn leichter, wenn er vorher durch die Glut der Sonne mürbe gemacht worden ist, als wenn er frisch seinen Feinden entgegentritt. Letzteren kann er so gefährlich werden wie irgendwelcher Bär; denn so harmlos er auch im ganzen ist, wenn er unbelästigt seine Gebirgshalden und Abgründe durchzieht, soviel Furcht flößt er ein, wenn seine Wuth durch empfangene Wunden oder sonstwie erregt wurde.
Man sagt, daß die Nahrung des Lippenbären fast ausschließlich in Pflanzenstoffen und kleineren, zumal wirbellosen Thieren bestehe, und daß er sich nur beim größten Hunger an Wirbelthiere wage. Verschiedene Wurzeln und Früchte aller Art, Immennester, deren Waben mit Jungen oder deren Honig er gleich hochschätzt, Raupen, Schnecken und Ameisen bilden seine Nahrung, und seine langgebogenen Krallen leisten ihm bei Aufsuchung und bezüglich Ausgrabung verborgener Wurzeln oder aber bei Eröffnung der Ameisenhaufen sehr gute Dienste. Selbst die festen Baue der Termiten soll er mit Leichtigkeit zerstören können und dann unter der jüngeren Brut arge Verwüstungen anrichten. Der Bienen und Ameisen wegen steigt er auf die höchsten Bäume.

Lippenbär.
»Einer meiner Freunde«, sagt Tennent, »welcher eine Waldung in der Nähe von Jaffea durchzog, wurde durch unwilliges Gebrumm auf einen Aswail aufmerksam gemacht, welcher hoch oben auf einem Zweige saß und mit einer Brante die Waben eines Rothameisennestes zum Munde führte, während er die andere Tatze nothwendig gebrauchen mußte, um seine Lippen und Augenwimpern von den durch ihn höchlichst erzürnten Kerfen zu säubern. Die Veddahs in Bintenne, deren größtes Besitzthum ihre Honigstöcke ausmachen, leben in beständiger Furcht vor diesem Bären, weil er, angelockt durch den Geruch seiner Lieblingsspeise, keine Scheu mehr kennt und die erbärmlichen Wohnungen jener Bienenväter rücksichtslos überfällt. Den Anpflanzungen fügt er oft empfindlichen Schaden zu; namentlich in den Zuckerwaldungen betrachtet man ihn als einen sehr unlieben Gast. Allein unter Umständen wird er auch größeren Säugethieren oder Vögeln gefährlich und fällt selbst Herdenthiere und Menschen an. Man erzählt sich in Ostindien, daß er die Säugethiere und somit auch den Menschen auf das grausamste martere, bevor er sich zum Fressen anschicke. Er soll seine Beute fest mit seinen Armen und Krallen umfassen und ihr nun gemächlich und unter fortwährendem Saugen mit den Lippen Glied für Glied zermalmen. Gewöhnlich weicht er dem sich nahenden Menschen aus; allein seine Langsamkeit verhindert ihn nicht selten an der Flucht, und nun wird er, weniger aus Bösartigkeit als vielmehr aus Furcht und in der Absicht, sich selbst zu vertheidigen, der angreifende Theil. Seine Angriffe werden unter solchen Umständen so gefährlich, daß die Singalesen in ihm das furchtbarste Thier erblicken. Kein einziger dieser Leute wagt es, unbewaffnet durch den Wald zu gehen; wer kein Gewehr besitzt, bewaffnet sich wenigstens mit dem »Kadelly«, einer leichten Axt, mit welcher man dem Bären zum Zweikampfe gegenübertritt.« Der Aswail zielt seinerseits immer nach dem Gesichte seines Gegners und reißt diesem, wenn er ihn glücklich niederwarf, regelmäßig die Augen aus. Tennent versichert, viele Leute gesehen zu haben, deren Gesicht noch die Belege solcher Kämpfe zeigte: grell von der dunklen Haut abstechende, lichte Narben, welche besser als alle Erzählungen den Grimm des gereizten Thieres bekundeten.
Die Postläufer, welche nur bei Nacht reisen, sind den Anfällen der Lippenbären mehr als andere Indier ausgesetzt und tragen deshalb immer hellleuchtende Fackeln in den Händen, deren greller Schein die Raubthiere schreckt und veranlaßt, den Weg zu räumen. Demungeachtet theilen auch sie den Glauben der meisten Singalesen, daß gewisse Gedichte mehr als alles übrige vor den Angriffen der Aswails schützen, und tragen deshalb immer im Haare oder im Nacken Amulete, deren Wunderkraft eben in jenen Gedichten beruht. Leider beweisen die Bären den durch Talismane Gefeitem oft genug, daß die Wunderkraft nicht eben groß ist, und die biederen Singalesen nehmen auch gar keinen Anstand, trotz aller Schutzmittel, einem wüthenden Aswail das Feld zu lassen, falls ihnen dazu Zeit bleibt. Sie wissen sehr wohl, daß der gereizte Bär nichts weniger als der gutmüthige Bursche ist, welcher er scheint, daß der Zorn vielmehr sein ganzes Wesen verändert. Während er bei ruhigem Gange in der sonderbarsten Weise dahinwankt und seine Beine so täppisch als möglich kreuzweise übereinander setzt, fällt er bei Erregung in einen Trab, welcher immer noch schnell genug ist, um einen Fußgänger unter allen Umständen zu erreichen. Bei langsamer Bewegung trägt er den Kopf zur Erde gesenkt und krümmt dabei den Rücken, wodurch der Haarfilz scheinbar erst recht zum Höcker wird, bei schnellerem Laufe aber trabt er mit emporgehobenem Haupte dahin. Einem Feinde geht er manchmal auch auf den zwei Hinterfüßen entgegen.
Ueber seine Fortpflanzung berichtet man, daß die Bärin zwei Junge wirft und diese, solange sie noch nicht vollständig bewegungsfähig sind, auf dem Rücken trägt, wie ein Faulthier seine Nachkommenschaft. Letztere Angabe fordert zu den entschiedensten Zweifeln heraus.
In der Gefangenschaft hat man den Lippenbären öfters beobachten können, und zwar ebensowohl in Indien wie in Europa. In seinem Vaterlande wird seine Gelehrigkeit von Gauklern und Thierführern benutzt und er gleich unserem Meister Petz zu allerlei Kunststückchen abgerichtet. Die Leute ziehen mit ihm in derselben Weise durch das Land, wie früher unsere Bärenführer, und gewinnen durch ihn dürftig genug ihren Lebensunterhalt. In Europa hat man ihn hauptsächlich in England längere Zeit, einmal sogar durch neunzehn Jahre, am Leben erhalten können. Man füttert ihn mit Milch, Brod, Obst und Fleisch und hat in Erfahrung gebracht, daß er Brod und Obst dem übrigen Futter entschieden vorzuziehen scheint. Wenn er jung eingefangen wird, läßt er sich leicht zähmen, macht auch trotz seiner scheinbaren Plumpheit und Schwerfälligkeit Vergnügen. Er wälzt sich, wie ein schlafender Hund zusammengelegt, von einer Seite zur anderen, springt umher, schlägt Purzelbäume, richtet sich auf den Hinterfüßen auf und verzerrt, wenn ihm irgendwelche Nahrung geboten wird, sein Gesicht in der merkwürdigsten Weise. Dabei erscheint er verhältnismäßig gutmüthig, zuthunlich und ehrlich. Er macht niemals Miene, zu beißen, man kann ihm also, wenn man ihn einmal kennen lernte, in jeder Hinsicht vertrauen. Gegen andere seiner Art ist er womöglich noch anhänglicher als manche seiner Familienverwandten. Zwei Aswails, welche man im Thiergarten von London hielt, pflegten sich auf die zärtlichste Weise zu umarmen und sich gegenseitig dabei die Pfoten zu lecken. In recht guter Laune stießen sie auch ein bärenartiges Knurren aus; dagegen vernahm man rauhe und brüllende Töne, wenn man sie in Zorn gebracht hatte.
Ich habe den Lippenbär oft in Thierschaubuden und in Thiergärten gesehen. Die Gefangenen liegen gewöhnlich wie ein Hund auf dem Bauche und beschäftigen sich stundenlang mit Belecken ihrer Tatzen. Gegen Vorgänge außerhalb ihres Käfigs scheinen sie höchst gleichgültig zu sein. Ueberhaupt kamen mir die Thiere gutartig, aber auch sehr stumpfgeistig vor. Wenn man ihnen Nahrung hinhält, bilden sie ihre Lippenröhre und versuchen, das ihnen dargereichte mit den Lippen zu fassen, ungefähr in derselben Weise, in welcher die Wiederkäuer dies zu thun pflegen. Ihre Stimme schien mir eher ein widerliches Gewimmer als ein Gebrumm zu sein.
Der erlegte Aswail wird in seinem Vaterlande ungefähr in derselben Weise benutzt wie die im Norden lebenden Bären von den Europäern, Asiaten und Amerikanern. Das Fleisch wird sehr geschätzt und gilt auch in den Augen der Engländer für besonders wohlschmeckend. Noch höher achtet man das Fett, nachdem man es in derselben Weise geklärt und gereinigt hat, wie ich es bei dem Tiger beschrieb. Die Europäer verwenden es zum Einschmieren ihrer Waffen, die Indier halten es für ein untrügliches Mittel gegen gichtische Schmerzen aller Art.
Wenn nach der Ansicht einiger Naturforscher die ziemlich geringen Unterschiede in der Gestalt und Lebensweise der letzterwähnten Bären schon hinreichend erscheinen, um sie eigenen Gruppen einzureihen, erklärt es sich, daß man gegenwärtig den Eisbären ( Ursus maritimus, U. marinus, polaris und albus, Thalassarctos maritimus und polaris) ebenfalls als Vertreter einer selbständigen Sippe, der Meerbären, ( Thalassarctos) betrachtet. Die ersten Seefahrer, welche von ihm sprechen, glaubten in ihm freilich bloß eine Abart unseres Meister Petz zu entdecken, dessen Fell der kalte Norden mit seiner ihm eigenthümlichen Schneefarbe begabt habe; dieser Irrthum währte jedoch nicht lange, weil man sehr bald die wesentlichen Unterschiede wahrnahm, welche zwischen dem Land- und dem Eisbären bestehen. Letzterer unterscheidet sich von den bis jetzt genannten Arten der Familie durch den gestreckten Leib mit langem Halse und kurzen, starken und kräftigen Beinen, deren Füße weit länger und breiter sind als bei den anderen Bären, und deren Zehen starke Spannhäute fast bis zur Hälfte ihrer Länge miteinander verbinden. Er übertrifft selbst den Grislibär noch etwa an Größe; denn die durchschnittliche Länge des Männchens beträgt 2,5 Meter, nicht selten noch 15 bis 20 Centim. mehr, das Gewicht aber steigt von neun auf elf, ja sogar auf sechszehn Centner an. Roß wog ein Männchen, welches, nachdem es gegen dreißig Pfund Blut verloren hatte, noch immer ein Gewicht von 1131 ½ Pfund zeigte; Lyon, der Begleiter von Parry, berichtet von einem 2,65 Meter langen Eisbären, welcher sechszehn volle Centner wog.
Der Leib des Eisbären ist weit plumper, aber dennoch gestreckter, der Hals bedeutend dünner und länger als bei dem gemeinen Bären, der Kopf länglich, niedergedrückt und verhältnismäßig
schmal, das Hinterhaupt sehr verlängert, die Stirn platt, die hinten dicke Schnauze vorn spitz; die Ohren sind klein, kurz und sehr gerundet, die Nasenlöcher weiter geöffnet und die Rachenhöhle minder tief gespalten als bei dem Landbären. An den Beinen sitzen bloß mittellange, dicke und krumme Krallen; der Schwanz ist sehr kurz, dick und stumpf, kaum aus dem Pelze hervorragend. Die lange, zottige, reiche und dichte Behaarung besteht aus kurzer Wolle und aus schlichten, feinen glänzenden, weichen und fast wolligen Grannen, welche am Kopfe, Halse und Rücken am kürzesten, am Hintertheile, dem Bauche und an den Beinen am längsten sind und auch die Sohlen bekleiden. Auf den Lippen und über den Augen befinden sich wenige Borstenhaare; den Augenlidern fehlen die Wimpern. Mit Ausnahme eines dunkeln Ringes um die Augen, des nackten Nasenendes, der Lippenränder und der Krallen, trägt der Eisbär ein Schneekleid, welches bei den jungen Thieren von reinem Silberweiß ist, bei älteren aber, wie man annimmt, infolge der thranigen Nahrung einen gelblichen Anflug bekommt. Die Jahreszeit übt nicht den geringsten Einfluß auf die Färbung aus.

Eisbär ( Ursus maritimus) [1/20] natürl. Größe.
Der Eisbär bewohnt den höchsten Norden der Erde, den eigentlichen Eisgürtel des Pols, und findet sich bloß da, wo das Wasser einen großen Theil des Jahres hindurch oder beständig, wenigstens theilweise, zu Eis erstarrt. Wie weit er nach Norden hinaufgeht, konnte bisher noch nicht ermittelt werden; soweit der Mensch aber in jenen unwirtlichen Gegenden vordrang, hat er ihn als lebensfrischen Bewohner des lebensfeindlichen Erdgürtels gefunden, während er nach Süden hin bloß ausnahmsweise noch unter dem 55. Grade nördlicher Breite bemerkt worden ist. Er gehört keinem der drei nördlichen Erdtheile ausschließlich, sondern allen nördlichen Erdtheilen gemeinschaftlich an. Von keinem anderen Wesen beirrt oder gefährdet, der eifrigsten Kälte und den fürchterlichsten, uns schier undenkbaren Unwettern sorglos trotzend, streift er dort durch Land und Meere über die eisige Decke des Wassers oder durch die offenen Wogen, und im Nothfalle muß ihm der Schnee selbst zur Decke, zum Schutze, zum Lager werden. An der Ostküste von ganz Amerika, um die Bassins- und Hudsonsbay herum, in Grönland und Labrador ist er gemein und ebensowohl auf dem festen Lande wie auf dem Treibeise zu erblicken, oft sogar in Scharen vereinigt, welche durch ihre Anzahl an Schafherden erinnern. Scoresby berichtet, daß er einstmals an der Küste von Grönland hundert Eisbären beisammentraf, von denen zwanzig getödtet werden konnten. In Europa ist es die Insel Spitzbergen, welche seinen ständigen Heimatsort bildet; und er bewohnt dieses Eiland auch noch im höchsten Norden, da wo Nordpolforscher, wie Nordenskjiöld, weder Seehundslöcher noch Spuren anderer lebenden Thiere bemerken und sich nicht erklären konnten, welche Beute oder Nahrung überhaupt der Eisbär hier zu gewinnen vermöge. Auf den kristallenen Fahrzeugen, welche ihm das Meer selbst bietet, auf Eisschollen nämlich, kommt er nicht selten auch an der Nordküste Islands angeschwommen und würde, wäre der Norwegens Küste umflutende und das Eis dort schmelzende Golfstrom nicht, wohl auch öfters in Lappland oder Nordland sich zeigen. »Eigenthümlich«, sagt Nordenskjiöld, »ist die Sorgfalt, mit welcher der Eisbär sich seine Wege wählt. Immer sind es die bequemsten; er vermeidet stets große und tiefe Schneemassen, wenn der Schnee nicht fest genug ist, ihn zu tragen. Während unserer Reise im Norden von Spitzbergen hinderten uns oft dichte Eisnebel, die besten Wege zu suchen; wir erkannten jedoch bald, daß letztere durch die Bärenspuren angezeigt wurden, folgten diesen auf lange Strecken und standen uns gut dabei.« In Asien ist die Insel Novaja-Semlja sein Hauptsitz; aber auch aus Neusibirien, selbst auf dem Festlande bemerkt man ihn, obgleich bloß dann, wenn er auf Eisschollen angetrieben wird. In den endlosen Winternächten des Nordens schlägt er, wenn er bei Nebel und Schneegestöber seine Richtung verliert oder durch die Aufsuchung der Nahrung weiter, als er beabsichtigte, vom Meere ab, beispielsweise nach Sibirien geführt wird, auf dem mit Moos und Flechten überzogenenen und gefrorenen Boden sein Winterlager auf und kehrt erst, wenn der beginnende kurze Frühling von neuem ein regeres Leben ihm ermöglicht, zu seiner Heimat zurück. Dennoch sieht man ihn nur höchst selten auf dem festen Lande zwischen der Lena und der Mündung des Jenisei und noch seltener zwischen dem Ob und dem Weißen Meere, weil ihm die weit nach Norden auslaufenden Gebirge und Novaja Semlja weit bessere Aufenthaltsorte gewähren. In Amerika zeigt er sich da am häufigsten, wo der Mensch ihm am wenigsten nachstellt. Zwar ist es nur der kleine, unscheinbare, verachtete Eskimo, welcher dort als Gebieter der Erde auftritt, aber dieser ist noch immer mächtig genug, den gewaltigen Meeresbeherrscher zu verdrängen. Nach Aussagen der Eskimos, seiner hauptsächlichsten Feinde, erscheint er nur in höchst seltenen Fällen jenseits des Mackenzieflusses, verbreitet sich somit weit weniger im Westen Amerikas als im Osten. Nach Süden hinab geht er bloß unfreiwillig, wenn ihn große Eisschollen dahintragen. Man hat häufig Eisbären gesehen, welche auf diese Weise mitten im sonst eisfreien Wasser und weit von den Küsten entfernt dahintrieben. Obgleich er nun den größten Theil seines Lebens auf dem Eise zubringt und im Meere ebensosehr oder noch heimischer ist als auf dem Lande, sind ihm derartige Reisen doch wohl nicht lieb, führen auch, wenn sie ihn weit nach Süden und zu gebildeteren Menschen tragen, regelmäßig sein Verderben herbei.
Die Bewegungen des Eisbären sind im ganzen plump, aber ausdauernd im höchsten Grade. Dies zeigt sich zumal beim Schwimmen, in welchem der Eisbär seine Meisterschaft an den Tag legt. Die Geschwindigkeit, mit welcher er sich stundenlang gleichmäßig und ohne Beschwerde im
Wasser bewegt, schätzt Scoresby auf drei englische Meilen in der Stunde. Die große Masse seines Fettes kommt ihm vortrefflich zustatten, da sie das Eigengewicht seines Leibes so ziemlich dem des Wassers gleichstellt. Man sah ihn schon vierzig Meilen weit von jedem Lande entfernt im freien Wasser schwimmen und darf deshalb vermuthen, daß er Sunde oder Straßen von mehreren hundert Meilen ohne Gefahr zu übersetzen vermag. Ebenso ausgezeichnet, wie er sich auf der Oberfläche des Wassers bewegt, versteht er zu tauchen. Man hat beobachtet, daß er Lachse aus der See geholt hat und muß nach diesem seine Tauchfähigkeit allerdings im höchsten Grade bewundern. Daß er oft lange Zeit nur auf Fischnahrung angewiesen ist, unterliegt gar keinem Zweifel, und hieraus geht also hervor, daß er mit mindestens derselben Schnelligkeit schwimmt wie der behende, gewandte Fischotter. Auch auf dem Lande ist er keineswegs so unbehülflich, ungeschickt oder plump, als es den Anschein hat. Sein gewöhnlicher Gang ist zwar langsam und bedächtig, allein wenn er von Gefahr gedrängt oder von Hunger angetrieben wird, läuft er sprungweise sehr rasch und kommt jedem anderen Säugethiere, welches sich auf dem Eise bewegt, und somit auch dem Menschen, leicht zuvor. Dabei sind seine Sinne ausnehmend scharf, besonders das Gesicht und der Geruch. Wenn er über große Eisfelder geht, steigt er, nach Scoresby, auf die Eisblöcke und sieht nach Beute umher. Todte Walfische oder ein in das Feuer geworfenes Stück Speck wittert er auf unglaubliche Entfernungen.
Die Nahrung des Eisbären besteht aus fast allen Thieren, welche das Meer oder die armen Küsten seiner Heimat bieten. Seine furchtbare Stärke, welche die aller übrigen bärenartigen Raubthiere noch erheblich übertrifft, und die erwähnte Gewandtheit im Wasser machen es ihm ziemlich leicht, sich zu versorgen. Ohne Mühe bricht er mit seinen starken Krallen große Löcher durch das dicke Eis, um an Stellen, welche ihm sonst unzugänglich sein würden, in die Tiefe gelangen zu können; ohne Beschwerde trägt er ein großes und schweres Meerthier, unter Umständen meilenweit, mit sich fort. Seehunde verschiedener Art bilden sein bevorzugtes Jagdwild, und er ist schlau und geschickt genug, diese klugen und behenden Thiere zu erlangen. Wenn er eine Robbe von fern erblickt, senkt er sich still und geräuschlos ins Meer, schwimmt gegen den Wind ihr zu, nähert sich ihr mit der größten Stille und taucht plötzlich von unten nach dem Thiere empor, welches nun regelmäßig seine Beute wird. Die Robben pflegen in jenen eisigen Gegenden nahe an Löchern zu liegen, welche ihren Weg nach dem Wasser vermitteln. Diese Löcher findet der unter der Oberfläche des Meeres dahinschwimmende Eisbär mit außerordentlicher Sicherheit auf, und plötzlich erscheint der gefürchtete Kopf des entsetzlichsten Feindes der unbehülflichen Meereshunde so zu sagen in deren eigenem Hause oder in dem einzigen Fluchtgange, welcher sie möglicherweise retten könnte. »Ich habe ihn«, bemerkt Brown, »einen vollen halben Tag auf einen Seehund lauern sehen. Jedesmal, wenn er sich anschickte, die in ihrem Athemloche zeitweilig anftauchende Robbe mit der Brante zu tödten, entschlüpfte diese, und der Eisbär sah sich schließlich genöthigt, zu einer anderen Jagdweise überzugehen. Er verließ seinen Stand, warf sich auf einige Entfernung davon ins Wasser und schwamm, als der Seehund in seinem Loche halb im Schlafe lag, unter dem Eise gegen ihn hin, um ihm den Weg abzuschneiden. Auch dieser Versuch mißlang. Die Wuth des Räubers war grenzenlos. Ingrimmig brüllend und Schnee in die Luft werfend, ging er von dannen, sicherlich in der allerschlechtesten Laune.« Fische weiß der Eisbär zu erbeuten, indem er tauchend ihnen nachschwimmt oder sie in Spalten zwischen dem Eise treibt und hier herausfängt. Die Samojeden und Jakuten versichern, daß er auf dem Lande sogar junge Walrosse tödtet, welche er im Meere unbehelligt läßt. Landthiere überfällt er bloß dann, wenn ihm andere Nahrung mangelt; Renthiere, Eisfüchse und Vögel sind jedoch keineswegs vor ihm sicher. Osborne sah einer alten Bärenmutter zu, welche Steinblöcke umwälzte, um ihre Jungen mit Lemmingen zu versorgen, und Brown bemerkt, daß er auf den Brutplätzen der Eiderenten öfters binnen wenigen Stunden alle Eier auffrißt. An die Hausthiere wagt er sich selten. Man hat mehr als einmal bemerkt, daß er zwischen weidenden Rinderherden durchgegangen ist, ohne eines von den Thieren anzufallen. Dies geschieht freilich bloß so lange, als er gesättigt ist; denn, wenn ihn der Hunger plagt, greift er jedes Thier an, welches ihm begegnet. Abweichend von anderen Bären schlägt er nicht mit den Branten, sondern tödtet durch Bisse, spielt mit der Beute wie die Katze mit der Maus und frißt erst, wenn sie nicht mehr sich regt. Aas frißt er ebenso gern wie frisches Fleisch, soll auch nicht einmal den Leichnam eines anderen Eisbären verschmähen. In den Meeren, welche von Robbenschlägern und Walfischfängern besucht werden, bilden die todten Seehunde und Wale ein vorzügliches Nahrungsmittel für ihn, und man sieht ihn immer bald bei jedem Aase sich einfinden. Dabei hat man die Beobachtung gemacht, daß diejenigen Bären, welche viel Walfischfleisch fressen, das gelblichste Fell haben, jedenfalls infolge des reichlichen Thranes, den sie mit dem Fleische verzehren müssen. Einem Menschen geht er, so lange er nicht gereizt oder von wüthenden Hunger gepeinigt wird, in der Regel aus dem Wege; doch ist auf diese vermeintliche Ehrfurcht des Thieres vor dem Herrn der Erde nicht viel zu geben. »Ich habe«, versichert Brown, »viele Grönländer kennen gelernt, denen er, während sie auf Seehunde lauerten oder solche abstreiften, plötzlich seine rauhe Brante auf die Schulter legte. Die Leute retteten sich dadurch, daß sie sich todt stellten und dem Eisbären, während er zunächst noch sein erträumtes Opfer betrachtete, einen tödtlichen Schuß beibrachten.« Gereizt und zum Kampfe aufgefordert, hält er jederzeit Stand und kehrt sich gegen seinen Feind, ist dann auch unbedingt das furchtbarste aller Thiere, welches in jenen hohen Breiten dem Menschen entgegentreten kann. Nur seine tödtliche Verwundung kann den Verwegenen retten, welcher ihm den Fehdehandschuh hinzuwerfen wagte. Schüsse, welche nicht das Herz oder den Kopf treffen, reizen nur die Wuth des Riesen und vermehren somit die Gefahr. Eine Lanze weiß er geschickt, mit seinen Zähnen zu fassen und beißt sie entweder entzwei oder reißt sie dem Gegner aus der Hand. Man erzählt sich viele Unglücksfälle, welche durch ihn herbeigeführt worden sind, und gar mancher Walfischfänger hat die Tollkühnheit, einen Eisbären bekämpfen zu wollen, mit seinem Leben bezahlt. »Wenn man den Bären im Wasser antrifft«, sagt Scoresby, »kann man ihn gewöhnlich mit Vortheil angreifen; wenn er aber am Ufer oder auf beschneitem oder glattem Eise, wo er mit seinen breiten Tatzen noch einmal so schnell fortzukommen vermag als ein Mensch, sich befindet, kann er selten mit Sicherheit oder gutem Erfolge bekämpft werden. Bei weitem die meisten Unglücksfälle wurden durch die Unvorsichtigkeit solcher Angriffe herbeigeführt. Ein trauriger Vorfall ereignete sich mit einem Matrosen eines Schiffes, welches in der Davisstraße vom Eise eingeschlossen war. Wahrscheinlich durch den Geruch der Lebensmittel angelockt, kam ein dreister Bär endlich bis dicht an das Schiff heran. Die Leute waren gerade mit ihrer Mahlzeit beschäftigt, und selbst die Deckwachen nahmen daran Theil. Da bemerkte ein verwegener Bursche zufällig den Bären, bewaffnete sich rasch mit einer Stange und sprang in der Absicht auf das Eis hinaus, die Ehre davonzutragen, einen so übermüthigen Gast zu demüthigen. Aber der Bär achtete wenig auf das elende Gewehr, packte, wohl durch Hunger gereizt, seinen Gegner sofort mit den furchtbaren Zähnen im Rücken und trug ihn mit solcher Schnelligkeit davon, daß Raubthier und Matrose schon weit entfernt waren, als die Gefährten des Unglücklichen, von seinem Geschrei herbeigezogen, aufsprangen und sich umsahen.«
Ein anderes Beispiel eines unklugen Angriffs gegen einen Bären wurde Scoresby vom Kapitän Munroe mitgetheilt, dessen Schiff im grönländischen Meere vor Anker lag. Einer von der Mannschaft des Schiffes, welcher aus einer Rumflasche wohl gerade besonderen Muth sich geholt haben mochte, machte sich anheischig, einem in der Nähe des Schiffes erschienenen Bären nachzusetzen. Bloß mit einer Walfischlanze bewaffnet, ging er zu seiner abenteuerlichen Unternehmung aus. Ein beschwerlicher Weg von ungefähr einer halben Stunde über lockern Schnee und schroffe Eisblöcke brachte ihn in unmittelbare Nähe seines Feindes, welcher, zu seinem Erstaunen, ihn unerschrocken anblickte und zum Kampfe herauszufordern schien. Sein Muth hatte unterdessen sehr abgenommen, theils weil der Geist des Rums unterwegs verdunstet war, theils weil der Bär nicht nur keine Furcht verrieth, sondern selbst eine drohende Miene annahm. Unser Matrose
hielt daher an und schwang seine Lanze ein paarmal hin und her, so daß man nicht recht wußte, ob er angreifen oder sich vertheidigen wollte. Der Bär stand auch still. Vergebens suchte der Abenteurer sich ein Herz zu fassen, um den Angriff zu beginnen: sein Gegner war zu furchtbar und sein Ansehen zu schrecklich; vergebens fing er an, ihn durch Schreien und mit der Lanze zu bedrohen: der Feind verstand dies entweder nicht oder verachtete solche leere Drohungen und blieb hartnäckig auf seinem Platze. Schon fingen die Knie des armen Teufels an zu wanken, und die Lanze zitterte in seiner Hand; aber die Furcht, von seinen Kameraden ausgelacht zu werden, hatte noch einigen Einfluß auf ihn: er wagte nicht, zurückzugehen. Der Eisbär hingegen begann mit der verwegensten Dreistigkeit vorzurücken! Seine Annäherung und sein ungeschlachtes Wesen löschten den letzten noch glimmenden Funken von Muth bei dem Matrosen aus; er wandte sich um und floh. Der Bär holte den Flüchtling bald ein. Dieser warf die Lanze, sein einziges Vertheidigungsmittel, weil sie ihn im Laufe beschwerte, von sich und lief weiter. Glücklicherweise zog die Waffe die Aufmerksamkeit des Bären auf sich; er stutzte, betastete sie mit seinen Pfoten, biß hinein und setzte erst hierauf seine Verfolgung fort. Schon war er dem keuchenden Schiffer auf den Fersen, als dieser in der Hoffnung einer ähnlichen Wirkung, wie die Lanze sie gehabt hatte, einen Handschuh fallen ließ. Die List gelang, und während der Bär wieder stehen blieb, um diesen zu untersuchen, gewann der Flüchtling einen guten Vorsprung. Der Bär setzte ihm von neuem mit der drohendsten Beharrlichkeit nach, obgleich er noch einmal durch den anderen Handschuh und zuletzt durch den Hut aufgehalten wurde, würde ihn auch ohne Zweifel zu seinem Schlachtopfer gemacht haben, wenn nicht die anderen Matrosen, als sie sahen, daß die Sache eine so ernste Wendung genommen hatte, zu seiner Rettung herbeigeeilt wären. Die kleine Phalanx öffnete dem Freunde einen Durchgang und schloß sich dann wieder, um den verwegenen Feind zu empfangen. Dieser fand jedoch unter so veränderten Umständen nicht für gut, den Angriff zu unternehmen, stand still, schien einen Augenblick zu überlegen, was zu thun wäre, und trat dann einen ehrenvollen Rückzug an.«
Es ist höchst wahrscheinlich, daß die meisten Eisbären keinen Winterschlaf halten. Ein geringerer oder größerer Kältegrad ist ihnen gleichgültig; es handelt sich für sie im Winter bloß darum, ob das Wasser dort, wo sie sich befinden, offen bleibt oder nicht. Einige Beobachter sagen, daß die alten Männchen und jüngeren oder nichtträchtigen Weibchen niemals Winterschlaf halten, sondern beständig umherschweifen. Soviel ist sicher, daß die Eskimos den ganzen Winter hindurch auf Eisbären jagen. Allerdings leben die Thiere während des Winters nur in der See, meistens auf dem Treibeise, wo sie stets hinlängliche Löcher finden, um jederzeit in die Tiefe hinabtauchen und Robben und Fischen nachstellen zu können. Die trächtigen Bärinnen dagegen ziehen sich gerade im Winter zurück und bringen in den kältesten Monaten ihre Jungen zur Welt. Bald nach der Paarung, welche in den Juli fallen soll, bereitet sich die Bärin ein Lager unter Felsen oder überhängenden Eisblöcken oder gräbt sich wohl auch eine seichte Höhlung in dem gefrorenen Schnee aus, thaut durch ihre Körperwärme dieses Lager ringsum auf, bildet durch den warmen Hauch eine Art Stollen nach oben und läßt sich hier einschneien. Bei der Menge von Schnee, welche in jenen Breiten fällt, währt es nicht lange, bis ihre Winterwohnung eine dicke und ziemlich warme Decke erhalten hat. Ehe sie das Lager bezog, hatte sie sich eine tüchtige Menge von Fett gesammelt, und von ihm zehrt sie während des ganzen Winters; denn sie verläßt ihr Lager nicht eher wieder, als bis die Frühlingssonne bereits ziemlich hochsteht. Mittlerweile hat sie ihre Jungen geworfen. Man weiß, daß dieselben nach sechs bis sieben Monaten ausgetragen sind, und daß ihre Anzahl zwischen eins und drei schwankt; genauere Beobachtungen sind nicht gemacht worden. Nach Aussage der nördlichen Völkerschaften sollen die jungen Eisbären kaum größer oder nicht einmal so groß als Kaninchen sein, Ende März oder anfangs April aber bereits die Größe kleiner Pudel erlangt haben. Weit eher als die Kinder des Landbären begleiten sie ihre Alte auf deren Zügen. Sie werden von ihr auf das sorgfältigste und zärtlichste gepflegt, genährt und geschützt. Die Mutter theilt auch dann noch, wenn sie schon halb oder fast ganz erwachsen sind, alle Gefahren mit ihnen und wird dem Menschen, solange sie Junge bei sich hat, doppelt furchtbar. Schon in der ersten Zeit der Jugend lehrt sie ihnen das Gewerbe betreiben, nämlich schwimmen und Fischen nachstellen. Die kleinen, niedlichen Gesellen begreifen das eine wie das andere bald, machen sich die Sache aber so bequem als möglich und ruhen z. B. auch noch dann, wenn sie bereits ziemlich groß geworden sind, bei Ermüdung behaglich auf dem Rücken ihrer Mutter aus.
Walfisch- und Grönlandsfahrer haben uns rührende Geschichten von der Aufopferung und Liebe der Eisbärenmutter mitgetheilt. »Eine Bärin«, erzählt Scoresby, »welche zwei Junge bei sich hatte, wurde von einigen bewaffneten Matrosen auf einem Eisfelde verfolgt. Anfangs schien sie die Jungen dadurch zu größerer Eile anzureizen, daß sie voranlief und sich immer umsah, auch durch eigenthümliche Geberden und einen besonderen, ängstlichen Ton der Stimme die Gefahr ihnen mitzutheilen suchte; als sie aber sah, daß ihre Verfolger ihr zu nahe kamen, mühte sie sich, jene vorwärts zu treiben, zu schieben und zu stoßen, entkam auch wirklich glücklich mit ihnen.« Eine andere Bärin, welche von Kane's Leuten und deren Hunden aufgefunden wurde, schob ihr Junges immer etwas weiter, indem sie es mit dem Kopfe zwischen Hals und Brust klemmte oder von oben mit den Zähnen packte und fortschleppte. Abwechselnd hiermit trieb sie die sie verfolgenden Hunde zurück. Als sie erlegt worden war, trat das Junge auf ihre Leiche und kämpfte gegen die Hunde, bis es, durch einen Schuß in den Kopf getroffen, von seinem Standpunkte herabfiel und nach kurzem Todeskampfe verendete.
Als das Schiff Carcasse im Eise stecken geblieben war, zeigten sich einstmals drei Eisbären ganz in seiner Nähe, jedenfalls angelockt durch den Geruch des Walroßfleisches, welches die Matrosen gerade auf dem Eise ausbrateten. Es war eine Bärin mit ihren zwei Jungen, welche ihr an Größe fast gleichkamen. Sie stürzten sich auf das Feuer zu, zogen ein tüchtiges Stück Fleisch heraus und verschlangen es. Die Schiffsmannschaft warf ihnen nun Stücke Fleisch hin; die Mutter nahm sie und trug sie ihren Jungen zu, sich selbst kaum bedenkend. Als sie eben das letzte Fleischstück wegholte, schossen die Matrosen beide Jungen nieder und verwundeten gleichzeitig auch die Mutter, jedoch nicht tödtlich. Sie konnte sich kaum noch fortbewegen, kroch aber dennoch sogleich nach ihren Jungen hin, legte ihnen neue und wieder neue Fleischstücke vor, und als sie sah, daß sie nicht zulangten, streckte sie erst ihre Tatzen nach dem einen, dann nach dem anderen aus, suchte sie emporzurichten und erhob, als sie bemerkte, daß alle ihre Mühe vergeblich war, ein klägliches Geheul. Hierauf ging sie eine Strecke fort, sah sich nach ihren Kindern um und heulte noch lauter als früher. Da ihr nun die Kinder noch nicht folgten, kehrte sie um, beschnupperte und betrachtete sie wieder und heulte von neuem. So ging und kam sie mehrere Male und wandte alle mütterliche Zärtlichkeit auf, um die Jungen zu sich zu locken. Endlich bemerkte sie, daß ihre Lieblinge todt und kalt waren; da wandte sie ihren Kopf nach dem Schiffe zu und brummte voll Wuth und Verzweiflung. Die Matrosen antworteten mit Flintenschüssen. Sie sank zu ihren Jungen nieder und starb, indem sie deren Wunden leckte.«
Die Jagd der Eisbären wird mit Leidenschaft betrieben. Eskimos, Jakuten und Samojeden bauen sich besondere Holzhütten, in denen sie den Bären auflauern, oder bedienen sich, wie Seemann berichtet, folgender List. Sie biegen ein vier Zoll breites, zwei Fuß langes Stück Fischbein kreisförmig zusammen, umwickeln es mit Seehundsfett und lassen dieses gefrieren. Dann suchen sie den Bären auf, necken ihn durch einen Pfeilschuß, werfen den Fettklumpen hin und flüchten. Der Bär beriecht den Ball, findet, daß er verzehrt werden kann, verschluckt ihn und holt sich damit seinen Tod; denn in dem warmen Magen thaut das Fett auf, das Fischbein schnellt auseinander und zerreißt ihm die Eingeweide. Daß derartige Ballen von den Eisbären wirklich gefressen werden, unterliegt kaum einem Zweifel: Kane erzählt, daß die Thiere in seinen Vorrathshäusern alles denkbare fraßen, außer dem dort befindlichen Fleisch und Brod auch Kaffee, Segel und die amerikanische Flagge, daß sie überhaupt nur die ganz eisernen Fässer nicht berührten. Nordenskjiölds Leute jagten anfangs meist vergeblich auf die Eisbären, deren Fleisch und Speck für die
ganze Gesellschaft von höchster Wichtigkeit war. Sie schlichen ohne besondere Vorsicht den Bären nach, welche sich zeigten, und erzielten damit nur, daß die wachsamen Thiere zurückwichen. Infolge dieser Erfahrungen änderten sie die Jagdweise. »Sobald ein Bär in Sicht kam und wir Zeit hatten, uns ihm zu widmen«, schildert Nordenskjiöld, »erhielten sämmtliche Leute Befehl, sich im Zelte oder hinter dem Schlitten zu verstecken. Nun kam der Bär neugierig und voll Eifers, zu sehen, welche Gegenstände – vielleicht Seehunde! – auf dem Eise sich bewegten, herangetrabt, und wenn er so nahe war, daß er die fremdartigen Gegenstände beschnuppern konnte, empfing er die wohlgezielte Kugel.«
Der Eisbär vertheidigt sich mit ebensoviel Muth als Kraft besonders im Wasser, obgleich dieses noch das beste Jagdgebiet für den Menschen ist. Man kennt unzählige Beispiele, daß die Bärenjagden unglücklich ausfielen, und mehr als einmal hat ein verwundeter und dadurch gereizter Bär einen seiner Angreifer ruhig aus der Mitte der anderen geholt und mit sich fortgeschleppt. So wurde ein Schiffskapitän, welcher einen großen schwimmenden Eisbären mit seinem stark bemannten Boote verfolgte, von dem bereits schwer verwundeten Thiere in demselben Augenblicke über Bord gerissen, als er die ihm zum dritten Male tief in die Brust gestoßene Lanze wieder herausziehen wollte, und nur durch das gleichzeitige Einschreiten der gesammten Mannschaft gelang es, den Gefährdeten zu retten. Gewöhnlich läßt sich ein verwundeter Bär nicht so leicht verscheuchen, geht vielmehr mit einer Entschlossenheit ohne gleichen auf seine Feinde los, in der festen Absicht, an ihnen möglichst empfindlich sich zu rächen. Die Mannschaft eines Walfischfängers schoß von ihrem Boote aus auf einen Eisbären, welcher sich eben auf einer schwimmenden Eisscholle befand. Eine der Kugeln traf und versetzte ihn in die rasendste Wuth. Eilig lief er gegen das Boot zu, stürzte sich ins Wasser, schwamm auf das Fahrzeug hin und wollte dort über Bord klettern. Man hieb ihm mit einer Axt eine Brante ab und suchte sich zu retten, indem man gegen das Schiff ruderte. Der Bär ließ sich nicht vertreiben, sondern verfolgte seine Angreifer bis an das Schiff, alles Schreiens und Lärmens der Matrosen ungeachtet, erkletterte trotz seiner verstümmelten Glieder noch das Deck und wurde erst hier von der gesammten Mannschaft getödtet. Hunde scheint der Eisbär mehr als Menschen zu fürchten; Feuer, Rauch und laute Klänge sind ihm ein Greuel: namentlich Trompetenschall soll er gar nicht vertragen können und sich durch ein so einfaches Mittel leicht in die Flucht schrecken lassen.
Gestellte Fallen weiß der Eisbär mit Klugheit und Geschick zu vermeiden. »Der Kapitän eines Walfischfängers«, erzählt Scoresby, »welcher sich gern einen Bären verschaffen wollte, ohne die Haut desselben zu verletzen, machte den Versuch, ihn in einer Schlinge zu fangen, welche er mit Schnee bedeckt und vermittels eines Stück Walfischspeckes geködert hatte. Ein Bär wurde durch den Geruch des angebrannten Fettes bald herbeigezogen, sah die Lockspeise, ging hinzu und faßte sie mit dem Maule, bemerkte aber, daß sein Fuß in die ihm gelegte Schlinge gerathen war. Deshalb warf er das Fleisch wieder ruhig hin, streifte mit dem anderen Fuße bedächtig die Schlinge ab und ging langsam mit seiner Beute davon. Sobald er das erste Stückchen in Ruhe verzehrt hatte, kam er wieder. Man hatte inzwischen die Schlinge durch ein anderes Stück Walfischfett geködert; der Bär war aber vorsichtig geworden, schob den bedenklichen Strick sorgfältig bei Seite und schleppte den Köder zum zweiten Male weg. Jetzt legte man die Schlinge tiefer und die Lockspeise in eine Höhlung ganz innerhalb der Schlinge. Der Bär ging wieder hin, beroch erst den Platz ringsumher, kratzte den Schnee mit seinen Tatzen weg, schob den Strick zum dritten Male auf die Seite und bemächtigte sich nochmals der dargebotenen Mahlzeit, ohne sich in Verlegenheit zu setzen.«
Auch junge Eisbären zeigen ähnliche Ueberlegung und versuchen es auf alle mögliche Weise, sich aus den Banden zu befreien, mit denen der Mensch sie umstrickte. Der eben genannte Berichterstatter erzählt auch hiervon ein Beispiel. »Im Juni 1812 kam eine Bärin mit zwei Jungen in die Nähe des Schiffes, welches ich befehligte, und wurde erlegt. Die Jungen machten keinen Versuch zu entfliehen, und konnten ohne besondere Mühe lebendig gefangen werden. Sie fühlten sich anfangs offenbar sehr unglücklich, schienen nach und nach aber doch mit ihrem Schicksale sich auszusöhnen und wurden bald einigermaßen zahm. Deshalb konnte man ihnen zuweilen gestatten, auf dem Verdeck umherzugehen. Wenige Tage nach ihrer Gefangennahme fesselte man den einen mit einem Stricke, den man ihm um den Hals gelegt hatte, und warf ihn dann über Bord, um ihm ein Bad im Meere zu gönnen. Das Thier schwamm augenblicklich nach einer nahen Eisscholle hin, kletterte an ihr hinauf und wollte entfliehen. Da bemerkte es, daß es von dem Stricke zurückgehalten wurde, und versuchte sofort, von der lästigen Bande sich zu befreien. Nahe am Rande des Eises fand sich eine lange, aber nur schmale und kaum metertiefe Spalte. Zu ihr ging der Bär, und indem er über die Oeffnung hinüberschritt, fiel ein Theil des Strickes in die Spalte hinein. Darauf stellte er sich quer hinüber, hing sich an seinen Hinterfüßen, welche er zu beiden Seiten auf den Rand der Spalte legte, auf, senkte seinen Kopf und den größten Theil des Körpers in die Schlucht und suchte dann mit beiden Vorderpfoten den Strick über den Kopf zu schieben. Er bemerkte, daß es ihm auf diese Weise nicht gelingen wollte, frei zu werden, und sann deshalb auf ein anderes Mittel. Plötzlich begann er mit größter Heftigkeit zu laufen, jedenfalls, in der Absicht das Seil zu zerreißen. Dies versuchte er zu wiederholten Malen, indem er jedesmal einige Schritte zurückging und einen neuen Anlauf nahm. Leider glückte ihm auch dieser Befreiungsversuch nicht. Verdrießlich brummend legte er sich auf das Eis nieder.«
Ganz jung eingefangene Eisbären lassen sich zähmen und bis zu einem gewissen Grade abrichten. Sie erlauben ihrem Herrn, sie in ihrem Käfige zu besuchen, balgen sich auch wohl mit ihm herum. Dies sind gewöhnlich Eisbären, welche von den Eskimos im Frühjahre sammt ihrer Mutter aus dem Schneelager ausgegraben und in ihrer zartesten Jugend an die Gesellschaft des Menschen gewöhnt worden sind. Die Gefangenschaft behagt ihnen nicht. Schon in ihrem Vaterlande fühlen sie sich auch in frühester Jugend unter Dach und Fach nicht wohl, und man kann ihnen keine größere Freude machen, als wenn man ihnen erlaubt, sich im Schnee herumzuwälzen und auf dem Eise sich abzukühlen. In größeren Räumen mit tiefen und weiten Wasserbecken, wie solche jetzt in Thiergärten für ihn hergerichtet werden, befindet er sich ziemlich wohl und spielt stundenlang im Wasser mit seinen Mitgefangenen oder auch mit Klötzen, Kugeln und dergleichen. Hinsichtlich der Nahrung hat man keine Noth mit ihm. In der Jugend gibt man ihm Milch und Brod und im Alter Fleisch, Fische oder auch Brod allein, von welchem drei Kilogramm täglich vollkommen hinreichen, um ihn zu erhalten. Er schläft bei uns in der Nacht und ist bei Tage munter, ruht jedoch ab und zu, ausgestreckt auf dem Bauche liegend, oder wie ein Hund auf dem Hintern sitzend. Mit zunehmendem Alter wird er reizbar und heftig. Gegen andere seiner Art zeigt er sich, sobald das Fressen in Frage kommt, unverträglich und übellaunig, obwohl nur selten ein wirklicher Streit zwischen zwei gleichstarken Eisbären ausbricht, der gegenseitige Zorn vielmehr durch wüthendes Anbrüllen bekundet wird. Bei sehr guter Pflege ist es möglich, Eisbären mehrere Jahre lang zu erhalten: man kennt ein Beispiel, daß ein jung eingefangener und im mittleren Europa aufgezogener zweiundzwanzig Jahre in der Gefangenschaft gelebt hat. Zur Fortpflanzung im Käfige schreitet er seltener als der Landbär und wohl auch nur dann, wenn er alle Bequemlichkeiten zur Verfügung hat. Im Laufe von zwanzig Jahren haben die Eisbären des Londoner Thiergartens dreimal Junge gebracht. An Krankheiten leiden die Gefangenen wenig, verlieren jedoch oft ihr Augenlicht, wahrscheinlich aus Mangel an hinreichendem Wasser zum Baden und Reinigen ihres Leibes.
Der getödtete Eisbär wird vielfach benutzt und ist für die nordischen Völker eines ihrer gewinnbringendsten Jagdthiere. Man verwerthet ebensowohl das Fell wie das Fett und das Fleisch. Ersteres liefert herrliche Decken zu Lagerstätten, außerdem warme Stiefeln und Handschuhe, ja selbst Sohlenleder. In den kleinen Holzkirchen Islands sieht man vor den Altären gewöhnlich Eisbärenfelle liegen, welche die Fischer ihren Geistlichen verehrten, um sie bei Amtshandlungen im Winter etwas vor der Kälte zu schützen. Fleisch und Speck werden von allen Bewohnern des hohen Nordens gern gegessen. Auch die Walfischfahrer genießen es, nachdem sie es vom Fett gereinigt haben, und finden es nicht unangenehm, namentlich wenn es vorher geräuchert worden ist. Doch behaupten alle Walfischfahrer einstimmig, daß der Genuß des Eisbärenfleisches im Anfange Unwohlsein errege; zumal die Leber des Thieres soll sehr schädlich wirken. »Wenn Schiffer«, sagt Scoresby, »unvorsichtigerweise von der Leber des Eisbären gegessen haben, sind sie fast immer krank geworden und zuweilen gar gestorben; bei anderen hat der Genuß die Wirkung gehabt, daß sich die Haut von ihrem Körper schälte.« Auch Kane bestätigt diese Angabe. Er ließ sich die Leber eines frisch getödteten Eisbären zubereiten, obgleich er gehört hatte, daß sie giftig sei, und wurde, nachdem er kaum die Speise genossen hatte, ernstlich krank. Unter den Fischern besteht der Glaube, daß man durch den Genuß des Eisbärenfleisches, obgleich es sonst nicht schadet, wenigstens frühzeitig ergraue. Die Eskimos haben fast dieselben Ansichten, wissen auch, daß die Leber schädlich ist, und füttern deshalb bloß ihre Hunde damit. Das Fett benutzt man zum Brennen; es hat vor dem Walfischthrane den großen Vorzug, daß es keinen üblen Geruch verbreitet. Aus dem Fette der Sohlen bereiten die Nordländer sehr geschätzte Heilmittel, aus den Sehnen verfertigen sie Zwirn und Bindfaden.
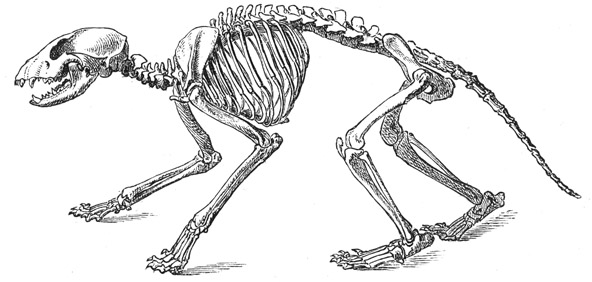
Geripp des Waschbären. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
In der zweiten Unterfamilie vereinigen wir die Kleinbären ( Subursina oder Procyonina), mittelgroße Glieder der Familie, mit mehr oder weniger gedrungenem Leibe, mittellangen Gliedmaßen, geraden Zehen, nicht einziehbaren Nägeln und langem Schwanze. Das Gebiß besteht ebenfalls aus 40 Zähnen; von den sechs Backenzähnen jeder Reihe sind vier als Lückzähne zu bezeichnen.
Die Sippe der Waschbären ( Procyon) kennzeichnet sich durch folgende Merkmale. Der Leib ist gedrungen gebaut, der Kopf hinten sehr verbreitert, die Schnauze kurz; die großen Augen liegen nah aneinander, die großen abgerundeten Ohren ganz an den Kopfseiten; die Beine sind verhältnismäßig hoch und dünn; die nacktsohligen Füße haben mittellange, schlanke Zehen und mäßig starke, seitlich zusammengedrückte Nägel; der Schwanz ist lang, der Pelz reich-, lang- und schlichthaarig. Das Gebiß zeigt am oberen Fleischzahne innen einen breiten, kegelförmigen Ansatz, während der untere Fleischzahn dick, länglich und einem Höckerzahne ähnlich ist; die oberen quergestellten Höckerzähne sind nach innen etwas verschmälert, die unteren verhältnismäßig lang. Man kennt nur zwei, in Gestalt, Färbung und Wesen sehr übereinstimmende Arten dieser Gruppe.
Der Waschbär oder Schupp ( Procyon Lotor, Ursus und Meles Lotor, Lotor vulgaris, Procyon gularis, brachyurus und obscurus etc.) erreicht bei 65 Centim. Leibes- und 25 Centim. Schwanz- oder 90 Centim. bis 1 Meter Gesammtlänge 30 bis 35 Centim. Höhe am Widerrist. Der Pelz ist gelblichgrau, schwarz gemischt, weil die Grannen am Grunde braun, in der Mitte bräunlichgelb und darüber schwarz gefärbt sind, somit eine höchst eigenthümliche Gesammtfärbung zu Stande bringen. Die Vorderarme, ein Busch in der Ohrengegend, welcher hinter dem Ohre von einem braunschwarzen Flecken begrenzt wird, die Schnauzenseiten und das Kinn haben eintönig gelblich weißgraue Färbung. Von der Stirne bis zur Nasenspitze und um das Auge ziehen sich schwarzbraune Streifen; über die Augen weg zu den Schläfen verläuft eine gelblichweiße Binde. Die Vorder- und Hinterpfoten sind bräunlich gelbgrau, die langen Haare des Unterschenkels und der Unterarme tief dunkelbraun. Der graugelbe Schwanz ist sechsmal schwarzbraun geringelt und endet in eine schwarzbraune Spitze. Keine einzige dieser Farben sticht besonders von den anderen ab, und so wird die Gesammtfärbung, schon aus einer geringen Entfernung betrachtet, zu einem schwer zu bestimmenden und bezeichnenden Grau, welches sich der Rindenfärbung ebenso vortrefflich anschließt wie dem mit frischem oder trockenem Grase bewachsenen Boden. Ausartungen des Waschbären sind selten, kommen jedoch vor. So steht im Britischen Museum ein Weißling, dessen Behaarung mit dem blendenden Felle des Hermelins wetteifern kann.
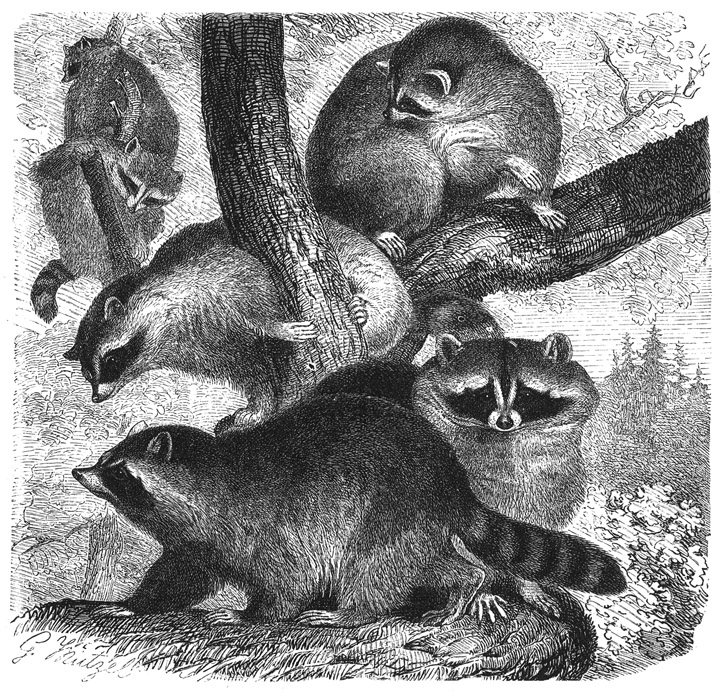
Waschbär ( Procyon Lotor). [1/8] natürl. Größe.
Die Heimat des Waschbären ist Nordamerika und zwar der Süden des Landes ebensowohl wie der Norden, wo er wenigstens in den südlichen Pelzgegenden vorkommt. Heutigen Tages ist er in den bewohnteren Gegenden infolge der unaufhörlichen Nachstellungen, die er erleiden mußte, weit seltener geworden, als er es früher war; doch konnte man ihn immerhin auch hier nicht gänzlich vertreiben. Im Innern des Landes, namentlich in den Waldgegenden, findet er sich noch in Menge. Wälder mit Flüssen, Seen und Bächen sind seine Lieblingsplätze; hier treibt er so ziemlich ungestört sein Wesen bei Tage und bei Nacht. In der Regel pflegt er seine Jagden erst mit Einbruch der Dämmerung zu beginnen und den hellen Sonnentag in hohlen Bäumen oder auf dicken, belaubten Baumästen zu verschlafen; wo er aber ganz ungestört ist, hat er eigentlich keine besondere Zeit zur Jagd, sondern lustwandelt ebensowohl bei Tage wie bei Nacht durch sein weites Gebiet.
Er ist ein munterer, schmucker Bursche, welcher durch große Regsamkeit und Beweglichkeit sehr erfreut. Bei gleichgültigem Dahinschlendern senkt er den Kopf, wölbt den Rücken, läßt den Schwanz hängen und schleicht schiefen Ganges ziemlich langsam seines Weges fort; sowie er jedoch eine der Theilnahme würdige Entdeckung macht, z. B. eine Fährte auffindet oder ein unbesorgtes Thierchen in großer Nähe spielen sieht, verändert sich sein Wesen gänzlich. Das gestruppte Fell glättet sich, die breiten Lauscher werden gespitzt, er stellt sich spähend auf die Hinterbeine und hüpft und läuft nun leicht und behend weiter oder klettert mit einer Geschicklichkeit, welche man schwerlich vermuthet hätte, nicht bloß an schiefen und senkrechten Stämmen hinan, sondern auch auf wagerechten Zweigen fort und zwar von oben oder unten. Oft sieht man ihn wie ein Faulthier oder einen Affen mit gänzlich nach unten hängendem Leibe rasch an den wagerechten Zweigen fortlaufen, oft und mit unfehlbarer Sicherheit Sprünge von einem Aste zum anderen ausführen, welche eine nicht gewöhnliche Meisterschaft im Klettern bekunden. Auch auf der Erde ist er vollkommen heimisch und weiß sich durch satzweise Sprünge, bei denen er auf alle vier Pfoten zugleich tritt, schnell genug fortzubewegen. In seinem geistigen Wesen hat er etwas affenartiges. Er ist heiter, munter, neugierig, neckisch und zu lustigen Streichen aller Art geneigt, aber auch muthig, wenn es sein muß, und beim Beschleichen seiner Beute listig wie der Fuchs. Mit seines gleichen verträgt er sich ausgezeichnet und spielt selbst im Alter noch stundenlang mit anderen Gesinnungsgenossen oder, in der Gefangenschaft z. B., mit jedem Thiere, welches sich überhaupt zum Spielen mit ihm einläßt.
Der Schupp frißt alles, was genießbar ist, scheint aber ein Leckermaul zu sein, welches sich, wenn es nur angeht, immer die besten Bissen auszusuchen weiß. Obst aller Art, Kastanien, wilde Trauben, Mais, so lange die Kolben noch weich sind, liefern ihm schätzbare Nahrungsmittel; aber er stellt auch den Vögeln und ihren Nestern nach, weiß listig ein Hühnchen oder eine Taube zu beschleichen, versteht es meisterhaft, selbst das verborgenste Nest aufzuspüren, und labt sich dann an den Eiern, welche er erstaunlich geschickt zu öffnen und zu leeren weiß, ohne daß irgend etwas von dem Inhalte verloren geht. Nicht selten kommt er bloß deshalb in die Gärten oder in die Wohnungen herein, um Hühner zu rauben und Hühnernester zu plündern, steht auch aus diesem Grunde bei den Farmern nicht eben in gutem Ansehen. Selbst die Gewässer müssen ihm Tribut zollen. Gewandt fängt er Fische, Krebse und Schalthiere und wagt sich bei der Ebbe, solchem Schmause zu Liebe, oft weit in das Meer hinaus. Die dicken Larven mancher Käfer scheinen wahre Leckerbissen für ihn zu sein, die Heuschrecken fängt er mit großer Geschicklichkeit, und den maikäferartigen Kerfen zu Gefallen klettert er bis in die höchsten Baumkronen hinaus. Er hat die Eigenthümlichkeit, seine Nahrung vorher in das Wasser zu tauchen und hier zwischen seinen Vorderpfoten zu reiben, sie gleichsam zu waschen. Das thut er jedoch nur dann, wenn er nicht besonders hungrig ist; in letzterem Falle lassen ihm die Anforderungen des Magens wahrscheinlich keine Zeit zu der ihm sonst so lieben, spielenden Beschäftigung, welcher er seinen Namen verdankt. Uebrigens geht er bloß bei gutem Wetter auf Nahrungserwerb aus; wenn es stürmt, regnet oder schneit, liegt er oft mehrere Tage lang ruhig in seinem geschützten Lager, ohne das Geringste zu verzehren.
Im Mai wirft das Weibchen seine vier bis sechs sehr kleinen Jungen auf ein ziemlich sorgfältig hergerichtetes Lager in einem hohlen Baume; ausführlicheres über das Jugendleben des freigeborenen Waschbären scheint nicht bekannt zu sein. Im Berliner Thiergarten brachte eine Waschbärin im Frühjahre 1811 fünf Junge zur Welt. Zum Wochenbett hatte sie ein wagerechtes Bret erwählt, ohne daran zu denken, dasselbe mit einem weichen Lager zu versehen. Hier lag sie, die kleinen Jungen anfänglich sorgsam zwischen den Beinen verdeckend, wochenlang fast auf einer Stelle. Als die Jungen etwas größer wurden und umherzukriechen begannen, holte sie dieselben fortwährend mit den handartigen Füßen wieder herbei und bedeckte sie nach wie vor. Schließlich wuchsen ihr die Sprossen über den Kopf, ließen sich nicht mehr wie Unmündige behandeln, kletterten auf ihr, bald auch mit ihr auf den Bäumen umher, nahmen alle ihrem Geschlechte geläufigen Stellungen an und trieben es im Alter von drei Monaten schon ganz wie die Alten. Im sechsten Monate ihres Alters waren sie halbwüchsig, nach Jahresfrist erwachsen.
Der Waschbär wird nicht bloß seines guten Pelzes wegen verfolgt, sondern auch aus reiner Jagdlust aufgesucht und getödtet. Wenn man bloß seinem Felle nachstrebt, fängt man ihn leicht in Schlageisen und Fallen aller Art, welche mit einem Fische oder einem Fleischstückchen geködert werden. Weniger einfach ist seine Jagd. Die Amerikaner üben sie mit wahrer Leidenschaft aus, und dies wird begreiflich, wenn man ihre Schilderungen liest. Man jagt nämlich nicht bei Tage, sondern bei Nacht, mit Hülfe der Hunde und unter Fackelbeleuchtung. Wenn der Waschbär sein einsames Lager verlassen hat und mit leisen, unhörbaren Schritten durch das Unterholz gleitet, wenn es im Wald sonst sehr still geworden ist unter dem Einflusse der Nacht, macht man sich auf, um sich des Schupp zu bemächtigen. Ein guter, erfahrener Hund nimmt die Fährte auf, und die ganze Meute stürzt jetzt dem sich flüchtenden, behenden Bären nach, welcher zuletzt mit Affengeschwindigkeit einen Baum ersteigt und sich hier im dunkelsten Gezweige zu verbergen sucht. Ringsum unten bilden die Hunde einen Kreis, bellend und heulend; oben liegt das gehetzte Thier in behaglicher Ruhe, gedeckt von dem dunkeln Mantel der Nacht. Da nahen sich die Jäger. Die Fackeln werden auf einen Haufen geworfen, trockenes Holz, Kienspäne, Fichtenzapfen aufgelesen, zusammengetragen, und plötzlich flammt, die Umgebung zauberisch beleuchtend, unter dem Baume ein gewaltiges Feuer auf. Nunmehr ersteigt ein guter Kletterer den Baum und übernimmt das Amt der Hunde oben im Gezweige. Mensch und Affenbär jagen sich wechselseitig in der Baumkrone umher, bis endlich der Schupp auf einem schwankenden Zweige hinausgeht, in der Hoffnung, sich dadurch auf einen anderen Baum flüchten zu können. Sein Verfolger eilt ihm nach, soweit, als er es vermag, und beginnt plötzlich den betreffenden Ast mit Macht zu schütteln. Der beklagenswerthe Gesell muß sich nun gewaltsam festhalten, um nicht zur Erde geschleudert zu werden. Doch dies hilft ihm nichts. Näher und näher kommt ihm sein Feind, gewaltsamer werden die Anstrengungen, sich zu halten, – ein Fehlgriff und er stürzt sausend zu Boden. Jauchzendes Gebell der Hunde begleitet seinen Fall, und wiederum beginnt die Jagd mit erneuter Heftigkeit. Zwar sucht sich der Waschbär noch ein- oder zweimal vor den Hunden zu retten und erklettert also nochmals einen Baum, endlich aber muß er doch die Beute seiner eifrigen vierfüßigen Gegner werden und unter deren Bissen sein Leben verhauchen.
Audubon schildert das Ende solcher Hetze in seiner lebendigen Weise, wie folgt: »Und weiter geht die Jagd. Die Jagdgehülfen mit den Hunden sind dem Waschbären hart auf den Fersen, und dieser rettet sich endlich verzweiflungsvoll in eine kleine Lache. Wir nähern uns ihm rasch mit den Fackeln. Nun Leute, gebt Acht und schaut! Das Thier hat kaum noch Grund unter den Füßen und muß schon beinahe schwimmen. Unzweifelhaft ist ihm der Glanz unserer Lichter im höchsten Grade unangenehm. Sein Fell ist gesträubt, der gerundete Schwanz erscheint dreimal so dick als gewöhnlich, die Augen blitzen wie Smaragde. Mit schäumendem Rachen erwartet er die Hunde, fertig jeden anzugreifen, welcher ihm sich zu nähern versuchen will. Dies hält einige Minuten auf, das Wasser wird schlammig, sein Fell tropft und sein im Kothe geschleifter Schwanz schwimmt auf der Oberfläche. Sein tiefes Knurren, in der Absicht, seine Angreifer zu verscheuchen, feuert diese nur noch mehr an, und näher und näher rückt ihm der Haufe, ohne Umstände auf ihn sich werfend. Einer ergreift ihn am Rumpfe und zerrt, wird aber schnell genöthigt, ihn gehen zu lassen. Ein zweiter packt ihn an der Seite, erhält aber augenblicklich einen wohlgerichten Biß in seine Schnauze. Da aber packt ihn doch ein Hund an dem Schwanze – der Schupp sieht sich verloren, und kläglich sind die Schreie des hülflosen Geschöpfes. Den einmal gepackten Gegner will er nicht fahren lassen; aber gerade hierdurch bekommen die anderen Hunde Gelegenheit, sich auf ihn zu werfen und ihn zu würgen; doch auch jetzt läßt er den ersten Angreifer nicht gehen. Ein Axtschlag auf den Kopf erlegt ihn endlich; er röchelt zum letzten Male, und qualvoll hebt sich noch einmal die Brust. Währenddem stehen die übrigen Jäger als Zuschauer neben ihm in der Lache, und in der ganzen Runde glänzen die Fackeln und lassen die herrschende Dunkelheit nur noch um so dichter erscheinen.«
Ein jung eingefangener Waschbär wird gewöhnlich sehr bald und im hohen Grade zahm. Seine Zutraulichkeit, Heiterkeit, die ihm eigene Unruhe, die niemals endende Lust an der Bewegung sowie sein komisches, affenartiges Wesen machen ihn den Leuten angenehm. Er liebt es sehr, wenn man ihm schmeichelt, zeigt jedoch niemals große Anhänglichkeit. Auf Scherz und Spiel geht er sofort mit Vergnügen ein und knurrt dabei leise vor Behagen, ganz so, wie junge Hunde dies zu thun pflegen. Sein Benehmen erinnert in jeder Hinsicht an das Gebaren der Affen. Er weiß sich immer mit etwas zu beschäftigen und ist aus alles, was um ihn her vorgeht, sehr achtsam. Bei seinen Spaziergängen in Haus und Hof stiftet er viel Unfug an. Er untersucht und benascht alles, in der Speisekammer sowohl, wie im Hof und Garten. Der Hausfrau guckt er in die Töpfe, und wenn diese mit Deckeln versehen sind, versucht er, dieselben auf irgend eine Weise zu öffnen, um sich des verbotenen Inhaltes zu bemächtigen. Eingemachte Früchte sind besondere Leckerbissen für ihn; er verschmäht aber auch Zucker, Brod und Fleisch im verschiedensten Zustande nicht. Im Garten besteigt er die Kirsch- und Pflaumenbäume und frißt sich da oben an den süßen Früchten satt oder stiehlt Trauben, Erdbeeren und dergl.; im Hofe schleicht er zu den Hühnerställen oder Taubenschlägen, und wenn er in sie eindringen kann, würgt er alle Insassen binnen einer einzigen Nacht. Er kann sich wahrhaft marderartig durch sehr enge Ritzen drängen und benutzt seine Pfoten außerordentlich geschickt nach Art der Hände. Bei diesem fortwährenden Kundschaften und Umherschnüffeln durch das Haus und Gehöft wirft er selbstverständlich eine Menge von Gegenständen um, welche ihn sonst nicht fesseln konnten, oder zerbricht Geschirre, welche nichts Genießbares enthalten. Seine Haltung hat nicht die geringsten Schwierigkeiten; er frißt, was man ihm gibt, rohes und gekochtes Fleisch, Geflügel, Eier, Fische, Kerbthiere, zumal Spinnen, Brod, Zucker, Sirup, Honig, Milch, Wurzeln, Körner etc. Auch in der Gefangenschaft behält der sonderbare Kauz die Gewohnheit bei, alles, was er frißt, vorher ins Wasser einzutauchen und zwischen den Vorderpfoten zu reiben, obgleich ihm dabei manche Leckerbissen geradezu verloren gehen, wie z. B. der Zucker. Das Brod läßt er gern lange weichen, ehe er es zu sich nimmt. Ueber das Fleisch fällt er gieriger als über alle andere Nahrung her. Alle festen Nahrungsstoffe bringt er mit beiden Vorderpfoten zum Munde, wie denn überhaupt eine aufrechte Stellung auf den Hinterbeinen ihm nicht die geringsten Schwierigkeiten macht. Mit anderen Säugethieren lebt er in Frieden und versucht niemals ihnen etwas zu Leide zu thun, solange jene auch ihn unbehelligt lassen. Falls ihm aber eine schlechte Behandlung wird, sucht er sich die Urheber derselben sobald wie möglich vom Halse zu schaffen, und es kommt ihm dabei auf einen Zweikampf mehr oder weniger nicht an. Bei guter Pflege hält er auch in Europa die Gefangenschaft ziemlich lange aus.
»Ich habe«, sagt Weinland, »einen Schupp einst jung aufgezogen und ihn fast ein Jahr lang im freien Zimmer wie einen Hund umherlaufen lassen. Hier hatte ich täglich Gelegenheit, seinen Gleichmuth zu bewundern. Er ist nicht träge, vielmehr sehr lebendig, sobald er seiner Sache sicher ist. Aber wie kein anderes Thier und wie wenige Menschen schickt er sich ins Unvermeidliche. An einem Käfig, in welchem ich einen Papagei hatte, kletterte er dutzendmale auf und nieder, ohne auch nur den Vogel anzusehen; kaum aber war dieser aus seinem Käfige und ich aus dem Zimmer, so machte mein Waschbär auch schon Jagd auf den Papagei. Dieser wußte sich freilich seines Verfolgers gewandt zu erwehren, indem er, den Rücken durch die Wand gedeckt, dem langsam und von der Wand heranschleichenden Bären immer seinen offenen Hakenschnabel entgegenstreckte.
»Neugierig bis zum äußersten, zog er sich doch, so oft die Thür sich öffnete, unter meinen Lehnstuhl zurück, gewiß aber nie anders als rückwärts, d. h. den Kopf gegen die Thüre gekehrt. Auch vor dem größten Hund ging er nie im schnellen Laufe, sondern stets in dieser spartanischen Weise zurück, dem Feinde Kopf und Brust entgegenhaltend. Kam ihm ein mächtiger Gegner zu nahe, so suchte er durch Haarsträuben und Brummen, auch wohl durch einen schnell hervorgestoßenen Schrei für Augenblicke Achtung einzuflößen und so den Rückzug zu decken, und das glückte ihm auch immer. War er aber in einem Winkel angekommen, so vertheidigte er sich wüthend. Vögel und Eier waren ihm Leckerbissen, Mäuse zeigten sich nie, solange ich ihn besaß, und er dürfte sich so gut wie die Katze zum Hausthiere eignen und dieselben Dienste thun, würde aber freilich ein mindestens ebenso unabhängiges Leben zu wahren wissen wie jene. Anhänglich wurde mein Waschbär nie. Doch kannte er seinen Namen, folgte aber dem Rufe nur, wenn er etwas zu bekommen hoffte. Selten zeigte er sich zum Spielen aufgelegt. Er versuchte dies einmal mit einer Katze, die ihn dafür ins Gesicht kratzte. Dies erbitterte ihn nicht nur nicht im geringsten, sondern, nachdem er bedächtig das Gesicht abgewischt, nahte er sich der Katze sofort wieder, betastete sie aber diesmal nur mit der Tatze und mit vorsichtig weit abgewendetem Kopfe.
»Daß er sich, wie das Opossum, todt stellt, habe ich selbst nie beobachtet, obwohl man es auch von ihm behauptet hat. Allerdings läßt er, sobald man ihn beim Pelze im Genicke packt, alle Glieder schlaff fallen und hängt herunter wie todt; nur die kleinen, klugen Augen lugen aller Orten nach einem Gegenstande umher, welcher mit den Zähnen oder Füßen erreicht werden könnte. Hat der Schupp glücklich einen solchen erfaßt, so hält er ihn mit außerordentlicher Zähigkeit fest. Bei Nacht machte er anfangs viel Lärm, während er bei Tag schlief; aber als er den Tag über immer im hellen Zimmer sich aufhalten und erst nachts in seinen Behälter kriechen mußte, lernte er bald nach ehrlicher Bürgersitte am Tage wachen und bei Nacht schlafen.
»Mit anderen seiner Art lebt der Schupp in vollster Einigkeit. Bekanntlich ist eine Nuß im Stande, den Frieden eines Affenpaares in einem Augenblicke in Hader und Gewaltthätigkeit umzuwandeln; bei dem Waschbär ist dem nicht also. Ruhig verzehrt derjenige, dem eben das Glück wohl will, vorn am Käfig zu sitzen, den dargebotenen Leckerbissen, ohne daß ihn die kurz davon sitzende Ehehälfte im geringsten behelligt, freilich, wie es scheint, auch nicht erfreut wurde. Sie ist einfach gleichgültig.«
Letztere Beobachtung bezieht sich übrigens, wie ich ergänzend bemerken muß, doch nur auf Waschbären, welche von Jugend auf zusammengewöhnt oder verschiedenen Geschlechtes sind. Zwei erwachsene Männchen, welche ich zusammenbrachte, bewiesen wenigstens durch Zähnefletschen, Knurren und Kläffen, daß sie gegenseitig nicht besonders erfreut waren über den ihnen gewordenen Gesellschafter. Zu wirklichen Thätlichkeiten kam es allerdings nicht, Lust dazu aber zeigten sie entschieden.
»Zu den hervorstechendsten Eigenschaften des Schupp«, schildert L. Beckmann, »zählt seine grenzenlose Neugierde und Habsucht, sein Eigensinn und der Hang zum Durchstöbern aller Ecken und Winkel. Im schroffsten Gegensatz hierzu besitzt er eine Kaltblütigkeit, Selbstbeherrschung und viel Humor. Aus dem beständigen Kampfe dieser Gegensätze gehen selbstverständlich oft die sonderbarsten Ergebnisse hervor. Sobald er die Unmöglichkeit einsieht, seine Zwecke zu erreichen, macht die brennendste Neugierde sofort einer stumpfen Gleichgültigkeit, hartnäckiger Eigensinn einer entsagenden Fügsamkeit Platz. Umgekehrt geht er aus träger Verdrossenheit oft ganz unerwartet mittels eines Purzelbaums zur ausgelassensten Fröhlichkeit über, und trotz aller Selbstbeherrschung und Klugheit begeht er die einfältigsten Streiche, sobald seine Begierden einmal aufgestachelt sind.
»In den zahlreichen Mußestunden, welche jeder gefangene Schupp hat, treibt er tausenderlei Dinge, um sich die Langeweile zu verscheuchen. Bald sitzt er aufrecht in einem einsamen Winkel und ist mit dem ernsthaftesten Gesichtsausdrucke beschäftigt, sich einen Strohhalm über die Nase zu binden, bald spielt er nachdenklich mit den Zehen seines Hinterfußes oder hascht nach der wedelnden Spitze der langen Ruthe. Ein anderes Mal liegt er auf dem Rücken, hat sich einen ganzen Haufen Heu oder dürre Blätter auf den Bauch gepackt und versucht nun, diese lockere Masse niederzuschnüren, indem er die Ruthe mit den Vorderpfoten fest darüberzieht. Kann er zum Mauerwerk gelangen, so kratzt er mit seinen scharfen Nägeln den Mörtel aus den Fugen und richtet in kurzer Zeit unglaubliche Verwüstung an. Wie Jeremias auf den Trümmern Jerusalems, hockt er dann mitten auf seinem Schutthaufen nieder, schaut finstern Blickes um sich und lüftet sich, erschöpft von der harten Arbeit, das Halsband mit den Vorderpfoten.
»Nach langer Dürre kann ihn der Anblick einer gefüllten Wasserbütte in Begeisterung versetzen, und er wird alles aufbieten, um in ihre Nähe zu gelangen. Zunächst wird nun die Höhe des Wasserstandes vorsichtig untersucht, denn nur seine Pfoten taucht er gern ins Wasser, um spielend verschiedene Dinge zu waschen; er selbst liebt es keineswegs, bis zum Halse im Wasser zu stehen. Nach der Prüfung steigt er mit sichtlichem Behagen in das nasse Element und tastet im Grunde nach irgend einem waschbaren Körper umher. Ein alter Topfhenkel, ein Stückchen Porzellan, ein Schneckengehäuse sind beliebte Gegenstände und werden sofort in Angriff genommen. Jetzt erblickt er in einiger Entfernung eine alte Flasche, welche ihm der Wäsche höchst bedürftig erscheint; sofort ist er draußen, allein die Kürze der Kette hindert ihn, den Gegenstand seiner Sehnsucht zu erreichen. Ohne Zaudern dreht er sich um, genau wie es die Affen auch thun, gewinnt dadurch eine Körperlänge Raum und rollt die Flasche nun mit dem weit ausgestreckten Hinterfüße herbei. Im nächsten Augenblicke sehen wir ihn, auf den Hinterbeinen aufgerichtet, mühsam zum Wasser zurückwatscheln, mit den Vorderpfoten die große Flasche umschlingend und krampfhaft gegen die Brust drückend. Stört man ihn in seinem Vorhaben, so geberdet er sich wie ein eigensinniges, verzogenes Kind, wirft sich auf den Rücken und umklammert seine geliebte Flasche mit allen Vieren so fest, daß man ihn mit derselben vom Boden heben kann. Ist er der Arbeit im Wasser endlich überdrüssig, so fischt er sein Spielzeug heraus, setzt sich quer mit den Hinterschenkeln darauf und rollt sich in dieser Weise langsam hin und her, während die Vorderpfoten beständig in der engen Mündung des Flaschenhalses fingern und bohren.
»Um sein eigenthümliches Wesen gebührend würdigen zu können, muß man ihn im freien Umgange mit Menschen und verschiedenen Thierarten beobachten. Sein übergroßes Selbständigkeitsgefühl gestattet ihm keine besondere Anhänglichkeit, weder an seinen Herrn noch an andere Thiere. Doch befreundet er sich ausnahmsweise mit dem einen wie mit den andern. Sobald es sich um Verabfolgung einer Mahlzeit, um Erlösung von der Kette oder ähnliche Anliegen handelt, kennt und liebt er seinen Herrn, ruft ihn durch ein klägliches Gewimmer herbei und umklammert seine Knie in so dringlicher Weise, daß es schwer hält, ihm einen Wunsch abzuschlagen. Harte Behandlung fürchtet er sehr. Wird er von fremden Leuten beleidigt, so sucht er sich bei vorkommender Gelegenheit zu rächen. Jeder Zwang ist ihm zuwider, und deshalb sehen wir ihn im engen Käfig der Thierschaubuden meist mit stiller Entsagung in einem Winkel hocken.
»Ein Waschbär, welcher nebst anderen gezähmten Vierfüßlern auf einem Gehöfte gehalten wurde, hatte eine besondere Zuneigung zu einem Dachse gefaßt, der in einem kleinen, eingefriedigten Raume frei umherwandelte. An heißen Tagen pflegte Grimmbart seinen Bau zu verlassen, um auf der Oberwelt im Schatten eines Fliederbusches sein Schläfchen fortzusetzen. In solchem Falle war der Schupp sofort zur Stelle; weil er aber das scharfe Gebiß des Dachses fürchtete, hielt er sich in achtungsvoller Entfernung und begnügte sich damit, jenen mit ausgestreckter Pfote in regelmäßigen Zwischenräumen leise am Hintertheile zu berühren. Dies genügte, den trägen Gesellen beständig wach zu erhalten und fast zur Verzweiflung zu bringen. Vergebens schnappte er nach seinem Peiniger: der gewandte Waschbär zog sich bei Seite, auf die Einfriedigung des Zwingers zurück, und kaum hatte Grimmbart sich wieder zur Ruhe begeben, so begann ersterer seine sonderbare Thätigkeit aufs neue. Sein Verfahren hatte keineswegs einen Anstrich von Tücke oder Schadenfreude, sondern wurde mit gewissenhaftem Ernst und mit unerschütterlicher Ruhe betrieben, als hege er die feste Ueberzeugung, daß seine Bemühungen zu des Dachses Wohlergehen durchaus erforderlich seien. Eines Tages ward es dem letztem doch zu arg, er sprang grunzend auf und rollte verdrießlich in seinen Bau. Der Hitze wegen streckte er den bunten Kopf aber bald wieder aus der engen Höhle heraus und schlief in dieser Lage ein. Der Schupp sah augenblicklich ein, daß er seinem Freunde die üblichen Aufmerksamkeiten in dieser Stellung unmöglich erweisen konnte, und wollte eben den Heimweg antreten, als der Dachs zufällig erwachte und, seinen Peiniger gewahrend, das schmale, rothe Maul sperrweit aufriß. Dies erfüllte unsern Schupp dermaßen mit Verwunderung, daß er sofort umkehrte, um die weißen Zahnreihen Grimmbarts von allen Seiten zu betrachten. Unbeweglich verharrte der Dachs in seiner Stellung und steigerte hierdurch die Neugierde des Waschbärs aufs äußerste. Endlich wagte der Schupp dem Dachse vorsichtig von oben herab mit der Pfote auf die Nase zu tippen – vergebens, Grimmbart rührte sich nicht. Der Waschbär schien diese Veränderung im Wesen seines Gefährten gar nicht begreifen zu können, seine Ungeduld wuchs mit jedem Augenblicke, er mußte sich um jeden Preis Aufklärung verschaffen. Unruhig trat er eine Weile hin und her, augenscheinlich unschlüssig, ob er seine empfindlichen Pfoten oder seine Nase bei dieser Untersuchung aufs Spiel setzen solle. Endlich entschied er sich für letzteres und fuhr plötzlich mit seiner spitzen Schnauze tief in den offenen Rachen des Dachses. Das Folgende ist unschwer zu errathen. Grimmbart klappte seine Kinnladen zusammen, der Waschbär saß in der Klemme und quiekte und zappelte, wie eine gefangene Ratte. Nach heftigem Toben und Gestrampel gelang es ihm endlich, die bluttriefende Schnauze der unerbittlichen Falle des Dachses zu entreißen, worauf er zornig schnaufend über Kopf und Hals in seine Hütte flüchtete. Diese Lehre blieb ihm lange im Gedächtnisse, und so oft er an dem Dachsbau vorüberging, pflegte er unwillkürlich mit der Tatze über die Nase zu fahren; gleichwohl nahmen die Neckereien ihren ungestörten Fortgang.
»Sein Zusammentreffen mit Katzen, Füchsen, Stachelschweinen und anderen wehrhaften Geschöpfen endete meistens ebenso. Eine alte Füchsin, welche ihn einmal übel zugerichtet, mißachtete er später gänzlich und suchte sie dadurch zu ärgern, daß er immer hart im Bereich ihrer Kette vorüberging, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Als er bei einer solchen Gelegenheit einst heftig quer über die Ruthe gebissen wurde, zeigte er kaum durch ein Zucken Schreck oder Zorn, sondern setzte mit scheinbarer Gleichgültigkeit seinen Weg fort, ohne auch nur den Kopf zu wenden.
»Mit einem großen Hühnerhunde hatte jener Waschbär dagegen ein Schutz- und Trutzbündnis geschlossen. Er ließ sich gern mit ihm zusammenkoppeln, und beide folgten ihrem Herrn Schritt für Schritt, während der Waschbär allein selbst an der Leine stets seinen eignen Weg gehen wollte. Sobald er morgens von der Kette befreit wurde, eilte er in freudigen Sprüngen, seinen Freund aufzusuchen. Auf den Hinterfüßen stehend, umschlang er den Hals des Hundes mit seinen geschmeidigen Vorderpfoten und schmiegte den Kopf höchst empfindsam an; dann betrachtete und betastete er den Körper seines vierbeinigen Freundes neugierig von allen Seiten. Es schien, als ob er täglich neue Schönheiten an ihm entdecke und bewundere. Etwaige Mängel in der Behaarung suchte er sofort durch Lecken und Streichen zu beseitigen. Der Hund stand während dieser oft über eine Viertelstunde dauernden Musterung unbeweglich mit würdevollem Ernste und hob willig einen Lauf um den andern empor, sobald der Waschbär dies für nöthig erachtete. Wenn letzterer aber den Versuch machte, seinen Rücken zu besteigen, ward er unwillig, und nun entspann sich eine endlose Rauferei, wobei der Waschbär viel Muth, Kaltblütigkeit und erstaunliche Gewandtheit zeigte. Seine gewöhnliche Angriffskunst bestand darin, dem ihm an Größe und Stärke weit überlegenen Gegner in einem unbewachten Augenblicke unter die Gurgel zu springen. Den Hals des Hundes von unten auf mit den Vorderpfoten umschlingend, schleuderte er im Nu seinen Körper zwischen jenes Vorderbeinen hindurch und suchte sich sofort mit den beweglichen Hinterpfoten auf dessen Rücken oder an den Seiten fest anzuklammern. Gelang ihm letzteres, so war der Hund kampfunfähig und mußte nun versuchen, durch anhaltendes Wälzen auf dem Rasen sich von der inbrünstigen Umarmung seines Freundes zu befreien. Zum Lobe des Schupp sei erwähnt, daß er den Vortheil seiner Stellung niemals mißbrauchte. Er begnügte sich damit, den Kopf fortwährend so dicht unter die Kehle des Hundes zu drängen, daß dieser ihn mit dem Gebisse nicht erreichen konnte.
»Mit den kleinen, bissigen Dachshunden hatte er nicht gern zu schaffen; doch wandelte ihn mitunter plötzlich die Laune an, ein solches Krummbein von oben herab zu umarmen. War der Streich geglückt, so machte er vor Wonne einen hohen Bocksprung nach rückwärts und schnappte dabei in der Luft zwischen den weitgespreizten Vorderbeinen hindurch nach dem rundgeringelten, baumelnden Schweife. Dann aber suchte er, steifen Schrittes rückwärts gehend und den zornigen Dächsel fortwährend im Auge behaltend, sich den Rücken zu decken und kauerte sich schließlich unter dumpfem Schnurren und unruhigem Schweifwedeln wie eine sprungbereite Katze platt auf dem Erdboden nieder. Von verschiedenen Seiten angegriffen, warf er sich sofort auf den Rücken, strampelte mit allen Vieren und biß unter gellendem Zetergeschrei wüthend um sich.
»Kleinere Säugethiere und jede Art Geflügel fiel er mörderisch an, und äußerst schwer hielt es, ihm den Raub zu entreißen. Mäuse, Ratten und anderes Gethier tödtete er durch einen raschen Biß ins Genick und verzehrte sie mit Haut und Haar, da ihm das Abstreifen des Felles trotz alles Zerrens und Reibens nur unvollständig gelingen wollte. An schönen Sommertagen schlich er gern in der Frühe im hohen, thaubedeckten Grase umher. Es war eine Lust, ihn hierbei zu beobachten. Hier und da hält er an, wie ein vorstehender Hühnerhund, plötzlich springt er ein: er hat einen Frosch erwischt, den er nun durch heftiges Hin- und Herreiben auf dem Boden vorläufig außer Fassung zu bringen sucht. Dann setzt er sich vergnügt auf die Hinterschenkel, hält seinen Frosch, wie ein Kind sein Butterbrod, zwischen den Fingern, beißt ihm wohlgemuth den Kopf herunter und verzehrt ihn bis auf die letzte Zehe. Während des Kauens summt die erste Biene heran. Der Schupp horcht auf, schlägt beide Pfoten in der Luft zusammen und steckt das so gefangene Kerbthier nach Entfernung des Stachels in die Schnauze. Im nächsten Augenblick richtet er sich am nahen Gemäuer auf, klatscht eine ruhende Fliege mit der flachen Pfote breit und kratzt seinen Fang sorgfältig mit den Nägeln ab. Schneckengehäuse knackt er wie eine Haselnuß mit den Zähnen, worauf der unglückliche Bewohner durch anhaltendes Reiben im nassen Grase von den Scherben seiner Behausung gründlich befreit und dann ebenfalls verspeist wird. Die große Wegeschnecke liebt er nicht; die großen, goldgrünen Laufkäfer aber scheinen ihm besonderes Vergnügen zu gewähren, denn er spielt lange und schonend mit ihnen, ehe er sie auffrißt. Im Aufsuchen und Plündern der Vogel- und Hühnernester ist er Meister. Als Allesfresser geht er auch der Pflanzennahrung nach: reifes Obst, Waldbeeren, die Früchte der Eberesche und des Hollunders weiß er geschickt zu pflücken. Es gewährt einen drolligen Anblick, wenn der rauhhaarige, langgeschwänzte Gesell mit einer großen Aprikose im Maule langsam rückwärts von einem Geländer herabsteigt, ängstlich den Kopf hin und her wendend, ob sein Diebstahl auch bemerkt worden sei.«
Der auf der Jagd erlegte Waschbär gewährt einen nicht unbedeutenden Nutzen. Sein Fleisch wird nicht nur von den Urbewohnern Amerikas und von den Negern, sondern auch von den Weißen gegessen, und sein Fell findet eine weite Verbreitung: Schuppenpelze sind allgemein beliebt. Die Grannenhaare geben gute Pinsel, aus den Wollhaaren macht man Hüte, die ganzen Schwänze benutzt man zu Halswärmern.
An den Schupp und Genossen reihen sich naturgemäß die Nasenbären ( Nasua ). Ihr gestreckter, schlanker, fast marderähnlicher Leib mit kurzem Halse und langem, spitzem Kopfe, dicht behaartem, körperlangem Schwanze und kurzen, kräftigen, breittatzigen und nacktsohligen Beinen unterscheiden sie leicht. Das bezeichnendste Merkmal ist die Nase. Sie verlängert sich rüsselartig weit über den Mund hinaus und hat scharfkantig aufgeworfene Ränder. Die Ohren sind kurz und abgerundet, die klaren Augen mäßig groß, die fünf fast ganz verwachsenen Zehen mit langen und spitzigen, aber wenig gebogenen Krallen bewehrt. Das Gebiß ähnelt dem der Waschbären; die Zähne sind jedoch etwas schmäler und schmächtiger.
Ueber die von verschiedenen Naturforschern aufgestellten Arten von Nasenbären sind wir noch nicht im Reinen. Die Thiere scheinen nicht allein abzuändern, sondern führen auch, wie Hensel überzeugend nachgewiesen hat, je nach dem Alter eine verschiedene Lebensweise. Prinz von Wied unterschied in Brasilien zwei Arten, den geselligen und den einsamen Nasenbären, beide aber bilden nach Hensels Untersuchungen nur eine und dieselbe Art; denn die »einsamen« Nasenbären sind nichts anderes als griesgrämige alte Männchen, welche von den Trupps der »geselligen« sich getrennt haben. Anders verhält es sich wohl mit zwei von Tschudi aufgestellten, aus Südwestamerika stammenden Arten, und möglicherweise unterscheiden sich auch die Nasenbären Mittelamerikas von den im Osten und Westen Südamerikas lebenden Verwandten.
Die bekannteste Art der Gruppe ist der Coati der Brasilianer, welchen wir Nasenbär nennen wollen ( Nasua narica, Viverra und Ursus narica, Nasua socialis und solitaria). aus Ostbrasilien stammend. Seine Gesammtlänge beträgt 1 bis l,05 Meter, wovon etwa 45 Centim. auf den Schwanz kommen, die Höhe am Widerrist 27 bis 30 Centim. Die dichte und ziemlich lange, jedoch nicht zottige Behaarung besteht aus straffen, groben, glänzenden Grannen, welche sich am Schwanze verlängern, und kurzem, weichen, etwas krausen Wollhaar, welches namentlich auf dem Rücken und an den Seiten dicht steht. Starke Schnurren und lange Borstenhaare finden sich auf der Lippe und über dem Auge; das Gesicht ist kurz behaart. Die auf dem Rücken zwischen Roth und Graubraun wechselnde Grundfärbung geht auf der Unterseite ins Gelbliche über; Stirn und Scheitel sind gelblichgrau, die Lippen weiß, die Ohren hinten bräunlichschwarz, vorn graulichgelb. Ein runder, weißer Flecken findet sich über jedem Auge, ein anderer am äußersten Winkel desselben und zwei, oft zusammenfließende, stehen unter dem Auge, ein weißer Streifen läuft längs der Nasenwurzel herab. Der Schwanz ist abwechselnd siebenmal braungelb und siebenmal schwarzbraun geringelt.
Als bestimmt verschiedene Art bezeichnet Hensel, nach Untersuchung der Schädel, den Weißrüsselbären ( Nasua leucorhyncha) aus Nordbrasilien. In der Größe kommt er dem Coati gleich, und auch die allgemeine Färbung erinnert an diesen. Die Oberseite des Pelzes ist mehr oder weniger dunkel, je nachdem die lichte Färbung der Haarspitzen zurücktritt oder sich bemerklich macht. Das einzelne Haar sieht an der Wurzel röthlich- oder fahlbraun, in der Mitte heller oder dunkler braun, an der Spitze fahl- oder braungelb aus; es entsteht daher eine mehr oder minder ausgesprochene Farbenmischung von Braun, Fahlbraun und Gelbbraun. Ein Ring ums Auge, ein über dem Auge beginnender, gegen die Nasenspitze verlaufender Streifen, die Vorderschnauze oben und unten sind gelblichweiß, Halsseiten und Kehle etwas dunkler, die übrigen Untertheile bräunlich, die Füße ausgesprochen braun, die Ohren innen und am Ende hellfahlgelb. Bei den meisten Stücken herrscht die lichtere Färbung vor; einzelne dagegen sehen sehr dunkel aus.
Wir verdanken Azara, Rengger, Wied und Hensel ausführliche Schilderungen der freilebenden Nasenbären. Nach Wied sollen sich der gesellige und einsame Coati dadurch unterscheiden, daß der eine beständig in Gesellschaften von acht bis zwanzig Stück lebt und herumschweift, der zweite aber einzeln in einem bestimmten Gebiete verweilt und nur während der Brunstzeit mit anderen seiner Art sich vereinigt, nach geschehener Begattung aber sich wieder trennt. Der einsame Nasenbär soll mehrere bestimmte Lager anlegen und bald in diesem, bald in jenem die Nacht zubringen, je nachdem er den einen oder den andern Theil des Waldes durchstreift, der gesellige dagegen weder ein Lager, noch ein bestimmtes Gebiet haben, sondern ein echtes Zigeunerleben führen, den Tag über im Walde umherlaufen und da, wo ihn die Nacht überfällt, in einem hohlen Baume oder unter Baumwurzeln sich verkriechen, auch wohl in eine von mehreren Aesten gebildete Gabel niederlegen, um hier bis zum nächsten Morgen zu schlafen. Seine Gesellschaften ziehen zerstreut umher und lassen dabei beständig eigenthümlich rauhe, halb grunzende, halb pfeifende Töne hören, welche man viel eher vernimmt, als man die Bande selbst gewahrt. Dabei wird der mit Laub und Aesten bedeckte Boden gründlich untersucht, jede Spalte, jeder Ritz durchstöbert, eine um die andere Nase schnuppernd in dieses oder jenes Loch gesteckt; aber niemals hält sich die Gesellschaft lange bei einem Gegenstande auf. Der Einsiedler dagegen zieht still und langsam dahin, untersucht ebenfalls jeden Gegenstand, jedoch äußerst bedächtig und nimmt sich ordentlich Zeit zu allen seinen Verrichtungen, jedenfalls deshalb, weil er keine Gewerbsbeeinträchtigung von Seiten seiner Artgenossen zu befürchten hat. Zuweilen sieht man die ganze Gesellschaft plötzlich einen Baum besteigen, welcher dann schnell durchsucht und ebenso schnell verlassen oder aber mit einem anderen vertauscht wird. Der Einsiedler ist zu solchen Kletterjagden viel zu faul und bleibt unten auf dem Boden. Bei den gesellig lebenden bemerkt man übrigens niemals eine besondere Uebereinstimmung in den Handlungen der verschiedenen Mitglieder einer Bande; jedes handelt für sich und bekümmert sich nur insofern um seine Begleiter, als es bei der Truppe bleibt, welche, wie es scheint, von alten Thieren angeführt wird.

Weißrüsselbär
Alle diese Angaben werden von Hensel nicht bestritten, die Abweichungen im Betragen der Thiere nur anders gedeutet. »Der Nasenbär«, sagt er, »ist in Brasilien so häufig, daß ich nicht weniger als zweihundert Schädel in meinen Besitz bringen konnte. Aus den Vergleichungen dieser Schädel wie aus vielfältiger Beobachtung des Coati im Freien hat sich ergeben, daß die alten Männchen, welche als besondere Art betrachtet worden sind, einsiedlerisch leben. Sie verlassen in einem bestimmten Lebensalter, wenn die langen Eckzähne anfangen abgeschliffen zu werden, den Trupp, welchen sie bisher mit den Weibchen gebildet hatten, und kehren nur in der Paarungszeit zu ihm zurück. Man bemerkt niemals einsiedlerische Weibchen; wird aber einmal ein einzelnes Coatiweibchen gefunden, so ist es vielleicht durch eine Jagd vom ganzen Trupp versprengt worden, oder der Jäger hat diesen, welcher ganz in der Nähe war, nicht bemerkt ... Den deutschen Ansiedlern des Urwaldes von Rio Grande do Sul, welche mit besonderer Leidenschaft die Jagd auf Coatis betreiben, war die Naturgeschichte dieser Thiere sehr wohl bekannt. Sie alle wußten, daß die Einsiedler nur die Männchen der geselligen Coatis seien, und betrachteten es als eine unzweifelhafte Thatsache, daß man niemals einsiedlerische Weibchen findet.
»Die Nasenbären sind Tagthiere. Sie ruhen des Nachts, zeigen dagegen vom Morgen bis zum Abend eine rastlose Thätigkeit. Während des Tages scheinen sie auf einer fortwährenden Wanderung begriffen zu sein, wobei sie keinen ihnen zugänglichen Raum undurchsucht lassen. Ihre Nahrung besteht ohne Zweifel aus allem Genießbaren des Thier- und Pflanzenreiches. Gern gehen sie auch in die Pflanzungen, um den Mais zu plündern, besonders so lange die Körner noch weich sind.« Kleine Thiere aller Art werden ihnen zur Beute, Kerbthiere und deren Larven, Würmer und Schnecken scheinen Leckerbissen für sie zu sein. Wenn sie einen Wurm im Boden, eine Käferlarve im faulen Holze ausgewittert haben, geben sie sich die größte Mühe, dieser Beute auch habhaft zu werden, scharren eifrig mit den Vorderpfoten, stecken von Zeit zu Zeit die Nase in das gegrabene Loch und spüren, wie unsere Hunde es thun, wenn sie auf dem Felde den Mäusen nachstellen, bis sie endlich ihren Zweck erreicht haben.
»Unter Lärmen und Pfeifen, Scharren und Wühlen, Klettern und Zanken vergeht der Morgen; wird es heißer im Walde, so schickt die Bande sich an, einen passenden Platz zur Mittagsruhe zu finden. Jetzt wird ein gut gelegener Baum oder ein hübsches Gebüsch ausgesucht, und jeder streckt sich hier auf einem Zweige behaglich aus und hält sein Schläfchen. Nachmittags geht die Wanderung weiter, bis gegen Abend die Sorge um einen guten Schlafplatz sie von neuem unterbricht. Bemerken Coatis einen Feind, so geben sie ihren Gefährten sofort durch laute, pfeifende Töne Nachricht und klettern eiligst auf einen Baum; alle übrigen folgen diesem Beispiele, und im Nu ist die ganze Gesellschaft in dem Gezweige des Wipfels vertheilt. Steigt man ihnen nach oder schlägt man auch nur heftig mit einer Axt an den Stamm, so begibt sich jeder weiter hinaus auf die Spitze der Zweige, springt von dort herab plötzlich auf den Boden und nimmt Reißaus. Ungestört, steigen die Thiere kopfunterst den Stamm hinab. Sie drehen dabei die Hinterfüße nach außen und rückwärts und klemmen sich mit ihnen fest an den Stamm an. Auf den Zweigen klettern sie vorsichtig weiter, und auf Sätze, wie Affen sie ausführen, etwa von einem Baume zum anderen, lassen sie sich nicht ein, obwohl sie es könnten; denn an Gewandtheit geben sie den Affen oder Katzen kaum etwas nach. Auf ebenem Boden sind ihre Bewegungen viel schwerfälliger als im laubigen Geäste der Bäume. Sie gehen hier entweder im Schritte mit senkrecht gehobenem Schwanze oder springen in kurzen Sätzen und berühren dabei immer bloß mit der halben Sohle den Boden. Nur wenn sie stehen oder sich auf die Hinterbeine setzen, ruhen die Füße auf ganzer Sohle. Der Lauf sieht unbehülflich aus, ist aber ein sehr fördernder Galopp. Vor dem Wasser scheinen sie sich zu fürchten und nehmen es nur im höchsten Nothfalle an; doch verstehen sie das Schwimmen gut genug, um über Flüsse und Ströme setzen zu können.
Unter den Sinnen steht der Geruch unzweifelhaft obenan, auf ihn folgt das Gehör, Während Gesicht, Geschmack und Gefühl verhältnismäßig schwach sind. Bei Nacht sehen sie nicht, bei Tage wenigstens nicht besonders gut, von Geschmack kann man auch nicht viel bei ihnen wahrnehmen, und das Gefühl scheint fast einzig und allein auf die rüsselförmige Nase, zugleich auch das hauptsächlichste Tastwerkzeug, beschränkt zu sein. Gegen Verletzungen sind die Nasenbären ebenso unempfindlich wie gegen Einflüsse der Witterung. Man begegnet zuweilen kranken, welche am Bauche mit bösartigen Geschwüren bedeckt sind, weiß auch, daß sie gerade dieser Krankheit häufig unterliegen; dennoch sieht man sie diese Geschwüre mit den Nägeln wüthend aufreißen, ohne daß sie dabei irgend ein Zeichen des Schmerzes äußern.
Wenn der an eine bestimmte Zeit gebundene Geschlechtstrieb sich regt, kehrt, laut Hensel, der Einsiedler zu seinem Trupp zurück, und es finden nunmehr zwischen den alten Männchen die heftigsten Kämpfe statt. Mit ihren riesenhaften und stets messerscharfen Eckzähnen bringen sie einander gewaltige Wunden bei, so daß die Gerber von ihren Fellen keinen Gebrauch machen können. Erst nachdem ein Männchen als Sieger hervorgegangen ist, genießt es dieser Kämpfe Lohn. Die Begattung geschieht, nach meinen Beobachtungen an gefangenen, wie bei den Hunden oder Pavianen. Letzteren ähneln die Nasenbären besonders darin, daß sie sehr oft Begattungsversuche machen, ohne daß es ihnen wirklich Ernst wäre. Das Weibchen läßt sich, wenn es das Männchen mit sich herumschleppt, in seinen Geschäften nicht stören und versucht letzteres höchstens ab und zu beißend abzuwehren; doch auch ihm scheint es damit nicht Ernst zu sein. Wie Rengger angibt, wirft das freilebende Nasenbärweibchen im Oktober, d. h. im südamerikanischen Frühling, drei bis fünf Junge in eine Baum- oder Erdhöhle, einen mit dichtem Gestrüpp bewachsenen Graben oder in einen anderen Schlupfwinkel. Hier hält es die Brut so lange versteckt, bis sie ihm auf allen seinen Streifereien folgen kann. Dazu bedarf es nicht viel Zeit; denn man trifft öfters ganz junge Thiere, welche kaum ihre Schneidezähne erhalten haben, unter den Trupps der älteren an.
Gefangene Nasenbären pflanzen sich seltener fort, als man von vornherein annehmen möchte. Von mir gepflegte Weibchen brachten nur zweimal Junge, welche zu meinem Bedauern beide Male zu Grunde gingen. Die Alte erwählte sich zum Wochenbette regelmäßig den Schlafkasten und baute sich in ihm aus Stroh und Heu ein hübsches Nest zusammen. In ihrem Betragen bekundete sie nicht die geringste Veränderung, was vielleicht darin seinen Grund haben mochte, daß die Jungen nach wenigen Tagen wieder starben. Glücklicher als ich war mein Berufsgenosse Schlegel, welcher bereits zweimal junge Nasenbären aufzog. Die Trächtigkeitsdauer konnte auch von ihm nicht bestimmt werden, und ebensowenig war über die erste Jugendzeit der Thierchen viel zu beobachten. Die Jungen wurden im finstern Verließe geboren und rührten sich anfänglich nicht von der Stelle; eines von ihnen, welches Schlegel nach der Geburt der Mutter abnahm, zeigte ein spaltförmig geöffnetes Auge, während das andere noch geschlossen war. Fünf Wochen nach der Geburt verließen vier von den fünf Jungen, so viel beobachtet werden konnte, zum erstenmale ihr
Lager, aber in so jämmerlich unbeholfenem Zustande, daß Schlegel vermuthete, die Alte habe den Versuch veranlaßt, beziehentlich ihre Jungen am Genick herausgeschleppt, wie sie dieselben in gleicher Weise wieder nach dem Lager zurückbrachte. Die Färbung der Jungen ist keine gleichmäßige, vielmehr eine sehr verschiedene, bei den einen hellere, bei den anderen dunklere. Die Farbenzeichnungen am Kopfe und Schwanze sind nur angedeutet und treten erst nach der fünften Woche stärker hervor.
Fünf Wochen später, in der zehnten Woche des Lebens also, beobachtete Mützel beim Zeichnen die Nasenbärenfamilie des Breslauer Thiergartens und berichtete mir hierüber das Nachstehende: »Der erste Eindruck der Gesellschaft war ein höchst eigenthümlicher. In tiefster Ruhe pflegte die Mutter ihre Kleinen. Sie saß oder richtiger lag auf der Breite des Kreuzbeines, die gespreizten Hinterbeine mir entgegenstreckend, auf ihrem Strohlager, stützte den Rücken an die Wand und beschnupperte und beleckte ihre Kinder, welche, den Bauch der Alten bedeckend, eifrig saugten. Von der Alten sah man nur das Gesicht und die Vorderbeine, während die fünf geringelten Schwänze der Kleinen, jeder von einem braunen Haarballe einspringend, strahlenartig die Mutter umkränzten. Doch bald änderte sich die Scene. Meine Gegenwart lenkte die Theilnahme der Mutter von ihren Kleinen ab. Neugierig erhob sie sich vom Lager und versuchte jene zum Loslassen der Zitzen zu bewegen; die aber hielten fest bis auf einen, und so schleppte sie ihre beharrliche Nachkommenschaft auf dem Boden entlang dem Drahtgitter zu, das eine, welches losgelassen hatte, aber noch schlaftrunken vor ihr umhertaumelte, einfach bei Seite schiebend. Erst nach längerer Zeit, während dem die Mutter mich gründlich besichtigt hat, kommen auch die Jungen zum Bewußtsein des Außergewöhnlichen, hören auf, die Alte zu belästigen und machen nun ihrerseits meine Bekanntschaft, mir dadurch Gelegenheit gebend, sie von allen Seiten zu betrachten. Trotz ihrer durchaus jugendlichen Formen tragen sie vollständig die Farbe der Alten, und ihre Gesichter erhalten gerade dadurch den Ausdruck des Hochkomischen. Die glänzend schwarze Nase, welche fortwährend in schnüffelnder Bewegung ist, das lange Gesicht, die anstatt der weißen Nasenstreifen von drei bis vier durch Braun unterbrochenen, lichten Flecken umgebenen, glänzenden, harmlosen, schwarzen Perlaugen und die mehrzackig braun und weiß gezeichneten Backen, der gewölbte Scheitel mit den mittelgroßen, weißen, viel bewegten Ohren, der bärenartig rundliche Körper, der lange, buschige, mit Ringen gezeichnete, hoch getragene Schwanz bilden ein absonderlich belustigendes Ganze, zumal wenn die Thiere laufen oder klettern. Alle Bewegungen sind tölpelhaft, halb bedächtig und halb flink, daß der Anblick den Beschauer auf das lebhafteste fesseln und bei dem unendlich gutmüthig und gemüthlichen Gesichtsausdrucke der Kleinen zur herzlichsten Theilnahme hinreißen muß.
»Doch ich wollte neues sehen und hielt deshalb der Alten eine Maus vor. Wie der Wind war sie dabei, biß zuerst heftig in den Kopf, als ob die bereits Todte noch einmal getödtet werden sollte, legte sie vor sich auf den Boden und begann, die Beute mit den Vorderfüßen haltend, am Hintertheile zu fressen. Dies fiel mir auf. Der Wärter aber sagte mir, daß solches Gewohnheit der Nasenbären sei, und sie immer, anstatt wie andere Thiere vom Kopfende, vom Schwanzende her begönnen. Beim zweiten Gericht einer todten Ratte, welche ich reichte, fand ich diese Angabe vollständig bestätigt. Auch der Ratte wurde der Biß in den Kopf versetzt, sie hierauf berochen und nunmehr mit dem Verzehren des Schwanzes angefangen, nach ihm folgten die Schenkel, sodann der übrige Leib, bis der Kopf den Beschluß machte. War die Maus nach wenigen Sekunden verschwunden, so währte das Verzehren der Ratte längere Zeit, und es wünschten, wie mir sehr begreiflich, an der Mahlzeit auch die Jungen theilzunehmen. Doch die Mutter versagte ihnen die Gewähr. Ob sie die Fleischnahrung noch nicht dienlich für die Kinder erachtete oder, was wahrscheinlicher, ob sie nur an sich dachte, genug, sie schnarrte ärgerlich auf, stieß nach rechts und links die Jungen weg, und warf sie, als deren Zudringlichkeit nicht nachließ, mit den Vorderfüßen seit- und rückwärts fort. Die Jungen rafften sich flink auf und umstanden nun die schmausende Alte, voller Theilnahme und Begierde zusehend, die schnüffelnde Nase in ewiger Bewegung, sämmtliche fünf Schwänze in die Höhe gereckt, mir zuweilen nach Katzenart mit den Spitzen derselben kleine Kreise beschreibend – ein köstliches Bild jugendlicher Begehrlichkeit. Endlich war der saftige Braten verzehrt, bis auf ein kleines Stück, welches aber auch noch nicht den Jungen zukommen sollte, vielmehr in ein diesen unerreichbares Loch, ungefähr einen halben Meter über den Boden, aufgehoben und mittels der langen beweglichen Nase so gut als möglich verborgen wurde. Gesättigt und in höchst behaglicher Stimmung trollte nunmehr die Mutter nach ihrem Lager und streckte sich hier zur Ruhe nieder, während im Vordergrunde sich folgender lebendige Vorgang entwickelte.
»Unbeachtet von der Alten waren zwei Stückchen Rattenhaut übrig geblieben, und über diese dürftigen Reste der Mahlzeit fielen die Kleinen her mit einem Eifer und einer Gier, wie ich etwas ähnliches nie gesehen. Es gab eine Balgerei, welche mir die Thränen in die Augen lockte, infolge eines nicht zu stillenden Lachens. Die fünf bunten Gesichter, die fünf wolligen Körper, die fünf ragenden Schwänze verwirren, überkugeln, verwickeln sich, die tölpelhaften Gesellen laufen, fallen und purzeln über- und durcheinander, kollern auf den Dielen dahin, überklettern die geduldige Alte, steigen an dem Kletterbaume auf und nieder, und das alles mit solcher Eilfertigkeit, daß man die größte Mühe hat, einen von ihnen mit den Augen zu verfolgen. Einmal in Bewegung, versuchen die Kleinen sich auch in Künsten, denen sie unbedingt nicht gewachsen sind, klettern an dem Mittelstamme ihres Käfigs empor, fallen schwerfällig herab, versuchen sich von neuem, laufen auf wagerechten Aesten hinaus, kippen um, kommen nochmals in Gefahr, herab zu fallen, halten sich mühsam an der Unterseite des Astes fest und setzen von hier den Weg bis zu Ende des Astes fort. Hier angekommen, ist guter Rath theuer. Auf dem schmalen Steige umzukehren, erlaubt die Ungeschicklichkeit noch nicht, verschiedene Versuche fallen auch äußerst unbefriedigt aus, und so bleibt nichts anderes übrig als springen: der kühne Kletterer läßt also die Vorderfüße los, und die Zehenspitzen reichen fast bis zum Boden herab; aber noch zaudert er lange vor dem Sprunge, endlich wagt er ihn doch. In demselben Augenblicke rennt zufällig einer seiner Brüder unter ihm durch; er fällt diesem auf den Rücken und schreit auf, ein dritter, welcher jenen verfolgt, bleibt erschreckt zurück, und die beiden durch Zufall verbundenen setzen nun die Hetze ihrerseits fort. In dieser Weise trieb sich das junge Volk im Käfig umher, bis schließlich alle ermatteten und nur die beiden flinksten im Besitze der Hautstückchen verblieben. Die anderen gingen bei Frau Mutter zu Tische und gewährten mir durch wechselnde Gruppirungen eine Reihe reizender Familienbilder,
»Herrschen keine aufregenden Verhältnisse, so treiben es die Jungen durchaus wie die Alten. Bedächtig wie alle Sohlengänger schreiten sie im Käfige umher, untersuchen jedes tausendmal ausgekratzte Loch aufs gewissenhafteste, sondern sich in Paare, spielen in lustiger Weise miteinander, rennen in einem drolligen Galopp hintereinander her, klettern am Baume in die Höhe oder steigen auf der Alten umher, welche ihrerseits mit unzerstörbarem Gleichmuthe alle Unbequemlichkeiten duldet und sich, obgleich sie nur selten zärtlich wird, dem Willen der Kinder unterwirft. Der Abend vereinigt das Völkchen im Schoße der Mutter und das zuerst gezeichnete Bild gestaltet sich von neuem, bis endlich die Alte, nachdem die Jungen ihrer Meinung nach sich gesättigt, auf die Seite sinkt und einnickt, gleichviel ob die Kleinen noch an ihren Zitzen haften oder nicht. Im ganzen ist das Benehmen einer Nasenbärenfamilie ein so anziehendes, daß ich nicht müde wurde, mich immer und immer wieder vor ihrer Wohnung aufzustellen, obgleich mir die Beobachtung weit mehr von meiner Zeit raubte, als ich als Zeichner auf diese Thiere hätte verwenden dürfen.«
Die weißen Bewohner Südamerikas und Mejikos jagen die Nasenbären hauptsächlich des Vergnügens wegen. Man durchstreift mit einer Meute Hunde die Waldungen und läßt durch diese eine Bande aufsuchen. Beim Anblick der Hunde flüchten die Nasenbären unter Geschrei auf die nächsten Bäume, werden dort verbellt und können nun leicht herabgeschossen werden. Doch verlangen sie einen guten Schuß, wenn man sie wirklich in seine Gewalt bekommen will; denn die verwundeten legen sich in eine Gabel der Aeste nieder und müssen dann mühselig herabgeholt werden. Zuweilen springen verfolgte Coatis wieder auf den Boden herab und suchen laufend zu entfliehen oder einen andern Baum zu gewinnen, werden hier aber von den Hunden leicht eingeholt und trotz alles Widerstandes getödtet. Ein einzelner Hund freilich vermag gegen einen Nasenbären nicht viel auszurichten. Zumal der Einsiedler weiß sich seiner scharfen Zähne gut zu bedienen, dreht sich, wenn ihm der Hund nahe kommt, muthig gegen diesen, schreit wüthend und beißt furchtbar um sich. Jedenfalls verkauft er seine Haut theuer genug und macht manchmal fünf bis sechs Hunde kampfunfähig, ehe er der Uebermacht erliegt. Das Fleisch wird nicht allein von den Eingeborenen, sondern auch von den Europäern gern gegessen. »Junge Nasenbären«, sagt Hensel, »liefern, namentlich wenn sie fett sind, einen vortrefflichen Braten, und auch das Fleisch der Alten ist immer noch wohlschmeckend.« Aus dem Felle verfertigen die Indianer kleine Beutel.
In allen Ländern des Verbreitungskreises der Nasenbären hält man sie sehr oft gefangen. Saussure sagt, daß sie unter allen Vierfüßlern einer gewissen Größe diejenigen sind, deren man am leichtesten habhaft werden kann. Bei den Indianern sind gefangene eine gewöhnliche Erscheinung. Auch nach Europa werden sie sehr häufig gebracht. Es kostet nicht viel Mühe, selbst wenn sie noch sehr jung sind, sie aufzuziehen. Mit Milch und Früchten lassen sie sich leicht ernähren; später reicht man ihnen Fleisch, welches sie ebenso gern gekocht wie roh verzehren. Rindfleisch scheinen sie allen anderen Fleischsorten vorzuziehen. Aus großem Geflügel und kleinen Säugethieren machen sie sich nichts, obwohl sie auch diese Nahrung nicht verschmähen. Sie sind durchaus nicht fleischgierig, sondern gern mit Pflanzennahrung zufrieden. Ganz gegen die Art anderer Raubthiere versuchen sie niemals, dem Hausgeflügel nachzustellen, und beweisen damit, daß sie sich im freien Zustande mehr von Pflanzennahrung und Kerbthieren als von dem Fleische der Wirbelthiere ernähren. An Wasser darf man die gezähmten nicht Mangel leiden lassen, sie nehmen dasselbe oft und in Menge zu sich.
Der junge Nasenbär wird selten in einem Käfige gehalten. Gewöhnlich legt man ihm ein Lederhalsband an und bindet ihn mit einem Riemen im Hof an einen Baum; bei anhaltendem Regenwetter bringt man ihn unter Dach. Dabei hat man nicht zu befürchten, daß er den Riemen, welcher ihn fesselt, zu zernagen sucht. Den größten Theil des Tages über ist er in unaufhörlicher Bewegung; nur die Mittagsstunde wie die Nacht, bringt er schlafend zu. Wenn die Hitze groß ist, ruht er der Länge nach ausgestreckt, sonst aber rollt er sich aus der Seite liegend zusammen und versteckt den Kopf zwischen den Vorderbeinen. Wirft man ihm seine Nahrung vor, so ergreift er diese erst mit den Zähnen und entfernt sich von seinem Wärter damit, soweit ihm seine Fesseln erlauben. Fleisch zerkratzt er vor dem Verzehren mit den Nägeln der Vorderfüße, Eier zerbeißt er oder zerbricht sie durch Aufschlagen gegen den Boden und lappt dann die auslaufende Flüssigkeit behaglich auf. In der Regel zerbeißt er auch Melonen und Pomeranzen, steckt jedoch zuweilen eine seiner Vorderpfoten in die Frucht, reißt ein Stück ab und bringt es mit den Nägeln zum Munde. Ein Nasenbär, welchen Bennett hielt, trank leidenschaftlich gern Blut und suchte sich an den Thieren, welche ihm zur Nahrung vorgeworfen wurden, jedesmal die blutigste Stelle aus. Außer dem Fleische fraß er sehr gern Feigen und besuchte deshalb bei seinen Ausflügen regelmäßig die Bäume, welche diese Leckerei trugen, schnupperte dann nach den reifsten von den abgefallenen herum, öffnete sie und saugte das Innere aus. Die ihm vorgeworfenen Thiere rollte er, nachdem er sie von dem Blute rein geleckt hatte, zuerst zwischen seinen Vorderhänden hin und her, riß sodann die Eingeweide aus der inzwischen geöffneten Bauchhöhle heraus und verschlang davon eine ziemliche Menge, ehe er die eigentlich fleischigen Theile seines Opfers berührte. Bei seinen Lustwandelungen im Garten wühlte er wie ein Schwein in der Erde und zog dann regelmäßig einen Wurm oder eine Kerflarve hervor, deren Vorhandensein ihm unzweifelhaft sein scharfer Geruch angezeigt hatte. Beim Trinken stülpte er die bewegliche Nase soviel als möglich in die Höhe, um mit ihr ja nicht das Wasser zu berühren.
Kein Nasenbär verlangt in der Gefangenschaft eine sorgfältige Behandlung. Ohne Umstände fügt er sich in jede Lage. Er schließt sich dem Menschen an, zeigt aber niemals eine besondere Vorliebe für seinen Wärter, so zahm er auch werden mag. Nach Affenart spielt er mit jedermann und ebenso mit seinen thierischen Hausgenossen, als mit Hunden, Katzen, Hühnern und Enten. Nur beim Fressen darf man ihn nicht stören, denn auch der zahmste beißt Menschen und Thiere, wenn sie ihm seine Nahrung entreißen wollen. In seinem Wesen hat er viel Selbständiges, ja Unbändiges. Er unterwirft sich keineswegs dem Willen des Menschen, sondern geräth in Zorn, wenn man ihm irgend einen Zwang anthut. Nicht einmal durch Schläge läßt er sich zwingen, setzt sich vielmehr herzhaft zur Wehr und beißt tüchtig, wenn er gezüchtigt wird, seinen Wärter ebensowohl wie jeden andern. Erst, wenn er so geschlagen wird, daß er die Uebermacht seines Gegners fühlt, rollt er sich zusammen und sucht seinen Kopf vor den Streichen zu schützen, indem er denselben an die Brust legt und mit seinen beiden Vorderpfoten bedeckt; wahrscheinlich fürchtet er am meisten für seine empfindliche Nase. Während der Züchtigung pfeift er stark und anhaltend (sonst vernimmt man bloß Laute von ihm, wenn er Hunger, Durst oder Langeweile hat), achtet dabei aber auf jede Gelegenheit, seinem Gegner eins zu versetzen. Gegen Hunde, welche ihn angreifen, zeigt er gar keine Furcht, sondern vertheidigt sich gegen sie noch muthvoller als gegen den Menschen. Auch unangegriffen geht er zuweilen auf fremde Hunde los und jagt sie in die Flucht.
Von einem so reizbaren, unbiegsamen Wesen läßt sich nicht viel Gelehrigkeit erwarten. Man kann den Nasenbären kaum zu etwas abrichten. Rengger sah zwar einen, welcher auf Befehl seines Herrn wie ein Pudel aufwartete und auf den nachgeahmten Knall eines Gewehres wie todt zu Boden fiel: aber so gelehrige Stücke sind Ausnahmen von der Regel. Gewöhnlich bemerkt man bald, daß es nicht viele andere Säugethiere seiner Größe gibt, welche weniger Verstand besitzen als er. In seinen Handlungen nimmt man keinen Zusammenhang wahr; sein Gedächtnis ist schwach, und er erinnert sich weder an Beleidigungen, noch an Wohlthaten, welche er erfahren, und ebensowenig an Unfälle, welche er sich zugezogen hat. Deshalb kennt er keine Gefahr und rennt nicht selten zu wiederholten Malen in die nämliche.
Wenn man ihn frei herumlaufen läßt, wird er im Hause höchst unangenehm. Er durchwühlt alles mit der Nase und wirft alle Gegenstände um. In der Nase besitzt er beträchtliche Kraft, in den Händen bedeutende Geschicklichkeit, und beides weiß er zu verwenden. Nichts läßt er unberührt. Wenn er sich eines Buches bemächtigen kann, dreht er alle Blätter um, indem er abwechselnd beide Vordertatzen unglaublich schnell in Bewegung setzt; gibt man ihm eine Cigarre, so rollt er sie durch dieselbe Bewegung gänzlich auf; sieht er etwas stehen, so versetzt er dem ihn sofort fesselnden Gegenstande erst mit der rechten, dann mit der linken Tatze einen Schlag, bis er zu Boden stürzt. Dazu kommen noch andere Unannehmlichkeiten. Der Nasenbär ist keinen Augenblick ruhig, er beißt, er gibt einen starken, unangenehmen, moschusähnlichen Geruch von sich und läßt seinen stinkenden Koth überall fallen. Bemerkenswerth erscheint, daß er mit demselben, so sorgfältig er sich auch sonst vor ihm in Acht nimmt, sich seinen Schwanz beschmiert, wenn ihn Flöhe peinigen oder er an einem juckenden Ausschlage leidet. Bennett beobachtete, daß er nicht bloß seinen Koth, sondern auch Leim und irgend einen andern klebrigen Stoff zwischen die Haare seiner buschigen Standarte einrieb. Später vergnügte er sich dann damit, den Schwanz wieder abzulecken oder ihn durch Waschen im Wasser zu reinigen.
Manche Nasenbären zeigen das lebhafteste Vergnügen, wenn sich jemand mit ihnen abgibt. Gegen Liebkosungen außerordentlich empfänglich, lassen sie sich gern streicheln und noch lieber hinter den Ohren krauen, beugen dabei den Kopf zur Erde nieder, schmiegen sich nach Katzenart an den Pfleger an und stoßen ein vergnügliches Gezwitscher aus. Weinland beobachtete, daß Nasenbären ohne eigentlich erklärlichen Grund manche Leute hassen und andere lieben. Letztere fordern sie durch ihr eigenthümliches Grunzen auf, ihnen zu schmeicheln und sie in den Haaren zu krauen, nach den ersteren hauen sie wüthend mit den Klauen und zeigen ihnen die weißen Eckzähne, sobald jene dem Käfig zu nahe kommen. Sie sind zwar schwach, aber klug genug, auch von denen, welche sie hassen, Futter anzunehmen, lassen sich aber nicht einmal durch ihre Lieblingsspeise vollständig versöhnen. Bennett erzählt, daß sein Gefangener, welcher wie ein Hund auf seinen Namen hörte, jedem Rufe Folge leistete und gewöhnlich gar nicht daran dachte, von seinen Zähnen Gebrauch zu machen, zuweilen wie unsinnig in seinem Käfige, und zwar immer im Kreise, umherlief und dabei heftig nach seinem Schwanze biß. Dann konnte sich niemand dem Käfige nähern, ohne mit Fauchen, Knurren oder lautem und mißtönendem Geschrei empfangen und mit Bissen bedroht zu werden. Setzte man ihn in Freiheit, so war er der beste Gesell von der Welt und jedermanns Freund.
»Mein zahmer Coati«, sagt Saussure, »begleitete mich monatelang auf meiner Reise. Er war an einer dünnen Schnur befestigt und versuchte niemals diese zu durchbeißen. Wenn ich ritt, hielt er sich den ganzen Tag lang auf dem Pferde im Gleichgewichte. Zu entfliehen trachtete er nicht und verursachte auch sonst keine Störung. Abends befestigte ich ihn an irgend einem Gegenstande oder ließ ihn auch wohl im Hofe frei umherlaufen. Trotz seiner Sanftheit hatte er doch immer Augenblicke von Zorn und suchte zu beißen; eine einfache Strafe aber brachte ihn zur Ruhe. Ein weibliches Thier, welches ich mir in demselben Jahre verschaffte, besaß ein noch sanfteres Wesen als das Männchen. Beide wuchsen außerordentlich schnell heran. Das Männchen zeigte schon vor seiner völligen Ausbildung Neigung zum Beißen. Sei es aus Langeweile oder sei es, daß es scherzen wollte, es suchte die Finger zu erhaschen, welche man durch die Luftlöcher steckte, und bei meiner Ausschiffung in Frankreich wurde einem Zollbeamten, welcher allzu neugierig die an einem der Löcher erscheinende fleischige Nase untersuchen wollte, der Finger blutig gebissen.
»Mehrere Monate behielt ich meine Nasenbären auf dem Lande nicht weit von Genf. Sie schienen Gefallen an der Gesellschaft des Menschen zu haben und folgten mir selbst auf Spaziergängen, indem sie sich immer rechts und links wendeten, um auf Bäume zu klettern oder Löcher in die Erde zu graben. Sie hatten ein munteres, scherzhaftes Wesen und liebten Affenstreiche. Sobald sie auf ihrem Wege einem Vorübergehenden begegneten, stürzten sie auf ihn los, kletterten ihm auf den Beinen hinauf, waren in einer Sekunde auf seiner Schulter, sprangen wieder auf die Erde zurück und flohen blitzschnell davon, entzückt, eine Eulenspiegelei ausgeführt zu haben. Da nun aber ein solches Abenteuer den meisten Vorübergehenden mehr lästig als angenehm war, so sah ich mich bald genöthigt, meinen Nasenbären das freie Umherlaufen zu versagen. Uebrigens wurde dies Tag für Tag nöthiger; denn je mehr sie die Freiheit kennen lernten, umso weniger schienen sie sich um ihren Herrn zu bekümmern. Sie gingen überaus gern spazieren, aber je weiter sie sich entfernt hatten, desto weniger wollte ihnen die Rückkehr gefallen, und ich war oft genöthigt, sie aus einer Entfernung von einer Viertelmeile holen zu lassen.
»Man hielt sie nun an langen Schnuren auf einer Wiese, und sie belustigten sich damit, die Erde aufzukratzen und nach Kerfen zu suchen, dachten aber auch jetzt nicht daran, die Schnur zu durchbeißen. Dies war im Sommer, und sie hatten also nichts von der Kälte zu leiden. Leider hörten Kinder und Neugierige nicht auf, sie mit Stöcken zu reizen, und so zerstörten sie in ihnen das wenige Gute, welches überhaupt noch vorhanden war. Nachdem die Thiere zwei Monate in freier Luft gelebt hatten, begannen sie, uns erst recht zu schaffen zu machen. Manchmal machten sie sich doch los und liefen ins Weite; nun mußte man sich aufmachen, um sie zu suchen. Am häufigsten fand man sie auf den großen Bäumen der benachbarten Dörfer. Einige Male verwickelte sich die Schnur, welche sie nachschleppten, schnürte ihnen den Hals ein und man fand sie dann halb ohnmächtig oben hängen. Noch immer waren sie gegen ihre Wärter leidlich zahm. So verbrachten sie oft mehrere Stunden mit Schlafen und Spielen auf dem Schoße einer Frau, welche vor ihnen keine Furcht hatte und sie auch nicht mit Drohungen erschreckte, ihnen überhaupt sehr gewogen war. Nach und nach nahm das Männchen aber einen immer schlimmeren Charakter an: sowie man es angriff, biß es. Da man nun sah, daß dies gefährlich werden konnte, sperrte man es mit seinem Weibchen in ein leeres und vollkommen abgeschlossenes Zimmer ein. Am nächsten Morgen war kein Coati zu sehen, noch zu hören: sie waren in das Kamin geklettert und vom Dache aus an einem kanadischen Weinstocke heruntergestiegen. Nachdem sie im Dorfe herumgelaufen waren, begegneten sie noch vor Tagesanbruch einer alten Frau, welcher sie auf den Rücken sprangen. Die Unglückliche, welche nicht wußte, wie ihr geschah, stieß sie, indem sie sich von ihnen befreien wollte. Sie sprangen nun zwar weg, brachten ihr aber doch in aller Schnelligkeit noch mehrere bedeutende Bisse bei. Am Morgen fand man sie in einem Gebüsche. Das Männchen, nicht damit zufrieden, auf den Ruf seines Wärters nicht gekommen zu sein, leistete sogar beim Fangen noch großen Widerstand. Es wurde nun mit jedem Tage schwieriger, sie frei laufen zu lassen, und ich beschloß klüglich, sie in einen großen Käfig zu setzen, um neuen Unglücksfallen vorzubeugen. Dieser Käfig wurde in den Stall gestellt, aber die Pferde wurden unruhig und schlugen während der ganzen Nacht aus.
»Da nun die Winterkälte vor der Thür war, und ich meine Coatis nicht im Stalle halten konnte, war ich unentschieden, was ich machen sollte, bis ein neuer Fall mich aus der Unentschlossenheit riß. Das Männchen nämlich mißbrauchte eines Tages die Freiheit, welche man ihm von Zeit zu Zeit gewährte, und entfloh. Mein Bedienter fand es am Ufer des Sees, gerade damit beschäftigt, die Kiesel umzuwenden. Bei seiner Ankunft sprang der Coati zur Seite und stieß sein gewöhnliches ärgerliches Zwitschern aus. Man war gewöhnt, die Coatis immer am Schwanze zu fangen, weil sie diesen gerade in die Höhe halten und, wenn man sie dann mit ausgestrecktem Arme trägt, nicht im Stande sind, sich aufzurichten. So gab man ihnen keine Gelegenheit, ihre Krallen und Zehen zu benutzen, und wenn man sie nachher wieder aus den Boden setzte, zeigten sie gewöhnlich gar keinen Groll. Mein Bedienter, welcher unseren Flüchtling auf dieselbe Weise gepackt hatte, hielt ihn aber dieses Mal nicht weit genug von seinem Körper ab, und es gelang dem Thiere, diesen zu erreichen und sich emporzuheben. Jetzt zeigte es einen heftigen Zorn. Gegen seine Gewohnheit ließ es sich nicht in den Armen seines Wärters tragen, sondern befreite sich mit Lebhaftigkeit und grub ihm die scharfen Zähne in den Hals ein, wodurch er ihm zwei schreckliche Wunden beibrachte. Einen Augenblick nachher schien es diese That zu bereuen und ließ sich ruhig wegtragen. Ein so großer Unfall brachte mich zu dem Entschlusse, mich der Thiere zu entledigen, und da ich nicht wußte, wie ich sie an einen Thiergarten gelangen lassen konnte, beschloß ich ihren Tod.
»Aus dem Angegebenen geht die große Beweglichkeit ihres geistigen Wesens hervor. Sie liebten es, sich in der Wonne der Liebkosung zu verlieren, aber sie beschränkten sich darauf, dieselbe zu empfangen, und sie wußten sie nicht anders zurückzugeben, als daß sie den Leuten plump auf Rücken und Schulter sprangen, mehr zum Zeitvertreib als aus Freundschaft.«
Die dritte Unterfamilie wird gebildet durch die Baumbären ( Cercoleptina ), kleine oder höchstens mittelgroße, meist gestreckt gebaute Glieder der Gesammtheit, mit langem, in der Regel greiffähigem Schwanze, kurzen, gekrümmten Zehen und mehr oder weniger einziehbaren Krallen, weshalb die Füße an die der Katzen erinnern. Im Gebisse sind gewöhnlich nur fünf Backenzähne in jedem Kiefer vorhanden, da auch bei der einen Art, welche sechs Backenzähne hat, einer auszufallen pflegt; drei von ihnen entsprechen den Lückzähnen, die beiden übrigen sind Mahlzähne.
Es ist noch nicht allzu lange her, daß ein Thierführer in Paris mit Fug und Recht erklären konnte, er zeige ein den Naturforschern noch unbekanntes Thier, welches er aus Amerika erhalten habe. Um dieselbe Zeit, im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts, kam dasselbe Thier auch nach London und beschäftigte hier die Naturforscher ebenso eifrig wie in Paris. Dieses räthselhafte Geschöpf war ein Wickelbär, welchen man damals wirklich so gut wie gar nicht kannte. Oken glaubt zwar, daß schon Hernandez den Wickelbären meint, wenn er von seinem Baumwiesel oder »Ouauh-Tenzo« spricht; doch sind die Angaben zu dürftig, als daß wir sie mit Sicherheit benutzen könnten. Erst Alexander von Humboldt hat uns genauere Nachrichten gegeben. Vor der Zeit seiner Forschungen hat kein Thier den Naturforschern so viel Schwierigkeiten verursacht als gerade unser Wickelbär. Einige sahen ihn für einen Lemur an und nannten ihn deshalb Lemur flavus ; andere glaubten in ihm, das von den Halbaffen gänzlich abweichende Gebiß beachtend, eine Schleichkatze zu erblicken und gaben ihm den Namen mexikanisches Wiesel ( Viverra caudivolvula ); doch wollte auch hier der Wickelschwanz nicht recht passen, und zeigte das Gebiß, welches sich namentlich durch die stumpfen Kauzähne auszeichnet und auf gemischte Nahrung deutet, wenig übereinstimmendes. Endlich brachte man ihn mit anderen, nicht minder eigenthümlichen Geschöpfen in der Bärenfamilie unter.
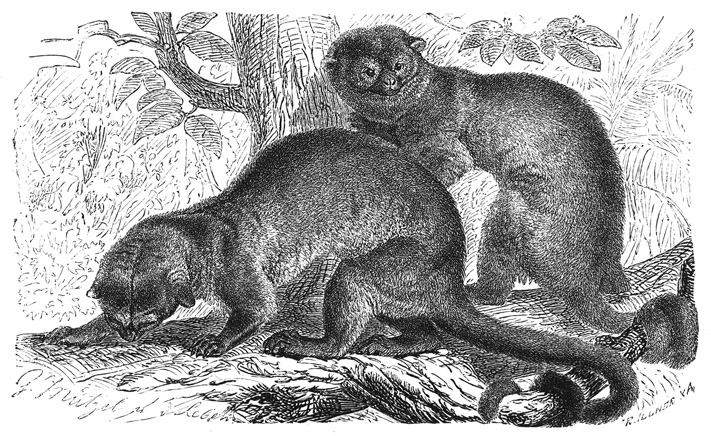
Wickelbär ( Cercoleptes caudivolvulus). ¼ natürl. Größe.
Der Wickelbär, Kinkaju, Hupurá, Manaviri oder Cuchumbi, wie das Thier in seiner Heimat, dem nördlichen Brasilien, genannt wird, erscheint gleichsam als Mittelglied zwischen Bär und Marder, wie der Coati als solches zwischen Bär und Schleichkatze oder der Waschbär als solches zwischen Bär und Affe betrachtet werden kann. Der sehr gestreckte, aber plumpe Leib steht auf niederen Beinen; der Kopf ist ungemein kurz, dick und sehr kurzschnäuzig; die Augen sind mäßig groß, die Ohren klein, die fünf Zehen halb verwachsen und mit starken Krallen bewehrt, die Sohlen nackt. Der mehr als körperlange Schwanz ist ein ebenso vollkommener Wickelschwanz wie der mancher Beutelthiere oder der Brüllaffen. Erwachsen, mißt der Wickelbär ( Cercoleptes caudivolvulus , Viverra, Ursus und Potos caudivolvulus, C. brachyotus, Caudivolvulus und Lemur flavus) 90 Centim., wovon 47 Centim. auf den Schwanz kommen, bei 17 Centim. Schulterhöhe. Die sehr dichte, ziemlich lange, etwas gekrauste, weiche, sammetartig glänzende Behaarung ist auf der Ober- und Außenseite licht graulichgelb nut einem schwachröthlichen Anfluge und schwarzbraunen Wellen, welche namentlich am Kopfe und am Rücken deutlich hervortreten, das einzelne Haar an der Wurzel grau, sodann gelblichröthlich und an der Spitze schwarzbraun. Vom Hinterhaupte zieht sich ein breiter und sicher begrenzter, dunkler Streifen längs des Rückgrates bis zur Schwanzwurzel. Die Unterseite ist röthlichbraun, gegen den Bauch hin lichter, die Außenseite der Beine schwarzbraun. Auch über die Mitte des Bauches verläuft ein dunkelrostbrauner Streifen. Der Schwanz ist an der Wurzel braun, in der letzten Hälfte fast schwarz.
Gegenwärtig wissen wir, daß der Wickelbär weit verbreitet ist. Er findet sich im ganzen nördlichen Brasilien, in Neugranada, Peru, Guayana, Mejiko, ja noch im südlichen Luisiana und Florida. Nach Humboldt ist er besonders am Rio Negro und in Neugranada häufig. Er lebt in den Urwäldern, zumal in der Nähe von großen Flüssen, und zwar auf Bäumen. Seine Lebensweise ist eine vollkommen nächtliche; den Tag verschläft er in hohlen Bäumen, des Nachts aber zeigt er sich sehr lebendig und klettert außerordentlich gewandt und geschickt in den hohen Baumkronen umher, seiner Nahrung nachgehend. Dabei leistet ihm sein Wickelschwanz vortreffliche Dienste. Er gibt kaum einem Affen an Klettergewandtheit etwas nach. Alle seine Bewegungen sind äußerst behend und sicher. Er kann sich mit den Hinterfüßen oder mit dem Wickelschwanze an Aesten und Zweigen festhalten und so gut an einen Baum klammern, daß er mit dem Kopfe voran zum Boden herabzusteigen vermag. Beim Gehen tritt er mit der ganzen Sohle auf.
»Eines Nachts«, erzählt Bates, »schliefen wir vor dem Hause einer eingeborenen Familie, welche mitten in den Wäldern sich angesiedelt hatte, uns aber wegen einer Festlichkeit nicht in der Hütte selbst beherbergen konnte. Als nach Mitternacht alles still geworden war, lenkte Geräusch meine Blicke auf eine aus den Wäldern kommende Gesellschaft von schlanken, langgeschwänzten Thieren, welche, im klaren Mondlichte gegen den reinen Himmel deutlich erkennbar, mit flugähnlichen Sprüngen von einem Zweige zum anderen setzten. Viele von ihnen hielten sich auf einer Papunhapalme auf, und bald bewies das Drängen, Zwitschern und Kreischen sowie das Fallen von Früchten, mit was sie hier beschäftigt waren. Ich hielt die Thiere zuerst für Nachtaffen, bis mich am nächsten Morgen der Hauseigenthümer durch ein von ihm gefangenes Junge der nächtlichen Gesellen belehrte, daß ich es mit Wickelbären zu thun gehabt hatte.«
Obwohl vorzugsweise Pflanzenfresser, verschmäht der Wickelbär doch auch kleine Säugethiere, Vögel und deren Eier oder Kerbthiere und deren Larven nicht. Dem Honig soll er mit besonderer Liebhaberei nachstellen und viele wilde Bienenstöcke zerstören; er wird deshalb von den Indianern gehaßt und hat von den Missionaren den Namen oso meloro ( Honigbär) erhalten. Zur Ausbeutung der Bienenstöcke soll er seine merkwürdig lange und vorstreckbare Zunge, mit welcher er in die schmälste Ritze, in das kleinste Loch greifen und die dort befindlichen Gegenstände herausholen kann, benutzen, sie durch die Fluglöcher der Bienen bis tief in den Stock stecken, mit ihr die Waben zertrümmern und dann den Honig auflecken.
Ueber die Fortpflanzung des sonderbaren Gesellen wissen wir noch gar nichts; doch schließt man aus seinen zwei Zitzen, daß er höchstens zwei Junge werfen kann. In der Gefangenschaft hat er meines Wissens noch nirgends sich fortgepflanzt.
Alle, welche den Wickelbären bis jetzt beobachteten, stimmen darin überein, daß er dem Menschen gegenüber sanft und gutmüthig ist und sehr bald sich ebenso zutraulich und schmeichelhaft zeigt wie ein Hund, Liebkosungen gern annimmt, die Stimme seines Herrn erkennt und die Gesellschaft desselben aufsucht. Er fordert seinen Pfleger geradezu auf, mit ihm zu spielen oder mit ihm sich zu unterhalten, und gehört deshalb in Südamerika zu den beliebtesten Hausthieren der Eingeborenen. Auch in der Gefangenschaft schläft er fast den ganzen Tag. Er deckt dabei seinen Leib, vor allem aber den Kopf, mit dem Schwanze zu. Legt man ihm Nahrung vor, so erwacht er wohl, bleibt aber bloß so lange munter, als er frißt. Nach Sonnenuntergang wird er wach, tappt anfangs mit lechzender Zunge unsicheren Schrittes umher, späht nach Wasser, trinkt, putzt sich und wird nun lustig und aufgeräumt, springt, klettert, treibt Possen, spielt mit seinem Herrn, läßt das sanfte Pfeifen ertönen, aus welchem seine Stimme besteht, oder knurrt kläffend wie ein junger Hund, wenn er erzürnt wird. Oft sitzt er auf den Hinterbeinen und frißt wie die Affen mit Hülfe der Tatzen, wie er überhaupt in seinem Betragen ein merkwürdiges Gemisch von den Sitten der Bären, Hunde, Affen und Zibetthiere zur Schau trägt. Auch seinen Wickelschwanz benutzt er nach Affenart und zieht mit ihm Gegenstände an sich heran, welche er mit den Pfoten nicht erreichen kann. Gegen das Licht sehr empfindlich, sucht er schon beim ersten Tagesdämmern einen dunkeln Ort auf, und sein Augenstern zieht sich zu einem kleinen Punkte zusammen. Reizt man das Auge durch vorgehaltenes Licht, so gibt er sein Mißbehagen durch eine eigenthümliche Unruhe in allen seinen Bewegungen zu erkennen. Er frißt alles, was man ihm reicht: Brod, Fleisch, Obst, gekochte Kartoffeln, Gemüse, Zucker, eingemachte Sachen, trinkt Milch, Kaffee, Wasser, Wein, sogar Branntwein, wird von geistigen Getränken betrunken und mehrere Tage krank. Ab und zu greift er auch einmal Geflügel an, tödtet es, saugt ihm das Blut aus und läßt es liegen. Nach recht lebhafter Bewegung nießt er zuweilen öfters hintereinander. Im Zorne zischt er wie eine Gans und schreit endlich heftig. So zahm er auch wird, so eifrig ist er bedacht, seine Freiheit wieder zu erlangen. Ein alter Wickelbär, welchen Humboldt besaß, entfloh während der Nacht in einen Wald, erwürgte aber noch vorher zwei Felsenhühner, welche zu der Thiersammlung des großen Forschers gehörten, und nahm sie gleich als Nahrungsmittel für die nächste Zeit mit sich fort.
Ich kann vorstehende Schilderung, welche im wesentlichen Humboldt nacherzählt ist, durchaus bestätigen. Der Wickelbär kommt neuerdings nicht gerade selten lebend zu uns herüber, und ich habe somit vielfach Gelegenheit gehabt, ihn zu beobachten. Beim Schlafen liegt er zusammengerollt auf der Seite, den Rücken nach dem Lichte gekehrt. Gegen Abend, immer ungefähr zu derselben Zeit, wird er munter, dehnt und reckt sich, gähnt und streckt dabei die Zunge lang aus dem Maule heraus. Dann tappt er geraume Zeit bedächtig und sehr langsam im Käfige umher. Sein Gang ist eigenthümlich und entschieden ungeschickt. Er setzt seine krummen Dachsbeine soweit nach innen, daß er den Fuß der einen Seite beim Ausschreiten fast, oft wirklich, über den der anderen wegheben muß. Den Wickelschwanz benutzt er fortwährend. Zuweilen hält er sich mit ihm und den beiden Hinterfüßen frei an einem Aste, den Leib wagerecht vorgestreckt. Er frißt alles genießbare, am liebsten Früchte, gekochte Kartoffeln und gesottenen Reis. Wenn ich ihm einen kleinen Vogel vorwerfe, naht er sich höchst bedächtig, beschnuppert ihn sorgfältig, beißt dann zu und hält den erfaßten beim Fressen mit beiden Vorderfüßen fest. Er frißt langsam und, ich möchte so sagen, liederlich, zerreißt und zerfetzt die Nahrung, beißt auch, anscheinend mit Mühe, immer nur kleine Stücken von ihr ab und kaut diese langsam vor dem Verschlingen. Eigentlich blutgierig ist er nicht, obgleich er seine Raubthiernatur nicht verleugnet.
Schwer dürfte es halten, einen gemüthlicheren Gesellen als ihn zum Hausgenossen zu finden. Er ist hingebend wie ein Kind. Liebkosungen machen ihn glücklich. Er schmiegt sich zärtlich dem an, welcher ihm schmeichelt, und scheint durchaus keine Tücke zu besitzen. Unwillig wird er nur dann, wenn man ihn ohne weiteres aus seinem süßesten Schlafe weckt. Ermuntert man ihn durch Anrufen und läßt ihm Zeit zum Wachwerden, so ist er auch bei Tage das liebenswürdige Geschöpf wie immer.
Mehrere Wickelbären vertragen sich ausgezeichnet zusammen. Von den ewigen Streitigkeiten, wie sie unter Nasenbären an der Tagesordnung sind, bemerkt man bei ihnen nichts. Männchen und Weibchen behandeln einander ungemein zärtlich. Zu einem Weibchen, welches ich pflegte, ließ ich ein neu erworbenes, noch etwas ängstliches Männchen bringen. Jenes war, unter meiner Pflege wenigstens, mit keinem anderen Thiere vereinigt gewesen, schien daher sehr überrascht zu sein, Gesellschaft zu erhalten. Eine höchst sorgfältige, anfangs etwas ängstliche Beschnupperung unterrichtete es nach und nach von dem ihm bevorstehenden Glück. Sobald es den Genossen erkannt hatte, überhäufte es ihn verführerisch mit Zärtlichkeiten. Der Ankömmling schien noch unerfahren zu sein und bekundete anfänglich mehr Furcht als Entgegenkommen, kreischte auch heiser auf, so oft das Weibchen liebkosend ihm sich näherte. Dieses aber ließ sich nicht abweisen. Es begann zunächst, den spröden Schäfer zu belecken, drängte sich zwischen ihn und das Gitter, an welchem er sich angeklammert hatte, rieb sich an ihm, umhalste ihn plötzlich und leckte ihn küssend am Maule. Noch immer benahm sich der Geliebkoste zurückhaltend, wehrte zumal die Küsse ab, indem er den Kopf nieder, mit dem Gesicht gegen die Brust bog, und bot dem Weibchen so nur das Ohr, welches dieses, sich vorläufig begnügend, leckte. Das Männchen ließ solches gutwillig geschehen, änderte sein Benehmen aber nicht. Endlich riß dem Weibchen der Geduldsfaden: es packte plötzlich den Kopf des Genossen, krallte die Pfotenhand fest ein in das rauhsammtene Haar, zog ihn in die Höhe, legte ihm den anderen Arm umhalsend in den Nacken und liebkoste ihn nunmehr so lange, bis er alle Scheu verloren zu haben und gutwillig in das Unvermeidliche sich zu fügen schien. Dieser Hergang wurde durch Pausen unterbrochen, welche nach jeder Abweisung seitens des Männchens eintraten. Während derselben verließ das Weibchen manchmal den Genossen, durchkletterte rasch den Käfig, stieg an dem in ihm befindlichen Baumstamme in die Höhe und sprang sodann geraume Zeit auf einem wagerechten Aste hin und her, wie Marder zu thun pflegen. Als das Einvernehmen endlich hergestellt worden war, umschlangen sich beide Thiere, förmlich sich verknäuelnd, und nahmen die wunderlichsten Stellungen au. Am nächsten Tage wurde das Lager noch nicht getheilt; wenige Tage später aber schliefen beide nur in inniger Umarmung zusammen. Bald begannen auch anmuthige Spiele, bei denen sie derartig sich umschlangen, daß man den einen von dem anderen nicht zu unterscheiden vermochte. Kugelnd wälzten sie sich auf dem Boden umher, umfaßten und umhalsten sich, bissen sich spielend und benutzten den Wickelschwanz in ausgiebigster Weise, bald als Angriffs-, bald als Befestigungswerkzeug. Meine Hoffnungen, sie zur Paarung schreiten zu sehen, erfüllten sich jedoch nicht, warum, vermag ich nicht zu sagen, da ihren Bedürfnissen anscheinend in jeder Hinsicht Rechnung getragen wurde.
Eine zweite Sippe der Unterfamilie vertritt der Binturong ( Arctitis Binturong, Viverra Binturong, Arctitis penicillatus, Ictides ater, Paradoxurus und Ictides albifrons), in den Augen einzelner Forscher eine Schleichkatze, nach Ansicht anderer ein Mittelglied zwischen dieser und dem Bär, von dem Wickel- und Katzenbär, seinen nächsten Verwandten, abweichend durch das Gebiß, in welchem der erste Lückzahn auszufallen pflegt. An Größe übertrifft der Binturong seine Verwandten: seine Länge beträgt 1,25 bis 1,3 Meter, wovon etwas mehr als die Hälfte, 63 Centim., auf den sehr langen Wickelschwanz kommt. Der Leib ist kräftig, der Kopf dick, die Schnauze verlängert; die Beine sind kurz und stämmig, die Füße nacktsohlig, fünfzehig, mit ziemlich starken, nicht einziehbaren Krallen bewehrt. Ein dichter, ziemlich rauhhaariger, lockerer Pelz bekleidet den Leib. Das Haar bildet an den kurzen, abgerundeten Ohren Pinsel, ist aber auch am Leibe und besonders am Schwanze auffallend lang, überhaupt nur an den Gliedern kurz. Dicke, weiße Schnurren zu beiden Seiten der Schnauze umgeben das Gesicht wie mit einem Strahlenkranze. Die Färbung ist ein mattes Schwarz, welches auf dem Kopfe ins Grauliche, an den Gliedmaßen ins Bräunliche übergeht; die Ohrränder und Augenbrauen sehen weißlich aus. Das Weibchen soll grau, das Junge gelblich aussehen, weil die Spitzen der übrigens schwarzen Haare die entsprechenden Färbungen zeigen.
Sumatra, Java, Malakka, Butan und Nepal sind, soweit bis jetzt bekannt, die Heimat dieses wirklich schönen Thieres. Major Farquhar entdeckte es, Raffles beschrieb es zuerst; spätere Reisende sandten Bälge, einige Thierfreunde und Händler in der letzten Zeit auch lebende Stücke nach Europa. Von seinem Freileben wissen wir nichts, über sein Gefangenleben nicht viel. An drei Stücken, von denen ich eines pflegte, beobachtete ich etwa folgendes.
Der Binturong ähnelt dem Wickelbär hinsichtlich seines Wesens; denn auch er ist ein stiller, sanfter und gemächlicher Gesell, vorausgesetzt natürlich, daß er jung in gute Pflege kam. Obwohl Nachtthier, zeigt er sich doch auch bei Tage zuweilen munter und rege. Seine Bewegungen geschehen langsam und bedächtig, die kletternden stets mit Hülfe des Schwanzes, welcher zwar kein vollständiger Wickelschwanz ist, aber doch als solcher gebraucht wird, indem das Thier mit ihm sich festhält, Aeste und Zweige leicht umschlingend, und die Schlinge sodann lockernd, ohne sie zu lösen, beziehentlich ohne den Halt zu lassen, da die Schwanzschlinge nach und nach mehr nach der Schwanzspitze hin verlegt wird. Erst wenn letztere von dem Aste abgleitct, greift der Binturong langsam weiter und verfährt wie vorher. Seine Stimme ähnelt dem Miauen der Hauskatze. Unter seinen Sinnen scheinen Geruch und Gefühl oder Tastsinn obenan zu stehen; er beschnuppert jeden Gegenstand lange und genau und gebraucht seine Schnurrhaare thatsächlich als empfindliche Taster. In seinem Wesen spricht sich weder Raublust noch Mordsucht aus. Er ist ein Fruchtfresser, welcher Pflanzennahrung thierischen Stoffen jeder Art entschieden vorzieht und im Käfige bei einfacher Pflanzenkost recht gut ausdauert.

Binturong ( Arctitis Binturong). [1/7] natürl. Größe.
Auch das letzte hier zu erwähnende Mitglied der Bärenfamilie, der Panda oder Katzenbär ( Ailurus fulgens, A. ochraceus), vertritt eine besondere Sippe und nimmt gewissermaßen eine Mittelstellung zwischen Katze und Waschbär ein. Sein Leib erscheint wegen des dichten und weichen Pelzes plumper als er ist; der langbehaarte Kopf ist sehr kurz und fast katzenartig, die Schnauze kurz und breit, der lange Schwanz schlaff und buschig behaart, daher sehr dick; die Ohren sind klein und gerundet, die Augen klein; die niederen Beine haben dichtbehaarte Sohlen und kurze Zehen mit starkgekrümmten, spitzigen, halbeinziehbaren Krallen. In der Größe kommt der Panda ungefähr einem starken Hauskater gleich: seine Leibeslänge beträgt 50, die des Schwanzes 35 und die Höhe am Widerriste 25 Centim. Die Behaarung ist dicht, weich, glatt und sehr lang, auf der Oberseite lebhaft und glänzend dunkelroth gefärbt, auf dem Rücken lichtgoldgelb angeflogen, weil hier die Haare in gelbe Spitzen enden; die Unterseite und die Beine mit Ausnahme einer dunkelkastanienrothen Querbinde über Außen- und Vorderseite sind glänzend schwarz, die Kinn- und die langen Wangenhaare weiß, nach rückwärts rostgelblich; Stirn und Scheitel spielen ins Rostgelbe; eine rostrothe Binde verläuft unterhalb der Augen zum Mundwinkel und trennt die weiße Schnauze von den Wangen; die Ohren sind außen mit schwarzrothen, innen mit langen weißen Haaren besetzt; der Schwanz ist fuchsroth, mit undeutlichen, lichteren, schmalen Ringen.
Die Heimat des Panda ist das Gebirgsland südlich vom Himalaya, zwischen Nepal und den Schneebergen. Hier lebt er in Wäldern zwischen 2000 bis 3000 Meter über dem Meere, am liebsten auf Bäumen in der Nähe von Flüssen und Alpenbächen. Die Botihs nennen ihn Wuk-Dongka des Liptschas Sunkum, die Nepalesen Wah. Alle Bergvölker scheinen ihn seines von ihnen vielfach benutzten Felles halber zu verfolgen; vielleicht ißt man auch, trotz des starken Moschusgeruches, den das gereizte Thier verbreitet, sein Fleisch.
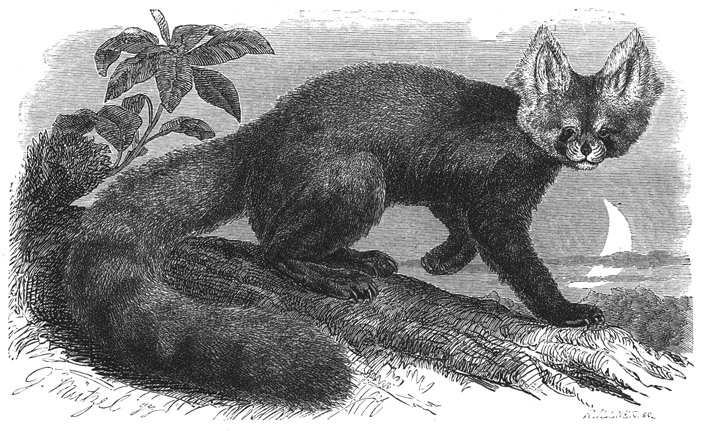
Panda ( Allurus fulgens). 1/4 natürl. Größe.
Ueber das Freileben des ebenso schönen als zierlichen Geschöpfes mangelt jede Kunde; dagegen haben wir neuerdings über sein Betragen in der Gefangenschaft Bericht erhalten. Simpson brachte einen Panda, den überlebenden von drei Stücken, mit sich nach London, woselbst das Thier unter Bartletts Pflege geraume Zeit lebte und von ihm und anderen beobachtet wurde. »In seiner Erscheinung«, schreibt Anderson, »erinnert der Panda ungemein an den Waschbären. Jede Bewegung ist bärenmäßig: er geht (mit gerade ausgestrecktem Schwanze), sitzt auf dem Hintertheile, arbeitet mit seinen Branten, klettert, ereifert sich und schreit in derselben Weise wie ein Bär.« Die Stimme bezeichnet Simpson als höchst eigenthümlich. »Erzürnt«, sagt er, »erhebt sich der Panda auf die Hinterbeine, ganz wie ein Bär, und stößt einen Laut aus, welchen man leicht nachahmen kann, indem man den Mund öffnet und in rascher Folge Luft durch die Nase zieht. Der gewöhnliche Schrei aber ist von diesem Schnarchen durchaus verschieden und ähnelt dem Zwitschern eines Vogels, da er aus einer Reihe kurzer Pfiffe besteht.« Mehr noch als alle übrigen Bären scheint der Panda Pflanzenfresser zu sein; wenigstens gelang es Simpson nie, ihm Fleisch beizubringen. Die gefangenen Katzenbären fraßen Blätter und Knospen, Früchte und dergleichen, weideten Gras und Bambusspitzen ab, und nahmen gekochten Milchreis oder auch mit Zucker versüßte Milch zu sich.
Bartlett übernahm den in London glücklich angelangten Panda in einem überaus traurigen Zustande, verkommen, beschmutzt von Unrath, krank, unfähig zu stehen und nur im Stande, kriechend sich fortzubewegen. Milch, gekochter Reis und Gras war das Futter des Thieres während der Seereise und wohl die Hauptursache seiner Verkommenheit gewesen; der erfahrene Pfleger beschloß also, zunächst die Nahrung zu ändern. Rohes und gekochtes Hühner- und Kaninchenfleisch wurde vorgesetzt, aber verschmäht, ein Gemisch von Arrowwurzel, Eidotter und mit Zucker versüßter Milch dagegen genommen, ebenso später süßer Thee mit eingerührtem Erbsen- und Maismehl. Bei solchem täglich verändertem Futter besserte sich das Befinden, und Bartlett durfte es wagen, den Panda unter Aufsicht ins Freie zu bringen. Sofort fiel dieser hier über Rosenstöcke her, verzehrte einige Blätter und die zarten Schößlinge mit Behagen, las unreife Aepfel auf, pflückte sich verschiedene Beeren ab und verspeiste auch diese. Bartletts Befürchtung, daß solche Nahrung schaden könne, erwies sich als unbegründet; das Befinden des Panda besserte sich im Gegentheile zusehends. Der alte verdorbene Pelz wurde nach einigen Bädern gelockert, abgekratzt und abgeschabt, und ein neues, prächtiges Kleid deckte und schmückte bald das bei dem ihm natürlichen Futter rasch erstarkte Thier. Doch bekundete der Panda durchaus keine Dankbarkeit für so ausgezeichnete Pflege, blieb vielmehr stets reizbar, stellte sich bei versuchter Annäherung sofort in Fechterstellung und hieb mit den Vorderfüßen nach Katzenart um sich, dabei die bereits erwähnten Laute ausstoßend.
Verglichen mit seinen Familiengenossen kommt der Panda dem Wickelbären am nächsten. Ihm ähnelt er in seinen Bewegungen, seinem Gehen, Laufen, Klettern und in der Art und Weise des Fressens. Der Kinkaju übertrifft ihn jedoch bei weitem an Beweglichkeit und scheint auch in geistiger Hinsicht merklich höher entwickelt zu sein.