
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Reicher an Arten und Formen als die Gruppe der Schleichkatzen ist die Familie der Marder ( Mustelidae). Es hält sehr schwer, eine allgemein gültige Beschreibung derselben zu geben; der Leibesbau, das Gebiß und die Fußbildung schwanken mehr als bei allen übrigen Fleischfressern, und man kann deshalb nur sagen, daß die Mitglieder der Abtheilung mittelgroße oder kleine Raubthiere sind, deren Leib sehr gestreckt ist und auf sehr niedrigen Beinen ruht, und deren Füße vier oder fünf Zehen tragen. In der Nähe des Afters finden sich ebenfalls Drüsen wie bei den meisten Schleichkatzen; niemals aber sondern sie einen wohlriechenden Stoff ab wie jene, vielmehr gehören gerade die ärgsten Stänker den Mardern an. Die Behaarung des Leibes ist gewöhnlich eine sehr reichliche und feine, und deshalb finden wir in unserer Familie die geschätztesten aller Pelzthiere.
Das Geripp zeichnet sich durch zierliche Formen aus. Elf oder zwölf rippentragende Wirbel umschließen die Brust, acht oder neun bilden den Lendentheil, drei, welche gewöhnlich verwachsen, das Kreuzbein und zwölf bis sechsundzwanzig den Schwanz. Das Schulterblatt ist breit, das Schlüsselbein fehlt regelmäßig. Im Gebisse sind die Eckzähne sehr entwickelt, lang, stark und häufig schneidend an der Kante, die Lückzähne scharf und spitz; der untere Fleischzahn ist zweizackig, der obere durch einen Zacken und einen Höcker ausgezeichnet. Die Krallen sind nicht zurückziehbar.
Die Marder traten zuerst, aber nur einzeln, in der Tertiärzeit auf. Gegenwärtig bewohnen sie alle Erdtheile mit Ausnahme von Australien, alle Klimate und Höhengürtel, die Ebenen wie die Gebirge. Ihre Aufenthaltsorte sind Wälder oder felsige Gegenden, aber auch freie, offene Felder, Gärten und die Wohnungen der Menschen. Die einen sind Erdthiere, die anderen bewohnen das Wasser; jene können gewöhnlich auch vortrefflich klettern, und alle verstehen zu schwimmen. Viele graben sich Löcher und Höhlen in die Erde oder benutzen bereits vorhandene Baue zu ihren Wohnungen; andere bemächtigen sich der Höhlen in Bäumen oder auch der Nester des Eichhorns und mancher Vögel: kurz man kann sagen, daß diese Familie fast alle Oertlichkeiten zu benutzen weiß, von der natürlichen Steinkluft an bis zur künstlichen Höhle, vom Schlupfwinkel in der Wohnung des Menschen bis zu dem Gezweige oder Gewurzel im einsamsten Walde. Die meisten haben einen festen Wohnsitz; viele schweifen aber auch umher, je nachdem das Bedürfnis sie hierzu antreibt. Einige, welche den Norden bewohnen, verfallen in Winterschlaf, die übrigen bleiben während des ganzen Jahres in Thätigkeit.
Fast sämmtliche Marder sind in hohem Grade behende, gewandte, bewegliche Geschöpfe und in allen Leibesübungen ungewöhnlich erfahren. Beim Gehen treten sie mit ganzer Sohle auf, beim Schwimmen gebrauchen sie ihre Pfoten und den Schwanz, beim Klettern wissen sie sich, trotz ihrer stumpfen Krallen, äußerst geschickt anzuklammern und im Gleichgewichte zu erhalten. Ihre Bewegungen stehen selbstverständlich mit ihrer Gestalt vollständig im Einklange. Zobel und Edelmarder z. B. bewegen sich beim Springen in kühn aufgerichteter Haltung, während der ihnen so nah verwandte Steinmarder sich schon viel geduckter hält und mehr schleicht, der Iltis fast nach Art einer Ratte, das Wiesel mäuseartig flink über den Boden huscht, der Fischotter langsam aalartig gleitet, der Vielfraß in Bogen rollend sich fortwälzt, die Tayra mit sprenkelkrummgebogenem Rücken sich fortschnellt, der Dachs bedächtig trabt, der Honigdachs noch lässiger fortgeht, ich möchte sagen »bummelt«. Je höher die Beine, um so kühner die Sätze, je niedriger, um so behender und rennender der Gang, beziehentlich um so fischähnlicher die Bewegung im Wasser. Unter den Sinnen der Marder scheinen Geruch, Gehör und Gesicht auf annähernd gleichhoher Stufe zu stehen; aber auch Geschmack und Gefühl dürfen als wohlentwickelt bezeichnet werden. Ebenso ausgezeichnet wie ihre Leibesbegabungen sind die geistigen Fähigkeiten. Der Verstand erreicht bei den meisten Arten eine hohe Ausbildung. Sie sind klug, listig, mißtrauisch und behutsam, äußerst muthig, blutdürstig und grausam, gegen ihre Jungen aber ungemein zärtlich. Die einen lieben die Geselligkeit, die anderen leben einzeln oder zeitweilig paarweise. Viele sind bei Tag und bei Nacht thätig; die meisten müssen jedoch als Nachtthiere angesehen werden. In bewohnten und belebten Gegenden gehen alle nur nach Sonnenuntergang auf Raub aus. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Thieren, namentlich in kleinen Säugethieren, Vögeln, deren Eiern, Lurchen und Kerbthieren. Einzelne fressen Schnecken, Fische, Krebse und Muscheln; manche verschmähen nicht einmal das Aas, und andere nähren sich zeitweilig auch von Pflanzenstoffen. Auffallend groß ist der Blutdurst, welcher alle beseelt. Sie erwürgen, wenn sie können, weit mehr, als sie zu ihrer Nahrung brauchen, und manche Arten berauschen sich förmlich in dem Blute, welches sie ihren Opfern aussaugen.
Die Jungen, deren Anzahl erheblich, soviel man weiß, zwischen zwei und zehn, schwankt, kommen blind zur Welt und müssen lange gesäugt und gepflegt werden. Ihre Mutter bewacht sie sorgfältig und vertheidigt sie bei Gefahr mit großem Muthe oder schleppt sie, sobald sie sich nicht sicher fühlt, nach anderen Schlupfwinkeln. Eingefangene und sorgsam aufgezogene Junge erreichen einen hohen Grad von Zahmheit und können dahin gebracht werden, ihrem Herrn wie ein Hund nachzulaufen und für ihn zu jagen und zu fischen. Eine Art ist sogar gänzlich zum Hausthiere geworden und lebt seit unbestimmbaren Zeiten in der Gefangenschaft.
Wegen ihrer Raublust und ihres Blutdurstes fügen einige dem Menschen zuweilen nicht unbeträchtlichen Schaden zu; im allgemeinen überwiegt jedoch der Nutzen, welchen sie mittelbar oder unmittelbar bringen, den von ihnen angerichteten Schaden bei weitem. Aber leider wird diese Wahrheit nur von wenigen Menschen anerkannt und deshalb ein wahrer Vernichtungskrieg gegen unsere Thiere geführt, nicht selten zum empfindlichen Schaden des Menschen. Durch Wegfangen von schädlichen Thieren leisten sie nicht unerhebliche Dienste, und wenn man ihnen auch ihre Eingriffe in das Besitzthum des Menschen nicht verzeihen kann, muß man doch zugeben, daß sie in der Regel nur die Nachlässigkeit ihrer unfreiwilligen Brodherren zu bestrafen pflegen. Wer seinen Taubenschlag oder Hühnerstall schlecht verwahrt, hat Unrecht, dem Marder zu zürnen, welcher sich dies zu Nutze macht, und wer über die Verluste klagt, welche diese Raubthiere dem Haar- oder Federwildstande zufügen, mag bedenken, daß zum mindesten Iltis, Hermelin und Wiesel weit mehr schädliche Nager als Jagdthiere vertilgen. Unbedingt schädlich sind überhaupt nur diejenigen Marderarten, welche der Fischjagd obliegen: alle übrigen bringen auch Nutzen. Der Jäger mag die Thätigkeit des Baum- und Steinmarders verdammen: der Forstwirt wird sie nicht rückhaltlos verurtheilen können.
Damit will ich nicht gesagt haben, daß eine eifrige und verständige Jagd auf unsere größeren Marderarten unberechtigt sei. Abgesehen von den mongolischen Marderjägern und einzelnen Gläubigen, welche, entsprechend den unfehlbaren Satzungen der Kirche, im Fischotterfleische eine fastengerechte Speise sehen, oder einigen Jägern, welche Dachswildpret für ein schmackhaftes Gericht erklären, ißt Niemand Marderfleisch; wohl aber verwerthet man das Fell fast aller Arten der Familie zu trefflichem Pelzwerke. Wie bedeutend die Anzahl der Marder ist, welche alljährlich ihres Felles halber getödtet werden, ergibt sich erst aus einer Zusammenstellung der nachweislichen Erträgnisse des Pelzhandels. Nach Lomer kommen alljährlich gegen dritthalb Millionen Felle verschiedener Marder im Werthe von zwanzig Millionen Mark in die Hände von Europäern und auf den Markt, diejenigen ungerechnet, welche von indianischen und asiatischen Jägern zu eigenem Gebrauche verwendet werden. Indianische und mongolische Stämme leben fast ausschließlich von den Erträgnissen der Jagd auf Pelzthiere, unter denen die Marder anerkanntermaßen die erste Stelle einnehmen; Tausende von Europäern gewinnen durch den Pelzhandel ihren Unterhalt; unbekannte Gebiete sind durch Marder- und Zobeljäger unserer Kenntnis erschlossen worden. Solchem Gewinne gegenüber dürfen alle Verluste, welche wir durch die Marder insgemein zu erleiden haben, mindestens als erträgliche bezeichnet werden.
Gray, welcher die Marder neuerdings vergleichend untersucht hat, theilt die Gesammtheit in vier Unterfamilien ein, unter denen er die Landmarder ( Mustelina ) obenan stellt. Sie kennzeichnen der sehr gestreckte Leib mit mittellangem, gleichmäßig dickem Schwanze, die kurzen Füße mit scharfen, zurückziehbaren Krallen und das wegen der ungleichen Anzahl von Backenzähnen im oberen und unteren Kiefer bemerkenswerthe Gebiß, dessen letzter oberer Backenzahn kurz, klein und in die Quere verlängert ist.
Die oberste Stellung innerhalb dieser Unterfamilie nehmen die Edelmarder ( Martes ) ein, mittelgroße, schlank gebaute und langgestreckte, kurzbeinige Thiere, mit vorn verschmälertem Kopfe, zugespitzter Schnauze, quergestellten, ziemlich kurzen, fast dreiseitigen, an der Spitze schwach abgerundeten Ohren und mittelgroßen, lebhaften Augen, mit fünfzehigen, scharfkralligen Füßen, eine bisamartige Flüssigkeit absondernden Afterdrüsen und langhaarigem, weichem Pelze. Das Gebiß besteht aus 38 Zähnen, sechs Schneidezähnen und einem kräftigen Eckzahne in jedem Kiefer, drei nach hinten zu sich vergrößernden Lückzähnen in jedem Ober-, vier in jedem Unterkiefer, und je zwei Backenzähnen oben und unten.
Als vorzüglichstes Mitglied der Sippe gilt uns der Edel-, Baum- oder Buchmarder ( Martes abietum, Mustela Martes, Viverra Martes, Martes vulgaris, sylvestris und sylvatica, Martarus abietum), ein ebenso schönes als bewegliches Raubthier von etwa 55 Centim. Leibes- und 30 Centim. Schwanzlänge. Der Pelz ist oben dunkelbraun, an der Schnauze fahl, an der Stirn und den Wangen lichtbraun, an den Körperseiten und dem Bauche gelblich, an den Beinen schwarzbraun, und an dem Schwanze dunkelbraun. Ein schmaler, dunkelbrauner Streifen zieht sich unterhalb der Ohren hin. Zwischen den Hinterbeinen befindet sich ein röthlichgelber, dunkelbraun gesäumter Flecken, welcher sich zuweilen in einem schmutziggelben Streifen bis zur Kehle fortzieht. Diese und der Unterhals sind schön dottergelb gefärbt, und hierin liegt das bekannteste Merkmal unseres Thieres. Die dichte, weiche und glänzende Behaarung besteht aus ziemlich langen, steifen Grannenhaaren und kurzem, feinem Wollhaare, welches an der Vorderseite weißgrau, hinten und an den Seiten aber gelblich gefärbt ist. Auf der Oberlippe stehen vier Reihen von Schnurren und außerdem noch einzelne Borstenhaare unter den Augenwinkeln sowie unter dem Kinne und an der Kehle. Im Winter ist die allgemeine Färbung dunkler als im Sommer. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen durch blässere Färbung des Rückens und einen weniger deutlichen Flecken. Bei jungen Thieren sind Kehle und Unterhals heller gefärbt.
Das Vaterland des Edelmarders erstreckt sich über alle bewaldeten Gegenden der nördlichen Erdhälfte. In Europa findet er sich in Skandinavien, Rußland, England, Deutschland, Frankreich, Ungarn, Italien und Spanien, in Asien bis zum Altai, südlich bis zu den Quellen des Jenisei. Solch ausgedehntem Verbreitungskreise entsprechend, ändert er namentlich in seinem Felle nicht unwesentlich ab. Die größten Edelmarder wohnen in Schweden, und der Pelz derselben ist noch einmal so dicht und so lang als der unserer deutschen Marder, die Färbung grauer. Unter den deutschen finden sich mehr gelbbraune als dunkelbraune, welche letztere namentlich in Tirol vorkommen und dem amerikanischen Zobel oft täuschend ähneln. Die Edelmarder der Lombardei sind blaßgraubraun oder gelbbraun, die der Pyrenäen groß und stark, aber ebenfalls hell, die aus Macedonien und Thessalien mittelgroß, aber dunkel.
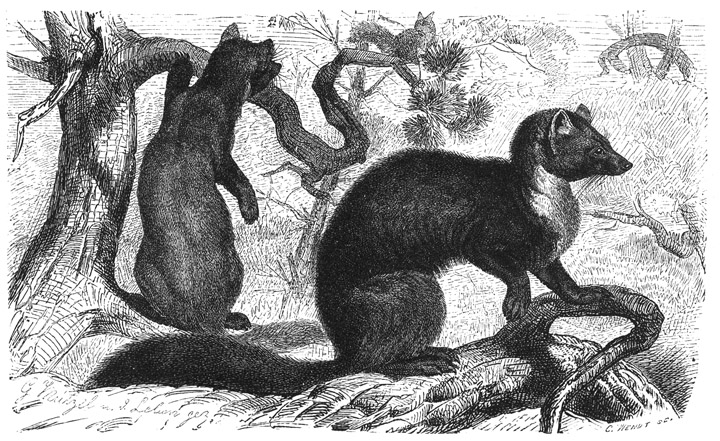
Edelmarder ( Martes abietum). [1/6] natürl. Größe.
Der Edelmarder bewohnt die Laub- und Nadelwälder und findet sich um so häufiger, je einsamer, dichter und finsterer dieselben sind. Er ist ein echtes Baumthier und klettert so meisterhaft, daß ihn kein anderes Raubsäugethier hierin übertrifft. Hohle Bäume, verlassene Nester von wilden Tauben, Raubvögeln und Eichhörnchen wählt er am liebsten zu seinem Lager; selten sucht er auch in Felsenritzen eine Zufluchtsstelle. Auf seinem Lager ruht er gewöhnlich während des ganzen Tages; mit Beginn der Nacht aber, meist schon vor Sonnenuntergang, geht er auf Raub aus und stellt nun allen Geschöpfen nach, von denen er glaubt, daß er sie bezwingen könnte. Vom Rehkälbchen und Hasen herab bis zur Maus ist kein Säugethier vor ihm sicher. Er beschleicht und überfällt sie plötzlich und würgt sie ab. Daß er sich, mindestens zuweilen, auch an junge oder schwache Rehe wagt, ist neuerdings von mehreren Forstleuten beobachtet worden. Dem Förster Schaal wurden zwei gerissene und verendende Rehkälber eingeliefert; unser Gewährsmann schrieb aber die Unthat schwachen Hunden zu, bis er gelegentlich eines Pürschganges den Edelmarder auf einem Rehkalbe, dessen Klagen ihn herbeigelockt hatten, sitzen sah und dieses bei näherer Untersuchung genau in derselben Weise wie die früheren verwundet fand; Oberförster Kogho berichtet von mehreren ähnlichen Fällen. Da die alte Rike dem von oben herab auf das Kitzchen springenden Räuber nicht beikommen, ihn nämlich mit ihren Vorderläufen nicht abschlagen kann, hat ein solcher Ueberfall für den Edelmarder keine Gefahr. Gleichwohl gehört es zu den seltenen Vorkommnissen, daß dieser an so große Säugethiere sich wagt; das beliebteste Haarwild, welches er jagt, sind und bleiben die baumbewohnenden Nager, insbesondere Eichhörnchen und Bilche. Unter dieser ebenso niedlichen als nichtsnutzigen, beziehentlich schädlichen Sippschaft richtet er arge Verheerungen an, wie ich dies gelegentlich der Beschreibung des Eichhörnchens zu schildern haben werde. Daß er ein sonstwie ihm sich bietendes Säugethier, welches bewältigen zu können er glaubt, nicht verschmäht, ist selbstverständlich, weil Marderart. Einen Hasen überfällt er im Lager oder während jener sich äset; die Wasserratte soll er sogar in ihrem Elemente verfolgen. Ebenso verderblich wie unter den Säugethieren haust der Edelmarder übrigens auch unter den Vögeln. Alle Hühnerarten, welche bei uns leben, haben in ihm einen furchtbaren Feind. Leise und geräuschlos schleicht er zu ihren Schlafplätzen hin, mögen diese nun Bäume oder der flache Boden sein; ehe noch die sonst so wachsame Henne eine Ahnung von dem blutgierigen Feinde bekommt, sitzt dieser ihr auf dem Nacken und zermalmt ihr mit wenigen Bissen den Hals oder reißt ihr die Schlagadern auf, an dem herausfließenden Blute gierig sich labend. Außerdem plündert er alle Nester der Vögel aus, sucht die Bienenstöcke heim und raubt dort den Honig oder geht den Früchten nach und labt sich an allen Beeren, welche auf dem Boden wachsen, frißt auch Birnen, Kirschen und Pflaumen. Wenn ihm Nahrung im Walde zu mangeln beginnt, wird er dreister; in der höchsten Noth kommt er zu den menschlichen Wohnungen. Hier besucht er Hühnerställe und Taubenhäuser und richtet Verwüstungen an wie kein anderes Thier, mit Ausnahme der Glieder seiner eigenen Sippschaft. Er würgt weit mehr ab, als er verzehren kann, oft den ganzen Stall, und nimmt dann nur eine einzige Henne oder eine einzige Taube mit sich weg. So wird er der gesammten kleinen Thierwelt wahrhaft verderblich und ist deshalb fast mehr gefürchtet als jedes andere Raubthier.
Ende Januars oder anfangs Februar beginnt die Rollzeit. Der Beobachter, welcher bei Mondschein in einem großen Walde unseren Strauchdieb zufällig entdeckt, sieht jetzt mehrere Marder im tollsten Treiben auf den Bäumen sich bewegen. Fauchend und knurrend jagen sich die verliebten Männchen, und wenn beide gleich stark sind, gibt es im Gezweige einen tüchtigen Kampf zur Ehre des Weibchens, welches nach Art ihres Geschlechts an diesem eifersüchtigen Treiben Gefallen zu finden scheint und die verliebten Bewerber längere Zeit hinhält, bis es endlich dem stärksten sich ergibt. Nach neunwöchentlicher Tragzeit, also zu Ende des März oder im Anfange des April, wirft das Weibchen drei bis vier Junge in ein mit Moos ausgefüttertes Lager in hohle Bäume, selten in Eichhorn- oder Elsternester oder in eine Felsenritze. Die Mutter sorgt mit aufopfernder Liebe für die Familie und geht, voll Besorgnis sie zu verlieren, niemals aus der Nähe des Lagers. Schon nach wenigen Wochen folgen die Jungen der Alten bei ihren Lustwandelungen auf die Bäume nach und springen auf den Aesten munter und hurtig umher, werden von der vorsichtigen Alten auch in allen Leibesübungen tüchtig eingeschult und bei der geringsten Gefahr gewarnt und zu eiliger Flucht angetrieben. Solche Junge kann man ziemlich leicht auffüttern und anfangs mit Milch und Semmel, später mit Fleisch, Eiern, Honig und Früchten lange erhalten.
»Am 29. Januar«, erzählt Lenz, »erhielt ich einen jungen Edelmarder, welcher an demselben Tage aus der Höhlung eines Baumes geholt worden war. Das Thierchen hatte erst die Größe einer Wanderratte; seine Bewegungen waren noch langsam. Er suchte sich immer in Löcher zu verkriechen und scharrte auch, um Löcher zu bilden. Anfangs war er beißig, wurde jedoch schon am ersten Tage ganz zahm. Laue Milch soff er bald und fraß auch schon wenige Stunden, nachdem er zu mir gebracht worden war, in Milch eingeweichte Semmel. Obgleich noch sehr jung, war er doch so reinlich, daß er eine Ecke seines Behälters zum Abtritt erkor, eine Tugend, welche man nur wenigen anderen Thieren nachrühmen kann. An diesem Thierchen konnte ich recht sehen, wie sich der Geschmack naturgemäß entwickelt. Anfangs (im Juni oder Juli) bekommt der junge Edelmarder von seinen Eltern gewisse Speisen, fast nur Vögel, später muß er sich auch an Mäuse, Obst etc. gewöhnen, wie es die Jahreszeit bietet.
»Am zweiten Tage bot ich ihm einen Frosch an: er beachtete ihn gar nicht; gleich darauf gab ich ihm einen lebenden Sperling: und er schnappte ihn sofort lebend weg und verzehrte ihn mit allen seinen Federn. Ebenso machte er es bald mit einem zweiten und dritten. Am vierten Tage ließ ich ihn hungern und bot ihm dann einen Frosch, eine Eidechse und eine Blindschleiche an. Er beachtete alles nicht, und wollte auch einen jungen Raben nicht fressen. Am sechsten Tage kroch er nachts aus seinem Behälter, biß einen im Neste sitzenden Thurmfalken todt und fraß den Kopf, Hals und einen Theil der Brust. Ich bot ihm nach und nach mancherlei an und fand, daß er kleine Vögel allem vorzog. Fischfleisch fraß er nicht, Kaninchen, Hamster, Mäuse recht gern, aber doch nicht so begierig wie Vögel, wogegen Iltis und Fuchs Säugethiere lieber fressen als letztere. Kirschen und Erdbeeren fraß er, Stachel- und Heidelbeeren nicht gern, Ameisenpuppen sehr gern; doch verdaute er sie nicht gehörig. Junge Katzen tödtete und fraß er; Eidotter schmeckten ihm gut, aber noch nicht so gut wie kleine Vögel; auch Gedärme und Fleisch von größeren Vögeln beachtete er nicht so sehr wie von kleinen. Schon als ganz junges Thier hatte er den Grundsatz, kein ihm zur Nahrung dienendes Wesen entwischen zu lassen. War er satt, so spielte er doch noch mit neuhinzukommenden Vögeln etc. stundenlang. Vorzüglich spielte er mit kleinen Hamstern. Er hüpfte und sprang unaufhörlich um das boshaft fauchende Hamsterchen herum und gab ihm bald mit der rechten, bald mit der linken Pfote eine Ohrfeige. War er aber hungrig, so zögerte er nicht lange, biß dem Hamsterchen den Kopf entzwei und fraß es mit Knochen, Haut und Haaren.
»Als er drei Viertel seines Wachsthums erreicht hatte und außerordentlich gefräßig war, gab ich ihm wiederum eine Blindschleiche. Er war gerade hungrig, näherte sich aber doch behutsam und sprang bei jeder ihrer Bewegungen wieder zurück. Als er sich endlich überzeugt hatte, daß sie nicht gefährlich sei, biß er endlich zu; ihr Schwanz brach ab: er fraß ihn auf und trug dann das Thier in sein Nest, wo es ihm entschlüpfte und unter das Heu kroch. Er zog es wieder vor, biß sich noch ein Stück des übergebliebenen Schwanzstummels ab, aber erst nach zwei Stunden wagte er es, die Blindschleiche am Halse zu packen und zu zerreißen. Er trug sie dann ins Nest und fraß sie nach und nach mit Wohlbehagen, jedoch ohne Begierde. Noch war er mit der Blindschleiche nicht fertig, als ich ihm eine etwa 60 Centim. lange Ringelnatter in seine Kiste warf. Sobald sie da lag, näherte er sich behutsam, sprang aber, so oft sie sich rührte oder zischte, erschrocken zurück. Die Schlange hatte endlich in einen Knäuel sich zusammengeballt und den Kopf unter ihren Windungen versteckt. Wohl eine Stunde lang war er schon um sie herumgesprungen, ohne sie anzutasten; dann erst begann er, überzeugt, daß keine Gefahr zu fürchten sei, sie zu beschnuppern und mit den Pfoten zu berühren, alles aber immer noch mit der größten Aengstlichkeit. Es war, als hätte er wohl Lust zu fressen, aber nicht den Muth, sie zu tödten. Daher trieb er sein Wesen, indem er sich ihr bald näherte, bald zurücksprang, über einen Tag lang, und nun erst wurde er so dreist, sie, am Nacken gepackt, umherzutragen und am dritten Tage endlich zu tödten; jedoch fraß er sie nicht. Während er noch mit dem Ringelnatterspiel beschäftigt war, brachte ich ihm eine frisch getödtete, große Kreuzotter. Vorsichtig kam er sogleich heran, überzeugte sich, daß sie todt sei, nahm sie auf, trug sie bald hier-, bald dorthin, und verschmauste sie nach einer Stunde sammt Kopf und Giftzähnen. Ich gab ihm dann eine Eidechse, welche er ebenfalls schnuppernd begrüßte; das Thierchen zischte heiser, fast wie eine Schlange, sperrte den Rachen auf und sprang wohl zehnmal auf ihn zu. Er traute nicht und wich ihren Bissen aus, wurde jedoch immer dreister und machte sich, da ihm die Eidechse nichts zu Leide that, nach Verlauf einer Stunde daran, biß sie todt und fraß sie auf.
»Hieraus geht hervor, daß er von Natur wenig Trieb hat, Schlangen und andere Kriechthiere zu tödten; es ist aber nach den genannten Erfahrungen keineswegs unwahrscheinlich, daß er sie im Winter, wenn er sie zufällig in ihrem wehrlosen Zustande trifft, umbringt und frißt; denn zu dieser Zeit mag er oft bitteren Hunger leiden, da er ungeheuer gefräßig ist.
»Wir haben gesehen, daß er sich selbst vor der Eidechse, welche doch ein wahrer Zwerg gegen ihn ist, furchtsam zeigt; dagegen ist aber sein Muth gegen andere Thiere, nach deren Fleisch er leckert, sehr groß. Wenn er einen starken Hamster oder eine große Ratte bekommt, setzt es einen fürchterlichen Kampf. Kleinen Nagern derselben Art beißt er sogleich den Hals und Kopf entzwei, auf größere aber stürzt er sich mit Ungestüm, packt sie mit allen vier Pfoten, wirft sie zu Boden und dreht und wendet die Thiere mit so einer ungeheueren Schnelligkeit zwischen den Pfoten, daß das Auge den Bewegungen gar nicht folgen kann. Man weiß nicht recht, was man sieht, wer siegt oder unterliegt: den Hamster hört man unaufhörlich fauchen; aber plötzlich springt der Marder empor, hält den Hamster im Genicke und zermalmt ihm die Knochen. Größeren Kaninchen fällt er sogleich ins Genick und läßt nicht eher los, bis sie erwürgt sind. Einen gewaltigen Lärm gibt es, wenn man ihm einen recht großen, starken Hahn reicht. Wüthend springt er diesem an den Hals und wälzt sich mit ihm herum, während der Hahn aus allen Kräften mit den Flügeln schlägt und den Füßen tritt. Nach einigen Minuten hat das Gepolter ein Ende, und dem Hahn ist der Hals zerbissen. Ich habe ihn absichtlich keinem gefährlichen Kampfe preisgegeben, und daher nie eine lebende Otter zu ihm gebracht, weil er mir sehr theuer war. Einstmals aber gab ich ihm eine ganz frisch erlegte, noch warme, sehr große Katze. Ich warf sie ihm plötzlich in seine Kiste: aber in demselben Augenblicke hatte er sie schon wüthend am Halse gepackt, daß ich wohl sah, er würde den Kampf gegen das lebende Thier nicht gescheut haben. Er ließ auch nicht eher los, als bis er sich vollkommen von ihrem Tode überzeugt hatte. Zu dieser Zeit war er schon erwachsen.
»Ich will hier noch auf einen Irrthum aufmerksam machen, welcher ziemlich allgemein ist. Man glaubt nämlich, daß die Wieselarten, wenn sie ein Thier tödten, allemal die starken Pulsadern des Halses mit den Eckzähnen treffen und durchschneiden. Das ist nicht richtig. Sie packen allerdings größere Thiere beim Halse und erwürgen sie so, jedoch ohne gerade die Adern zu treffen, daher vermögen sie auch nicht, ihnen das Blut auszusaugen, sondern begnügen sich damit, das zufällig hervorfließende abzulecken. Dann fressen sie das Thier an und beginnen gewöhnlich mit dem Halse; bei etwas größeren Thieren, wie bei großen Ratten, Hühnern etc., wird beim Tödten nicht einmal die Halshaut, welche zähe ist und nachgibt, durchschnitten, sondern erst später.
»Solange er noch jung war, spielte er gern mit Menschen, wenn man das Spiel selbst begann; später ist zu solchen Spielen nicht zu rathen, denn er gewöhnt sich, wenn er groß ist, in alles, selbst wenn er es nicht böse meint, so fest einzubeißen, daß er mich durch dicke Handschuhe mit den Eckzähnen bis ins Fleisch gebissen hat, übrigens in aller Freundschaft. Eigentliche Liebe zu seinem Erzieher spricht sich nicht in seinen Mienen und Geberden aus, obgleich er Wohlbekannten, wenn er gut behandelt wird, nie etwas zu Leide thut. Aus seinen schwarzen Augen blickt nur Begierde und Mordlust. Wenn er recht behaglich in seinem Neste liegt, läßt er oft ein anhaltendes, trommelndes Murren hören. Das Knäffen des Iltis habe ich nie von ihm gehört. Wenn er böse ist, knurrt er heftig.«
Ganz so unfreundlich gegen den Pfleger, wie Lenz zu glauben scheint, benehmen sich keineswegs alle gefangenen Edelmarder; viele, und ich selbst habe solche gehalten, werden sehr zahm und zeigen sich ungemein anhänglich an ihren Gebieter. »Ich habe«, so erzählt Ritter von Frauenfeld, »einen Edelmarder gesehen, welcher meinem Bruder auf dem Wege von Tulln nach Wien auf eine Entfernung von mehreren Meilen durch den Wald von Dornbach wie ein Hund auf dem Fuße folgte. In Wien schlug er seine Wohnung in einem Holzschuppen auf und bereitete hier sich ein Lager auf einem ungeheueren Haufen von Hühner- und Taubenfedern, den Beuteresten der Thiere, welche er auf seinen nächtlichen Wanderungen erjagte. Des Morgens kam er vom Hofe herauf in die im ersten Stockwerke gelegene Wohnung, wo er durch Kratzen und Scharren Einlaß verlangte. Er bekam allda seinen Kaffee, den er außerordentlich liebte, spielte und neckte sich mit den Kindern in der launigsten Weise herum und liebte es unendlich, wenn ihm verstattet wurde, daß er eine Stunde im Schoße ruhen und schlafen durfte.«
»Ein Baummarder«, schreibt mir Grischow, »war so zahm, daß ich ihn auf den Arm nehmen und streicheln durfte. Die Taschen meines Vaters untersuchte er stets auf das genaueste, weil er gewohnt war, in ihnen Leckerbissen zu finden; uns kroch er gern zwischen Aermel und Arm, um sich zu wärmen. Ein schwarzer Affenpintscher spielte so gern und so hübsch mit ihm, daß man wahre Freude an den Thieren haben mußte. Beide jagten sich unter lautem Bellen des Hundes hin und her, und der Marder entfaltete dabei alle ihm eigene Gewandtheit. Oft saß er auf dem Rücken des Hundes wie ein Affe auf dem Rücken des Bären; gefiel der Reiter dem Hunde nicht länger, so wußte er ihn schlau dadurch zu entfernen, daß er soweit lief, bis die Leine, an welcher der Marder gefesselt war, diesen herabriß. Mitunter erzürnten sich beide ein wenig; dann schlüpfte der Marder in eine kleine Tonne, und der Hund wartete, vor dieser stehend, bis sein Spielgefährte wieder guter Laune war. Lange währte es nie, bis der Marder, schelmisch sich umsehend, hervorkam, dem Hund eine Ohrfeige versetzte und damit das Zeichen zu neuen Spielen gab.«
Sehr unfreundlich benahmen sich von mir gepflegte Edelmarder gegen einen Iltis, welchen ich zu ihnen bringen ließ, weil ich sehen wollte, ob sich zwei so nah verwandte Thiere vertragen würden oder nicht. Der Iltis suchte ängstlich nach einem Auswege; aber auch die Edelmarder nahmen den Besuch nicht günstig auf. Sie stiegen sofort zur höchsten Spitze ihres Kletterbaumes empor und betrachteten den Fremdling funkelnden Auges. Neugier oder Mordlust siegten jedoch bald über ihre Furcht: sie näherten sich dem Iltis, berochen ihn, gaben ihm einen Tatzenschlag, zogen sich blitzschnell zurück, näherten sich von neuem, schlugen nochmals, schnüffelten hinter ihm her und fuhren plötzlich, beide zugleich, mit geöffnetem Gebisse nach dem Nacken des Feindes. Da nur einer sich festbeißen konnte, ließ der zweite ab und beobachtete aufmerksam den Kampf, welcher sich zwischen seinem Genossen und dem gemeinsamen Gegner entsponnen hatte. Beide Streiter waren nach wenig Augenblicken in einander verbissen und zu einem Knäuel geballt, welcher sich mit überraschender Schnelligkeit dahinkugelte und wälzte. Nach einigen Minuten eifrigen Ringens schien der Sieg sich auf die Seite des Edelmarders zu neigen. Der Iltis war festgepackt worden und wurde festgehalten. Diesen Augenblick benutzte der zweite Edelmarder, um sich im Hintertheile des Iltis einzubeißen. Jetzt schien dessen Tod gewiß zu sein: da mit einem Male ließen beide Edelmarder gleichzeitig los, schnüffelten in der Luft und taumelten dann wie betrunken hinter dem ein Versteck suchenden Iltis einher. Ein durchdringender Gestank, welcher sich verbreitete, belehrte uns, daß der Ratz seine letzte Waffe gebraucht hatte. In welcher Weise der Gestank gewirkt hatte, ob besänftigend oder abschreckend, blieb unentschieden: die Edelmarder folgten wohl, eifrig schnüffelnd, den Spuren des Stänkers, griffen ihn aber nicht wieder an.
Die gefangenen Edelmarder unserer Thiergärten pflanzen sich nicht selten fort, fressen aber ihre Jungen nach deren Geburt gewöhnlich auf, selbst wenn man ihnen überreichliche Nahrung vorwirft. Doch hat man auch, beispielsweise in Dresden, das Gegentheil beobachtet und die im Käfige geborenen Edelmarder unter treuer Pflege ihrer Mutter glücklich großwachsen sehen.
Man verfolgt den Edelmarder überall auf das nachdrücklichste, weniger um seinem Würgen zu steuern, als vielmehr, um sich seines werthvollen Felles zu bemächtigen. Am leichtesten erlegt man ihn bei frischem Schnee, weil dann nicht bloß seine Fährte auf dem Boden, sondern auch die Spur auf den beschneiten Aesten verfolgt werden kann. Zufällig bemerkt man ihn wohl auch ab und zu einmal im Walde liegen, gewöhnlich der Länge nach ausgestreckt auf einem Baumaste. Von dort aus kann man ihn leicht herabschießen und, wenn man gefehlt hat, oft noch einmal laden, weil er sich manchmal nicht von der Stelle rührt und den Jäger unverwandt im Auge behält. Die vor ihm aufgestellten Gegenstände beschäftigen ihn derart, daß er gar nicht daran denkt, zu entrinnen. Ein glaubwürdiger Mann erzählt mir, daß er vor Jahren mit mehreren anderen jungen Leuten einen Edelmarder mit Steinen vom Baume herabgeworfen habe. Das Thier schien zwar die an ihm vorübersausenden Steine mit großer Theilnahme zu betrachten, rührte sich aber nicht von der Stelle, bis endlich ein größerer Stein es an den Kopf traf und betäubte.
Bei der Jagd des Edelmarders muß man einen recht scharfen Hund haben, welcher herzhaft zubeißt und den Marder faßt, weil dieser wüthend gegen seine Verfolger zu springen und einen minder guten Hund abzuschrecken pflegt. Verhältnismäßig leicht fängt er sich in Eisen, welche eigens dazu verfertigt worden und sehr verborgen aufgestellt sind. Als Anbiß dient gewöhnlich ein Stückchen Brod, welches man nebst einem Scheibchen Zwiebel in ungesalzener Butter und Honig gebraten und mit Kampher bestreut hat. Andere Witterungen bestehen aus 0,1 Gramm Moschus, 2 Gramm Anisöl und ebensoviel Bilsenöl, welche Mischung tüchtig geschüttelt und mittels eines Läppchens tropfenweise auf das gut geputzte Eisen gestrichen wird, oder aus 4 Gramm Anisöl, 1 Gramm Ambra, 1 Gramm Bisam, 1 Gramm Bibergeil und 1 Gramm Kampher, welche Stoffe mit zerlassenem Gänsefett vermischt werden, oder endlich in Katzenkraut, mit welchem man das Eisen tüchtig einreibt, freilich aber oft auch Katzen anstatt des Marders fängt. Zibet thut übrigens dieselben Dienste wie jede andere Witterung. Ausgezeichnet für den Fang ist, nach Lenz, auch der sogenannte Schlagbaum. Dieser besteht aus zwei knapp der Länge nach passenden und am Ende zusammengebundenen starken Stangen. Sie werden auf einem Baume befestigt; an dem anderen Ende bringt man ein Schnellbret von 40 Centim. Länge und ebensoviel Breite an, welches zur Befestigung des Köders dient. Damit das Thier bequem hinaufkommen kann, wird eine Anlaufstange in die Erde gestellt und an das dicke Ende der unteren Schlagbaumstange befestigt. Klettert der Marder hinauf, so muß er, um den Köder zu erhaschen, zwischen den beiden Stangen an das Schnellholz. Sobald er aber den Köder berührt, fällt die Stellstange nieder und zerquetscht ihn. Außerdem bedient man sich einer Falle, welche aus einem langen, nach einer Seite offenen Kasten mit einer Fallthüre besteht. In der Mitte ist ein tellerförmiges Bretchen und die Lockspeise oder, noch besser, am hinteren Ende der Falle ein enggeflochtener Drahtkäfig angebracht, welcher ein lebendes junges Kaninchen, Täubchen oder Mäuschen enthält. Der Marder kriecht durch die Fallthüre in den Kasten, und wird gefangen, sobald er nach der Lockspeise greift, weil die geringste Bewegung an dem Bretchen die Thüre zum Fallen bringt.
Das Pelzwerk des Edelmarders ist das kostbarste aller unserer einheimischen Säugethiere und ähnelt in seiner Güte am meisten dem des Zobels. Die Anzahl der jährlich auf den Markt kommenden Edelmarderfelle schätzt Lomer auf 180,000; in Deutschland, beziehentlich Mitteleuropa, allein sollen jährlich drei Viertheile davon erbeutet werden. Die schönsten Felle liefert Norwegen, die nächstbesten Schottland; die übrigen, in der hier eingehaltenen Reihe an Güte abnehmend, kommen aus Italien, Schweden, Norddeutschland, der Schweiz, Oberbayern, der Tatarei, Rußland, der Türkei und Ungarn. Man schätzt diesen Pelz ebenso seiner Schönheit wie seiner Leichtigkeit halber und bezahlt das Fell mit fünfzehn bis dreißig Mark, je nach seiner Güte.
Der Stein- oder Hausmarder ( Martes foina, M. fagorum und domestica, Mustela foina) unterscheidet sich vom Edelmarder durch seine etwas geringere Größe, die verhältnismäßig kürzeren oder niedrigeren Beine, den trotz des kürzeren Gesichtes längeren Kopf, die kleineren Ohren, den kürzeren Pelz, die lichtere Haarfärbung und die weiße Kehle; außerdem weichen der dritte obere Lückzahn, der obere Reiß- und Höckerzahn in ihrer Gestalt und ihren Verhältnissen von denen des Edelmarders ab. Die Gesammtlänge des ausgewachsenen Männchens beträgt 70 Centim., wovon etwas über ein Drittel auf den Schwanz kommt. Der graubraune Pelz, zwischen dessen Grannenhaaren das einfarbig weißliche Wollhaar durchschimmert, dunkelt auf Beinen und Schwanz und geht auf den Füßen in Dunkelbraun über; der Kehlfleck, welcher in Form und Größe manchem Wechsel unterworfen, immer aber kleiner als beim Edelmarder ist, wird durch rein weiße Haare gebildet; die Ohrränder sind mit kurzen weißlichen Haaren besetzt.
Der Steinmarder findet sich fast in allen Ländern und Gegenden, in denen der Edelmarder vorkommt. Ganz Mitteleuropa und Italien, mit Ausnahme von Sardinien, England, Schweden, das gemäßigte europäische Rußland bis zum Ural, der Krim und dem Kaukasus sowie Westasien, insbesondere Palästina, Syrien und Kleinasien, sind seine Heimat. In den Alpen steigt er während der Sommermonate über den Tannengürtel hinauf, im Winter zieht er sich gewöhnlich nach den tieferen Gegenden zurück. In Holland scheint er gegenwärtig fast ausgerottet zu sein, wird wenigstens unverhältnismäßig selten gefunden. Er ist fast überall häufiger als der Edelmarder und nähert sich weit mehr als jener den Wohnungen der Menschen; ja man darf sagen, daß Dörfer und Städte geradezu sein Lieblingsaufenthalt sind. Einsam stehende Scheuern, Ställe, Gartenhäuser, altes Gemäuer, Steinhaufen und größere Holzstöße in der Nähe von Dörfern werden regelmäßig von diesem gefährlichen Feinde des zahmen Geflügels bewohnt. »Im Walde«, sagt Karl Müller, welcher ihn sehr eingehend beobachtet hat, »ist sein Versteck fast immer der hohle Baum; in der Scheuer geht seine Höhle mehr oder weniger tief in das Heu oder Stroh hinein, in der Regel an der Wand hin. Diese Gänge bildet er theils durch Beiseitedrängen, theils durch Zerbeißen der Stoffe. Unter Heu- und Strohvorräthen, gewöhnlich in einer Mauerecke oder an einem Balken des betreffenden Gebäudes, legt er seine Familienstätte an, welche in einer bloßen Vertiefung in der an und für sich weichen Umgebung besteht, mit dieser im Vereine aber einen kugeligen Behälter bildet, welcher zuweilen mit Federn, Wolle, Haarwerk, auch wohl vollständig mit Flachs ausgepolstert wird.«
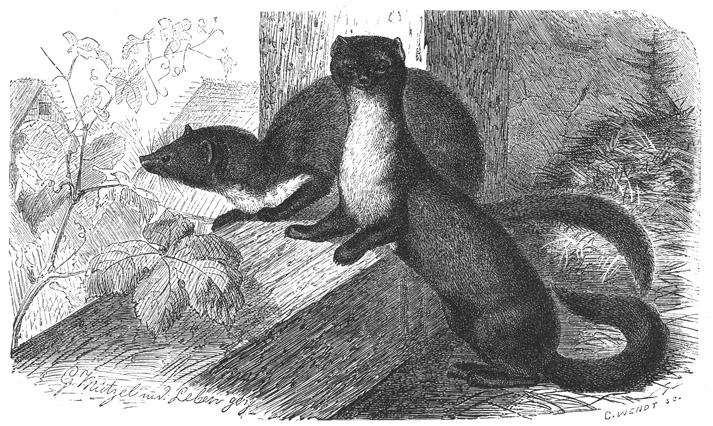
Steinmarder ( Martes foina). [1/6] natürl. Größe.
Lebensweise und Sitten des Hausmarders stimmen vielfach mit denen des Edelmarders überein. Er ist in allen Leibesübungen Meister und ebenso lebendig, gewandt und geschickt, ebenso muthig, listig und mordsüchtig wie jener, klettert selbst an glatten Bäumen und Stämmen hinauf, versteht es, weite Sprünge zu machen, schwimmt mit Leichtigkeit, weiß zu schleichen und sich durch die engsten Ritzen zu zwängen. Im Winter schläft er, laut Müller, so lange er nicht beunruhigt wird, bei Tage in seinem Lager; im Sommer dagegen geht er in der Nähe desselben nicht selten auch angesichts der Sonne auf Raub aus und wagt sich bis in entferntere Gärten und Felder. »Geheimnisvoll ist sein Wandel. Wie ein Schatten huscht er vorüber und weiß die kleinste Erhöhung zu benutzen, um sich zu decken. Kommt er einmal in Verlegenheit, sodaß er im ersten Augenblicke der Ueberraschung nicht weiß, wohinaus er seinen Rückzug antreten soll, dann nickt er, wie ein altes Weib, sonderbar mit dem Kopfe, steckt denselben in etwa vor ihm befindliche Vertiefungen, zieht ihn aber rasch wieder zurück, wirft sich wohl auch in eine vertheidigende Stellung und zeigt das blendendweiße Gebiß. Auch habe ich ihn in solchen Augenblicken, gleich dem Fuchse in ähnlichen Lagen, die Augen zudrücken sehen, als ob er irgend einen Schlag erwarten müsse. Auf seinen Raubgängen ist er ebenso kühn und verwegen wie listig und schlau. Kein Taubenschlag ist ihm zu hoch: er erreicht ihn, und sei es auf Umwegen der schwierigsten Art. Eine Oeffnung, welche den Kopf durchläßt, genügt an Weite auch dem ganzen Leibe. Auf schlechten Dächern hebt er zuweilen die Ziegeln auf, um zur Beute zu gelangen.«
Seine Nahrung ist fast dieselbe wie die des Edelmarders; gleichwohl wird er weit schädlicher als dieser, weil er viel mehr Gelegenheit findet, dem Menschen merkbare Verluste beizubringen. Wo er nur irgend kann, schleicht er sich in die Wohnungen des Hausgeflügels ein und würgt hier mit unersättlicher Mordlust. Nicht selten findet man zehn bis zwölf, ja selbst zwanzig Stück todtes Geflügel, welches er in einer einzigen Nacht umgebracht hat. Außerdem fängt er Mäuse, Ratten, Kaninchen, allerhand Vögel und, wenn er im Walde jagt, Eichhörnchen, Kriechthiere und Lurche. Eier scheinen für ihn ein Leckerbissen zu sein, und auch an Früchten aller Art, Kirschen, Pflaumen, Birnen und Stachelbeeren, Vogelbeeren, Hanf und dergleichen findet er Gefallen. Gute Obstsorten muß man vor ihm schützen und erreicht diesen Zweck einfach dadurch, daß man, sobald man den Unfug wahrnimmt, den Stamm mit Tabaksaft oder Steinöl bestreicht. Hühnerhäuser und Taubenschläge muß man aber durch festes Verschließen vor ihm bewahren und dabei bedacht sein, jedes nur halbwegs große Rattenloch zu stopfen. Außer dem Schaden, welchen er den Geflügelbesitzern anrichtet, wird er noch besonders deshalb sehr lästig, weil er die bedrohten Thiere so erschreckt, daß sie, d. h. die glücklich entkommenen, lange Zeit gar nicht wieder in den Stall gehen wollen. Seine Mordlust wird zur förmlichen Raserei, und das Berauschen des Marders im Blute seiner Schlachtopfer scheint thatsächlich begründet zu sein. Nach von ihm angerichteten Blutbädern in Taubenschlägen und Hühnerställen, hat man, laut Müller, den Marder in solchen Behältern wie in einem Schlupfwinkel schlafend angetroffen. »Vor einigen Jahren«, erzählt dieser Gewährsmann, »wurde ein Taubenschlag in der Nähe Alsfelds geplündert. Sämmtliche Tauben ließen ihr Blut. Der Marder wurde, offenbar berauscht, Tags darauf in einer Hecke, nahe den Gebäuden angetroffen und zwar in einem Zustande eigenthümlicher Blödigkeit und Dummheit, so daß er ohne Mühe und List erlegt werden konnte. Bei solchen Gelegenheiten verachtet er das Fleisch, und der Kopf mit dem wohlschmeckenden Hirn ist noch das einzige, was er als Nachtisch verzehrt. Uebrigens schleift er da, wo es möglich ist, mehrere Körper nach, um für künftige Tage zu sorgen.«
Gewöhnlich beginnt die Rollzeit drei Wochen später als die des Edelmarders, meist zu Ende Februars. Dann hört man, noch öfters als sonst, das katzenartige Miauen des Thieres und wohl auch ein merkwürdiges Murren und Zanken auf den Dächern, woselbst ein paar verliebte Männchen sich herumbalgen. Um diese Zeit riecht der Steinmarder stärker als je nach Bisam, im Zimmer so, daß man es kaum aushalten kann, und lockt damit wahrscheinlich andere seiner Art herbei. Nicht allzuselten paart er sich auch mit dem Edelmarder und erzeugt mit diesem lebenskräftige Blendlinge. Im April oder Mai wirft das Weibchen drei bis fünf Junge, welche von ihm ungemein geliebt, sorgfältig verborgen und später eingehend unterrichtet werden. »Die Mutter«, schildert Müller, »ist auf das angelegentlichste bemüht, den Kindern vorzuturnen. Ich habe Gelegenheit gehabt, dies einige Male zu sehen. In einem Parke stand eine fünf Meter hohe Mauer in Verbindung mit einer Scheune, in welcher ein Marderpaar mit vier Jungen hauste. Zur Zeit der einbrechenden Dämmerung kam zuerst die Alte vorsichtig hervor, sah scharf sich um und lauschte, schritt sodann langsam, nach Art der Katzen, einige Schritte weit auf der Mauer dahin und blieb dort ruhig sitzen. Es verging eine Minute, ehe das erste Junge erschien und sich neben sie drückte; ihm folgte rasch das zweite, das dritte und vierte. Nach einer kurzen Pause völliger Regungslosigkeit erhob die Alte sich bedächtig und durchmaß in fünf bis sechs Sätzen eine lange Strecke der Mauer. Mit eiligen Sprüngen folgte das kleine Volk. Plötzlich war die Alte verschwunden, und, kaum meinem Ohre vernehmlich, hörte ich einen Sprung in den Garten. Nun machten die Kleinen lange Hälse, unentschlossen, was sie thun sollten. Endlich entschieden sie sich, einen an der Mauer stehenden Pappelbaum benutzend, hinabzuklettern. Kaum waren sie unten angelangt, als ihre Führerin an einer Hollunderstaude wieder auf die Mauer sprang. Diesmal wurde das Kunststück ohne Zögern von den Jungen nachgeahmt, und erstaunlich war es, wie sie den leichteren Weg in raschem Ueberblick zu finden wußten. Nunmehr aber begann das Rennen und Springen mit solchem Eifer und in so halsbrechender Weise, daß das Spielen der Katzen und Füchse mir dagegen wie Kinderspiel vorkam. Mit jeder Minute schienen die Zöglinge gelenker, gewandter und entschlossener zu werden. An Bäumen auf und nieder, über Dach und Mauer hin und zurück, immer der Mutter nach, zeigten diese Thiere eine Fertigkeit, welche zur Genüge andeutete, wie sehr die Vögel des Gartens künftig vor ihnen auf der Hut würden sein müssen.«
Mit ihren Jungen gefangene Mardermütter widmen sich ersteren auch im Käfige ohne Scheu und Zögern. Ein säugendes Weibchen, welches Lenz besaß, machte keine Umstände, sondern versorgte sein Junges vor Aller Augen. Das kleine Thierchen kreischte oft laut, wenn es hungrig oder mißvergnügt war, roch auch, wenn es von der Alten nicht rein gehalten wurde, nach Bisam, während Lenz an dem alten Weibchen nur wenig Geruch wahrnehmen konnte. Zuweilen hat man junge Steinmarder durch Katzen aufziehen lassen, weil diese sich, wie ich oben mitgetheilt habe, gern einem so auffallenden Pflegegeschäfte hingeben. Solche Jungen werden sehr zahm und zu förmlichen Hausthieren. Sie gehen aus und ein, verunglücken aber fast alle früher oder später, weil sie ihre Räubereien nicht lassen können. So hatte ein Schuhmacher einen jungen Steinmarder aufgezogen und gezähmt. Ungeachtet das Thier hinlänglich Nahrung erhielt, konnte es doch sein natürliches Wesen nicht verleugnen und verübte zahlreiche Verbrechen an Eigenthum und Leben. Seine Streifereien ermüdeten sehr bald die Geduld der Nachbarn unseres Thierfreundes; eines schönen Tages wurde das ihm sehr theure Wesen daher durch allgemeinen Beschluß feierlich zum Tode verurtheilt und dieser Richterspruch auch ausgeführt.
Selbst alt eingefangene Thiere erreichen einen gewissen Grad von Zähmung. In Schottland fing man einmal einen Steinmarder auf absonderliche Weise. Lange Zeit hatte der ungebetene Gast in einem Gebirgsdorfe gehaust und dort an dem Hühnergeschlechte namenlose Schandthaten verübt. Es gab keinen einzigen Hühnerstall im Dorfe, in welchem nicht Wehklage über ihn erhoben worden wäre: da entdeckte man seinen Aufenthaltsort. Mit Hülfe von guten Hunden trieb man ihn endlich aus der einsamen Scheuer, seiner Räuberhöhle, fort und ins Freie. Vergebens versuchte er alle List und Gewandtheit, den Hunden zu entgehen. Sie kamen ihm näher und näher und hatten ihn, als er zum Rande eines Abgrundes gelangt war, beinahe gefaßt. Er entschloß sich kurz und sprang mit einem einzigen kühnen Satze in die wohl dreißig Meter tiefe Schlucht hinab. Der Sturz war doch zu heftig; denn unten lag er wie todt und rührte und regte sich nicht. Seine Verfolger waren der festen Ueberzeugung, daß er sich zerschellt habe. Des Felles wegen stieg einer der Leute hinab und hob den Verunglückten auf. Plötzlich begann dieser, von neuem sich zu regen, gab seinem Fänger auch sofort mit einem gehörigen Bisse das deutlichste Zeichen seines wiedererlangten Bewußtseins. Gleichwohl ließ der verwundete Mann das Thier nicht fahren, sondern faßte es sicher am Halse und brachte es so nach Hause. Hier wurde es freundlich und mild behandelt und war nach wenig Zeit wirklich zahm, sei es nun infolge des hohen Sturzes oder aus Dankbarkeit für die ihm angethane Freundschaft. Der Besitzer beschloß, ihn als Mäusefänger zu verwenden und brachte ihn in den Pferdestall. Hier war er binnen kurzem nicht nur eingewohnt, sondern hatte sich sogar einen Freund zu erwerben gewußt und zwar – eines der Pferde selbst. So oft man in den Stall trat, fand man ihn bei seinem Gesellen, den er durch dumpfes Knurren gleichsam zu vertheidigen suchte. Bald saß er auf dem Rücken des Pferdes, bald auf dem Halse, bald rannte er auf ihm hin und her, bald spielte er mit dem Schwanze oder mit den Ohren seines Gastfreundes, und dieser schien höchst erfreut zu sein über die Zuneigung, welche der kleine Räuber zu ihm gefaßt hatte. Leider wurde dieser merkwürdige Freundschaftsbund grausam zerrissen. Der Marder gerieth bei einem seiner nächtlichen Ausflüge in eine Falle und wurde am anderen Morgen todt in ihr gefunden.
Auch der Steinmarder ist ein höchst angenehmes Thier in der Gefangenschaft, unterhaltend wegen der außerordentlichen Behendigkeit und Anmuth seiner Bewegungen, eigentlich auch keinen Augenblick in Ruhe, da er sich rennend, kletternd, springend, ohne Unterlaß in allen Richtungen bewegt. Die Gewandtheit des Thieres läßt sich schwer beschreiben, und wenn er zuweilen sich recht übermüthig herumtummelt, kann man kaum unterscheiden, was Kopf oder Schwanz von ihm ist. Doch macht ihn der unangenehme Geruch, welchen namentlich das Männchen verbreitet, oft widerlich, und er wird auch durch seine Mordlust anderen, schwachen Thieren sehr gefährlich.
Jagd und Fang des Steinmarders erfordern einen wohlerfahrenen Weidmann. Das Thier hält zwar seine Wechsel mit größter Regelmäßigkeit ein, wird jedoch leicht mißtrauisch und weiß dann selbst den geschicktesten Jäger zu überlisten. »Die gerühmte Vorsicht und den scharfen Witterungssinn des Marders«, bemerkt Müller, »fanden wir durch unsere Erfahrung nicht allein bestätigt, sondern unsere Erwartungen noch weit übertroffen. Jede Veränderung des auf dem Passe vom Marder besuchten Ortes, jede kleine Erhöhung, jeder verdächtige Gegenstand kann ihn auf Wochen und Monate vertreiben. Nur dann, wenn es gelungen ist, ihn durch den Köder an einer Stelle vertraut zu machen, fängt man ihn ohne besondere Mühe im Schwanenhalse oder in der Kastenfalle.« Verzweiflungsvoll sind oft seine Sprünge, wenn es sich darum handelt, der Verfolgung zu entgehen oder einer anderen Bedrängnis los zu werden. In einem mit Läden verschlossenen Gartenhause, durch dessen vier Meter hohe Decke eine Luke nach dem Dachboden führte, fand der Besitzer, wie Müller noch mittheilt, eines Morgens sämmtliche Glasscheiben zerbrochen und bedeutende Blutspuren, auch Marderhaare an denselben. Die Wände des Raumes waren an vielen Stellen bis zur Decke zerkratzt, und deutlich sah man, daß von dem verzweifelnden Thiere, welches in der Nacht durch die Luke vom Boden herab gesprungen sein mußte, viele mißlungene Kletter- und Springversuche gemacht worden waren, bevor es sein Ziel glücklich erreicht hatte.
Deutschland oder Mitteleuropa liefert, nach Lomer, jährlich 250,000, der Norden Europas 150,000 Steinmarderfelle in den Handel, und die Gesammtausbeute hat einen Werth von mehr als vier Millionen Mark. Die schönsten, größten und dunkelsten Felle kommen aus Ungarn und der Türkei. Sie stehen am höchsten im Preise, während die in Deutschland erbeuteten höchstens mit zehn Mark bezahlt werden.
An unsere deutschen Marder reiht der hochberühmte Zobel ( Martes zibellina, Mustela und Viverra zibellina) auf das innigste sich an. Ihn unterscheiden von dem nah verwandten Edelmarder der kegelförmige Kopf, die großen Ohren, die hohen, starken Beine, die großen Füße und das glänzende, seidenweiche Fell. »Beim Zobel«, bemerkt Mützel, welcher das Glück hatte, auch diesen in unseren Käfigen so seltenen Marder nach dem Leben zeichnen zu können, »dessen Leib und Gliederbau im Vergleiche zu anderen Mardern stark und gedrungen ist, erscheint der Kopf gleichmäßig kegelförmig, man mag ihn betrachten, von welcher Seite man wolle. Die Spitze des Kegels bildet die Nase; die von ihr zur Stirn verlaufende fast gerade Linie steigt steil an, was seinen vorzüglichsten Grund darin hat, daß die sehr langen Haare der Stirn und der Schläfengegend, indem sie sich an die großen, aufrechtstehenden Ohren anlegen, diese in ihrem unteren Theile bedecken und damit den Winkel, welchen die Ohren mit der Oberfläche des Kopfes bilden, ausfüllen. Auch die Haare auf Wangen und Unterkiefer sind lang und nach hinten gerichtet, und beides trägt ebenfalls viel zu der erwähnten Kegelgestalt bei. Die Ohren des Zobels sind die größten und spitzigsten aller mir bekannten Marderarten, viel größer als die des Steinmarders, verleihen daher dem Gesichte einen durchaus eigenthümlichen Ausdruck. Die Beine endlich zeichnen sich vor denen der Verwandten durch ihre Länge und Stärke, die Füße durch ihre Größe aus; letztere machen daher den schwächeren oder zarten Füßchen anderer Marder gegenüber den Eindruck bärenartiger Tatzen, während infolge der verhältnismäßig größeren Länge der Beine die Gesammterscheinung des Thieres durch ihre gedrungene Kürze und die bedeutende Höhe auffällt.«
Das Fell gilt für um so schöner, je größer seine Dichtigkeit, Weichheit und Gleichfarbigkeit, insbesondere aber, je ausgesprochener die ins Bläulichgraue ziehende rauchbraune Färbung des Wollhaares ist. Diese Färbung wird von den sibirischen Zobelhändlern das »Wasser« genannt und nach ihm der Werth des Felles abgeschätzt. Je gelber das Wasser, je lichter das Grannenhaar, um so geringer, je gleichfarbiger und dunkler dieses und das Wasser, um so höher ist der Werth des Felles. Die schönsten Felle sind oberseits schwärzlich, an der Schnauze schwarz und grau gemischt, auf den Wangen grau, am Halse und an den Seiten röthlich kastanienbraun, am Unterhalse schön dottergelb gefärbt; das Ohr pflegt grauweißlich oder lichtblaßbraun umrandet zu sein. Das Gelb der Kehle, welches, laut Radde, bisweilen zum Rothorange dunkelt, bleicht nach dem Tode des Thieres um so rascher aus, je lebhafter es war.

Zobel ( Martes zibellina). [1/4] natürl. Größe.
Bei vielen Zobeln, welche man sogar als Unterarten aufzustellen versucht hat, sind in das oben schwärzliche Fell viele weiße Haare eingestreut, und Schnauze, Wangen, Brust und Untertheile weißlich, bei anderen die Haare der Oberseite gelblichbraun, die der Unterseite, manchmal auch die des Halses und der Wangen weiß und nur die der Beine dunkler; bei manchen herrscht die gelbbräunliche Färbung oben und unten vor und dunkelt nur an den Füßen und an dem Schwanze; einzelne endlich sehen ganz weiß aus.
Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Zobels erstreckt sich vom Ural bis zum Behringsmeere und von den südlichen Grenzgebirgen Sibiriens bis gegen den 68. Grad nördlicher Breite sowie über einen nicht sehr ausgedehnten Theil Nordwestamerikas, ist aber nach und nach sehr beschränkt worden. Die unablässige Verfolgung, welcher er ausgesetzt ist, hat ihn in die dunkelsten Gebirgswälder Nordostasiens zurückgedrängt, und da ihm der Mensch auch hier begierig, ja mit Aussetzung seines Lebens, nachfolgt, muß er immer weiter sich zurückziehen und wird immer seltener. »In Kamtschatka«, sagt Steller, »hat es bei der Eroberung der Halbinsel so viele Zobel gegeben, daß es den Kamtschadalen nicht die geringste Schwierigkeit machte, Zobelfelle zur Bezahlung der Steuern zusammenzubringen; ja die Leute lachten die Kosaken aus, daß sie ihnen ein Messer für ein Zobelfell gaben. Einmal hatte ein Mann, ohne sich anstrengen zu müssen, sechszig, achtzig und noch mehr Zobel in einem Winter zusammengebracht. Es gingen deshalb ganz erstaunliche Mengen von Zobeln aus dem Lande, und ein Kaufmann konnte durch Tauschhandel mit Eßwaaren leicht das Funfzigfache gewinnen. Ein Beamter, der in Kamtschatka war, kam als reicher Mann, wenigstens als ein Besitzer von dreißigtausend Rubeln und mehr nach Jakutsk zurück.« Diese Goldzeit für die Zobelhändler gründete Fängergesellschaften auf Kamtschatka, von da ab verminderten sich die Thiere dergestalt, daß zu Stellers Zeiten, also etwa vor hundert Jahren, nicht einmal der zehnte Theil der Zobelfelle ausgeführt wurde wie früher. In jener Zeit, welche Steller erwähnt, kostete ein vorzügliches Zobellfell nicht mehr als einen Silberrubel, ein mittelgutes aber bloß einen halben, und ein schlechtes kaum einen Fünftelrubel, während sie gegenwärtig um das Sechszigfache theuerer sind. Demungeachtet ist Kamtschatka immer noch einer der reichsten Orte an Zobeln, und die Thiere können auch, der vielen und beschwerlichen Gebirge wegen, nicht so leicht vertilgt werden als an anderen Orten Sibiriens. Sie können auch nicht so leicht aus Kamtschatka auswandern, weil ihnen nach drei Seiten das Meer, nach der vierten große Torfmoore den Weg versperren. Doch sind sie auch hier in steter Abnahme begriffen und finden sich bloß noch an den unzugänglichsten Orten.
In anderen Ländern und Gegenden Ostasiens verhält es sich ebenso wie in Kamtschatka. Radde bemerkt, daß im Quellgebiete des Jenisei und im östlichen Sajan der Zobel immer seltener wird, ja in einzelnen Gegenden dieser seiner ursprünglichen Heimat gar nicht mehr vorkommt. Noch vor fünfundzwanzig Jahren, so erzählte man unserem Naturforscher, erlegte jeder gute Schütze sieben bis acht Zobel in derselben Zeit, in welcher acht bis zehn Jäger jetzt (1856) höchstens fünfzehn der geschätzten Pelzthiere erbeuten. Verfolgung seitens der Jäger ist die Hauptursache der Abnahme dieses Marders; doch unternimmt er auch größere Wanderungen, nach Ansicht der Eingeborenen den Eichhörnchen, seinem Lieblingswilde, nachziehend. Beim Verfolgen gedachter Nager durchschwimmt er ohne Bedenken breite Ströme, selbst während des Eisganges, so sehr er diese sonst zu meiden scheint. Sehr beliebte Aufenthaltsorte von ihm sind die Arvenwaldungen, deren riesige Stämme ihm ebensowohl passende Schlupfwinkel wie in den Samen ihrer Zapfen eine erwünschte Speise bieten.
»Der Zobel«, sagt Radde, »ist im Verhältnis zu seiner geringen Größe unter allen Thieren Ostsibiriens wohl das schnellste, ausdauerndste und stellenweise durch Verfolgung der Menschen das gewitzigste. Auch an ihm, wie an den meisten anderen Thieren, welche zu den klugen zählen, läßt sich sehr wohl eine Bildungsfähigkeit der geistigen Grundlagen überall da nachweisen, wo bei häufigerem Begegnen mit den nachstellenden Jägern sie genöthigt wurden, ihre Körperkraft und List in gesteigerter Weise zu gebrauchen. So wird der Zobel im Baikalgebirge, wo er die Trümmergesteine mit ihren Löchern und Gängen sehr gut zu benutzen weiß, viel schwerer durch Hunde gestellt als im Burejagebirge, in welchem er die hohlen Bäume aufsucht und jene Gesteinsritzen meidet. Hier zeigt er sich nicht ausschließlich als nächtliches Raubthier, wie dort er es ist, sondern geht, weniger behindert, seiner Nahrung auch während des Tages nach und schläft nur dann, wenn er durch die nachts erworbene Beute gesättigt wurde. Am liebsten und eifrigsten schweift er vor Sonnenaufgang um die Thalhöhen. Seine Spur ist etwas größer als die verwandter Marder und zeichnet sich infolge der längeren seitlichen Zehenbehaarung durch die größere Undeutlichkeit der Umrisse aus; auch setzt er beim Laufen gemeiniglich den rechten Vorderfuß zuerst vor.« Hinsichtlich seines Auftretens scheint das Thier am meisten dem Edelmarder zu gleichen, dessen Gewandtheit und Kletterfertigkeit es theilt. Die Nahrung besteht hauptsächlich in Eichhörnchen und anderen Nagern, Vögeln und dergleichen; doch verschmäht der Zobel auch Fische nicht, da er sich durch Fischköder in Fallen locken läßt. In den höher gelegenen Gegenden des Sajan will man, laut Radde, beobachtet haben, daß ihm der Honig wilder Bienen besonders lieb sei. Cedernnüsse sind ihm eine sehr erwünschte Speise: die Magen der meisten, welche Radde erbeutete, waren mit diesen Samenkernen straff gefüllt. Die Rollzeit soll in den Januar fallen und das Weibchen ungefähr zwei Monate später drei bis fünf Junge zur Welt bringen.
Jagd und Fang des Zobels setzen alljährlich die gesammte waffenfähige Mannschaft ganzer Stämme in Bewegung und treiben Kaufleute durch Tausende von Meilen. Dem Jäger winkt ein hoher Gewinn, wenn er glücklich ist, er geht jedoch bei der Zobeljagd auch vielfachen Gefahren entgegen. Ein plötzlich hereinbrechender Schneesturm raubt ihnen oft alle Hoffnung, zu ihren Freunden zurückzukehren. Nur die größte Abhärtung und eine oft geprüfte Erfahrung kann den Jäger aus Gefahren erretten, und es fallen von Jahr zu Jahr noch genug Opfer. Wie uns schon Steller und später der Russe Schtschukin berichten, finden sich gegenwärtig die meisten Zobel noch in den finsteren Wäldern zwischen der Lena und dem östlichen Meere, und der Ertrag ihrer Felle bildet jetzt noch immer den bedeutendsten Zweig des Einkommens der Eingeborenen und der russischen Ansiedler. Vom Oktober an währen die Jagden bis zur Mitte des November oder bis Anfang Decembers. In kleine Genossenschaften vereinigen sich die kühnen Jäger auf den Jagdplätzen, wo jede Gesellschaft ihre eigenen Wohnungen hat; die Hunde müssen während der Reise zugleich die Schlitten ziehen, welche mit Lebensmitteln für mehrere Monate beladen sind. Nun beginnt die Jagd, wesentlich noch immer in derselben Weise, wie Steller sie beschreibt. Man verfolgt auf Schneeschuhen die Spur des Zobels, bis man sein Lager antrifft oder ihn bemerkt; man stellt Fallen oder Schlingen der allerverschiedensten Arten. Entdeckt man einen Zobel in einer Erd- oder Baumhöhle, in welche er sich zurückgezogen hat, so stellt man ringsum ein Netz und treibt ihn aus seinem Schlupfwinkel, oder man fällt den Baum und erlegt dann den Flüchtenden mit Pfeilen und mit der Flinte. Am beliebtesten sind diejenigen Fallen, in denen sich die Thiere fangen, ohne ihrem Felle irgendwie Schaden zu thun. Der Jäger braucht mehrere Tage mit seinen Genossen, um alle die Fallen zurechtzumachen, und oft genug findet er dann beim Nachsehen, welches er täglich vornehmen muß, daß ein naseweiser Schneefuchs oder ein anderes Raubthier die kostbare Beute aufgefressen hat bis auf wenige Fetzen, welche gleichsam noch daliegen, um ihm sicher zu beweisen, daß er beinahe eine Summe von vierzig, fünfzig, ja sechszig Silberrubel hätte verdienen können! Oder der Arme wird von Ungewitter aller Art überrascht und muß nun eilig darauf bedacht sein, sein eigenes Leben zu retten, ohne weiter an die Auslösung der möglicherweise gefangenen Thiere zu denken. So ist der Zobelfang eigentlich eine ununterbrochene Reihe von Mühseligkeiten aller Art. Wenn endlich die Gesellschaften zurückkehren, stellt es sich häufig heraus, daß kaum mehr als die Kosten, niemals aber die Beschwerden bezahlt sind. Und hat man dann glücklich seine Beute eingeheimst, so kommen auch noch die gierigen Pfaffen oder die nicht minder habsüchtigen Beamten der Krone und fordern jenem Armen mehr als ein Zehntel seines Erwerbes ab.
In den Hochgebirgen des südlichen Baikal fängt man, laut Radde, schon Ende Septembers an, die Zobeljagd zu betreiben, weil das Thier hier seinen Winterpelz früher anlegt als in tieferen Gegenden. Die schwierige Zugänglichkeit der meisten Thalhöhen des Gebirges hat die Jäger eine besondere Jagdweise und besonderes Fangzeug, Kurkafka genannt, ersinnen lassen. Der Zobel geht, zumal zu so vorgerückter Jahreszeit, nicht gern ins Wasser, sondern sucht sich zum Uebergange von Bächen die Windfälle auf, welche je zwei Bachufer überbrücken. Nun hauen die Zobeljäger, im Thale aufwärts gehend, absichtlich viele Stämme an den Ufern des Baches um und lassen sie über letzteren fallen. Etwa in der Mitte solcher schmalen Brücken befestigen sie aus dicker Weiden- oder Birkenruthe einen Bogen und bringen seitwärts so viele schlanke und hohe Weidenruthen an, daß der Zobel nicht gut über dieselben hinwegspringen kann, sondern beim Uebergange auf die Mitte unter dem Bogen angewiesen ist. Hier aber hängt eine Haarschlinge, welche oben im Bogen nur lose eingekerbt, dagegen an einem längeren mit einem Steine beschwerten Haarseile befestigt ist. Der Zobel, welcher solche Brücke überschreitet, geräth trotz aller Vorsicht mit dem Halse in die Schlinge, wird von dem lose aufliegenden Steine in die Tiefe des Wassers gerissen, festgehalten und ertränkt. Außerdem bedient man sich der Prügelfalle, welche das den Köder ausnehmende Raubthier erschlägt, legt Stellpfeile und andere Selbstgeschosse, folgt mit Hunden seiner Spur, falls nicht Trümmergestein vorhanden ist, und läßt es sich nicht verdrießen, tagelang dem unruhigen Thiere nachzulaufen, bis der Hund endlich es gestellt hat, und es, meist erst durch Ausräuchern aus der Höhle, zum Schusse gebracht werden kann.
Ueber das Gefangenleben des Zobels sind die Berichte noch sehr dürftig. In Sibirien fängt man das kostbare Thier erklärlicherweise nur auf Bestellung für den Käfig, und von den wenigen, welche man zähmt, kommt höchst ausnahmsweise einer oder der andere lebend zu uns, wie beispielsweise derjenige, welchen Mützel zeichnen konnte. Ein Zobel wurde in dem Palaste des Erzbischofs von Tobolsk gehalten und war so vollkommen gezähmt, daß er nach eigenem Ermessen in der Stadt lustwandeln durfte. Er verschlief, wie seine Verwandten, den größten Theil des Tages, war aber bei Nacht um so munterer und lebendiger. Wenn man ihm Futter gereicht hatte, fraß er sehr gierig, verlangte dann immer Wasser und fiel nun in einen so tiefen Schlaf, daß er während der ersten Stunden desselben wahrhaft ohne Gefühl zu sein schien. Man konnte ihn zwicken und stechen, er rührte sich nicht. Um so munterer war er bei Nacht. Er war ein arger Feind von Raubthieren aller Art. Sobald er eine Katze sah, erhob er sich wüthend auf die Hinterfüße und legte die größte Lust an den Tag, mit ihr einen Kampf zu bestehen. Andere gezähmte Zobel spielten sehr lustig mit einander, setzten sich oft aufrecht, um so besser fechten zu können, sprangen munter im Käfige umher, wedelten mit dem Schwanze, wenn sie sich behaglich fühlten, und grunzten und knurrten im Zorne, wie junge Hunde.
Schon in Sibirien bezahlt man für ein Zobelfell aus erster Hand 20 bis 25 Rubel Silber; bei uns schwankt der Preis desselben zwischen 30 bis 500 Mark. Die schönsten Felle liefern die östlichen Provinzen Sibiriens, Jakutsk und Ochotsk, minder schöne die Länder an dem Jenisei, der Lena und dem Amur. Aus Sibirien, Nordchina und Nordwestamerika gelangen, nach Lomer, jährlich 199,000 Felle im Gesammtwerthe von 4,350,000 Mark in den Handel.
Im Nordosten und hohen Norden Amerikas wird der Zobel vertreten durch den Fichtenmarder oder amerikanischen Zobel ( Martes americana , Mustela americana, vulpina, leucopus, leucotis und huro), ein Thier von 45 Centim. Leibes- und 15 Centim. Schwanzlänge, welches dem Edelmarder näher steht als dem Zobel. Die Färbung ist ein mehr oder minder gleichmäßiges Braun; der Brustfleck sieht gelb, der Kopf einschließlich der Ohren grau oder weiß aus. Das Haar ist bedeutend gröber als beim Zobel und kommt dem unseres Edelmarders etwa gleich.
Die schönsten Felle stammen aus den Küstenländern der Hudsonsbai, den Gegenden am Großen und Kleinen Walflusse, Ostmaine und aus Labrador. Nach Lomer kommen jährlich ungefähr 100,000 Stück in den Handel, und wird das Stück der besten mit 75 Mark bezahlt.
Denselben Ländern entstammt der Fischermarder, Fischer der Nordamerikaner, Pekan der Kanadier, Wijack der Indianer ( Martes Pennantii , Mustela Pennantii, canadensis, melanorhyncha, nigra, piscatoria und Goodmanii, Viverra canadensis und piscatoria, Gulo castaneus und ferrugineus), ein großes, stämmiges, »fuchsartiges« Thier von mehr als 60 Centim. Leibes- und 30 bis 35 Centim. Schwanzlänge. Der aus dichtem, feinem, glänzendem Grannenhaar und langem, weichem Wollhaar bestehende Pelz hat in der Regel sehr dunkle, selbst schwarze Färbung, und nur am Kopfe, im Nacken und auf dem Rücken mischt sich Grau ein; doch gibt es auch sehr helle, kastanien- oder hellbraune und selbst gilblichweiße Stücke.
Das Vaterland des Fischermarders erstreckt sich über den ganzen Norden Amerikas. In der Lebensweise ähnelt er bald mehr dem einen, bald mehr dem anderen seiner Verwandten. Seine gewöhnlichen Wohnungen sind Höhlen, welche er sich in der Nähe von Flußufern ausgräbt. Die Nahrung soll größtentheils aus Fleisch von Vierfüßlern bestehen, welche nahe am Wasser leben. Die Jagd wird von den jungen Indianern betrieben, welche in dem bissigen Geschöpfe ein Wesen finden, an dem sie ihren Muth erproben können, während sie sich bei der Jagd noch nicht so großen Gefahren aussetzen, wie sie Männer ihres Stammes zu bestehen haben, wenn sie zum Kampfe mit den grimmigen Bären hinausziehen. Da man im Norden Amerikas wie in Rußland das Fell des Fischermarders besonders schätzt und mit 30 bis 60 Mark bezahlt, auch für einen aus ihm bereiteten Pelz gern 1200 bis 4000 Mark ausgibt, gelangen verhältnismäßig wenige Felle in den Handel, mindestens auf unseren Markt, immerhin aber noch für mehr als 300,000 Mark jährlich.
Das letzte Mitglied der Sippe, welches allgemeiner gekannt zu werden verdient, ist der Charsamarder der Birar-Tungusen ( Martes flavigula , Mustela flavigula, Hardwickii, leucotis, Elliotii und lasiotis, Viverra quadricolor) aus Nepal, Java, Sumatra, den Vorbergen des Himalaya und den nordöstlicher liegenden Gebirgen bis zum Amurlande. Er zählt zu den größten Arten seiner Sippschaft; seine Leibeslänge beträgt 61 Centim., seine Schwanzlänge 46 Centim. Der Kopf, einschließlich der Ohren und ein seitlicher Halsstreifen, Hintertheil, Füße und Schwanz sind schwarz oder braunschwärzlich, Oberlippe, Kinn und Kehle rein weiß, alle übrigen Theile glänzend hellgelb, auf der Bauchseite reiner und heller als oben, an dem Halse und an der Kehle guttigelb.
Radde fand den Charsamarder, welchen man bis zu seiner Reise nur in den südasiatischen Gebirgen beobachtet hatte, auch im Amurlande auf. Das Thier lebt nach seiner Beschreibung meistens zu zweien oder dreien und betreibt gemeinschaftlich seine Jagden, ist äußerst schnell im Laufen, geschickt im Klettern, und wählt nicht wie der Zobel gewisse Thalhöhen zu seinem alltäglichen Ruheplatze, sondern schweift beständig umher. Der Marderhund wird ihm während des Sommers vorzugsweise zur Beute; selbst den bissigen Dachs greift er, falls er in Gesellschaft ist, muthig an und überwindet ihn; mit anderen seinesgleichen verfolgt er Rehe und Moschusthiere; im Herbste zieht er den Eichhörnchen nach und betreibt dann in den dichten Arven- und Cedernwaldungen seine Jagden auch auf Bäumen, während er dieses sonst nur im Nothfalle thut, weil ihn seine Schwere untüchtig macht, die biegsamen Spitzen der Aeste zu betreten und von ihnen auf die nächstgelegenen zu springen. Von Hunden gestellt, vertheidigt er sich wie der Luchs, auf dem Rücken liegend und Klauen und Zähne als Waffen gebrauchend. Ueber die Fortpflanzung fehlen Berichte. Gefangene sind wiederholt auch im Londoner Thiergarten gehalten worden; sie waren ebenso zahm, gut gelaunt, spiellustig und anhänglich, als irgend ein Marder es werden kann, und gaben nur einen unbedeutenden Mardergeruch von sich.
Stinkmarder oder Stänker ( Foetorius oder Putorius) heißen die Mitglieder einer anderen Sippe, und zwar zu Ehren des allbekannten Iltis, welcher den obigen Namen allerdings verdient, während dies bei anderen Arten der Gruppe keineswegs der Fall ist. Die hierher gehörigen Marderarten kennzeichnen sich durch vorn stark verschmälerten Kopf, zugespitzte Schnauze, kurz abgerundete, dreiseitige Ohren, schlanken und langgestreckten Leib, kurze Beine mit langzehigen Füßen und runden, ziemlich lang behaarten Schwanz von noch nicht halber Leibeslänge. Das Gebiß besteht aus 34 Zähnen und zwar sechs Schneidezähnen und einem Eckzahne in jedem Kiefer, zwei Lückzähnen im oberen, drei im unteren Kiefer und zwei Backenzähnen oben und unten, deren erster, der sogenannte Reißzahn, in beiden Kiefern stark und kräftig entwickelt ist, während der dreimal so breite als lange Höckerzahn durch seine Querstellung auffällt. Fast alle Arten der Sippe halten sich in Erdlöchern oder Gebäuden auf und stehen in Raublust und Mordsucht hinter den verwandten Mardern nicht im geringsten zurück, erwerben sich aber durch Wegfangen schädlicher Nager, beziehentlich Schlangen, durchschnittlich viel größere Verdienste als jene. Man theilt die Gruppe ein in drei Untersippen: Iltisse, Wiesel und Sumpfottern; die Unterscheidungsmerkmale zwischen ihnen sind jedoch sehr untergeordneter Art und beziehen sich hauptsächlich auf die Färbung des Pelzes sowie unwesentliche Eigenschaften des Schädels.
Der Iltis, Eltis, Jlk, Elk, Iltnis, Stänker, Stänkermarder, Stinkwiesel, Stölling oder Ratz ( Foetorius Putorius , Mustela und Viverra Putorius, Mustela Eversmanni und foetida, Putorius foetidus, typus, communis und vulgaris) hat eine Leibeslänge von 40 bis 42, eine Schwanzlänge von 16 bis 17 Centim. Der Pelz ist unten einfarbig schwarzbraun, oben und an den Rumpfseiten heller, gewöhnlich dunkelkastanienbraun, an dem Oberhalse und den Seiten des Rumpfes, wegen des besonders hier durchschimmernden gelblichen Wollhaares, lichter. Ueber die Mitte des Bauches verläuft eine undeutlich begrenzte röthlichbraune Binde; Kinn und Schnauzenspitze, mit Ausnahme der dunklen Nase, sind gelblichweiß. Hinter den Augen steht ein kaum begrenzter gelblichweißer Flecken, welcher mit einer undeutlichen, unterhalb der Ohren beginnenden Binde zusammenfließt. Letztere sind braun und gelblichweiß gerändert, die langen Schnurren schwarzbraun. Verschiedene Abänderungen, welche zum Theil als eigene Arten angesehen worden sind, kommen vor, unter anderen auch Weißlinge oder ganz gelb gefärbte Iltisse. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen hauptsächlich durch rein weiße Färbung aller Stellen, welche bei jenem gelblich sind. Der Pelz ist zwar dicht, aber doch weit weniger schön als der des Edelmarders.

Frettchen ( Foetorius Furo) und Iltis ( Foeterius Putorius). ¼ natürl. Größe.
Im südöstlichen Europa, nach Norden hin bis Polen vordringend, tritt neben dem Iltis ein Verwandter auf: der Tigeriltis ( Foeterius sarmaticus , Mustela sarmatica, Peregusna und praecincta, Viverra sarmatica). Seine Gesammtlänge beträgt 50 Centim., wovon 16 Centim. auf den Schwanz kommen. Das kurzhaarige und straffe Fell ist auf der Oberseite und der Außenseite braun, mit unregelmäßigen gelben Flecken gezeichnet, am Kopfe, aus der Unterseite und der Innenseite der Beine schwarz; die Kehle rostweißlich gefleckt; die Lippen und eine hinter den Augen über den Scheitel verlaufende Binde sind weiß, die Ohren an der Wurzel braunschwarz, an der Spitze rostweißlich; der verhältnismäßig lange Schwanz hat an der Wurzel braune und gelbbunte, in der Mitte blaßgelbliche, an der Spitze schwarze Färbung. Hinsichtlich der Lebensweise, der Sitten und Gewohnheiten ähnelt der Tigeriltis durchaus seinem Verwandten, so daß es ausreichend sein dürfte, ein Lebensbild des letzteren zu entwerfen.
Der Iltis bewohnt die ganze gemäßigte Zone von Europa und Asien, geht sogar ein Stück in den nördlichen Gürtel hinüber. Mit Ausnahme von Lappland und Nordrußland ist er überall in unserem Erdtheile zu finden. In Asien trifft man ihn durch die Tartarei bis an den Kaspischen See und nach Osten hin durch ganz Sibirien bis nach Kamtschatka. Ihm ist jeder nahrungversprechende Ort recht, und deshalb bewohnt er ebenso die Ebenen wie die Gebirge, die Wälder wie die Felder, vor allem aber die Nähe menschlicher Wohnungen, zumal größerer Bauergüter. Im Freien schlägt er sein Lager in hohlen Bäumen, im Geklüft, in alten Fuchsbauen und anderen Erdlöchern auf, welche er zufällig findet; im Nothfalle gräbt er sich selbst einen Bau. Auf den Feldern bezieht er das hohe Getreide; außerdem haust er in der Nähe von Felsen, zwischen Pfahlwerk, unter Brücken, in altem Gemäuer, dem Gewurzel größerer Bäume, dichten Hecken: kurz er weiß es sich überall wohnlich zu machen, wo es irgend angeht, scheut sich jedoch vor eigener Arbeit und läßt lieber andere Thiere für sich graben und wühlen. Im Winter zieht er sich bei uns nach Dörfern oder Städten zurück und kommt hier der Hauskatze oder dem Hausmarder in das Gehege, dabei aber auch gelegentlich in Hühnerhäuser, Taubenschläge, Kaninchenställe und an andere Orte, wo er dann nicht eben zur Freude des Menschen eine Thätigkeit entwickelt, welche bloß von seinen Familienverwandten erreicht, kaum aber übertroffen werden kann. Auf der anderen Seite ist er aber auch nützlich, und wenn die Bauern sonst Hühner, Tauben und Kaninchen gut verwahren, können sie mit ihrem Gaste ganz zufrieden sein; denn dieser fängt ihnen eine unschätzbare Menge von Ratten und Mäusen weg, säubert auch die Nähe der Wohnungen von Schlangen gründlich und verlangt dafür weiter nichts als ein warmes Lager im dunkelsten Winkel des Heubodens. Es gibt Gegenden, wo man ihn ebenso gern sieht, als man ihn an anderen Orten haßt. Er genießt dort eines gewissen Schutzes von Seiten der Landwirte und steht so hoch in der Achtung, daß er auch dann noch für unschuldig erklärt wird, wenn einmal der Hühnerstall oder Taubenschlag von dem nächtlichen Besuche eines gefährlichen Räubers Blutspuren aufweist; denn der Landmann glaubt, daß sein gehegter und gepflegter Ratz unmöglich so grenzenlos undankbar sein könne, ihm den gewährten Schutz mit einem Raubanfalle auf das nützliche Geflügel zu vergelten, und vermuthet in dem Mörder seiner Hühner einen anderen Iltis oder einen Hausmarder, welcher aus irgend einem Nachbarhause herübergeschlichen ist. Das sind freilich Ansichten, welche wohl von Edelmuth und Milde der Gesinnung, aber von sehr wenig Kenntnis des stinkenden Gastes Zeugnis geben. Denn dieser hat, wie Meister Reineke, vom Eigenthum eigentlich gar keinen Begriff und betrachtet den Menschen höchstens als einen gutmüthigen Kauz, welcher ihm durch seine Geflügel- oder Kaninchenzucht dann und wann zu einem leckeren Gerichte verhilft.
Ehe wir Meister Ratz auf seinen Raubzügen weiter verfolgen und uns mit seinem übrigen Leben beschäftigen, wollen wir uns zu seiner besseren Kennzeichnung mit den Beobachtungen vertraut machen, welche Lenz an gezähmten anstellte: sie werden wesentlich dazu dienen, das Bild des Thieres zu zeichnen. Lenz widmet dem Iltis ein hübsches Gedicht wegen seiner tapferen Kämpfe mit dem giftigen Gewürm, nimmt aber klüglicherweise dabei auf seine übrigen Thaten keine Rücksicht und vergißt fast den ganzen Schaden, welchen der Stänker anrichtet. Vollkommen einverstanden müssen wir uns erklären, wenn der genannte Naturforscher jedem Forstmanne anrathet, den Ratz im Walde zu schonen; denn hier ist er an seinem Platze und wirkt unstreitig viel gutes durch Wegfangen der Mäuse und zumal auch der Kreuzottern, sowie er auf dem Felde durch Vertilgung der Hamster sich sehr verdient macht. Doch lassen wir Lenz selbst reden:
»Am 4. August kaufte ich fünf halbwüchsige Iltisse, that sie in eine große Kiste und warf ihnen zehn lebende Frösche, eine lebende Blindschleiche und eine todte Drossel hinein. Am folgenden Morgen waren acht Frösche verzehrt, die Blindschleiche und Drossel noch nicht angerührt. Am zweiten Tage verzehrten sie die beiden lebenden Frösche, die Blindschleiche, drei Hamster und eine zwei Fuß lange Ringelnatter. In der folgenden Nacht fraßen sie die Drossel und sechs Frösche sowie eine fast meterlange, lebende Ringelnatter. Am dritten Tage speisten sie wiederum Frösche nebst zwei großen, tobten Kreuzottern und eine Eidechse. Am vierten Tage fraßen sie vier Hamster und drei Mäuse. Am fünften Tage brachte ich einen Iltis in eine Kiste allein, gab ihm Futter vollauf und, als er satt war, eine große, jedoch matte Kreuzotter. Als ich nach einer Stunde wieder hinkam, hatte er ihr den Kopf zerbissen und sie in eine Ecke gelegt. Nun ließ ich eine große, recht bissige Otter zu ihm; er zeigte vor ihrem Fauchen gar keine Furcht, sondern blieb ruhig liegen (denn der Iltis ruht oder schläft den ganzen Tag, woher die Redensart kommt: »Er schläft wie ein Ratz«), und als ich am anderen Morgen zusah, hatte er sie getödtet. Er befand sich so wohl wie gewöhnlich.
»Am anderen Tage legte ich neben den anderen ruhig in seiner Ecke sich pflegenden Iltis eine recht bissige Otter. Er wollte doch sehen oder vielmehr riechen, was da los wäre; kaum aber rührte er sich, als er zwei Bisse in die Rippen und einen in die Backen bekam. Er kehrte sich wenig daran, blieb aber, wohl hauptsächlich aus Furcht vor mir, ziemlich ruhig. Jetzt warf ich ein Stück Mausefleisch auf die Otter. Er ist nach Mausefleisch außerordentlich lüstern und konnte es daher unmöglich liegen sehen, ohne mit der Schnauze danach zu langen und es wegzukapern, aber wupp! da hatte er wieder einen tüchtigen Biß ins Gesicht. Er fraß sein Fleisch, und ich warf nun ein neues Stück auf die Otter; doch wagte er es nicht mehr es wegzunehmen, sondern ließ sich durch das Fauchen und Beißen abschrecken.
»Während er nun beschäftigt war, wenigstens die Fleischstückchen, welche um die Otter herumlagen, zu beobachten, brachte mir zufällig ein Mann einen anderen, halbwüchsigen Iltis, den ich sogleich kaufte. Er war so fest an allen vier Beinen geknebelt, daß die Bindfaden tiefe Furchen eingeschnitten hatten, und daß er, sobald ich ihn seiner Fesseln entledigt und zu dem anderen gethan hatte, weder stehen noch gehen konnte. Er mußte wohl hungrig sein; denn er schob sich, auf der Seite liegend, mit seinen Beinen, welche alle wie zerschlagen aussahen, nach der Otter hin und wollte von ihr fressen; doch wurde ihm dieses bald durch drei derbe Bisse vergolten, worauf er es bequemer fand, ein Stückchen Mausefleisch zu benagen. Es wollte durchaus nicht gehen; denn seine Kinnladen waren ganz verrenkt, und erst nach einer halben Stunde konnte er wieder ein wenig kauen. Trotzdem nun, daß dieser Unglückliche in einer eisernen Falle gefangen worden war, seine Beine darin gebrochen, dann, fürchterlich geknebelt, einen ganzen Tag gelegen und endlich die Otterbisse geschmeckt hatte: erholte er sich doch nach und nach wieder und ward gesund; die Beine aber blieben lahm. Nachdem ich ihn einige Tage lang durch Frösche, Mäuse, Blindschleichen und Hamster erquickt hatte, legte ich ihm wieder eine tüchtige Otter vor die Füße. Er wollte sie fressen, bekam aber gleich einen furchtbaren Biß in die Backen. Wegen des lahmen Beines war er zu langsam, und da er immer wieder heranrückte, bekam er nach und nach vier Bisse. Jetzt ließ er ab, besann sich jedoch eines bessern, kam wieder, trat mit dem gesunden Fuße auf die Schlange, wobei er eine Menge Bisse erhielt, faßte den Kopf zwischen die Zähne, zermalmte ihn und fraß mit Begierde das ganze Thier. Es zeigte sich gar kein Merkmal von Krankheit. Ich tödtete ihn nach siebenundzwanzig Stunden und zog ihm das Fell ab, fand aber keine Spur der Bisse, als zwei kleine Flecken, die wohl auch vom Knebeln herrühren konnten.
»Doch kehren wir im Gedanken zu dem anderen Iltisse zurück. Er blieb in der Nacht mit der wüthenden Otter zusammen, ohne sie weiter anzutasten. So oft er sich rührte, fauchte sie; als er aber einmal lange Zeit ruhig lag und schlief, ging sie hin und wärmte sich an ihm, kroch jedoch gerade über ihn weg. Es war schon eine Stunde lang dunkel, als ich, wenn ich ohne Licht in das Zimmer trat, sie noch immer fauchen hörte. Endlich, zehn Uhr abends, da ich zu Bette gehen wollte und nochmals mit dem Lichte nachsah, war sie verstummt und zerrissen. – Ein vierter Iltis ließ sich auch noch vier Bisse von einer Otter versetzen. Er litt aber ebensowenig wie die schon angeführten.«
Außer den giftigen Schlangen verzehrt der Iltis nach Marderart alles Gethier, welches er überwältigen kann. Er ist ein furchtbarer Feind aller Maulwürfe, Feld- und Hausmäuse, Ratten und Hamster, selbst der Igel, sowie sämmtlicher Hühner und Enten. Die Frösche scheinen eine Lieblingsspeise für ihn zu sein; denn er fängt sie oft massenweise und sammelt sie in seinen Wohnungen zu Dutzenden. Im Nothfalle begnügt er sich mit Heuschrecken und Schnecken. Aber auch auf den Fischfang geht er aus und lauert an Bächen, Seen und Teichen den Fischen auf, springt plötzlich nach ihnen ins Wasser, taucht und packt sie mit sehr großer Gewandtheit. Außerdem frißt er sehr gern Honig und Früchte. Seine Blutgier ist ebenfalls groß, jedoch nicht so groß wie bei den Mardern. Er tödtet in der Regel nicht alles Geflügel eines Stalles, in welchen er sich geschlichen, sondern nimmt das erste, beste Stück und eilt mit ihm nach seinem Schlupfwinkel, wiederholt aber seine Jagd mehrere Male in einer Nacht. Mehr als andere Marderarten hat er die Gewohnheit, sich Vorrathskammern anzulegen, und nicht selten findet man in seinen Löchern hübsche Mengen von Mäusen, Vögeln, Eiern und Fröschen aufgespeichert. Seine Behendigkeit macht es ihm leicht, sich immer zu versorgen.
In Ostsibirien ändert der Iltis, nach Radde, seine Lebensweise. Er bleibt den dichten Wäldern meistens fern, wählt aber auch nicht wie in Europa die Ansiedelungen der Menschen zu seinem Lieblingsaufenthalte. Wo Wälder sind, bevorzugt er die Ränder derselben oder sucht die Heuschläge auf, welche Feld- und Spitzmäuse anlocken; mehr noch sagt ihm der öde und feste Boden der Hochsteppen zu, weil er hier sein Hauptwild, die Bobaks oder Steppenmurmelthiere, in größerer Menge findet, ebenso wie in den trockeneren Theilen der Hochgebirge ihn eine Zieselart zu fesseln weiß. In den Daurischen Hochsteppen, wo sein Dasein eng an die genannten Murmelthiere geknüpft ist, sorgt er für die lange Winterszeit, in welcher letztere schlafen, sehr listig, indem er schon im Herbste, wenn das Erdreich noch nicht gefroren ist, tiefe Röhren gräbt, welche nach den dann noch leeren Nestern der Murmelthiere führen; hier läßt er aber, sobald er merkt, daß er dem Neste nahe ist, eine dünne Erdschicht stehen, welche er erst im Winter durchbricht, wenn die Murmelthiere, welche die von ihnen selbstgegrabenen Röhren verstopfen, im Winterschlafe liegen. Die Art und Weise, wie der Iltis seine Arbeit anlegt, um später zu den schlafenden Murmelthieren zu gelangen, soll sehr verschieden sein. Zuweilen gräbt er ziemlich senkrecht gegen zwei Meter tief und verfehlt die Stelle, an welcher das Nest sich befindet, nicht, ohne äußere leitende Kennzeichen zu haben; häufig aber gräbt er den Gang der Murmelthiere, welcher mit Steinen und Erde verstopft wird, noch im Spätherbste nach.
Alle Bewegungen des Iltis sind gewandt, rasch und sicher. Er versteht meisterhaft zu schleichen und unfehlbare Sprünge auszuführen, läuft bequem über die dünnste Unterlage, klettert, schwimmt, taucht, kurz macht von allen Mitteln Gebrauch, welche ihm nützen können. Dabei zeigt er sich schlau, listig, behutsam, vorsichtig und mißtrauisch, sehr scharfsinnig und, wenn er angegriffen wird, muthig, zornig und bissig, also ganz geeignet, großartige Räubereien auszuführen. Nach Art der Stinkthiere vertheidigt er sich im Nothfalle durch Ausspritzen einer sehr stinkenden Flüssigkeit und schreckt dadurch oft die ihn verfolgenden Hunde zurück.
Seine Lebenszähigkeit ist unglaublich groß. Er springt ohne Gefahr von bedeutender Höhe herab, erträgt Schmerzen aller Art fast mit Gleichmuth und erliegt nur unverhältnismäßig starken Verwundungen. Lenz führt davon Beispiele an, welche geradezu an das Unglaubliche grenzen. »Es brachte mir ein Mann«, erzählt er, »einen Iltis, welcher unter Bruch seiner Beine in der Falle gefangen worden war. Der Mann glaubte, nachdem er eine halbe Stunde auf ihn losgeprügelt, ihn todtgeschlagen zu haben. Er that ihm Unrecht; denn der Ratz war bald wieder lebendig und biß um sich her. Was war zu thun? Ihn wieder zu knebeln, wäre in der Stube ein böses Geschäft gewesen. Ich gedachte, ihn so schnell als möglich zu tödten, griff zum Bogen und schoß einen mit langer Stahlspitze versehenen Pfeil ihm mitten durch die Brust, so daß er fest an den Boden genagelt war. Nun, dachte ich, ists gut; aber der Ratz dachte nicht so, sondern krümmte sich und fauchte immer noch. Schnell ergriff ich einen zweiten Pfeil, und dieser flog ihm mitten durch den Kopf, gerade durchs Gehirn, und nagelte auch den Kopf an den Boden. Jetzt war endlich Ruhe. Das Thier rührte sich nicht, und nach etwa vier Minuten zog ich den Pfeil aus der Brust und wollte dann den aus dem Kopfe ziehen. Er saß aber so fest in dem Schädelknochen, daß die Stahlspitze in dem Kopfe blieb. Kaum war eine Minute verflossen, so bewegte sich der Iltis und begann zu fauchen. Ich aber hatte es recht satt und sagte dem Manne, er solle mir das Unthier eiligst aus der Stube schaffen und nie wieder bringen.
»Einen anderen großen Iltis hielt ich in einer mit Bretern bedeckten Kiste. Ich hatte beschlossen, ihn, wie gewöhnlich, wieder im Walde an einem von Ottern bewohnten Orte loszulassen, sah aber unerwartet einen Raubvogel, den ich nirgends anders als in die Iltiskiste unterbringen konnte, und wollte deshalb den Iltis schnell herausfangen. Damit kam ich aber nicht sogleich zu Stande, weil er biß und zu entschlüpfen suchte. Als ich sah, daß meine Mühe, ihn am Schwanze oder hinter dem Kopfe zu packen, um ihn herauszuziehen, vergeblich war, und er mir statt des Schwanzes immer die Zähne zeigte, entschloß ich mich kurz, ihn zu erschießen. Aber leider konnte ich durch das Gitter nicht genau zielen. Der erste Pfeil flog ihm gleich hinter den Augen durch den Kopf und nagelte ihn am Boden fest, hatte auch, wie ich nachher sah, das Gehirn verletzt, vermochte ihn aber doch nicht zu tödten. Er arbeitete gewaltig, sich vom Boden loszureißen, und ich schoß ihm noch zwei Pfeile durch den Hals, zwei durch die Brust und einen durch den Bauch, so daß er ganz fest angenagelt war; aber das Thier war noch nicht todt. Ich mußte erst noch das Drahtgitter der Kiste abnehmen und ihm den Kopf spalten, bevor er sich nicht mehr rührte.«
Die Rollzeit des Iltis fällt in den März. An Orten, wo er häufig ist, gewahrt man, daß Männchen und Weibchen sich von Dach zu Dach verfolgen, oder daß zwei Männchen ihre nebenbuhlerischen Kämpfe ausfechten. Dabei schreien alle sehr laut, beißen sich nicht selten in einander fest und rollen, zu einem Knäuel geballt, über die Dächer herab, fallen zu Boden, trennen sich ein wenig und beginnen den Tanz von neuem. Nach zweimonatlicher Tragzeit wirft das Weibchen in einer Höhle und noch lieber in einem Holz- oder Reisighaufen vier bis fünf, zuweilen auch sechs Junge, gewöhnlich im Mai. Die Mutter liebt ihre Kleinen ungemein, sorgt für sie auf das zärtlichste und beschützt sie gegen jeden Feind; ja, sie geht zuweilen, wenn sie in der Nähe ihres Nestes Geräusch vernimmt, auch unangefochten auf Menschen los. Nach etwa sechswöchentlicher Kindheit gehen die Jungen mit der Alten auf Raub aus, und nach Ablauf des dritten Monats sind sie fast ebensogroß geworden wie diese.
Man kann junge Iltisse durch Katzenmütter säugen und zähmen lassen, erlebt jedoch nicht viele Freude an ihnen, weil der angeborene Blutdurst mit der Zeit durchbricht und sie dann jedem harmlosen Hausthiere nachstellen. Mehrere Gefangene, welche in einem Raume leben müssen, vertragen sich keineswegs immer gut, fallen im Gegentheile oft wüthend über einander her, kämpfen auf Tod und Leben zusammen und fressen die von ihnen erwürgten Mitbrüder auf, so daß zuletzt oft nur der Stärkste übrig bleibt. Doch thun Zähmung und Abrichtung viel, selbst an Iltissen. Zum Austreiben der Kaninchen können sie ebensogut gebraucht werden wie das Frettchen; ihr Gestank ist aber viel heftiger als bei diesem. Selbst Füchse treiben solche gezähmte Iltisse aus ihren Bauen; denn ihr Muth ist unverhältnismäßig groß, und sie greifen jedes Thier ohne weiteres an, oft in der unverschämtesten Weise. Wie sie Hunden zuweilen mitspielten, geht aus nachstehender Mittheilung Geyers hervor. Ein Iltis, welcher einen Igel umgebracht und zum Erstaunen der Jäger etwa eine Viertelstunde weit geschleppt und verzehrt hatte, wurde durch zwei Dachshunde aufgestöbert und gestellt. »Nachdem die beiden Dächsel, welche sich infolge der Witterung des Iltis wie rasend geberdeten, von der Leine gelöst waren, versuchten wir, ihn mit einer Stange zum Ausfahren zu zwingen; da aber bei der vorderen Röhre beide Dachshunde vorlagen und das unausgesetzte Stoßen in den Rücken seine Lage verzweifelnd gestalten mußte, beschloß er, selbst zum Angriffe überzugehen. Dies geschah, indem er sich in die Nase des ersten Hundes derart verbiß, daß alles Stoßen, Wälzen und Schleudern auf den Schnee ihn nicht zum Loslassen bewog. Der zweite Hund kam seinem Kameraden zu Hülfe und packte den Iltis in der Mitte, ward aber nicht besser behandelt als sein Genosse; denn nun ließ der Iltis den ersten Hund los und packte den anderen bei einem Vorderlaufe, ließ überhaupt nicht eher vom Kampfe ab, bevor er von den Hunden förmlich in Stücke zerrissen war. Nachdem alles beendet, bemerkten wir, welche Verwundungen der tapfere Iltis den Hunden beigebracht hatte. Dem einen war die Nase bis auf die Wurzel gespalten, so daß sie klaffte und genähet werden mußte, der andere ging wochenlang krumm, und sein Vorderlauf heilte erst nach längerer Zeit.«
Freilebende Iltisse betragen sich zuweilen wahrhaft tolldreist den Menschen gegenüber, und können Kindern sogar gefährlich werden. »In Verna, einem Dorfe Kurhessens«, erzählt Lenz, »hatte ein sechsjähriger Knabe sein Brüderchen in der Nähe eines Kanals auf die Landstraße gesetzt, um sich die Wartung desselben leichter zu machen. Plötzlich erschienen drei Ratze und griffen das Kind an. Der eine setzte sich im Genick fest, der andere an der Seite des Kopfes und der dritte an der Stirn. Das Kind schrie laut auf, der Bruder wollte ihm zu Hülfe kommen, allein aus dem Kanal eilten noch andere Ratze herbei und wollten ihn angreifen. Glücklicherweise kamen zwei Männer vom Felde den Kindern zu Hülfe und schlugen zwei von den Ratzen todt, worauf die übrigen Thiere abließen.
»In Riga drang ein Ratz durch ein Loch durch den Fußboden in die Stube, fiel über ein in der Wiege liegendes Kind, tödtete es und biß es an der linken Wange an. In Schnepfenthal wurde sogar ein Hirt von einem Iltisse angegriffen, welcher aber freilich seine Kühnheit mit dem Leben bezahlen mußte.«
Wegen des bedeutenden Schadens, welchen das Thier anrichtet, ist es fast überall einer sehr lebhaften Verfolgung ausgesetzt. Man gebraucht alle üblichen Waffen und Fallen, um es zu erbeuten. Am erfolgreichsten sind die Kastenfallen, welche an einer Seite eine Fallthüre haben, auf den Wechsel gestellt werden und den hereintretenden Iltis einsperren, sobald er ein Bretchen berührt, auf welchem die Lockspeise befestigt wurde. Wo man sehr von Mäusen geplagt ist, thut man wohl, den Ratz laufen zu lassen, und die Mühe, welche sein Fang verursachen würde, lieber auf Ausbesserung und dichten Verschluß der Hühnerställe zu verwenden.
Das Fell des Iltis liefert ein warmes und dauerhaftes Pelzwerk, welches aber seines anhaltenden und wirklich unleidlichen Geruches wegen weit weniger geschätzt wird, als es seiner Dichtigkeit halber verdient. Neuerdings erst ist es etwas mehr zu Ehren gekommen und wird selbst von den empfindsamsten Damen ohne Widerstreben getragen. Nach Lomer gelangen gegenwärtig jährlich ungefähr 600,000 Iltisfelle, welche einen Gesammtwerth von etwa zwei Millionen Mark haben, auf den Rauchwaarenmarkt. Die besten liefern die Bayerische Hochebene, Holland, Norddeutschland und Dänemark, weniger gute Ungarn und Polen, die geringsten Rußland und Asien. In Rußland herrschen kleine schwärzliche, in Asien hellgelbliche, welche einen sehr geringen Preis haben, entschieden vor. Die Mehrzahl der Felle wird in den betreffenden Ländern selbst gebraucht, eine nicht unbedeutende Anzahl aber auch nach Schweden und Finnland ausgeführt. Aus den langen Schwanzhaaren fertigt man Pinsel; das Fleisch ist vollkommen unbrauchbar und wird sogar von den Hunden verachtet.
Außer den Menschen scheint der Ratz wenig Feinde zu haben. Gute Jagdhunde fallen ihn allerdings wüthend an, falls sie ihn nur erreichen können, und beißen ihn gewöhnlich bald todt; außerdem dürfte wohl bloß noch Reineke sein Gegner sein. Lenz beschreibt in ergötzlicher Weise, wie im Käfige der Fuchs einem Iltis mitspielt: »Der Fuchs, welcher nach seinem Fleische durchaus nicht leckert und es, wenn der Iltis todt ist, gar nicht einmal fressen mag, kann doch gegen den lebenden Ratz seine Tücke nicht lassen. Er schleicht heran, liegt lauernd auf dem Bauche, springt plötzlich zu, wirft den Ratz übern Haufen und ist schon weit entfernt, wenn jener sich wüthend erhebt und ihm die Zähne weist. Der Fuchs kommt wieder, springt ihm mit großen Sätzen entgegen und versetzt ihm in dem Augenblicke, wenn er ihn zu Boden wirft, einen Biß in den Rücken, hat aber schon wieder losgelassen, ehe jener sich rächen kann. Jetzt streicht er von fern im Kreise um den Ratz herum, welcher sich immer hindrehen muß, endlich schlüpft er an ihm vorüber und hält den Schwanz nach ihm hin. Der Ratz will hineinbeißen, der Fuchs hat ihn schon eiligst weggezogen, und jener beißt in die Luft. Jetzt thut der Fuchs, als ob er ihn nicht beobachte, – der Ratz wird ruhig, schnuppert umher und beginnt an einem Kaninchenschenkel zu nagen. Das ist dem bösen Feinde ganz Recht. Auf dem Bauche kriechend kommt er von neuem herbei, seine Augen funkeln, die Ohren sind gespitzt, der Schwanz ist in sanft wedelnder Bewegung: plötzlich springt er zu, packt den schmausenden Ratz beim Kragen, schüttelt ihn tüchtig und ist verschwunden. Der Ratz, um nicht länger geschabernackt zu werden, wühlt in die Erde und sucht einen Ausweg. Vergebens! Der Fuchs ist wieder da, beschnuppert das Loch, beißt plötzlich durch und fährt dann schnell zurück.« Ein solches Schauspiel, bei welchem weder der eine noch der andere Schaden leidet, dauert oft stundenlang und erweckt mit Recht die Heiterkeit der versammelten Zuschauer.
Gegenwärtig gilt es unter allen Naturforschern als ausgemacht, daß das Frett ( Foetorius Furo , Mustela und Putorius Furo) nichts anderes als der durch Gefangenschaft und Zähmung etwas veränderte Abkömmling des Iltis ist.
Man kennt das Frettchen zwar seit den ältesten Zeiten, aber bloß im gezähmten Zustande. Aristoteles erwähnt es unter dem Namen Ictis, Plinius unter dem Namen Viverra. Auf den Balearen hatten sich einmal die Kaninchen so vermehrt, daß man den Kaiser Augustus um Hülfe anrief. Er sendete den Leuten einige Viverrae, deren Jagdverdienste groß waren. Sie wurden in die Gänge der Kaninchen gelassen und trieben die verderblichen Nager heraus in das Netz ihrer Feinde. Strabo erzählt die Sache noch umständlicher. Spanien hat fast keine schädlichen Thiere, mit Ausnahme der Kaninchen, welche Wurzeln, Kräuter und Samen fressen. Diese Thiere hatten sich so verbreitet, daß man in Rom um Hülfe bitten mußte. Man erfand verschiedene Mittel, um sie zu verjagen. Das beste blieb aber, sie durch afrikanische Katzen (unter diesem Namen verstehen alle alten Naturforscher die Marder), welche mit verschlossenen Augen in die Höhlen gesteckt wurden, aus ihrem Baue zu vertreiben. Zu Zeiten der Araber hieß das Frett bereits Furo, wurde auch schon, wie Albertus Magnus berichtet, in Spanien zahm gehalten und wie heutzutage verwendet.
Das Frett ähnelt dem Iltis in Gestalt und Größe. Es ist zwar etwas kleiner und schwächlicher als dieser, allein ähnliches bemerken wir fast bei vielen Thieren, welche nur in abhängigen Verhältnissen von den Menschen, also in der Gefangenschaft, leben. Die Leibeslänge beträgt 45 Centim., die des Schwanzes 13 Centim. Dies sind genau die Verhältnisse des Iltis, und auch im Bau des Gerippes weicht es nicht wesentlich von diesem ab. Gewöhnlich sieht man das Frett in Europa bloß im Kakerlakenzustande, d. h. weißlich- oder semmelgelb, unten etwas dunkler gefärbt, und mit hellrothen Augen. Nur wenige sehen dunkler und dann echt iltisartig aus. Der Kakerlakenzustand gilt bekanntlich immer als ein Zeichen der Entartung, und dieser Umstand spricht für die oben ausgesprochene Meinung. Soviel ist sicher, daß bis jetzt scharfe Unterschiede zwischen Iltis und Frett noch nicht aufgefunden werden konnten, und daß alle Gründe, welche man für den Beweis der Selbständigkeit unseres Frettchens zusammenstellte, als nicht stichhaltig betrachtet werden müssen. Als Hauptgrund gilt die größere Zartheit und Frostigkeit, die Sanftmuth und leichte Zähmbarkeit des Frettes, gegenüber den uns bekannten Eigenschaften des Iltis. Allein dieser Grund ist meiner Ansicht nach so wenig beweisend wie die übrigen; denn alle Kakerlaken sind eben schwächliche, verzärtelte Wesen. Einige Naturforscher nehmen fest an, daß das Frett ein Afrikaner sei und sich von Afrika aus über Europa verbreitet habe, sind aber nicht im Stande, diese Meinung durch irgendwelche Beobachtung zu unterstützen. Das Frett findet sich also bloß in der Gefangenschaft, als Hausthier, und wird von uns einzig und allein für die Kaninchenjagd gehalten; nur die Engländer gebrauchen es auch zur Rattenjagd und achten diejenigen Frette, welche Rattenschläger genannt werden, weit höher als die, welche sie bloß zur Kaninchenjagd verwenden können. Man hält die Thiere in Kisten und Käfigen, gibt ihnen oft frisches Heu und Stroh und bewahrt sie im Winter vor Kälte. Sie werden gewöhnlich mit Semmel oder Milch gefüttert; doch ist es ihrer Gesundheit weit zuträglicher, wenn man ihnen zartes Fleisch von frisch getödteten Thieren reicht. Mit Fröschen, Eidechsen und Schlangen kann man sie nach den Beobachtungen unseres Lenz ganz billig erhalten; denn sie fressen alle Lurche und Kriechthiere sehr gern.
In seinem Wesen ähnelt das Frettchen dem Iltis, nur daß es nicht so munter ist wie dieser; an Blutgier und Raublust steht es seinem wilden Bruder nicht nach. Selbst wenn es schon ziemlich satt ist, fällt es über Kaninchen, Tauben und Hühner wie rasend her, packt sie im Genick und läßt sie nicht eher los, bis die Beute sich nicht mehr rührt. Das aus den Wunden hervorfließende Blut leckt es mit einer unglaublichen Gier auf, und auch das Gehirn scheint ihm ein Leckerbissen zu sein. An Lurche geht es mit größerer Vorsicht als an andere Thiere, und die Gefährlichkeit der Kreuzotter scheint es zu ahnen. Ringelnattern und Blindschleichen greift es, nach Lenz, ohne weiteres an, auch wenn es diese Thiere noch niemals gesehen hat, packt sie trotz ihrer heftigen Windungen, zerreißt ihnen das Rückgrat und verzehrt dann von ihnen ein gutes Stück. Den Kreuzottern aber naht es sich äußerst vorsichtig und versucht, diesem tückischen Gewürm Bisse in die Mitte des Leibes zu versetzen. Ist es erst einmal von einer Otter gebissen worden, so gebraucht es alle erdenkliche List, um die Giftzähne zu meiden, wird aber zuweilen so ängstlich, daß es sich von dem Kampfe zurückzieht und der Otter das Feld überläßt. Der Biß der Otter tödtet das Frett nicht, macht es aber krank und muthlos.
Selten gelingt es, ein Frettchen vollkommen zu zähmen; doch sind Beispiele bekannt, daß einzelne ihrem Herrn wie ein Hund auf Schritt und Tritt nachgingen und ohne Besorgnis frei gelassen werden konnten. Die meisten wissen, wenn sie einmal ihrem Käfige entrinnen konnten, die erlangte Freiheit zu benutzen, laufen in den Wald hinaus und beziehen dort eine Kaninchenhöhle, welche ihnen nun während des Sommers als Lager und Zufluchtsort dienen muß, entwöhnen sich nach kurzer Frist vollkommen des Menschen, gehen jedoch, wenn sie nicht zufällig wieder eingefangen werden, im Winter regelmäßig zu Grunde, weil sie viel zu zart sind, als daß sie der Kälte widerstehen könnten. Nur sehr wenige suchen nach längeren Streifzügen das Haus ihrer Pfleger wieder auf oder unternehmen regelmäßig von hier aus Jagden nach ihnen bekannten Orten. Auf den Kanaren verwildern sie, laut Bolle, oft vollständig.
Die Stimme des Fretts ist ein dumpfes Gemurr, bei Schmerz ein helles Gekreisch. Letzteres hört man selten; gewöhnlich liegt das Frett ganz still in sich zusammengerollt auf seinem Lager, und nur wenn es seine Raubgier bethätigen kann, wird es munter und lebendig.
Das Weibchen wirft nach fünfwöchentlicher Tragzeit anfangs Mai fünf bis acht Junge, welche zwei bis drei Wochen blind bleiben. Sie werden mit großer Sorgfalt von der Mutter gepflegt und nach etwa zwei Monaten entwöhnt; dann sind sie geeignet, abgesondert aufgezogen zu werden. Junge Iltisse pflegt die Frettmutter ohne Umstände unter ihre Kinderschar aufzunehmen und mit derselben Sorgsamkeit zu behandeln wie diese; solche Milchgeschwister vertragen sich auch später vortrefflich miteinander. Man pflegt das Frettchen wie jeden anderen Marder, muß aber auf seine Entwöhnung von frischer Luft und Freiheit die gebührende Rücksicht nehmen und darf den Weichling namentlich strenger Kälte nicht aussetzen. Frische Luft, Reinlichkeit und entsprechende Nahrung sind die Hauptbedingungen zu seinem Wohlsein: im Sommer muß man es kühl, im Winter warm legen; Käfig, Freß- und Trinkgefäß sind stets rein zu halten; mit dem Futter hat man entsprechend zu wechseln. In Ermangelung eines besseren Behälters sperrt man ihrer zwei bis drei Frettchen zusammen in einen Breterkasten, welcher etwa 1 Meter lang, 70 Centim. tief und ebenso hoch, mit einem verschließbaren Deckel versehen, an einer Wand mit einem Gitter und innen mit einem Schlafkästchen ausgestattet ist. Für letzteren genügt eine Länge von 40, eine Höhe und Breite von 20 bis 25 Centim.; es besitzt ein Schlupfloch und unten ein zum Ausschieben eingerichtetes enges Drahtgitter, auf welches durch den oben zu öffnenden Deckel Leinen- oder Wollläppchen zur Unterlage für die ein weiches Bett liebenden Thiere gebreitet werden; in der entgegengesetzten Ecke des Kastens bringt man im Boden ein Loch an und befestigt unter demselben ein Kästchen mit einem Thonnapfe zur Aufnahme der Losung der Frettchen, welche man dadurch an einen bestimmten Ort gewöhnt, daß man zuerst ihren Unrath aufsammelt und in den betreffenden Napf legt, oder denselben mit jenem einreibt; wollen sie sich nicht bequemen, auf einem bestimmten Orte sich zu lösen, so muß man alle verunreinigten Theile des Kastens sorgfältig reinigen und durch Auflegen von Ziegelsteinen und dergleichen sie abhalten, dieselben wieder zu benutzen. Zur Aesung erhalten die Frettchen, laut Zeiller, dem ich in vorstehendem gefolgt bin, morgens Milchsemmel, abends rohes Fleisch und wöchentlich ein- oder zweimal ein rohes Ei; auch kann man ihnen, wie allen Mardern, verschiedene Früchte, insbesondere Kirschen, Pflaumen und Birnenschnitzel reichen. Nach geschehener Paarung hat man das Männchen von dem Weibchen zu trennen, weil es sonst regelmäßig die kaum geborenen Jungen auffrißt, darf aber ohne Bedenken mehrere, mindestens zwei Weibchen mit Jungen in demselben Käfige lassen. Nicht wohl gethan ist es, die rechtzeitige Paarung der Frettchen zu verhindern, weil Männchen wie Weibchen, wenn man ihren natürlichen Trieb unterdrückt, fast regelmäßig erkranken und zu Grunde gehen können. Bei sorgfältiger Pflege erhält man die Thierchen sechs bis acht Jahre lang am Leben und bei guter Gesundheit.
So treffliche Dienste das Frett bei der Kaninchenjagd leistet, so gering ist der wirkliche Nutzen, den es bringt, im Vergleiche zu den Kosten, welche es verursacht. Man darf die Kaninchenjagd mit dem Frett eben nur während der gewöhnlichen Jagdzeit, vom Oktober bis zum Februar, betreiben und muß das ganze übrige Jahr hindurch das Thierchen ernähren, ohne den geringsten Nutzen von ihm zu erzielen; zudem ist es bloß gegen halb oder ganz erwachsene Kaninchen zu gebrauchen, weil es Junge, welche es im Baue findet, augenblicklich tödtet und auffrißt, worauf es sich gewöhnlich in das weiche, warme Nest legt und nun den Herrn Gebieter draußen warten läßt, so lange es ihm behagt.
Zur Jagd zieht man am Morgen aus. Die Frettchen werden in einem weich ausgelegten Korbe oder Kästchen, unter Umständen auch in der Jagdtasche getragen. Am Baue sucht man alle befahrenen Röhren auf, legt vor jede ein sackartiges, etwa drei Fuß langes Netz, welches um einen großen Ring geflochten und an ihm befestigt ist, und läßt nun eins der Frettchen in die Hauptröhre, welche hierauf ebenfalls verschlossen wird. Sobald die Kaninchen den eingedrungenen Feind merken, fahren sie erschreckt heraus, gerathen in das Netz und werden in ihm erschlagen. Wenn die Röhren etwas breiter sind, und sich gerade mehrere Kaninchen in dem Baue aufhalten, rennen die ziemlich geängstigten Thiere zuweilen am Frett vorüber und zwar so schnell, daß dieses nicht einmal Zeit hat, sie zu packen. Das Frettchen selbst wird durch einen kleinen Beißkorb oder durch Abfeilen der Zähne gehindert, ein Kaninchen im Baue abzuschlachten und bekommt, um von seinem Treiben beständig Kunde zu geben, ein helltönendes Glöckchen um den Hals gehängt. In früheren Zeiten war man, namentlich in England, so grausam, zu gleichem Behufe die Lippen des armen Jagdgehülfen zusammenzunähen, ehe man ihn in die Höhle kriechen ließ; glücklicherweise hat man sich überzeugt, daß ein Beißkorb dieselben Dienste leistet. Sobald das Frettchen wieder an der Mündung der Höhle erscheint, wird es sofort aufgenommen; denn wenn es zum zweiten Male in den Bau geht, legt es sich in das Nest zur Ruhe und läßt dann oft stundenlang auf sich warten. Sehr wichtig ist es, wenn man es an einen Pfiff und Ruf gewöhnt. Kommt es dann nicht heraus, so sucht man es durch allerhand Lockungen wieder in seine Gewalt zu bringen. So bindet man an eine schwankende Stange ein Kaninchen und schiebt dieses in die Röhre: Einer solchen Aufforderung, der unser Thier beherrschenden Blutgier Folge zu leisten, kann kein Frett widerstehen; es beißt sich fest und wird sammt dem Kaninchen herausgezogen.
In England benutzt man das Frett häufiger noch, als zur Jagd der Kaninchen, zum Vertreiben der Ratten und noch lieber zu Kämpfen mit diesen bissigen Nagern, welche, wie bekannt, einen echten Engländer stets zu fesseln wissen. Mein englischer Gewährsmann versichert, daß verhältnismäßig wenige Fretts zur Rattenjagd zu gebrauchen sind, nachdem sie einige Male von den Zähnen der gefräßigen Langschwänze zu leiden gehabt haben. Ein Frett, welches bloß an Kaninchenjagd gewohnt ist, soll für die Rattenjagd gänzlich unbrauchbar sein, weil es sich vor jeder großen Ratte fürchtet. Der Rattenjäger muß also besonders erzogen werden. Man läßt ihn anfangs nur mit jungen und schwachen Ratten kämpfen und gewöhnt ihn nach und nach an Kampf und Sieg. Dann regt sich der angeborene Blutdurst; der Muth des kleinen Räubers wächst, und zuletzt erlangt er eine solche Fertigkeit in dem Kampfe mit dem schwarzen Wilde, daß er wahre Wunder verrichtet und die edlen Briten mit unsäglichem Entzücken erfüllt. Gewöhnlich ziehen sich alte, erfahrene Ratten, sobald sie angegriffen werden, in eine Ecke zurück und wissen von hier aus erfolgreiche Ausfälle zu machen und dem unvorsichtigen Feinde gefährliche Wunden beizubringen; ein gut abgerichtetes Frett aber schrecken solche ausgelernte Fechter nicht ab: es weiß doch den richtigen Augenblick zu wählen, um den tückischen Gegner zu fassen. Rodwell beschreibt mit wenigen Strichen einen dieser Kämpfe zwischen großen Ratten und einem besonders ausgezeichneten Frettchen, welches seine Kunst so weit gebracht hatte, daß es fünfzig Ratten in einer Stunde tödten konnte. »Die Ratten«, erzählt er, »befanden sich in einem viereckigen Raume von zwei bis drei Meter im Durchmesser, welcher mit einer meterhohen Planke umgeben war. Das Frett wurde unter sie geworfen, und es war bewunderungswürdig zu sehen, wie regelrecht das Thier sein Werk begann. Einige von den größten Ratten waren abscheuliche Feiglinge und übergaben sich, während mehrere von den kleineren, noch nicht einmal erwachsenen, wie Tiger kämpften. Diese hauptsächlich zogen meine Aufmerksamkeit auf sich. Das Frett wurde, während es sie angriff, einige Male ganz empfindlich von den Ratten gebissen; allein dies vermehrte nur seine Wuth. Die Augen glühten vor Zorn, und plötzlich hatte es einen von seinen Feinden am Nacken und setzte hier sein furchtbares Gebiß mit einer solchen Gewalt ein, daß nur ein kurzer Angstschrei des Opfers noch gehört wurde, bevor es seinen Geist aufgab. Einige Male trat es geschickt auf die Ratten, hielt sie so am Boden fest und schien sich förmlich über die vergeblichen Anstrengungen zu freuen, welche das erboste Schwarzwild machte, um seinem Gegner einen gefährlichen Biß beizubringen. Dann sah man es schneller als der Blitz zufahren, und die Zähne vergruben sich einen Augenblick lang im Genicke. Ein verzweifelter Schrei wurde gehört, und ein neues Opfer lag regungslos bei den übrigen. Während das blutgierige Geschöpf im besten Kampfe war, nahte eine alte, erfahrene Ratte sich vorsichtig dem Feinde und schien über einen gefährlichen Gedanken zu brüten. Sie war augenscheinlich entsetzt über das Blutbad, welches das Frett unter ihren Genossen angerichtet hatte, und schien sich rächen zu wollen. Eben hatte das Frett eine neue Ratte am Genicke gepackt und war beschäftigt, ihr den Lebensnerv zu zerschneiden, da stürzte sich die andere nach ihm hin und versetzte ihm in den Kopf einen furchtbaren Biß, welchem alsbald ein Blutstrom folgte. Das Frett, welches glauben mochte, daß die empfangene Wunde von seinem eben gefaßten Gegner herrühre, biß die bereits getödtete Ratte mit dem fürchterlichsten Zorne, ohne den wahren Thäter zu erkennen, und erhielt von ihm einen neuen Biß. Endlich aber erkannte es seinen eigentlichen Feind und stürzte sich mit einer unglaublichen Wuth auf ihn. Ein unbeschreibliches Getümmel entstand. Man sah nichts mehr als einen verworrenen Knäuel von schwarzen Gestalten, aus welchem ab und zu das lichtgefärbte Raubthier vorleuchtete; man hörte dessen Knurren, das Quieken der Ratten und das ängstliche Geschrei der vom Frett ergriffenen Nager. Viele von den gehetzten Langschwänzen suchten sich zu retten, und immer toller wurde die Verwirrung: aber weniger und weniger Ratten bewegten sich; der Haufen der Leichen wurde immer größer, und lange, bevor die Stunde abgelaufen war, lagen wirklich alle fünfzig Ratten auf dem Boden, der wackere Kämpe, welcher in der Verwirrung den Blicken entgangen war, natürlich auch mit.«
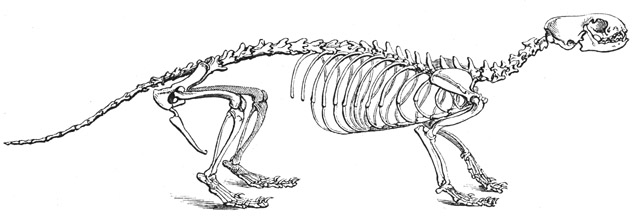
Geripp des Iltis. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Ich habe schon bemerkt, daß das Frett bei seinen Kaninchenjagden zuweilen auch auf andere Feinde trifft, welche in einem verlassenen Kaninchenbau Zuflucht gefunden haben. So ereignet es sich zuweilen, daß es in einer Kaninchenhöhle mit einem Iltis zusammenkommt. Dann beginnt ein furchtbarer Kampf zwischen beiden gleich starken und gewandten Thieren, keineswegs zur Freude des Besitzers des gezähmten Mitgliedes der Marderfamilie, weil er alle Ursache hat, für das Leben seines Jagdgehülfen zu fürchten. »Ein Frett, welches in eine Kaninchenhöhle gesandt wurde«, erzählt ein Jäger, »verblieb so lange Zeit darin, daß ich ungeduldig wurde und bereits glauben wollte, mein Thier habe sich in das warme Nest gelegt und schlafe dort. Ich stampfte deshalb heftig auf den Boden, um es zu erwecken und wieder zu mir zu bringen. Freilich erfuhr ich bald, daß mein Frettchen sich keiner Unterlassungssünde schuldig gemacht hatte. Ich hörte ein ganz eigenthümliches Geschrei, welches dem Murren und Kreischen des Frettchens glich, aber doch noch von Tönen begleitet war, welche ich mir nicht enträthseln konnte. Der Lärm wurde lauter, und bald konnte ich unterscheiden, daß es von zwei Thieren herrühren mußte. Endlich sah ich in dem Dunkel der Höhle den Schwanz meines Frettchens und entdeckte nun zu gleicher Zeit, daß es mit einem Thiere im Kampfe lag. Das Frett bemühte sich nach Kräften, seine Beute nach der Mündung der Höhle zu schleppen, stieß aber auf einen bedeutenden Widerstand. Endlich kam es doch hervor, und ich entdeckte zu meiner nicht geringen Ueberraschung, daß es sich mit einem männlichen Iltis in den Kampf eingelassen hatte. Beide waren in einander verbissen; eines hatte das andere am Nacken gefaßt, und keines schien gewillt zu sein, seinen Gegner so leichten Kampfes davon zu lassen. Plötzlich erblickte mich der Iltis und versuchte nun, mein armes Frettchen nach der Tiefe der Höhle zu schleppen, um den Kampf dort weiter auszufechten. Das vorzügliche Thierchen hielt jedoch trefflich Stand und brachte seinen Feind nach kurzer Zeit nochmals an die Mündung der Höhle zurück. Aber es war zu schwach, um ihn vollends bis an das Tageslicht zu bringen. Der Iltis gewann wieder die Oberhand, und beide verschwanden von neuem. Nun sah und hörte ich wieder lange Zeit nichts von ihnen, und meine Aengstlichkeit nahm begreiflicherweise mit jeder Minute zu. Aber zum dritten Male sah ich das Frett, welches seinen Feind an das Tageslicht zu schleppen versuchte. An der Mündung der Höhle entstand ein verzweifeltes Ringen; das Frettchen kämpfte mit unübertrefflichem Geschicke, und ich hoffte schon die Niederlage des Iltis zu sehen, als jenes plötzlich den Kampf aufgab und mit zerfetzter Brust auf mich zusprang. Sein Feind erkühnte sich nicht, ihm zu folgen, sondern blieb vorsichtig schnüffelnd in der Mündung der Röhre stehen. Ich schlug auf ihn an; allein mein Gewehr versagte mir mehrere Male, und ehe ich noch schießen konnte, drehte sich der kleine Held plötzlich um und ließ seinen Gegner und dessen Helfershelfer im Stiche.«
Ungeachtet solcher Kämpfe paaren sich Frett und Iltis ohne viele Umstände mit einander und erzielen Blendlinge, welche von den Jägern sehr geschätzt werden. Solche Bastarde ähneln dem Iltis mehr als dem Frett, unterscheiden sich von ersterem auch bloß durch die lichtere Färbung im Gesichte und an der Kehle. Ihre Augen sind ganz schwarz und aus diesem Grunde feuriger als die des Frettchens. Sie vereinigen die Vorzüge beider Eltern in sich; denn sie lassen sich weit leichter zähmen, stinken auch nicht so heftig wie der Iltis, sind aber stärker, kühner und weniger frostig als das Frettchen. Ihr Muth ist unglaublich. Sie stürzen sich wie rasend auf jeden Feind, welchem sie in einer Höhle begegnen, und hängen sich wie Blutegel an ihm fest. Nicht selten sind sie aber auch gegen ihren Herrn heftig und beißen ihn ohne Rücksicht höchst empfindlich.
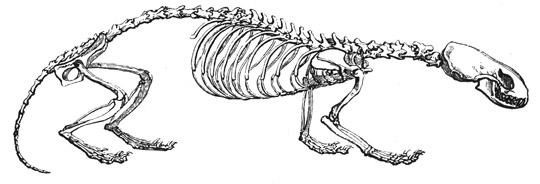
Geripp des Wiesels. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Die Wiesel, nach Ansicht einiger Naturforscher eine besondere Sippe oder doch Untersippe ( Mustela oder Gale) bildend, sind noch weit schlanker und gestreckter als die übrigen Marder; ihr Schädel ist etwas schmächtiger und hinten schmäler, der obere Reißzahn ein wenig anders gestaltet als bei den Iltissen: hierauf aber beschränken sich die Unterscheidungsmerkmale zwischen beiden Gruppen. Alle hierher gehörigen Arten halten sich am liebsten in Feldern, Gärten, Erdhöhlen, Felsritzen, unter Steinen und Holzhaufen auf und jagen fast ebensoviel bei Tage als des Nachts. Obgleich die kleinsten Raubthiere, zeichnen sie sich durch ihren Muth und ihre Raublust aus, so daß sie als wahre Musterbilder der Familie gelten können.
Das Wiesel, Hermännchen oder Hermchen ( Foetorius vulgaris , Viverra und Mustela vulgaris, Mustela Gale, nivalis und pusilla), erreicht eine Gesammtlänge von 20 Centim., wovon 4,5 Centim. auf das kurze Schwänzchen zu rechnen sind. Der außerordentlich gestreckte Leib sieht wegen des gleichgebauten Halses und Kopfes noch schlanker aus, als er ist. Vom Kopfe an bis zum Schwanze fast überall gleich dick, erscheint er nur bei Erwachsenen in den Weichen etwas eingezogen und an der Schnauze ein wenig zugespitzt. Er ruht auf sehr kurzen und dünnen Beinen mit äußerst zarten Pfoten, deren Sohlen zwischen den Zehenballen behaart und deren Zehen mit dünnen, spitzigen und scharfen Krallen bewaffnet sind. Der Schwanz hat etwa Kopflänge und spitzt sich von der Wurzel nach dem Ende allmählich zu. Die Nase ist stumpf und durch eine Längsfurche einigermaßen getheilt. Die breiten und abgerundeten Ohren stehen seitlich und weit hinten; die schiefliegenden Augen sind klein, aber sehr feurig. Eine mittellange, glatte Behaarung deckt den ganzen Leib und zeigt sich nur in der Nähe der Schnauzenspitze etwas reichlicher. Lange Schnurren vor und über den Augen und einzelne Borstenhaare unter diesen sind außerdem zu bemerken. Die Färbung des Pelzes ist röthlichbraun; der Rand der Oberlippe und die ganze Unterseite sowie die Innenseiten der Beine sind weiß. Hinter jedem Mundwinkel steht ein kleiner, rundlicher, brauner Flecken, und zuweilen finden sich auch einzelne braune Punkte auf dem lichten Bauche. In gemäßigten und südlichen Gegenden ändert diese Färbung nicht wesentlich ab; weiter nördlich hingegen legt das Wiesel, wie sein nächster Verwandter, eine Wintertracht an und erscheint dann weißbraun gefleckt, ohne jedoch die schöne, schwarze Schwanzspitze zu erhalten, welche das Hermelin so auszeichnet.
Das Wiesel bewohnt ganz Europa ziemlich häufig, obschon vielleicht nicht in so großer Anzahl wie das nördliche Asien, und zwar ebensowohl die flachen, wie die gebirgigen Gegenden, buschlose Ebenen so gut wie Wälder, bevölkerte Orte nicht minder zahlreich als einsame. Ueberall findet es einen passenden Aufenthalt; denn es weiß sich einzurichten und entdeckt aller Orten einen Schlupfwinkel, welcher ihm die nöthige Sicherheit vor seinen größeren Feinden gewährt. So wohnt es denn bald in Baumhöhlen, in Steinhaufen, in altem Gemäuer, bald unter hohlen Ufern, in Maulwurfsgängen, Hamster- und Rattenlöchern, im Winter in Schuppen und Scheuern, Kellern und Ställen, unter Dachböden etc., häufig auch in Städten. Wo es ungestört ist, streift es selbst bei Tage umher, wo es sich verfolgt sieht, bloß des Nachts oder wenigstens bei Tage nur mit äußerster Vorsicht.
Wenn man achtsam und ohne Geräusch an Orten vorübergeht, welche ihm Schutz gewähren, kann man leicht das Vergnügen haben, es zu belauschen. Man hört ein unbedeutendes Rascheln im Laube und sieht ein kleines, braunes Wesen dahinhuschen, welches, sobald es den Menschen gewahrt, aufmerksam wird und auf seine Hinterbeine sich erhebt, um bessere Umschau halten zu können. Gewöhnlich fällt es dem zwerghaften Gesellen gar nicht ein, zu fliehen; er sieht vielmehr muthig und trotzig in die Welt hinaus und nimmt eine wahrhaft herausfordernde Miene an. Wenn man ihm dicht an den Leib kommt, ist er auch wohl so dreist, dem Störenfriede selbst sich zu nähern und ihn mit einer unbeschreiblichen Unverschämtheit anzusehen, als wolle es sich Kunde verschaffen, was der ungebetene Gast zu suchen habe.
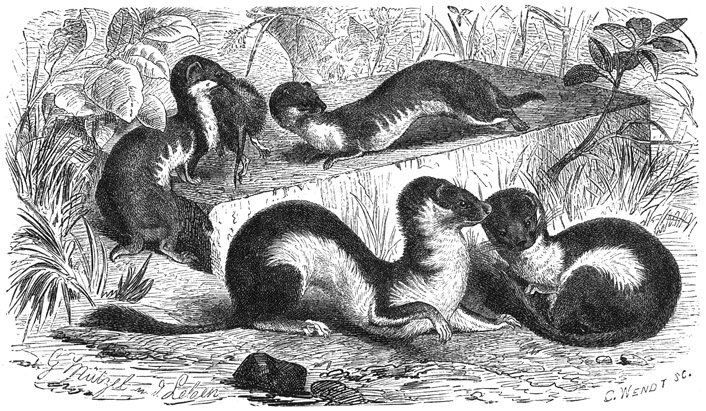
Wiesel ( Foeterius vulgaris) und Hermelin ( Foeterius Erminea) im Sommerkleide. ⅓[???] Größe
Mehr als einmal ist es vorgekommen, daß das kühne Geschöpf sogar den Menschen angegriffen und von ihm erst nach langem Streite abgelassen hat. Auch in den Beinen von vorübergehenden Pferden hat es sich festgebissen und konnte nur durch vereinte Anstrengung von Roß und Reiter abgeschüttelt werden. Mit diesem Muthe ist eine unvergleichliche Geistesgegenwart verbunden. Das Wiesel findet fast immer noch einen Ausweg: es gibt sich in den Krallen des Raubvogels noch nicht verloren. Der starke und raubgierige Habicht freilich macht wenig Umstände mit dem ihm gegenüber allzuschwachen Zwerge, nimmt ihn vielmehr, ohne die geringste Gefahr befürchten zu müssen, mit seinen langen Fängen vom Boden auf und erdolcht oder erdrosselt ihn, ehe der arme Schelm noch recht zur Besinnung gelangt; die schwächeren Räuber aber haben sich immerhin vorzusehen, wenn sie Gelüste nach dem Fleische des Wiesels verspüren. So sah ein Beobachter einen Weih auf das Feld herabstürzen, von dort ein kleines Säugethier aufheben und in die Luft tragen. Plötzlich begann der Vogel zu schwanken, sein Flug wurde unsicher, und schließlich fiel der Raubvogel todt zur Erde herab. Der überraschte Zuschauer eilte zur Stelle und sah ein Wiesel lustig dahinhuschen. Es hatte seinem fürchterlichen Feinde geschickt die Schlagader zerbissen und sich so gerettet. Aehnliche Beobachtungen hat man bei Krähen gemacht, welche so kühn waren, das unscheinbare Thier anzugreifen und sich arg verrechnten, indem sie ihr Leben lassen mußten, anstatt einen guten Schmaus zu halten.

Wiesel und Hermelin im Winterkleide ⅓[???] natürl. Größe.
Ein lehrreiches Beispiel von einem ungleichen Zweikampfe, den unser kleiner Räuber bestand, theilt Lenz mit: »Zu einem alten Wiesel, welches mit anderen Thieren schon ganz gesättigt war, setzte ich einen Hamster, welcher es an Körpermasse wohl dreimal übertraf. Kaum hatte es den bösen Feind bemerkt, vor dem es wie ein Zwerg vor einem Riesen stand, so rückte es im Sturmschritte vor, quiekte laut auf und sprang unaufhörlich nach dem Gesichte und Halse seines Gegners. Der Hamster richtete sich empor und wehrte mit den Zähnen den Wagehals ab. Plötzlich aber fuhr das Wiesel zu, biß sich in seine Schnauze ein, und beide wälzten sich nun, das Wiesel laut quiekend, auf dem mit Blute sich röthenden Schlachtfelde. Die Streiter fochten mit allen Füßen; bald war das leicht gebaute Wiesel, bald der schwere, plumpe Hamster obenauf. Nach zwei Minuten ließ das Wiesel los, und der Hamster putzte, die Zähne fletschend, seine verwundete Nase. Aber zum Putzen war wenig Zeit; denn schon war der kleine, kühne Feind wieder da, und wupp! saß er wieder an der Schnauze und hatte sich fest eingebissen. Jetzt rangen sie eine Viertelstunde lang unter lautem Quieken und Fauchen, ohne daß ich bei der Schnelligkeit der Bewegungen recht sehen konnte, wer siegte, wer unterlag. Zuweilen hörte ich zerbissene Knochen knirschen. Die Heftigkeit, womit sich das Wiesel wehrte, die zunehmende Mattigkeit des Hamsters schien zu beweisen, daß jenes im Vortheile war. Endlich ließ das Wiesel los, hinkte in eine Ecke und kauerte sich nieder; das eine Vorderbein war gelähmt, die Brust, welche es fortwährend leckte, blutig. Der Hamster nahm von der anderen Ecke Besitz, putzte seine angeschwollene Schnauze und röchelte. Einer seiner Zähne hing aus der Schnauze hervor und fiel endlich gänzlich ab; die Schlacht war entschieden. Beide Theile waren zu neuen Anstrengungen nicht mehr fähig. Nach vier Stunden war das tapfere Wiesel todt. Ich untersuchte es genau und fand durchaus keine Verletzung, ausgenommen, daß die ganze Brust von den Krallen des Hamsters arg zerkratzt war. Der Hamster überlebte seinen Feind noch um vier Stunden. Die Schnauze desselben war zermalmt, ein Zahn ausgefallen, zwei andere wackelig, und nur der vierte saß fest. Uebrigens sah ich nirgends eine Verletzung, da ihn das Wiesel immer fest an der Schnauze gehalten hatte«.
Es versteht sich von selbst, daß ein so muthvolles und kühnes Geschöpf ein wahrhaft furchtbarer Räuber sein muß, und ein solcher ist das Wiesel in der That. Es hat allen kleinen Säugethieren den Krieg erklärt und richtet unter ihnen oft entsetzliche Verwüstungen an. Unter den Säugethieren fallen ihm die Haus-, Wald- und Feldmäuse, Wasser- und Hausratten, Maulwürfe, junge Hamster, Hasen und Kaninchen zur Beute; aus der Klasse der Vögel raubt es junge Hühner und Tauben, Lerchen und andere auf der Erde wohnende Vögel, selbst solche, welche auf Bäumen schlafen, plündert auch deren Nester, wenn es dieselben auffindet. Unter den Kriechthieren stellt es den Eidechsen, Blindschleichen und Ringelnattern nach, wagt sich selbst an die gefährliche Kreuzotter, obgleich es deren wiederholten Bissen erliegen muß. Außerdem frißt es auch Frösche und Fische, genießt überhaupt jede Art von Fleisch, selbst das der eigenen Art. Kerbthiere der verschiedensten Ordnungen sind ihm ein Leckerbissen, und wenn es Krebse erlangen kann, weiß es deren harte Kruste geschickt zu zerbrechen. Seine geringe Größe und unglaubliche Gewandtheit kommen ihm bei seinen Jagden trefflich zu statten. Man kann wohl sagen, daß eigentlich kein kleines Thier vor ihm sicher ist. Den Maulwurf sucht es in seinem unterirdischen Palaste auf, Ratten und Mäusen kriecht es in die Löcher nach, Fischen folgt es ins Wasser, Vögeln auf die Bäume. Es läuft außerordentlich gewandt, klettert recht leidlich, schwimmt sehr gut und weiß durch blitzschnelle Wendungen und rasche Bewegungen, im Nothfalle auch durch ziemlich weite Sprünge seiner Beute auf den Leib zu kommen oder seinen Feinden zu entgehen. In der Fähigkeit, die engsten Spalten und Löcher zu durchkriechen und somit überall sich einzuschleichen, liegt seine Hauptstärke, und Muth, Mordlust und Blutdurst thun dann vollends noch das ihrige, um das kleine Thier zu einem ausgezeichneten Räuber zu machen. Man will sogar beobachtet haben, daß es gemeinschaftlich jagt, hat auch keinen Grund, dies zu bezweifeln, weil es gesellig lebt und an manchen Orten in großer Anzahl sich sammelt. Kleine Thiere packt es im Genicke oder beim Kopfe, große sucht es am Halse zu fassen und womöglich durch Zerbeißen der Halsschlagader zu tödten. In die Eier macht es geschickt an einem Ende eines oder mehrere Löcher und saugt dann die Flüssigkeit aus, ohne daß ein Tropfen verloren geht. Größere Eier soll es zwischen Kinn und Brust klemmen, wenn es sie fortschaffen muß; kleinere trägt es im Maule weg. Bei größeren Thieren begnügt es sich mit dem Blute, welches es trinkt, ohne das Fleisch zu berühren, kleinere frißt es ganz auf; die, welche es einmal gepackt hat, läßt es nicht wieder fahren. Und dabei gilt es ihm gleich, ob seine Räuberthaten bemerkt werden oder nicht. In einer Kirche bei Oxford sah man während des Gottesdienstes plötzlich ein Wiesel aus einer kleinen Oeffnung, welche nach dem Kirchhofe führte, hervorkommen, sich neugierig umschauen, plötzlich wieder verschwinden und nach wenigen Minuten von neuem erscheinen mit einem Frosche im Maule, den es angesichts der ganzen Gemeinde gemächlich verzehrte. In unmittelbarer Nähe von bewohnten Gebäuden jagt es fast ohne alle Scheu.
Die Paarungszeit fällt in den März. Im Mai oder Juni, also nach fünfwöchentlicher Tragzeit, bekommt das Weibchen fünf bis sieben, manchmal aber bloß drei, zuweilen auch acht blinde Junge, welche es meist in einem hohlen Baume oder in einem seiner Löcher zur Welt bringt, immer aber an einem versteckten Orte auf ein aus Stroh, Heu, Laub und dergleichen bereitetes, nestartiges Lager bettet. Es liebt sie außerordentlich, säugt sie lange und ernährt sie dann noch mehrere Monate mit Haus-, Wald-und Feldmäusen, welche es ihnen lebendig bringt. Wenn sie beunruhigt werden, trägt es sie im Maule an einen anderen Ort. Bei Gefahr vertheidigt die treue Mutter ihre Kinder mit grenzenlosem Muthe. Sowie die allerliebsten Thierchen erwachsen sind, spielen sie oft bei Tage mit der Alten, und es sieht ebenso wunderlich als hübsch aus, wenn die Gesellschaft im hellsten Sonnenscheine auf Wiesen sich umhertreibt, zumal auf solchen, welche an unterirdischen Gängen, namentlich an Maulwurfslöchern, reich sind. Lustig geht es beim Spielen zu. Aus diesem und jenem Loche guckt ein Köpfchen hervor; neugierig sehen sich die kleinen, hellen Augen nach allen Seiten um. Es scheint alles ruhig und sicher zu sein, und eines nach dem anderen verläßt die Erde und treibt sich im grünen Grase umher. Die Geschwister necken, beißen und jagen sich und entfalten dabei alle Gewandtheit, welche ihrem Geschlechte eigenthümlich ist. Wenn der versteckte Beobachter ein Geräusch macht, vielleicht ein wenig hustet oder in die Hand schlägt, stürzt Alt und Jung voll Schrecken in die Löcher zurück, und nach weniger als einer Zehntelminute scheint alles verschwunden zu sein. Doch nein! Hier schaut bereits wieder ein Köpfchen aus dem Loche hervor, dort ein zweites, da ein drittes: jetzt sind sie sämmtlich da, prüfen von neuem, vergewissern sich der Sicherheit, und bald ist die ganze Gesellschaft vorhanden. Wenn man nunmehr das Erschrecken fortsetzt, bemerkt man gar bald, daß es wenig helfen will; denn die kleinen, muthigen Thierchen werden immer dreister, immer frecher und treiben sich zuletzt ganz unbekümmert vor den Augen des Beobachters umher.
Junge Wiesel, welche noch bei der Mutter sind, haben das rechte Alter, um gezähmt zu werden. Die Ansicht, welche sich unter den Naturforschern von Buffon her fortgeerbt hat, daß unser Thierchen unzähmbar sei, hat mit Recht Widerlegung gefunden; gänzlich unbegründet aber ist sie nicht. Gefangene Wiesel gehören zu den großen Seltenheiten, nicht weil man sie schwer erlangt, sondern weil sie nur in wenigen Ausnahmefällen den Verlust ihrer Freiheit ertragen. Ich meinestheils habe mir die größte Mühe gegeben, ein Wiesel längere Zeit am Leben zu erhalten, ihm die ihm zusagendsten Aufenthaltsorte und die passendste Nahrung geboten, es in keiner Weise an umsichtiger Pflege fehlen lassen, und bin doch nicht zum Ziele gelangt. Ein oder zwei Tage, manchmal auch wochenlang geht es ganz gut; plötzlich aber liegt das Thierchen zuckend und sich windend auf dem Boden, und bald darauf ist es verendet. In seiner außerordentlichen Reizbarkeit dürfte meiner Meinung nach die hauptsächlichste Ursache dieser Hinfälligkeit gefunden werden: das Wiesel ärgert sich, falls man so sagen darf, zu Tode. Anders verhält es sich, wenn man junge, womöglich noch blinde Wiesel aufzieht, beziehentlich sie durch eine sanfte Katzenmutter aufsäugen läßt; sie, welche von Kindheit an an den Menschen sich gewöhnen, werden ungemein zahm und dann zu wirklich allerliebsten Geschöpfen. Unter den verschiedenen Geschichten, welche von solchen Wieseln berichten, scheint mir eine von Frauenhand niedergeschriebene, welche Wood in seiner »Natural History« mittheilt, die anmuthigste zu sein, und deshalb will ich sie im Auszuge wiedergeben.
»Wenn ich etwas Milch in meine Hand gieße«, sagt die Dame, »trinkt mein zahmes Wiesel davon eine gute Menge; schwerlich aber nimmt es einen Tropfen der von ihm so geliebten Flüssigkeit, wenn ich ihm nicht die Ehre anthue, ihm meine Hand zum Trinkgefäße zu bieten. Sobald es sich gesättigt hat, geht es schlafen. Mein Zimmer ist sein gewöhnlicher Aufenthaltsort, und ich habe ein Mittel gefunden, seinen unangenehmen Geruch durch wohlriechende Stoffe vollständig aufzuheben. Bei Tage schläft es in einem Polster, zu dessen Innern es Eingang gefunden hat; während der Nacht wird es in einer Blechbüchse in einem Käfig verwahrt, geht aber stets ungern in dieses Gefängnis und verläßt es mit Vergnügen. Wenn man ihm seine Freiheit gibt, ehe ich wach werde, kommt es in mein Bett und kriecht nach tausend lustigen Streichen unter die Decke, um in meiner Hand oder an meinem Busen zu ruhen. Bin ich aber bereits munter geworden, wenn es erscheint, so widmet es mir wohl eine halbe Stunde und liebkost mich auf die verschiedenste Weise. Es spielt mit meinen Fingern, wie ein kleiner Hund, springt mir auf den Kopf und den Nacken oder klettert um meinen Arm oder um meinen Leib mit einer Leichtigkeit und Zierlichkeit, welche ich bei keinem anderen Thiere gefunden habe. Halte ich ihm in einer Entfernung von einem Meter meine Hand vor, so springt es in sie hinein, ohne jemals zu fallen. Es bekundet große Geschicklichkeit und List, um irgend einen seiner Zwecke zu erreichen, und scheint oft das Verbotene aus einer gewissen Lust am Ungehorsam zu thun.
»Bei seinen Bewegungen zeigt es sich stets achtsam auf alles, was vorgeht. Es schaut jede hohle Ritze an und dreht sich nach jedem Gegenstande hin, welchen es bemerkt, um ihn zu untersuchen. Sieht es sich in seinen lustigen Sprüngen beobachtet, so läßt es augenblicklich nach und zieht es gewöhnlich vor, sich schlafen zu legen. Sobald es aber munter geworden ist, bethätigt es sofort seine Lebendigkeit wieder und beginnt seine heiteren Spiele sogleich von neuem. Ich habe es nie schlecht gelaunt gesehen, außer wenn man es eingesperrt oder zu sehr geplagt hatte. In solchen Fällen suchte es dann sein Mißvergnügen durch kurzes Gemurmel auszudrücken, gänzlich verschieden von dem, welches es ausstößt, wenn es sich wohl befindet.
»Das kleine Thier unterscheidet meine Stimme unter zwanzig anderen, sucht mich bald heraus und springt über Jeden hinweg, um zu mir zu kommen. Es spielt mit mir auf das liebenswürdigste und liebkost mich in einer Weise, welche man sich nicht vorstellen kann. Mit seinen zwei kleinen Pfötchen streicht es mich oft am Kinne und sieht mich dabei mit einer Miene an, welche sein großes Vergnügen auf das beste ausdrückt. Aus dieser seiner Liebe und tausend anderen Bevorzugungen meiner Person ersehe ich, daß seine Zuneigung zu mir eine wahre und nicht eingebildete ist. Wenn es bemerkt, daß ich mich ankleide, um auszugehen, will es mich gar nicht verlassen, und niemals kann ich mich so ohne Umstände von ihm befreien. Listig, wie es ist, verkriecht es sich gewöhnlich in ein Zimmer an der Ausgangsthüre, und sobald ich vorbeigehe, springt es plötzlich auf mich und versucht alles mögliche, um bei mir zu bleiben.
»In seiner Lebendigkeit, Gewandtheit, in der Stimme und in der Art seines Gemurmels ähnelt es am meisten dem Eichhörnchen. Während des Sommers rennt es die ganze Nacht hindurch im Hause umher; seit Beginn der kälteren Zeit aber habe ich dies nicht mehr beobachtet. Es scheint jetzt die Wärme sehr zu vermissen, und oft, wenn die Sonne scheint und es auf meinem Bette spielt, dreht es sich um, setzt sich in den Sonnenschein und murmelt dort ein Weilchen.
»Wasser trinkt es bloß, wenn es Milch entbehren muß, und auch dann immer mit großer Vorsicht. Es scheint just, als wolle es sich nur ein wenig abkühlen und sei fast erschreckt über die Flüssigkeit; Milch hingegen trinkt es mit Entzücken, jedoch immer bloß tropfenweise, und ich darf stets nur ein wenig von der so beliebten Flüssigkeit in meine Hand gießen. Wahrscheinlich trinkt es im Freien den Thau in derselben Weise wie bei mir die Milch. Als es einmal im Sommer geregnet hatte, reichte ich ihm etwas Regenwasser in einer Tasse und lud es ein, hin zu gehen, um sich zu baden, erreichte aber meinen Zweck nicht. Hierauf befeuchtete ich ein Stückchen Leinenzeug in diesem Wasser und legte es ihm vor, darauf rollte es sich mit außerordentlichem Vergnügen hin und her.
»Eine Eigenthümlichkeit meines reizenden Pfleglings ist seine Neugier. Es ist geradezu unmöglich, eine Kiste, ein Kästchen oder eine Büchse zu öffnen, ja bloß ein Papier anzusehen, ohne daß auch mein Wiesel den Gegenstand beschaut. Wenn ich es wohin locken will, brauche ich bloß ein Papier oder ein Buch zu nehmen und aufmerksam auf dasselbe zu sehen, dann erscheint es plötzlich bei mir, rennt auf meiner Hand hin und schaut mit größter Aufmerksamkeit auf den Gegenstand, welchen ich betrachte.
»Ich muß schließlich bemerken, daß das Thier mit einer jungen Katze und einem Hunde, welche beide schon ziemlich groß sind, gern spielt. Es klettert auf ihren Nacken und Rücken herum und steigt an den Füßen und dem Schwanze empor, ohne ihnen jedoch auch nur das leiseste Ungemach zuzufügen.«
Der Herausgeber der artigen Geschichte bemerkt nun noch, daß das Thierchen hauptsächlich mit kleinen Stückchen Fleisch gefüttert wurde, welche es ebenfalls am liebsten aus der Hand seiner Herrin annahm.
Dies ist nicht das einzige Beispiel von der vollständig gelungenen Zähmung des Wiesels. Ein Engländer hatte ein jung aus dem Neste genommenes so an sich gewöhnt, daß es ihm überall folgte, wohin er auch ging, und andere Thierfreunde haben die niedlichen Geschöpfe dahin gebracht, daß sie nach Belieben nicht nur im Hause herumlaufen, sondern auch aus- und eingehen durften.
Bei guter Behandlung kann man das Wiesel vier bis sechs Jahre am Leben erhalten; in der Freiheit dürfte es ein Alter von acht bis zehn Jahren erreichen. Leider werden die kleinen, nützlichen Geschöpfe von unwissenden Menschen vielfach verfolgt und aus reinem Uebermuthe getödtet. In Fallen, welche man mit Eiern, kleinen Vögeln oder Mäusen ködert, fängt sich das Wiesel sehr leicht. Oft findet man es auch in Rattenfallen, in welche es zufällig gerathen ist. Wegen des großen Nutzens, den es stiftet, sollte man das ausgezeichnete Thier kräftig schützen, anstatt es zu verfolgen. Man kann dreist behaupten, daß zur Mäusejagd kein anderes Thier so vortrefflich ausgerüstet ist wie das Wiesel. Der Schaden, welchen es anrichtet, wenn es zufällig in einen schlechtverschlossenen Hühnerstall oder Taubenschlag geräth, kommt diesem Nutzen gegenüber gar nicht in Betracht. Doch ist gegen Vorurtheile aller Art leider nur schwer anzukämpfen, und die
Dummheit gefällt sich eben gerade darin, Vernunftgründe nicht zu beachten. Nicht genug, daß man die Thätigkeit des Thieres vollkommen verkennt, schmückt man auch seine Geschichte noch mit mancherlei Fabeln aus. Unter vielen ist noch hier und da die Meinung verbreitet, daß das Wiesel seine Jungen aus dem Munde gebäre, jedenfalls deshalb, weil man die Mutter oft ihre Jungen von einem Orte zum anderen tragen sieht und dabei zufällig nicht an die Hauskatze denkt, welche doch genau dasselbe thut. Außerdem glaubt man, daß alle Thiere, welche mit ihm in Berührung kommen oder von ihm gebissen werden, an den betreffenden Stellen bösartige Geschwülste bekommen und fürchtet namentlich für Kühe, welche den Bissen des vollkommen harmlosen Geschöpfes mehr als alle anderen Hausthiere ausgesetzt sein sollen. In den Augen abergläubischer Leute ist, laut Wuttke, das Wiesel ein äußerst gefährliches Thier. Wenn Jemand von ihm angefaucht wird, so schwillt das Gesicht auf, oder man wird blind oder muß sterben, ja schon das bloße Ansehen des Thierchens macht blind oder krank. Man darf das Wiesel nicht beim Namen nennen, sonst verfolgt es den Menschen und bläst ihn an, deshalb muß man zu ihm sagen: »Schönes Dingel behüt' dich Gott«. Es bläst auch das Vieh an, wodurch dieses krank wird und Blut statt Milch gibt. Ein langsam zu Tode gemartertes Wiesel heilt Beulen, das ihm abgezapfte, noch warm getrunkene Blut die Fallsucht, das einem lebendigen Wiesel ausgerissene und sofort gegessene Herz verleiht die Kraft der Wahrsagung. Von sonstiger Quacksalberei, wie solche der alte Geßner erzählt, will ich schweigen; nach den Proben, welche ich weiter oben gegeben, genügt es zu sagen, daß so ziemlich jeder Theil des Leibes im Arzneischatze früherer Zeiten seine Rolle spielte. Dagegen glauben die Landleute in anderen Gegenden, daß die Anwesenheit eines Wiesels im Hofe dem Hause und der Wirtschaft Glück bringe, und diese Leute haben, in Anbetracht der guten Dienste, welche der kleine Räuber leistet, jedenfalls die Wahrheit besser erkannt, als jene, welche mit Inbrunst an albernen Weibermärchen hängen.
Der nächste Verwandte des Wiesels ist das Hermelin, auch wohl großes Wiesel genannt ( Foeterius Erminea , Viverra, Mustela und Putorius Erminea, Mustela candida etc.), ein Thier, welches dem Hermännchen in Gestalt und Lebensweise außerordentlich ähnelt, aber bedeutend größer ist als der kleine Verwandte. Die Gesammtlänge beträgt 32 bis 33 Centim., wovon der Schwanz 5 bis 6 Centim. wegnimmt; im Norden soll es jedoch größer werden als bei uns. Oberseite und Schwanzwurzelhälfte sehen im Sommer braunroth, im Winter weiß aus und haben zu jener Zeit braunröthliches, zu dieser weißes Wollhaar, die Unterseite hat jederzeit weiße Färbung mit gilblichem Anfluge, und die Endhälfte des Schwanzes ist immer schwarz.
Die Veränderung der Färbung des Hermelins im Sommer und Winter hat unter den Naturforschern zu Meinungsverschiedenheiten Veranlassung gegeben. Einige sonst trefflich beobachtende Schriftsteller nehmen an, daß eine doppelte Härung stattfinde, andere, zu denen ich zähle, sind der Ansicht, daß das Sommerhaar gegen den Winter hin und beziehentlich bei Eintritt starker Kälte einfach verbleicht, sowie wir dies bei dem Eisfuchse und dem Schneehasen beobachten können. Ueber den Farbenwechsel im Frühlinge hat der Schwede Grill, dessen anmuthige Schilderungen weiter unten folgen werden, nach Wahrnehmungen an seinen Gefangenen treffliche Beobachtungen gemacht. »Am 4. März«, sagt er, »konnte man zuerst einige dunkle Haare zwischen den Augen bemerken. Am 10. hatte es auf derselben Stelle einen braunen, hier und da mit Weiß durchbrochenen Flecken, von der Breite der halben Stirne. Ueber den Augen und um die Nase zeigten sich nun mehrere kleine dunkle Flecke. Wenn es sich krumm bückte, sah man, daß der Grund längs der Mitte des Rückens, unter den Schultern und auf dem Scheitel dunkel war. Am 11. war es den ganzen Rückgrat und über die Schultern entlang dunkel. Am 15. zog sich das Dunkle schon über die Hinter- und Vorderbeine sowie ein Stück über die Schwanzwurzel. Am 18. umfaßte das Graubraun den Durchgang zwischen den Ohren, den Hinterhals, ungefähr 5 Centim. breit, ebenso den Rücken, ein Viertel des Schwanzes und zog sich über Schultern und Hüften bis zu den Füßen. Ueberall war die dunkle und die weiße Färbung scharf begrenzt und die erstere durchaus unvermischt mit Weiß, ausgenommen im Gesichte, welches ganz bunt aussah. Das Braune war dort am dunkelsten und wurde nach hinten zu allmählich heller, so daß es über den Lenden und um die Schwanzwurzel gelbbraun oder schmutziggelblich war. Der Schwanz hatte nun drei Farben, nämlich ein Viertel braungelb, ein Viertel weiß mit schwefelgelbem Anstrich und die Hälfte schwarz. Auch unter dem Bauche war die schwefelgelbe Farbe jetzt stärker als vorher. Der Farbenwechsel ging sehr schnell vor sich, besonders im Anfange, so daß man ihn täglich, ja sogar halbtäglich bemerken konnte. Am 3. April war nur noch weiß: die untere Seite des Halses und der Kehle, der ganze Bauch, die Ohren und von da zu den Augen, welche mit einem kleinen Ring umgeben waren, ein kurzes Stück vor der schwarzen Hälfte des Schwanzes und die ganze Unterseite seiner vorderen Hälfte, die ganzen Füße sowie die innere Seite der Vorder- und Hinterbeine und die Hinterseite der Schenkel. Am 19. waren auch die Ohren, bis auf einen kleinen Theil des unteren Randes, braun. Es ist an keiner Stelle stachelhaarig gewesen, außer an der Stirne, wo mehrere weiße Haare neben einander sitzen und kleine Flecken bilden. Erst wuchsen die dunklen Haare auf einmal hervor, und ehe sie mit den weißen gleich hoch waren, waren diese schon ausgefallen. Man kann annehmen, daß der eigentliche Wechsel in der ersten Hälfte des März vor sich ging; nach dem 19. März hat das braune Kleid sich nur mehr ausgebreitet und allmählich das weiße verdrängt.«
Ueber die Ausbleichung des Sommerkleides fehlen allerdings noch Angaben, welche auf Beobachtung lebender Wiesel beruhen; doch wissen wir, daß die Wintertracht unter Umständen sehr schnell angelegt werden kann. Nicht selten sieht man das Hermelin bis spät in den Winter hinein in seinem Sommerkleide umherlaufen; wenn aber plötzlich Kälte eintritt, verändert es oft in wenigen Tagen seine Färbung. Hieraus geht für mich mit kaum anzufechtender Gewißheit hervor, daß ebenso wie bei den oben genannten Thieren auch beim Hermelin eine einfache Verfärbung oder, wenn man will, Ausbleichung des Haares stattfindet. Bei allen Marderarten bedarf das Wachsthum des Pelzes eine beträchtliche Zeit, und geht die Härung wesentlich in der oben (Bd. I, S. 29[???]) angegebenen Weise vor sich; es läßt sich also kaum annehmen, daß das Hermelin eine Ausnahme von der Regel machen und binnen wenigen Tagen ein verhältnismäßig ebenso dichtes Kleid erhalten kann wie seine Verwandten, da letztere doch Monate gebrauchen, bevor sie dasselbe anlegen. Bestimmtes vermag ich aus dem Grunde nicht zu sagen, weil ich bis jetzt die Umfärbung eines lebenden Hermelins noch nicht beobachtet habe, meiner Ansicht nach aber die streitige Sache einzig und allein durch solche Beobachtungen, nicht aber durch Folgerungen und Schlüsse erledigt werden kann; gleichwohl halte ich meine Ansicht für die richtige.
Das Hermelin hat eine sehr ausgedehnte Verbreitung im Norden der Alten Welt. Nordwärts von den Pyrenäen und dem Balkan findet es sich in ganz Europa, und außerdem kommt es in Nord- und Mittelasien bis zur Ostküste Sibiriens vor. In Kleinasien und Persien hat man es ebenfalls angetroffen, ja selbst im Himalaya will man es beobachtet haben. In allen Ländern, in denen es vorkommt, ist es auch nicht selten, in Deutschland sogar eines der häufigsten Raubthiere.
Wie dem Wiesel, ist auch dem Hermelin jede Gegend, ja fast jeder Ort zum Aufenthalte recht, und es versteht, sich überall so behaglich als möglich einzurichten. Erdlöcher, Maulwurf- und Hamsterröhren, Felsklüfte, Mauerlöcher, Ritzen, Steinhaufen, Bäume, unbewohnte Gebäude und hundert andere ähnliche Schlupforte bieten ihm Obdach und Verstecke während des Tages, welchen es größtentheils in seinem einmal gewählten Baue verschläft, obwohl es gar nicht selten auch angesichts der Sonne im Freien lustwandelt und sich dreist den Blicken des Menschen aussetzt. Seine eigentliche Jagdzeit beginnt jedoch erst mit der Dämmerung. Schon gegen Abend wird es lebendig und rege. Wenn man um diese Zeit an passenden Orten vorübergeht, braucht man nicht lange zu suchen, um das klugäugige, scharfsinnige Wesen zu entdecken. Findet man in der Nähe einen geeigneten Platz, um sich zu verstecken, so kann man sein Treiben leicht beobachten.
Ungeduldig und neugierig, wie es ist, vielleicht auch hungrig und sehnsüchtig nach Beute, kommt es hervor, zunächst bloß um die unmittelbarste Nähe seines Schlupfwinkels zu untersuchen. Alle Behendigkeit, Gewandtheit und Zierlichkeit seiner Bewegungen offenbaren sich jetzt. Bald windet es sich wie ein Aal zwischen den Steinen und den Schößlingen des Unterholzes hindurch; bald sitzt es einen Augenblick bewegungslos da, den schlanken Leib in der Mitte hoch aufgebogen, viel höher noch, als es die Katze kann, wenn sie den nach ihr benannten Buckel macht; bald bleibt es einen Augenblick vor einem Mauseloche, einer Maulwurfshöhle, einer Ritze stehen und schnuppert da hinein. Auch wenn es auf einer und derselben Stelle verharrt, ist es nicht einen Augenblick ruhig; denn die Augen und Ohren, ja selbst die Nase, sind in beständiger Bewegung, und der kleine Kopf wendet sich blitzschnell nach allen Richtungen. Man darf wohl behaupten, daß es in allen Leibesübungen Meister ist. Es läuft und springt mit der größten Gewandtheit, klettert vortrefflich und schwimmt unter Umständen rasch und sicher über Ströme, ja selbst durch das Meer. »Ein Bauer«, sagt Thompson, »bemerkte, als er mit seinem Boote über den eine englische Meile breiten Meeresarm fuhr, welcher einen Theil von Islandmagee von dem nächsten Lande trennt, ein kleines Thier lustig schwimmend in dem Wasser. Er ruderte auf dasselbe zu und fand, daß es ein Wiesel war, welches unzweifelhaft das genannte Inselchen besuchen wollte und bereits das Viertel einer englischen Meile zurückgelegt hatte.«
Mit seiner Leibesgewandtheit stehen die geistigen Eigenschaften des Hermelins vollständig im Einklange. Es besitzt denselben Muth wie sein kleiner Vetter und eine nicht zu bändigende Mordlust, verbunden mit dem Blutdurste seiner Sippschaft. Auch das Hermelin kennt keinen Feind, welcher ihm wirklich Furcht einflößen könnte; denn selbst auf den Menschen geht es unter Umständen tolldreist los. Man sollte nicht glauben, daß es dem erwachsenen Manne ein wenigstens lästiger Gegner sein könnte: und doch ist dem so. »Ein Mann«, so erzählt Wood, »welcher in der Nähe von Cricklade spazieren ging, bemerkte zwei Hermeline, welche ruhig auf seinem Pfade saßen. Aus Uebermuth ergriff er einen Stein und warf nach den Thieren, und zwar so geschickt, daß er eines von ihnen traf, und es durch den kräftigen Wurf über und über schleuderte. In demselben Augenblicke stieß das andere einen eigenthümlichen, scharfen Schrei aus und sprang sofort gegen den Angreifer seines Gefährten, kletterte mit einer überraschenden Schnelligkeit an seinen Beinen empor und versuchte, in seinem Halse sich einzubeißen. Das Kriegsgeschrei war von einer ziemlichen Anzahl anderer Hermeline, welche sich in der Nähe verborgen gehalten hatten, erwidert worden, und diese kamen jetzt ebenfalls herbei, um dem muthigen Vorkämpfer beizustehen. Der Mann raffte zwar schleunigst Steine auf, in der Hoffnung, jene zu vertreiben, mußte sie aber bald genug fallen lassen, um seine Hände zum Schutze seines Nackens frei zu bekommen. Er hatte gerade hinlänglich zu thun; denn die gereizten Thierchen verfolgten ihn mit der größten Ausdauer, und er verdankte es bloß seiner dicken Kleidung und einem warmen Tuche, daß er von den boshaften Geschöpfen nicht ernstlich verletzt wurde. Doch waren seine Hände, sein Gesicht und ein Theil seines Halses immer noch mit Wunden bedeckt, und er behielt diesen Angriff in so gutem Andenken, daß er hoch und theuer gelobte, niemals wieder ein Hermelin zu beleidigen. Seinen Freunden versicherte er steif und fest, ganz deutlich gehört zu haben, daß das erste Raubthier, welches ihn angriff, nach seinem Steinwurfe entrüstet das Wort »Mörder« ausgerufen habe, – und wir wollen unserem Manne diese Uebertreibung auch gern verzeihen, da das Geknurr eines wüthenden Hermelins wenigstens die beiden »r« jenes Wortes entschieden ausdrückt. Daß der Mann mindestens hinsichtlich des Angriffes keine Unwahrheit berichtet hat, beweist nachstehende Angabe des Kreisphysikus Hengstenberg. »Ich erlaube mir«, schreibt derselbe unterm 8. August 1869 an mich, »Mittheilung von einer Thatsache zu machen, welche Ihnen vielleicht nicht unwichtig erscheinen dürfte. Vorgestern gegen Abend spielt das fünfjährige Kind des Bahnhofsinspektors Braun in Bochum am Rande eines Grabens, gleitet aus und fällt mit der Hand in diesen. Mit Blitzesschnelle schießt ein Hermelin auf das Kind zu und beißt es zweimal in die Hand. Heftig blutend eilt dieses nach Hause, wo eine zufällig gegenwärtige barmherzige Schwester den ersten Verband übernimmt. Ich werde hinzugerufen und finde die Speichenschlagader vollständig durchgerissen und bogenförmig spritzend. Die Wunde hatte ganz die halbkreisförmige Gestalt des Kiefers des Thieres; etwas höher, nach dem Ballen des Daumens zu, fand sich eine regelmäßig eingerissene Hautwunde vor. Ich vermuthe, daß das Thierchen in der Nähe der Stelle, an welcher das Kind fiel, Junge hatte, dieselben bedroht glaubte, sie vertheidigen wollte und deshalb die Wunde beibrachte.«
Das Hermelin jagt und frißt fast alle Arten kleiner Säugethiere und Vögel, die es erlisten kann, und wagt sich gar nicht selten auch an Beute, welche es an Leibesgröße bedeutend übertrifft. Mäuse, Maulwürfe, Hamster, Kaninchen, Sperlinge, Lerchen, Tauben, Hühner, Schwalben, welche es aus den Nestern holt, Schlangen und Eidechsen werden beständig von ihm befehdet, und selbst Hasen sind nicht vor ihm sicher. Vor einigen Jahren sah Lenz einmal fünf Hermeline bei einem Gartenzaune auf einem kranken Hasen sitzen, um diesen zu erwürgen. Derselbe Beobachter fügt hinzu, daß gesunde und große Hasen natürlich vor dem Wiesel sicher seien und bloß kranke und junge ihm zur Beute fielen; jedoch versichern englische Naturforscher, daß das freche Thier auch gesunde überfalle. Hope hörte Lampes lauten Angstschrei und wollte nach dem Orte hingehen, um sich von der Ursache zu überzeugen. Er sah einen Hasen dahinhinken, welcher offenbar von irgend etwas auf das äußerste gequält wurde. Dieses etwas hing ihm an der Seite der Brust, wie ein Blutegel angesaugt, und beim Näherkommen erkannte unser Beobachter, daß es ein Wiesel war. Der Hase schleppte seinen furchtbaren Feind noch mit sich fort und verschwand im Unterholze; wahrscheinlich kam er nicht mehr weit. Man hat auch diese Thatsache bestreiten wollen; doch unterliegt sie keinem Zweifel. Schon Geßner weiß von Angriffen des Hermelins auf Hasen zu berichten: »Dem Hasen sol es listiglich nachstellen, dann es spilt und schimpfft ein weyl mit jm, unn so er müd, sich der feyndschafft nit versicht, so springt es im an seinen halß und gurgel, hangt, truckt vnd erwürgt in, ob er gleych in dem louff ist«. Auch neuerdings sind von Naturforschern, deren Glaubwürdigkeit keinen Zweifel zuläßt, hierauf bezügliche Beobachtungen gemacht worden. »Es ist bekannt«, erzählt Karl Müller, »daß das Hermelin ein gefährlicher Feind des Hasen ist, und namentlich im Sommer, wenn die üppige Saat und das hoch gewachsene Gras dem kleinen Schelm das Lauern an heimlichen Plätzchen oder das Anschleichen begünstigt, oft reiche Beute unter den feigen Bewohnern der Felder macht. Das Angst- und Todesgeschrei des wehrlosen Opfers mit dem kühnen blutsaugenden Reiter im Nacken ist auf meinen Abendspaziergängen mir schon viele Male zu Ohren gedrungen, und einmal habe ich das Glück gehabt, in den Besitz des sterbenden Hasen sammt dem im Blutgenusse trunkenen Hermelin zu gelangen. Trotz alledem hielt ich es nicht für möglich, daß ein einziges Hermelin im Stande wäre, in einem Zeitraume von wenigen Wochen ein halbes Dutzend Hasen zu überlisten und zu morden, bis ich im Spätsommer des Jahres 1865 Gelegenheit fand, mich eines besseren zu überzeugen. Mehrere Wegebauer unweit Alsfelds waren gegen Abend schon etliche Male durch das Klagen eines Hasen aufmerksam gemacht worden, ohne in den Haferacker, aus welchem die Angsttöne herüber schallten, sich zu begeben, bis endlich ein Kenner der jagdbaren Thiere sich entschloß, der Ursache nachzuspüren. Am dritten Abende seiner Anwesenheit vernahm er wiederum die Klagetöne eines Hasen, lief eilig der Richtung zu und sah, näher gekommen, in immer enger geschlossenen Kreislinien die Haferhalme sich bewegen; plötzlich ward es stille und nach wenigen Augenblicken des Suchens fand er den alten Hasen zuckend am Boden liegen. Als er denselben aufheben wollte, kam unter ihm das Schwänzchen eines Hermelins zum Vorscheine. Sofort tritt der derbe Bauer auf den Hasen, um das Raubthier zu erdrücken, läßt auch seinen Fuß so lange mit dem ganzen Gewichte seines Körpers auf dem Halse des Hasen ruhen, bis das Schwänzchen kein Zeichen des Lebens mehr verräth. Kaum aber lüftet er den Fuß, so springt taumelnd der kleine Mörder unter dem verendeten Hasen hervor und stellt sich zähnefletschend ihm gegenüber. Nun schlägt er diesen noch glücklich mit einem Hackenstiel auf den Kopf und rächt somit das gefallene Opfer. Die Untersuchung ergibt, daß die kleine Wunde vom Bisse des Hermelins
vorn am Halse sich befindet. Zur Stelle geführt, überzeugte ich mich von den Spuren der Mordscene, und bei dieser Gelegenheit fanden die Steinklopfer theilweise im Haferacker, zum Theil in dem angrenzenden Graben fünf getödtete, vorzugsweise an Kopf und Hals angefressene Hasen. Mit Ausnahme eines einzigen waren es junge, sogenannte halbwüchsige und Dreiläufer, alle noch ziemlich frisch. Die Leute, welche noch vierzehn Tage lang in der Nähe der erwähnten Stelle Steine klopften, nahmen einen neuen Fall des Angriffs des Hermelins auf einen Hasen nicht wahr, ein Beweis, daß der erschlagene der alleinige Mörder gewesen war.« Ein solches Vorkommnis gehört übrigens, wie ich bemerken will, immer zu den Ausnahmen; es sind stets bloß einzelne Hermeline, welche sich derartige Uebergriffe erlauben, nachdem sie einmal erfahren haben, wie leicht es für sie ist, selbst dieses unverhältnismäßig große Wild zu tödten. »Es ist eine eigenthümliche Thatsache«, bemerkt Bell, welcher das erst erwähnte Beispiel mittheilt, »daß ein Hase, welcher von dem Hermeline verfolgt wird, seine natürliche Begabung nicht benutzt. Selbstverständlich würde er mit wenigen Sprüngen aus dem Bereiche aller Angriffe gelangen, wie er einem Hunde oder Fuchse entkommt; aber er scheint das kleine Geschöpf gar nicht zu beachten und hüpft gemächlich weiter, als gäbe es kein Hermelin in der Welt, obwohl ihm diese stumpfe Gleichgültigkeit zuweilen zum Verderben wird.«
Allerliebst sieht es aus, wenn ein Hermelin eine seiner Lieblingsjagden unternimmt, nämlich eine Wasserratte verfolgt. Gedachtem Nager wird von dem unverbesserlichen Strolche zu Wasser und zu Lande nachgestellt und, so ungünstig das eigentliche Element dieser Ratten dem Hermeline auch zu sein scheint, zuletzt doch der Garaus gemacht. Zuerst spürt das Raubthier alle Löcher aus. Sein feiner Geruch sagt ihm deutlich, ob in einem von ihnen eine oder zwei Ratten gerade ihrer Ruhe pflegen oder nicht. Hat das Hermelin nun eine beuteversprechende Höhle ausgewittert, so geht es ohne weiteres hinein. Die Ratte hat natürlich nichts eiligeres zu thun, als sich entsetzt in das Wasser zu werfen, und ist im Begriff, durch das Schilfdickicht zu schwimmen; aber das rettet sie nicht vor dem unermüdlichen Verfolger und ihrem ärgsten Feinde. Das Haupt und den Nacken über das Wasser emporgehoben, wie ein schwimmender Hund es zu thun pflegt, durchgleitet das Hermelin mit der Behendigkeit des Fischotters das ihm eigentlich fremde Element und verfolgt nun mit seiner bekannten Ausdauer die fliehende Ratte. Diese ist verloren, wenn nicht ein Zufall sie rettet. Kletterkünste helfen ihr ebensowenig wie Versteckenspielen. Der Räuber ist ihr ununterbrochen auf der Fährte, und seine Raubthierzähne sind immer noch schlimmer als die starken und scharfen Schneidezähne des Nagers. Der Kampf wird unter Umständen selbst im Wasser ausgeführt, und mit der erwürgten Beute im Maule schwimmt dann das behende Thier dem Ufer zu, um sie dort gemächlich zu verzehren. Wood erzählt, daß einige Hermeline eine zahlreiche Ansiedelung von Wasserratten in wenig Tagen zerstörten.
Die Paarungszeit des Hermelins fällt bei uns in den März. Im Mai oder Juni bekommt das Weibchen fünf bis acht Junge. Gewöhnlich bereitet die Alte ihr weiches Bett in einem günstig gelegenen Maulwurfsbaue oder in einem anderen ähnlichen Schlupfwinkel. Sie liebt ihre Kinder mit der größten Zärtlichkeit, säugt und pflegt sie und spielt mit ihnen bis in den Herbst hinein; denn erst gegen den Winter hin trennen sich die fast vollständig ausgewachsenen Jungen von ihrer treuen Pflegerin. Sobald Gefahr droht, trägt die besorgte Mutter die ganze Brut im Maule nach einem anderen Verstecke, sogar schwimmend durch das Wasser. Wenn die Jungen erst einigermaßen erwachsen sind, macht sie Ausflüge mit ihnen und unterrichtet sie auf das gründlichste in allen Künsten des Gewerbes. Die kleinen Thiere sind auch so gelehrig, daß sie schon nach kurzer Lehrfrist der Alten an Muth, Schlauheit, Behendigkeit und Mordlust nicht viel nachgeben.
Man fängt das Hermelin in Fallen aller Art, oft auch in Rattenfallen, in welche es zufällig geräth; kommt man dann hinzu, so läßt es ein durchdringendes Gezwitscher hören; reizt man es, so fährt es mit einem quiekenden Schrei auf einen zu, sonst aber gibt es seine Angst bloß durch leises Fauchen zu erkennen. In der Regel lebt auch ein alt gefangenes Hermelin nicht lange, weil es, ebenso reizbar wie das Wiesel, sich weder an den Käfig, noch an den Pfleger gewöhnen will und entweder Nahrung verschmäht oder sich so aufregt, daß es infolge dessen zu Grunde geht. Ich habe viele Hermeline gefangen, sorgsam gepflegt, niemals aber eines von ihnen am Leben erhalten können. Jung aus dem Neste gehobene Wiesel dieser Art dagegen werden sehr zahm und bereiten ihrem Pfleger viel Vergnügen; einzelne soll man dazu gebracht haben, nach Belieben aus- und einzugehen und ihrem Herrn wie ein Hund zu folgen. Aber auch alt gefangene machen zuweilen von dem eben gesagten eine Ausnahme. »Einige Tage vor Weihnachten 1843«, erzählt Grill, »bekam ich ein Hermelinmännchen, welches in einem Holzhaufen gefangen wurde. Es trug sein reines Winterkleid. Die schwarzen, runden Augen, die rothbraune Nase und die schwarze Schwanzspitze stachen grell gegen die schneeweiße Färbung ab, welche nur an der Schwanzwurzel und auf der inneren Hälfte des Schwanzes einen schönen, schwefelgelben Anflug hatte. Es war ein hübsches, allerliebstes, äußerst bewegliches Thierchen. Ich setzte es anfangs in ein größeres, unbewohntes Zimmer, worin sich bald der dem Mardergeschlechte eigene üble Geruch verbreitete. Seine Fertigkeit, zu klettern, zu springen und sich zu verbergen, war bewundernswerth. Mit Leichtigkeit kletterte es die Fenstervorhänge hinauf, und wenn es dort oben auf seinem Platze erschreckt wurde, stürzte es sich oft plötzlich mit einem Angstschrei auf den Fußboden herunter. Am zweiten Tage lief es an der Ofenröhre hinauf und blieb dort, ohne etwas von sich hören zu lassen, bis es endlich, nach mehreren Stunden, mit Ruß bedeckt wieder zum Vorscheine kam. Oft foppte es mich stundenlang, wenn ich es suchte, bis ich es zuletzt an einem Orte versteckt fand, wo ich es am wenigsten vermuthete. Es drängte sich hinter einem dicht an der Wand stehenden Schranke empor und ruhte dort ohne irgend eine Unterlage. In seinem Zimmer hing hoch an der freien Wand eine Pendeluhr. Einmal, als ich hineinkam, bemerkte ich zu meiner Verwunderung, daß die Uhr ging; und bei näherer Untersuchung fand ich, daß mein »Kisse« in guter Ruhe hinter der Uhrtafel auf dem Rande des Werkes lag. Es war vom Fußboden hinaufgeklettert oder gesprungen, und die dadurch verursachte Erschütterung hatte wohl den Pendel in Gang gesetzt. Da das Zimmer nicht geheizt wurde, suchte es sich bald sein Lager in einer Bettstelle und wählte sich einen besonderen Platz, den es jedoch gleich verließ, wenn Jemand in die Thüre trat. Das Bett blieb aber von nun an sein liebstes Versteck. Gewöhnlich sucht es dieses auf, wenn man rasch auf es zugeht; aber wenn man ihm freundlich zuredet und sich sonst still hält, bleibt es oft in seinem Laufe stehen oder geht neugierig einige Schritte vorwärts, indem es seinen langen Hals ausstreckt und den einen Vorderfuß aufhebt. Diese seine Neugier ist auch allgemein bekannt, so daß das Landvolk zu sagen pflegt: »Wieselchen freut sich, wenn man es lobt«. – Wenn es sehr aufmerksam, oder wenn ihm etwas verdächtig ist, so daß es weiter sehen will, als sein niedriger Leib ihm erlaubt, setzt es sich auf die Hinterbeine und richtet den Körper hoch auf. Es liegt oft mit erhobenem Halse, gesenktem Kopfe und aufwärts gekrümmtem Rücken. Wenn es läuft, trägt es den ganzen Körper so dicht dem Boden entlang, daß die Füße kaum zu bemerken sind. Wenn man ihm nahe kommt, bellt es, ehe es die Flucht ergreift, mit einem heftigen und gellendem Tone, welcher dem des großen Buntspechtes am ähnlichsten ist; man könnte den Laut auch mit dem Fauchen einer Katze vergleichen, doch ist er schneidender. Noch öfter läßt es ein Zischen wie das einer Schlange hören.
»Als das Hermelin am dritten Tage in einen großen Bauer gesetzt worden war, wo es sah, daß es nicht herauskommen konnte und sich sicher fühlte, ließ es sich nichts nahe kommen, ohne ans Gitter zu springen, heftig mit den Zähnen zu hauen und den vorhin erwähnten Laut in einem langen Triller zu wiederholen, welcher dann dem Schackern einer Elster sehr ähnlich war. Dort ist es auch nicht bange vor dem Hunde, und beide bellen, jeder dicht an seiner Seite des Gitters, gegen einander. Wenn man z. B. den Finger eines Handschuhs durchs Gitter steckt, beißt es hinein und reißt heftig daran. Wenn es sehr böse ist – und dazu ist nicht mehr erforderlich, als daß es von seinem Lager aufgejagt wird – sträubt es jedes Haar seines langen Schwanzes.
»Im allgemeinen ist es sehr boshaft. Musik ist ihm zuwider. Wenn man vor dem Bauer die Guitarre spielt, springt es wie unsinnig gegen das Gitter und bellt und zischt so lange, als man
damit fortfährt. Es versucht niemals, die Klauen zum Zerreißen seiner Beute zu gebrauchen, sondern fällt immer mit den Zähnen an. – Während der beiden ersten Tage verbreitete sich der üble Geruch oft, nachher jedoch äußerst selten, weshalb ich ohne Unannehmlichkeit den Bauer immer in meinem Arbeitszimmer haben konnte.
»Wenn es zur Ruhe geht, dreht es sich wohl mehrere Male rund um, und wenn es schläft, liegt es kreisförmig, die Nase dicht bei der Schwanzwurzel aufwärts gerichtet, wobei der Schwanz rund um den Körper gebogen wird, so daß die ganze Länge beinahe zwei Kreise bildet. Gegen Kälte zeigt es sich sehr empfindlich. Wenn es nur etwas kalt im Zimmer ist, liegt es beständig in dem Neste, welches es sich aus Moos und Federn und mit zwei Ausgängen selbst eingerichtet hat, und wenn man es hinausjagt, zittert es sichtlich. Ist es dagegen warm, so sitzt es gern hoch oben auf dem Tannenbüschel, welcher im Bauer steht. Zuweilen putzt es sich den ganzen Körper bis zum Schwanzende; aber es behelligt seinen Reinlichkeitssinn durchaus nicht, daß nach der Mahlzeit beinahe immer die eine oder andere Feder auf der Nase sitzen bleibt. Wenn ein Licht dem Käfige nahe steht, schließt es, von dem Scheine belästigt, die Augen; eine dichte Ratzenfalle, worin ich es im Zimmer fing, wollte es aber durchaus nicht gegen den hellen Bauer vertauschen. Im Halbdunkel glänzen seine Augen in einer grünen, klaren und schönen Farbe. Die ziemlich dichten Stahldrähte an dem Bauer biß es öfters paarweise zusammen, und wenn es allein im Zimmer war, entschlüpfte es auch wohl dem Gebauer. Einen Beweis seiner Klugheit gab es in den ersten Tagen, indem es sorgfältig seine liebsten Verstecke vermied, sobald es merkte, daß man es von dort in den Bauer locken wollte. Dieser mußte bald gegen einen starken Eisenbauer ausgetauscht werden, dessen Dach und Fußboden von Holz das Thier niemals zu durchbeißen versuchte; dagegen biß es oft in das Eisengitter, um hinauszukommen. Es hatte einen bestimmten Platz für die Losung, und die Einrichtung, wozu dieses Veranlassung gab, erleichterte sehr das Reinhalten des Bauers.
»In den beiden ersten Tagen fraß das Hermelin Kopf und Füße von einigen Birkhühnern. Milch leckte es gleich anfangs mit großer Begier, und diese war, nebst kleinen Vögeln, seine liebste Speise. Zwei Goldammer reichten kaum für einen Tag aus. Es verzehrte den Kopf zuerst und ließ nichts als die Federn übrig. Von größeren Vögeln, als von Hehern und Elstern, ließ es Kopf und Füße zurück. Rohe Hühnereier blieben mehrere Tage unberührt, obgleich es sehr hungrig war, bis ich Löcher hinein machte, worauf es den Inhalt schnell ausgetrunken hatte. Frisches Fleisch von Hornvieh nimmt es nicht gern. Es ißt und trinkt mit einem schmatzenden Laute, wie wenn junge Hunde oder Ferkel saugen. Seine Beweglichkeit in der unteren Kinnlade ist bemerkenswerth: wenn es frißt, gähnt etc. stellt es sie beinahe senkrecht gegen die Oberkinnlade, wie Schlangen, was unter anderem Veranlassung gegeben hat, eine Aehnlichkeit zwischen ihm und diesen Thieren zu finden. Beim Fressen hält es die Augen fast geschlossen und runzelt Nase und Lippen so auf, daß das ganze Gesicht eine platte Fläche bildet. Wenn es dann das geringste Geräusch hört, wird es aufmerksam und mordet oder frißt nicht, so lange es sich beobachtet glaubt. Einen kleinen lebendigen Vogel fällt es gewöhnlich nicht gleich an, sondern erst dann, wenn alles still ist und der Vogel aus Furcht wie unbeweglich dasitzt; dann untersucht es ihn und, wenn es ein Zeichen von Leben sieht, tödtet es denselben durch Zerquetschen des Kopfes, aber selten schnell und auf einmal, läßt ihn vielmehr fast immer lange im Todeskampfe zappeln: eine Grausamkeit, welche es auch gegen eine große Wanderratte bewies, die ich lebendig zu ihm hineinließ. Zuerst sprangen beide lange um einander herum, ohne sich anzufallen: sie schienen sich vor einander zu fürchten. Die ungewöhnlich große Ratte war sehr dreist, biß boshaft in ein durchs Gitter gestecktes Stäbchen und hatte in wenigen Minuten die Milch des Hermelins ausgetrunken. Dieses saß ganz still am anderen Ende des meterlangen Bauers. Es sah aus, als wäre die Ratte dort schon lange zu Hause und das Hermelin eben erst hineingekommen. Nach vollendeter Mahlzeit wollte indessen die erstere sich auch soweit wie möglich von dem Hermelin entfernt halten; als ich sie aber zwang, näher zu kommen, war immer sie die angreifende, und wären Größe und Bosheit allein entscheidend gewesen, hätte ich gewiß mit den übrigen Zuschauern geglaubt, daß der Ausgang sehr ungewiß sei. Das Hermelin schien sogar einige Male zu unterliegen: daß es doch überlegen war, sah man an den schnelleren und sicheren Hieben, womit es sich vertheidigte. Wie eine Schlange zog es sich zurück nach den Anfällen, welche so schnell geschahen, daß man nicht Zeit hatte, den geöffneten Rachen zu sehen. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Die Ratte knirschte und piepte beständig, das Hermelin bellte nur bei der Vertheidigung. Beide sprangen um einander und gegen das Dach des fast meterhohen Bauers hinauf. Als ich sie lange gegen einander aufgereizt hatte und die Ratte weniger kampflustig wurde, begann auch das Hermelin mit seinen Angriffen. Alle Anfälle geschahen offen, von vorn und nach dem Kopfe gerichtet. Keines schlich sich hinter das andere. Bei dem letzten Zusammentreffen kam das Hermelin auf den Rücken der Ratte, preßte die Vorderfüße dicht hinter den Schultern der Ratte fest um ihren Leib zusammen, und da diese sich folglich nicht mehr vertheidigen konnte, lagen beide längere Zeit auf der Seite, wobei der Sieger, sich in den Oberhals der Ratte hineinfraß, bis diese endlich starb. Dann zerquetschte es ihr das Rückgrat der Länge nach und ließ beim Verzehren fast die ganze Haut, den Kopf, die Füße und den Schwanz zurück. Ganz auf gleiche Weise verfuhr das Hermelin mit einer anderen ebenso großen lebendigen Ratte. Ich habe nie gesehen, daß es den Säugethieren oder Vögeln, welche es getödtet, das Blut ausgesogen hätte, wie man zuweilen angibt, aber wohl, daß es sie gleich auffraß.
»Erst am 7. Mai, nachdem ich das Thier ungefähr 4 ½[???] Monate gehabt hatte, versuchte ich, ihm zu schmeicheln, obwohl mit Handschuhen versehen. Wohl biß es in diese hinein, aber ich fühlte keine Zahnspitzen, und noch weniger ließ es Spuren zurück. Zuerst suchte es meinen Liebesbezeigungen auszuweichen, zuletzt aber schienen sie ihm sichtbar zu behagen: es legte sich auf den Rücken und schloß die Augen. Am folgenden Tage wiederholte ich meine Versuche, da ich mir fest vorgenommen hatte, es so zahm wie möglich zu machen. Bald zog ich den Handschuh ab und beschäftigte mich mit ihm, doch mit gleicher Sicherheit als vorher. Es ließ sich willig streicheln und krauen, so viel ich wollte, die Füße aufheben etc., ja, ich konnte ihm sogar den Mund öffnen, ohne daß es böse wurde. Wenn ich es aber um den Leib faßte, glitt es mir leicht und schnell wie ein Aal aus den Händen. Man mußte ihm leise nahen, wenn es nicht bange werden sollte, und die Hauptregel bei dieser sowie der Behandlung anderer wilden Thiere beachten: zu gleicher Zeit zu zeigen, daß man nicht bange ist, und dem Thiere nichts böses thun will.
»Doch bald war es aus mit meiner Freude. Das Hermelin schien mit größerer Schwierigkeit als vorher kleine Mäuse und Vögel zu verzehren, und am 15. Juli lag mein hübscher »Kisse« todt in seinem Bauer, nachdem er mir sieben Monate so manches Vergnügen geschenkt hatte. Ich sah nun deutlich, was ich schon lange zu bemerken geglaubt hatte, daß alle Zähne, außer den Raubzähnen in der Oberkinnlade, beinahe ganz abgenutzt waren, die Eckzähne am meisten. Kam dies vom hohen Alter? Oder hat das Hermelin sie durch das Beißen in das Eisengitter abgenutzt beim Arbeiten für seine Freiheit? Wahrscheinlich hat beides zusammengewirkt.
»Weil man anzuführen pflegt, daß das Hermelin, wenn es gereizt oder erschreckt wird, eine übelriechende Feuchtigkeit aus den Schwanzdrüsen ergießt, will ich noch mittheilen, daß mein Hermelin dieses niemals aus reiner Bosheit, auch nicht, wenn es sehr gereizt wurde, sondern nur beim Erschrecken that. Wenn es bellend und zischend mit gesträubten Schwanzhaaren hervorstürzte – und dies that es immer, wenn es böse war – verbreitete sich niemals dieser Geruch, nicht einmal während der Kämpfe mit den größten Ratten, aber wohl, wenn es die Flucht ergriff. Im Anfange der Gefangenschaft traf letzteres oft ein, weil es da bei jedem Geräusche oder jeder eingebildeten Gefahr gleich bange ward, aber nachdem es daran gewöhnt und heimisch geworden war, sehr selten, und nach zwei oder drei Monaten erinnere ich mich nur einer einzigen Gelegenheit, nämlich, als ich die Thüre seines Käfigs heftig zuschlug. Es ward darüber so erschreckt, daß es bis an die Decke hinaufsprang, und der Geruch verbreitete sich augenblicklich so stark wie in den ersten Tagen. Ich bin daher geneigt, anzunehmen, daß diese Ergießung nicht von dem freien Willen des Thieres
abhängt, sondern durchaus unfreiwillig geschieht. Es ist wahrscheinlich, daß das Hermelin bei großem Schrecken die Schließmuskeln der Afterdrüsen nicht zu schließen vermag, und daß deshalb die Flüssigkeit frei wird. Dasselbe Verhältnis möchte auch wohl bei allen verwandten Thieren, welche mit derartigen Drüsen versehen sind, stattfinden. Es ist auch natürlich! Wenn das Thier Grund hat, sich zu fürchten, bedarf es dieser kleinen Hülfe in der Stunde der Gefahr; aber wozu sollte sie dienen, wenn das Thier überlegen ist oder im Vertrauen auf seine Kraft es zu sein glaubt?«
Das Fell des Hermelins gibt ein zwar nicht theueres, seiner Schönheit halber jedoch geschätztes Pelzwerk. Früher wurde dasselbe nur von Fürsten getragen, gegenwärtig ist es allgemeiner geworden. Nach Lomer gelangen jährlich etwa 400,000 Hermelinfelle im Gesammtwerthe von 300,000 Mark in den Handel, die besten von Barabinsk und Ischim, minder gute vom Jenisei und Jakutsk. In Südostsibirien wird das Hermelin, laut Radde, erst in neuester Zeit eifriger gejagt und seit 1856 zehn bis fünfzehn Kopeken Silber für das Fell bezahlt, während man früher des geringen Preises halber das Thier gar nicht verfolgte.
Zu einer anderen Untersippe vereinigt man die Sumpfottern oder Nörze ( Vison), dem Iltis ungemein nahe verwandte Marder, welche sich von ihm einzig und allein unterscheiden durch den etwas platteren Kopf, den stärkeren Höckerzahn, die kürzeren Beine, die namentlich an den Hinterfüßen deutlicher ausgeprägten Bindehäute zwischen den Zehen, den verhältnismäßig etwas längeren Schwanz und das glänzende, aus dicht und glatt anliegenden, kurzen Haaren bestehende, an das der Fischottern erinnernde, auf der Ober- und Unterseite gleichmäßig braun gefärbte Fell. Von den wenigen Arten, welche man der gedachten Gruppe zurechnet, sind die wichtigsten: unser Nörz und sein amerikanischer Vertreter, der Mink. Bis in die neueste Zeit war über die Lebensweise der beiden Sumpfottern nur höchst wenig bekannt, und auch jetzt noch lassen die veröffentlichten Beobachtungen viel an Vollkommenheit zu wünschen übrig, wenigstens was die europäische Art anlangt. Ich danke der Freundlichkeit eines Weidmanns aus der Lübecker Gegend wichtige Bereicherungen unserer bisherigen Kenntnis, soweit diese den eigentlichen Nörz angeht; über dessen Vertreter in Amerika, den Mink, haben Audubon und Prinz von Wied berichtet.
Viele Naturforscher halten den amerikanischen Sumpfotter oder Mink nur für eine klimatische Ausartung des unserigen, und in der That sind beide Thiere sich sehr nahe verwandt. Doch unterscheidet sich der Mink vom Nörz durch die Verschiedenheit der Leibesverhältnisse hinlänglich, um die entgegengesetzte Ansicht anderer Forscher zu rechtfertigen, d. h. Mink und Nörz als verschiedene Thiere anzusehen. Als Hauptkennzeichen des ersteren mag gelten, daß er kurzköpfiger, aber langschwänziger ist als unser Nörz. Dem entspricht die verschiedene Anzahl der Schwanzwirbel beider Thiere; denn während Hals-, Rücken- und Lendentheil bei Mink und Nörz aus der gleichen Anzahl Wirbel besteht, zählt man bei ersterem 21, bei letzterem dagegen nur 19 Schwanzwirbel. Diese Unterscheidungsmerkmale sind übrigens die einzigen, welche man aufgefunden hat.
Unser Nörz, welcher auch Krebsotter, Steinhund, Wasserwiesel und bei Lübeck Menk oder Wassermenk genannt wird ( Putorius Lutreola , Mustela, Viverra, Lutra Vison und Foetorius Lutreola, Lutra minor etc.), erreicht eine Länge von 50 Centim., wovon etwa 14 Centim. auf den Schwanz kommen. Der Leib ist gestreckt, schlank und kurzbeinig, im ganzen fischotterähnlich, der Kopf jedoch noch schlanker als bei dieser Verwandten. Die Füße ähneln denen des Iltis, aber alle Zehen sind, wie bemerkt, durch Bindehäute verbunden. Der glänzende Pelz besteht aus dichten und glattanliegenden, kurzen, ziemlich harten Grannenhaaren von brauner Färbung, zwischen und unter denen ein grauliches, sehr dichtes Wollhaar sitzt. In der Mitte des Rückens, am Nacken und Hinterleibe am meisten, dunkelt diese Färbung, auch die Schwanzhaare pflegen dunkler zu sein als jene der Leibesseite. Auf dem Unterleibe geht die Färbung in Graubraun über. Ein kleiner, lichtgelber oder weißlicher Fleck steht an der Kehle; die Oberlippe ist vorn, die Unterlippe der ganzen Länge nach weiß.
Eine ganz ähnliche Färbung zeigt auch der Mink ( Putorius vison , Mustela, Martes, Lutreola und Foetorius vison, Mustela und Vison lutreophala, Mustela minx), dessen Pelz weit höher geachtet wird, weil er wollhaariger und weicher ist. Der Mink übertrifft den Nörz etwas an Größe, ist diesem aber sehr ähnlich gefärbt. In der Regel sehen Ober- und Unterseite dunkel nußbraun, der Schwanz braunschwarz und die Kinnspitze weiß aus.

Nörz ( Putorius Lutreola). ⅓[???] natürl. Größe.
Hinsichtlich der Lebensweise werden beide Thiere wahrscheinlich in allem wesentlichen übereinkommen, und deshalb scheint es mir angemessen, einer kurzen Schilderung der Sitten und Gewohnheiten unseres Sumpfotters das wichtigste aus den Berichten der genannten Naturforscher über den amerikanischen Mink vorausgehen zu lassen.
Nächst dem Hermelin ist nach Audubons Bericht der Mink das thätigste und zerstörungswüthigste Raubthier, welches um den Bauernhof oder um des Landmanns Ententeich streift, und die Anwesenheit von einem oder zwei dieser Thiere wird an dem plötzlichen Verschwinden verschiedener jungen Enten und Küchlein bald bemerkt werden. Der wachsame Bauer sieht vielleicht ein schönes, junges Huhn in einer eigenthümlichen und sehr unwillkürlichen Weise sich bewegen und endlich in irgend einer Höhle oder zwischen dem Gestein verschwinden. Er hat einen Mink beobachtet, welcher den unglücklichen Vogel überfiel und seiner Wohnung zuschleppte. Entrüstet über diese That, eilt er nach Hause, sein Gewehr zu holen, kehrt zurück und wartet geduldig, bis es dem Strolche gefällig sein mag, wieder zu erscheinen. Aber gewöhnlich kann er lange harren, ehe es dem listigen Geschöpfe beliebt, wieder zum Vorscheine zu kommen. Und doch ist Geduld hier das einzige Mittel, sich des schädlichen Räubers zu entledigen. Audubon erfuhr dies selbst bei einem Mink, welcher sich unmittelbar neben seinem Hause in dem Steindamme eines kleinen Teiches eingenistet hatte. Der Teich war eigentlich den Enten des Gehöftes zu Liebe aufgestaut worden und bot somit dem Raubthiere ein höchst ergiebiges Jagdgebiet. Sein Schlupfwinkel war mit ebensoviel Kühnheit als List gewählt: sehr nahe am Hause und noch näher der Stelle, zu welcher die Hühner des Hofes, um zu trinken, herabkommen mußten. Vor der Höhle lagen zwei große Stücke von Granit; sie dienten dem Sumpfotter zur Warte, von wo aus er Gehöft und Teich überschauen konnte. Hier lag er tagtäglich stundenlang auf der Lauer, und von hier aus raubte er bei hellem, lichtem Tage Hühner und Enten weg, bis unser Forscher seinem Treiben, obwohl erst nach längerem Anstande, ein Ende machte. »Wir thun zu wissen«, sagt Audubon, »daß wir nicht die geringste Absicht haben, irgend etwas zur Vertheidigung des Mink zu sagen, müssen jedoch hinzufügen, daß, so listig und zerstörungssüchtig er auch ist, er weit hinter seinem nächsten Nachbar, dem Hermelin, zurücksteht, weil er sich mit so viel Beute begnügt, als er zur Sättigung bedarf, während das Hermelin bekanntlich in einer Nacht ein ganzes Hühnerhaus veröden kann.« Besonders häufig fand Audubon den Mink am Ohio, und hier beobachtete er, daß sich derselbe durch Mäuse- und Rattenfang auch nützlich zu machen weiß. Neben solcher, dem Menschen nur ersprießlichen Jagd, treibt er freilich allerhand Wilddiebereien und namentlich den Fischfang, zuweilen zum größten Aerger des Anglers, dessen Gebaren das listige Thier mit größter Theilnahme verfolgt, um im entscheidenden Augenblicke aus seiner Höhle unter dem Weidicht des Ufers hervorzukommen und den von jenem erangelten Fisch in Beschlag zu nehmen. Nach den Beobachtungen unseres Gewährsmannes schwimmt und taucht der Mink mit größter Gewandtheit und jagt, wie der Otter, den schnellsten Fischen, selbst Lachsen und Forellen, mit Erfolg nach. Im Nothfalle begnügt er sich freilich auch mit einem Frosche oder Molche; wenn er es aber haben kann, zeigt er sich sehr leckerhaft. Seine feine Nase gestattet ihm, eine Beute mit der Sicherheit eines Jagdhundes zu verfolgen; gute Beobachter sahen ihn von dieser Begabung den ausgedehntesten Gebrauch machen. Im Moore verfolgt er die Wasserratten, Rohrsperlinge, Finken und Enten, an dem Ufer der Seen Hasen, im Meere stellt er Austern nach, und vom Grunde der Flüsse holt er Muscheln herauf: kurz er weiß sich überall nach des Ortes Beschaffenheit einzurichten und immer etwas zu erbeuten. Felsige Ufer bleiben unter allen Umständen sein bevorzugter Aufenthalt; nicht selten wählt er sich seinen Stand in unmittelbarer Nähe von Stromschnellen und Wasserfällen. Verfolgt flieht er stets ins Wasser und sucht sich hier tauchend und schwimmend zu retten. Auf dem Lande läuft er ziemlich rasch, wird jedoch vom Hunde bald eingeholt und dann selbst zum Klettern gezwungen. In der Angst verbreitet er einen sehr widerlichen Geruch wie der Iltis.
In Nordamerika fällt die Rollzeit des Mink zu Ende Februars oder zu Anfang des März. Den Boden deckt um diese Zeit meist tiefer Schnee, und somit kann man recht deutlich wahrnehmen, wie rastlos er ist. Man sieht die brünstigen Männchen längs der Stromufer nach Weibchen suchen, und es kann dabei geschehen, daß eine ganze Gesellschaft unserer Thiere, den Flüssen folgend, sich in Gegenden verirrt, in denen sie sonst selten oder gar nicht mehr vorkommen. Audubon schoß an einem Morgen sechs alte Männchen, welche unzweifelhaft beabsichtigten, ein Weibchen zu suchen. In einer Woche erhielt gedachter Naturforscher eine große Anzahl von männlichen Minks, jedoch nicht einen einzigen weiblichen, und spricht deshalb seine Meinung dahin aus, daß die weiblichen Minks während der Rollzeit in Höhlen sich verbergen. Die fünf bis sechs Jungen, welche ein Weibchen wirft, findet man zu Ende Aprils in Höhlen unter den überhängenden Ufern oder auf kleinen Inselchen, im Sumpfe und auch wohl in Baumlöchern. Wenn man sie bald aus dem Neste nimmt, werden sie ungemein zahm und zu wahren Schoßthierchen. Richardson sah eins im Besitze einer Canadierin, welches sie bei Tage in der Tasche ihres Kleides mit sich herumtrug. Audubon besaß ein anderes über ein Jahr lang und durfte es frei im Hause und Hofe umher laufen lassen, ohne daß er Ursache hatte, sich zu beklagen. Es fing wohl Ratten und Mäuse, Fische und Frösche, griff aber niemals die Hühner an. Mit den Hunden und Katzen stand es auf bestem Fuße. Am lebendigsten und spiellustigsten zeigte es sich in den Morgen- und Abendstunden; gegen Mittag wurde es schläfrig. Einen unangenehmen Geruch verbreitete es niemals.
Der Mink geht leicht in alle Arten von Fallen und wird ebenso häufig geschossen als gefangen; seine Lebenszähigkeit macht jedoch einen guten Schuß nothwendig.
Prinz von Wied bestätigt Audubons Beschreibung, fügt ihr aber noch hinzu, daß der Mink zuweilen doch mehr als ein Huhn auf einmal tödte, daß er sich im Winter oft längere Zeit von Flußmuscheln ernähre, und man deshalb viele leere Muschelschalen in der Nähe seines Wohnplatzes finde, daß er sich im Winter häufig den menschlichen Wohnungen nähere und dann oft gefangen oder erlegt würde, und endlich, daß er, obwohl er außerordentlich geschickt und schnell mit langausgestrecktem Körper schwimme, doch nicht lange unter dem Wasser bleiben könne, sondern mit der Nase bald hervorkomme, um Athem zu holen.
Ueber unseren Nörz sind die Angaben viel dürftiger. Schon Wildungen sagt in seinem 1799 erschienenen »Neujahrsgeschenk für Forst- und Jagdliebhaber«, daß der Sumpfotter ein in Deutschland sehr seltenes, manchem wackeren Weidmann wohl gar noch unbekanntes Geschöpf sei, daß er schon länger gewünscht habe, näher mit ihm vertraut zu werden, und die Erfüllung dieses Wunsches nur der unermüdlichen Fürsorge des Grafen Mellin verdanke. Von diesem Naturforscher theilt er einige Beobachtungen mit.
»In seinem Gange mit gekrümmtem Rücken, in seiner Behendigkeit, durch die kleinsten Oeffnungen zu schlüpfen, gleicht der Nörz dem Marder. Gleich dem Frettchen ist er in unaufhörlicher Bewegung, alle Winkel und Löcher auszuspähen. Er läuft schlecht, klettert auch nicht auf die Bäume, ist aber, wie der gemeine Fischotter, ein sehr geübter Schwimmer, welcher sehr lange unter Wasser ausdauern kann. Den reißenden Wellen starker Ströme zu widerstehen, mag er sich wohl zu schwach fühlen, da er weniger an großen Flüssen, sondern mehr an kleinen, fließenden Wässern gefunden wird. Seine Ranz- oder Rollzeit ist im Februar und März, und im April oder Mai findet man an erhabenen, trockenen Orten, in den Brüchen oder Baumwurzeln, in den eigenen Röhren blindgeborene Junge.
»Der Sumpfotter liebt Stille und Einsamkeit an seinem Wohnorte. So sehr er aber auch Menschen flieht und mit großer Klugheit deren Nachstellungen zu entgehen weiß, besucht er doch zuweilen Federviehställe und erwürgt dann, wie Marder und Iltis, so lange noch Federvieh vorhanden und er nicht gestört wird; doch geschieht dies nur in einsamen Fischerwohnungen, und ich habe nie gehört, daß er in Dörfer gekommen sei, um dort zu rauben. Seine gewöhnliche Nahrung sind Fische, Frösche, Krebse, Schnecken; wahrscheinlich mögen ihm aber auch manche junge Schnepfen und Wasserhühnchen zur Beute werden.
»Der anlockende Preis seines Balges, welcher auch im Sommer gut ist, vermehrt die Nachstellungen auf das immer seltener werdende Thier ungemein, und wenn ihm nicht die bisherigen gelinden Winter etwas zu statten gekommen sind, so möchte diese Thierart auch wohl in Schwedisch-Pommern, woselbst Mellin sie beobachtete, bald gänzlich ausgerottet sein.«
In diesen Nachrichten ist eigentlich alles enthalten, was wir bisher vom Nörz erfahren haben. Die Furcht, daß er in Deutschland gänzlich ausgerottet sei, ist nach und nach ziemlich allgemein geworden, glücklicherweise jedoch nicht begründet. Der Nörz kommt in Norddeutschland allerorts, obgleich überall nur sehr einzeln noch vor. Seine eigentliche Heimat ist das östliche Europa, Finnland, Polen, Litauen, Rußland. Hier findet man ihn von der Ostsee bis zum Ural, von der Dwina bis zum Schwarzen Meere und nicht besonders selten. In Bessarabien, Siebenbürgen und Galizien lebt er auch. In Mähren gehört er laut Jeitteles zu den sehr seltenen Thieren, kommt aber hier und da noch vor; in Schlesien wird er ebenfalls dann und wann gefangen. »In meinem Hause«,schreibt mir Jänicke, »wohnt ein aus Schweidnitz gebürtiger Kürschner, ein für sein Fach sehr unterrichteter Mann, welcher mir versichert, daß während seiner Lehrzeit und später in den Jahren 1848 bis 1855 in Schweidnitz an den Ufern der Weistritz, welche meistens aus Steingeröll bestehen, jährlich ungefähr ein Dutzend Nörze gefangen wurden. Die dortigen Kürschner hielten es nicht für gerathen, die Bauern, welche solche als dunkle Iltisse verkauften, aufzuklären, weil letztere, damals wenigstens, viel geringer im Preise als erstere standen. Gegenwärtig ist der Nörz auch hier sehr selten, schwerlich aber gänzlich ausgerottet worden, wie in so vielen anderen Gegenden Deutschlands. « Zu Ende des vorigen Jahrhunderts wurde er ab und zu noch in Pommern, Mecklenburg und der Mark Brandenburg erwähnt. In den Jagdregistern der Grafen Schulenburg-Wolfsburg wird er regelmäßig mit aufgeführt. Man erlegte ihn in den Sumpfniederungen der Aller. In diesem Jahrhunderte ist er sehr selten geworden, jedoch immer noch einzeln vorgekommen. Nach Blasius wurde im Jahre 1852 ein Nörz im Harz in der Grafschaft Stolberg gefangen, nach Hartig ein anderer im Jahre 1859 in der Nähe von Braunschweig und ein dritter bei Ludwigslust in Mecklenburg erlangt. Hier soll er, mir gewordenen übereinstimmenden Nachrichten zufolge, überhaupt nicht gerade selten sein, mindestens jährlich erbeutet und zu Markte gebracht, beziehentlich sein Fell an die Kürschner verkauft werden. Daß er im Holsteinischen vorkommt, wußte man, ohne jedoch sicheres mittheilen zu können. Um so erfreulicher war es mir, von einem naturwissenschaftlich gebildeten Weidmann, Herrn Förster Claudius, folgende Nachrichten zu erhalten.
»Soviel mir bis jetzt bekannt geworden, kommt der Nörz in der Umgebung Lübecks auf einem Flächenraume von nur wenigen Geviertmeilen, hier aber nicht so selten vor, daß er nicht jedem Jäger von Fach unter dem Namen Menk, Ottermenk, wenigstens oberflächlich bekannt wäre. Als nördliche Grenze dieses Verbreitungsgebietes könnte man etwa den Himmeldorfsee, als südliche den Schallsee, als östliche den Dassowersee betrachten. Immerhin tritt er zu vereinzelt auf, und sein Rauchwerk wird hier zu Lande auch zu schlecht bezahlt, als daß man ihm besondere Aufmerksamkeit schenken sollte. Ich erinnere mich nicht, gehört zu haben, daß man ihm mit eigenen Lockspeisen nachstellt oder besondere Fangwerkzeuge, welche sein Aufenthalt am Wasser gestatten würde, Flügelreusen z. B., gegen ihn in Anwendung bringt. Er geräth fast immer nur durch Zufall in die Hand des Jägers und dies selten anders als zur Winterzeit, da nur dann dem Raubzeuge nachgegangen wird, sein Gebiet auch häufig nur bei Frost betreten werden kann. Und so ist leider über sein Verhalten in der anderen Hälfte des Jahres, welche dem Naturforscher ungleich wichtigere Aufschlüsse zu bieten hat, wenig oder nichts mit Sicherheit zu erfahren. Mir ist ein einziger Fall zu Ohren gekommen, daß Junge in einem Bau gefunden wurden, und zwar von einem meiner Nachbarn, welcher einmal in der letzten Hälfte des Juli gelegentlich der Bekassinenjagd vier bis fünf junge Nörze in einem Erdloche beisammen traf und aus der Anwesenheit der Mutter mit Bestimmtheit als den Wurf eines Minks erkannte. Da zu erwarten stand, daß diese ihre Jungen sofort entfernen würde, waren auch alle weiteren Beobachtungen unterblieben. Sonst kommt er höchstens auf der Entenjagd einmal vor die Flinte, und dann wird er nicht geschont, weil sein Balg auch im Sommer gut ist. Bei dieser Gelegenheit wurde vor einigen Jahren hier in der Nachbarschaft ein Mink, dem die Hunde von der Wasserseite aus zusetzten, von dem Kopfe einer hohlen Weide herabgeschossen. In den Wintermonaten dagegen kommt der Nörz öfter mit dem Jäger in Berührung, meist, wie erwähnt, gelegentlich, wenn auf den Iltis Jagd gemacht wird. Ab und zu wird er auf einer Neue vor dem Hunde geschossen, von diesem beim Ausrutschen aus dem Bau gegriffen, am häufigsten aber noch auf dem Teller gefangen. Der Jagdlehrling, welcher die Eisen abzugehen hat, wird dann aber nicht etwa mit der Freude, mit welcher der Forscher ihn begrüßen würde, sondern sicher mit einem sauern Gesicht empfangen, weil unser Nörz kaum die Hälfte des Werthes von einem Iltisse hat. Mehr als ein Gulden, derselbe Preis, den fast vor fünfzig Jahren Dietrich aus dem Winkell von der Provinz Brandenburg angibt, wird noch heutzutage nicht gezahlt, da der Balg weder zum eigenen Gebrauche, noch von Aufkäufern sehr gesucht ist.
»Die augenfällige Ähnlichkeit, welche er einerseits mit dem Iltisse in der Färbung der Schnauze und der Behaarung der kurzen Ruthe, andererseits mit dem Otter in der glänzenden Oberfläche des Balges und mit beiden in der Lebensweise gemein hat, machen die hier allgemein verbreitete Annahme, daß er ein Blendling von Iltis und Fischotter sei, ebenso begreiflich als verzeihlich; auch erklärt sich der Jäger daraus das stets vereinzelte Auftreten dieses für große Streifzüge über Land scheinbar so untüchtigen Thieres. Der Nörz liebt die brüchigen und schilfreichen Umgebungen von Seen und Flüssen, wo er, wie der Iltis, seine Wohnung auf einer Kaupe oder dammartigen Erhöhung im Gewurzel von Erlenbäumen, doch gern in möglichster Nähe des Wassers anlegt und mit wenigen Ausgängen, welche nach der Wasserseite münden, versieht. Fluchtröhren nach einer anderen Richtung oder gar Gänge nach benachbarten Kaupen sind hier nicht anzutreffen. Während der Iltis, aus dem Baue gestört, sich durchaus nicht zu Wasser jagen läßt, sondern stets sein Heil in der Flucht auf dem Lande sucht, wo er Schlupfwinkel in hinreichender Menge kennt, fällt der Mink unter solchen Umständen sofort, und zwar in senkrechter Richtung ins Wasser und verschwindet hier den Blicken. Bemerkenswerth ist, wie er sich hierzu seiner Läufe bedient: er rudert nicht abwechselnd, wie der Iltis, sondern er schnellt sich stoßweise fort, und zwar mit überraschender Geschwindigkeit. Es gelingt selten, ihn im Wasser zu schießen, da er lange unter der Oberfläche bleibt und stets an einer entfernten Stelle wieder zum Vorschein kommt. Vor dem Hunde ist er im Wasser, selbst im beschränkten Raume, sicher.
»Die Spur sowohl, wie die einzelne Fährte, ist der des Iltis so ähnlich, daß selbst der geübte Jäger leicht getäuscht wird, da sich bei gewöhnlicher Gangart die kurze Schwimmhaut nicht im Boden abdrückt. Man hat sie im Winter da zu suchen, wo sich das Wasser lange offen zu halten pflegt, in Gräben, welche ein starkes Gefälle haben, in Wasserbächen, über Quellen, wo man zu derselben Zeit den Iltis ebenfalls antrifft, welcher bekanntlich auch unter dem Eise eifrig nach Fröschen fischt. Hier in den Ausstiegen eben unter dem Wasser ist es, wo man hin und wieder den Menk, von Schlamm fast unkenntlich, auf dem Eisen sitzen sieht.«
Später berichtet Claudius in den »Forstlichen Blättern« weiteres über das Thier. »Zu den Standorten«, bemerkt er, »welche, so lange die örtlichen Verhältnisse sich nicht ändern, noch einige Aussicht auf Erhaltung dieser Thierart zu gewähren scheinen, gehört der etwa zwei Meilen lange Abfluß des Ratzeburger Sees in die Trave bei Lübeck, die Wagenitz genannt, ein fast durchgängig von flachen Ufern begrenzter Wasserlauf, in welchem von einer Strömung kaum die Rede sein kann. Infolge künstlicher Aufstauung des Wassers bei Lübeck, welches von hier zum größten Theile seinen Wasserbedarf bezieht, sind die Ufer auf große Strecken gänzlich versumpft und mit Schilf und Erlenstöcken bestanden, und jede Trockenlegung derselben, so sehr auch wirtschaftliche und gesundheitliche Rücksichten dies wünschenswerth erscheinen lassen, ist unmöglich gemacht. Daß der Nörz hier vorkommt, erfuhr ich durch einen meiner Forstarbeiter, welcher hier mehrere Jahre als Fischerknecht gedient und seiner Zeit der Sumpf- und Fischotterjagd obgelegen hatte. Durch seine Hülfe wurde es mir möglich, an Ort und Stelle durch eigenen Augenschein mich von der Richtigkeit seiner Angabe zu überzeugen und mir etwaige Gefangene zu sichern. Wie günstig die Oertlichkeit für das Thier ist, erkannte ich auf den ersten Blick: der Nörz genießt hier während des größten Theiles vom Jahre die ungestörteste Ruhe, und selbst der Winter, welcher ihm am meisten gefährlich wird, tritt oft so milde auf, daß die in einzeln liegenden Gehöften längs des Ufers wohnenden Fischer weite Strecken des Bruches gar nicht betreten können. Dazu kömmt, daß unser immer nur vereinzelt auftretendes Thier bloß dann die Beachtung der Umwohner erregt, wenn es durch wiederholte Diebereien lästig wird. Die gefangenen Fische werden hier nicht in geschlossenen Behältern, sondern in offenen Weidenkörben am Ufer kleiner zum Theil künstlich angelegter Inselchen in der Nähe der Wohnungen aufbewahrt; eine so leicht zu erlangende Beute verschmäht der Nörz natürlich nicht, und wenn man ihm auch wohl den einen oder anderen Fisch gönnen möchte, kann man ihm doch den Schaden nicht verzeihen, welchen er dadurch verursacht, daß er lieber die oft daumendicken Weidenruthen durchschneidet, als über den Rand des offenen Korbes klettert, wie der Iltis in solchen Fällen unbedenklich thut. Wahrnehmung dieser Eigenheiten des Thieres führt in der Regel zu seinem Verderben, obgleich die Fanganstalten, welche die Fischer treffen, mit einer Sorglosigkeit zugerichtet werden, daß sie bei mir ein Lächeln erregt haben würden, hätte ich mich nicht mehrfach von ihrem guten Erfolge zu überzeugen Gelegenheit gehabt. Man streut nämlich auf diesen sogenannten Werdern am liebsten beim ersten starken Froste, wenn der Nörz anfängt Noth zu leiden, einige Fische aus, legt ein paar gute Ratteneisen, verblendet sie nothdürftig und befestigt sie wie die für den Otter gelegten, so daß der Fang mit dem Eisen das Wasser erreichen kann; auf die Ausstiege nimmt man keine Rücksicht, nicht einmal auf die Fährte: die Bequemlichkeit des Fängers allein scheint maßgebend zu sein. Daß der Räuber dessen ungeachtet in den meisten Fällen bald gefangen wird, spricht wenig für seine Vorsicht, so menschenscheu er sonst ist.«
Es vergingen Jahre, bevor Claudius und durch ihn ich zu dem erwünschten Ziele gelangten, einen lebenden Nörz zu erhalten. Erst im Anfange des Jahres 1868 konnte mir mein eifriger Freund mittheilen, daß ein Weibchen gefangen und ihm überbracht worden sei, bei Milch und frischer Fleischkost sich auch sehr wohl befinde, und daß sein Pfleger wegen der ruhigen Gemüthsart des Gefangenen die Hoffnung habe, den durch das Eisen verursachten Schaden bald ausgeheilt zu sehen. »Der Nörz ist«, schreibt mir Claudius, »bei weitem gutartiger als seine Gattungsverwandten und zürnt nur, wenn er geradezu gereizt wird; außerdem zieht er es vor, mich nicht zu beachten, läßt sich wohl auch mit einem Stöckchen den Balg streichen, ohne darüber böse zu werden. Den ganzen Tag über liegt er auf der einen Seite des Käfigs zusammengerollt auf seinem Heulager, während er auf der anderen Seite regelmäßig sich löst und näßt; nachts spaziert er in seiner ziemlich geräumigen Wohnung umher, hat sich auch verschiedene Male gewaltsam daraus entfernt. Aber nur das erste Mal traf ich ihn des Morgens außerhalb derselben in einem Winkel der Stube verborgen; später fand ich ihn, wenn er sich des Nachts befreit hatte, am Morgen regelmäßig wieder auf seinem Lager, als wenn er in seinen nächtlichen Wanderungen mehr eine Erheiterung als Befreiung aus seiner Haft gesucht habe.«
Nachdem der Nörz sich mit seiner Haft vollständig ausgesöhnt hatte und so zahm geworden war, daß er sich von seinem Pfleger widerstandslos greifen ließ, auch gegen Liebkosungen empfänglich sich zeigte, sandte Claudius ihn mir in einer verschlossenen Kiste. Ich erkannte schon beim Oeffnen derselben an dem vollständigen Fehlen irgend welches unangenehmen Geruches, wie solchen der Iltis unter ähnlichen Umständen unbedingt verbreitet haben würde, daß ich es gewiß mit einem Sumpfotter zu thun hatte. Wohl darf ich sagen, daß mich kaum ein Thier jemals mehr erfreut hat, als dieser seltene, von mir seit Jahren erstrebte europäische Marder, welcher heute noch, fünf Jahre nach seinem Fange, des besten Wohlseins sich erfreut. Leider hat sich meine Hoffnung, ein Männchen zu erlangen und dadurch vielleicht auch über die Fortpflanzung ins Klare zu kommen, nicht erfüllt, und ich kann deshalb über meinen Gefangenen nur Beobachtungen wiedergeben, welche ich bereits veröffentlicht habe.
Während des ganzen Tages liegt der Nörz zusammengewickelt auf seinem Lager, welches in einem vorn verschließbaren Kästchen angebracht worden ist, und nicht immer, selbst durch Vorhaltung von Leckerbissen nicht regelmäßig, gelingt es, ihn zum Aufstehen zu bewegen oder hervorzulocken. Er hört zwar auf den Anruf, ist auch mit seinem Wärter in ein gewisses Verhältnis getreten, zeigt aber keineswegs freundschaftliche Gefühle gegen den Pfleger, vielmehr einen entschiedenen Eigenwillen und fügt sich den Menschen nur so weit, als ihm eben behagt. Hieran hat freilich der Käfig den Haupttheil der Schuld; wenigstens zweifle ich nicht, daß er als Zimmergenosse wahrscheinlich schon längst zum niedlichen Schoßthiere geworden sein würde. Erst ziemlich spät abends, jedenfalls nicht vor Sonnenuntergang, verläßt er das Lager und treibt sich nun während der Nacht in seinem Käfige umher. Diese Lebensweise beobachtet er einen wie alle Tage, und hieraus erklärt sich mir zur Genüge die allgemeine Unkenntnis über sein Freileben. Den Edelmarder kann man im Walde unter Umständen aufspüren und gewaltsam aus seinem Verstecke treiben, im Sommer auch wohl mit seinen Jungen spielen und der Eichhörnchenjagd obliegen sehen; Steinmarder und Iltis lassen sich als Bewohner alter, beziehentlich stiller Gebäude mindestens in hellen Mondnächten beobachten, und der Fischotter wählt sich, wenn er sich zeigt, die breite Wasserstraße: wer aber vermag im Dunkel der Nacht den Nörz in seinem eigentlichen Heimgebiete, dem Bruche oder Sumpfe, zu folgen? In seinen Bewegungen steht letzterer, soweit man von meinem in engem Raume untergebrachten Gefangenen urtheilen kann, dem Iltis am nächsten. Er besitzt alle Gewandtheit der Marder, aber nicht die Kletterfertigkeit der hervorragendsten Glieder der Familie und ebensowenig ihre Bewegungslust, man möchte vielmehr sagen, daß er keinen Schritt unnütz thue. Ein Edel- oder Baummarder vergnügt sich zuweilen im Käfige stundenlang mit absonderlichen Sprüngen, indem er gegen die eine Wand seines Käfigs setzt, zurückschnellend sich überschlägt, in der Mitte des Raumes auf den Boden springt, nach der anderen Wand sich wendet und hier wie vorher verfährt, kurzum die Figur einer Acht beschreibt, und zwar mit solcher Schnelligkeit, daß man vermeint, diese Zahl durch den Leib des Thieres gebildet zu sehen: auf solche Spielereien läßt sich, so weit meine Beobachtungen reichen, der Nörz niemals ein. Trippelnden Ganges schleicht er mehr, als er geht, seines Weges dahin, gleitet rasch und behend über alle Unebenheiten weg, hält sich aber auf dem Boden und strebt nicht nach der Höhe. Ins Wasser geht er aus freien Stücken nicht, sondern nur, wenn dort ihm eine Beute winkt; doch mag an dieser auffallenden Zurückhaltung der nicht mit einem Schwimmbecken eingerichtete Käfig schuld sein. Bei allen Bewegungen ist das sehr klug aussehende Köpfchen nicht einen Augenblick ruhig; die scharfen Augen durchmustern ohne Unterlaß den ganzen Raum, und die kleinen Ohren spitzen sich so weit als möglich, um das wahrzunehmen, was jenen entgehen könnte. Reicht man ihm jetzt eine lebende Beute, so ist er augenblicklich zur Stelle, faßt das Opfer mit vollster Mardergewandtheit, beißt es mit ein paar raschen Bissen todt und schleppt es in seine Höhle. Schmidt beobachtete, daß er Frösche an den Hinterschenkeln packte und diese zunächst durchbiß, um die Lurche zu lähmen: ich habe stets gesehen, daß er sie, wie alle übrigen ihm vorgehaltenen Thiere, am Kopfe ergreift und diesen so schleunig wie möglich zermalmt. Hat er mehr Nahrung, als er bedarf, so schleppt er ein Stück nach dem anderen in seinen Schlafkasten, frißt jedoch in der Regel von ihm eilfertig ein wenig und wirft es erst dann bei Seite, wenn ein anderes seine Mordlust erregt. Fische und Frösche scheinen die ihm liebste Nahrung zu sein, obgleich Claudius meinte, daß er Fleischkost allem übrigen vorziehe und Fische nur dann verzehre, wenn er kein Fleisch bekommen könnte. Allerdings läßt er Fische liegen, wenn ihm eine lebende Maus, ein lebendiger Vogel oder Lurch gereicht wird; es reizt ihn aber dann nur das Bewegen solcher Beute, und er beeilt sich gleichsam, seine Fertigkeit im Fangen und Abwürgen zu zeigen. Hat er aber dagegen seine Opfer getödtet, und reicht man ihm dann einen Fisch, so pflegt er letzteren zuerst zu sich zu nehmen oder höchstens einen Frosch ihm vorzuziehen. Daß Gewöhnung bei der Auswahl der Speisen nicht ohne Einfluß ist, beweisen Schmidts Beobachtungen an einem von ihm gepflegten Nörze, welcher Krebse ohne weiteres packte und sich auch durch ihre Abwehr nicht beirren ließ, während mein Gefangener bis jetzt alle Krebse hartnäckig verschmäht hat. Auch Eier habe ich letzterem wiederholt vorgesetzt, ohne daß er sich um sie bekümmert hat; dem ungeachtet glaube ich gern, daß er während seines Freilebens so gut wie andere Marder ein Vogelnest ausnehmen und seines Inhaltes berauben wird; jedenfalls möchte ich nicht wagen, von dem einen auf das Betragen aller und am wenigsten auf das Benehmen der freilebenden Nörze zu schließen. Besonders auffallend ist es mir, daß mein Gefangener sich eher vor dem Wasser zu scheuen als sich nach ihm zu sehnen scheint. Ein Fischotter versucht selbst in dem kleinsten Raume das befreundete Element in irgend welcher Weise für sich auszunutzen: der Nörz denkt nicht daran, und das Wasser dient ihm eigentlich nur zum Trinken, nicht aber zum Baden oder gar zum Tummelplatze.
Im Verhältnis zu der Anzahl von Minkfellen, welche unter dem Namen amerikanische Nörze auf den Markt kommen, ist die Anzahl der echten Nörzfelle sehr gering: nach Lomer erbeutet man höchstens 55,000 Nörze, aber 160,000 Minke jährlich. Letztere werden gegenwärtig mit neun bis dreißig Mark bezahlt, während russische durchschnittlich nur drei bis sechs Mark werth sind. Der Unterschied zwischen beiden Fellen ist freilich ein sehr bedeutender: erstere haben feineres und darum haltbareres Haar, welches sich zu dem der europäischen Nörze wie Seide zu Zwirn verhält. Die besten Minkfelle liefert die Ostküste Nordamerikas, Neuengland und Maine, das Gebiet, aus welchem die schlechtesten Fichtenmarder oder amerikanische Zobel kommen.
Linné stellt den ihm aus eigener Anschauung bekannten Vielfraß zu den Mardern, die Wolverene, dasselbe Thier, dagegen zu den Bären. Hierdurch bekundet der ausgezeichnete Naturforscher, was der Vielfraß ist: ein Mittelglied zwischen den genannten Familien.
Der Vielfraß, eine der plumpesten Gestalten der Marderfamilie, vertritt eine besondere Sippe ( Gulo), deren Kennzeichen folgende sind: Der Leib ist kräftig und gedrungen, der Schwanz kurz und sehr buschig, der Hals dick und kurz, der Rücken gewölbt, der Kopf groß, die Schnauze länglich, ziemlich stumpf abgeschnitten, die Beine sind kurz und stark, die plumpen Pfoten fünfzehig und mit scharf gekrümmten und zusammengedrückten Krallen bewehrt. Der Schädel ähnelt dem des Dachses, ist aber doch etwas breiter, gedrungener und sehr gebogen, so daß die Stirn und der Nasenrücken stark hervortreten; das aus 38 Zähnen bestehende Gebiß sehr kräftig, der Reißzahn oben und unten stark entwickelt, der Höckerzahn im Oberkiefer quer gestellt und doppelt so breit als lang, während der untere Höckerzahn größere Länge als Breite hat. Die Anzahl der rippentragenden Wirbel beträgt fünfzehn oder sechszehn; vier oder fünf sind rippenlos, vier bilden das Kreuzbein und vierzehn den Schwanz.

Vielfraß ( Gulo borealis). 1/6 natürl. Größe.
Der Vielfraß ( Gulo borealis, Ursus, Mustela und Taxus Gulo, Ursus sibiricus, Gulo vulgaris, arcticus, luscus, Volverene und leucurus) ist 95 Centim. bis 1 Meter lang, wovon 12 bis 15 Centim. auf den Schwanz kommen, und am Widerrist 40 bis 45 Centim. hoch. Auf der Schnauze sind die Haare kurz und dünn, an den Füßen stark und glänzend, am Rumpfe lang und zottig, um die Schenkel, an den hellen Seitenbinden und am Schwanze endlich straff und sehr lang. Scheitel und Rücken sind braunschwarz mit grauen Haaren gemischt, der Rücken, die Unterseite und die Beine dunkelschwarz; ein hellgrauer Flecken steht zwischen Augen und Ohren, und eine hellgraue Binde verläuft von jeder Schulter an längs der Seiten hin. Das Wollhaar ist grau, an der Unterseite mehr braun.
Der Vielfraß bewohnt den Norden der Erde. Von Südnorwegen und Finnmarken an findet man ihn durch ganz Nordasien und Nordamerika bis Grönland. Früher war die südliche Grenze seiner Verbreitung in Europa unter tieferen Breiten zu suchen als gegenwärtig; zur Renthierzeit erstreckte sie sich bis zu den Alpen. Eichwald versichert, daß er noch spät in den Wäldern von Litauen vorgekommen sei; Brincken hat ihn noch vor einigen Jahren im Walde von Bialowies beobachtet, wo er jetzt auch nicht mehr gefunden wird; Bechstein erzählt von einem Vielfraße, welcher bei Frauenstein in Sachsen, und Zimmermann von einem anderen, welcher bei Helmstedt im Braunschweigischen erlegt wurde. Die beiden letzteren werden als versprengte Thiere angesehen, weil man nicht wohl annehmen kann, daß der Vielfraß in so späten Zeiten noch so weit nach Süden gegangen ist. Gegenwärtig sind Norwegen, Schweden, Lappland, Großrußland, namentlich die Gegenden um das Weiße Meer, ganz Sibirien, Kamtschatka und Nordamerika sein Wohngebiet.
Die älteren Naturforscher erzählen von ihm die fabelhaftesten Dinge, und ihnen ist es zuzuschreiben, daß der Vielfraß einen in allen Sprachen gleichbedeutenden Namen führt. Man hat sich vergebliche Mühe gegeben, das deutsche Wort Vielfraß aus dem Schwedischen oder Dänischen abzuleiten. Die Einen sagen, daß das Wort aus Fjäl und Fräß zusammengesetzt sei und Felsenkatze bedeute; Lenz behauptet aber, daß das Wort Vielfraß der schwedischen Sprache durchaus nicht angehöre, und weist auch die Annahme zurück, daß es aus dem Finnischen abgeleitet sei. Die Schweden selbst sind so unsicher hinsichtlich der Bedeutung des Namens, daß jene Ableitung wohl zu verwerfen sein dürfte. Bei den Finnen heißt das Thier Kampi, womit man jedoch auch den Dachs bezeichnet, bei den Russen Rosomacha oder Rosomaka und bei den Skandinaviern Jerf; die Kamtschadalen nennen es Dimug und die Amerikaner endlich Wolverene. Höchst wahrscheinlich wurde der Name nach den ersten Erzählungen ins Deutsche übersetzt und ging nun erst in die übrigen Sprachen über. Wenn man jene Erzählungen liest und glaubt, muß man dem alten Kinderreim
»Vielfraß nennt man dieses Thier,
Wegen seiner Freßbegier!«
freilich beistimmen. Michow sagt folgendes: »In Litauen und Moscowien gibt es ein Thier, welches sehr gefräßig ist, mit Namen Rosomaka. Es ist so groß wie ein Hund, hat Augen wie eine Katze, sehr starke Klauen, einen langhaarigen, braunen Leib und einen Schwanz wie der Fuchs, jedoch kürzer. Findet es ein Aas, so frißt es so lange, daß ihm der Leib wie eine Trommel strotzt; dann drängt es sich durch zwei nahestehende Bäume, um sich des Unraths zu entledigen, kehrt wieder um, frißt von neuem und preßt sich dann nochmals durch die Bäume, bis es das Aas verzehrt hat. Es scheint weiter nichts zu thun, als zu fressen, zu saufen und dann wieder zu fressen«. In dieser Weise schildert auch Geßner den Vielfraß; Olaus Magnus aber weiß noch mehr. »Unter allen Thieren«, sagt er, »ist dieses das einzige, welches, wegen seiner beständigen Gefräßigkeit, im nördlichen Schweden den Namen Jerf, im Deutschen den Namen Vielfraß erhalten hat. Sein Fleisch ist unbrauchbar, nur sein Pelz ist sehr nützlich und kostbar und glänzt sehr schön und noch mehr, wenn man ihn künstlich mit anderen Farben verbindet. Nur Fürsten und andere große Männer tragen Mäntel davon, nicht bloß in Schweden, sondern auch in Deutschland, wo sie wegen ihrer Seltenheit noch viel theurer zu stehen kommen. Auch lassen die Einwohner diese Pelze nicht gern in fremde Länder gehen, weil sie damit ihren Wintergästen eine Ehre zu erweisen pflegen, indem sie nichts für angenehmer und schöner halten, als ihren Freunden Betten von solchem Pelze anweisen zu können. Dabei darf ich nicht verschweigen, daß alle diejenigen, welche Kleider von solchen Thieren tragen, nie mit Essen und Trinken aufhören können. Die Jäger trinken ihr Blut; mit lauem Wasser und Honig vermischt, wird es sogar bei Hochzeiten aufgetragen. Das Fett ist gut gegen faule Geschwüre etc. Die Jäger haben verschiedene Kunststücke erfunden, um dieses listige Thier zu fangen. Sie tragen ein Aas in den Wald, welches noch frisch ist. Der Vielfraß riecht es sogleich, frißt sich voll, und während er sich, nicht ohne viele Qual, zwischen die Bäume durchdrängt, wird er mit Pfeilen erschossen. Auch stellt man ihm Schlagfallen, wodurch er erwürgt wird. Mit Hunden ist er kaum zu fangen, weil diese seine spitzigen Klauen und Zähne mehr fürchten, als den Wolf.«
Schon Steller widerlegt die abgeschmackten Fabeln, und Pallas gibt eine richtige Lebensbeschreibung des absonderlichen Gesellen. Ich selbst habe ihn auf meiner Reise in Skandinavien bloß ein einziges Mal zu Gesicht bekommen, und zwar auf einer Renthierjagd, welche wir gemeinschaftlich, d. h. ich und der Vielfraß, unternahmen; mein alter Erik Swenson, einer der naturkundigsten Jäger, welche ich überhaupt angetroffen habe, konnte mir jedoch manches über die Lebensweise mittheilen, so daß ich also auch nach eigenen Forschungen über ihn zu berichten vermag.
Der Vielfraß bewohnt die gebirgigen Gegenden des Nordens, zieht z. B. die nackten Höhen der skandinavischen Alpen den ungeheueren Wäldern des niederen Gebirges vor, obwohl er auch in diesen zu finden ist. Die ödeste Wildnis ist sein Aufenthalt. Er hat keine feststehenden Wohnungen, sondern wechselt sie nach dem Bedürfnisse und verbirgt sich, wenn die Nacht hereinbricht, an jedem beliebigen Orte, welcher ihm einen Schlupfwinkel gewährt, sei es im Dickichte der Wälder oder im Geklüfte der Felsen, in einem verlassenen Fuchsbaue oder in einer anderen, natürlichen Höhle. Wie alle Marder mehr Nacht- als Tagthier, schleicht er doch in seiner so wenig von den Menschen beunruhigten Heimat ganz nach Belieben umher und zeigt sich auch im Lichte der Sonne, würde dies auch unter allen Umständen thun müssen, da ja bekanntlich in seinem Vaterlande während des Sommers die Sonne ein Vierteljahr lang Tag und Nacht am Himmel steht. In dem von Radde bereisten südlichen Grenzgebiete des östlichen Sibirien ist das Vorkommen des Vielfraßes viel mehr an das Vorhandensein der Moschusthiere als der Renthiere geknüpft. Das Auftreten des erstgenannten Wiederkäuers hängt nun aber wesentlich mit dem pflanzlichen Gepräge der betreffenden Gegenden zusammen, und daher findet man da, wo in weitgedehnten bleichgelben und grauen Flechtengebieten eine Alpenflora noch die äußerste Grenze des Baumwuchses schmückt, Moschusthier und Vielfraß am häufigsten, während man in einer durchschnittlichen Höhe von 1000 Meter über dem Meere in dem Gebiete der üppigen Pflanzenwelt beide Thiere nur zufällig und vereinzelt antrifft. Dem entsprechend ist der Vielfraß im östlichen Sajan entschiedener Gebirgsbewohner, welcher, ohne festen Wohnsitz zu haben, beständig umherschweift und namentlich diejenigen Oertlichkeiten der Hochgebirge aufsucht, an denen den Moschustieren Schlingen gelegt werden. Unter ähnlichen Verhältnissen tritt er überall im Süden von Sibirien auf, und ebenso verhält es sich, unter Berücksichtigung örtlicher Eigentümlichkeiten, im Norden Amerikas. In seinen Bewegungen plump und ungeschickt, weiß er doch durch Ausdauer seiner Beute sich zu bemächtigen, und sollte er sie, laut Radde, sechs bis sieben Tage lang verfolgen, bevor er sie stellt. Im Winter, welchen er nach Art der nächstverwandten Marder, ohne längere Zeit zu schlafen, durchlebt, setzen ihn seine großen Tatzen in den Stand, mit Leichtigkeit über den Schnee zu gehen, und da er kein Kostverächter ist, führt er ein sehr behagliches und gemütliches Leben, ohne jemals in große Noth zu kommen. Seine Bewegungen sind sehr eigentümlicher Art, und namentlich der Gang zeichnet sich vor dem aller übrigen mir bekannten Thiere aus. Der Vielfraß wälzt sich nämlich in großen Bogensätzen dahin, ganz merkwürdig humpelnd und Purzelbäume schlagend. Doch fördert diese Gangart immer noch so rasch, daß er kleine Säugethiere bequem dabei einholt und auch größeren bei längerer Verfolgung nahe genug auf den Leib rücken kann. Im Schnee zeigt sich seine Fährte, diesem Gange entsprechend, in tiefen Löchern, in welche er mit allen vier Beinen gesprungen ist. Aber gerade sein eigenthümlicher Gang ist dann ganz geeignet, ihn leicht zu fördern, während das von ihm verfolgte Wild mit dem tiefen Schnee sehr zu kämpfen hat. Trotz seiner Ungeschicklichkeit versteht er es, niedere Bäume zu besteigen. Auf deren Aesten liegt er, dicht an den Stamm gedrückt, auf der Lauer und wartet, bis ein Wild unter ihm weggeht. Dem springt er dann mit einem kräftigen Satze auf den Rücken, hängt sich am Halse fest, beißt ihm rasch die Schlagadern durch und wartet, bis es sich verblutet hat. Unter seinen Sinnen steht der Geruch oben an; doch sind auch sein Gesicht und Gehör hinlänglich scharf.
Die Lebens- und Jagdweise des Vielfraßes hat widersprechende Berichte hervorgerufen. Einige Schriftsteller behaupten, daß er bloß von solchen Thieren lebe, welche zufällig getödtet worden sind, daß er also Aas jeder übrigen Nahrung vorziehe. Nur im Sommer soll er Murmelthiere und Mäuse ausgraben oder die Fallen, welche Jäger gestellt haben, und selbst die Häuser der Nordländer plündern. Dem ist jedoch nicht so, vielmehr die uns von Pallas gegebene Beschreibung seiner Lebensweise durchaus richtig. Er sieht schläfrig und plump aus, weiß aber seine Jagd mit hinlänglichem Erfolge zu betreiben. Seine Hauptnahrung bilden die Mäusearten des Nordens und namentlich die Lemminge, von denen er eine erstaunliche Menge vertilgt. Bei der großen Häufigkeit dieser Thiere in gewissen Jahren, braucht er sich kaum um ein anderes Wild zu bekümmern. Den Wölfen und Füchsen folgt er auf ihren Streifzügen nach, in der Hoffnung, etwas von ihrem Raube zu erbeuten. Im Nothfalle aber betreibt er selbst die höhere Jagd. Steller erzählt, daß er das Renthier mit List zu sich heranlocke, indem er auf einen Baum klettere und von dort aus in Absätzen Renthiermoos herabwürfe, welches dann von dem Ren aufgefressen würde, wodurch ihm Gelegenheit gegeben werde, einen guten Sprung zu machen. Dann soll er dem Wilde die Augen auskratzen und auf ihm sitzen bleiben, bis sich der geängstete Hirsch an Bäumen zu Tode stößt. Allein diese Angaben scheinen bloß auf Erzählungen zu beruhen und dürften unrichtig sein. Gewiß aber ist es, daß er Renthiere, ja selbst Elenthiere angreift und niedermacht. Thunberg erkundete, daß er sogar Kühe umbringt, indem er ihnen die Gurgel abbeißt. Löwenhjelm erwähnt in seiner Reisebeschreibung von Nordland, daß er dort Schaden unter den Schafherden anrichte, und Erman erfuhr von den Ostjaken, daß er dem Elenthiere auf den Nacken springe und es durch Bisse tödte. Hiermit stimmen die Mittheilungen Radde's vollständig überein. In geeigneten Gebirgen am Baikalsee wird der dort häufige Vielfraß in der Nähe der Ansiedelungen eine Plage für das junge Hornvieh; im Gebirge selbst stellt er die ermüdeten Moschusthiere auf vorspringenden Zinken und wirft sich von höheren Stufen derselben auf sie herab. Eine im Jahre 1855 stattgehabte Auswanderung der Renthiere aus dem östlichen Sajan südwärts in die Quellgebirge des Jenisei blieb jedoch ohne Einfluß auf die Lebensweise des Vielfraßes; die Karagassen und Sojotten behaupteten sogar, er habe hier niemals ein Renthier angegriffen, sondern sei ausschließlich auf das Moschusthier angewiesen. Unter letzterem scheint er arge Verheerungen anzurichten. Erik erzählte mir, daß er sich, zumal im tiefen Schnee, leise unter dem Winde an die vergrabenen Schneehühner heranmacht, sie in den Höhlen, welche sich die Vögel ausscharren, verfolgt und dann mit Leichtigkeit tödtet. Den Jägern ist er ein höchst verhaßtes Thier. Mein Begleiter versicherte mich, daß ein jedes erlegte Renthier, welches er nicht sorgfältig unter Steinen verborgen habe, während seiner Abwesenheit von dem Vielfraße angefressen worden sei. Sehr häufig stiehlt er auch die Köder von den Fallen weg oder frißt die darin gefangenen Thiere an. Genau ebenso treibt er es in Sibirien und Amerika. Nach Radde geht er schlau den Schlingen, welche für die Moschusthiere gestellt werden, nach, folgt den Fallen der Zobel und wird den Jägern, welche leider nicht immer zeitig genug nachsehen können, eine lästige Plage, indem er die Beute auffrißt. In den Hütten der Lappen richtet er oft bedeutende Verwüstungen an. Er bahnt sich mit seinen Klauen einen Weg durch Thüren und Dächer und raubt Fleisch, Käse, getrockneten Fisch und dergl., zerreißt aber auch die dort aufbewahrten Thierfelle und frißt, bei großem Hunger, selbst einen Theil derselben. Während des Winters ist er Tag und Nacht auf den Beinen, und wenn er ermüdet, gräbt er sich einfach ein Loch in den Schnee, läßt sich dort verschneien und ruht in dem nun ganz warmen Lager behaglich aus.
Daß er auch in gänzlich baumlosen Gebirgsgegenden, dem ausschließlichen Aufenthalte der wilden Renthiere, diesen großen Schaden zufügt, habe ich nicht bloß aus dem Munde meiner Jäger vernommen, sondern ebenso aus dem Benehmen einer von ihm bedrohten Renthierherde schließen können. Ich bemerkte einen Vielfraß, welcher auf einer mit wenig Steinen bedeckten Ebene hinter einem größeren Blocke saß und die Renthiere mit größter Theilnahme betrachtete. Jedenfalls gedachte er ein unvorsichtiges Kalb bei Gelegenheit zu überraschen. Sein Standpunkt war vortrefflich gewählt: er hatte den Wind mit derselben Gewissenhaftigkeit beobachtet wie wir. Die scheuen Renthiere bekamen jedoch bei einer Wendung, welche das sich äsende Rudel machte, Witterung und stiebten augenblicklich in die Weite. Jetzt mochte er einsehen, daß für heute seine Jagd erfolglos bleiben würde, und wandte sich, trottelnd und Purzelbäume schlagend, den Kopf und Schwanz zur Erde gesenkt, dem höheren Gebirge zu, lauschte plötzlich, sprang seitwärts, fing einen Lemming, verspeiste denselben mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit und setzte dann seinen Weg weiter fort. Ich war leider zu entfernt von ihm, um meinen Grimm an der gestörten Jagd ihm fühlen lassen zu können; er aber nahm sich in der Folge wohl in Acht, uns wieder zu nahe zu kommen.
Eine kleine Beute, welche der Vielfraß gemacht hat, verzehrt er auf der Stelle mit Haut und Haaren, eine größere aber vergräbt er sehr sorgfältig und hält dann noch eine zweite Mahlzeit davon. Die Samojeden behaupten, daß er auch Menschenleichen aus der Erde scharre und zeitweilig von diesen sich nähre.
Infolge seiner umfassenden Thätigkeit als Raubthier steht der Vielfraß bei sämmtlichen nordischen Völkerschaften keineswegs in besonderer Achtung, und man jagt, verfolgt und tödtet ihn, wo man nur immer kann, obgleich sein Fell keineswegs überall benutzt wird. Die Kamtschadalen freilich schätzen es sehr hoch und glauben, daß es kein schöneres Rauchwerk geben kann als eben dieses Fell. Gerade die weißgelben Felle, welche von den Europäern für die schlechtesten gehalten werden, gelten in ihren Augen als die allerschönsten, und sie sind fest überzeugt, daß der Gott des Himmels, Bulutschei, Rosomaka- oder Vielfraßkleider trage. Die gefallsüchtige Itelmänin trägt zwei Stück Vielfraßfelle von Handgröße über dem Kopfe, oberhalb der Ohren; man kann deshalb seiner Frau oder Geliebten nicht besser sich verbindlich machen, als wenn man ihr derartige Rosomakenfleckchen kauft, deren Preis dort dem eines Biberfelles gleichgeachtet wird. Vor Stellers Zeiten konnte man von den Kamtschadalen für einen Vielfraß eine Menge andere Felle eintauschen, welche zusammen nicht selten dreißig bis sechszig Rubel werth waren. Die Liebhaberei für diese Fleckchen geht soweit, daß die Frauen, welche keine besitzen, gefärbte Fellstücke aus dem Balge einer Seeente tragen. Steller fügt hinzu, daß trotz des hohen Werthes gedachter Felle Vielfraße in Kamtschatka häufig sind, weil die Einwohner es nicht verstehen, sie zu fangen, und bloß zufällig einen erbeuten, welcher sich in die Fuchsfallen verirrt.
Der Eskimo legt sich vor der Höhle des Vielfraßes auf den Bauch und wartet, bis derselbe herauskommt, springt dann sofort auf, verstopft das Loch und läßt nun seine Hunde los, welche zwar ungern auf solches Wild gehen, es aber doch festmachen. Nunmehr eilt der Jäger hinzu, zieht dem Räuber eine Schlinge über den Kopf und tödtet ihn. In Norwegen und Lappland wird er mit dem Feuergewehre erlegt.
Trotz seiner geringen Größe ist der Vielfraß kein zu verachtender Gegner, weil unverhältnismäßig stark, wild und widerstandsfähig. Man versichert, daß selbst Bären und Wölfe ihm aus dem Wege gehen; letztere sollen ihn, wahrscheinlich seines Gestankes wegen, überhaupt nicht anrühren. Gegen den Menschen wehrt er sich bloß dann, wenn er nicht mehr ausweichen kann. Gewöhnlich rettet er sich angesichts eines Jägers durch die Flucht, und wenn er getrieben wird, auf einen Baum oder auf die höchsten Felsspitzen, wohin ihm seine Feinde nicht nachfolgen können. Von raschen Hunden wird er in ebenen, baumlosen Gegenden bald eingeholt, vertheidigt sich aber mit Ausdauer und Muth gegen dieselben und beißt wüthend um sich. Ein einziger Hund überwältigt ihn nicht; zuweilen wird es auch mehreren schwer, ihn zu besiegen. Wenn er vor seinen Verfolgern nicht auf einen Baum entkommen kann, wirft er sich auf den Rücken, faßt den Hund mit seinen scharfen Krallen, wirft ihn zu Boden und zerfleischt ihn mit dem Gebisse derart, daß jener an den ihm beigebrachten Wunden oft zu Grunde geht.
Die Rollzeit des Vielfraßes fällt in den Herbst oder Winter, in Norwegen, wie Erik mir erzählte, in den Januar. Nach vier Monaten Tragzeit, gewöhnlich also im Mai, wirft das Weibchen, in einer einsamen Schlucht des Gebirges oder in den dichtesten Wäldern, zwei bis drei, selten auch vier Junge auf ein weiches und warmes Lager, welches es entweder in hohlen Bäumen oder in tiefen Höhlen angelegt hat. Es hält schwer, ein solches Wochenbett aufzufinden; bekommt man aber Junge, welche noch klein sind, so kann man sie ohne große Mühe zähmen. Genberg zog einen Vielfraß mit Milch und Fleisch auf und gewöhnte ihn so an sich, daß er ihm wie ein Hund auf das Feld nachlief. Er war beständig in Thätigkeit, spielte artig mit allerlei Dingen, wälzte sich im Sande, scharrte sich im Boden ein und kletterte auf Bäume. Schon als er drei Monate alt war, wußte er sich mit Erfolg gegen die ihn angreifenden Hunde zu vertheidigen. Er fraß nie unmäßig, war gutmüthig, erlaubte Schweinen, die Mahlzeit mit ihm zu theilen, litt aber niemals Hunde um sich. Immer hielt er sich reinlich und stank gar nicht, außer, wenn mehrere Hunde auf ihn losgingen, welche er wahrscheinlich durch die Entleerung seiner Stinkdrüsen zurückschrecken wollte. Gewöhnlich schlief er bei Tage und lief bei Nacht umher. Er lag lieber im Freien als in seinem Stalle und liebte überhaupt den Schatten und die Kälte. Als er ein halbes Jahr alt war, wurde er bissiger, blieb jedoch immer noch gegen Menschen zutraulich, und als er einmal in den Wald entflohen war, sprang er einer alten Magd auf den Schlitten und ließ sich von ihr nach Hause fahren. Mit zunehmendem Alter wurde er wilder, und einmal biß er sich derart mit einem großen Hunde herum, daß man letzterem zu Hülfe eilen mußte, weil man für sein Leben fürchtete. Auch im Alter spielte er immer noch mit den bekannten Leuten; hielten ihm jedoch Unbekannte einen Stock vor, so knirschte er mit den Zähnen und ergriff ihn wüthend mit den Klauen.
So lange ein gefangener Vielfraß jung ist, zeigt er sich höchst lustig, fast wie ein junger Bär. Wenn man ihn an einen Pfahl gebunden hat, läuft er in einem Halbkreise herum, schüttelt dabei den Kopf und stößt grunzende Töne aus. Vor dem Eintritte schlechter Witterung wird er launisch und mürrisch. Obgleich nicht eben schnell in seinen Bewegungen, ist er doch fortwährend in Thätigkeit, und bloß, wenn er schläft, liegt er still auf einer und derselben Stelle. Einen Baum, welchen man in seinem Käfige angebracht hat, besteigt er mit Leichtigkeit und scheint sich durch die merkwürdigsten Turnkünste, welche er auf den Aesten ausführt, besonders zu vergnügen. Zuweilen spielt er förmlich mit den Zweigen, indem er mit Leichtigkeit und ohne jede Furcht aus ziemlichen Höhen herunter auf die Erde springt und an den eisernen Stäben seines Käfigs oder an seinem Lieblingsbaume rasch wieder empor klettert; zuweilen rennt er in einem kurzen Galopp im Kreise innerhalb seines Käfigs umher, hält jedoch ab und zu inne, um zu sehen, ob ihm nicht einer von den Zuschauern ein Stückchen Kuchen oder sonst einen Leckerbissen durch das Gitter geworfen habe.
Das eigentliche Wesen des Vielfraßes zeigt sich aber doch erst, wenn er Gesellschaft seines Gleichen hat. Im Berliner Thiergarten leben gegenwärtig drei Stück des in unseren Käfigen so seltenen Thieres, und zwar ein altes und zwei noch nicht erwachsene, welche in früher Jugend ankamen. Etwas lustigeres und vergnügteres, als diese beiden Geschöpfe sind, kann man sich nicht denken. Nur äußerst selten sieht man sie kurze Zeit der Ruhe pflegen; den größten Theil des Tages verbringen sie mit Spielen, welche ursprünglich durchaus nicht böse gemeint zu sein scheinen, bald aber ernster werden und gelegentlich in einen Zweikampf übergehen, bei welchem beide Recken Gebiß und Tatzen wechselsweise gebrauchen. Unter kaum wiederzugebendem Gekläff, Geknurr und Geheul rollen sie übereinander weg, so daß der eine bald auf dem Rücken, bald auf dem Bauche des anderen liegt, von diesem abgeschüttelt und nun seinerseits niedergeworfen wird, springen auf,
suchen sich mit den Zähnen zu packen, zerren sich an den Schwänzen und kollern von neuem ein gutes Stück über den Boden fort. Endet das Spiel und beziehentlich der Zweikampf, so trollen beide hintereinander her, durchmessen ihren Käfig nach allen Seiten, durchschnüffeln alle Winkel und Ecken, untersuchen jeden Gegenstand, welcher sich findet, werfen Futter- und Trinkgefäße über den Haufen, ärgern die rechtschaffenen Waschweiber, welche ihre Käfige zu reinigen haben, durch unstillbaren Forschungseifer nach Dingen und Gegenständen, welche sie unbedingt nichts angehen, erzürnen sich wiederum und beginnen das alte Spiel, achtsame Beobachter stundenlang fesselnd. Ganz anders benehmen sie sich angesichts des futterspendenden Wärters. Alle Ungeduld, welche ein hungriges Thier zu erkennen gibt, gelangt jetzt bei ihnen zum Ausdrucke. Der Name Vielfraß wurde mir, als ich sie zum ersten Male füttern sah, urplötzlich verständlich. Winselnd, heulend, knurrend, kläffend, zähnefletschend und sich gegenseitig mit Ohrfeigen und anderweitigen Freundschaftsbezeigungen bedenkend, rennen sie wie toll und unsinnig im Käfige umher, gierig nach dem Fleische blickend, wälzen sich, wenn der Wärter dasselbe ihnen nicht augenblicklich reicht, gleichsam verzweifelnd auf dem Boden und fahren, sobald ihnen der Brocken zugeworfen wird, mit einer Gier aus diesen los, wie ich es noch bei keinem anderen Thiere, am wenigsten aber bei einem so sorgsam wie sie gepflegten und gefütterten, beobachtet habe. Der unstillbare Blutdurst der Marder scheint bei ihnen in Freßgier umgewandelt zu sein. Sie stürzen sich, alles andere vergessend, wie sinnlos auf das Fleischstück, packen es mit Gebiß und Klauen zugleich und kauen nun unter lebhaftem Schmatzen, Knurren und Fauchen so eifrig, schlingen und würgen so gierig, daß man nicht im Zweifel bleiben kann, die Fabelei der älteren Schriftsteller habe Ursprung und gewissermaßen auch Berechtigung in Beobachtung solcher gefangenen Vielfraße.
Nach Lomer gelangen jährlich höchstens 3500 Vielfraßfelle im Werthe von 32,000 Mark in den Handel, die meisten von Nordamerika her. Jedenfalls aber werden weit mehr Vielfraße alljährlich getödtet und ihrer Felle beraubt; denn nicht allein die Kamtschadalen, sondern auch die Jakuten und andere Völkerschaften Sibiriens schätzen letztere ungemein hoch und zahlen sie mit guten Preisen. Nach Radde bleiben alle Felle der in Ostsibirien erlegten Vielfraße im Lande und kosten schon an Ort und Stelle vier bis fünf Rubel das Stück. Die asiatischen Völkerschaften und ebenso die Polen benutzen sie zu schweren Pelzen, Amerikaner und Franzosen dagegen zu Fußdecken, für welche sie sich der verschiedenen Färbung und Haarlänge wegen vorzüglich eignen.
In Brasilien lebende, schlank gebaute Mitglieder unserer Familie vom Ansehen der Marder, welche zwischen diesen und dem Vielfraße in der Mitte zu stehen scheinen, sind die Huronen oder Grisons ( Galera ). Sie kennzeichnen sich durch ziemlich dicken, hinten verbreiterten, an der Schnauze wenig vorgebogenen Kopf mit niedrigen, abgerundeten Ohren und verhältnismäßig großen Augen, niedrige Beine, mäßig große Füße mit fünf durch Spannhäute verbundenen Zehen, welche scharfe, starkgebogene Krallen tragen, und nackte, schwielige, an den Hinterbeinen bis zur Fußwurzel unter die Fersen reichende Sohlen zeigen, mittel- oder ziemlich langen Schwanz, ein kurzes Haarkleid und durch ihr von dem der übrigen Marder erheblich abweichendes Gebiß. Dasselbe besteht wie bei den Stinkmardern aus 34 Zähnen, zeichnet sich aber besonders durch die Stärke derselben aus; namentlich gilt dies für die Schneide- und Eckzähne des Oberkiefers, weniger für die oberen vier und unteren fünf Backenzähne. Neben dem After finden sich drüsige Stellen, welche eine starke nach Bisam riechende Feuchtigkeit absondern.
Man hat auch diese Gruppe neuerdings in zwei Untersippen getrennt, die Unterschiede sind jedoch so unwesentlicher Art, daß wir sie nicht zu berücksichtigen brauchen.
Die Hyrare der Brasilianer oder Tayra der Bewohner Paraguays ( Galera barbara , Gulo Mustela und Galictis barbara, Gulo barbatus, Mustela galera, gulina und tayra, Viverra poliocephala und Vulpecula, Eira ilya, Galea subfusca etc.) erreicht eine Länge von 1,1 Meter, wovon etwa 45 Centim. auf den Schwanz kommen. Der dichte Pelz ist am Rumpfe, an den vier Beinen und am Schwanze bräunlichschwarz, das Gesicht blaßbraungrau, die übrigen Theile des Kopfes, der Nacken und die Seiten des Halses sind bald aschgrau, bald gelblichgrau; die Färbung des Ohres zieht sich etwas ins Röthlichgelbe. An der Unterseite des Halses steht ein großer, gelber Flecken. Beide Geschlechter unterscheiden sich nicht; wohl aber kommen Abänderungen in der Färbung vor, und namentlich ist die Färbung des Kopfes und des Nackens bald heller, bald dunkler, und der Fleck am Halse zuweilen gelblichweiß. Auch Weißlinge oder Albinos sind nicht gerade selten.
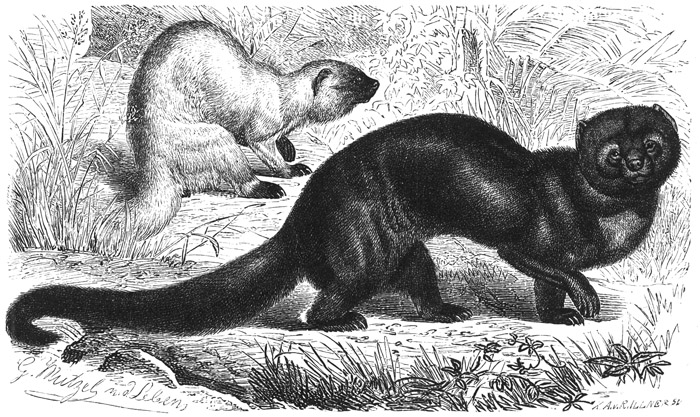
Hyrare ( Galera barbara). ⅙natürl. Größe.
Der Hyrare verbreitet sich über einen großen Theil von Südamerika, von Britisch-Guiana und Brasilien bis Paraguay und noch weiter südlich. Sie ist keineswegs selten, an manchen Orten sogar häufig. In den vom Prinzen von Wied bereisten Waldungen Brasiliens fehlt sie nirgends, ist auch allen Ansiedlern wohl bekannt. Moore behauptet, daß sie in Trupps von fünfzehn bis zwanzig Stücken zusammen auf die Jagd ausgehe; diese Angabe ist aber jedenfalls nicht richtig, weil kein einziger der übrigen Beobachter solches erwähnt. Laut Rengger lebt sie theils in Feldern, welche mit hohem Grase bewachsen sind, theils in den dichten Waldungen. Dort dient ihr der verlassene Bau eines Gürtelthieres, hier ein hohler Baumstamm zum Lager. Sie ist nichts weniger als ein bloß nächtliches Thier, geht vielmehr erst, wenn der Morgen bald anbricht, auf Raub aus und verweilt besonders bei bedecktem Himmel bis gegen Mittag auf ihren Streifereien. Während der Mittagshitze zieht sie sich in ihr Lager zurück und verläßt dasselbe erst wieder gegen Abend, dann bis in die Nacht hinein jagend. Sie wird als ein sehr schädliches Thier angesehen, welches sich kühn selbst bis in die Nähe der Wohnungen drängt.
Die Nahrung der Hyrare besteht aus allen kleinen, wehrlosen Säugethieren, deren sie habhaft werden kann. Junge Feldhirsche, Agutis, Kaninchen, Apereas und Mäuse bilden wohl den Hauptbestandtheil ihrer Mahlzeiten; auf dem Felde geht sie den Hühnern und jungen Straußen nach, in den Wäldern besteigt sie die Bäume und bemächtigt sich der Brut der Vögel. In die Hühnerställe bricht sie nach Marderart ein, beißt dem Federvieh den Kopf ab und trinkt das Blut mit derselben Gier, wie Baummarder oder Iltis; denn auch sie ist blutdürstig und erwürgt, wenn
es in ihrer Gewalt liegt, mehr Thiere, als sie zur Sättigung bedarf. Als ausgezeichneter Kletterer besteigt sie selbst die höchsten Bäume, um die Nester der Vögel zu plündern oder den Honig der Bienen aufzusuchen. Abwärts klettert sie stets mit dem Kopfe voran und zeigt dabei eine Fertigkeit, welche nur wenig andere kletternde Säugethiere besitzen. »Sie läuft«, sagt der Prinz von Wied, »zwar nicht besonders schnell, hält aber sehr lange die Spur des angejagten Thieres ein und soll dadurch dasselbe oft ermüden und fangen. Man will gesehen haben, daß sie ein Reh jagte, bis dieses aus Ermüdung sich niederlegte und dann noch lebend von ihr angefressen wurde.«
Ihre Lager oder Nester legt sie, laut Hensel, wohl immer in unterirdischen Bauen an; wenigstens fanden Hensels Hunde einst ein solches unter Felsen. »Es gelang nach vieler Mühe, durch abgehauene schwere Stämme, welche als Hebebäume benutzt wurden, die Felstrümmer auf die Seite zu schaffen und die Alten nebst zwei Jungen zu erhalten. Diese waren noch blind und vielleicht erst wenige Tage alt; sie glichen in Ansehen und Stimme ganz täuschend jungen Füchsen, und man mußte ziemlich genau zusehen, um an den etwas kürzeren Beinen und den längeren Krallen an allen fünf Zehen die Unterschiede herauszufinden.«
Die Hyrare wird in ganz Südamerika ziemlich oft gezähmt. Schomburgk fand sie oft in den Hütten der Indianer, welche sie » Maikong« oder » Hava« nennen, und besaß, wie auch Rengger, selbst längere Zeit ein Stück lebendig. Beide Forscher berichten uns darüber etwa folgendes: Man ernährt die Hyrare mit Milch, Fleisch, Fischen, gekochtem Yams, reifen Bananen, Kassavabrode, kurz mit allem möglichen, und kann sie somit sehr leicht erhalten. Wenn man ihr Speise zeigt, springt sie heftig danach, ergreift sie sogleich mit den Vorderpfoten und den Zähnen und entfernt sich damit soweit als thunlich von ihrem Wärter. Dann legt sie sich auf den Bauch nieder und frißt das Fleisch, es mit beiden Vorderpfoten festhaltend, ohne Stücke davon abzureißen, nach Katzenart, indem sie mit den Backenzähnen der einen Seite daran kaut. Wirft man ihr lebendes Geflügel vor, so drückt sie dasselbe in einem Sprunge zu Boden und reißt ihm den Hals nahe am Kopfe auf. Ein gleiches thut sie mit kleinen Säugethieren, ja, wenn sie nicht sorgsam genug gezogen worden ist, selbst mit jungen Hunden und Katzen. Sie liebt das Blut sehr, und man sieht sie gewöhnlich dasselbe, wenn sie ein Thier erlegt hat, auflecken, bevor sie von dem Fleische genießt. Stört man sie beim Fressen, so beißt sie wüthend um sich. Flüssigkeiten nimmt sie lappend zu sich. Sie ist sehr reinlich und leckt und putzt ihr glänzend schwarzes Fell fortwährend. Im Zorn gibt sie einen eigenen Bisamgeruch von sich, welcher von einer Absonderung der in der Hautfalte unter dem After liegender Drüsen herrührt. Behandelt man sie mit Sorgfalt, so wird sie gegen den Menschen sehr zahm, spielt mit ihm, gehorcht seinem Rufe und folgt ihm, wenn sie losgebunden wird, gleich einer Katze durch das ganze Haus nach. Dabei zeigt sie sich sehr spiellustig und leckt und kaut besonders gern an den Händen herum, beißt aber oft auch recht herzhaft zu. Im Spielen stößt sie, wie es die jungen Hunde zu thun pflegen, knurrende Töne aus; wird sie aber ungeduldig, so läßt sie ein kurzes Geheul hören. Ungeachtet ihrer Liebenswürdigkeit bleibt sie doch gegen alle kleineren Hausthiere, namentlich gegen das Geflügel, ein gefährlicher Feind und springt, so lange sie etwas lebendes um sich sieht, mit einer Art von Wuth auf dasselbe zu, um es abzuwürgen, alle früher erhaltenen Züchtigungen vergessend. Ihre Lebensart ändert sie in der Gefangenschaft, wenn sie immer angebunden bleibt oder in einem Käfige gehalten wird, insoweit, daß sie die ganze Nacht schlafend zubringt; läßt man sie aber in der Wohnung frei umherlaufen, so bringt sie dieselbe Ordnung wie im Freien zu Stande. Sie schläft dann bloß während der Mitternacht und in den Mittagsstunden und jagt vom frühen Morgen bis Abend den jungen Mäusen und Ratten nach, von denen sie besser als eine Katze das Haus zu reinigen versteht.
Bloß die wilden Indianer, für deren Gaumen keine Art von Fleisch zu schlecht zu sein scheint, essen den Maikong; die Europäer finden sein Fleisch abscheulich. Jene benutzen auch sein Fell, um kleine Säcke daraus zu verfertigen oder dasselbe in Riemen zu zerschneiden welche sie dann als Zierrath gebrauchen; gleichwohl jagen sie das Thier nicht besonders häufig. Wenn sich die Hyrare verfolgt sieht, versteckt sie sich, falls sie Gelegenheit dazu findet, in einem Erdloche oder in einem hohlen Stamme oder klettert auf einen hohen Baum. Fehlt ihr aber ein solcher Zufluchtsort, so erreichen die Hunde sie sehr bald, da sie kein Schnellläufer ist, und überwältigen sie nach einer kurzen, aber muthigen Gegenwehr. »Die Hyrare«, sagt Hensel, »ist schwierig zu jagen und wird darum nicht häufig erlegt. Vor Hunden läuft sie nicht sogleich, sondern läßt sich erst lange treiben; doch erkennt man bald an dem eifrigen Bellen und an der Schnelligkeit der Jagd, wenn jene auf ihrer Fährte sind. Rücken sie ihr zu nahe auf den Leib, so bäumt sie pfeilschnell und setzt ihre Flucht durch die Kronen der hohen Bäume fort, um nach einiger Entfernung wieder den Boden zu gewinnen. Dadurch entgeht sie in den meisten Fällen dem Jäger; denn die Hunde bleiben an dem Baume, welchen sie zuerst erkletterte, stehen und bellen fortwährend hinauf, und wenn sie auch den Baum umkreisen, finden sie doch nicht die frische Fährte, da die Hyrare erst in größerer Entfernung wieder auf den Boden herabkommt. Alte sehr erfahrene Hunde kennen zwar ihre Gewohnheiten und suchen sie auf ihrer Flucht durch die Baumkronen im Auge zu behalten, allein deren Dichtigkeit verhindert in der Regel den Erfolg.«
Der Grison ( Galictis vittata , Viverra, Mustela, Lutra und Grisonia vittata, Gulo vittatus, Ursus brasiliensis, Viverra, und Mustela quiqui etc.), Vertreter der Untersippe Grisonia, ist kleiner als die Hyrare, etwa 65 Centim. lang, wovon auf den Schwanz ungefähr 22 Centim. kommen, und durch gedrungenere Gestalt und verhältnismäßig kurzen Schwanz, auch durch das dünnere, eng anliegende Haarkleid ausgezeichnet. Die Färbung erscheint besonders deshalb merkwürdig, weil die Oberseite des Körpers lichter gefärbt ist als die Unterseite. Die Schnauze, der untere Theil des Nackens, der Bauch und die Kiefer sind dunkelbraun, während die ganze Oberseite von der Stirne an bis zum Schwanze blaßgrau aussieht, da die Grannenhaare schwarze und weiße Ringe zeigen. Von der Stirne läuft über die Wangen eine hellockergelbe Binde, welche gegen die Schultern hin etwas stärker wird. Die Schwanzspitze und die kleinen Ohren sind ganz gelb, die Sohlen und die Fersen dunkelschwarz gefärbt, die kurzen Streifen der Stirn und Wange glänzend stahlgrau. Zwischen Männchen und Weibchen sowie zwischen Alt und Jung findet kein Unterschied in der Färbung statt.
Der Grison bewohnt so ziemlich dieselben Gegenden wie die vorhergehende Art. Schomburgk nennt ihn eines der gewöhnlichen Raubthiere der Küste. Er hält sich in den Pflanzungen und besonders gern in der Nähe der Gebäude auf, wo er unter dem Federvieh zuweilen großen Schaden anrichtet. In Brasilien findet er sich, laut Hensel, nicht so häufig wie der Hyrare und bewohnt lieber die Camposgegenden, obwohl er auch tief im Urwalde angetroffen wird. Von den Hunden getrieben, bäumt er nicht, sondern verbirgt sich baldmöglichst unter Steinen und Baumwurzeln. Wenn die Hyrare unserem Edelmarder gleicht, vertritt der Grison den Iltis, mit welchem er auch in der Größe übereinstimmt. Hohle Bäume, Felsspalten und Erdlöcher sind seine Aufenthaltsorte. Das Thier macht den Eindruck eines unverschämten Wesens und hat eine eigenthümliche Gewohnheit, den langen Hals emporzuheben, ganz wie giftige Schlangen zu thun pflegen; dabei blitzen die kleinen, dunklen Augen unter der weißen Binde sehr lebendig hervor und geben der geistigen Regsamkeit sowie auch dem mordlustigen Wesen belebten Ausdruck. Man sagt, daß der Grison ebenso blutgierig wie unser Marder wäre und ohne Hunger so viele Thiere würge, als er nur erhaschen könne. Sein Muth soll außerordentlich groß sein. Ein Grison, welchen ein Engländer zahm hielt, verließ einigemal seinen Käfig und griff einen jungen Alligator an, welcher sich in demselben Zimmer befand. Letzterer war, wie der Erzähler bemerkt, dummzahm und hatte sich an einem Abende in die Nähe des Feuers gelegt, um der willkommenen Wärme sich zu erfreuen. Als am nächsten Morgen der Eigner eintrat, fand er, daß der Grison die Flucht aus dem Käfig bewerkstelligt hatte, entdeckte auch zugleich die Spuren des Angriffs des kleinen Geschöpfs an der riesigen Panzerechse. Gerade unter den Vorderbeinen, dort, wo die starken Blutgefäße verlaufen, hatte der
Grison den Alligator so furchtbar zerfleischt, daß das arme Vieh an den Folgen seiner Wunden zu Grunde ging. Der zweite Alligator, welchen jener Forscher besaß, war durch den Mord seines Gefährten so wüthend geworden, daß er ärgerlich nach Jedem schnappte, welcher sich ihm näherte. Auch Cuvier berichtet von den Angriffen unseres Marders auf andere, verhältnismäßig stärkere Thiere. Ein Grison, welchem fortwährend Nahrung im Ueberflusse gereicht wurde, stillte seinen Blutdurst an einem armen Lemur, dessen Anblick ihn vorher so aufgeregt hatte, daß er endlich die Stäbe seines Käfigs zernagte und das harmlose Geschöpf überfiel und tödtete. Gerade dieser Grison war sehr zahm und im hohen Grade spiellustig, seine Spielerei aber freilich eigentlich nichts anderes als ein versteckter Kampf. Sobald man ihm sich hingab, legte er sich auf den Rücken und faßte die Finger seines menschlichen Spielkameraden zwischen seine Klauen, nahm dieselben in das Maul und kniff sie leise mit den Zähnen. Niemals hatte er so heftig gebissen, daß solches Spiel gefährlich geworden wäre, und um so verwunderter war man, daß er sich anderen Thieren gegenüber ganz abweichend benahm. Das Gedächtnis dieses Thieres war merkwürdig: der Grison erkannte seine alten Freunde an den Fingern, mit welchen er früher gespielt hatte. In seinen Bewegungen war er flink und anmuthig, und während er sich in seinem Käfige bewegte, hörte man von ihm, so lange er bei guter Laune war, beständig ein heuschreckenartiges Gezirpe. Gereizt gab er einen ziemlich starken, doch keineswegs unerträglichen Bisamgeruch von sich, welcher nach einigen Stunden wieder verging. In der Provinz Rio Grande do Sul, namentlich in der Stadt gleichen Namens, soll er, laut Hensel, nicht selten in großen Speichern wie bei uns die Katzen zum Vertilgen der Ratten gehalten werden. Ein zahmes Pärchen, welches ein Kaufmann in Porto Alegro von dorther sich kommen ließ, hielt sich einige Wochen in seinen Speichern, verschwand dann aber, angeblich infolge der Nachlässigkeit der schwarzen Bediensteten, auf Nimmerwiedersehen. In unseren Käfigen sieht man den Grison selten; doch kommt dann und wann einer auf den europäischen Thiermarkt. Ich selbst habe eine Zeitlang ein solches Thier gepflegt und mich an seiner munteren Beweglichkeit und anscheinenden Gemüthlichkeit ergötzt. Auffallend war mir die Haltung im Vergleiche zu der seiner Verwandten, der Hyrare. Während diese beim Sitzen den ausgeprägtesten Katzenbuckel zu machen und sich in eigenthümlichen Sprüngen immer mit mehr oder weniger krummgebogenem Rücken zu bewegen pflegt, hält sich der Grison gerade und läuft mit gestrecktem Leibe trollend seines Weges fort. Mein Gefangener war stets gut gelaunt und aufgeräumt, schien sich mit seinem Loose als Gefangener vollständig ausgesöhnt zu haben und machte wenig Ansprüche an Pflege und Nahrung, verlangte beziehentlich der ersteren nur größte Reinhaltung des Käfigs nebst einem weichen Heulager und liebte hinsichtlich des Futters Abwechselung. Früchte verschiedener Art, insbesondere Kirschen, Pflaumen und Birnenschnitzel, fraß er mit demselben Appetit wie Fleisch, und gierig zeigte er sich überhaupt nur dann, wenn ihm ein lebendes Thier zum Futter geboten wurde.
Das Weibchen des Grison bringt im Oktober zwei Junge zur Welt und pflegt und liebt sie in eben dem Grade wie seine Verwandten.
Die Guaraner, welche ihn » Yaquape« oder »niederer Hund« nennen, fangen ihn, halten ihn häufig in der Gefangenschaft, essen auch sein Fleisch und verwenden seinen Pelz. Die Ansiedler tödten ihn, wo sie ihn nur erlangen können.
In der zweiten Unterfamilie vereinigt man die Ottern ( Lutrina). Die hierher gehörigen Marderarten, einige zwanzig an der Zahl, kennzeichnen sich durch den gestreckten, flachen, auf niederen Beinen ruhenden Leib, den platten, stumpfschnäuzigen Kopf mit kleinen vorstehenden Augen und kurzen, runden Ohren, die sehr ausgebildeten Schwimmhäute zwischen den Zehen, den langen, zugespitzten, mehr oder weniger flachgedrückten Schwanz und durch das kurze, straffe, glatte, glänzende Haar. Ihre Vorder- und Hinterbeine sind fünfzehig, die beiden mittleren Zehen nur wenig länger als die seitlichen. In der Aftergegend ist keine Drüsentasche vorhanden, es finden sich aber zwei Absonderungsdrüsen, welche neben dem After münden. Im Gebiß und Knochenbau ähneln die Ottern noch sehr den übrigen Mardern; jedoch ist der letzte obere Backenzahn groß und viereckig, und gibt sich auch im Geripp der auffallend flache Schädel mit breitem Hirnkasten, verengter Stirngegend und kurzem Schnauzentheil als sehr eigenthümliches Merkmal kund.
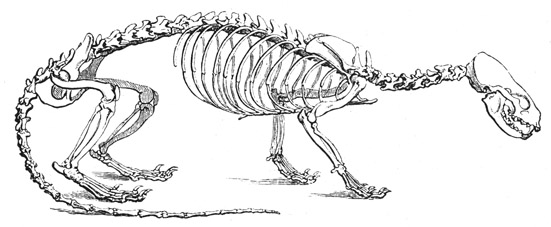
Geripp des Fischotters. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
Die Ottern bewohnen Flüsse und Meere und verbreiten sich mit Ausnahme von Neuholland und des höchsten Nordens über fast alle Theile der Erde. Nur gezwungen entfernen sie sich von dem Wasser und auch dann bloß in der Absicht, um ein anderes Gewässer aufzusuchen. Sie schwimmen und tauchen meisterhaft, können lange Zeit unter dem Wasser aushalten, laufen, ihrer kurzen Beine ungeachtet, ziemlich schnell, sind stark, muthig und kühn, verständig und zur Zähmung geeignet, leben aber fast überall in gespannten Verhältnissen mit dem Menschen, weil sie diesem einen so großen Schaden zufügen, daß derselbe durch den kostbaren Pelz, welchen sie liefern, nicht im entferntesten aufgewogen werden kann.
Europa beherbergt eine einzige Art der Gruppe, gewissermaßen das Urbild der Unterfamilie, die, oder wie die meisten Jäger sagen, den Fischotter, Fluß- oder Landotter und Fischdieb ( Lutra vulgaris , Mustela und Viverra Lutra, Lutra nudipes), einen Wassermarder von reichlich 1,2 Meter Länge, wovon 40 bis 43 Centim. auf den Schwanz zu rechnen sind. Der Kopf ist länglichrund, die Schnauze abgerundet, das Auge klein, aber lebhaft, das sehr kurze, abgerundete, durch eine Hautfalte verschließbare Ohr fast ganz im Pelze versteckt, der Leib ziemlich schlank, aber flach, der Schwanz mehr oder weniger rundlich, an der Spitze stark verschmälert; die sehr kurzen Beine, deren Zehen durch bis zu den Nägeln vorgezogene Schwimmhäute miteinander verbunden werden, treten mit der ganzen Sohle auf. In dem ziemlich kurzen und sehr flachen Schädel ist das Hinterhaupt ungewöhnlich stark und breit entwickelt, die Stirne nur wenig niedriger als der Scheitel, die Nase vorn kaum merklich abschüssig; im Gebisse, welches aus 36 Zähnen und zwar drei Schneide-, einem Eck-, drei Lückzähnen, dem Höcker- und noch einem Backenzahne oben und unten in jedem Kiefer besteht, ist der äußere obere Vorderzahn bedeutend stärker als die vier mittelsten, und tritt der zweite untere Vorderzahn aus der Zahnreihe zurück; der sehr stark entwickelte Höckerzahn des Oberkiefers ist quer gestellt, vierseitig, rhombischen Querschnittes und nur wenig breiter als lang. Als bezeichnend für die Sippe gilt noch die nackte, netzartig gerissene und flachwarzige Haut an der Nasenspitze über dem behaarten Lippenrande, zu deren Seiten die länglichen, bogigen Nasenlöcher sich öffnen, weil die Form dieses Nasenfeldes für die Unterscheidung anderer Ottern von Wichtigkeit ist und zur Aufstellung besonderer Untersippen Veranlassung gegeben hat. Ein dichter und kurz anliegender, aus derbem, starrem, glänzendem Oberhaar von dunkelbrauner Färbung bestehender Pelz deckt den Leib; seine Färbung lichtet sich nur auf der Unterseite etwas und geht unter dem Halse und an den Kopfseiten ins Weißlichgraubraune über, während der im Pelze versteckte Ohrrand lichtbraun aussieht; ein heller, verwaschen weißlicher Flecken steht über der Mitte der Unterlippe, einzelne unregelmäßige rein weiße oder weißliche Fleckchen finden sich am Kinne und zwischen den Unterkieferästen. Das sehr feine Wollhaar ist an der Wurzel lichtbraungrau, an der Spitze dunkler braun. Manche Thiere haben eine mehr graubraune als dunkelbraune Färbung. Spielarten kommen ebenfalls vor: so wurde mir vor geraumer Zeit ein Balg zugeschickt, welcher auf der ganzen Oberseite ziemlich große, runde, graugelblichweiße Flecken zeigte.
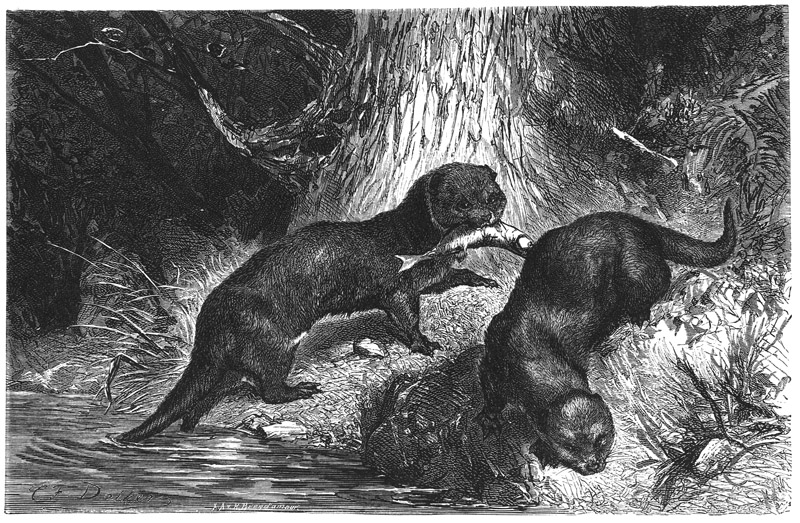
Fischotter.
In der Weidmannssprache heißt der männliche Fischotter Rüde, der weibliche Feh oder Fehe, der Schädel Grind, der Schwanz Ruthe, das Fleisch Kern, das Fell Balg, das weibliche Geschlechtsglied Nuß. Der Fischotter ranzt und die Fehe bringt Junge, er steigt aus oder an das Land, wenn er das Wasser verläßt, geht über Land, wenn er auf dem Trockenen eine Strecke zurücklegt, steigt, fällt oder fährt in das Wasser; er wittert, scherzt oder spielt, pfeift, fischt, hat eine Fährte und einen Bau, keine Wohnung oder Höhle.
Unser Fischotter bewohnt ganz Europa und außerdem den größten Theil von Nord- und Mittelasien, sein Verbreitungsgebiet nach Osten hin bis zur Mündung des Amur ausdehnend. In den Polarländern scheint er nicht weit nach Norden vorzudringen, obwohl er einzeln noch in Lappland lebt; in Sibirien geht er nur bis gegen den Polarkreis hinauf. In Indien, China und Japan wird er durch verwandte Arten vertreten, in Afrika und Amerika durch solche, welche man gegenwärtig besonderen Untersippen zuzählt. In Mittel- und Südeuropa haust er in jedem nahrungversprechenden Gewässer, auch in Flüssen und Bächen der bewohntesten Theile stark bevölkerter Staaten, in Mittelasien fehlt er an geeigneten Orten ebensowenig.
Der Fischotter liebt vor allem Flüsse, deren Ufer auf große Strecken hin mit Wald bedeckt sind. Hier wohnt er in unterirdischen Gängen, welche ganz nach seinem Geschmacke und im Einklange mit seinen Sitten angelegt wurden. Die Mündung befindet sich stets unter der Oberfläche des Wassers, gewöhnlich in einer Tiefe von einem halben Meter. Von hier aus steigt ein etwa zwei Meter langer Gang schief nach aufwärts und führt zu dem geräumigen Kessel, welcher regelmäßig mit Gras ausgepolstert und stets trocken gehalten wird. Ein zweiter, schmaler Gang läuft vom Kessel aus nach der Oberfläche des Ufers und vermittelt den Luftwechsel. Gewöhnlich benutzt der Fischotter die vom Wasser ausgeschwemmten Löcher und Höhlungen im Ufer, welche er einfach durch Wühlen und Zerbeißen der Wurzeln verlängert und erweitert; in seltenen Fällen bezieht er auch verlassene Fuchs- oder Dachsbaue, wenn solche nicht weit vom Wasser liegen. Unter allen Umständen besitzt er mehrere Wohnungen, es sei denn, daß ein Gewässer außerordentlich reich an Fischen ist, er also nicht genöthigt wird, größere Streifereien auszuführen. Bei hohem Wasser, welches seinen Bau überschwemmt, flüchtet er sich auf nahestehende Bäume oder in hohle Stämme und verbringt hier die Zeit der Ruhe und Erholung nach seinen Jagdzügen im Wasser.
Soviel Aerger ein Fischotter seines großen Schadens wegen Besitzern von Fischereien und leidenschaftlichen Anglern verursacht, so anziehend wird er für den Forscher. Sein Leben ist so eigentümlicher Art, daß es eine eigene Beobachtung verlangt und deshalb jeden an der schädlichen Wirksamkeit des Thieres unbetheiligten Naturfreund fesseln muß. An dem Fischotter ist alles merkwürdig, sein Leben und Treiben im Wasser, seine Bewegungen, sein Nahrungserwerb und seine geistigen Fähigkeiten. Er gehört unbedingt zu den anziehendsten Thieren unseres Erdtheiles. Daß er ein echtes Wasserthier ist, sieht man bald, auch wenn man ihn auf dem Lande beobachtet. Sein Gang ist der kurzen Beine wegen schlangenartig kriechend, aber keineswegs langsam. Auf Schnee oder Eis rutscht er oft ziemlich weit dahin, wobei ihm das glatte Fell gut zu statten kommt und selbst der kräftige Schwanz zuweilen Hülfe gewähren muß. Dabei wird der breite Kopf gesenkt getragen, der Rücken nur wenig gekrümmt, und so gleitet und huscht er in wirklich sonderbarer Weise seines Weges fort. Doch darf man nicht glauben, daß er ungeschickt wäre; denn die Geschmeidigkeit seines Leibes zeigt sich auch auf dem Lande. Er kann den Körper mit unglaublicher Leichtigkeit drehen und wenden, wie er will, und ist im Stande, ohne Beschwerde sich aufzurichten, minutenlang in dieser Stellung zu verweilen und, ohne aus dem Gleichgewichte zu kommen, sich vor- und rückwärts zu wenden, zu drehen oder auf- und niederzubeugen. Nur im höchsten Nothfalle macht er auch noch von einer anderen Fertigkeit landlebender Thiere Gebrauch, indem er durch Einhäkeln seiner immer noch ziemlich scharfen Krallen an schiefstehenden Bäumen, aber freilich so tölpisch und ungeschickt als möglich, emporklettert.
Ganz anders bewegt er sich im Wasser, seiner eigentlichen Heimat, welche er bei der geringsten Veranlassung flüchtend zu erreichen sucht, um der ihm auf dem feindlichen Lande drohenden Gefahr zu entgehen. Der Bau seines Körpers befähigt ihn in unübertrefflicher Weise zum Schwimmen und Tauchen: der schlangengleiche, breite Leib, mit den kurzen, durch große Schwimmhäute zu kräftigen Rudern umgewandelten Füßen, der starke und ziemlich lange Schwanz, welcher als treffliches Steuer benutzt werden kann, und der glatte, schlüpfrige Pelz vereinigen alle Eigenschaften in sich, welche ein rasches Durchgleiten und Zertheilen der Wellen ermöglichen. Zur Ergreifung der Beute dient ihm das scharfe, vortreffliche und kräftige Gebiß, welches das einmal Erfaßte, und sei es noch so glatt und schlüpfrig, niemals wieder fahren läßt. In den hellen Fluten der Alpenseen oder des Meeres hat man zuweilen Gelegenheit, sein Treiben im Wasser zu beobachten. Er schwimmt so meisterhaft nach allen Richtungen hin, daß er die Fische, denen er nachfolgt, zu den größten Anstrengungen zwingt, falls sie ihm entgehen wollen; und wenn er nicht von Zeit zu Zeit auf die Oberfläche kommen müßte, um Athem zu schöpfen, würde wohl schwerlich irgend welcher Fisch schnell genug sein, ihm zu entrinnen. Dem Fischotter ist vollkommen gleichgültig, ob er auf- oder niedersteigt, seitwärts sich wenden, rückwärts sich drehen muß; denn jede nur denkbare Bewegung fällt ihm leicht. Gleichsam spielend tummelt er sich im Wasser umher. Wie ich an Gefangenen beobachtete, schwimmt er manchmal auf einer Seite, und oft dreht er sich, scheinbar zu seinem Vergnügen, so herum, daß er auf den Rücken zu liegen kommt, zieht hierauf die Beine an die Brust und treibt sich noch ein gutes Stück mit dem Schwanze fort. Dabei ist der breite Kopf in ununterbrochener Bewegung, und die Schlangenähnlichkeit des Thieres wird besonders ausfallend. Auch bei langem Aufenthalte im Wasser bleibt das Fell glatt und trocken. Zur Nachtzeit will man bemerkt haben, daß es bei raschen Bewegungen einen elektrischen Schein von sich gibt. Die Wasserschicht, in welcher ein Fischotter schwimmt, ist leicht festzustellen, weil von ihm beständig Luftblasen aufsteigen, und auch das ganze Fell gewissermaßen eine Umhüllung von feinen Luftbläschen wahrnehmen läßt. Zur Zeit des Winters sucht er, wenn die Gewässer zugefroren sind, die Löcher im Eise auf, steigt durch dieselben unter das Wasser und kehrt auch zu ihnen zurück, um Luft zu schöpfen. Solche Eislöcher weiß er mit unfehlbarer Sicherheit wieder aufzufinden, und ebenso geschickt ist er, andere, welche er auf seinem Zuge trifft, zu entdecken. Ein Eisloch braucht bloß so groß zu sein, daß er seine Nase durchstecken kann, um zu athmen: dann ist das zugefrorene Gewässer vollkommen geeignet, von ihm bejagt zu werden.
Im Freien vernimmt man die Stimme des Fischotters viel seltener als in der Gefangenschaft, wo man ihn weit leichter aufregen kann. Wenn er sich recht behaglich fühlt, läßt er ein leises Kichern vernehmen; verspürt er Hunger, oder reizt man seine Freßgier, so stößt er ein lautes Geschrei aus, welches wie die oft und rasch nacheinander wiederholten Silben » girrk« klingt und so gellend ist, daß es die Ohren beleidigt; im Zorne kreischt er laut auf; verliebt, pfeift er hell und wohlklingend.
Die Sinne des Fischotters sind sehr scharf; er äugt, vernimmt und wittert ausgezeichnet. Schon aus einer Entfernung von mehreren hundert Schritten gewahrt er die Annäherung eines Menschen oder Hundes, und eine solche Erscheinung ist für ihn dann stets die Aufforderung zur schleunigsten Flucht nach dem Wasser. Die unablässigen Verfolgungen, denen er ausgesetzt ist, haben ihn sehr scheu und vorsichtig, aber auch sehr listig gemacht, und so kommt es, daß man tagelang auf ihn lauern kann, ohne ihn wahrzunehmen. Zwar trifft man ihn zuweilen auch bei Tage außerhalb seines Baues oder des Wassers, behaglich hingestreckt auf einem alten Stocke oder einer Kaupe, hier sich sonnend, manchmal sogar so weit sich vergessend, daß er von heranschleichenden Menschen erschlagen werden kann: dies aber sind seltene Ausnahmen. In der Regel zieht er erst nach Sonnenuntergang zum Fischfange aus und betreibt diesen wahrend der Nacht, am liebsten und eifrigsten bei hellem Mondscheine. Gelegentlich solcher Jagden nähert er sich den menschlichen Wohnungen nicht selten bis auf wenige Schritte, durchzieht auch Ortschaften, welche an größeren Flüssen oder Strömen liegen, regelmäßig, meist ohne daß man von seinem Vorhandensein etwas merkt. Unter Umständen legt er seinen Bau in der Nähe einer Mühle an: Jäckel berichtet, daß ein Müller drei junge, wenige Tage alte Ottern in der Nähe seines Mahlwerkes erschlagen hat, und theilt noch mehrere andere ähnliche Fälle mit.
Alte Fischottern leben gewöhnlich einzeln, alte Weibchen aber streifen lange Zeit mit ihren Jungen umher oder vereinigen sich mit anderen Fehen oder um die Paarungszeit mit solchen und Männchen und fischen dann in Gesellschaft. Sie schwimmen stets stromaufwärts und suchen einen Fluß nicht selten auf Meilen von ihren Wohnungen gründlich ab, befischen dabei auch in dem Umfange einer Meile alle Flüsse, Bäche und Teiche, welche in den Hauptfluß münden oder mit ihm in Verbindung stehen. Nöthigenfalls bleiben sie, wenn sie der Morgen überrascht, in irgend einem schilfreichen Teiche während des Tages verborgen und setzen bei Nacht ihre Wanderung fort. In den größeren Bächen z. B., welche in die Saale münden, erscheinen sie nicht selten drei, ja vier Meilen von deren Mündungen entfernt und vernichten, ohne daß der Besitzer eine Ahnung hat, in aller Stille oft die sämmtlichen Fische eines Teiches. Obgleich der Fischotter zu weiteren Spaziergängen keineswegs geeignet erscheint, unternimmt er erforderlichen Falles weite Streifzüge zu Lande, um aus fischarmen in fischreichere Jagdgebiete zu gelangen: »er scheut dabei«, sagt Jäckel, »um beispielsweise in die Gebirgsbäche des bayrischen Hochlandes zu kommen, selbst hohe Gebirgsrücken nicht und übersteigt sie mit überraschender Schnelligkeit. Im Steigerwaldrevier Koppenwind hatte ein Paar Ottern einen verlassenen Dachsbau inne, von wo aus der eine in einer Nacht von der Rauhen Ebrach durch die Mittelebrach über Mittelsteinach und Aschbach in die reiche Ebrach nach Heuchelheim wechselte, wie sich durch Verfolgung der Fährte bei neugefallenem Schnee zeigte. Aus der Chiemseeachen steigen Ottern bis in den Loferbach bei Reit im Winkel, in die Schwarzachen bei Rupholding, in die Rothe und Weiße Traun. Im Jahre 1850 überstieg nach Beobachtung des Forstwartes Sollacher von Staudach ein starker Otter bei mehr als anderthalb Meter tiefem Schnee den felsigen, von Gemsen bewohnten Siedleckrücken am Hochgerngebirge, etwa 1460 Meter über der Meeresfläche erhaben, um von dem Weißachenthale in das gegenüberliegende Eibelsbachthal auf dem kürzesten Wege zu kommen und in letzterem Bache zu fischen. Er mußte hierbei mindestens drei Stunden an dem sehr steilen und felsigen Gehänge aufwärts und dann zwei Stunden ebenso steil abwärts bis zum Ursprunge des Eibelsbaches, welchen er bis zu seiner Einmündung in den Achenfluß ununterbrochen verfolgte. Ein kräftiger Gebirgsjäger kann unter den obwaltenden Verhältnissen die betreffende Wegstrecke kaum in sieben Stunden zurücklegen, während sie der schwerfällige, zu Gebirgswanderungen nicht geschaffene Otter einschließlich der seinem Fischfange geopferten Zeit in dem kurzen Zeiträume von zwölf Stunden ausführte, wovon sich Forstwart Sollacher durch Hin- und Herverfolgen der frischen Fährte mit Staunen überzeugte. Im Jahre 1840 stieg nach der Beobachtung des Revierförsters Sachenbacher aus dem das Aurachthal bei Schliersee durchziehenden Aurachflüßchen bei sehr tiefem Schnee ein starker Otter an das Land und setzte unter den schwierigsten örtlichen Verhältnissen seinen Weg über das nahezu 1300 Meter über der Meeresfläche liegende Hohenwaldeckgebirge und den Rhonberg fort, um in den weit entgegengesetzt liegenden, sehr fischreichen Leitzachfluß zu gelangen. Diese durch den Otter in einer Nacht zurückgelegte Wegstrecke beträgt mit Rücksicht auf das steile Gebirgsgehänge und das damalige tiefe Schneelager für einen geübten Bergsteiger wenigstens acht Gehstunden.«
Im Wasser ist der Fischotter dasselbe, was Fuchs und Luchs im Vereine auf dem Lande sind. In den seichten Gewässern treibt er die Fische in den Buchten zusammen, um sie dort leichter zu erhaschen, oder scheucht sie, indem er mehrmals mit dem Schwanze plätschernd auf die Wasseroberfläche schlägt, in Uferlöcher und unter Steine, wo sie ihm dann sicher zur Beute werden. In tieferen Gewässern verfolgt er sie vom Grunde aus und packt sie rasch am Bauche. Nicht selten lauert er, auf Stöcken und Steinen sitzend, taucht, sobald er einen Fisch von ferne erblickt, plötzlich in das Wasser, jagt ihm in eiligster Hetzjagd eine Strecke weit nach und faßt ihn, falls er erschreckt sich zu verbergen sucht. Wenn ihrer zwei einen Lachs verfolgen, schwimmt der eine über, der andere unter ihm, und so jagen sie ihn so lange, bis er vor Müdigkeit nicht weiter kann und sich ohne Widerstand ergeben muß. Der Otter, welcher seine Jagd ohne Mithülfe anderer seiner Art ausüben muß, nähert sich den größeren Fischen, welche nicht gut unter sich sehen können, vom Grunde aus und packt sie dann von unten plötzlich am Bauche. Kleinere Fische verzehrt er während seines Schwimmens im Wasser, indem er den Kopf etwas über die Oberfläche emporhebt, größere trägt er im Maule nach dem llfer und verspeist sie auf dem Lande. Dabei hält er die schlüpfrige Beute zwischen seinen Vorderfüßen und beginnt in der Gegend der Schulter zu fressen, schält das Fleisch vom Nacken nach dem Schwanze zu ab und läßt Kopf und Schwanz und die übrigen Theile liegen. In fischreichen Flüssen wird er noch leckerer und labt sich dann bloß an den besten Rückenstücken. So kommt es, daß er an einem Tage oft mehrere große Fische fängt und von jedem bloß ein kleines Rückenstückchen verzehrt. Die in der Umgegend solcher Gewässer wohnenden biederen Bauern stören einen so leckeren Fischotter durchaus nicht, zumal wenn der Strom oder das Fischrecht in ihm einem größeren Gutsbesitzer gehört, betrachten vielmehr den Fischotter als einen höchst willkommenen Beschicker ihres Tisches und gehen des Morgens regelmäßig an die Ufer, um die angefressenen Fische aufzuheben und für sich zu verwerthen. Bei Ueberfluß an Nahrung verleugnet der Otter die Sitten seiner Familie nicht. Auch er mordet, wie ich an Gefangenen beobachtete, so lange etwas Lebendes in seiner Nähe unter Wasser sich zeigt, und wird durch einen an ihm vorüber schwimmenden Fisch selbst von der leckersten Mahlzeit abgezogen und zu neuer Jagd angeregt. Wenn er zufällig unter einen Schwarm kleiner Fische geräth, fängt er so rasch als möglich nacheinander einen um den anderen, schleppt ihn eiligst ans Land, beißt ihn todt, läßt ihn einstweilen liegen und stürzt sich von neuem ins Wasser, um weiter zu jagen.
Auch von Krebsen, Fröschen, Wasserratten, kleinen und sogar größeren Vögeln nährt sich der Fischotter, obschon Fische, zumal Forellen, seine Lieblingsspeise bleiben. Selbst durch außergewöhnliche Jagden wird er schädlich. »In den schönen Gartenanlagen zu Stuttgart«, erzählt Tessin, »sind die Teiche stark mit zahmem und wildem Wassergeflügel sowie mit Fischen bevölkert. Unter ersteren trieb im Sommer 1824 ein Fischotter seine nächtlichen Räubereien sechs bis sieben Wochen lang, ohne daß irgend eine Spur seiner Anwesenheit bemerkt wurde. Während dieser Zeit wurden alle Entennester sowohl aus dem Lande als auf den Inseln zerstört und die Eier ausgesaugt, auch die jungen Enten und Gänse schnell vermindert, ohne daß Ueberreste hiervon angetroffen worden wären, ebensowenig, als man solche von den gefressenen Fischen bemerkte. Dagegen fand man täglich zwei bis sieben alte Enten, von denen nichts als Kopf und Hals verzehrt worden waren, desgleichen stark verletzte Gänse und Schwäne, welche infolge ihrer Wunden bald eingingen. In einer mondhellen Nacht entschloß sich endlich der in den Anlagen wohnende königliche Oberhofgärtner Bosch, aus dem Platze anzustehen. Von neun Uhr an bis gegen zwölf Uhr wurde das Wassergeflügel beständig beunruhigt und nach allen Richtungen hin umhergetrieben. Unaufhörlich tönte der Angstschrei, besonders der jungen Enten, und es fing erst an, ruhig zu werden, nachdem sich alle auf das Land geflüchtet hatten. Noch war es nicht möglich, zu entdecken, wodurch das Geflügel so in Angst gesetzt worden war, und vergebens versuchte Herr Bosch, dasselbe wieder in den Teich zu treiben. Nach ein Uhr fiel eine wilde Ente in kurzer Entfernung von dem Versteck des Jägers ins Wasser. Bald darauf bemerkte dieser im Wasser eine schmale Strömung, welche jedoch durchaus kein Geräusch verursachte und das Ansehen hatte, als ob ein großer Fisch hoch ginge, nur daß sich die Strömung weit schneller bewegte, als es geschehen sein würde, wenn ein Fisch die Ursache gewesen wäre. Als die Ente diese Strömung wahrgenommen hatte, stand sie schnell auf und strich weg. Die Strömung kam Bosch immer näher, und er schoß endlich mit starken Schroten auf sie hin. Nach dem Schusse blieb das Wasser ruhig, Bosch nahm einen Kahn, fuhr damit an die Stelle und untersuchte mit dem Ladestocke, an dem sich ein Krätzer befand, das Wasser. Er verspürte bald eine weiche Masse, bohrte dieselbe an und brachte einen Fischotter männlichen Geschlechts empor. Von nun an hörten alle Verheerungen unter dem Wassergeflügel auf.« Auch dieser Fall steht nicht vereinzelt da. Waltl nahm, wie Jäckel ferner mittheilt, einem Otter, welcher eine am Schwanze ergriffene Henne eben in seinen Bau unter einer Erle unter das Wasser ziehen wollte, die Beute wieder ab. Die Henne flatterte und breitete die Flügel aus; der Otter aber zerrte so lange, bis dem Huhne der Schwanz ausgerissen war. Im Jahre 1851 fand der Revierförster Schreck ein zufällig in ein Ottereisen gegangenes Wasserhuhn, welches nachts vorher von einem Otter zur Hälfte verzehrt worden war. Die andere Hälfte des Vogels wurde an dem Springer des Eisens befestigt, und am nächsten Morgen hatte sich der Otter, welcher ohne Zweifel den Rest seines gestrigen Nachtmahles holen wollte, glücklich gefangen.
Ob der Fischotter während seines Freilebens auch Pflanzenstoffe frißt, weiß ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen; wohl aber habe ich beobachtet, daß er solche in der Gefangenschaft durchaus nicht verschmäht. Eine Möhre war denen, welche ich pflegte, oft eine bevorzugte Speise, eine Birne, Pflaume, Kirsche eine Leckerei. Da nun die meisten übrigen Marder an Fruchtstoffen Gefallen finden, glaube ich annehmen zu dürfen, daß der Marder des Wassers auch im Freien Obst und dergleichen nicht liegen läßt.
Eine bestimmte Rollzeit hat der Otter nicht; denn man findet in jedem Monate des Jahres Junge. Gewöhnlich fällt die Paarungszeit in das Ende des Februar oder den Anfang des März. Männchen und Weibchen locken sich durch einen starken, anhaltenden Pfiff gegenseitig herbei und spielen allerliebst miteinander im Wasser umher. Sie verfolgen einander, necken und foppen sich; das Weibchen entflieht spröde, das Männchen wird ungestümer, bis ihm endlich Sieg und Gewähr zum Lohne wird. Neun Wochen nach der Paarungszeit, bei uns gewöhnlich im Mai, wirft das Weibchen in einem sicheren, d. h. unter alten Bäumen oder starken Wurzeln gelegenen Uferbau, auf ein weiches und warmes Graspolster zwei bis vier blinde Junge. Die Mutter liebt diese zärtlich und pflegt sie mit der größten Sorgfalt. Aengstlich sucht sie das Lager zu verbergen und vermeidet, um ja nicht entdeckt zu werden, in der Nähe desselben irgend eine Spur von ihrem Raube oder ihrer Losung zurückzulassen. Nach etwa neun bis zehn Tagen öffnen die niedlichen Kleinen ihre Augen, und nach Verlauf von acht Wochen werden sie von der Mutter zum Fischfange ausgeführt. Sie bleiben nun noch etwa ein halbes Jahr lang unter Aufsicht der Alten und werden von ihr in allen Künsten des Gewerbes gehörig unterrichtet. Im dritten Jahre sind sie erwachsen oder wenigstens zur Fortpflanzung fähig.
Junge, aus dem Neste genommene und mit Milch und Brod aufgezogene Fischottern können sehr zahm werden. Die Chinesen benutzen eine Art der Sippe zum Fischfange für ihre Rechnung, und auch bei uns zu Lande hat man mehrmals Fischottern zu demselben Zwecke abgerichtet. Ein zahmer Otter ist ein sehr niedliches und gemächliches Thier. Seinen Herrn lernt er bald kennen und folgt ihm zuletzt wie ein treuer Hund auf Schritt und Tritt nach. Er gewöhnt sich fast lieber an Milch- und Pflanzenkost als an Fleischspeise und kann dahin gebracht werden, Fische gar nicht anzurühren. Ich habe viele gepflegt und bald in hohem Grade gezähmt, ziehe es jedoch vor, Andere für mich reden zu lassen. Eine Dame hatte einen jungen Otter mit Milch aufgezogen und so gezähmt, daß er ihr überall nachlief und, sobald er konnte, an ihrem Kleide emporstieg, um sich in ihren Schoß zu legen. Er spielte mit der Herrin oder in drolliger Weise mit sich selbst, suchte sich einen zu diesem Zwecke hingelegten Pelz auf, wälzte sich auf demselben herum, legte sich auf den Rücken, haschte nach dem Schwanze, biß sich in die Vorderpfoten und setzte dies so lange fort, bis er sich selbst in Schlummer wiegte. Die Gebieterin konnte mit ihm thun, was sie wollte. »So sehr ich das liebe Thierchen«, schreibt sie meinem Vater, »mit meinen Liebkosungen plagte, so ruhig duldete es dieselben. Ich legte es minutenlang um meinen Hals, dann auf den Rücken, ergriff es mit beiden Händen und vergrub mein Gesicht in seinem Felle; dann hielt ich es unter den Vorderfüßen umfaßt und drehte es wie einen Quirl herum: alles dieses ließ es sich geduldig gefallen. Nur wenn ich es von mir that, bekam es wieder eigenen Willen, den es dadurch kund gab, daß es an mir in die Höhe zu klettern suchte, dabei auch wohl in mein Kleid biß und dasselbe zerriß. Mit diesem Beißen und seinen schmutzigen Pfötchen konnte es mich recht plagen; denn nie blieb ein Unterkleid einen Tag lang sauber. Ich konnte aber doch nicht umhin, das Thierchen schlafen zu lassen, wo es wünschte. So gestaltete sich unsere gegenseitige Liebe immer inniger, je größer und verständiger der Otter wurde.«
»Ein Fischotter«, sagt Winkell, »welcher unter der Pflege eines in Diensten meiner Familie stehenden Gärtners aufwuchs, befand sich, noch ehe er halbwüchsig wurde, nirgends so wohl als in menschlicher Gesellschaft. Waren wir im Garten, so kam er zu uns, kletterte auf den Schoß, verbarg sich vorzüglich gern an der Brust und guckte mit dem Köpfchen aus dem zugeknöpften Oberrocke hervor. Als er mehr heranwuchs, reichte ein einziges Mal Pfeifen nach der Art des Otters, verbunden mit dem Rufe des ihm beigelegten Namens hin, um ihn sogar aus dem See, in welchem er sich gern mit Schwimmen vergnügte, heraus und zu uns zu locken. Bei sehr geringer Anweisung hatte er apportiren, aufwarten und nächstdem die Kunst, sich fünf- bis sechsmal über den Kopf zu kollern, gelernt und übte dies sehr willig und zu unserer Freude aus. Beging er, was zuweilen geschah, eine Ungezogenheit, so war es für ihn die härteste Bestrafung, wenn er mit Wasser stark besprengt oder begossen ward; wenigstens fruchtete dies mehr als Schläge. Sein liebster Spielkamerad war ein ziemlich starker Dachshund, und sobald sich dieser im Garten nur blicken ließ, war auch gewiß gleich der Otter da, setzte sich ihm auf den Rücken und ritt gleichsam auf ihm spazieren. Zu anderen Zeiten zerrten sie sich spielend umher; bald lag der Dachshund oben, bald der Otter. War dieser recht bei Laune, so kicherte er dabei in einem weg. Ging man mit dem Hunde in ziemlicher Entfernung vorüber und schien er nicht willens, seinen Freund zu besuchen, so lud dieser durch wiederholtes Pfeifen ihn ein. Jener folgte, wenn es sein Herr erlaubte, augenblicklich dem Rufe.«
Die Abrichtung eines gezähmten Otters znm Fischfange ist ziemlich einfach. Das Thier bekommt in der Jugend niemals Fischfleisch zu fressen und wird bloß mit Milch und Brod erhalten. Nachdem er ziemlich erwachsen ist, wirft man ihm einen roh aus Leder nachgebildeten Fisch vor und sucht ihn dahin zu bringen, mit diesem Gegenstande zu spielen. Später wird der Lehrfisch in das Wasser geworfen und schließlich mit einem wirklichen, todten Fische vertauscht. Nimmt der Otter einmal diesen auf, so wirft man denselben in das Wasser und läßt ihn von dort aus herausholen. Schließlich bringt man lebende Fische in einen großen Kübel und schickt den Otter dahinein. Von nun an hat man keine Schwierigkeiten mehr, letzteren auch in größere Teiche, Seen oder Flüsse zu senden, und man kann ihn, wenn man die Geduld nicht verliert, soweit bringen, daß er in Gesellschaft eines Hundes sogar auf andere Jagd mitgeht und so wie dieser die über dem Wasser geschossenen Enten herbeiholt. Man kennt Beispiele, daß er wie der Hund zur Bewachung der Hausgegenstände verwendet werden konnte.
»Ein wohlbekannter Jäger«, erzählt Wood, »besaß einen Otter, welcher vorzüglich abgerichtet war. Wenn er mit seinem Namen »Neptun« gerufen wurde, antwortete er augenblicklich und kam auf den Ruf herbei. Schon in der Jugend zeigte er sich außerordentlich verständig, und mit den Jahren nahm er in auffallender Weise an Gelehrigkeit und Zahmheit zu. Er lief frei umher und konnte fischen nach Belieben. Zuweilen versorgte er die Küche ganz allein mit dem Ergebnisse seiner Jagden, und häufig nahmen diese den größten Theil der Nacht in Anspruch. Am Morgen fand sich Neptun stets an seinem Posten, und jeder Fremde mußte sich dann verwundern, dieses Geschöpf unter den verschiedenen Vorstehe- und Windhunden zu erblicken, mit denen es in größter Freundschaft lebte. Seine Jagdfertigkeit war so groß, daß sein Ruhm sich von Tag zu Tag vermehrte und mehr als einmal die Nachbarn des Besitzers zu dem Wunsche veranlaßte: man möge ihnen das Thier auf einen oder zwei Tage leihen, damit es ihnen eine Anzahl von guten Fischen verschaffe.«
Richardson berichtet von einem anderen Otter, welchen er gezähmt hatte. Er war ganz an ihn gewöhnt und folgte ihm bei seinen Spaziergängen wie ein Hund, in der anmuthigsten Weise neben ihm her spielend. Bei Ankunft an einem Gewässer sprang der Otter augenblicklich in die Wellen und schwamm hier nach seinem Ermessen umher. Trotz aller Anhänglichkeit und Freundschaft, welche er seinem Herrn bewies, konnte er jedoch niemals dahin gebracht werden, diesem seine gemachte Beute zu überliefern. Sobald er sah, daß Richardson in der Absicht auf ihn zuging, einen gefangenen Fisch ihm zu entreißen, sprang er schnell mit ihm ins Wasser, schwamm an das andere Ufer, legte ihn dort nieder und verzehrte ihn daselbst in Frieden. Zu Hause durchstreifte der Otter nach Behagen Hof und Garten und fand auch dort seine Rechnung; denn er fraß das verschiedenartigste Ungeziefer, wie z. B. Schnecken, Würmer, Raupen, Engerlinge und dergleichen. Die Schnecken wußte er mit der größten Geschicklichkeit aus ihrem Gehäuse zu ziehen. In dem Zimmer sprang er auf Stühle und Fenster und jagte dort nach Fliegen, welche er sehr gewandt zu fangen wußte, wenn sie an den Glastafeln herumschwärmten. Mit einer schönen Angorakatze hatte er eine warme Freundschaft geschlossen, und als seine Freundin eines Tages von einem Hunde angegriffen wurde, eilte er zu ihrer Hülfe herbei, ergriff den Hund bei den Kinnbacken und war so erbittert, daß sein Herr die Streitenden trennen und den Hund aus dem Zimmer jagen mußte.
Die anmuthigste aller Erzählungen über einen gezähmten Fischotter rührt von dem polnischen Edelmann und Marschall Chrysostomus Passek her: »Im Jahre 1686, als ich in Ozowka wohnte, schickte der König den Herrn Straszewski mit einem Briefe zu mir; auch hatte der Kronstallmeister mir geschrieben und mich ersucht, dem König meinen Fischotter als Geschenk zu bringen, indem mir dies durch allerlei Gnadenbezeigungen würde vergolten werden. Ich mußte mich zur Herausgabe meines Lieblings bequemen. Wir tranken Branntwein und begaben uns dann auf die Wiesen, weil der Fischotter nicht zu Hause war, sondern an den Teichen umherkroch. Ich rief ihn bei seinem Namen »Wurm«; da kam er aus dem Schilfe hervor, zappelte um mich herum und ging mit mir in die Stube. Straszewski war erstaunt und rief: »Wie lieb wird der König das Thierchen haben, da es so zahm ist!« Ich erwiderte: »Du stehst und lobst nur seine Zahmheit; Du wirst aber noch mehr zu loben haben, wenn Du erst seine anderen Eigenschaften kennst«. Wir gingen zum nächsten Teiche und blieben auf dem Damme stehen. Ich rief: »Wurm, ich brauche Fische für die Gäste, spring ins Wasser!« Der Fischotter sprang hinein und brachte zuerst einen Weißfisch heraus. Als ich zum zweiten Male rief, brachte er einen kleinen Hecht, und zum dritten Male einen mittleren Hecht, welchen er am Halse verletzt hatte. Straszewski schlug sich vor die Stirn und rief: »Bei Gott, was sehe ich!« Ich frug: »Willst Du, daß er noch mehr holt? denn er bringt so viele, bis ich genug habe«. Straszewski war vor Freude außer sich, weil er hoffte, den König durch die Beschreibung jener Eigenschaften überraschen zu können, und ich zeigte ihm deshalb vor seiner Abreise alle Eigenschaften des Thieres.
»Der Fischotter schlief mit mir auf einem Lager und war dabei so reinlich, daß er weder das Bett, noch das Zimmer beschmutzte. Er war auch ein guter Wächter. In der Nacht durfte sich Niemand meinem Bette nahen; kaum daß er dem Burschen erlaubte, meine Stiefel auszuziehen, dann durfte er sich aber nicht mehr zeigen, weil das Thier sonst ein solches Geschrei erhob, daß ich selbst aus dem tiefsten Schlafe erwachen mußte. Wenn ich betrunken war, trat der Otter so lange auf meiner Brust herum, bis ich erwachte. Am Tage legte er sich in irgend einen Winkel und schlief so fest, daß man ihn auf den Armen umhertragen konnte, ohne daß er die Augen öffnete. Er genoß weder Fische noch rohes Fleisch. Wenn mich Jemand am Rocke faßte und ich rief: »Er berührt mich!« so sprang er mit einem durchdringenden Schrei hervor und zerrte jenen an den Kleidern und Beinen wie ein Hund. Auch liebte er einen zottigen Hund, welcher Korporal hieß. Von diesem hatte er alle jene Künste erlernt; denn er hielt mit ihm Freundschaft und war sowohl in der Stube als auf Reisen stets bei ihm. Dagegen vertrug er sich mit anderen Hunden gar nicht. Einst stieg Stanislaus Ozarawski nach einer Reise, welche wir zusammen gemacht hatten, bei mir ab. Ich hieß ihn willkommen. Der Fischotter, welcher mich drei Tage hindurch nicht gesehen hatte, kam an mich heran und konnte sich in Liebkosungen gar nicht mäßigen. Der Gast, welcher einen sehr schönen Windhund bei sich hatte, sagte zu seinem Sohne: »Samuel, halt den Hund, damit er den Fischotter nicht zerreiße!« »Bemühe Dich nicht!« rief ich; »dies Thierchen, so klein es auch ist, duldet keine Beleidigung«. »Wie! Du scherzest!« erwiderte er, »dieser Hund packt jeden Wolf, und ein Fuchs athmet nur einmal unter ihm.« Als der Fischotter genug mit mir gespielt hatte, sah er den fremden Hund, trat an ihn heran und sah ihm starr unter die Augen; auch der Hund betrachtete den Fischotter; dieser aber ging im Kreise herum, beroch ihn bei den Hinterfüßen, trat zurück und entfernte sich. Ich dachte bei mir: er wird dem Hunde nichts thun. Kaum aber fingen wir an, etwas zu sprechen, als der Fischotter sich an den Hund schlich und ihn mit der Pfote über die Schnauze schlug, so daß er zur Thüre und von dort hinter den Ofen sprang. Auch dahin folgte er ihm nach. Als der Hund keinen anderen Ausweg sah, sprang er auf den Tisch und zerbrach zwei geschliffene, mit Wein gefüllte Gläser; darauf wurde er hinausgelassen und kam nicht mehr ins Zimmer, obgleich sein Herr erst am folgenden Mittag abreiste. Wenn ein Hund auf der Straße den Fischotter beroch, so schrie er so laut, daß jener fortlief.
»Dieses Thierchen war auch auf der Reise sehr nützlich. Wenn ich während der Fastenzeit an einen Fluß oder Teich kam und den Fischotter bei mir hatte, so stieg ich ab und rief: »Wurm, spring hinein!« Das Thierchen sprang ins Wasser und brachte Fische heraus, soviel ich für mich und meine Dienerschaft brauchte. Auch Frösche, und was es sonst fand, schleppte es herbei. Die einzige Unannehmlichkeit, welche ich mit ihm auf Reisen hatte, war, daß allerwegens die Leute in Haufen zusammenströmten, als wenn das Thierchen aus Indien gewesen wäre. Ich besuchte einmal meinen Oheim Felix Chociewski, bei welchem sich auch der Priester Srebienski befand, welcher bei Tische neben mir saß, während hinter mir der Fischotter auf den Rücken gestreckt lag, weil er am liebsten auf diese Art ruhte. Als der Priester ihn bemerkte, glaubte er einen Muff zu sehen und faßte ihn an. Der Otter wachte auf, schrie und biß den Priester in die Hand, so daß dieser vor Schreck ohnmächtig wurde.
» Straszewski begab sich nun zum Könige und erzählte ihm alles, was er gesehen und gehört hatte. Der König ließ mich schriftlich befragen, wieviel ich für den Fischotter verlangte; auch der Kronstallmeister Piekarski schrieb an mich: »Um Gotteswillen, schlage dem König die Bitte nicht ab, gib ihm den Fischotter, weil Du sonst keine Ruhe haben wirst!« Straszewski überbrachte mir die Briefe und erzählte, daß der König immer sagte: bis dat, qui cito dat. Der König ließ auch zwei sehr schöne türkische Pferde von Jaworow holen, sie mit prächtigem Reitzeuge versehen und mir als Gegengeschenk überschicken. Ich sandte nun den Otter in den neuen Dienst. Er bequemte sich ungern dazu, denn er schrie und lärmte in dem Käfige, als er durch das Dorf gefahren wurde. Das Thierchen grämte sich und wurde mager. Als es dem König überbracht wurde, freute er sich unmäßig und rief: »Das Thierchen sieht so abgehärmt aus, doch soll es schon besser mit ihm werden«. Jeder, der es berührte, wurde von ihm in die Hand gebissen. Der König aber streichelte es, und es neigte sich zu ihm hin; darüber erfreute er sich sehr, streichelte es noch länger, befahl, ihm Speisen zu bringen, reichte sie ihm stückweis, und er verzehrte auch einiges. Er ging in den Zimmern frei und ungehindert zwei Tage umher; auch wurden Gefäße mit Wasser hingestellt und kleine Fische und Krebse hineingesetzt. Daran ergötzte sich der Otter und brachte die Fische heraus. Der König sagte zu seiner Gemahlin: »Holde Maria, ich werde keine anderen Fische essen als die, welche der Otter fängt. Wir wollen morgen nach Wilanow fahren, um zu sehen, wie er sich aufs Fischen versteht«. Der Fischotter aber schlich sich in nächster Nacht aus dem Schlosse, irrte umher und ward von einem Dragoner erschlagen, welcher nicht wußte, daß er zahm war. Das Fell verkaufte er sogleich an einen Juden. Als man im Schlosse aufstand und ihn vermißte, wurde geschrieen,
gejammert, nach allen Seiten ausgeschickt. Da findet man den Juden und Dragoner, ergreift sie und führt sie vor den König. Als dieser das Fell erblickte, bedeckte er mit einer Hand seine Augen, fuhr mit der anderen in seine Haare und rief: »Schlag zu, wer ein ehrlicher Mann ist; hau zu, wer an Gott glaubt!« Der Dragoner sollte erschossen werden. Da erschienen Priester, Beichtväter und Bischöfe vor dem Könige, baten und stellten ihm vor, daß der Dragoner nur in Unwissenheit gesündigt habe. Sie wirkten endlich soviel aus, daß er nicht erschossen, sondern nur durchgepeitscht wurde.«
Der Fischotter wird wegen der argen Verwüstungen, welche er anrichtet, zu jeder Zeit unbarmherzig gejagt. Seine Schlauheit macht viele Jagdarten, welche man sonst anwendet, langweilig oder unmöglich. Es ist ein seltener Fall, daß man einen Otter auf dem Anstande erlegt; denn wenn er die Nähe eines Menschen wittert, kommt er nicht zum Vorscheine. Im Winter ist der Anstand ergiebiger, zumal wenn man dem Thiere an den Eislöchern auflauert. Unter allen Umständen muß der Schütze unter dem Winde stehen, wenn er zum Ziele kommen will. Am häufigsten fängt man den Otter im Tellereisen, welches man vor seine Ausstiege ohne Köder so in das Wasser legt, daß es fünf Centim. hoch überspült wird. Das Eisen wird mit Wassermoos ganz bedeckt. Kann man eine solche Falle in einem Bache oder Graben aufstellen, durch welche er fischend von einem Teiche zum anderen zu gehen pflegt, so ist es um so besser. Man engt alsdann den Weg durch Pfähle derart ein, daß das Thier über das Eisen weglaufen muß. Letzteres wird, mehr oder weniger mit zweifelhaftem Erfolge, ebenfalls verwittert, und zwar entweder mit wilder Krausemünze allseitig berieben oder mit Fett eingesalbt, welchem man Baldrianwurzel, Biebergeil, Kampher oder Karpfenfett, Ottergeil oder Biebergeil, Kampher oder Angelikawurzel beigemischt hat. Auch verwendet man wohl die Losung des Otters selbst, vermischt mit gestoßener Baldrianwurzel und weißem Fischthran, oder stößt Hechtleber, Karpfengalle, Krebseier und Otterlosung zusammen in einen gereinigten Mörser und bereibt damit das Eisen. Erfolgreicher als jede Witterung ist jedenfalls die richtige Wahl des Ortes, auf welchen man das Eisen stellt. Erfahrene Otterfänger beobachten ihr Wild sorgfältig bei seinem Aus- und Einsteigen, stellen in der Nähe dieses Ausstieges das Eisen ohne jede Witterung ins Wasser und erbeuten mehr Fischottern als andere Jäger trotz aller Witterung. Zufällig fängt man den einen oder anderen Otter auch in Reußen oder sackförmigen Fischnetzen, in welche er bei seinen Fischjagden kommt und, weil er keinen Ausweg findet, erstickt. In meiner Heimat wurde ein Otter mit einem Hamen aus dem Wasser gefischt. Hier und da überrascht man ihn wohl auch bei seinen Landgängen; doch nehmen nur wenige Hunde seine Fährte an, ebensowohl, weil sie die Ausdünstung des Thieres verabscheuen, als auch, weil sie sich vor dem Gebisse desselben fürchten. Der in die Enge getriebene Otter ist ein furchterregender Gegner, welcher jeden Kampf aufnimmt und mit seinem starken Gebisse sehr gefährlich verwunden kann. Dies erfuhr ein Jäger, welcher einen von seinem Hunde verfolgten Otter in dem Augenblick ergriff, als er sich in das Wasser stürzen wollte. Der Mann hatte das Thier am Schwanze erfaßt, dieses aber drehte sich blitzschnell herum, schnappte nach der Hand und hatte im Nu das Endglied des Daumens abgebissen. Was der Otter gefaßt hat, läßt er nicht wieder los, eher läßt er sich todtschlagen. Auf größeren Seen und Teichen verfolgt man ihn in leichten Kähnen und schießt auf ihn, sobald er an die Oberfläche kommt, um Luft zu schöpfen. Die aufsteigenden Luftblasen verrathen den Weg, welchen er unter dem Wasser nimmt, und leiten die Jäger auf ihrer Verfolgung. In tiefem Wasser ist diese Jagdart nicht anwendbar, weil der Otter wie Blei zum Grunde und dadurch verloren geht; denn wenn er halb verfault wieder emporkommt, ist sein Fell natürlich nicht mehr zu gebrauchen. In Flüssen, in denen es viele Ottern gibt, kann man noch eine andere Jagdweise anwenden. Man zieht in aller Stille große Netze quer durch den Fluß und läßt den Otter durch die erwähnten Hunde treiben. Mehrere Leute mit Gewehren und Spießen stehen an den Netzen oder gehen, wo dies thunlich, mit den Hunden im Flusse fort. Dann versucht man, das Raubthier entweder zu erlegen oder anzuspießen und trägt es dann stolz auf den Spießen nach Hause. So jagt man hauptsächlich in Schottland. Der gefangene Otter zischt und faucht fürchterlich, vertheidigt sich bis zum letzten Lebenshauche, wird auch unvorsichtigen Hunden höchst gefährlich, da er ihnen nicht selten die Beinknochen zerbeißt. Geübte Otterhunde wissen derartigen Unfällen freilich auszuweichen und werden ihres Wildes bald Herr. Im Augenblicke des Todes stößt der Otter klagende und wimmernde Laute aus.
Schon in den ältesten Jagdgesetzen wird die Ausrottung des Fischotters nachdrücklich befohlen und jedem Jäger oder Fänger möglichst Vorschub geleistet. In früheren Jahrhunderten zählte man, laut Jäckel, den Fischotterfang zur Fischerei, weil sie denjenigen zu Nutze kommen sollte, welche von ihnen den Schaden hatten ertragen müssen. Doch gab es eigene Otterjäger; dieselben standen aber unter den Fischmeistern und waren minder angesehen als andere Weidmänner. Als Auslösung zahlte man ihnen sehr geringe Summen; doch hatten sie das Recht, Balg und Kern des Thieres zu eigenem Nutzen zu verwenden. Das Fleisch stand einst in Bayern und Schwaben in hohem Werthe und wurde in die Klöster als beliebte Fastenspeise, das Pfund zu einem Gulden verkauft, während gegenwärtig da, wo man solchen Braten zu schätzen vorgibt, höchstens der dritte Theil gedachter Summe dafür gezahlt wird; denn selbst die frömmsten Gläubigen, welche in unseren Tagen noch glauben, daß der Fischotter zu den Fischen, nicht aber zu den Säugethieren gezählt und in der Fastenzeit gegessen werden dürfe, scheinen den Geschmack an dem so wenig versprechenden und schwer verdaulichen Wildpret, welches erst durch allerlei Kunst des Kochens einigermaßen schmackhaft gemacht werden kann, verloren zu haben. Sogar in dem glaubenseifrigen Bayern erachtet man jetzt Fischotterfleisch an vielen Orten für werthlos und verschenkt es im besten Falle an arme Leute, welche sonst keinen Sonntagsbraten zu erwerben im Stande sind. Ungleich werthvoller als der Kern ist der allerorten sehr geschätzte Balg, für welchen bei uns zu Lande 12 bis 60 Mark gezahlt werden. Nach Lomer erbeutet man in Mitteleuropa jährlich ungefähr 12,000 Fischotterfelle, welche einen Gesammtwerth von 135,000 Mark haben. Eine größere Anzahl gelangt deshalb nicht auf unseren Markt, weil das Fischotterfell bei fast allen nördlichen Völkerschaften sehr beliebt ist und fast ebenso hoch oder höher im Preise steht als bei uns. Fischotter und Luchs gelten, laut Radde, bei allen mongolischen Völkern als werthvolle Pelzthiere und werden von ihnen ungleich theuerer als von den europäischen Händlern bezahlt; für gute Fischottern erlegen die Mongolen der Hochsteppen 20 bis 25 Rubel Silber, also ebensoviel wie für die besten Zobel. Man verwendet das Fell allgemein zu Verbrämungen der Pelze und Winterkleider, in Süddeutschland zu den sogenannten Ottermützen, wie sie von Männern und Frauen in Hessen, Bayern und Schwaben getragen werden, in Norddeutschland zu Pelzkragen und dergleichen, in China zum Besatz der Mützen, in Kamtschatka endlich zum Einpacken der sehr theueren Zobelfelle, weil man annimmt, daß es alle Nässe und Feuchtigkeit an sich zieht und dadurch die Zobelfelle schön erhält. Aus den Schwanzhaaren fertigt man Malerpinsel und aus den feinen Wollhaaren schöne und dauerhafte Hüte. Wohl mit Unrecht gelten die Pelze der Fischottern, welche an kleinen Flüssen und Bächen wohnen, für besser als die solcher, welche an großen Flüssen und Seen leben. Früher wurden auch Blut, Fett und manche Eingeweide des Thieres als Arzneimittel gebraucht.
Der Fischotter war schon den alten Griechen und Römern bekannt, obwohl sie über sein Leben viel fabelten. So glaubte man, daß unser Thier selbst den Menschen anfalle und, wenn es ihn mit seinem fürchterlichen Gebisse erfaßt habe, nicht eher loslasse, als bis es das Krachen der zermalmten Knochen vernehme, und dergleichen mehr.
Zur Vervollständigung des Lebensbildes unseres Marders des Wassers will ich noch eine Art der Gruppe, die Lontra oder Ariranha (sprich Ariranje) der Brasilianer ( Lutra brasiliensis, Lontra brasilisensis), mit den Worten des Prinzen von Wied und Hensels beschreiben. Nach Anschauung von Gray vertritt das Thier mit zwei anderen Verwandten eine besondere Untersippe ( Lontra); die Unterschiede zwischen unserem und dem brasilianischen Fischotter sind jedoch höchst gering und beschränken sich wesentlich auf die Bildung des Kopfes und Schwanzes: ersterer scheint im Vergleiche zu dem unseres Fischotters mehr rund und nicht so platt gedrückt, letzterer beiderseitig scharfkantig oder von oben nach unten abgeplattet. Das Gebiß hat keine wesentlichen Eigenthümlichkeiten. Die Färbung des schönen kurzen Pelzes ist chokoladenbraun, unten etwas heller; der Unterkiefer sieht gelblich oder weiß aus, und der ganze Unterhals bis zur Brust zeigt längliche, oft sehr abwechselnde weißliche Flecken. Spielarten kommen ebenfalls vor. Verglichen mit unserem Fischotter erscheint die Ariranha als ein Riese: ihre Gesammtlänge beträgt 1,5 bis 1,7 Meter, wovon auf den Schwanz 55 bis 63 Centim. zu rechnen sind.
Die Ariranha bewohnt besonders die großen Flüsse der Tiefebene und hier am liebsten die ruhigen Seitenarme derselben, geht auch nicht hoch in das Gebirge hinauf. »In wenig besuchten Flüssen von Brasilien«, schildert der Prinz von Wied, »findet man diese Thiere in zahlreichen Banden. Selten haben wir den Belmonte, den Itabapuana, Ilheos und andere Flüsse beschifft, ohne durch die sonderbare Erscheinung solcher Gesellschaften von Fischottern unterhalten zu werden. Sie haben die Sitten unserer europäischen, sind aber vollständige Tagethiere, welche mit Beginn des Morgens auf ihr Tagewerk ausgehen, mit der Dunkelheit des Abends aber sich zur Ruhe begeben. Wenn eine solche Bande ankommt, hört man schon von fern laut pfeifende, an das Miauen der Katzen erinnernde Töne, von heftigem Schnauben und Schnarchen begleitet; das Wasser ist in Bewegung, und die äußerst gewandt schwimmenden Thiere kommen öfters mit dem Kopfe, ja mit dem halben Leibe über die Oberfläche empor, einen Fisch in dem Rachen tragend, als wollten sie ihre Beute zeigen. So steigen sie, gesellschaftlich fischend, die Ströme hinauf oder lassen sich von dem Wasser gemächlich hinabtreiben. Um die ihnen begegnenden Kanoes tauchen sie gaukelnd umher, obschon man sie gewöhnlich mit der Flinte begrüßt.«
»Wenn man«, ergänzt Hensel, »in einer leichten Canoa die stillen Seitenarme des Jacuhy oder seiner Zuflüsse besucht und, geschützt von dem Dunkel überhängender Aeste, geräuschlos dahingleitet, wird man leicht in einiger Entfernung von Zeit zu Zeit dunkle Punkte bemerken, welche, gewöhnlich zu mehreren vereinigt, den Fluß durchschwimmen. Sie verrathen sich dem Auge des Jägers schon von weitem durch Wellenzüge, welche in Form eines spitzen Winkels durch das Wasser ziehen und an deren Scheitelpunkte dem bewaffneten Auge den kaum hervorragenden Kopf der Ariranha erkennen lassen. Hat man endlich den Ort erreicht, so ist alles verschwunden, und lautlose Stille, höchstens unterbrochen von dem Schrei eines Eisvogels, lagert auf der dunklen Wasserlache. Unerwartet ertönt ein zorniges Schnauben neben der Canoa, und rechts und links, vor und hinter uns erheben sich senkrecht die Köpfe der riesigen Thiere, um blitzschnell mit einem zweiten Schnauben wieder in die Tiefe zu tauchen. Vergebens ist die Gewandtheit des Jägers: ehe er das Gewehr am Backen hat, ist die vielbegehrte Beute verschwunden, um ebenso unerwartet an einer entgegengesetzten Seite wieder aufzutauchen; und gelingt auch einmal ein Schuß, so verschwindet das verwundete Thier in dem unergründlich tiefen Wasser auf Nimmerwiedersehen.
»Die Ariranha lebt trotz ihrer Seehundsnatur von allem, was sie bewältigen kann. Eine tödtete mir einst ein Beutelthier, welches sich im Tellereisen gefangen hatte, und fraß es zum Theil auf; eine andere fing in der Nähe eines Hauses in kurzer Zeit zwei Gänse, welche auf dem schmalen Flusse schwammen, und zwar indem sie sich der Beute unter Wasser näherte und diese am Bauche faßte. Groß ist ihre Abneigung gegen Hunde, und in Gegenden, in denen sie Menschen noch nicht fürchten gelernt hat, macht sie nicht selten, zu mehreren vereint, Angriffe auf die bei den Jägern in den Booten befindlichen Hunde. Einen sie im Wasser verfolgenden Hund bewältigt sie leicht.«
Wie der Prinz von Wied mittheilt, wandert auch die Ariranha über Land von einem Flusse zum anderen und fängt sich dann zuweilen in den Schlagfallen. Ihr Fell wird hier und da sehr geschätzt, in der Gegend von Pernambuco beispielsweise höher als ein Unzenfell, und man würde eifriger auf den Otter Jagd machen, wäre es so leicht, seiner habhaft zu werden.
»Aus einem Trupp von fünf Stücken«, fährt Hensel fort, »waren bereits vier derselben von mir und meinen Leuten aufgerieben worden, ehe es endlich gelang, des fünften habhaft zu werden. Die Austrittsstellen dieses Otters sind, seiner Größe entsprechend, umfangreiche kahle Plätze unter dem dichten überhängenden Bambusrohre oder ebenso undurchdringliche Hecken. Man findet sie stets mit zahllosen Fischschuppen bedeckt, welche nicht bei dem Verzehren der Fische abfallen, sondern aus dem flüssigen Kothe der Ottern herrühren, in welchem sie unverdaut erhalten bleiben. An einer solchen Stelle hatte einst mein Diener ein Tellereisen ins Wasser, dicht unter dem Uferrande, gelegt. Als er nach einigen Stunden wieder hierherkam, um nach dem Eisen zu sehen, saß der Otter am Ufer und sonnte sich. Der Mann schoß mit der Kugel nach dem Thiere, welches sich auf den Schuß mit einem gewaltigen Satze in das Wasser stürzte, dabei aber glücklicherweise in das Eisen sprang. Obgleich der Otter, wie sich nachher herausstellte, von der Kugel getroffen war, hatte er doch noch die Kraft, die starke Leine, mit welcher das Eisen befestigt war, zu zerreißen und mit diesem in der Tiefe zu verschwinden. Ein glücklicher Zufall fügte es, daß das Eisen mit einem Theile der Leine in den zahlreichen, unter dem Wasser befindlichen Baumwurzeln sich verwickelte, so daß das gefangene Thier ertrank und sammt dem Eisen, wenn auch mit vieler Mühe, an das Tageslicht befördert werden konnte.«
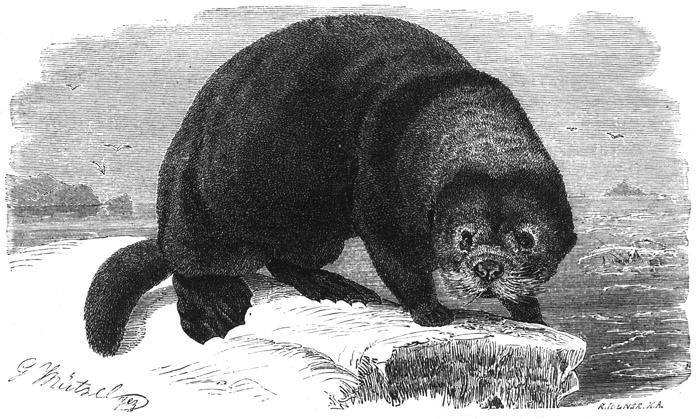
Seeotter ( Enhydris lutris). [1/10] natürl. Größe. (Nach Wolf.)
Unser Fischotter und mehrere seiner Verwandten wohnen hier und da und zeitweilig zwar auch im Meere, eine Art der Unterfamilie aber gehört diesem ausschließlich an. Der Seeotter oder Kalan ( Enhydris lutris, Mustela, Lutra, und Phoca lutris, Enhydra marina, und Stelleri, Latax marina), Vertreter einer besonderen Sippe, bildet gleichsam ein Mittelglied zwischen den Ottern und Robben. Der Kopf ist zwar noch etwas abgeplattet, jedoch rundlicher als bei den Süßwasserottern, der Hals sehr kurz und dick, der Leib walzig, der Schwanz kurz, dick, zusammengedrückt, keilförmig zugespitzt und dicht behaart, das vordere Fußpaar noch wenig, das Hintere sehr abweichend gebaut. Während die Vorderfüße nur wegen ihrer verkürzten Zehen, welche vermittels einer schwieligen, unten nackten Haut verbunden werden, und ihrer kleinen und schwachen Krallen von denen der Flußottern abweichen, erscheinen die hinteren gleichsam als Flosse, und zwar mindestens in demselben Grade wie bei den Seehunden, von deren hinteren Flossenfüßen sie sich dadurch unterscheiden, daß die Zehen gradweise von innen nach außen an Länge zunehmen.
In mancher Hinsicht ähnelt der Hinterfuß des Seeotters dem des Bibers, ist jedoch oben und unten mit kurzen, dichten, seidigen Haaren besetzt. Der Pelz besteht aus langen, steifen Grannen von schwarzbrauner, der weißen Spitzen halber weiß gesprenkelter Färbung, und äußerst feinen Wollhaaren. – Junge Thiere tragen ein langes, grobes, weißes Haar, welches die feine braune Wolle vollständig versteckt. Ausgewachsene Seeottern erreichen eine Gesammtlänge von mindestens anderthalb Meter, wovon etwa 30 Centim. auf den Schwanz kommen, und ein Gewicht von 30 bis 40 Kilogramm.
Der Verbreitungskreis des Seeotters beschränkt sich auf die nördlichsten Theile des Stillen Weltmeeres, die nördlichen Küsten von Kalifornien und die Inseln und Küsten von hier aus nördlich, sowohl auf nordamerikanischer wie asiatischer Seite. Längs der amerikanischen Küste geht er weiter nach Süden hinauf als längs der asiatischen, wird aber auch dort von Jahr zu Jahr seltener.
Die beste Beschreibung des Seeotters hat Steller gegeben, und bis zum heutigen Tage kein anderer Naturforscher ihr etwas zuzusetzen oder abzusprechen vermocht. Dies mag zum Theil darin seinen Grund haben, daß der Seeotter schon seit hundert Jahren in stetem Abnehmen begriffen ist, und sich gegenwärtig bei weitem nicht mehr mit der Bequemlichkeit beobachten läßt, mit welcher Steller dies konnte.
»Der Pelz des Seeotters«, sagt genannter Beobachter, »dessen Haut lose auf dem Fleische aufliegt und sich während des Laufens überall bewegt, übertrifft an Länge, Schönheit und Schwärze das Haar aller Flußbiber so weit, daß diese nicht mit ihm in Vergleichung kommen können. Die besten Felle werden auf Kamtschatka zu dreißig, in Jakutzk zu vierzig, an der chinesischen Grenze aber gegen Tausch in Waaren zu achtzig bis hundert Rubel bezahlt. Das Fleisch ist ziemlich gut zu essen und schmackhaft. Die Weibchen haben es aber viel zarter und sind gegen den Gang der Natur kurz vor und nach der Paarungszeit am allerfettesten und schmackhaftesten. Die noch saugenden Jungen, welche ihrer schlechten Felle wegen »Medwedki« oder junge Bären genannt werden, können, sowohl gebraten als gesotten, immer mit einem Sauglamme um den Vorzug streiten. Das Männchen hat ein knöchernes Geburtsglied, wie alle anderen warmblütigen Seethiere, das Weibchen zwei Brüste neben der Scham. Sie begehen sich auf menschliche Weise.
»Im Leben ist der Seeotter ein ebenso schönes und angenehmes als in seinem Wesen lustiges und spaßhaftes, dabei sehr schmeichelndes und verliebtes Thier. Wenn man ihn laufen sieht, übertrifft der Glanz seiner Haare den schwärzesten Sammet. Am liebsten liegen sie familienweise: das Männchen mit seinem Weibchen, den halberwachsenen Jungen oder »Koschlockis« und den ganz kleinen Säuglingen, Medwedkis. Das Männchen liebkost das Weibchen mit Streicheln, wozu es sich der vorderen Tatzen wie der Hände bedient, und legt sich auch öfters auf dasselbe, und sie stößt das Männchen scherzweise und gleichsam aus verstellter Sprödigkeit von sich und kurzweilt mit den Jungen wie die zärtlichste Mutter. Die Liebe der Eltern gegen ihre Jungen ist so groß, daß sie sich der augenscheinlichsten Todesgefahr für sie unterwerfen und, wenn sie ihnen genommen werden, fast wie ein kleines Kind laut zu weinen beginnen. Auch grämen sie sich dergestalt, daß sie, wie wir aus ziemlich sicheren Beispielen sahen, in zehn bis vierzehn Tagen wie ein Geripp vertrocknen, krank und schwach werden, auch vom Lande nicht weichen wollen. Man sieht sie das ganze Jahr lang mit Jungen. Sie werfen bloß eins, und zwar auf dem Lande. Es wird sehend mit allen Zähnen geboren. Die Weibchen tragen das Junge im Maule, im Meere aber, auf dem Rücken liegend, zwischen den Vorderfüßen, wie eine Mutter ihr Kind in den Armen hält. Sie spielen auch mit demselben wie eine liebreiche Mutter, werfen es in die Höhe und fangen es wie einen Ball, stoßen es ins Wasser, damit es schwimmen lerne, und nehmen es, wenn es müde geworden, wieder zu sich und küssen es wie ein Mensch. Wie auch die Jäger ihr zu Wasser oder zu Lande zusetzen, so wird doch das im Maule getragene Junge nicht, außer in der letzten Noth oder im Tode, losgelassen, und deshalb kommen gar viele um. Ich habe den Weibchen absichtlich die Jungen genommen, um zu sehen, was sie thaten. Sie jammerten wie ein betrübter Mensch und folgten mir von fern wie ein Hund, als ich sie forttrug. Dabei riefen sie ihre Jungen mit jenem Gewimmer, welches ich oben beschrieb. Als die Jungen in ähnlicher Weise antworteten, setzte ich sie an den Boden; da kamen gleich die Mütter herbei und stellten sich bereit, dieselben fortzutragen. Auf der Flucht nehmen sie ihre Säuglinge in den Mund, die erwachsenen aber treiben sie vor sich her. Einmal sah ich eine Mutter mit ihrem Jungen schlafen. Als ich mich näherte, suchte sie dasselbe zu erwecken; da es aber nicht fliehen, sondern schlafen wollte, faßte sie es mit den Vorderfüßen und wälzte es wie einen Stein ins Meer. Haben sie das Glück, zu entgehen, so fangen sie an, sobald sie nur das Meer erreicht haben, ihren Verfolger dergestalt auszuspotten, daß man es nicht ohne sonderliches Vergnügen sehen kann. Bald stellen sie sich wie ein Mensch senkrecht in die See und hüpfen mit den Wellen, halten wohl auch eine Vordertatze über die Augen, als ob sie einen unter der Sonne scharf ansehen wollten. Bald werfen sie sich auf den Rücken und schaben sich mit den Vorderfüßen den Bauch und die Scham, wie wohl Affen thun. Dann werfen sie ihre Kinder ins Wasser und fangen sie wieder etc. Wird ein Seeotter eingeholt und sieht er keine Ausflucht mehr, so bläst und zischt er wie eine erbitterte Katze. Wenn er einen Schlag bekommt, macht er sich dergestalt zum Sterben fertig, daß er sich auf die Seite legt, die Hinterfüße an sich zieht und mit den Vordertatzen die Augen deckt. Todt liegt er wie ein Mensch ausgestreckt mit kreuzweise gelegten Vorderfüßen.
»Die Nahrung des Seeotters besteht in Seekrebsen, Muscheln, kleinen Fischen, weniger in Seekraut oder Fleisch. Ich zweifle nicht, daß, wenn man die Kosten daran wenden wollte, die Thiere nach Rußland überzubringen, sie zahm gemacht werden könnten; ja sie würden sich vielleicht in einem Teiche oder Flusse vermehren. Denn aus dem Seewasser machen sie sich wenig, und ich habe gesehen, daß sie sich mehrere Tage in den Inseln und kleinen Flüssen aufhalten. Uebrigens verdient dieses Thier die größte Hochachtung von uns allen, da es fast sechs Monate allein zu unserer Nahrung und den an der Zahnfäule leidenden Kranken zugleich zur Arznei gedient.
»Die Bewegungen des Seeotters sind außerordentlich anmuthig und schnell. Sie schwimmen vortrefflich und laufen sehr rasch, und man kann nichts schöneres sehen als dieses wie in Seide gehüllte und schwarzglänzende Thier, wenn es läuft. Dabei ist es merkwürdig, daß die Thiere um so munterer, schlauer und hurtiger sind, je schöner ihr Pelz ist. Die ganz weißen, höchst wahrscheinlich uralte, sind im höchsten Grade schlau und lassen sich kaum fangen. Die schlechtesten, welche nur braune Wolle haben, sind meist träge, schläfrig und dumm, liegen immer auf dem Eise oder Felsen, gehen langsam und lassen sich leicht fangen, als ob sie wüßten, daß man ihnen weniger nachstellt. Beim Schlafen auf dem Lande liegen sie krumm wie die Hunde. Kommen sie aus dem Meere, so schütteln sie sich ab und putzen sich mit den Vorderfüßen wie die Katzen. Sie laufen sehr geschwind, jedoch mit vielen Umschweifen. Wird ihnen der Weg zum Meere versperrt, so bleiben sie stehen, machen einen Katzenbuckel, zischen und drohen, auf den Feind zu gehen. Man braucht ihnen aber nur einen Schlag auf den Kopf zu geben, so fallen sie wie todt hin und bedecken die Augen mit den Pfoten. Auf den Rücken lassen sie sich geduldig schlagen; sobald man aber den Schwanz trifft, so kehren sie um und halten, lächerlich genug, dem Verfolger die Stirn vor; manchmal stellen sie sich auf den ersten Schlag todt und – laufen davon, sobald man sich mit anderen beschäftigt. Wir trieben sie ziemlich in die Enge und hoben die Keule in die Höhe, ohne zu schlagen; da legten sie sich nieder, schmeichelten, sahen sich um und krochen sehr langsam und demüthig wie Hunde zwischen uns durch. Sobald sie sich aber außer aller Gefahr sahen, eilten sie mit großen Sprüngen nach dem Meere.
»Im Juli oder August hären sich die Seeottern, jedoch nur wenig, und werden dann etwas brauner. Die besten Felle sind die aus den Monaten März, April und Mai. Vor fünfzehn Jahren (jetzt also vor 140) konnte man die besten Felle für ein Messer oder Feuerzeug kaufen, und die russischen Kaufleute gaben dafür höchstens fünf oder sechs Rubel; jetzt haben sie den oben angegebenen Preis schon erreicht, hauptsächlich, weil die Chinesen so hohen Werth auf sie legen. Nach China gehen die meisten von allen Fellen, und da die Chinesen meist Seidenpelze tragen, so ziehen sie die
schweren Pelze des Seeotters den leichteren des Zobels vor und verbrämen sie auch ringsum. In Kamtschatka gibt es keinen größeren Staat, als ein Kleid, zusammengenäht aus weißem Pelz der Renthierfelle mit Otterpelz verbrämt. Vor einigen Jahren trug noch alles Meerotterkleider; es hat aber aufgehört, seitdem sie so theuer geworden; auch hält man jetzt in Kamtschatka die Hundefelle für schöner, wärmer und dauerhafter.
»Der Seeotter, welcher wegen der Beschaffenheit seines Felles mit Unrecht für einen Biber angesehen und daher »Kamtschatka-Robbe« genannt worden, ist ein echter Otter, und unterscheidet sich von dem Flußotter allein darin, daß er sich in der See aufhält, fast um die Hälfte größer ist und an Schönheit der Haare einem Biber ähnelt. Er ist unstreitig ein amerikanisches Seethier und an den Küsten von Asien bloß ein Gast und Ankömmling, welcher sich in dem sogenannten Bibermeer unter dem 56. bis 50. Breitengrade aufhält, wo beide Erdtheile vielleicht nur durch einen fünfzig Meilen breiten Kanal getrennt sind. Besagter Kanal ist übrigens mit vielen Eilanden angefüllt, und diese machen der Thiere Ueberkunft nach Kamtschatka möglich, weil sie sonst über eine weite See zu gehen nicht im Stande sein dürften. Nach eingezogenen Kundschaften von dem tschuktschischen Volke weiß ich gewiß, daß diese Thiere gegenüber am Festlande Amerika zwischen dem 58. und 60. Grade anzutreffen sind; man hat auch Felle davon über Annadyrsk durch den Handel bekommen. Vom 56. bis 50. Grad haben wir die Seeottern auf den Inseln am Festlande von Amerika, und unter 60. Grad nahe am Festlande, beim Vorgebirge Eliä, selbst 500 Meilen von Kamtschatka nach Osten hin angetroffen. Die meisten Ottern werden mit dem Treibeise von einer Küste des Festlandes zur anderen geführt; denn ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie gern diese Thiere auf dem Eise liegen, und obgleich wegen gelinden Winters die Eisschollen nur dünn und sparsam waren, wurden sie durch die Flut auf die Insel und mit abnehmendem Wasser wieder in die See geführt, im Schlafen sowohl wie im Wachen.
»Als wir auf der Beringsinsel anlangten, waren die Seeottern häufig vorhanden. Sie gehen zu allen Jahreszeiten, doch im Winter mehr als im Sommer, aufs Land, um zu schlafen und auszuruhen, auch um allerlei Spiele miteinander zu treiben. Zur Zeit der Ebbe liegen sie auf den Klippen und auf den abgetrockneten Blöcken, bei vollem Wasser auf dem Lande im Grase oder Schnee bis auf eine halbe, ja eine Werst vom Ufer ab, gewöhnlich jedoch nahe an demselben. Auf Kamtschatka oder den Kurilischen Inseln kommen sie selten ans Land, so daß man hieraus sieht, sie seien auf unserer Insel niemals in ihrer Ruhe und ihren Spielen gestört worden.
»Wir jagten sie auf folgende Art: Gewöhnlich des Abends oder in der Nacht gingen wir in Gesellschaft von zwei, drei oder vier, mit langen, starken Stöcken von Birkenholz versehen, gegen den Wind so still als möglich dicht an dem Ufer hin und sahen uns aller Orten fleißig um. Wo wir nur einen Seeotter schlafend liegen sahen, ging einer ganz stille auf selbigen los, kroch wohl auch aus allen Vieren, wenn er nahe war; die anderen benahmen ihm einstweilen den Weg nach der See. Sobald man ihm so nahe kam, daß man ihn mit einem Sprunge zu erreichen dachte, fuhr man mit einemmale zu und suchte ihn mit wiederholten Streichen auf den Kopf zu tödten. Entsprang er aber, ehe man ihn erreichen konnte, so jagten die anderen gemeinschaftlich ihn von der Seeseite weiter nach dem Lande und schlossen ihn im Laufen immer enger ein, da dann dieses Thier, so schnell und geschicklich es auch laufen kann, endlich ermüdete und leicht erschlagen wurde. Trafen wir, was oft geschah, eine ganze Herde an, so wählte sich jeder sein Thier, welches ihm am nächsten schien, und dann ging die Sache noch besser von statten. Im Anfange brauchten wir wenig Fleiß, List und Behendigkeit, weil das ganze Ufer von ihnen voll war und sie in der größten Sicherheit lagen; später aber lernten sie unsere Löffel dergestalt kennen, daß man sie bloß lauernd und mit der äußersten Vorsicht ans Land gehen sah. Sie schauten allenthalben um sich her, wandten die Nasen nach jeder Gegend hin, um Witterung zu bekommen, und wenn sie sich nach langem Umsehen zur Ruhe gelegt hatten, sah man sie manchmal im Schrecken wieder aufspringen und entweder nochmals sich umsehen oder wieder nach der See wandern. Wo eine Herde lag, waren aller Orten Wachen von ihnen aufgestellt. So hinderten uns auch die boshaften Steinfüchse, welche dieselben mit Gewalt vom Schlaf erweckten oder wachsam erhielten. Deshalb mußten wir immer neue Stellen aufsuchen und immer weiter auf die Jagd gehen, auch die finstere Nacht der hellen und das ungestüme Wetter dem ruhigen vorziehen, um sie nur zu bekommen, weil unsere Erhaltung darauf beruhte. Aller dieser Hindernisse ungeachtet sind jedoch vom 6. September 1741 bis zum 17. August 1742 über siebenhundert Stück von ihnen durch uns erschlagen, von uns verzehrt und ihre Felle von uns zum Wahrzeichen mit nach Kamtschatka genommen worden. Weil man sie aber öfters ohne Noth, nur der Felle wegen erschlagen, ja auch öfters, wenn diese nicht schwarz genug waren, mit Fell und Fleisch liegen lassen, kam es durch unsere heillose Verfolgung der Thiere dahin, daß wir im Frühjahre, nachdem unsere Mundvorräthe verzehrt waren, die Ottern schon auf fünfzig Werste von unseren Wohnungen abgetrieben hatten. Man hätte sich nun gern mit Seehunden begnügt; diese aber waren allzu listig, als daß sie sich weiter auf das Land hätten wagen sollen, und es war immer ein großes Glück, wenn man einen Seehund erschleichen konnte.
»Die Kurilen gehen im Frühjahre mit leeren Booten, worin sechs Ruderer, ein Steuermann und ein Schütze befindlich sind, auf zehn Werste und weiter in die See. Wenn sie einen Seeotter erblicken, rudern sie auf denselben mit allen Kräften los. Der Otter spart aber auch keinen Fleiß, um zu entkommen. Ist das Boot nahe genug, so schießen der Steuermann und die vornsitzenden Schützen mit dem Pfeile nach dem Thiere. Treffen sie es nicht, so zwingen sie es doch unterzutauchen, und lassen es nicht wieder aufkommen, ohne es gleich wieder durch einen Pfeil am Athemholen zu hindern. An den aufsteigenden Blasen bemerken sie, wo sich der Otter hinwendet, und dahin steuert auch der Steuermann das Fahrzeug. Der Vordermann aber fischt mit einer Stange, an welcher kleine Querstöcke wie an einer Bürste sitzen, die wieder emporkommenden Pfeile aus der See auf. Wenn der Otter ein Junges bei sich hat, kommt dieses zuerst außer Athem und ersäuft. Dann wirft es die Alte, um sich besser retten zu können, weg; man fängt es auf und nimmt es in das Boot, wo es nicht selten wieder zu sich kommt. Endlich wird auch die Mutter oder das männliche Thier so athemlos und matt, daß es sich keine Minute lang unter dem Wasser aufhalten kann. Da erlegen es die Jäger entweder mit einem Pfeile oder in der Nähe mit der Lanze. Wenn Seeottern in Stellnetze gerathen, womit man sie auch zu fangen pflegt, verfallen sie in eine solche Verzweiflung, daß sie sich einander entsetzlich zerbeißen. Zuweilen beißen sie sich selbst die Füße ab, entweder aus Wuth oder, weil sie selbige verwickelt sehen, aus Verzweiflung.
»Nichts ist fürchterlicher anzusehen, als wenn der Eisgang ankommt, wobei man die Seeottern auf dem aus der See antreibenden Eise jagt und mit Keulen erschlägt. Gewöhnlich ist dabei ein solcher Sturm und ein solches Schneegestöber, daß man sich kaum auf den Füßen erhalten kann, und doch scheuen die Jäger es nicht, selbst in der Nachtzeit auf den Fang zu gehen. Sie laufen auch ohne Bedenken auf dem Eise fort, wenn es gleich im Treiben ist und von den Wellen so gehoben wird, daß sie zuweilen bald auf einem Berge erscheinen und dann wieder gleichsam in den Abgrund fahren. Jeder hat ein Messer und eine Stange in den Händen und lange Schneeschuhe an die Füße gebunden, woran sich Haken von Knochen befinden, um nicht auf dem Eise zu glitschen oder, wo es sich thürmt, herunter zu fallen. Die Häute müssen gleich auf dem Eise abgenommen werden, und darin sind die Kurilen und Kamtschadalen so fertig, daß sie in zwei Stunden oft dreißig bis vierzig abziehen. Manchmal aber, wenn das Eis gänzlich vom Ufer getrieben wird, müssen sie alles verlassen und nur sich zu retten versuchen. Dann helfen sie sich mit Schwimmen und binden sich mit einem Stricklein an ihren Hund, der sie getreu mit an das Ufer zieht. Bei günstigem Wetter laufen sie so weit auf das Eis hinaus, daß sie das Land aus dem Gesichte verlieren; doch geben sie bei ihrer Jagd immer auf Ebbe und Flut Obacht und sehen auch zu, ob der Wind nach dem Lande geht oder nicht.«
Heutzutage werden, nach Lomer, jährlich etwa 1500 Seeotterfelle auf den Markt gebracht. Dieselben haben aber einen Gesammtwerth von 600,000 Mark, da der Preis der guten bis zu den
schönsten Stücken dieser Art zwischen 300 und 1500 Mark schwankt. Man kann aus einem solchen Felle drei bis fünf Mantelkragen schneiden, welche in Rußland und in anderen Ländern von vornehmen reichen Leuten getragen werden. Hohe Mandarinen Chinas lassen sich sogar Pelze aus Seeotterfellen bereiten und zahlen dafür gern die Summe von etwa 6000 Mark unseres Geldes.
Man kann nicht sagen, daß irgend ein Mitglied aus der Familie der Marder Wohlgerüche verbreite; wir finden im Gegentheile schon unter den bei uns hausenden Arten solche, welche »Stänker« benannt werden und diesen Namen mit Fug und Recht tragen. Was aber ist unser Iltis gegen einige seiner Verwandten, welche in Amerika und Afrika leben! Sie sind die wahren Stänker. Wenn man liest, welches Entsetzen sie verbreiten können, sobald sie sich nur zeigen, begreift man erst, was eine echte Stinkdrüse besagen will. Alle Berichte von amerikanischen Reisenden und Naturforschern stimmen darin überein, daß wir nicht im Stande sind, die Wirkung der Drüsenabsonderung dieser Thiere uns gehörig ausmalen zu können. Keine Küche eines Scheidekünstlers, keine Senkgrube, kein Aasplatz, kurz, kein Gestank der Erde soll an Heftigkeit und Unleidlichkeit dem gleichkommen, welchen die äußerlich so zierlichen Stinkthiere zu verbreiten und auf Wochen und Monate hin einem Gegenstande einzuprägen vermögen. Man bezeichnet den Gestank mit dem Ausdruck »Pestgeruch«; denn wirklich wird Jemand, welcher das Unglück hatte, mit einem Stinkthiere in nähere Berührung zu kommen, von Jedermann gemieden, wie ein mit der Pest Behafteter. Die Stinkthiere sind trotz ihrer geringen Größe so gewaltige und mächtige Feinde des Menschen, daß sie Denjenigen, welchen sie mit ihrem furchtbaren Safte bespritzten, geradezu aus der Gesellschaft verbannen und ihm selbst eine Strafe auferlegen, welche so leicht von keiner anderen übertroffen werden dürfte. Sie sind fähig, ein ganzes Haus unbewohnbar zu machen oder ein mit den kostbarsten Stoffen gefülltes Vorrathsgewölbe zu entwerthen.
Die Stinkthiere, nach Ansicht Gray's eine besondere Unterfamilie bildend, unterscheiden sich von den Dachsen, ihren nächsten Verwandten, durch merklich schlankeren Leib, langen, dicht behaarten Schwanz, große aufgetriebene Nase, schwarze Grundfärbung und weiße Bandzeichnung. Der Kopf ist im Verhältnis zum Körper klein und zugespitzt, die Nase auffallend häßlich, kahl und dick, wie aufgeschwollen; die kleinen Augen haben durchdringende Schärfe; die Ohren sind kurz und abgerundet; die kurzen Beine haben mäßig große Pfoten, mit fünf wenig gespaltenen, fast ganz miteinander verwachsenen Zehen, welche ziemlich lange, aber keineswegs starke, schwach gekrümmte Nägel tragen, und mindestens auf den Ballen nackten Sohlen. Das Gebiß besteht, nach Burmeister, aus je sechs Schneidezähnen, deren untere innen durch eine Längsfurche gezeichnet werden, kräftigen, obschon nicht sehr langen Eckzähnen und oben vier, unten fünf Backenzähnen, oder oben und unten drei Lück-, oben einen und unten zwei Backenzähnen, wird also aus 34 Zähnen zusammengesetzt. Bei einer Untersippe fällt der erste obere Lückzahn aus, und das bleibende Gebiß enthält dann nur noch 32 Zähne. Der Fleischzahn des Oberkiefers ist kurz, aber breit, sein innerer Zacken stark, jedoch flach; der untere Fleischzahn hat vorn drei kleine spitze Zacken und hinten eine große, vertiefte, die halbe Krone einnehmende Kaufläche; der Kauzahn des Oberkiefers ist sehr stark, fast quadratisch, nur wenig breiter als lang, innen bogig gerundet; der untere Kauzahn stellt einen kleinen, kreisrunden und vertieften Höcker dar. Durch diese Eigenthümlichkeiten der Kauzähne läßt sich das Gebiß leicht und scharf von dem anderer Marder unterscheiden. Die Stinkdrüsen haben bedeutende Größe, öffnen sich innen in dem Mastdarme und können durch einen besonderen Muskel zusammengezogen werden. Jede Drüse stellt, laut Hensel, einen etwa haselnußgroßen Hohlraum vor, dessen Wand mit einer Drüsenschicht ausgekleidet und an der Außenseite mit einer starken Muskellage umgeben ist. Den Hohlraum füllt eine gelbe ölähnliche Flüssigkeit, welche von dem Thiere durch Zusammenpressen des Muskels mehrere Meter weit weggespritzt werden kann, unmittelbar hinter dem After einen dünnen, gelblichen Strahl bildet, bald in einen feinen Staubregen sich verwandelt, wie wenn Jemand Wasser aus dem Munde hervorsprudelt, und somit einen großen Raum bestreicht. Bei älteren Thieren und bei Männchen soll dieser fürchterliche Saft stärker als bei jungen und Weibchen sein, seine Wirkung auch während der Begattungszeit sich steigern.
Als eigentliche Waldthiere kann man die Stinkmarder nicht bezeichnen; sie ziehen steppenartige Gegenden, in Amerika das Camposgebiet, in Afrika die Steppen, dem Urwalde vor. Bei Tage liegen sie in hohlen Bäumen, in Felsspalten und in Erdhöhlen, welche sie sich selbst graben, versteckt und schlafen; nachts werden sie munter und springen und hüpfen höchst beweglich hin und her, um Beute zu machen. Ihre gewöhnliche Nahrung besteht in Würmern, Kerbthieren, Lurchen, Vögeln und Säugethieren; doch fressen sie auch Beeren und Wurzeln. Nur wenn sie gereizt werden oder sich verfolgt sehen und deshalb in Angst gerathen, gebrauchen sie ihre sinnbetäubende Drüsenabsonderung zur Abwehr gegen Feinde, und wirklich besitzen sie in ihrer stinkenden Flüssigkeit eine Waffe wie kein anderes Thier. Sie halten selbst die blutdürstigsten und raubgierigsten Katzen nöthigenfalls in der bescheidensten Entfernung, und nur in sehr scharfen Hunden, welche, nachdem sie bespritzt worden sind, gleichsam mit Todesverachtung sich auf sie stürzen, finden sie Gegner. Abgesehen von dem Pestgestanke, welchen sie zu verbreiten wissen, verursachen sie dem Menschen keinen erheblichen Schaden; ihre Drüsenabsonderung aber macht sie entschieden zu den von Allen am meisten gehaßten Thieren. Gegenwärtig unterliegt es keinem Zweifel mehr, daß die vielen Arten von Stinkthieren, welche man unterschieden hat, auf wenige zurückgeführt werden müssen, weil sich die außerordentliche Veränderlichkeit derselben zur Genüge herausgestellt hat. In der Lebensweise ähneln sich alle bekannten Arten, und es genügt daher vollständig, eine oder zwei von ihnen kennen zu lernen.
Den größten Theil Südamerikas bewohnt das Stinkthier, Surilho (Surilje) der Brasilianer ( Mephitis suffocans , M. nasuta, mesoleuca, marputio, Molinae, patagonica, chilensis, amazonica, furcata, Humboldtii und Lichtensteinii, Conepatus nasutus, Humboldtii und amazonicus, Thiosmus marputio und chilensis, Viverra murputio etc.), Vertreter einer besonderen Untersippe ( Thiosmus), dessen Gebiß aus 32 Zähnen besteht, ein Thier von 40 Centim. Leibes-, 28 Centim. Schwanzlänge und außerordentlich abändernder Färbung und Zeichnung. Das dichte, lange und reichliche, auf der Schnauze kurze, von hier allmählich länger werdende, an den Seiten drei, auf dem Rücken vier, am Schwanze sieben Centimeter lange Haar spielt, laut Hensel, vom Schwarzgrau und Schwarzbraun bis zum glänzenden Schwarz. Die weißen Streifen beginnen an der Stirn und laufen getrennt in etwa Fingersbreite bis zur Schwanzwurzel; zuweilen verbreitern sie sich, sodaß der Zwischenraum fast ganz verloren geht, und verschwinden schon in der Gegend der letzten Rippen; in seltneren Fällen fehlen sie ganz, und das Thier sieht einfarbig schwarz aus. Der Schwanz ist meist an der Spitze weiß, oder die schwarzen und weißen Haare mischen sich so durcheinander, daß er grau erscheint; zuweilen, namentlich wenn die weißen Streifen des Rückens wenig entwickelt sind, ist er ebenfalls rein schwarz. Hensel versichert, daß man kaum zwei Surilhos finde, welche vollkommen übereinstimmen. Unsere treffliche, nach Meister Wolf gezeichnete Abbildung überhebt mich einer weiteren Beschreibung.
»In der Lebensweise«, sagt Hensel, »unterscheidet sich der Surilho nicht wesentlich von den Mardern. Er lebt in den Camposgegenden des Tieflandes und der Serra und vermeidet durchaus den dichten Urwald; doch ist er immer an den Wald gebunden, denn er findet sich bloß in vereinzelten Waldstellen der Campos. Hier erkennt man seine Anwesenheit sehr leicht an kleinen trichterförmigen Löchern, welche er nahe am Waldrande in dem Grasboden macht, um Mistkäfer zu suchen. Diese Löcher gleichen denen des Dachses, wenn er »sticht«, wie der Jäger sagt; nur sind sie weiter als diese, werden aber ohne Zweifel, wie auch vom Dachse, mit seinen Vorderpfoten, nicht mit der Nase gemacht.
»Den Tag über ruhen die Stinkthiere wie der Iltis in unterirdischen Bauen unter Felsstücken oder Baumwurzeln. Mit der Dämmerung aber gehen sie ihrer Nahrung nach, welche bloß in Mistkäfern zu bestehen scheint; wenigstens habe ich niemals etwas anderes in ihrem Magen gefunden.«
Im Norden Amerikas vertritt den Surilho die Chinga ( Mephitis varians , M. macroura, vittata, mesomelas, occidentalis, mephitica, chinga, americana, hudsonica, mexicana, Viverra mephitis etc.), Vertreter der Untersippe Mephitis, deren Gebiß aus 34 Zähnen besteht. Die Leibeslänge beträgt 40 Centim., die Schwanzlänge beinahe ebensoviel. Der glänzende Pelz hat Schwarz zur Grundfarbe. Von der Nase zieht sich ein einfacher, schmaler, weißer Streifen zwischen den Augen hindurch, erweitert sich auf der Stirne zu einem rautenförmigen Flecken, verbreitert sich noch mehr auf dem Halse und geht endlich in eine Binde über, welche sich am Widerriste in zwei breite Streifen theilt, die bis zu dem Schwanzende fortlaufen und dort sich wieder vereinigen. Am Halse, an der Schultergegend, an der Außenseite der Beine, seltener auch an der Brust und am Bauche treten kleine, weiße Flecken hervor. Ueber den Schwanz ziehen sich entweder zwei breite, weiße Längsstreifen, oder er erscheint unregelmäßig aus Schwarz und Weiß gemischt.

Stinkthier oder Surilho ( Mephitis suffocans). ⅙ natürl. Größe (Nach Wolf.)
Die Chinga ist wegen der rücksichtslosen Beleidigung eines unserer empfindlichsten Sinneswerkzeuge schon seit langer Zeit wohl bekannt geworden und macht noch heutzutage fast in allen Reisebeschreibungen von sich reden. Ihr Verbreitungskreis ist ziemlich ausgedehnt; am häufigsten wird sie in der Nähe der Hudsonsbai gefunden, von wo aus sie sich nach dem Süden hin verbreitet. Ihre Aufenthaltsorte sind höher gelegene Gegenden, namentlich Gehölze und Wälder längs der Flußufer, oder auch Felsengegenden, in deren Spalten und Höhlen sie wohnt.
Der Erste, welcher eine ausführliche Beschreibung des Stinkthieres gibt, ist Kalm. »Das Thier«, sagt er, »ist wegen seiner besonderen Eigenschaft bekannt. Wird es von Hunden oder Menschen gejagt, so läuft es anfangs so schnell, als es kann, oder klettert aus einen Baum; findet es keinen Ausweg mehr, so wendet es noch ein Mittel an, welches ihm übrig ist: es spritzt seinen Feinden seinen Harn entgegen, und zwar auf große Entfernung. Einige Leute haben mir erzählt, daß ihnen von diesem schändlichen Safte das Gesicht ganz bespritzt worden wäre, obwohl sie noch gegen achtzehn Fuß davon entfernt gewesen seien. Diese Feuchtigkeit hat einen so unerträglichen Gestank, daß kein schlimmerer gedacht werden kann. Ist Jemand dem Thiere zur Zeit des Ausspritzens nahe, so kann er wohl kaum Athem holen, und es ist ihm später zu Muthe, als wenn er ersticken sollte. Ja, kommt dieser Pestsaft in die Augen, so läuft man Gefahr, das Gesicht zu verlieren, und aus Kleidern ist der Geruch fast gar nicht wieder herauszubringen, man mag sie waschen, so oft man will. Viele Hunde laufen davon, sobald sie der Guß trifft; richtige Fänger hören aber nicht eher auf, dem Flüchtigen nachzusetzen, als bis sie ihn todt gebissen haben. Sie reiben jedoch ihre Schnauze auf der Erde, um den Gestank einigermaßen zu vertreiben.
»Der widrige Geruch geht selten vor einem Monate aus den Kleidern; doch verlieren sie das meiste davon, wenn man sie vierundzwanzig Stunden lang mit Erde bedeckt. Auch die Hand und das Gesicht muß man wenigstens eine Stunde mit Erde reiben, weil das Waschen nichts hilft. Als ein angesehener Mann, welcher unvermuthet gespritzt wurde, sich in einem Hause waschen wollte, schloß man die Thüre, und die Leute liefen davon. Bespritzte Hunde läßt man Tage lang in kein Haus. Wenn man in einem Walde reiset, muß man sich oft lange Zeit die Nase zuhalten, falls das Thier an einer Stelle seinen Pestgeruch verbreitet hat. Ich schlief einmal auf einem Hofe, wo ein Lamm getödtet lag, und es schlich sich solch ein Thier heran; der Hund sah und verjagte es. Da entstand plötzlich ein solcher Gestank, daß ich glaubte, ersticken zu müssen; sogar die Kühe blökten aus vollem Halse. Die Köchin bemerkte, daß verschiedene Tage nacheinander das Fleisch im Keller benascht worden war; sie versperrte deshalb alle Abgänge, um die Katzen abzuhalten. Allein in der folgenden Nacht hörte sie einen Lärm in dem Keller und ging hinab. Da sah sie ein Thier mit feurigen Augen, welches sie ganz ruhig zu erwarten schien. Sie faßte sich jedoch ein Herz und schlug es todt. Plötzlich aber entstand solch ein abscheulicher Gestank, daß sie einige Tage krank wurde und man alle Eßwaaren im Keller sammt Brod und Fleisch wegwerfen mußte.«
Das Stinkthier ist sich seiner furchtbaren Waffe so wohl bewußt, daß es keineswegs scheu oder feig ist. Alle seine Bewegungen sind langsam. Es kann weder springen, noch klettern, sondern nur gehen und hüpfen. Beim Gehen tritt es fast mit der ganzen Sohle auf, wölbt den Rücken und trägt den Schwanz nach abwärts gerichtet. Ab und zu wühlt es in der Erde oder schnüffelt nach irgend etwas genießbarem herum. Trifft man nun zufällig auf das Thier, so bleibt es ruhig stehen, hebt den Schwanz auf, dreht sich herum und spritzt nötigenfalls den Saft gerade von sich. Wenn die Hunde es stellen, legt es, laut Hensel, den Schwanz wie ein sitzendes Eichhörnchen über den Rücken, kehrt das Hintertheil den andrängenden Rüden entgegen und führt zornig sonderbare, hüpfende Bewegungen aus, wie man sie zuweilen in den Käfigen von Bären sieht. Die Hunde kennen die gefährliche Waffe ihres Gegners sehr gut und halten sich meist in achtungsvoller Entfernung. Nur wenige von ihnen haben den Muth, das Stinkthier zu greifen und zu tödten: unter Hensels Hunden war ein einziger, welcher jeden Surilho, und zwar ohne Rücksicht auf die Lage, in welcher er sich befand, zu packen wagte, während alle anderen erst zugriffen, wenn der Feind todt war. Niemals verschießt das angegriffene Thier seinen Pestsaft voreilig, sondern drohet bloß, so lange die Hunde einige Schritte sich entfernt halten; rückt ihm aber einer derselben zu nahe auf den Leib, dann stülpt es den weiten, ringsum haarlosen After so um, daß die Mündungen der beiden Stinkdrüsen zum Vorscheine kommen, und spritzt den Inhalt derselben auf den Feind.
Zuweilen greift das Stinkthier an, ohne daß es irgendwie gereizt wurde, vielleicht weil es meint, in Gefahr zu kommen, möglicherweise aber auch aus reinem Uebermuthe. »Als mein Sohn«, so erzählt Siedhof, »eines Abends langsam im Freien umherging, kam plötzlich ein Stinkthier auf ihn los und biß sich in seinen Beinkleidern fest. Er schüttelte es mit Mühe ab und tödtete es durch einen Fußtritt. Als er aber nach Hause kam, verbreitete sich von seinen durch das gefährliche Thier benetzten Kleidern ein so durchdringender, abscheulicher Knoblauchsgeruch, daß augenblicklich das ganze Haus erfüllt wurde, die befreundeten Familien, welche gerade zu Besuch anwesend waren, sofort davonliefen und die Einwohner, welche nicht flüchten konnten, sich erbrechen mußten. Alles Räuchern und Lüften half nichts; selbst nach einem Monate war der Geruch noch zu spüren. Die Stiefel rochen, so oft sie warm wurden, noch vier Monate lang, trotzdem sie in den Rauch gehängt und mit Chlorwasser gewaschen wurden. Das Unglück hatte sich im December ereignet; das Thier war im Garten vergraben worden: aber noch im nächsten August konnte man seine Ruhestätte durch den Geruch auffinden.«
Auch Audubon erfuhr die Furchtbarkeit des Stinkthieres an sich selbst. »Dieses kleine, niedliche, ganz unschuldig aussehende Thierchen«, sagt er, »ist doch im Stande, jeden Prahlhans auf den ersten Schuß in die Flucht zu schlagen, so daß er mit Jammergeschrei Reißaus nimmt. Ich selbst habe einmal, als kleiner Schulknabe, solch Unglück erlitten. Die Sonne war eben untergegangen. Ich ging mit einigen Freunden langsam meinen Weg. Da sahen wir ein allerliebstes, uns ganz unbekanntes Thierchen, welches gemüthlich umherschlich, dann stehen blieb und uns ansah, als warte es, wie ein alter Freund, um uns Gesellschaft zu leisten. Das Ding sah gar zu unschuldig und verführerisch aus, und es hielt seinen buschigen Schwanz hoch empor, als wolle es, daran gefaßt, und in unseren Armen nach Hause getragen sein. Ich war ganz entzückt, griff voller Seligkeit zu – und patsch! da schoß das Höllenvieh seinen Teufelssaft mir in die Nase, in den Mund, in die Augen. Wie vom Donner gerührt, ließ ich das Ungeheuer fallen und nahm in Todesangst Reißaus.«
Fröbel hörte einmal ein Geräusch hinter sich und bemerkte, als er sich umwandte, das ihm unbekannte Stinkthier, welches, als er sich nach ihm hinkehrte, augenblicklich zu knurren begann, mit dem Fuße stampfte und, sobald er seinen Stock ergriff, ihm Kleider, Gesicht und Haare mit seiner entsetzlichen Flüssigkeit bespritzte. Voller Wuth schlug er das Thier todt, eilte über den Platz und wollte dem Hause zu, verursachte aber allgemeine Furcht. Die Thür wurde verrammelt, und nur aus dem Fenster rief man ihm guten Rath zu. Wasser, Seife, kölnisches Wasser half nichts; endlich wurde ein kräftiges Feuer angebrannt, und der arme, verstänkerte Reisende legte die ihm von einem Ansiedler geborgten Kleider an und räucherte die bespritzten, nebst Gesicht und Haar, im dichten Qualm einige Stunden lang, worauf dann wirklich der Geruch verschwand.
Ein an einem Zaune dahinlaufendes Stinkthier wurde durch eine vorbeifahrende Kutsche erschreckt, versuchte zu fliehen, kam aber nicht gleich durch den Zaun und spritzte jetzt seinen Saft gegen die Kutsche, an welcher unglücklicherweise die Fenster offen standen. Die volle Ladung drang in das Innere und dort verbreitete sich dann augenblicklich ein so fürchterlicher Gestank, daß mehrere von den mitfahrenden Damen sofort in Ohnmacht fielen.
Die in Südamerika lebenden Stinkthiere unterscheiden sich, was die Güte ihres Pestsaftes anlangt, durchaus nicht von den nordamerikanischen. Azara fand einen Surilho in Paraguay, wo er Yaguaré, zu deutsch »stinkender Hund« genannt wird, und berichtet, daß er im Freien von Kerfen, Eiern und Vögeln lebt, und sowohl bei Tage als bei Nacht still umherschleicht. Er ergreift niemals die Flucht, nicht einmal vor dem Menschen. Sobald er bemerkt, daß man ihm nachstellt, macht er Halt, sträubt sein Haar, hebt den Schwanz in die Höhe, wartet, bis man nahe gekommen ist, dreht sich plötzlich um und schießt los. Selbst der Jaguar soll augenblicklich zurückweichen, wenn er eine gehörige Ladung von dem teuflischen Gestank bekommt, und vor Menschen und Hunden ist das Thier fast gänzlich gesichert. Selbst nach zwanzigmaligem Waschen bleibt der Gestank noch so stark, daß er das ganze Haus erfüllt. Ein Hund, welcher acht Tage vorher bespritzt und mehr als zwanzigmal gewaschen und noch öfter mit Sand gerieben worden war, verpestete eine Hütte noch derartig, daß man es nicht in ihr aushalten konnte. Azara glaubt, daß man den Gestank wohl eine halbe englische Meile weit riechen könne.
»Der Geruch des Pestsaftes«, sagt Hensel von dem Surilho, »ist ein überaus heftiger und durchdringender; doch hat man seine Stärke mitunter übertrieben, denn er ist nicht unbedingt unerträglich. Manche Personen bekommen allerdings Kopfweh und Erbrechen, wenn das Stinkthier in ihrer Nähe seine Afterdrüsen ausleert; der Thierkundige aber wird sich schwerlich dadurch abhalten lassen, die beachtenswerthen Thiere zu jagen und zu sammeln. Hunde, welche von dem Safte getroffen werden, scharren den Boden auf und wälzen sich wie rasend auf demselben umher, um den an ihrem Pelze haftenden Geruch zu entfernen. Den ersten Surilho, den ich erhielt, tödtete mein Diener in einer mondhellen Nacht, ohne ihn zu kennen; dabei waren seine Wasserstiefeln etwas bespritzt worden. Der Geruch haftete noch wochenlang an denselben, ungeachtet sie immer getragen und oft gewaschen wurden. Nach etwa sechs Wochen besuchte der Mann einen Bekannten und traf bei diesem viel Gesellschaft. Während der allgemeinen Unterhaltung schnüffelte einer der Anwesenden unter dem Tische und theilte dem Hausherrn die unliebsame Entdeckung mit, es müsse ein Surilho unter den Dielen des Hauses seine Wohnung aufgeschlagen haben. Alle überzeugten sich von der Richtigkeit seiner Wahrnehmung und beschlossen, sogleich eine Jagd auf den gefährlichen Störenfried zu machen. Mein Diener aber verabschiedete sich unter einem Vorwande in Eile und ritt heim.
»Ein hier geborener Deutscher, welcher aber zufälligerweise niemals Gelegenheit gehabt hatte, das Stinkthier kennen zu lernen, sah einst ein solches bei einem Ritte in der Dämmerung, hielt es für einen jungen Fuchs und stieg vom Pferde, um es seiner Zahmheit wegen zu fangen. Das Thier ließ sich auch ruhig greifen; in demselben Augenblicke aber, als der Mann es mit den Händen erfaßte und aufhob, spritzte es ihm den ganzen Inhalt seiner Stinkdrüsen auf die Brust und traf Hemd und Weste. Eiligst ließ der Erschreckte das gefährliche Geschöpf fallen, warf sich aufs Pferd und ritt im vollsten Jagen dahin, um durch den Luftzug die Einwirkung des Pestsaftes auf seine Geruchswerkzeuge etwas zu mildern. Gleichwohl konnte er es nicht aushalten und mußte während des schnellsten Reitens der Kleider des Oberkörpers sich so viel als möglich entledigen, so daß er halb nackt zu Hause ankam.
»Ganz besonders haftet der Pestgeruch an Tuchkleidern, welche man in den Rauch zu hängen pflegt, um sie wieder zu reinigen. Wahrscheinlich wirkt dabei nicht der Rauch, sondern die Hitze des Feuers, durch welche der flüssige Stoff verdunstet.
»Der Geruch des Drüsensaftes eines Stinkthieres ist, wie jede Sinneswahrnehmung, nicht zu beschreiben; allein man kann sich ihn vorstellen als einen Iltisgestank in vielfacher Verstärkung. Ungereizt riecht das Thier durchaus nicht.«
Ungeachtet des abscheulichen Geruches ist das Stinkthier doch nützlich. Aus seinem Pelze machen sich die Indianer weiche und schöne Decken, welche man trägt, obgleich sie sehr schlecht riechen. Um es zu fangen, gebrauchen dieselben eine eigene List. Sie nähern sich ihm mit einer langen Gerte und reizen es damit, bis es wiederholt seine Drüsen entleert hat; hierauf springen sie plötzlich zu und heben es beim Schwanze empor. In dieser Lage soll es dann nicht weiter spritzen können und somit gefahrlos sein. Ein einziger Schlag auf die Nase tödtet es augenblicklich. Dann werden die Drüsen ausgeschnitten und die Indianer essen das Fleisch ohne Umstände. Aber auch Europäer nützen das Thier, und zwar das allerfürchterlichste von ihm, nämlich die stinkende Flüssigkeit selbst. Sie wird in derselben Weise gebraucht, wie unsere Damen wohlriechende Wasser anwenden, als nervenstärkendes Mittel. Aber da der Aberglaube in Amerika noch etwas stärker ist als bei uns in Deutschland, so glaubt man, wunder welch ein vortreffliches Mittel erhalten zu haben, wenn man stinkende Flüssigkeit sich vor die Nase hält. Daß dabei Unannehmlichkeiten
mancherlei Art vorkommen können, zumal in Gesellschaft, ist leicht zu erklären. So erzählt man, daß ein Geistlicher einmal während der Predigt sein Fläschchen herausgezogen habe, um seine Nerven zu stärken, die Riechwerkzeuge seiner andächtigen Zuhörer dabei aber dergestalt erregte, daß die gesammte Versammlung augenblicklich aus der Kirche hinausstürmte, gleichsam als wäre der Teufel, welchen der würdige »Diener am Worte« mit ebensoviel Achtung als Liebe vorher behandelt hatte, leibhaftig zwischen den frommen Schafen erschienen, und zwar mit vollem Pomp und allen höllischen Wohlgerüchen, welche ihm als Fürsten der Unterwelt zukommen.
Es ist noch nicht ausgemacht, ob die Stinkthiere auch einander anspritzen, und es wäre jedenfalls wichtig, dies genau zu erfahren. Freilich finden wir, daß die Gerüche, welche ein Thier verbreitet, ihm gewöhnlich durchaus nicht lästig fallen, ja sogar gewissermaßen wohlriechend erscheinen: demungeachtet wäre es doch möglich, daß ein Stinkthiermännchen durch eine gehörige Ladung Pestsaft von einem spröden Weibchen hinlänglich abgeschreckt werden könnte.
In der Gefangenschaft entleeren die Stinkthiere ihre Drüsen nicht, falls man sich sorgfältig hütet, sie zu reizen. Sie werden nach kurzer Zeit sehr zahm und gewöhnen sich einigermaßen an ihren Pfleger, obgleich sie anfangs mit dem Hintertheile vorangehen, den Schwanz in die Höhe gerichtet, um ihr Geschütz zum Losschießen bereit zu halten. Nur durch Schlagen oder sehr starke Beängstigung sollen sie veranlaßt werden, von ihrem Vertheidigungsmittel Gebrauch zu machen. Einzelne lassen sich, wie ihre Pfleger versichern, ohne alle Fährlichkeit behandeln. Heu ist ihr liebstes Lager. Sie bereiten sich ein ordentliches Bettchen und rollen sich dann wie eine Kugel zusammen. Nach dem Fressen putzen sie sich die Schnauze mit den Vorderfüßen; denn sie sind reinlich und halten sich stets zierlich und glatt, legen auch ihren Unrath niemals in ihrem Lager ab. Man füttert sie mit Fleisch; am liebsten fressen sie Vögel. Sie verzehren oft mehr, als sie verdauen können, und erbrechen sich dann gewöhnlich nach einer solchen Ueberladung. Ihre Gier ist aber immer noch so groß, daß sie das Erbrochene wieder auffressen, wie es die Hunde auch thun. Bei reichlicher Nahrung schlafen sie den ganzen Tag und gehen erst des Abends herum, selbst wenn sie keinen Hunger haben.
Vertreter der Stinkthiere in Afrika sind die Bandiltisse, jenen in Gestalt und Ansehen sehr nahe verwandte Thiere mit behaarten Sohlen und eher marder- als stinkthierähnlichem, aus 34 Zähnen bestehendem Gebisse. Der innere Höckeransatz des länglichen Fleischzahnes richtet sich nach vorn. Die Wurzeln der niederen Kegelzacken der Lückzähne zeichnen sich durch ihre Dicke aus. Im Gerippe erscheinen die Bandiltisse als Mittelglieder zwischen Mardern und Stinkthieren; in ihrer Lebensweise scheinen sie mehr den ersteren als den letzteren zu ähneln.
Die einzige sicher bestimmte Art der Sippe ist die Zorilla, der »Maushund« der Ansiedler des Vorgebirges der guten Hoffnung ( Rhabdogale mustelina , Viverra, Mustela und Putorius Zorilla, Viverra und Zorilla striata, Zorilla capensis und leucomelas, Ictonyx capensis etc.), ein Thier von 35 Centim. Leibes- und 25 Centim. Schwanzlänge. Der Leib ist lang, jedoch nicht sehr schlank, der Kopf breit, die Schnauze rüsselförmig verlängert; die Ohren sind kurz zugerundet, die Augen mittelgroß, mit längs gespaltenem Stern; die Beine sind kurz und die Vorderfüße mit starken, ziemlich langen, aber stumpfen Krallen bewehrt; der Schwanz ist ziemlich lang und buschig, der ganze Pelz dicht und lang. Seine Grundfärbung, ein glänzendes Schwarz, wird gezeichnet durch mehrere weiße Flecken und Streifen, welche mehr oder weniger abändern. Zwischen den Augen befindet sich ein schmaler, weißer Flecken, ein anderer zieht sich von den Augen nach den Ohren hin; beide fließen zuweilen zusammen und bilden auf der Stirne ein einziges weißes Band, welches nach der Schnauze zu in eine Schneppe ausläuft. Auch die Lippen sind häufig weißgesäumt. Der obere Theil des Körpers ist sehr verschieden, immer aber nach einem gewissen Plane gezeichnet. Bei den einen zieht sich über das Hinterhaupt eine breite, weiße Querbinde, aus welcher vier Längsbinden entspringen, die über den Rücken verlaufen, sich in der Mitte des Leibes verbreitern und durch drei schwarze Zwischenstreifen getrennt werden; die beiden äußeren Seitenbinden vereinigen sich auf der Schwanzwurzel und setzen sich dann auf dem Schwanze jederseits als weißer Streifen fort. Bei anderen ist der ganze Hinterkopf und Nacken, ja selbst ein Theil des oberen Rückens weiß, und dann entspringen erst am Widerrist die drei dunklen Binden, welche sich nun seitlich am Schwanze noch fortsetzen. Letzterer ist bald gefleckt und bald längs gestreift.
Der Bandiltis verbreitet sich über ganz Afrika, geht auch noch über die Landenge von Suez weg, findet sich in Kleinasien, soll sogar in der Nähe von Konstantinopel, selbstverständlich nur auf der asiatischen Seite, vorkommen. Felsige Gegenden bilden seinen Lieblingsaufenthalt. Hier lebt er entweder im Geklüfte oder in selbstgegrabenen Löchern unter Bäumen und Gebüschen. Seine Lebensweise ist eine rein nächtliche, und daher kommt es, daß er im ganzen doch nur selten gesehen wird. Ich z. B. habe während meines Aufenthaltes in Afrika viel von dem » Vater des Gestankes« reden hören, denselben aber niemals zu Gesicht bekommen. Die Berichte, welche ich erhielt, stimmen im wesentlichen vollkommen mit der Beschreibung überein, welche Kolbe gegeben hat. Dieser ist der erste, welcher unser Thier erwähnt. Es heißt bei den holländischen Ansiedlern am Kap der guten Hoffnung » Stinkbinkfem« oder » Maushund« und macht beiden Bezeichnungen durch die That volle Ehre. Seine Nahrung besteht in kleinen Säugethieren, namentlich in Mäusen, kleinen Vögeln und deren Eiern, in Lurchen und Kerbthieren. Dem Hausgeflügel wird er nicht selten gefährlich, weil er nach Marderart in die Bauernhöfe einschleicht und wie ein Iltis mordet.
In seinen Bewegungen ähnelt er den Mardern nicht; denn er ist weniger behend und kann eher träge genannt werden. Das Klettern versteht er nicht, und auch vor dem Wasser hat er große Scheu, obwohl er, wenn es sein muß, recht fertig schwimmt. Seiner abscheulichen Waffen bedient er sich ganz in derselben Weise wie das Stinkthier. »Befindet er sich auf einem Felde oder einer Wiese«, sagt Kolbe, »und bemerkt er, daß sich ihm ein Hund oder ein wildes Thier nähert, welches ihn umbringen will, so spritzt er seinen Feinden einen so pestartigen Gestank entgegen, daß sie genug zu thun haben, die Nase an der Erde und den Bäumen abzureiben, um den Gestank nur einigermaßen wieder loszuwerden. Nähert sich ihm der Feind wieder oder kommt wohl noch ein zweiter hinzu, so schießt er zum zweiten Male auf die Gegner und gibt wieder einen Gestank von sich, welcher durchaus nicht besser ist als der erste. Auf diese Weise vertheidigt er sich sehr tapfer gegen seine Widersacher. Nimmt ein Jäger einen erschossenen Bandiltis in die Hand, so hängt sich ein solcher Gestank an dieselbe, daß er ihn nicht los wird, selbst wenn er sich mit Seife wäscht. Daher läßt man ihn liegen, wenn man ihn geschossen hat. Denn wer nur einmal etwas von diesem Gestanke bekommen hat, wird ihm gewiß ein ander Mal von selbst aus dem Wege gehen und ihn ungehindert sein Wesen treiben lassen.«
Wie bei den Stinkthieren, sind auch bei der Zorilla hauptsächlich die Männchen die Stänker, und zwar ganz besonders in der Paarungszeit, wahrscheinlich weil dann ihr ganzes Wesen außerordentlich erregt ist. Möglich ist es auch, daß das Weibchen die Düfte, welche uns entsetzlich vorkommen, ganz angenehm findet.
Ueber die Fortpflanzung unserer Thiere weiß man nichts sicheres. Dagegen ist es bekannt, daß die Zorilla am Vorgebirge der guten Hoffnung von einigen holländischen Ansiedlern in ihren Häusern gehalten wird, um Ratten und Mäuse zu vertilgen. Man sagt, daß sie niemals einen höheren Grad von Zähmung erreiche, sondern immer stumpfsinnig und gleichgültig gegen Liebkosungen und gute Behandlung bleibe. Die vielen Namen, welche der Bandiltis außer dem genannten trägt, bezeichnen ihn in allen Sprachen als einen Stänker.
Unserem Grimmbart zu Ehren nennen wir die letzte Abtheilung oder Unterfamilie der Marder Dachse ( Melina ) und vereinigen in ihr die plumpesten, gedrungensten Gestalten der ganzen Familie, wenn man will, die Uebergangsglieder zwischen Mardern und Bären. Sie kennzeichnen der kleine, hinten breite, an der Schnauze meist rüsselförmig zugespitzte Kopf, kleine und tiefliegende Augen und mehr oder minder kurze, längliche Ohren, der dicke Hals, die kurzen, fünfzehigen, nacktsohligen, mit ziemlich langen Scharrkrallen bewehrten Füße, der etwa kopflange oder kürzere Schwanz sowie endlich ein aus kurzen, straffen Haaren bestehendes Fell, in welchem oben Grau, unten Schwarz als Hauptfärbung vorzuherrschen pflegen. Das Gebiß besteht aus 32 bis 38 Zähnen, und zwar regelmäßig sechs Schneidezähnen und einem Eckzahne oben und unten, drei Lückzähnen oben, vier unten, von denen jedoch einer in jedem Kiefer und oben selbst zwei ausfallen können, und zwei Backenzähnen in jedem Kiefer. Schädel und übriges Gerippe sind entsprechend der äußeren Leibesgestalt verhältnismäßig kräftig. Eine Drüsentasche neben dem After, welche bei einzelnen Arten ebenfalls Pestgerüche absondert, fehlt auch den Dachsen nicht.
Die erste Sippe wird gebildet durch die Honigdachse ( Mellivora ), die breitrückigsten, kurzschnauzigsten und kurzschwänzigsten Glieder der Unterfamilie, von den übrigen hauptsächlich unterschieden durch das Gebiß, welches nur aus 32 Zähnen und zwar der regelmäßigen Anzahl von Schneide- und Eck-, aber nur drei Lück- und je einem Backenzahne in jedem Kiefer besteht, und dessen oberer Höckerzahn quer bandförmig ist, während der untere gänzlich fehlt. Der Leib ist plumper als der unseres Dachses und seiner nächsten Verwandten, erscheint auch von oben nach unten abgeplattet, der Rücken ist breit und flach, die Schnauze lang, die kleinen Ohren treten mit ihren Muscheln wenig über das Fell hervor, die Augen sind klein und tiefliegend, die Beine kurz und stark, nacktsohlig und die Zehen der Vorderfüße mit langen Scharrkrallen versehen.
Man hat gegenwärtig drei Arten der Sippe unterschieden; wir beschreiben jedoch aller Lebensweise, wenn wir die der bekanntesten am Vorgebirge der guten Hoffnung und in Mittelafrika lebenden Art schildern.
Der Honigdachs oder Ratel ( Mellivora capensis, Gulo, Mustela, Viverra und Ratelus capensis, Ursus, Taxus, Meles, Viverra und Lipotus mellivora, Ratelus typicus) erreicht ausgewachsen eine Länge von reichlich 70 Centim., wovon auf den verhältnismäßig sehr langen Schwanz etwa 25 Centim. zu rechnen sind. Die Behaarung ist lang und straff; Stirne, Hinterkopf, Nacken, Rücken, Schultern und Schwanz sind aschgrau, Schnauze, Wangen, Ohren, Unterhals, Brust, Bauch und Beine schwarzgrau gefärbt, scharf von der oberen Färbung abgegrenzt. Gewöhnlich trennt ein hellgrauer Randstreifen die Rückenfärbung von der unteren, und dieser Streifen ist es hauptsächlich, welcher den afrikanischen Honigdachs von dem indischen unterscheidet.
Der Ratel lebt in selbstgegrabenen Höhlen unter der Erde und besitzt eine unglaubliche Fertigkeit, solche auszuscharren. Träge, langsam und ungeschickt, wie er ist, würde er seinen Feinden kaum entgehen können, wenn er nicht die Kunst verstände, sich förmlich in die Erde zu versenken, d. h. sich so rasch eine Höhle zu graben, daß er sich unter der Erdoberfläche verborgen hat, ehe ein ihm auf den Leib rückender Widersacher nahe genug gekommen ist, um ihn zu ergreifen. Er führt eine nächtliche Lebensweise und geht des Tages nur selten auf Raub aus. Auf unserem Jagdausfluge nach den Bogosländern wurde er zweimal gesehen, jedesmal gegen Abend, jedoch ehe die Sonne niedergegangen war. Nachts dagegen streift er langsam und gemächlich umher und stellt kleinen Säugethieren, namentlich Mäusen, Springmäusen und dergleichen, oder Vögeln, Schildkröten, Schnecken und Würmern nach, gräbt sich Wurzeln oder Knollengewächse aus oder sucht Früchte. Eine Liebhaberei bestimmt seine ganze Lebensweise: er ist nämlich ein leidenschaftlicher Freund von Honig, und aus diesem Grunde der eifrigsten Bienenjäger einer.
In Afrika bauen die Bienenarten hauptsächlich in die Erde und zwar in verlassenen Höhlen aller Art, wie es bei den Hummeln und Wespen ja auch der Fall ist. Solche Nester sind nun für den Honigdachs das erwünschteste, was er finden kann, und er macht sich, wenn er einen derartigen Schatz entdeckt hat, mit unverhehlter Freude darüber her. Die Bienen wehren sich zwar nach Kräften und suchen ihn mit ihrem Stachel bestmöglichst zu verwunden; sein dicht behaartes, sehr starkes Fell aber ist gegen Bienenstiche das vorzüglichste Schild, welches es gibt, weil es auf der Fettschicht unter ihm locker aufliegt wie kaum bei einem anderen Thiere. Man versichert, daß sich der Ratel förmlich in seinem Balge herumdrehen könne. Die Bienen sind vollkommen ohnmächtig solchem Feinde gegenüber, und dieser wühlt nun mit Lust in ihren Wohnungen umher und labt sich nach Behagen an dem köstlichen Inhalte derselben. Sparmann berichtet über die Art und Weise der Jagden unserer Honigdachse ergötzliche Dinge, von denen weiter nichts zu bedauern ist, als daß sie bloß auf Erzählung der Hottentotten und holländischen Ansiedler gegründet und nicht wahr sind.

Honigdachs ( Mellivora capensis). ⅙[???] natürl. Größe.
»Die Bienen«, sagt jener Reisende, »geben dem Honigdachse, wenn auch nicht die einzige, so doch die hauptsächlichste Nahrung, und ihr Feind ist mit großer Schlauheit begabt, die unterirdischen Nester aufzuspüren. Gegen Sonnenuntergang verläßt er seine Höhle, in welcher er den Tag verträumte, und schleicht umher, um seine Beute von fern zu beobachten, wie das der Löwe auch thut. Er setzt sich auf einen Hügel hin, schützt seine Augen durch eine vorgehaltene Vorderpfote vor den Strahlen der tiefstehenden Sonne und paßt sorgfältig den Bienen auf. Bemerkt er nun, daß einige immer in derselben Richtung hinfliegen, so humpelt er denselben gemächlich nach, beobachtet sie, und wird so allmählich bis zu ihrem Neste geleitet, in welchem nun ein gegenseitiger Kampf auf Leben und Tod stattfindet. Es wird erzählt, daß der Ratel ebensowohl wie der Eingeborene Südafrikas zuweilen auf der Suche nach Honig von einem Vogel, dem Honigangeber, geleitet werde, welcher Klugheit genug besitzt, um zu wissen, daß Menschen und Thiere nach jenem Leckergerichte verlangen. Der kleine Bursche, unfähig, eine Bienenfestung durch eigene Macht zu erobern, sucht seinen Vortheil darin, aufgefundene Bienenstöcke anderen, stärkeren Wesen anzuzeigen, um dann bei der Räumung des Nestes mitzuschmausen. Zu diesem Zwecke erregt er durch sein Geschrei die Aufmerksamkeit der Honigliebhaber und fliegt in kurzen Absätzen gemächlich vor ihnen hin, von Zeit zu Zeit sich niederlassend, wenn der schwerleibige Bodenbewohner ihm nicht so schnell folgen kann, und dann von neuem seine Führerschaft aufnehmend. In der Nähe eines Bienennestes angekommen, läßt er seine Stimme um so freundlicher vernehmen und zeigt endlich geradezu auf den niedergelegten Schatz. Während dieser erhoben wird, bleibt er ruhig in der Nähe und wartet, bis der habgierige Mensch oder Ratel genug hat, um dann seinen Antheil für den geleisteten Dienst sich zu holen.
»Bei solchen Angriffen auf einen wüthenden Schwarm von Bienen leistet dem Ratel die Dicke seines Felles vortreffliche Dienste, und es ist nicht bloß erwiesen, daß es den Bienen undurchdringlich ist, sondern auch wohl bekannt bei allen Jägern, daß Hunde nicht im Stande sind, das verhältnismäßig schwache, nichtssagende Thier zu bezwingen.«
Der Ratel stellt übrigens nicht bloß dem Honig nach, sondern liebt auch kräftigere Nahrung. Carmichael sagt, daß er von den Besitzern der Hühnerhöfe als eines der schädlichsten Thiere betrachtet werde. In der Algoabai zankten sich einmal die Bauern um das Eigenthum der Eier, welche die Hühner verlegt hatten. Der Ratel machte in einer Nacht diesem Streite ein Ende, indem er einfach allen Hühnern, gegen dreißig Stück, den Kragen abbiß und drei todte in seine Höhle schleppte.
Man versichert, daß der Honigdachs mit zwei oder drei Weibchen lebe und diese niemals aus den Augen lasse. Zur Rollzeit soll er wild und wüthend sein, selbst Menschen anfallen und mit seinen Bissen sie schwer verwunden. Uebrigens wehrt er sich seiner Haut, wenn er angegriffen wird. Es ist nicht rathsam, ihn lebend packen zu wollen; denn er weiß von seinem Gebisse einen ungemein empfindlichen Gebrauch zu machen. Ehe er zum Beißen kommt, sucht er sich zu retten, indem er, wo es der Boden erlaubt, durch unglaublich rasches Eingraben in die Erde sich versenkt oder aber seine Stinkdrüsen gegen den Feind entleert.
Von der Wirksamkeit dieser Drüsen habe ich mich selbst überzeugen können. Im Mensathale sah mein Freund und Jagdgenosse van Arkel d'Ablaing gegen Abend ein ihm unbekanntes dachsähnliches Thier, welches von dem einen Gehänge herabkam, dicht vor ihm das Thal überschritt und im Buschwalde der anderen Thalwand sich weiterbewegte. Er jagte dem »Dachs« beide Schüsse seines Schrotgewehres auf den Pelz und bekam dafür im nächsten Augenblicke einen furchtbaren Gestank zu riechen; das Thier selbst war aber, ungeachtet der Schuß es gut getroffen hatte, davongegangen. Die einbrechende Nacht verhinderte uns, nach ihm zu suchen; dafür durchstöberten wir jedoch am nächsten Morgen das Gebüsch. Hierbei brauchten wir bloß der Nase nachzugehen; denn der in der Nacht gefallene Regen hatte den Gestank wohl etwas gedämpft, aber keineswegs vernichtet. Er roch noch immer so abscheulich, daß nur unser Eifer die Suche uns erträglich machen konnte.
Man sagt, daß der Honigdachs bloß im höchsten Nothfalle sich seines Gebisses bediene. Wenn dies wahr ist, begreife ich ihn nicht; denn das Gebiß ist so kräftig, daß es jedem Jäger und jedem Hund Achtung einflößen und beide zur Vorsicht mahnen muß. Dagegen bin ich von der Lebenszähigkeit des Thieres vollkommen überzeugt. An den beiden Schüssen, welche mein Freund auf kaum zwanzig Schritte jenem Honigdachse zukommen ließ, hätte ein Löwe genug haben können; der Ratel aber war davongegangen, als wäre ihm nichts geschehen. Die Bauern des Kaplandes sollen sich ein »Vergnügen« daraus machen, dem Ratel ihre Messer in verschiedene Theile seines Leibes zu stoßen, weil sie wissen, daß sie hierdurch noch keineswegs seinen raschen Tod herbeiführen. Bei getödteten, welche von Hunden gebissen worden waren, konnte man niemals im Felle ein Loch bemerken. Starke Schläge auf die Schnauze sollen ihn jedoch augenblicklich tödten.
Jung eingefangene Ratels werden zahm und ergötzen durch die Plumpheit ihrer Bewegungen. Weinland nennt die Ratels im Regents-Park in London »außerordentlich muntere Thiere, welche, wie manche besonders schlaue und thörichte Menschen, plötzlich ein ganz anderes Gebaren annehmen, wenn sie sich bemerkt glauben, außerdem aber die Zuschauer durch Purzelbäume zu unterhalten und zu fesseln wissen;« ich beobachtete an diesen und anderen Gefangenen, daß sie mit bewunderungswürdiger Regelmäßigkeit ihre höchst komischen Purzelbäume immer genau auf derselben Stelle ihres Käfigs machen, hundertmal nacheinander, falls sie die Laune anwandelt, ihren Käfig so oft zu durchmessen. Die beiden bekanntesten Arten sind im Regents-Park zusammengesperrt, vertragen sich vortrefflich und ergötzen sich gegenseitig durch ihren unverwüstlichen Humor. Ein Ratel, welchen ich pflegte, war viel langweiliger, unzweifelhaft nur deshalb, weil ihm Gesellschaft fehlte.

Stinkdachs ( Midaus meliceps). ⅕[???] natürl. Größe.
Im Ganzen läßt unsere Kenntnis des Honigdachses noch viel zu wünschen übrig; dies aber wird einleuchtend, wenn man an unseren deutschen Dachs denken will: ihn kennen wir auch noch nicht.
Eine zweite Sippe wird gebildet durch den Stinkdachs, dessen Merkmale folgende sind: der Leib ist untersetzt, der Schwanz ein bloßer, mit langen Haaren besetzter Stummel, der Kopf sehr gestreckt, die Schnauze rüsselartig verlängert; die Augen sind klein, die kurzen, länglichen Ohren unter den Haaren versteckt; die niederen und starken Beine tragen an den mäßig großen Füßen mächtige Scharrkrallen, die Vorderfüße doppelt so lange als die Hinterfüße; ihre Zehen sind bis zum letzten Gliede miteinander verwachsen. Das Gebiß besteht aus 34 Zähnen und zwar, außer der gewöhnlichen Anzahl von Schneide- und Eckzähnen, aus zwei Lückzähnen im oberen, drei im unteren Kiefer und zwei Backenzähnen. In der Aftergegend ist keine Drüsentasche vorhanden, dagegen finden sich an der Mastdarmmündung Absonderungsdrüsen, welche durch einen besonders entwickelten Ringmuskel sehr stark zusammengepreßt werden, und die in ihnen enthaltene Flüssigkeit hervorspritzen können.
Der Stinkdachs, Teladu und Telagon von den Indiern, Segung von den Javanen, Tellego von den Bewohnern Sumatras genannt, und damit als ein Stänker ersten Ranges
bezeichnet ( Midaus meliceps , M. javanicus, Mephitis javanensis, Ursus foetidus), ist ein kleines, kaum mardergroßes Mitglied seiner Unterfamilie von 37 Centim. Länge, wovon auf das Stumpfschwänzchen etwa 2 Centim. kommen. Die Färbung des dichten, langen Felles ist, mit Ausnahme des Hinterhauptes und Nackens, ein gleichartiges Dunkelbraun. Ein weißer Streifen verläuft längs des Rückens bis zur Spitze des Schwanzes. Die Unterseite des Leibes ist lichter als die obere. Der Pelz besteht aus seidenweichem Woll- und grobem Grannenhaar und deutet darauf hin, daß das Thier in kälteren Gegenden, in Höhen, lebt. An den Seiten und auf dem Nacken bildet das Haar eine Art von Mähne.
Der Reisende und Naturforscher Horsfield hat uns zuerst mit der Lebensweise des eigenthümlichen Geschöpfes bekannt gemacht. Der Stinkdachs ist nicht bloß hinsichtlich seiner Gestalt, sondern auch beziehentlich seiner Heimat ein sehr merkwürdiges Thier. Ausschließlich auf Höhen beschränkt, welche mehr als 2000 Meter über dem Meere liegen, kommt er hier ebenso regelmäßig vor wie gewisse Pflanzen. Alle Gebirgsbewohner kennen ihn und seine Eigenthümlichkeiten; in der Tiefe weiß man von ihm ebensowenig wie von einem fremdländischen Geschöpfe: in Batavia, Samarang oder Surabaya würde man vergeblich nach ihm fragen. Die langgestreckten Gebirge der Inseln, welche mit so vielen Spitzen in jene Höhen ragen, geben ihm herrliche Wohnorte. Man baut auf den Hochebenen europäisches Korn, Kartoffeln etc.; diese Pflanzen dienen ihm zur hauptsächlichsten Nahrung. Seinen Bau legt er mit großer Vorsicht und vielem Geschick in geringer Tiefe unter der Oberfläche der Erde an. Wenn er einen Ort gefunden hat, welcher durch die langen und starken Wurzeln der Bäume besonders geschützt ist, scharrt er sich hier zwischen den Wurzeln eine Höhle aus und baut sich unter dem Baume einen Kessel von Kugelgestalt, welcher fast einen Meter im Durchmesser hat und regelmäßig ausgearbeitet wird. Von hier aus führen Röhren von etwa zwei Meter Länge nach der Oberfläche und zwar nach verschiedenen Seiten hin, deren Ausmündungen gewöhnlich durch Zweige oder trockenes Laub verborgen werden. Während des Tages verweilt er versteckt in seinem Baue, nach Einbruch der Nacht beginnt er Jagd auf Larven aller Art und auf Würmer, zumal Regenwürmer, welche in der fruchtbaren Dammerde in außerordentlicher Menge Vorkommen. Die Regenwürmer wühlt er wie ein Schwein aus der Erde und richtet deshalb häufig Schaden in den Feldern an.
Alle Bewegungen des Stinkdachses sind langsam, und er wird deshalb öfters von den Eingeborenen gefangen, welche sich keineswegs vor ihm fürchten, sondern sogar sein Fleisch essen sollen.
Horsfield beauftragte während seines Aufenthaltes in den Gebirgen von Prahu die Leute, ihm behufs seiner Untersuchungen Stinkdachse zu verschaffen, und die Eingeborenen brachten ihm dieselben in solcher Menge, daß er bald keinen einzigen mehr annehmen konnte. »Ich wurde versichert«, sagt dieser Forscher, »daß das Fleisch des Teladu sehr wohlschmeckend wäre; man müsse das Thier nur rasch tödten und sobald als möglich die Stinkdrüsen entfernen, welche dann ihren höllischen Geruch dem übrigen Körper noch nicht mittheilen konnten. Mein indischer Jäger erzählte mir auch, daß der Stinkdachs seinen Stinksaft höchstens auf 60 Centim. Entfernung spritzen könne. Die Flüssigkeit selbst ist klebrig; ihre Wirkung beruht auf ihrer leichten Verflüchtigungsfähigkeit, welche unter Umständen die ganze Nachbarschaft eines Dorfes verpesten kann und in der nächsten Nähe so heftig ist, daß einzelne Leute geradezu in Ohnmacht fallen, wenn sie dem Geruch nicht ausweichen können. Die verschiedenen Stinkthiere in Amerika unterscheiden sich von unserem Teladu bloß durch die Fähigkeit, ihren Saft weiter zu spritzen«. Junghuhn bestätigt diese Angaben und fügt hinzu, daß man den heftigen, an Knoblauch erinnernden Gestank bei günstigem Winde eine halbe Meile weit wahrnehmen könne.
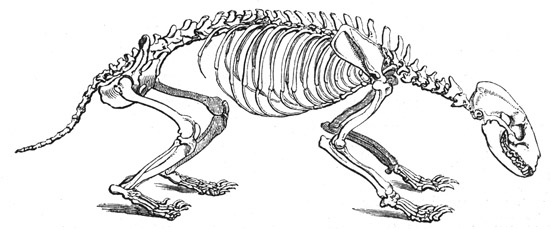
Geripp des Dachses. (Aus dem Berliner anatomischen Museum.)
»Der Stinkdachs«, fährt Horsfield fort, »ist sanft und mild in seinem Wesen und kann, wenn man ihn jung einfängt, sehr leicht gezähmt werden. Einer, welchen ich gefangen hatte und lange Zeit bei mir hielt, bot mir Gelegenheit, sein Wesen zu beobachten. Er wurde sehr bald liebenswürdig, erkannte seine Lage und seinen Wärter und kam niemals in so heftigen Zorn, daß er seinen Pestdunst losgelassen hätte. Ich brachte ihn mit nur von den Gebirgen Prahus nach Blederan, einer Ortschaft am Fuße dieses Gebirges, wo die Wärme bereits viel größer ist als in der Höhe. Um eine Zeichnung von ihm anzufertigen, wurde er an einen kleinen Pfahl gebunden. Er bewegte sich sehr rasch und wühlte den Grund mit seiner Schnauze und seinen Nägeln auf, als wolle er Futter suchen, ohne den Nebenstehenden die geringste Beachtung zu schenken oder heftige Kraftanstrengungen zu seiner Befreiung zu machen. Einen Regenwurm, welcher ihm gebracht wurde, verspeiste er gierig, das eine Ende desselben mit dem Fuße haltend, während er das andere hinterfraß. Nachdem er ungefähr zehn bis zwölf Würmer verzehrt hatte, wurde er ruhig und machte sich jetzt eine kleine Grube in die Erde, in welcher er seine Schnauze versteckte. Dann streckte er sich bedachtsam aus und war wenige Augenblicke später in Schlaf versunken.«
Merklichen Schaden verursacht der Stinkdachs nur dann, wenn er bei seinen Wühlereien in den Pflanzungen die Wurzeln der Bäume bloslegt oder kleine Pflanzen aushebt. Auch durch seinen Gestank wird er bloß dem unangenehm, welcher ihn unnöthig zur Entleerung seiner Drüsen reizt.
Das vollendetste Bild eines selbstsüchtigen, mißtrauischen, übellaunischen und gleichsam mit sich selbst im Streite liegenden Gesellen ist der Dachs. Hierüber sind so ziemlich alle Beobachter einverstanden, obgleich sie den Nutzen, welchen dieser eigenthümliche Marder gewährt, nicht verkennen. Der Dachs ist unter den größeren europäischen Raubthieren das unschädlichste und wird gleichwohl verfolgt und befehdet wie der Wolf oder der Fuchs, ohne daß er selbst unter den Weidmännern, welche doch bekanntlich diejenigen Thiere am meisten lieben, denen sie am eifrigsten nachstellen, viele Vertheidiger gefunden hat. Man schilt und verurtheilt ihn rücksichtslos, ohne zu bedenken, daß er nach seiner Weise schlecht und gerecht lebt und, so gut es gehen will, ehrlich und redlich sich durchs Leben schlägt. Nur die eigenthümliche Lebensweise, welche er führt, trägt die Schuld der Härte des Urtheils über ihn. Er ist allerdings ein griesgrämiger, menschen- und thierscheuer Einsiedler und dabei ein so bequemer und fauler Gesell, wie es nur irgend einen geben kann, und alle diese Eigenschaften sind in der That nicht geeignet, sich Freunde zu erwerben. Ich für meinen Theil muß gestehen, daß ich ihn nicht ungern habe: mich ergötzt sein Leben und Wesen.
Gedrungener, starker und kräftiger Leib, dicker Hals und langer Kopf, an dem sich die Schnauze rüsselförmig zuspitzt, kleine Augen und ebenfalls kleine, aber sichtbare Ohren, nackte Sohlen und starke Krallen an den Vorderfüßen, der kurze, behaarte Schwanz und der dichte, grobe Pelz sowie eine Querspalte, welche zu einer am After liegenden Drüsentasche führt, kennzeichnen die Sippe Meles, welche der Dachs vertritt. Im Gebiß fällt die Stärke der Zähne, zumal die unverhältnismäßige Größe des einzigen oberen Kauzahnes oder die Abstumpfung des Fleischzahnes als eigenthümlich auf. Außer den Schneide- und Eckzähnen finden sich oben drei, unten vier Lückzähne und oben und unten zwei Backenzähne in jedem Kiefer; das Gebiß besteht also aus 38 Zähnen, von denen jedoch, unabhängig von dem Alter des Thieres, die ersten sehr kleinen Lückzähne auszufallen pflegen, also nur 34 bleibend sind.
Der Dachs, Gräving oder Greifing ( Meles Taxus, Ursus Taxus und Meles, Taxus vulgaris, Meles vulgaris und europaeus), erreicht bis 75 Centim. Leibes- und 18 Centim. Schwanzlänge, bei ungefähr 30 Centim. Höhe am Widerriste. Alte Männchen erlangen im Herbste ein Gewicht bis zu 20 Kilogramm. Ein ziemlich langes, straffes, fast borstenartiges, glänzendes Haarkleid bedeckt den ganzen Körper und hüllt auch die Ohren ein. Seine Färbung ist am Rücken weißgrau und schwarz gemischt, weil die einzelnen Haare an der Wurzel meist gelblich, in der Mitte schwarz und an der Spitze grauweiß ausgehen, an den Körperseiten und am Schwanze röthlich, auf der Unterseite und an den Füßen schwarzbraun. Der Kopf ist weiß, aber ein matter, schwarzer Streifen verläuft jenseits der Schnauze, verbreitert sich, geht über die Augen und die weiß behaarten Ohren hinweg und verliert sich allmählich im Nacken. Die Weibchen unterscheiden sich von den Männchen durch geringere Größe und Breite sowie durch hellere Färbung, welche namentlich durch die weißlichen, durchschimmernden Wollhaare bewirkt wird. Sehr selten sind Spielarten von ganz weißer Färbung, noch seltner solche, welche auf weißem Grunde dunkel kastanienbraune Flecke zeigen.

Dachs ( Meles Taxus). [1/7] natürl. Größe.
Neugeborene Dachse sind, nach Döbner, 15, mit dem Schwanze 19 Centim. lang und tragen ein dünnes, auf dem Bauche äußerst spärliches, aus straffen, verhältnismäßig dicken und borstenartigen, dicht anliegenden Haaren bestehendes, nur an den dunkel gefärbten Stellen des Körpers mehr oder weniger mit grauen und schwarzen Haaren gemengtes, übrigens weiß gefärbtes Fell. Der bei erwachsenen Dachsen zu beiden Seiten des Kopfes verlaufende schwarze Streifen ist bereits deutlich sichtbar, aber noch bräunlich gefärbt; ebenso sehen die Füße und die Unterschenkel der Vorder- und Hinterbeine aus. Auch längs der Kehle und Brust zeigt sich schon die dunkle Färbung, doch finden sich hier noch keine dunklen Haare.
In der Weidmannssprache nennt man das Dachsmännchen Dachs, das Weibchen Fähe oder Fehe, die Augen Seher, die Ohren Lauscher, die Eckzähne Fänge, die Beine Läufe, die Haut Schwarte, den Schwanz Pürzel, Ruthe, Zain, die Nägel Klauen, die Gänge, welche zu seiner Wohnung führen Röhren, Geschleife und Einfahrten, den Ort, wo unter der Erde die Röhren zusammenlaufen, den Kessel. Man sagt, der Dachs bewohnt den Bau, befährt die Röhre, sitzt im Kessel, versetzt, verklüftet, verliert sich, wird vom Dachshunde im Kessel angetrieben, schleicht und trabt, weidet sich oder nimmt Weide an, sticht oder wurzelt, wenn er Nahrung aus der Erde gräbt, ranzt oder rollt, indem er sich begattet, verfängt sich, wenn er sich an Hunden fest beißt; er wird todt geschlagen, die Schwarte abgeschärft, das Fett abgelöst, der Leib aufgebrochen, zerwirkt und zerlegt.
Der Dachs bewohnt mit Ausnahme der Insel Sardinien und des Nordens von Skandinavien ganz Europa, ebenso Asien von Syrien an durch Georgien und Persien bis nach Japan sowie Sibirien bis zur Lena. Er lebt einsam in Höhlen, welche er selbst mit seinen starken, krummen Krallen auf der Sonnenseite bewaldeter Hügel ausgräbt, mit vier bis acht Ausgängen und Luftlöchern versieht und innen aufs bequemste einrichtet. Die Hauptwohnung im Baue, der Kessel, zu welchem mehrere Röhren führen, ist so groß, daß er ein geräumiges, weiches Moospolster und das Thier selbst nebst seinen Jungen aufnehmen kann. Die wenigsten Röhren aber werden befahren, sondern dienen bloß im Falle der größten Noth als Fluchtwege oder auch als Luftgänge. Größte Reinlichkeit und Sauberkeit herrscht überall, und hierdurch zeichnet sich der Dachsbau vor fast allen übrigen ähnlichen unterirdischen Behausungen der Säugethiere aus. Vorhölzer, welche nicht weit von Fluren gelegen sind, ja sogar unbewaldete Gehänge mitten in der Flur werden mit Vorliebe zur Anlegung dieser Wohnungen benutzt; immer aber sind es stille und einsame Orte, welche der Einsiedler sich aussucht. Er liebt es, ein beschauliches und gemächliches Leben zu führen und vor allem seine eigene Selbständigkeit in der ausgedehntesten Weise zu bewahren. Seine Stärke macht es ihm leicht, Höhlen auszuscharren, und wie einige andere unterirdisch lebende Thiere ist er im Stande, sich in wenig Minuten vollkommen zu vergraben. Dabei kommen ihm seine starken, mit tüchtigen Krallen bewaffneten Vorderfüße vortrefflich zustatten. Schon nach sehr kurzer Zeit bereitet ihm die aufgegrabene Erde Hindernisse; nun aber nimmt er seine Hinterfüße zu Hülfe und wirft mit kräftigen Stößen das Erdreich weit hinter sich. Wenn die Aushöhlung weiter fortschreitet, schiebt er, gewaltsam sich entgegenstemmend, die Erde mit seinem Hintertheile nach rückwärts, und so wird es ihm möglich, auch aus der Tiefe sämmtliche Erde herauszuschaffen.
Unter allen halbunterirdisch lebenden Thieren sowie unter denen, welche bloß unter der Erde schlafen, sieht der Dachs am meisten darauf, daß seine Baue möglichste Ausdehnung haben und entsprechende Sicherheit gewähren. Fast regelmäßig sind die Gänge, welche von dem Kessel auslaufen, acht bis zehn Meter lang und ihre Mündungen oft dreißig Schritte weit von einander entfernt. Der Kessel befindet sich gewöhnlich einundeinhalb bis zwei Meter tief unter der Erde; ist jedoch die Steilung, auf welcher der Bau angelegt wurde, bedeutend, so kommt er auch wohl bis auf fünf Meter unter die Oberfläche zu liegen. Dann aber führen fast regelmäßig einzelne Röhren, welche zur Lüftung dienen, senkrecht empor. Kann der Dachs den Bau im Geklüfte anlegen, so ist es ihm um so lieber: er genießt dann größere Sicherheit und Ruhe, Hauptbedingungen für Behaglichkeit seines Daseins.
In diesem Baue bringt der Dachs den größten Theil seines Lebens zu, und erst, wenn die Nacht vollkommen hereingebrochen ist, verläßt er ihn auf weitere Entfernung. In sehr stillen Waldungen treibt er sich während des Hochsommers auch wohl schon in den späteren Nachmittagsstunden spazieren gehend außen umher, und ich selbst bin ihm in der Nähe von Stubbenkammer auf Rügen am hellen, lichten Tage begegnet; solche Tagesausflüge gehören jedoch zu den Ausnahmen. »Von einem Jäger«, berichtet Tschudi, »dem das seltene Glück zu Theil ward, einen Dachs im Freien ungestört längere Zeit beobachten zu können, erhalten wir anziehende Mittheilungen. Er besuchte wiederholt einen Dachsbau, welcher, am Rande einer Schlucht angelegt, von der entgegengesetzten Seite dem freien Ueberblicke offen lag. Der Bau war stark befahren, der neu aufgeworfene Boden jedoch vor der Hauptröhre so eben und glatt wie eine Tenne und so festgetreten, daß nicht zu erkennen war, ob er Junge enthalte. Als der Wind günstiger war, schlich sich der Jäger von der entgegengesetzten Seite in die Nähe des Baues und erblickte bald einen alten Dachs, welcher griesgrämig, in eigener Langweiligkeit verloren, dasaß, doch sonst, wie es schien, sich recht behaglich fühlte in den warmen Strahlen. Dies war nicht ein Zufall: der Jäger sah das Thier, so oft er an hellen Tagen den Bau beobachtete, in der Sonne liegen. In Wohlseligkeit und Nichtsthun brachte es die Zeit hin. Bald saß es da, guckte ernsthaft ringsum, betrachtete dann einzelne Gegenstände genau und wiegte sich endlich nach Art der Bären auf den vorderen Branten gemächlich hin und her. So große Behaglichkeit unterbrachen jedoch plötzlich blutdürstige Schmarotzer, welche es mit außergewöhnlicher Hast mit Nagel und Zahn sofort zur Rechenschaft zog. Endlich zufrieden mit dem Erfolge des Strafgerichtes gab der Dachs mit erhöhtem Behagen in der bequemsten Lage sich der Sonne preis, indem er ihr bald den breiten Rücken, bald den wohlgenährten Wanst zuwandte. Lange dauerte aber dieser Zeitvertreib auch nicht; mit der Langweile mochte ihm etwas in die Nase kommen. Er hebt diese hoch, wendet sich nach allen Seiten, ohne etwas ausfindig zu machen. Doch scheint ihm Vorsicht rathsam, und er fährt zu Baue. Ein anderes Mal sonnte er sich wieder, trabte dann zur Abwechselung einmal thalabwärts, um in ziemlicher Entfernung Raum zu schaffen für die Aesung der nächsten Nacht, kehrte sogar, gemäß seiner gerühmten Vorsicht und Reinlichkeit, nochmals um und überwischte zu wiederholten Malen seine Losung, damit sie ja nicht zum Verräther werde. Auf dem Rückwege nahm er sich Zeit, stach hier und da einmal, ohne jedoch beim Weiden sich aufzuhalten, trieb dann noch ein Weilchen den alten Zeitvertreib, und als allmählich der Bäume Schlagschatten die Scene überliefen, fuhr er nach sehr schweren Mühen wieder zu Baue, wahrscheinlich, um auf die noch schwereren der Nacht zum voraus noch ein Bischen zu schlummern.«
Eigenthümlich ist die Art und Weise, wie er aus dem Baue und in denselben fährt. »Ganz verschieden vom Fuchse«, sagt Adolf Müller, »welcher rasch aus der Röhre hervorkommt und dann erst sichert, kündigt sich dem aufmerksamen Jäger die Ankunft des unterirdischen Gesellen erst durch ein dumpfes Gerumpel in der Röhre an: er schüttelt den Staub von seinem Felle. Dann rückt er äußerst vorsichtig mit dem halben Kopfe aus der Röhre, sichert einen Augenblick und taucht wieder unter. Dies wiederholt sich oft mehrmals, bis der geheimnisvolle Bergbewohner sich höher aus der Röhre heraushebt, einen Augenblick noch mit Gehör und Nase die Umgebung prüft und dann, gewöhnlich trottend, den Bau verläßt. Das Einfahren geschieht in der Regel rasch und im Herbste wegen seiner Beleibtheit unter vernehmbarem Keuchen, langsamer nur bei besonders stillem Wetter und vollkommener Sicherheit, auffallend schnell dagegen, wenn es windig ist.« Nur junge Dachse gehen in Gesellschaft zur Nahrung aus, alte stets allein.
Zur Zeit der Paarung lebt der Dachs mit seinem Weibchen gesellig, jedoch immer nur in beschränkter Weise; den ganzen übrigen Theil des Jahres bewohnt er für sich allein einen Bau und hält weder mit seinem Weibchen noch mit anderen Thieren Freundschaft. In alten, ausgedehnten Bauen drängt sich ihm zwar der Fuchs nicht selten als Gesellschafter auf; beide Thiere aber bekümmern sich wenig um einander, und der Fuchs haust sodann regelmäßig in den oberen, der Dachs in den unteren Röhren und Kesseln. Daß Reineke durch Absetzen seiner Losung den reinlichen Grimbart vertreibe, ist eine von neueren Beobachtern wiederlegte Jägerfabel.
Die Bewegungen des Dachses sind langsam und träge; der Gang erscheint schleppend und schwerfällig; nicht einmal der schnellste Lauf ist fördernd: man behauptet, daß ein guter Fußgänger Grimbart einholen könne. Das Thier macht einen eigenthümlichen Eindruck. Anfänglich meint man, eher ein Schwein vor sich zu sehen als ein Raubthier, und ich meine, daß schon eine gewisse Vertrautheit mit seiner Gestalt und seinem Wesen dazu gehört, wenn man ihn überhaupt erkennen will. An das Schwein erinnert auch seine grunzende Stimme.
Seine Nahrung besteht im Frühjahre und Sommer vorzüglich aus Wurzeln, namentlich Birkenwurzeln, später aus Trüffeln, Bücheln und Eicheln. Hier und da scharrt er ein Hummel- oder Wespennest aus und frißt mit großem Behagen die larvenreichen und honigsüßen Waben, ohne sich viel um die Stiche der erbosten Kerbthiere zu kümmern; sein rauher Pelz, die dicke Schwarte und die darunter sich befindende Fettschicht schützen ihn auch vollständig vor den Stichen der Immen. Kerbthiere aller Art, Schnecken und Regenwürmer bilden während des Sommers wohl den Haupttheil seiner Mahlzeiten. Die Regenwürmer bohrt er mit den scharfen langen Nägeln seiner Vorderpfoten aus ihrem Verstecke sehr geschickt heraus, und derselben Werkzeuge bedient er sich beim Aufsuchen von Larven des Maikäfers und sonstiger schädlichen Kerbthiere, welche auf Aeckern, Wiesen und anderem Gelände unter der Erde leben. Bei Erbeutung der letzteren sticht er aber nicht, wie der Jäger sagt, d. h. macht nicht trichterförmige, drei bis fünf Centim. tiefe und halb so weite Löcher wie beim Erbeuten der Regenwürmer, sondern wühlt öfters tief den Boden auf. Hierbei gebraucht er freilich ebenfalls die Schnauze, aber keineswegs zum Stechen oder Bohren, sondern, wie andere Raubthiere auch, einzig und allein zum Auswittern. Schnecken, möglicherweise auch Raupen, Schmetterlinge und dergleichen sucht er, wie von Bischofshausen beobachten konnte, von den Bäumen ab. Genannter Weidmann sah zu seiner nicht geringen Ueberraschung an einem schönen Sommerabende eine Dachsfamilie von fünf Stücken, welche auf einem Schlage in sichtlicher Eile, um einander zuvorzukommen, von Baum zu Baum rannten, mit den Vorderläufen, so hoch sie reichen konnten, daran hinauf kletterten und so, auf den Hinterfüßen stehend, jeden Stamm umkreisten. »Sie kamen«, erzählt der Beobachter, »mir dabei sehr nahe und waren in ihrem Geschäfte so eifrig, daß sie meine Anwesenheit nur insofern beachteten, als sie wenigstens an dem Baume, an welchem ich stand, keine Kletterversuche machten, sondern, mich eine Sekunde neugierig betrachtend, zum nächsten Baume gingen. Was aber trieben sie überhaupt in den Bäumen? Zuerst glaubte ich, sie tränken das in den Baumrinnen herabfließende Regenwasser; dazu aber verweilten sie zu kurze Zeit auf einer Stelle und drehten sich zu schnell um den ganzen Stamm herum. Später, als ich nahe genug war, sah ich nun allerdings deutlich, daß sie nicht tranken, bemerkte vielmehr, wie einer von ihnen eine am Baume sitzende kleine Schnecke sammt dem Gehäuse verschlang. Gleichzeitig fielen infolge des Regens öfters Schneckenhäuser von dem Baume, unter welchem ich stand; ungeachtet aller Aufmerksamkeit konnte ich jedoch nicht entdecken, daß auch nur einer den Versuch gemacht hätte, solche aufzulesen. Sie schienen bloß darauf versessen, sich an den Stämmen aufzurichten, und zwar unbekümmert, ob dasselbe eben vorher schon von einem anderen Dachse an dem gleichen Baume bereits geschehen war oder nicht. Ihr Geschäft wurde von allen unter beständigem Gemurmel ausgeführt, welches in der Nähe wie ein dumpfes knurrendes »Bruno, Bruno« sich anhörte.« Im Herbste verspeist Grimbart abgefallenes Obst aller Art, Möhren und Rüben, Vogeleier und junge Vögel; kleinere Säugethiere, junge Hasen, Feldmäuse, Maulwürfe etc., werden auch nicht verschmäht, ja selbst Eidechsen, Frösche und Schlangen munden ihm vortrefflich. In den Weinbergen richtet er unter Umständen Verwüstungen an, drückt die traubenschweren Reben ohne Umstände mit der Pfote zusammen und mästet sich förmlich mit ihrer süßen Frucht. Höchst selten stiehlt er junge Enten und Gänse von Bauerhöfen, welche ganz nahe am Walde liegen; denn er ist außerordentlich mißtrauisch und furchtsam, wagt sich deshalb auch bloß dann heraus, wenn er überzeugt sein kann, daß alles vollkommen sicher ist. Im Nothfalle geht er Aas an. Er frißt im ganzen wenig und trägt nicht viel für den Winter in seinen Bau ein; es müßte denn ein Möhrenacker in der Nähe desselben liegen und seiner Bequemlichkeit zu Hülfe kommen. Merklichen Schaden verursacht der Dachs in Europa nicht, jedenfalls niemals und nirgends so viel, daß der
Nutzen, welchen er durch Wegfangen und Verzehren von allerlei Ungeziefer im Walde und in der Flur uns bringt, jenen nicht reichlich aufwiegen sollte. Unter allen Mardern ist er der nützlichste und ein Erhalter, nicht aber ein Schädiger des Waldes: der Forstmann, welcher ihn zu vernichten sucht, sündigt also an sich selbst und an dem von ihm gepflegten Walde.
»Mit dem Igel«, bemerkt Adolf Müller, »hat man den harmlosen Grimbart der Zerstörung der Waldsaaten bezichtigt. Beide Thiere sind von unkundigen, oberflächlichen Beobachtern beim emsigen Suchen nach Larven und Maden in den Rinnen der mit Buchen- oder Fichtensamen besäten Flächen gesehen, für die Zerstörer der zerkauten Samen gehalten und verfolgt worden. Als ob die Thiere nicht vielmehr den in solchen Saaten und gerade hier vorzugsweise sich ansiedelnden schädlichen Engerlingen und anderen Larven oder gar Mäusen nachstellten! Schauet doch tiefer, ihr Pfleger und Erzieher der Wälder, die ihr nicht die Böcke von den Schafen scheiden könnt; thut Dachs und Igel aus dem abergläubischen Bann der alten Nimrode und in den Schutz der vorurtheilslosen Naturwissenschaft. Betrachtet das Gebiß und vergleicht dies mit den Zähnen der Nager, und ihr werdet Dachs und Igel nicht mehr für Waldsamen- oder gar Nadelholzsamendiebe halten. Die Nahrung des Dachses ist und bleibt die von Gliederthieren, und dadurch, verbunden mit dem Umstande, daß er Mäuse fängt, bekundet er sich als eines der nützlichsten Thiere im großen Haushalte der Natur.«
Nicht ganz so harmlos wie bei uns zu Lande tritt der Dachs in Asien auf. »In Ostsibirien«, sagt Radde, »scheint er viel dreister und blutdürstiger zu sein als in Europa. Er bleibt in den besser bevölkerten Gegenden ausschließlich ein nächtliches Raubthier, was beispielsweise im Burejagebirge, wo wir ihn vierzehnmal bei Tage sahen, nicht der Fall war. Hier begnügte er sich mit Mäusen und Schlangen und hatte sicher keine Gelegenheit, das junge Rindvieh zu belästigen, wie er es überall in Transbaikalien thut. In den Hochsteppen Dauriens ist es etwas ganz gewöhnliches, daß er die Kälber seitwärts anspringt. Die größeren von diesen kommen gemeiniglich mit starken Schrammen und Kratzwunden davon, während Schwächlinge dem Raubthiere unterliegen. Nach der Ansiedelung der Kosaken am Amur belästigten die Dachse besonders in den Ebenen oberhalb des Burejagebirges die Herden dieser Leute.«
Zu Ende des Spätherbstes hat sich der Dachs wohl gemästet. Jetzt denkt er daran, den Winter so behaglich als nur irgend möglich zu verbringen und bereitet das wichtigste für seinen Winterschlaf vor. Er trägt Laub in seine Höhle und bettet sich ein dichtes, warmes Lager. Bis zum Eintritte der eigentlichen Kälte zehrt er von dem Eingetragenen. Nun rollt er sich zusammen, legt sich auf den Bauch und steckt den Kopf zwischen die Vorderbeine (nicht, wie gewöhnlich behauptet wird, zwischen die Hinterbeine, die Schnauzenspitze in seiner Drüsentasche verbergend) und verfällt in einen Winterschlaf. Dieser aber wird, wie jener der Bären, sehr häufig unterbrochen. Bei nicht anhaltender Kälte oder beim Eintritte gelinderer Witterung, besonders bei Thauwetter und in nicht sehr kalten Nächten, ermuntert er sich, geht sogar zuweilen nachts aus seinem Baue heraus, um zu trinken. Bei verhältnismäßig warmer Witterung verläßt er schon im Januar oder spätestens im Februar zeitweise den Bau, um Wurzeln auszugraben und, wenn ihm das Glück wohl will, auch vielleicht ein Mäuschen zu überraschen und abzufangen. Dennoch bekommt ihm das Fasten schlecht, und wenn er im Frühling wieder an das Tageslicht kommt, ist er, welcher sich ein volles Bäuchlein angemästet hatte, fast klapperdürr geworden.
Die Rollzeit des Dachses findet im Oktober, ausnahmsweise (zumal bei jungen Thieren) später statt. Nach zwölf bis fünfzehn Wochen, also Ende Februar oder anfangs März, wirft die Mutter drei bis fünf blinde Junge auf ein sorgfältig ausgepolstertes Lager von Moos, Blättern, Farrenkräutern und langem Grase, welche Stoffe sie zwischen den Hinterbeinen bis zum Eingange ihres Baues getragen und dann mit gegengestemmtem Kopfe und den Vorderfüßen durch die Röhre in den Kessel geschoben hat. Daß sie dabei einen eigenen Bau bewohnt, versteht sich eigentlich von selbst; denn der weibliche Dachs ist ebensogut ein eingefleischter Einsiedler wie der männliche. Die Jungen werden von ihr treu geliebt. Sie trägt ihnen nach der Säugezeit so lange Würmer, Wurzeln und kleine Säugethiere in den Bau, bis sie selbst sich zu ernähren im Stande sind. Während des Wochenbettes wird es dem Weibchen schwer, die sonst musterhafte Reinlichkeit, welche im Baue herrscht, zu erhalten; denn die ungezogenen Jungen sind natürlich noch nicht so weit herangebildet, um jene hohe Tugend zu würdigen. Da hat nun die Alte ihre liebe Noth, weiß sich aber zu helfen. Neben dem Kessel legt sie noch eine besondere Kammer an, welche der kleinen Gesellschaft als Abtritt dienen und zugleich alle Nahrungsstoffe aufnehmen muß, welche die Jungen nur teilweise verzehren.
Nach ungefähr drei bis vier Wochen wagen sich die kleinen, sehr hübschen Thierchen in Gesellschaft ihrer Mutter bereits bis zum Eingange ihres Baues, legen sich mit ihr auch wohl vor die Höhle, um sich zu sonnen. Dabei spielen sie nach Kinderart allerliebst miteinander und erfreuen den glücklichen Beobachter umsomehr, als diesem das anziehende Schauspiel selten geboten wird. Bis zum Herbste bleiben sie bei der Mutter, trennen sich sodann und beginnen nun ihr Leben auf eigene Hand. Alte Dachsbaue werden von ihnen mit Vorliebe bezogen; im Nothfalle muß aber auch ein eigener gegraben werden. Bloß in seltenen Fällen duldet die Mutter, daß sie sich in ihrem Geburtshause einen zweiten Kessel anlegen und dann den unterirdischen Palast noch während eines Winters mit ihr benutzen. Im zweiten Jahre sind die Jungen völlig ausgewachsen und zur Fortpflanzung fähig, und wenn ihnen nicht der Schuß eines vorsichtig aufgestellten Jägers das Lebenslicht ausbläst, bringen sie ihr Alter auf zehn oder zwölf Jahre.
Man fängt den Dachs in verschiedenen Fallen, gräbt ihn aus und bohrt ihn, scheußlich genug, mit dem sogenannten Krätzer an, einem Werkzeuge, welches einem Korkzieher in vergrößertem Maßstabe ähnelt, treibt ihn durch scharfe Dachshunde aus seinem Baue und erschießt ihn beim Herauskommen. Nur wenn er sich in seinem Bau verklüftet, d. h. so versteckt, daß sogar die Hunde ihn nicht auffinden können, ist er im Stande, der drohenden Gefahr sich zu widersetzen; denn seine Plumpheit ist so groß, daß ihm eine Flucht vor dem Hunde nichts helfen würde. Er sucht sich deshalb, wenn er in seinem Bau verfolgt wird, gewöhnlich dadurch zu retten, daß er still, aber mit großer Schnelligkeit sich tiefer eingräbt und hierdurch wirklich oft genug den ihm nachgehenden Hunden entzieht.
Ganz früh am Morgen kann man dem heimkehrenden Dachs wohl auch auf dem Anstande auflauern und ihn erlegen. Abends ist der Anstand höchst langweilig; denn der mißtrauische Gesell erscheint regelmäßig erst mitten in der Nacht und geht so geräuschlos als möglich davon. Gewöhnlich errichtet man zum Schießstande eine sogenannte Kanzel, d. h. man baut sich auf den nächststehenden Bäumen in einer Höhe von zehn bis fünfzehn Meter mit Stangen und Bretern einen Standort, und schießt den zu Tage tretenden Dachs von hier aus nieder. Der dickfellige Gesell verlangt aber einen sehr starken Schuß oder verschwindet noch vor den Augen des Schützen in seinem Baue. Zuweilen geschieht es auch wohl, daß ein Dachs dem anderen verwundeten zu Hülfe kommt. Einen solchen Fall hat, nach Karl Müller, ein Förster in Diensten des Grafen von Schlitz aufgezeichnet. Derselbe schoß im Oktober abends auf einen Dachs, welcher kaum einen Schritt von der Röhre sich entfernt hatte. Das Thier wälzte sich klagend und schien dadurch die Theilnahme eines Gefährten im Baue erweckt zu haben, denn ehe der Schütze hinzueilen Zeit findet, steigt ein zweiter Dachs aus dem Baue, packt den klagenden, zieht ihn in die Röhre und verschwindet in der Tiefe. Wird der Dachs im freien von einem Hunde überrascht, so legt er sich zuerst platt auf den Boden, als würde er dadurch geborgen, wirft sich dann aber auf den Rücken und vertheidigt sich ebenso schnell als muthig mit seinem scharfen Gebisse und seinen Krallen. Im Baue verwundet er die eingefahrenen Dachshunde oft fürchterlich an der Nase, und wenn er sich einmal verbissen hat, läßt er nicht sogleich los. Ein einziger Schlag auf die Nase genügt, um ihn zu tödten, während an den übrigen Theilen des Leibes die heftigsten Hiebe keine besondere Wirkung hervorzubringen scheinen. Sobald er Nachstellungen erfährt, verdoppelt er seine Vorsicht, und es kommt nicht selten vor, daß ein Dachs zwei bis drei Tage ruhig in seinem Baue verbleibt, wenn derselbe vorher von einem Hunde oder Jäger besucht wurde. In manchen Gegenden geht man nachts an den Bau, setzt dort scharfe Hunde auf seine Fährte und läßt ihn verfolgen. Nach kurzer Zeit kommt er zurück und kann von dem Jäger, welcher mit einer Blendlaterne versehen ist, erlegt werden, da ihn die Hunde gewöhnlich bald erreichen und festpacken.
Alt eingefangene, beim Ausgraben ihrer Baue erbeutete Dachse sind geradezu abscheuliche Thiere, jeder Behandlung oder Erziehung unzugänglich, faul, mißtrauisch, tückisch und bösartig. Sie rühren sich bei Tage nicht und kommen nur des Nachts zum Vorscheine, fletschen bei jeder Gelegenheit die Zähne und beißen den, welcher unvorsichtig sich ihnen nähert, in gefahrdrohender Weise. Lenz erhielt einen alten, fetten, ganz unversehrten Dachs und that ihn in eine große Kiste. Hier blieb er ruhig in derselben Ecke liegen, rührte sich nicht, wenn man ihn nicht derb stieß, und wurde erst nachts nach zehn Uhr munter. »Wollte ich ihn«, sagt unser Gewährsmann, »den Tag über in eine andere Ecke schaffen, so mußte ich ihn mit Gewalt vermittels einer großen Schaufel dahin schieben. In solchen Fällen und überhaupt, wenn ich ihn durch Rippenstöße etc. kränkte, fauchte er heftig durch die Nase, verursachte dann abwechselnd durch die Erschütterung seines Bauches ein ganz eigenes Trommeln, und wenn er, um zu beißen, auf mich losführ, gab er einen Ton von sich, fast wie ein großer Hund oder Bär in dem Augenblicke, wann er einen Rippenstoß bekommt und losbeißt.
»Am ersten Tage gab ich ihm einige Möhren, zugleich aber auch eine lebende Blindschleiche nebst zwei Ringelnattern in seine Kiste. Am folgenden Morgen fand ich, daß er nichts gefressen, aber eine Ringelnatter in der Mitte tüchtig zerbissen hatte; jedoch lebte sie noch. Abends fügte ich zu diesen Speisen noch zwei große Kreuzottern, welche ich vor seine Schnauze legte. Er beachtete sie nicht im geringsten, ließ sich durch ihr Fauchen gar nicht in seiner Ruhe stören, obgleich er keineswegs schlief, und litt späterhin ganz geduldig, daß sie wie auch die Ringelnattern auf ihm herumkrochen. Am dritten Tage morgens fand ich noch immer alle Speisen unversehrt, nur hatte er von der tags zuvor angebissenen Ringelnatter ein etwa sieben Centim. langes Stück abgefressen. Zu den erwähnten Speisen fügte ich nun noch eine todte Meise, ein Stück Kaninchen und Runkelrüben. Am vierten Tage morgens fand ich, daß er die Blindschleiche nebst beiden Kreuzottern ganz aufgezehrt, von beiden Ringelnattern sowie vom Kaninchen ein tüchtiges Stück abgefressen, die Meise aber wie die Möhren und Rüben nicht angerührt hatte. Er zeigte sich nun überhaupt munter, und da ich sah, daß ihm Kreuzottern wohlbehagten, sehnte ich mich nach dem Schauspiel, ihn solche zerreißen und fressen zu sehen. Wie war dies aber anzufangen, da er seiner Natur nach nur des Nachts frißt und außerdem fast übermäßig scheu ist?
»Ich hatte schon im voraus auf eine List gesonnen. Der Dachs ist auf einen frischen Trunk sehr begierig, und wenn er durch eine Falle tagelang verhindert wird, seinen Bau zu verlassen, geschieht es oftmals, daß er dann, nachdem er endlich doch glücklich herausgekommen ist, sogleich zum Wasser eilt und dort so viel säuft, daß er todt auf dem Flecke bleibt(?). Ich hatte ihn deshalb zwei Tage lang dursten lassen, nahm jetzt aber eine große, matte Otter, tauchte sie in frisches Wasser und legte sie ihm vor. Sowie er das Wasser roch, erhob er sich und beleckte die Otter. Sie suchte zu entwischen; er aber trat mit dem linken Fuße fest auf sie, zerriß ihren Hinterleib und fraß vor meinen Augen ein tüchtiges Stück davon mit sichtbarem Wohlbehagen. Die Otter öffnete ihren Rachen weit und drohend, biß aber nicht zu. Jetzt setzte ich ihm einen Napf vor und goß Wasser hinein. Alsbald verließ er die Otter und soff mit großer Begierde alles, was da war, über zwei Nößel. Beim Sausen läßt er nicht, wie Hund und Fuchs, die Zunge vortreten, sondern steckt den Mund in das Wasser und bewegt die Unterkinnlade, als ob er kaue.«
Ganz anders als die im Alter erbeuteten, betragen sich jung eingefangene und sorgfältig auferzogene Dachse. Sie werden, insbesondere wenn man ihnen ausschließlich oder doch vorwiegend pflanzliche Nahrung reicht, zahm und anhänglich, können sogar dahin gebracht werden, ihrem Wärter zu folgen und auf den Ruf desselben vom Freien aus nach ihrem Käfige zurückzukehren. Im Berliner Thiergarten lebten ein Paar Dachse, welche die Besucher regelmäßig zu begrüßen und anzubetteln pflegten. Sie hatten ihre Lebensweise merklich verändert und schliefen nur in den Vormittagsstunden, so daß die schönen mit erbaulicher Nutzanwendung schließenden Fibelverse:
»Drei Viertel seines Lebens
Verschläft der Dachs vergebens«
bei ihnen vollständig zu Schanden wurden. Solche Dachse halten auch keinen Winterschlaf mehr, sondern kommen selbst bei der strengsten Kälte täglich hervor, um ihre Nahrung in Empfang zu nehmen. Vor der Kälte schützen sie sich durch ein weiches und warmes Stroh- und Heulager, welches sie im Inneren ihres Schlupfwinkels sorgfältig aufschichten, und dessen Zugang sie je nach Steigen oder Fallen der äußeren Wärme mehr oder weniger öffnen und verschließen. Achtsame Beobachter haben an solchen Gefangenen ein so feines Gefühl für Witterungsveränderungen wahrgenommen, daß sie Grimmbart unter die Propheten, wenn auch nur Wetterpropheten, zählen zu dürfen behaupten.
»Im Mai des Jahres 1833«, erzählt von Pietruvski, »bekam ich zwei junge Dachse, ein Weibchen und ein Männchen, welche höchstens vier Wochen alt waren. Während der ersten Tage ihrer Gefangenschaft waren diese Thierchen ziemlich scheu und aus Furcht Tag und Nacht in einen Ballen zusammengerollt. Binnen fünf Tagen verging ihnen jedoch diese Furchtsamkeit gänzlich, und sie kamen dahin, das ihnen vorgehaltene Futter aus der Hand zu nehmen. Sie fraßen alles, Brod, Früchte, Milch, am liebsten jedoch rohes Fleisch. Anfangs hielt ich sie in meinem Vorzimmer, und sie waren so treu und zutraulich, daß sie auf den ihnen gegebenen Namen hörten. Ich hatte sie deshalb drei volle Wochen auf meinem Zimmer, bis sie mir endlich durch die Unruhe bei Nacht und durch die immerwährende Lust zum Graben lästig wurden. Dieses bewog mich, für sie einen großen Käfig von Eisenstäben nach Art der Thierbehälter in Schaubuden anfertigen zu lassen. In ihm erhielt ich meine Dachse einen ganzen Sommer hindurch. Das Reinhalten des Käfigs wurde immer pünktlich beobachtet. Erst mit Annäherung des Herbstes fühlte ich die Unmöglichkeit, die Thiere länger hier beherbergen zu können; denn das Fell der Dachse wurde schon anfangs Oktober sehr schmutzig. Ich beschloß daher, sie ganz naturgemäß zu halten, und dieser Versuch glückte mir ausgezeichnet.
»Ueber einen ummauerten Graben, welcher zehn Meter im Durchmesser hatte, ließ ich noch einen ordentlichen Zaun ziehen, durch welchen man mittels einer Treppe in den Graben gehen konnte. In der Tiefe des letzteren ließ sich ein zwei Meter langes, ebenso breites und einen halben Meter hohes Häuschen mit einer Eingangsthüre bauen. Da hinein wurden meine Dachse gelassen, und sie gewöhnten sich sehr bald an den ihnen anfangs fremden Ort. Nach etwa zehntägigem Aufenthalte begannen sie schon, eine naturgemäße Höhle sich zu bauen. Bewunderungswürdig war dabei ihre unermüdliche Thätigkeit. Sie gruben immer mit ihren Vorderpfoten; der Hinterfüße bedienten sie sich, um die losgegrabene Erde aus dem Loche herauszuwerfen. Bei diesem Geschäfte war das Weibchen viel thätiger als das weit schönere und größere Männchen. Binnen zwei Wochen war schon die Höhle zwei Meter ausgetieft, verlief aber immer noch innerhalb des für die Thiere gemachten Häuschens. Jetzt wandten die Dachse alle mögliche Thätigkeit an, um sich ihren Bau um soviel zu erweitern, daß sie bequem in ihm schlafen konnten. Es mangelte ihnen noch an einem guten Lager, und als ich bemerkte, daß sie die in ihrem Bereiche befindlichen Grasflecken ihrer Höhle zutrugen, ließ ich ihnen frisches Heu holen. Sie wußten dieses sehr gut zu benutzen, und es gewährte einen anziehenden Anblick, wenn man ihnen zusah, wie sie die ihnen vorgeworfenen Heubündel nach Art der Affen zwischen ihre Vorderpfoten nahmen und so ihrer Wohnung zuschleppten. Das Graben währte noch immer fort, und ich hatte das Vergnügen zu bemerken, daß sich meine Thiere neben der ersten Höhle, welche zur Schlafkammer bestimmt wurde, eine andere gruben, welche sie als Vorrathskammer zu benutzen gedachten. Bald darauf machten sie noch drei kleinere Höhlen, in denen sie sich dann regelmäßig ihres Kothes entledigten. Es war aber immer noch bloß ein Ausgang und zwar innerhalb des für sie gemachten Häuschens vorhanden. Doch nun wurde alle mögliche Mühe angewendet, um sich einen Ausgang außerhalb des Häuschens zu graben. Als sie dieses bezweckt hatten, waren sie vollkommen frei und konnten, obgleich die Thüre des Häuschens zugemacht worden war, aus- und eingehen und, wenn sie einmal im Graben waren, auch in den Garten durch Zaunlöcher gelangen.
»Sehr schön war es anzusehen, wie sie hier in hellen und milden Nächten zusammen spielten. Sie bellten wie junge Hunde, murmelten wie Murmelthiere, umarmten einander zärtlich wie Affen und trieben tausenderlei Possen. Wenn ein Schaf oder Kalb in der Gegend zu Grunde ging, waren die Dachse immer die ersten bei seinem Aase. Es erregte Aller Bewunderung, zu sehen, was für große Stücken Fleisch sie bis auf eine Viertelmeile weit zu ihrer Wohnung trugen. Das Männchen entfernte sich selten von dem Baue, außer wenn es der Hunger trieb; das Weibchen aber folgte mir auf allen meinen Spaziergängen nach.
»Die Monate December und Januar verschliefen meine Dachse in der Höhle. Im Februar wurden sie lebendig. Zu Ende dieses Monates begatteten sie sich. Aber leider sollte ich nicht das Vergnügen haben, Junge von meinem Pärchen zu erhalten; denn das trächtige Weibchen wurde am ersten April in einem benachbarten Walde in einem Fuchseisen gefangen und von dem unkundigen Jäger erschlagen.«
Ueber einen anderen gezähmten Dachs schreibt mir Ludwig Beckmann, der treffliche Kenner und Maler der Thiere, das nachstehende: »Jung eingefangene Dachse werden bei guter Behandlung, namentlich im freien Umgange mit Haushunden, außerordentlich zahm. Ich habe früher eine völlig zum Hausthiere gewordene Dächsin besessen und ihren Verlust tief betrauert. Kaspar, so wurde sie trotz ihres Geschlechtes genannt, war eine grundehrliche, wenn auch etwas plumpe Natur. Er wollte mit aller Welt gern im Frieden leben, wurde indeß wegen seiner derben Späße oft mißverstanden und mußte dann unangenehme Erfahrungen machen. Sein eigentlicher Spielkamerad war ein äußerst gewandter, verständiger Hühnerhund, welchen ich von Jugend auf daran gewöhnt hatte, mit allerlei wildem Gethier zu verkehren. Mit diesem Hunde führte der Dachs an schönen Abenden förmliche Turniere auf, und es kamen von weit und breit Thierfreunde zu mir, um diesem seltenen Schauspiele beizuwohnen. Das wesentliche des Kampfes bestand darin, daß der Dachs nach wiederholtem Kopfschütteln wie eine Wildsau schnurgerade auf den etwa fünfzehn Schritte entfernt stehenden Hund losfuhr und im Vorüberrennen seitwärts mit dem Kopfe nach dem Gegner schlug. Dieser sprang mit einem zierlichen Satze über den Dachs hinweg, erwartete einen zweiten und dritten Angriff und ließ sich dann von seinem Widerpart in den Garten jagen. Glückte es dem Dachse, den Hund am Hinterlaufe zu erschnappen, so entstand eine arge Balgerei, welche jedoch niemals in ernsten Kampf ausartete. Wenn es Kaspar zu arg wurde, fuhr er, ohne sich umzukehren, eine Strecke zurück, richtete sich unter Schnaufen und Zittern hoch auf, sträubte das Haar und rutschte dann wie ein aufgeblasener Truthahn vor dem Hunde hin und her. Nach wenigen Augenblicken senkte sich das Haar und der ganze Körper des Dachses langsam nieder, und nach einigem Kopfschütteln und begütigendem Grunzen »hu, gu, gu, gu« ging das tolle Spiel von neuem an.
»Den größten Theil des Tages verschlief Kaspar in seinem Baue, welchen er ziemlich geschickt unter seiner Hütte, inmitten einer etwa acht Schritte im Geviert haltenden Einzäumung, angelegt hatte. Der Bau bestand eigentlich nur in einem großen unregelmäßigen Loche mit kurzer Einfahrt, und das merkwürdige daran war nur, daß der Dachs an der Hinterwand des Kessels beständig, wahrscheinlich der Lüftung wegen, ein kaum handgroßes Loch unterhielt. Hinter der Hütte hatte er drei bis fünf Senkgruben, topfförmige Erdlöcher von etwa 25 Centim. Breite und Tiefe, angelegt, denen er eine komische Aufmerksamkeit widmete. Bald wurde eine derselben erweitert, bald eine verschüttet und geebnet, eine neue angelegt, dieselbe wieder zugeworfen etc. Nur in diesen Senkgruben setzte er Losung und Harn ab. Bei großer Kälte schleppte er Heu und Stroh aus der Hütte in den Bau hinunter, verstopfte die Löcher von innen, warf oft vierundzwanzig Stunden vor Eintritt des Thauwetters plötzlich alles wieder hinaus und rannte dann fröstelnd im Zwinger auf und ab, bis er in das Haus oder einen frostfreien Stall gebracht wurde.
»Infolge seiner außerordentlichen Reinlichkeitsliebe durfte er im Hause frei umherwandern. Besonderes Vergnügen schien es ihm zu machen, auf den Treppen auf und ab zu trippeln; nicht selten trabte er aber auch ganz einsam und still auf dem Speicher umher, den Kopf neugierig in alle Ecken steckend. Als eine besondere Gunst betrachtete er es, wenn er während des Mittagsessens bei mir bleiben durfte. Er drängte dann den Hühnerhund einfach bei Seite, richtete sich auf den Hinterläufen in die Höhe, legte die Vorderläufe und den bunten, glatten Kopf auf meine Schenkel und forderte unter dem üblichen »Hu, gu, gu, gu« ein Stückchen Fleisch, welches er sodann sehr geschickt und zart mit den Vorderzähnen von der Gabel zog. Im Winter liebte er es, sich vor den Ofen platt aus den Rücken zu legen und den breiten, dünn behaarten Wanst der Wärme zuzukehren.
»Im Sommer begleitete er mich sehr gern zu einem Streifen dichten Gehölzes, in welchem er sich vollkommen heimisch fühlte und bei jedem Schritte neue Entdeckungen machte. Bald fing er eine Hummel oder zog einen Wurm aus der Erde, bald suchte er abgefallene Beeren auf, bald verarbeitete er eine braune Wegschnecke mit seinen Nägeln. Auf dem Heimwege folgte er mir verdrossen auf den Fersen, begann aber bald an meinen Beinkleidern zu zerren. Ein derber Tritt mit der Breitseite des Fußes ermunterte ihn nur noch, mit seinen plumpen Späßen fortzufahren; dagegen verstimmte ihn der leiseste Schlag mit der Hand oder einer Gerte aufs äußerste.
»Während der Dauer des Haarwechsels, etwa von Mitte des April bis zu Anfang des September, war der Dachs ziemlich dürr und mager. Dann mehrte sich plötzlich seine Eßlust und damit gleichzeitig seine Fettleibigkeit. Gegen Ende Oktobers war er bereits so fett, daß er beim Traben keuchte. Als Allesfresser liebte er gemischte Kost: Küchenabfälle, Rüben, Möhren, Kürbis, Fallobst mit Hafermehl zu einem steifen Brei gekocht, dazu einige Stücke rohes oder gekochtes Fleisch bildeten seinen Küchenzettel. Pflaumen und Zwetschen, welche er im Garten aufsuchte und, nach oberflächlichem Zerkauen, mit den Steinen verschluckte, waren seine Lieblingskost. Rohes Fleisch verdaute er weit langsamer als Füchse und Hunde, fraß es jedoch mit Gier, selbst das von Katzen, Füchsen und Krähen, welches letztere ich ihm vorzugsweise reichte. Indeß hatte sein ganzes Benehmen durchaus nichts Raubthierartiges, und wenn er zur Herbstzeit so still gefräßig an seinem Troge stand und im Vollgenusse mit den Lippen schmatzte, erinnerte er mich immer an ein kleines chinesisches Mastschweinchen.
»Die Ausführbarkeit einer förmlichen Dachszüchterei schien mir damals keine Schwierigkeiten zu haben, und ich möchte den Versuch, Dachse zu züchten, noch heute allen denen empfehlen, welche nicht, wie Schreiber dieser Zeilen, eine Abneigung gegen Dachsbraten haben. Zu Anfang Oktobers stellte sich bei meiner Fehe unverkennbar der Fortpflanzungstrieb ein; doch schien es mir, als ob die Dauer der Ranzzeit nicht über einige Tage hinausginge. Leider wollte ein eigener Unstern, daß es mir trotz aller Bemühungen nicht gelang, in der Umgegend meines Wohnortes einen männlichen Dachs aufzutreiben. Mehrere junge Dachse, welche ich aufzuziehen versuchte, waren beim Einfangen beschädigt worden und gingen, trotz ihres anscheinend gesunden Aeußeren, später an inneren Verletzungen ein: kurz, meine Fehe blieb ohne Gatten.
»Trotz vieler lobenswerthen Eigenschaften des Dachses möchte ich denselben doch nicht als Hausthier für Jedermann empfohlen haben, am allerwenigsten aber als Spielkameraden für Kinder. Abgesehen von seinen oft sehr derben Späßen hat er die üble Gewohnheit, vor unliebsamen Erscheinungen aufs heftigste zu erschrecken. Er fährt dann zitternd und schnaufend eine Strecke zurück, sträubt das Haar und schießt aus reiner Verzweiflung tollkühn auf den Gegenstand seines Schreckens los.
»Mein guter Kaspar fand an einem schönen Herbstmorgen ein schmähliches Ende. Er hatte, wahrscheinlich sanfteren Regungen folgend, über Nacht seinen Zwinger verlassen, war in allen umliegenden Gemüsegärten und Rübenfeldern umhergestreift und kehrte gegen Morgen ganz vertraut in einem etwa eine Viertelmeile von meiner Wohnung entfernten Gehöfte ein. Hier ward er von den zusammengelaufenen Bauern für ein »wildes Ferkel« gehalten und trotz verzweifelter Gegenwehr nach Bauernart mit dem gemeinen Knüppel erschlagen.«
Kjärbölling erhielt ein trächtiges Dachsweibchen, welches später zwei Junge warf, sie mit größter Zärtlichkeit und Fürsorge pflegte, und währenddem alle frühere Schüchternheit ablegte. Gegen jede Störung zeigte sich die Fehe höchst empfindlich, stellte sich bei Annäherung eines Menschen zähnefletschend an das Gitter und suchte dem Wärter den Eintritt in den Käfig zu wehren. Als die Jungen herangewachsen waren, spielte die Mutter mit ihnen in anmuthiger Weise.
Der Nutzen, welchen der getödtete Dachs bringt, ist ziemlich beträchtlich. Sein Fleisch schmeckt süßer als Schweinefleisch, erscheint aber manchen Menschen als ein wahrer Leckerbissen. Die wasserdichten, festen und dauerhaften Felle, von denen, nach Lomer, jährlich 55,000 Stück im Werthe von 123,000 Mark auf den Markt kommen, werden zu Ueberzügen von Koffern und dergleichen verwendet; aus den langen Haaren, namentlich aus denen des Schwanzes, verfertigt man Bürsten und Pinsel; das Fett gebraucht man als Arzneimittel oder benutzt es zum Brennen.