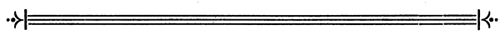|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Elysium-Theater
Der Maler Bernhart stand in seiner Dachstube und starrte auf die graue Leinwand auf seiner Staffelei, als die Tür geöffnet wurde und in ihren Rahmen eine militärische Figur trat, die sich den Kopf rieb und dann, als gälte es, eine besondere Höflichkeit auszuüben, einen kübelartigen Tschako aufsetzte und einige Finger daran legte. Es war die schönste Lustspielfigur, die man sich denken konnte. Bernhart konnte nur mit der größten Mühe das Lachen verbeißen, als er die Figur betrachtete, die sich offenbar im Gang den Kopf angerannt hatte und sich den Fleck rieb, während sie noch nicht ganz mit ihren Gedanken in Ordnung war.
Es war ein langer, dürrer Mann mit glattrasiertem Gesicht. Der Schnurrbart, welcher sonst bei militärischen Personen unter der Nase zu sitzen pflegt, saß bei ihm über der Nase, denn die Augenbrauen hatten eine Länge und Stärke erlangt, die ihnen das Ansehen eines Schnurrbartes gaben, worunter ein Paar kleine graue Augen hervorblickten, zwischen denen ein Exemplar von Nase hing, in der sich eine Farbenanalyse aller in Hamburg gangbaren Rotweine gesammelt hatte, womit der Besitzer gewöhnlich von seinen Mannschaften traktiert wurde. Die Nase sah einem Stück Bimsstein, das lange in einem Rotweinfaß gelegen, sehr ähnlich.
Den martialischsten Effekt machten aber die Beinkleider des Kriegsmannes, die einem gefangenen Feinde glichen, den die Hosenstege von unten packten und festhielten, während er sich nach der Gegend des Knies zurückzuziehen versuchte, wo durch vieles Treppensteigen ein Paar Knuppen herausgedrückt waren, wie man sie bei den alten Ritterrüstungen sieht. Der Mann war Feldwebel der Bürgergarde und hatte die Bestellungen zu den Wachen zu besorgen, weshalb er einige Zettel in der Hand hielt, aus denen er einen hervorsuchte, als er sich von dem Puff am Balken einigermaßen erholt hatte.
»Sie haben am Sehnten auf die Wache su siehen«, sagte er, Bernhart den Zettel hinreichend.
»Ich soll auf die Wache ziehen?« rief dieser verwundert aus, »das muß ein Irrtum sein.«
»Is ganz richtig. Am Sehnten – Herr Bernhart – Kunstmaler – Burstah«, sprach der Feldwebel, ihm den Zettel schmunzelnd hinhaltend, wobei er sich schlau rund umsah, um den Ort zu entdecken, wo vielleicht eine Weinflasche hervorkommen könnte.
Bernhart nahm den Zettel und las mit maßlosem Erstaunen, daß er richtig am Zehnten eine Wache da und da beziehen solle.
»Aber um Gottes willen, wie komme ich denn zum Wachdienst! Ich bin ja bei gar keiner Truppe und habe weder eine Flinte noch sonst was!« sprach er.
»Das ist egal. Am Sehnten müssen Sie die Wache besiehen«, antwortete der Kriegsmann.
»Nun gut, ich werde kommen«, sagte Bernhart ganz ernsthaft, indem er den Zettel an das Fenster steckte.
Der Feldwebel riß den Mund auf und starrte den zusagenden Wachmann an, indem er förmlich erschrocken über eine Dienstwilligkeit war, die er weder suchte noch erwartete.
»Sie wollen auf die Wache siehen?« fragte er ungläubig. Bernhart nickte mit dem Kopfe.
»Selbst?« fragte der Feldwebel ganz verwirrt.
»Mit diesen zwei Beinen!« versicherte Bernhart, sich auf die Schenkel klopfend.
»Sie haben ja aber keine Flinte und keinen Säbel«, sagte der Kriegsmann sehr kleinlaut.
»Oh, die kriege ich schon. Ich habe einen Bekannten, der hat eine Menge Flinten aus allen Zeitaltern. Mit Luntenschlössern, Radschlössern, Feuerschlössern, – Wallbüchsen, – Entenflinten, – da kann ich alles kriegen«, sprach Bernhart zuversichtlich.
»Aber Sie können vielleicht nicht exersieren«, meinte der Feldwebel.
»Oh, ausgezeichnet! Exerzieren, Voltigieren, Bajonettfechten, Schlagen, Stoßen, alles was Sie nur wollen.«
»Herrgott! Se verstohn awer keen Plattdütsch!« schrie der verzweifelte Feldwebel. »Un wenn denn in de Nacht een kummt – –«
»Den spieße ich ohne weiteres auf das Bajonett, sobald er mir zu nahe kommt«, entgegnete Bernhart entschieden.
»Da haben wir's. Sie verstehen den Dienst nicht und sollten sich doch lieber 'n Stellvertreter besorgen lassen. Es kost nur zwei Märk. Was wollen Sie sich auf der Wache rumtreiben«, sprach der Feldwebel schmeichelnd, denn es war ihm daran gelegen, die Wache bezahlt zu erhalten, worauf eigentlich die ganze Maßregel hinausläuft, weil es damals eine Menge verdorbener oder arbeitsscheuer Handwerker gab, die den Bürgergardendienst permanent betrieben und sich für die zwei Mark, die von Fremden und Geschäftsleuten regelmäßig bezahlt wurden, wenn ihnen die Republik eine Wache zumutete, gern vierundzwanzig Stunden auf dieser herumdehnten oder sich als militärische Karikaturen vor das Schilderhaus stellten und eine jämmerliche Rolle als Soldaten spielten.
Daß ein Fremder eine Wache selbst tun wollte, war etwas so Unerhörtes, ganz außer aller Berechnung Liegendes, daß der Feldwebel fast den Verstand darüber verlor und sich ebensowenig zu helfen wußte, als wenn er mit seiner Mannschaft eine Batterie (d. h. nicht Flaschen) hätte nehmen sollen. Außerdem büßte er dabei noch acht Schillinge ein, denn wenn die Gepreßten gewöhnlich einen preußischen Taler hergaben, so konnte er die acht Schillinge, welche herauszugeben waren, niemals finden, und sie fielen ihm in der Regel zu.
Da nun Bernhart die Wache durchaus selbst tun wollte, so blieb dem Manne nichts übrig, als sich zurückzuziehen. Er steckte jedoch den Kopf zur Tür herein und bemerkte, daß er doch lieber am Neunten noch einmal nachfragen wolle, was Bernhart ganz zufrieden war, da er dann längst in Neumühlen saß, wohin er andern Tages ging, um die Villa zu malen.
Der Feldwebel kroch fast auf allen vieren unter dem Balken hinweg, an dem er sich den Kopf beinahe eingerannt. Er hatte diesmal ein sehr schlechtes Geschäftchen gemacht, denn erstens erhielt er einen Puff an den Kopf, wie er in seiner ganzen militärischen Laufbahn noch keinen bekommen, dann gab es nichts zu trinken, und schließlich kam er gar noch um seine acht Schillinge, auf die er mit mathematischer Sicherheit rechnete. Seine Soldatenrolle war ihm gänzlich mißlungen. Er stieg fluchend die Treppen hinab und suchte vor der Haustür einen Zettel aus, durch dessen Abgabe ihm ein Glas Rotwein gesichert erschien. In dieser Hoffnung leckte er sich die Lippen und ging dann weiter, bis er vor dem Hause des Senators Eiskuhl kerzengerade stehenblieb, denn Herr Eiskuhl trat eben, blendend wie immer, vor die Tür und blickte nach dem Glockenspiel des Petriturmes hinaus, das sich erlaubt hatte, auf eine etwas nachlässige Art und mit Hinweglassung einiger Töne zu spielen: ein Versehen, wofür ihm der Senator einen strengen Blick zuwarf.
Herr Eiskuhl war eigentlich der Kriegsherr des Feldwebels, weshalb dieser wie ein Laternenpfahl, mit den Fingern am Tschako, dastand, bis ihm sein hochweiser Befehlshaber einen gnädigen Blick schenkte. Der Hochweise hatte ihn eben angelächelt, als plötzlich ein dunkler Gegenstand dicht vor der Bimssteinnase des Kriegers vorbeifuhr und sich auf die schneeweiße Brust Eiskuhls heftete, wo sich ein langer schwarzer Streifen zeigte, der unter der Weste verschwand, während aus dieser ein Stück Baurohr hervorstand. Der Schaft eines Pfeiles, dessen Spitze aus einem Klumpen Werg und Teer gebildet war. Eine schändliche Waffe, von verruchter Hand abgeschossen, um den Stolz des Senators, die weiße Leinwand, anzuschwärzen.
Herr Eiskuhl stand da wie Geßler, als ihm Tell zurief: »Du kennst den Schützen.« Leider kannte ihn aber der Senator nicht und sah sich umsonst nach ihm um. In der Hand hielt er einen Pfeil und blickte entsetzt auf die beschmutzte Hemdenbrust. Als er den ganzen ungeheuren Frevel erkannte, drückte er dem Feldwebel das unheilvolle Instrument in die Hand und befahl ihm, den meuchlerischen Schützen sofort zu verhaften, worauf er in sein Haus zurückrannte, in dem zum Glück die Senatorin nicht anwesend war. Sie wäre sonst über sein gemeines Aussehen in Ohnmacht gefallen.
Der tapfere Feldwebel stand aber noch regungslos dort und hielt den Teerpfeil auf Armeslänge von sich, als wäre es eine unbekannte, höchst gefährliche Waffe, die jeden Augenblick losgehen und den eigenen Träger umbringen könnte. Er sah sich dabei nach dem verborgenen Schützen oder irgend jemand, den er dafür nehmen könnte, um. Da er aber keinen Geeigneten fand, so lehnte er das Geschoß vorsichtig an die Treppenpfeiler und machte sich aus dem Staube.
Schnepfe und Spickmann jun. hatten sich am Gänsemarkt getroffen und nahmen eine Droschke, die sie nach dem Trichter Trichter. Es gab zwei Trichter in Hamburg, einen in St. Georg bei der Kirchenallee (Münchs Trichter) und einen in St. Pauli; hier ist dieser gemeint, der ein bekanntes Kaffeehaus war. Die Franzosen hatten hier einen Torpavillon, auch Mischels Trichter nach seinem trichterförmigen Dach genannt, zerstört. Nach ihrem Abzug wurde der Trichter in größeren Dimensionen wieder errichtet und existierte bis in die sechziger Jahre. Später Mutzenbechers Wirtschaft, dann Hornhardts Etablissement, und jetzt wieder Trichter. brachte.
Hierauf gingen sie nach den Spielbuden hin und wurden ganz besonders vom Elysiumtheater gefesselt, wo der »Freischütz« angezeigt war.
Fürst Ottokar stand höchst eigenhändig vor der Tür und lud das Publikum zum Besuch der Oper ein. Dies war sehr herablassend von dem wackeren Fürsten, wenn man bedenkt, daß er den ganzen Vormittag einen Karren mit geräuchertem Stör herumgefahren und verkauft, daß er dann die Theaterzettel geschrieben und angeklebt hatte, wonach ihm nur wenig Zeit blieb, sich in sein glänzendes Kostüm zu werfen, da er erst eine Eule und einen Samiel zur Wolfsschlucht auftreiben mußte.
Es war jedoch keine Übereilung in seiner Toilette zu bemerken. Der reiche Hermelinpelz von Kaninchenfell, der die Seele dieses Theaters war und in allen Stücken spielte, lag prachtvoll auf seinen Schultern. Der Helm, in dem er den Ottokar wie den Karl Moor, den Don Juan wie den Mephistopheles spielte, saß glänzend auf seinem Kopfe und hatte die alte Gewohnheit, sein Visier alle halbe Minuten zuzuschnappen und ihm das Wort von dem Munde abzuschneiden, was ihm jedoch Gelegenheit gab, eine nachlässige Grazie zu entfalten, wenn er mit der Rückseite des gelben Ritterhandschuhs das Visier wieder hinaufschlug, als scheuche er nur eine zudringliche Fliege hinweg.
Da der Fürst das Interesse bemerkte, das Schnepfe und Spickmann an ihm fanden, so richtete er seine Aufforderungen, die Kunst zu unterstützen, an sie, und zwar hochdeutsch, soviel ihm das möglich war.
»Treten Sie ein, meine hohen Herrschaften, und sehen Sie sich das unsterbliche Werk der großen Komponistin Maria Weber an.« (Er hatte sich nämlich in den Kopf gesetzt, daß Weber ein Frauenzimmer gewesen sei.) »Treten Sie ein. Sie werden sich nicht langweilen, denn wir haben alles Unnötige weggelassen und –«
Hier schnappte ihm das Visier die Fortsetzung weg, ward jedoch sogleich mit einer geschickten Handbewegung wieder auf den Helm geschleudert, worauf der Fürst fortfuhr: »… bleiben nur bei der Hauptsache. Dafür sind unsere Preise skandalös, unter dem Hund billig. Der erste Platz – Parkett – kostet veer Schilling, der zweite zwei und der dritte, ich schäme mich als Künstler fast, es zu sagen, einen Schilling.«
Die beiden jungen Leute konnten nicht mehr widerstehen und gewannen die ganze Gunst des Fürsten, als Spickmann einen Taler für zwei Parkettsitze bezahlte, wofür Seine Durchlaucht, der nebenbei Regisseur und Dekorationsmaler war, den sofortigen Anfang der Oper ins Werk setzte und das Orchester aus dem Keller von Pries holte, wo es eben, in Gestalt eines jungen Mannes vereinigt, ein Glas Bier trank.
Der junge Mann, der in einer Balltracht erschien, die sich im letzten Stadium ihres irdischen Daseins befand – denn der Frack begann weiß und die Glacéhandschuhe schwarz zu werden –, kam langsam hereingeschlendert und ergriff den Deckel eines Pianofortes, den er auf dieselbe nachlässige Art hinaufschleuderte, wie dies der Fürst mit seinem Visier tat. Dabei betrachtete er das Publikum sehr geringschätzig und warf besonders auf Schnepfe und Spickmann einen unbeschreiblich verächtlichen Blick, der diese ungemein belustigte.
Der Jüngling spielte offenbar nur aus Gefälligkeit, denn als der Fürst den Kopf hinter dem Vorhang hervorsteckte und »An…« – das Visier schnappte herunter und wieder hinauf – »…fangen« schrie, steckte er die Hände in die Hosentaschen und suchte die Stimme im Publikum. Erst als ihn der Fürst mit seinem Titel »Kapellmeister« ansprach, war er so gefällig, sich halb auf einen Stuhl niederzulassen und mit dem bekannten C der Ouvertüre zu beginnen. Er wahrte jedoch den Künstlerstolz, indem er seinen etwas baufälligen Maschinenhut auf dem Kopfe behielt und die Zigarre im Munde wie einen Taktstock auf und ab bewegte.
Die Ouvertüre war vorbei, und der Vorhang hob sich, indem der Schuß fiel, den der Regisseur dadurch bewerkstelligte, daß er mit einem Stocke auf einen Tisch hieb. Ein Fingerzeig für alle Regisseure, die ihrem Direktor Pulver sparen wollen.
Wenn der Fürst erklärte, daß alles Unnötige weggelassen sei, so bestand das darin, daß besonders die Chöre sämtlich gestrichen waren. Auch die großen Arien waren in der Art vereinfacht worden, daß die Vortragenden deren ungefähren Inhalt dem neugierigen Publikum gesprächsweise mitteilten. Er hatte überhaupt den »Freischütz« zu einem Melodrama gemacht, wobei er hier und da für die etwas veralteten Lieder passende neue einlegte. So sang der Kaspar statt des Trinkliedes: »Eins ist eins und drei sind drei«, die für seinen Charakter ganz angemessene Arie: »Ick jehe meinen Schlenderjang und tu, wat mich gefällt«, worauf er, statt der einfachen Tanzstellungen, die er sonst gewöhnlich vor dem betrübten Max ausführt, eine vollständige Hornpipe zum besten gab, die der talentvolle Regisseur, in Betracht des Matrosenpublikums, hier sehr geschickt eingelegt hatte.
Der Schuß nach dem Adler war wiederum ein Meisterstück dramatischer Täuschung; denn da Max seine Bürgerwehrflinte, von der man das Bajonett abzunehmen vergessen, nicht gut in den Himmel stecken konnte, so sprach Kaspar, in die Kulisse deutend: »Kiek! süst du da buten bi Blankenes' den grooten Steenadler – da, gliek öwer den Süllbarg! – Scheet!« – Und Max steckte den Schießprügel in die Kulisse und knallte ein Zündhütchen los, während der Fürst a tempo mit dem Stock auf den Tisch hieb, worauf sofort ein ungeheuerliches Vieh, ein alter ausgestopfter Albatros, hinter dem Rücken des Max herunterfiel und aus Bosheit drei Lichter am Proszenium ausschlug, was den Fürsten verleitete, dem Kapellmeister den unwürdigen Antrag zu machen, sie wieder anzuzünden. Dieser hatte nur stille Verachtung für eine solche Schmach. Mit dem verhängnisvollen Schuß war der erste Akt zu Ende, und der zweite begann sofort mit der Wolfsschlucht.
Das erste Erfordernis einer solchen, dicke Finsternis, lag auf der Bühne und ließ nur mühsam die Gestalt Kaspars erkennen, der in einer Gefängnisdekoration den Zauberkreis mit Ziegelsteinen legte, während der Fürst hinten das schauerliche »Uhi« des Geisterchores sang, und zwar in einer andern Tonart, als es der Kapellmeister vorn spielte, der fortwährend »höher« schrie. Die Geister singen aber stets nach eigenem Belieben und kümmern sich um keine Tonarten.
Kaspar ließ sich durch den Zwiespalt von Chor und Orchester nicht stören und arbeitete trotz allen Schrecknissen ruhig weiter, wozu in Anbetracht der furchtbaren Umgebung viel Mut gehörte. Der Regisseur hatte nämlich von einem Nachbar, der eine Art Raritätenkabinett besaß, mehrere Sachen entliehen und im Vordergrund der Wolfsschlucht aufgestellt, die diese ohnehin schauerliche Gegend noch furchtbarer machen mußten.
Eine Eule konnte er zwar nicht auftreiben, dafür stand jedoch ein ausgestopfter Storch drohend an der Seite, den einige dergleichen Seehunde unterstützten. Ein getrockneter Haifisch paßte vortrefflich in die Wolfsschlucht und sah neugierig von einer Art Baum dem Kaspar zu.
Jetzt wurde das heillose Kompaniegeschäft der Freikugelfabrikation mit einem alten Suppenlöffel eröffnet, wobei Kaspar die Ankunft des wilden Heeres prophezeite.
Er hatte dieses kaum erwähnt und seinen Suppenlöffel dabei in der Luft geschwungen, als auf dem letzten Platze ein so gräßlicher Lärm losbrach, daß sich alle Zuschauer in Erwartung einer Prügelei danach umkehrten. Es war aber nur das wilde Heer, das der Regisseur von den etwa zwanzig Freibillettlern dort aufführen ließ, weil ihm die Gegend dazu sehr geeignet erschien. Die zwanzig taten, was möglich war, und arbeiteten mit Bellen, Pfeifen und Stampfen für hundert, und da der zweite Platz auch einfiel, so konnte das wilde Heer mit jedem Hoftheater in die Schranken treten und erhielt allgemeinen Beifall, womit der zweite Akt schloß.
Nach dem Schluß des zweiten Aktes trat der Fürst in das Parkett und erkundigte sich huldvoll, wie den Herren die Oper gefiele und ob sie keinen Durst hätten, in welchem Fall er ihnen ein Glas Punsch oder Rotwein verschaffen könne.
Spickmann, der erst kürzlich den »Freischütz« im Stadttheater gesehen, war ganz verblüfft über diese Bearbeitung. Da sie aber Schnepfe für »himmlischen Schund« erklärte, so kam er plötzlich auf die Idee, daß man die Kunst unterstützen müsse, und bestellte drei Bowlen Punsch für die Schauspieler, was den Erfolg hatte, daß alle Spielenden im dritten Akt ihre Worte an ihn richteten, daß der Fürst in fortwährendem Kampf mit seinem Visier lag. Als Finale spielte der begeisterte Kapellmeister die Melodie: »Der Graf von Luxemburg hat all sein Geld verjuxt, juxt, juxt«, was diesmal keine Einlage des Regisseurs, sondern eine boshafte Anspielung auf Spickmann als Dank für den Punsch war. Denn der Kapellmeister, ein verkanntes Genie, trank zwar gern Punsch, hatte aber eine Wut auf alle Leute, die sich in Verhältnissen befanden, in denen sie sich diesen Genuß immer verschaffen konnten, während er stets auf jemand warten mußte, der ihn damit bewirtete.
»Was fangen wir nun an?« fragte Schnepfe, als er mit Spickmann wieder vor dem Theater stand.
»Ich habe fürchterlichen Durst«, ächzte dieser.
»Sie tranken ja aber eben zwei Glas Punsch!« sprach Schnepfe erstaunt.
»Nun, gerade deshalb. – Gehen wir in die Stadt und trinken ein paar Flaschen Champagner.«
»Um's Himmels willen!« schrie Schnepfe. »Sie werden sich einen Millionenhaarbeutel holen und haben morgen einen Kater, wenn Sie Ihren Heiratsantrag machen wollen.«
»Schwerenot noch mal, Doktor, Sie haben recht. – Trinken wir nur eine Flasche Clicquot zur Abkühlung. Muß heute noch mit meinem Alten reden. Morgen an der Börse alten Stubborn. Nachmittags junge Stubborn. Abends um zehn Uhr in Alsterhalle, bringe Nachricht, ob gewonnen oder verloren.«
»Gut. Ich werde den Professor mitbringen. Wenn Sie Glück machen und das Jawort erhalten, wie es gar nicht anders möglich, dann stecken Sie ein paar grüne Weidenblätter ins Knopfloch« – damit ich gleich weiß, ob ich ausreißen muß oder nicht, dachte Schnepfe.
»Weidenblätter ins Knopfloch?« sprach Spickmann überlegend. »Das ist mir im ganzen Journal nicht vorgekommen. Ist nicht Mode«, erklärte er kopfschüttelnd.
»Wenn Sie es tragen, dann muß es Mode werden«, sagte Schnepfe bestimmt.
»Äh – meinen Sie?« lachte das Kalb.
»Ich versichere Ihnen, wenn Sie es tragen, sind in acht Tagen alle Büsche in der Umgegend kahlgerupft, und die Börse sieht aus wie ein großer Weidenbusch«, erklärte der boshafte Schnepfe.
»Nun denn – wenn ich Jawort kriege, sollen Sie Weidenzweig sehen. He, ist das nicht Professor, was da an Alster kommt?« fragte Spickmann.
Beide waren an der Alster angekommen und trafen richtig Bernhart, der daher kam und sich schon seit einer Stunde nach Schnepfe umsah, dessen Ausbleiben ihm unerklärlich erschien. Die jungen Leute erzählten von den Erlebnissen im Theater und gingen, eine Flasche Champagner darauf zu trinken, in der jedoch für den vorhandenen Durst viel zu wenig Nasses war. Es kam zu noch einer und noch einer und so weiter, wie jeder weiß, der sich einmal vorgenommen hat, mit mehreren Freunden eine Flasche von diesem verhexten Wein zu trinken, der von selbst aus der Flasche zu verschwinden scheint.
Spickmann erklärte endlich, daß er sich heute himmlisch amüsiert habe, und daß er den letzten Tag seiner Freiheit ge–nos–sen. Und wenn er morgen keinen Weidenbusch im Knopfloch trage, er sich den Hals mit einem Mühlstein verzieren und ein Bad nehmen werde, worauf er sich selbst bitterlich zu beweinen begann, indem er auf die Idee kam, daß er sein eigener alter, untröstlicher Vater sei, der sich beim Angeln in der Bille finde, worauf er herzbrechend »Mein Sohn! mein armer Sohn!« schluchzte.
Seine Freunde suchten ihn damit zu trösten, daß an dem Bengel nicht viel verloren sei. Er bestand aber darauf, daß die Stütze seines Alters zer–bro–chen worden und seine einzige Hoffnung der Nacht–wäch–ter bleibe, den er an Kindes Statt an–neh–men wolle.
Auf diese Idee hatte ihn jedenfalls ein solcher Beamter gebracht, der schmunzelnd in der Nähe stand. Schnepfe glaubte, daß es am Ende besser sein würde, wenn der nächtliche Beamte Spickmann an Kindes Statt annehme und ihn nach Hause bringe. Da er aber seine Wohnung nicht wußte, so wollte er sie eben von ihm herauszufragen suchen, als der Nachtwächter sagte:
»Oh, wir kennen ihn schon. Von mir kriegt 'n Smittgen an der Ellerntorsbrücke, dann kriegt 'n Leikens an 'n Graskeller, dann Jan am Altenwall, Heikens am Rathausmarkt, un so kömmt er dusemang nach 'n Holzdamm. So, mien goode Herr. Oh, holl di jo ni upp!« sprach der gute Wächter zärtlich, als Spickmann in einen Keller zu fallen versuchte, und er ihn festhielt. »Man ümmer vorut – en bitten mehr Stürboord – Backbord sünd slimme Kellers. – So, Smittgen, ik krieg veer Schilling«, sprach der Wächter, ihm Spickmann übergebend, worauf Smittgen diesen zärtlich weiterschaffte und an Leikens gegen acht Schillinge abgab, der ihn wiederum für zwölf Schillinge an Jan verkaufte, so daß Spickmann endlich vierundzwanzig Schillinge wert war, als er bei seinem Hause ankam, wo er vom Hausknecht auch ohne Widerrede gegen diese Summe übernommen und zu Bett gebracht ward. Es ging ihm wie einem Wechsel, für den auch immer mehr bezahlt wird, je näher er seiner Heimat kommt.
Bernhart und Schnepfe kamen zwar allein, aber nicht ohne einiges Gepolter nach ihrem Dachstübchen hinauf und schliefen bald den Schlaf der Gerechten.