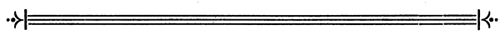|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Pavillon in Neumühlen
Die Villa Eiskuhl, die zwischen großen Baumgruppen am Ufer der Elbe versteckt lag, hatte ihren langen Winterschlaf ausgeträumt und war heute zum vollen Leben erwacht. – Unter einigen alten Linden, kaum fünfzig Schritt vom Flußstrande entfernt, stand ein kleiner, von wildem Wein umrankter Pavillon, aus dem man die ganze Elbe und den Garten der Villa übersehen konnte. Es war ein herrlicher Platz, besonders gegen Abend, wenn die Sonne zwischen den nächsten Bäumen niedersank und ihre goldenen Strahlen durch die Zweige spielen ließ, während sie über den Fluß glänzende horizontale Streifen zog, in denen die Schiffe wie in glühendem Metall schwammen. Auch in den warmen Sommernächten war der Ort reizend. Dann wehte der kühle Nachtwind durch die Weiden herauf, oder der Mond stand gerade über dem Fluß, den er mit zitterndem Silberflitter überzog.
Es war der Lieblingsaufenthalt der Frau Senatorin, die hier gern in Gesellschaft der neuesten Romane, d. h. nur französischer, die Mitternacht herbeikommen ließ, schwärmerisch nach dem Mond blickte und von dem Mann träumte, den sie so oft in den Romanen, aber leider nicht in Herrn Eiskuhl gefunden hatte.
Auf einer kleinen Erhöhung, dem Pavillon gegenüber, lag im Gebüsch versteckt eine Einsiedelei von der Größe eines etwas geräumigen Papageibauers. Diese hatte sich Selma, die ältere Tochter Eiskuhls, zugeeignet.
In ihr stand eine niedliche Staffelei nebst allerlei Mal- und Zeichenutensilien sowie ein Miniaturschreibtisch, eine Art poetischer Falle, worin dichterische Eingebungen des Augenblicks gefangen wurden.
Fräulein Selma hatte früher sogar einmal versucht, ein Pianoforte hineinzubringen. Da man jedoch die Einsiedelei eher in das Pianoforte gebracht hätte, so mußte eine Gitarre es ersetzen, und diese war eigentlich schon zu groß für das Gebäude.
Sowohl Madame Eiskuhl wie Fräulein Selma waren in ihren »Heiligtümern«, wie sie die Pavillons nannten, beschäftigt, alles für die poetischen Stunden des Sommers herzurichten.
Kein männliches Wesen durfte diese Räume betreten. Am wenigsten der Senator, der sich früher einigemal erlaubt hatte, bei Abwesenheit der Damen ein Pfeifchen dort zu rauchen, was sogleich durch den Geruch entdeckt wurde. Als man Herrn Eiskuhl in flagranti ertappte, wurde er für ewige Zeiten aus den geheiligten Räumen verbannt, worauf er sich in das Gewächshaus flüchtete, das seine jüngste Tochter Emma bewohnte, die ihn gutmütig fortrauchen ließ.
Deshalb stand denn auch Henri oder Herr Henri, wie er von seinen Kollegen genannt zu werden verlangte, inmitten der beiden Pavillons und sah, die Hände müßig unter die Frackschöße gesteckt, abwechselnd von einem zum andern. Man darf nicht denken, daß Herr Henri etwa eine Livree wie andere gemeine Diener trug. Madame Eiskuhl sah in ihm mehr einen Kammerdiener und ließ ihn deshalb stets im Ballanzug umhergehen. Nur am Band seines Zylinders war ein ganz kleines Zeichen seiner Sklaverei angebracht, das silberne Wappen der Madame, von der Größe eines Schillings, das Herr Henri indes durch die Enden des Bandes zu verstecken wußte.
So kam es denn, daß er von Fremden öfter, zum großen Ärger des Senators, für einen Verwandten oder gar für den Schwiegersohn angesehen wurde, was er mit stiller Resignation hinnahm. Er wäre auch gar nicht abgeneigt gewesen, dem Herrn Senator als Eidam die Last einer Million tragen zu helfen, ja, er glaubte sogar ein ganz besonderes Talent zur Verwendung einer Rente von fünfundzwanzig- bis dreißigtausend Talern zu besitzen, denn er fühlte eine große Neigung, früh um halb zehn Uhr aufzustehen, gegen zwölf Uhr einige Austern mit Portwein oder im schlimmsten Fall etwas Hummersalat mit St. Julien zu frühstücken, dann etwas spazierenzufahren und um fünf Uhr zu dinieren, so daß ein Souper um zehn oder elf Uhr in Wilckens Keller nicht zu früh erschien.
Leider hatte ihn Madame Eiskuhl, als er einmal, in stille Bewunderung versunken, Selma von weitem betrachtete und schwiegersöhnliche Luftschlösser zu bauen begann, beiseite genommen und ihm bestimmt erklärt, daß er sie ansehen könne, soviel er Lust habe, auf ihre Töchter dagegen niemals mehr sein Auge werfen dürfe, wenn er nicht sofort entlassen sein wolle.
Henri küßte damals demütig die Land seiner Gebieterin und beteuerte, daß er sich nur ihrem Dienst geweiht habe, wie Fridolin der Gräfin von Savern, und daß er das Fräulein nur so aufmerksam betrachtete, weil er im ersten Augenblick nicht gewußt habe, ob es die Frau Senatorin oder ihre Tochter gewesen sei.
Der Halunke log dabei so, daß er von der Tochter, wenn sie es gehört, eine Ohrfeige, und von der Senatorin, wenn sie ein bißchen gesunden Menschenverstand und etwas weniger Eitelkeit besessen, die andere dazugehörige erhalten hätte.
Madame Eiskuhl war zwar mit ihrer älteren Tochter von einer Größe, hier hörte jedoch alle weitere Ähnlichkeit auf, denn von der jüngeren ganz abgesehen, die ein kleines rundes Ding war, erschien die Senatorin gewachsen wie ein Talglicht. Sie bestand aus lauter Ecken. Man konnte sie betrachten, von wo aus man wollte, man bekam eine Ecke zu Gesicht.
Wenn ein Dichter die lange Röhre, auf der ihr Kopf saß, einen Schwanenhals genannt hätte, so wäre der Ausdruck ganz richtig gewesen. Vom Goldhaar haben die Dichter auch oft gesungen. Dies besaß Madame Eiskuhl, was die Farbe betraf, zwar in vollem Maße, sie liebte jedoch mehr ein schwarzes Haar und färbte deshalb den etwas dünnen Bestand ihres Hauptes alle vierzehn Tage einmal auf. Die Farbe hätte recht gut einen Monat gehalten, da aber die Haare nachwuchsen, so schimmerte bald nach der Färbung ein roter Grund unter dem Schwarz hervor und machte eine Nachhilfe nötig.
Die Nasenspitze, die von allen Ecken an der Frau Senatorin die schärfste war, konnte sie jedoch nicht färben. Sie hatte es einmal mit Fettschminke, wie sie die Schauspieler brauchen, versucht. Da die Mimen aber ganz besondere Ansichten von roten Backen und Fleischfarbe haben, so erhielt sie eine solche vom schönsten Rosenrot, nach deren Anwendung sie in den Verdacht kam, eine wächserne Nase zu tragen. Sie ließ diese Ecke deshalb wie sie war und half der schönroten Farbe sogar mit etwas Portwein und Madeira nach, wodurch sie freilich wiederum manchmal in den Verdacht kam, jemand damit erstochen zu haben.
Man wird fragen, was Herrn Eiskuhl veranlaßte, sich in den Besitz solcher Reize zu bringen. Es war die Familie, die er stets im Auge behielt. Er war zur Zeit, wo er um die Hand der reizenden Jungfrau anhielt, weder Millionär noch Senator. Da er indes schon auf guten Füßen stand, so wollte er seiner Familie wegen ebenfalls in eine gute Familie heiraten. Madame Eiskuhl war die Tochter eines holsteinischen Barons und besaß nebenbei etwa eine halbe Million. Da sich aber alle heiratsfähigen Männer sechs Stunden im Umkreis ihrer Heimat in einer unbegreiflichen Verblendung befanden, die sie abhielt, um sie zu werben, so ergriff sie die Gelegenheit, nach Hamburg zu heiraten, und beglückte Herrn Eiskuhl mit ihrer Hand.
Fräulein Selma und ihre Schwester Emma waren allerdings besser geraten, als man einem Vater Wollsack und Mutter Hopfenstange nach hätte vermuten sollen. Sie waren wirklich ein paar hübsche junge Damen mit einigen Talenten für Malerei, Poesie und Musik. Sachen, die sie unmöglich von ihren Eltern geerbt haben konnten, da diese kaum einen Begriff von deren Vorhandensein hatten.
War die Mutter stolz, der Vater hochmütig und beide dumm bis zu dem Punkt, wo der eigene Vorteil in das Spiel kommt, ein Punkt, in dem nebenbei gesagt die Dummen immer klüger sind als die Intelligenten, so waren die Töchter durchaus gutmütig und die guten Engel des Eiskuhlschen Hauses. Nur von der Zunge der Frau Mama hatten sie etwas, was manchmal durchging und die gute Natur der Mädchen bewog, sich öfter mit einer halben Antwort zu begnügen.
Die Senatorin war durch ihre Lektüre in eine Stimmung versetzt, in der sie gar zu gern einen kleinen Roman gespielt hätte. Sie sah die grenzenlose Ergebenheit, die Henri heuchelte, für verborgene Liebe an und erwartete von Monat zu Monat, daß er ihr einmal zu Füßen stürzen und sich entdecken würde. Er schien jedoch zu dumm dazu. Er sah nicht die provozierenden Blicke der grüngrauen Augen. Die rote Nasenspitze verdarb den Effekt.
Herr Henri war nun allerdings nicht ganz so dumm, wie seine Dame dachte. Er war ein hübscher, blondhaariger Bengel und eigentlich ein verdorbener, weggejagter Schulmeister aus Buxtehude, zu dumm für einen Lehrer und zu klug für einen Diener. Jedenfalls aber immer auf seinen Vorteil bedacht.
Er sprach etwas, das wie Französisch klang, wußte ungefähr zwanzig lateinische Sprichwörter auswendig, die einen ganzen Haselwald bei ihrer Erlernung gekostet hatten, und brachte mit diesem philologischen Fonds den Senator in Schrecken und die Senatorin in Entzücken.
Herr Henri stand also, wie Mohammeds Sarg zwischen zwei Magneten, inmitten der Pavillons und drehte seinen Kopf verstohlen wie ein Rabe von einem zum andern. Scheinbar betrachtete er die Elbe und die Schiffe, die mit der Ebbe hinabtrieben.
Fräulein Selma mit der Samtjacke und der halben Million im Hintergrunde war ihm nie so besitzenswert wie heute erschienen. Wie sie im Garten daherkam, um ihr poetisches Handwerkszeug in die Einsiedelei zu tragen, hatte er ihr ein tiefes Kompliment gemacht, was mit einem so kühlen Kopfnicken beantwortet ward, daß er nicht wagte, ein Wort zu sprechen, und ihr stillschweigend nachblickte, wobei er mehrmals sinnend mit dem Kopf nickte.
»Stolze Prise«, murmelte er, denn er war im Gewächshaus ebenso kurz hinausgewiesen worden, als er seine Dienste dort anbot.
Während nun Henri auf der Terrasse stand und nach der Einsiedelei hinüberschielte, stand unten im Gebüsch ein junger Mann und sah ebenfalls nach diesem Punkt.
Selma hatte eine Minute zum Fenster hinausgeblickt und sich dann an der Staffelei niedergelassen, um eine Baumgruppe, durch die man die ferne Elbe sah, auf der Leinwand zu skizzieren und später zu malen.
Sie zeigte beim Hinblicken auf ihren Studienpunkt jeden Augenblick ihr Profil am Fenster. Der Lauscher in den Weiden war von diesem Anblick so entzückt, daß er wie eine Statue stand und auf seinem Rücken den abgezogenen Hut festhielt.
Ein anderer junger Mann umschlich indes den Gartenzaun von allen Seiten und suchte einen Blick auf die Villa zu erlangen.
Herr Henri hatte diese beiden verdächtigen Subjekte nicht so bald entdeckt, als er sich hinter einem Holunderbusch auf die Lauer legte, um ihre Absichten auszukundschaften.
Den Lauscher im Gebüsch hatte er schon einigemal im Hause des Senators gesehen. Da er jedoch selten früh auf dem Platz war, so kannte er das Amt, das Schnepfe bei Herrn Eiskuhl bekleidete, nicht und hielt ihn für einen Kaufmann.
Was er aber aus dem andern, sehr elegant gekleideten Herumschleicher machen sollte, wußte er nicht. Jedenfalls hatten sie es auf die Villa abgesehen, denn Bernhart, der einen günstigen Punkt zur Aufnahme des Hauses gesucht, setzte sich jetzt und machte eine Skizze davon.
Beobachtete nun Henri die beiden, so wurde er wieder vom Pavillon unter den Linden belauscht.
Plötzlich erschien jedoch zwischen den Gebüschen des Gartens ein großer weißer Fleck, bei dessen Anblick sich Henri drückte. Es war der Senator, oder vielmehr seine Hemdenbrust, die wie ein weißes Segel daherkam. Ihm folgte Jost, der ein Paket trug.
Herr Eiskuhl begab sich nach einer hohen Flaggenstange, die auf der Terrasse stand.
Jost legte hier sein Bündel nieder und untersuchte die Flaggleine. Nachdem er sie klargemacht, breitete er eine große Hamburger Flagge auf dem Boden aus und legte sie dann mit des Senators Hilfe viermal der Länge nach zusammen, worauf er das lange Tuch in einen kleinen Ballen verwandelte und die beiden Enden der Schnur an die Flaggleine band, mit deren unterem Teil er den Ballen leicht umschlang. Nun hißte ihn der Senator schmunzelnd in die Höhe, während Jost die Leine langsam nachließ und dann, als er den Knopf erreichte, die Schlinge aufzog, durch welches Manöver sich die Flagge entfaltete.
Herr Eiskuhl hatte durch das Aufziehen der Flagge allen denen, die ihre Blicke nach der Villa richten wollten, angezeigt, daß er nun auf seinem Landsitz eingetroffen sei. Er wollte es jedoch auch denen kundtun, die nicht hersahen, und lud nun mit Josts Hilfe einen kleinen Böller, worauf er sich ein wenig zurückzog, als ihn Jost mit der größten Seelenruhe losbrannte.
Man hörte bei dem Knall in den Pavillons einen Schrei, während Schnepfe im Gebüsch einen Satz machte, als wäre er angeschossen, und Bernhart einen Baumast vor Schreck um wenigstens zwanzig Ellen verlängerte.
Die Senatorin und Selma sprangen aus ihren Pavillons hervor, was dem Herrn Senator ungemeinen Spaß machte.
Madame Eiskuhl las erst kürzlich in einem Buch, worin ein barbarischer Ehemann den Geliebten seiner Frau in seinem Park erschossen hatte. Das ängstliche Fortschleichen Henris, dessen Grund sie nicht entdeckte, war ihr aufgefallen, und sie wollte eben nachsehen, wohin er gegangen sei, als der Schuß fiel.
Wie sie nun hervorsprang und den Senator mit Jost hohnlachend, wie sie glaubte, neben einer Wolke von Pulverdampf stehen sah, suchten ihre Augen die Leiche Henris, die ihrer Phantasie nach blutend am Boden liegen mußte.
Es war zwar bis jetzt kein Grund vorhanden, weshalb Herr Eiskuhl Henri erschießen sollte, denn die Senatorin verbarg ihre Leidenschaft für ihn sorgfältig, und Henri hatte keine Leidenschaft zu verbergen. Durch die Romane war ihr jedoch der Kopf so verdreht, daß ihr der als Ehemann nur zu harmlose Eiskuhl ganz blaubärtig vorkam. Sie blickte deshalb noch mit entsetzten Zügen nach dem toten Henri umher, als dieser mit gewohnter Sanftmut aus einer Buschgruppe trat, um sich zu der Meldung herabzulassen, daß das Frühstück serviert sei.
Fräulein Emma empfing ihre Eltern am Frühstückstisch. Sie sah ihrer Schwester sehr ähnlich, nur war sie eine handbreit kleiner als diese und zeigte ein immer lachendes Gesicht und infolgedessen stets eine Reihe weißer Zähne.
Zum großen Ärger ihrer Mutter war sie geneigt, kleine Possen zu treiben, und unterhielt sich gern mit jedem, der ihr in den Weg kam. Auch heute hatte sie wieder etwas ausgeführt, worüber die Mama im stillen in großen Zorn geriet.
Auf ihrem vollen braunen Haar sah man einen Kranz von grünem Kraut, in welches gelbe Rüben eingeflochten waren.
Der alte Eiskuhl lachte übers ganze Gesicht, küßte die Tochter auf die Stirn und biß dabei eine halbe Rübe ab, über welche Kriegslist er so lachen mußte, daß sie ihm in die unrechte Kehle kam.
Die Senatorin war im höchsten Grade indigniert über das Benehmen ihres Mannes. Es war empörend anzusehen, wie er in einem Salon, und wenn es sein eigener war, so brüllend lachen und dazu mit den Beinen stampfen und sprudeln konnte. Er hätte es wahrhaftig auch getan, wenn jemand dagewesen wäre. Es war schrecklich gemein!
Wie glänzend, stand dagegen Henri dort und ertrug mit stiller Resignation die Szene, wie ein gefangener oder verbannter Fürst mit etwas abwesenden Finanzen.
Wer wußte auch?! – Er hüllte seine Abkunft und Heimat in ein undurchdringliches Dunkel, und er tat auch wohl daran, denn Buxtehude hatte nie einen guten Klang als Vaterstadt schwärmerischer Liebhaber gehabt.
Die Frau Senatorin sah ihn mit schmeichelhaftem Mißtrauen an. Er war nur ihretwegen als Diener in das Eiskuhlsche Haus getreten. Soviel wußte sie bereits von seinem Geheimnis. Es steckte mehr hinter ihm, als er wissen lassen wollte. Er mußte in eine höhere Charge versetzt werden. Das waren die Gedanken der Frau Senatorin beim Frühstück, welchem der verkleidete Prinz Henri zum Schmerz seiner Dame stehend beiwohnen mußte.
Als der Senator wieder zu sich kam, band ihm Jost, der indessen mit einigen Flaschen erschienen war, eine Serviette um den Hals, und zwar mit einer Manier, die einen fremden Zuschauer auf den Gedanken bringen mußte, Herr Eiskuhl sei in die Hände eines Garrotters geraten.
Nachdem die Serviette befestigt war, so daß hinter dem Kopf zwei große Zipfel in die Höhe standen, was die Senatorin stets an König Midas erinnerte und wofür sie Henri mit einem bittenden Blick um Verzeihung bat, sah sich Herr Eiskuhl, der jetzt Messer und Gabel ergriff, auf dem Tische um.
Es war ein Frühstückstisch, dessen Bestandteile ohne das Geschirr vollkommen hingereicht hätten, eine arme Familie für eine ganze Woche luxuriös zu beköstigen.
Herr Eiskuhl hatte alle diese Herrlichkeiten aufmerksam gemustert und suchend unter ihnen umhergeblickt. Er war indes offenbar nicht zufrieden mit dem Bestand der Tafel, denn sein Gesicht färbte sich vor Ärger dunkelrot. Er griff nach der Glockenschnur, welche in die Küche ging, und riß heftig daran.
Der Champagner war eben mit großer Geschicklichkeit von Henri geöffnet und der Madame eingeschenkt worden. Diese brach im Schlürfen des Schaumes ab, sobald der Senator an der Klingel zog, und sprach sanft: »Henri, bitte, gehn Sie sogleich nach dem Strand hinunter und fragen Sie einen Schiffer, wann die Flut kommt. Aber bitte, bitte, schnell!« Henri stürzte sofort hinaus und hätte in der Zerstreuung die Champagnerflasche mitgenommen, wenn ihn Jost nicht mit hämischem Grinsen daran gehindert hätte.
Die Senatorin wußte, was kommen mußte, und wollte Henri den Schmerz ersparen, seine angebetete Gebieterin als die Gattin eines Ungeheuers zu sehen. Nebenbei wollte sie ihn allerdings auch nicht sehen lassen, wie sie ihren Kopf aufsetzen konnte.
In der Tür erschien jetzt ein weibliches Wesen mit einer so weißen Schürze und Mütze, daß selbst des Senators Hemd nicht darüber hinauskam. Sie sah etwas herausfordernd aus und blickte auf die Senatorin. Diese zeigte auf ihren Mann.
»Weshalb sind keine gelben Rüben heraufgekommen!« schrie sie dieser an.
»Frau Senat'rn hat sie vom Küchenzettel gestrichen!« erwiderte die Köchin höchst gleichmütig.
»Gestrichen?« schrie Herr Eiskuhl durch die Fistel. »Gestrichen? Ich habe sie aber nicht gestrichen und will sie jedesmal zum Frühstück und Mittagessen haben. Das merken Sie sich, sonst jage ich Sie davon!«
»Frau Senat'rn hat mir extra befohlen, von jetzt an keine gelben Rüben mehr –«
»Hinaus!« brüllte hier Herr Eiskuhl in höchster Wut. Dabei ergriff er die Kaviarbüchse und warf sie, wie es weiland Dr. Luther mit dem Tintenfaß auf der Wartburg nach dem Teufel tat, nach dem Kopf der Köchin, die blitzschnell verschwand, als die Büchse noch einen Bogen in der Luft beschrieb.
Die Wirkung war dieselbe, nur daß statt eines Tintenkleckses ein ungeheurer Kaviarklecks an der weißlackierten Tür zu sehen war.
Die Senatorin trank schnell ihr Glas aus und schenkte sich ebenso schnell ein anderes ein, um es gleichfalls auszutrinken, denn sie wußte, daß sie spätestens in einer Minute in Ohnmacht fallen würde. Hierauf sagte sie in sehr hohem Tone:
»Herr Senator, ich muß wirklich bitten, sich –«
»Herr Teufel un sien Grotmodder!« schrie Eiskuhl, mit der Faust auf den Tisch schlagend. »Ick will eten, wat mi smeckt! Un wenn tein Höllendrokens mi verbeeden wöhlt, Reuben to eeten, ick eet doch welke!« Und um zu zeigen, daß er seinen Willen durchsetzen wolle, nahm er Butter und Schwarzbrot, wozu er die gelben Rüben, roh wie sie waren, zu verspeisen begann.
Die Senatorin sah entsetzt auf das rübenverzehrende Ungeheuer, das sich nach langer Zeit wieder einmal gegen ihre Herrschaft auflehnte. Das Ungeheuer sah eigentlich sehr komisch aus, denn die großen Serviettenohren wackelten bei jeder Bewegung, die der rote Kopf machte, hin und her. Er biß jedoch so grimmig in die Rüben und schnarpte dabei so kannibalisch mit den Zähnen, daß der Senatorin nichts übrig blieb, als in Ohnmacht zu fallen.
»Jost!« lispelte sie mit schwacher Stimme, »servieren Sie den Kindern im Gewächshaus.« »Ihr«, wandte sie sich an die Töchter, »verlaßt diese Stelle der Gemeinheit und mir bestellt einen Saaaaa–rg!« Damit fiel sie ohnmächtig in ihren Stuhl.
Die Töchter sprangen zwar hinzu, sie wußten jedoch, daß die Sache nicht gefährlich, sondern ein altes Manöver war, um den Papa in eine Defensivstellung zu drängen.
Dieser schickte sie fort und speiste nach ihrer Entfernung so ruhig weiter, als sei die Senatorin eine Statue, die zur Zierde des Salons angebracht war.
In der Gartentür erschien Henri mit dem Bericht über den Flutstand.
»Hinrich!« schrie das Ungeheuer kauend, »bringen Se Ehr Madam rut na baben, se is slecht worden.«
Herr Henri wollte eigentlich bei der gemeinen Verdrehung seines Namens, die der Senatorin fast wirkliche Krämpfe verursachte, eine stolze Antwort geben. Der große Kaviarfleck an der Tür und die Scherben darunter bewogen ihn jedoch, seine Schmach stillschweigend zu tragen und seine eben ins Leben zurückkehrende Dame fortzuführen.
Das Ungeheuer kroch nicht zu Kreuz, sondern kaute ruhig weiter und trank Portwein dazu.
Jost hatte den Töchtern ihr Frühstück in das Gewächshaus besorgt und stand nun an der Tür, von der er gemütlich den Kaviar abkratzte, auf eine Buttersemmel strich und, so das Angenehme mit dem Nützlichen verbindend, verzehrte, während der Senator mit stillem Grimm von allem möglichen aß, was auf der Tafel stand.
Zu derselben Zeit, als man sich oben im Salon zum Frühstück niedersetzte, geschah das gleiche unter den Weiden.
Bernhart hatte seine Skizze der Villa fertig und suchte nun mit Schnepfe in den Weidenbüschen am Strande ein schattiges Plätzchen, um ein frugales Frühstück zu halten.
Es war bald eine Stelle gefunden, wo die Flut einen Haufen altes Schilf angeschwemmt und so für einen natürlichen Divan gesorgt hatte.
Der unselige, von Schnepfe eingewechselte Hut mußte mit seinem breiten Deckel als Tisch dienen. Man deckte eine Zeitung darüber und trug dann auf.
Die jungen Leute hatten eben die Hände zum lecker bereiteten Mahle erhoben, als sie die musikalischen Töne durch das leise Summen der Käfer erklingen hörten.
Beide lauschten, ohne sich zu rühren.
Die gebrochenen Akkorde klangen im Anfang so piano mit dem Geflüster der Weiden zusammen, daß es von keinem Instrument herzukommen schien. Als das Piano auf einem verminderten Septakkord ruhte und dann in eine Auslösung überging, in der die weiche Stimme Selmas einsetzte, zog der zarte Ton des Windes wie ein cantus firmus hindurch, und die Lauscher hatten ihr Frühstück total vergessen.
Schon nach den ersten Strophen hatte Bernhart ein Skizzenbuch hervorgeholt, das teilweise mit Notenlinien durchzogen war, in die er die Melodie mit beziffertem Baß schrieb, worauf er den Text, soweit es ihm möglich war, nachtrug.
Als die letzten Töne verklungen waren, griffen die jungen Leute wieder nach ihrem Frühstück und verzehrten es mit einem Appetit, um den sie die ganze Hamburger Millionärschaft beneidet und ihnen ihn jedenfalls für einen guten Preis abgehandelt hätte, wenn er an die Börse gekommen wäre.
»Wenn dieser verwünschte Hut wenigstens ein Schinken wäre, dann verlohnte es sich doch der Mühe, ihn mit herumzuschleppen, aber so? – Da, du Kanaille!« sagte Schnepfe, ihm einen Faustschlag versetzend, der ihn ins Gebüsch warf. Er holte ihn jedoch, eingedenk des Bürgen, der in Hamburg für ihn gut stand, wieder und machte Bernhart auf die Einsiedelei aufmerksam, in der er Selma am Fenster zeichnend gesehen hatte.
Beide stiegen neugierig die Böschung hinauf und blickten in das Fenster.
Als Bernhart die Skizze auf der Leinwand und daneben Farben, Palette und Pinsel sah, erfaßte ihn die Lust, der abwesenden Künstlerin eine kleine Überraschung zu bereiten.
Er bat deshalb Schnepfe, Wache zu halten, und stieg in das Fenster, worauf er mit einem Griff die Malgerätschaften erfaßte und das skizzierte Bild mit kecken und doch eleganten Strichen in Farben setzte.
Bernhart besaß eine große Fertigkeit im Skizzieren nach der Natur und hatte nach zwei Stunden beinahe ein Bild aus der Skizze gemacht, als Schnepfe von seinem Wachtposten herbeikam und nach dem Garten zeigend in die Weiden sprang.
Der Maler legte die Gerätschaften schnell beiseite, machte einen einzigen großen Schritt aus dem Fenster und verschwand ebenfalls.
Beide legten sich im Gebüsch auf die Lauer und beobachteten die Einsiedelei wie ein paar skalpsüchtige Indianer.