
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Im Waadtland, aber auch auf arrondierten Rebgütern des Seelandes, wie z. B. u̦f em Chapf über Twann, werden die gelesenen und zum wịịnle (Li. 1609) bestimmten Trauben i der Bränte ( S. 365) gleich i’ n Trüel (s. u.) ’traage oder ’treit. Auf so mannigfach verbitzlete Weinbergbesitzen, wie sie am bernischen und neuenburgischen Jurasüdgehänge die Regel bilden ( S. 231 f.), wäre das kompleet nid (radikaal nid) z’mache. Da müssen umfänglichere Transportgeräte die zuweilen stundenweite Entfernung zwischen Trüel und Rebe vermitteln.
Hierzu dienen in erster Linie Zü̦ü̦bere von gleicher, auf 100 l geeichter Gröößi. Trotzdem der voll Zü̦ü̦ber dementsprechend viel wĭ̦gt (Ins: wägt), macht oder ist, muß er möglichst liecht, dazu handlich und solid gebaut sein. Er besteht daher aus ụụsg’spaltnem, d. h. der hööch Wääg oder stän͜dlig gespaltenem (nicht lĭ̦gglig oder der läng Wääg g’spaltnem) roottannigem oder fiechtigem (Erl.: fi̦chtigem) Holz: aus Fiechte, ahd. fiuhta. Nur wenn’s sịị mueß, ist er wị̆ßdannig und damit etwas schwäärer (schwẹẹrer). (Äichig sind bloss die im Keller verwendeten Chällerzü̦ü̦bere.)
Einige Zeit vor dem Leset werden die Züber und übrigen Mostgschi̦i̦r (Ins und alt Tw.: -g’schi̦i̦rn) aus dem Trüel, dem Chäller oder dem Rĕ́mịịse fü̦ü̦reg’noo und neuerdings ụụspu̦tzt. (Einen « Essuie-tine» z’räiche schicken dabei etwa neckische Welsche einen ungewitzigten Jungen, der dann eine mit schwerem Stein beladene Hu̦tte an den Rücken gehängt bekommt.) 1 Darauf werden die Geschirre 384 z’g’schwalle too, damit sie verschwalli. Denn i der Tröcheni sị si̦ erlä̆chchet (erlächnet; vgl. sich erli̦cke, S. 6); sị sị rü̦nnig woorte; si̦ rü̦nne wohl sogar wi̦ n es Si̦i̦b oder wi̦ ’ne Haberrịtere (Tw.: -rị̆ter).
In tunlichst erreichbarer Nähe des Leseplatzes nun, am liebsten natürlich an offener Heerstraße, reiht sich in stolzer Zịịlete, die Namensinitialen des Besitzers dem Beschauer zukehrend, Züber an Züber. Selbst ihre beträchtliche Zahl säit frịịlich (frịịli) no nụ̈ụ̈t gegen die mehr als 900 Züber, welche es bloß im Erlacher Weingelände während der Lese von 1834 mit ihrem köstlichen Inhalt über Nacht im Freien zu bewachen galt. Da̦ isch mḁ mäṇgisch acht Tag nid us de Chläider choo. 2 Zur Hut des so sauer erworbenen süssen Guts kam aber noch die Sorge um seine Bergung. Es galt, mit Aufbietung aller List leere Züber z’verstecke, z’er ntlehnne, wohl auch z’stịbịtze, weil es immer und immer an «Holz» (Ins) fehlte. 3
Stattlich fällt die Reihe immerhin auch heute aus bei größern Weinbergbesitzern und zugleich Weinhändlern, welchen kleine Besitzer, wo nid sälber trüele, ihren Leseertrag ab der Räbe im Züber verchạuffe.
Auf den Mostplatz, wo Brente um Brente in die Züber g’läärt werden soll, wurden diese hergefahren u̦f dem Mostwaage. Und nun wird mit bereits ( S. 371) geschilderter Kraftentfaltung g’mostet. Die Trauben werden verstampft, g’stu̦ngget (neu Tw.: g’stu̦nket). Jede neue Brentenlast wird abeg’stampft, um einer weitern Platz zu schaffen. Das tut in kleinerem Betrieb der Bräntetreeger, in größerem ein eigener Angestellter: der Moster. Er ergreift z’beedne Hän͜d an den ausgedrechselten ( d’drääite) Handheebi die Keule: den Moster, wie dagegen zwecks Nachfüllung der Brente auf dem Leseplatz bloß z’äi’r Han͜d das Mosterli, Bräntemosterli. So heißt (in Ins) aber auch der ( Hördöpfel-) Stu̦ngger oder -Stämpfel (Kartoffelquetscher), wie hinwieder der Traubenquetscher auch der Stu̦ngger, das Stu̦nggerli (neu Tw.: Stu̦nker-li) ist. In Lü. sagt man: der Stụ̈̆nggel.
Als Trị̈ị̈bel stampfe travestiert man in Tw. das bekannte Kinderspiel, in welchem der Kopf des ausersehenen «Opfers» zwischen die Knie seines «Peinigers» geklemmt wird, indes des letztern Fäuste auf des erstern Rücken das Sprüchlein sekundieren:
Tippis Tappis
Äierlappis (statt: Haberlappis)!
385 Wi män’ge Finger han i uuf? (statt:
Wi män’ge Finger streckt der Bock
Auf seinem Kopf?)
«Drei!» (oder irgend eine Fingerzahl.)
Hättisch (z.B.) vier erroote,
Chënntisch de̥ un͜der em Bëckli duure schnogge! (statt:
Chönntisch Tụ̈ụ̈beli broote!)
Der im Erraten Ung’fel lig muß weiter erroote, bis er endlich ị̆hm drụf chunnt, ị̆hm druff isch und unter Faustgetrommel auf dem Rücken, das eben Trị̈ị̈bel stampfe heißt, entlassen wird. «So schlöö me̥r alli drịị, drịị, drịị!» lautet dabei der Bescheid auf die getroffene Wahl des Inquirierten unter drei zur Sühne anerbotenen guten Dingen: Chääs, Broot, Wịị (statt: Hammer oder Bịßzange). Der (in der Regel gewählte) Wein muß eben zuerst als Most g’stampft werden, wie das Brot als Getreide ’trösche (s̆s̆), der Käse mit Gewalt gepreßt.

«Brentenleeren»
Transport der Trauben
vom Weinberg zum Züber
Käi G’spaß verstäit dagegen der z’äärnstem die Trauben quetschende Mann an häiße Daage eines just guten Erntejahres, wo d’Bättler u d’Schelme und d’Wäspi sich melden und er begreiflich zur Abwehr der letztem nid emool taarf raụke. Denn der Räbmḁ mueß sụụfer (sụber) sịị wi n e Chääser. Bloß der Bräntetreeger erhält grad no äxtra guete Tuback geschenkt, damit er darob das ụụselääse der goldensten Beeren vergääs. — Einen außerordentlich profitlige n und förderlichen Ersatz des Moster bietet in größern Betrieben die Mostere: die Trụ̈ụ̈belmühli, Trüelmü̦hli, Trüele, welche vom Trü̦llezieijer (Ins) in Bewegung gesetzt wird. Von dieser Traubenmühle lạuft meh abb.
Sowohl zur Eigentumskontrolle des Rebherrn wie auch für den Kauf und Verkauf werden die Züber mittels irgend eines als Verglịịchschü̦ü̦beli gebrauchten Lesegeschirrs na̦’m Määs vergli̦chche: Ihre Füllung wird ausgeglichen auf das obligatorisch schweizerische Maß hin, welches das Chü̦ü̦beli als das heutige Lịterchü̦ü̦beli (das alte Zähntchü̦ü̦beli), den Züber als den hundertlịterigen Züber bestimmt. (Die 99 l fassende gerle der Neuenburger.) 4 In diesem letztern geben inwendig eingetriebene Messingnägel mit breiten Köpfen die obere 386 Grenze von 50 und von 100 l an. Nun sollen beim Füllen mit Zübermost diese Negeli d’deckt sịị, oder sie solle schwü̦mme: die neue Füllung auf dem Mostplatz soll nicht bloß die Mitte des Nagelscheibchens — wie die Norm erfordert — sondern den höchsten Punkt erreichen. Worum?
Das ụụsespri̦tze und die Entweichung von ịịg’mosteter Luft während der Wegfahrt wird die Füllung erst auf das genaue Maß zurückführen. Aus z’volle Zü̦ü̦bere wird also ụụseg’mässe, in zu wenig gefüllte ịịneg’mässe.
Acht bis zehn derart volle Züber gäben es Fueder, Mostfueder. Man ladet also mit ihnen den Mostwaage, dessen vorgespanntes Roß geduldig g’wartet het — vielleicht schon sich freuend uf e Mäie (Strauß), der zur letzten Saisonfahrt sein Chome̥tschịt zieren wird. Die Züber kommen in stolzer Reihe auf das Mostgụ̈ụ̈fi 5 des danach auch Gü̦fiwage geheißenen Mostwagens zu stehen. Dieses Gü̦ü̦fi besteht in der Hauptsache aus zwei flach g’sa̦gte Bäüm, welche verhööchti Randlịịste tragen, um das seitliche abrü̦tsche der Züber zu verhüten. (Beim Faßgü̦ü̦fi sind diese Gü̦ü̦fibäüm rund, d. i. zylindrisch.)
Das Züber lade ist aber ein Erweis von Kraft und Gewandtheit, der gelernt sein will. Zwei Männer fassen eins ums andere der schweren Geräte an je einem der beiden Horn oder Ohre: der je drei heraufragenden Lochtaue (Lochdauben), deren mittleri, äxtra bräit geschnitten, so durchlocht sind, daß sie eine sichere Handheebi gewähren. Die beiden andern Hände fassen den Züber un͜der am Gaargelchopf (s. u.). Ein selbstkommandiertes auf! oder hoor! 5a sichert die Gleichzeitigkeit der Grịịf, und in elegantem Schwung ( Schlu̦ngg, schli̦ngge) ist die Ladung vom Boden ụụfg’noo und veröörteret. Der Mostfuehrmḁ besteigt das Mostgü̦ü̦fi, um die Züber fahrbereit zu rücken.
Also vo Han͜d, wie ein ganz äxtra starche Räbmḁ, ein Simson, der a lläini auch es Fueder abz’lade imstande wäre, indem er so ’ne Züber i der Stemmi nimmt: mit waagrecht ausgestrecktem Oberarm und senkrecht ausgestrecktem Vorderarm. Kräftige Glieder erfordert aber auch das ablade mit der durch die Züberloch du̦u̦rg’steckte 387 Züberstange (Most-, Laadstange), womit man im Neuenburgischen auch uụf̣ladet. (Es ist der neuenburgische téneri.) 6 Die besten dieser, wie ein Turnerreck langen und dicken Stangen sind eschig oder äschig: sie bestehen aus Esche oder Äsche (s̆s̆), besonders dem von Lüscherzern gelieferten Moosäschli; sie sind liecht, und sie fäädere, ohni z’verheie. Sehr brauchbar sind auch die Stangen aus (Weiß- oder Schwarz-) Dorn.
Die Züber werden in die riesige Most- oder Trụ̈ụ̈belbü̦tti, wenn nicht in die zwoo, drei Bü̦ttine 7 eines sehr großen oder in das Bü̦tteli eines beschränkten Preßraums ụụsg’läärt. Es folgt ein sorgfältiges ụụswüsche, um nichts von dem kostbaren Stoff la̦ z’nüüte z’goo.
Die Bottiche behalten ihre süße Belastung e Zịt lang, damit d’s Most si ch setz. Nachher loot mḁ d’Bü̦tti ablạuffe, indem man den Auslaufhahn drääit, wi we nn mḁ Wịị abzu̦u̦g: mi zieht d’Bü̦tti ab. 8 Ist die Preßvorrichtung von der Bü̦tti etwas entfernt, so tritt der Chällerzü̦ber in den Dienst. Auch Răselierzüber ( S. 30) geheißen wird derselbe, wenn er aus dem Bottich g’fü̦llt ist, über den genügend langen und sehr glatt gehobelten Răselierlade geschoben, oder gut seeländisch: g’răseliert. Sind dagegen Bottich und Presse nooch bi nenand, so tritt der Mostchaarst mit seinen drei oder vier sehr breiten, dünnen, aus weichem Eisen bestehenden Zi̦ngge (Zinke) in Aktion. Er heißt eben so häufig d’Mosthạue, weil man damit tüchtig in den Inhalt des Bottichs ịịhạut, um ganzi Schụ̈ụ̈ble in ausgiebigem Schlụngg auf die Presse zu werfen. Auf diese kommt auch der bereits tüchtig im Jääs (s. u.) begriffene letzte Inhalt der Gäärstande, wovon in Bälde zu reden ist.
1
Gign. 31. Vgl. das «Tuurnersalb»
Gw. 397, den «Habermutz» im Emmental zum «Zerfasern» der Hafer-«Ähren» (gleich dem der Dinkelähren) usw.
2
Großrat Stucki in Ins († 1915).
3
Drastisch geschildert:
Favre 200. 202.
4
Favre 196.
Gerle ist
ger-ula (Traggerät).
5
Güfi aus l.
cophinus (Tragkorb); vgl.
M-L. 2207.
5a
Zu Erlach rufen die Kinder beim
schli̦ttle bergab:
Oor, oor, oor! Süst nimm i di bi de Hoor! Das kann gekürztes
hors route! hors voie (
u̦s Wääg, u̦s Wääg!) sein, dessen Anlaut h in
hoor! mitgesprochen wird. (Zu frz.
hors aus l.
fŏras: ad foras: zur Tür [hinaus]! vgl.
M-L. 3431.) Hieraus abgeleitet: Fort aus der für euch gefährlichen Bahn! Achtung! Haltet euch gefaßt! Jetzt!
6
Zu
tenēre (tenir: halten).
7
Vgl.
Lf. 322;
schwz. Id. 4, 1138;
Kluge 67. 81.
8
Eine der so mundartgemäßen Objektsverschiebungen.
Die Qualität der Trauben, die Beschaffenheit der Presse und die Art ihrer Behandlung entscheiden gemeinsam darüber, äb’s guet oder schlächt trüeli. Im erstern Falle trüelet’s achtz’g bis fụ̈fenachtz’g Brozä́nt, wenn nicht ’s Dü̦nne sogar auf 88% ansteigt. Der Räste ist Treeber.
Der neu Wịị ist größtenteils Voorschutz, kleinstenteils Ụụsdrü̦ckete. Jener «Vorschuß», Vorla̦uf, die «Essenz», mère goutte, Malte. Malten (Li. 1592, 1609) 1 ist das untrüelet Most, welches 388 aus der Mostbü̦tti durch deren geöffneten Hahn aus- und aus der Preßmulde vor deren Arbeit als Schwall und Schwetti abfließt in das unter der Presse eingesenkte Mostbütteli. Frisch aus diesem getrunken, schmeckt er gar chäibisch guet, und sein noch unvergorener Zucker ist eine Hauptquelle rasch erneuerter Muskelkraft. Das merkten sich klösterliche und städtische Rebenbesitzer, welche häufig weiße Malten (von Weißweintrauben) als Abgabe forderten. Aber auch das schlaue Mostroß vor dem Mostwage wäiß öppis dḁrvoo; mit bemerkenswerter List trachtet es e Mostzüber z’errecke. Eine in Tüscherz zum Ersatz eingespannte und losgewordene Kuh holte sich damit den Tod: d’s Most het im Mage g’jääse und het si̦ versprängt.
Allein, solch untrüelet’s Most ist z’mastig für si ch z’bhaa. Es lạuft öölig ụụs: schwäär (nid lääbig), und wird bald brụụn von Farbe, lin͜d im Geschmack. Es würde in kurzem umstoo, wenn sich ihm nicht, vom Weinproduzenten glịịchlig vertäilt, konservierende Stoffe beimischten, namentlich der Gerbstoff: der Tannin (-Stoff). Solchen aus Traubenkernen zu gewinnen, wird von Fachmännern sehr empfohlen. 2
Hieran besonders gehaltreich sind eben d’Chäärne, sowie d’Hü̦ltsche; auch d’Gräät (Tw.) oder Grappe (Ins, vgl. S. 277) bergen sie. Sie mit G’walt z’berchoo, ist eine Hauptaufgabe der Weinpresse.
Eine zweite tritt hinzu: den zerquetschten Fetzen der Rotweintrauben, deren Farbe man dem aus ihnen gewonnenen Wein erhalten will, die Farbstoffe zu entreißen. D’Farb li̦ggt (Erl.: lị̆t) i de Hü̦ltsche. Schon deswegen wird d’s Roote a lläini und vorab g’lääse, wenn es nicht ( S. 280) wegen zu geringen Ertrags i d’s Wị̆ße g’heit wird, das es nid fäärbt. Soll es dieses tun, so mueß d’s roote Most öppḁ vier bis fụ̈ụ̈f Daag jääse (gären, s. u.). Länger nicht, sonst teilen die Kämme dem Wein auch ihre mißbeliebige chratzigi Sụ̈ụ̈ri mit. Zum Zwecke solcher Auslaugung des Weinrots bleiben kleinere Quanta im Züber stehen, größere kommen in die eigene Gäärstande. Da sich hier zunächst Cholesụ̈ụ̈ri vom Traubenzucker abspaltet, so stịgt (wallet) d’s Most und muß täglich zweimal abeg’mostet (abeg’stampfet) werden, bis Dicks und Dünns glịịch schwäär geworden sind, so daß es vo sälber fallt (si ch setzt). Ein als Sänkbode beweglicher Dechchel der Gärstande hindert, daß der Jääs oder der Wall über den Rand des Gefäßes ụụfe chaa. Ein überg’spräitets Äschetuech wehrt alls U̦sụụfere ab.
Auch der Tóggeier («Tokayer», S. 281) erhält auf diese Weise 389 sein eigenartiges Rooseroot oder den Schi̦ller, ebenso ihri rächti Faarbb die als Graau oder sonstwie aufzutischende Sorten. Was hier hauptsächlich um der Farbe, geschieht in der Ost- und Mittelschweiz um der Haltbarkeit auch der Weißweine willen. Der Mụschgidä́ller ( S. 285) hinwieder muß von den Hülsen seinen eigenartigen Muskatgeruch und -geschmack bekommen, die aber von den mitgärenden Kämmen teils absorbiert ( ịịgschlü̦ckt), teils verderbt würden. Daher sind die Muskatellertrauben vor dem Verbringen in die Gärkufe z’stru̦pfe oder z’grappiere. Solches Abkämmen besorgt im großen eine Máschine. Im kleinen vollzog es sich vormals an Oobesitze, an welchen gemäß dem Satze, daß, wenn öppis zum Mụụl ụụsgäit, nụ̈ụ̈t drị gäit, der Hausherr zu fleißigem singe animierte. (Wie im Leset, S. 364.) So wurde das einträgliche Entbeeren zum erträglichen Entbehren.

Züber tragen
Transport der eingestampften
Trauben nach der Presse
Der Muskateller würde aber Gräätchu̦st auch dann abbekommen, wenn er so stark wie die übrigen Weinsorten gepreßt würde. Drum wurden und werden seine Beeren da und dort gar nid d’drückt, sondern i d’s Feßli too, halb u halb mit gutem, frischem Most anderer Sorten übergossen und im Frühling abgezogen. Die Beeren geben dann eine äxtra gueti Trueße.
Die Weißweine werden dagegen in der Westschweiz durch Süeßdruck gewonnen: sie kommen sófort nach der Lese und der Quetschung unter die Presse.
1
Gr.
maltha war das weiche Schreibtafelwachs, l.
maltha Bergteer, deutsch Malte 1. Mörtel, 2. schlammig weißer Vorlaufmost. Vgl.
schwz. Id. 4, 213 f.
2
OW. 25, 342 f.
Als Presse elementarster Art dienen — d’Füeß, von Menschen nämlich. Die werden damit doch o wịder äinisch sụụfer, und si̦ gäbe dem Wịị ḁ lsó n es äigets Chü̦stli; ja, sonst gehaltlose Weine werden damit chü̦stig. Im Seeland ist freilich ( richtiger Wịịs) diese Art so alt wi di chlịịnne Stäine; seit ihrem Bestehen isch scho mäṇgi Mụụs in es an͜ders Loch g’schloffe.
Allein das «Treten» mit der Ferse ( Fäärßere) ist doch so bodenständig deutsch, daß es in seiner ablautenden Intensivform «trotten» 390 frz. als trotter entlehnt und schon älter deutsch als trotten und die Trotte zurückentlehnt wurde. Man konnte unter letzterer die Baumpresse verstehen: den Stamm einer kleineren Fiechte (Fichte) oder einer ( Wĭ̦ß-) Tanne, dessen nicht befestigtes Ende mit einer Win͜de nieder gedrückt wurde; oder es konnten, wie am uralten Trü̦el zu St. Niklaus bei Bellmund, sowie im Feld zu Steffisburg, zwäi Bäüm in ähnlicher Weise wirken. Mit solcher trota, truta, trutta, trote, 1 Trotte hat man z. B. 1390 zu Ligerz «den wyn getrottet». Zu Bern stand 1364 «Ougers trote»; 2 noch hat Brüttelen seinen Trottewääg, und der trottebaum manch einer «alten Trotte zu vier Mann» beschlug ein eigenes trottehûs.
Solch hinter der Kultur nachhinkendes Sprachgut, das an einer neuen Einrichtung die Bezeichnung der verdrängten haften läßt, begegnet uns auch in der durch Luther schriftdeutsch gewordenen Kelter, der ostfränkischen Kalter, dem altlothringischen chauchoir aus calcatorium und der hieraus entlehnten ahd. kelktra, zu calcare (treten, wie z. B. der Orgeletrapper als « Calcant» tut), und dies wieder aus calx (Ferse, eigentlich: die Stampfende). 3 Daß man aber noch vor einem Menschenalter, z. B. auch im Badischen, die Trauben ụụstrappet het, sagen Augenzeugen. Sehr früh trat jedoch neben diese Arten des Pressens die Anwendung des drehbaren Hebels. Nach solchem drääije 4 benennt sich die Torkel, graubündnerisch: Toorggel mit dem Torggelbett und -baum, gehandhabt vom Toorggelmeister, 5 sowie der Trüel, 6 Trïel, zum trüele, triele dienend.
Zur nämlichen Lehnwortsippe gehört die Drehwalze z. B. als Äichhorntrülle und als Strafmittel ( Ins 566, auch Tw.), sowie als die Trü̦lle zum trü̦lle des vor dem Lagern zu bewahrenden Getreides, um Biel als die Troole und das troole bezeichnet. Auch das «sich walzen» und das «kollern» ist ein troole, das «wälzen» ein trööle. Ein Rundholz ist ein Trööli, die Teigwalze ein Tröölholz oder ein Troölnagel, das Schieben einer Gerichtssache auf die lange Bank eine Tröölerei. Der Rekrut ( Rege̥rụtt) wird zu gewandtem «si ch chehre» erzogen: trü̦llet, und Fertigkeiten werden ịịtrüllet.
391 Die ersten zur Weinbereitung dienenden Trüel waren Schraubenpressen als Differenzialpressen. Sie nahmen mit der Schwerfälligkeit ihrer Holzkonstruktion einen so gewaltigen Raum ein, daß sie sich in keinen Wohnraum einfügten. Sie beanspruchten einen eigenen Schäärme und konnten damit nach sich Flurstücke benennen. So die Trüelere auf dem sonnigen Abhang über Gümmenen; die Trüelachere zu Gampelen; Burgers Trüelwääg zu Erlach; Reben zu Burgers Thrüll ebd. 1573. Die bernische Regierung besaß um 1731 einen Trüel zu Suncort (in der Su̦nke̥rt ebd.) und ein Trüelhụụs am Stad, also am See, der bis i d’s Stedtli Erlach reichte. Auch die Landschaft Ins besaß einst ihren Trüel; das alte Müeterli desselben (s. u.) wurde 1798 verkauft. 7 Erst so umfängliche Gebäude wie das Twanner Bu̦chsihụụs ( S. 203) umfaßten auch den alten « Trüel sammt Bü̦tti und Zugehördt» (1728) und setzten ihn in Verbindung mit dem freien Trüelhof, der um 1727 für etwa 25 Fässer Raum bot. Der mit einer B’setzi belegte Trüel zu Engelberg herbergte auch noch einen Bachofe (1770) und ein Bụụchööfeli (1800) zum Bäuchen ( bụụche) der Wäsche, sowie das Trüelchemmi (1836). «Trüel» bedeutet also hier überall zugleich den Raum für die Weinpresse und deren Umschwung; und es verbleibt dieser Name auch, wenn die Presse längst weg ist. Der zu ebener Erde liegende und mit der Gasse verbundene Raum dient in solchem Fall als Vorratsraum oder als Werkstätte z. B. für Stickel z’mache u. dgl., und bietet vollgenügend Platz für si ch z’chehre, ohni daß mḁn an allne Orte (Ecken und Enden) aa ist. Nicht wenige solche Trüele aber wurden zu Verkaufs- Läde oder Gaststube umgebaut.

Zübertragen
Echte alte Weinbauern indes, die ihren Wein vom Faß (s. u.) oder ab em Trüel verkaufen, nachdem er vertrüelet oder ụụstrüelet ist, beschäftigen nach wie vor im Trüel (Preßraum) am Trüel (Preßapparat) ihre Trüeler (1634: Trüller), 8 welche unter dem Trüelermäister stehen.
Angetan mit dem allzeit weißen halbrịịstige Trüelerschu̦u̦rz oder Trüelerfü̦ü̦rte̥ ch (1771), genährt mit währschafter Trüelersuppe (1841), mit magerem Chääs oder gesalzenem Fleisch neben nassem Zubehör, heute bei taghellem elektrischem Liecht arbeitend, statt bei der frühern Trüellantäärne oder gar dem als Pandụ̆́derli 392 bemitleideten Notlämpchen spiegeln sie mit ihrem ganzen Gehaben die Hablichkeit ihres Brot- und Weinherrn.
1
Graff 5, 522.
2
Font. 8, 582.
3
Walde 117. Näheres: Jud in Z. f. r. Ph. 38, 39;
M-L. WB. 1491. 1493. 1534;
Kluge 237.
4
Als l.
torquēre, frz.
tordre, vgl. «davon torkeln».
5
Luck; vgl.
Gign. 33 f.
6
Drehen heißt gr.
tréchein. Die Lastwinde der Griechen und Römer: die
trochalía, tróchlea wurde auch, und schließlich bloß, als Weinpresse gebraucht: als der frz.
treuil (
M-L. 8929), als der westschweiz.
Trüel; der
trui und
tru wurde als vermeintlich herzustellendes
trou das
trou des Nonnes als die Kelter des Freiburger Kloster Magerau (
Maigre auge) zu St. Baise nahe der Station der Biel-Neuenburg-Bahn.
Ung trüll pour trottier le vin de la Diemerie (Zehntwein,
Zähntewii) stand 1492 zu Twann.
7
LBI. 64.
8
SJB. B 431.
Beobachten wir sie an ihrem Werk! Wir lernen damit zugleich den Aufbau alter und neuer Trüel kennen. Alle lassen sich als kleinere, tragbare Tragtrüele und als fix eingebaute Trüele n unterscheiden. Die kleinsten alten Trüeli werden etwa als eine Nu̦ßdrü̦cki oder ein Nu̦ßchnü̦tscher bemitleidet. Sie werden in kleinen Betrieben denn auch vorteilhaft ersetzt durch die praktische und handliche Schaffhụụsere (von Rauschenbach). Zwei riesenhafte alti Möbel dagegen lagern ungebraucht zu Erlach. Fünf Ungetüme ihrer Art arbeiteten miteinander im Tschugger Inselhụụs.
Aus den ụụfg’rüstete, zwägg’machte, g’rangschierte, g’schlagne Trüel (I mues däm go der Trüel schloo) wird der Bäck ụụfg’schü̦ttet. — «Der Bäck» ist ursprünglich svw. «schneidender Hieb» und ist ein Verbalabstrakt aus «bäcke», welches z. B. im Simmental und Oberhasli «schneidend schlagen, schlagend zerhauen» bedeutet. 1 Wie aber z. B. «der Baach» im Emmental 1. das Backen ( bachche) und 2. die auf einmal in den Ofen geschobene oder zu schiebende Menge Laibe, Kuchen usw. mäint (es ist die Bachchete oder der Schu̦tz) — wie ferner der Druck sowohl das drücke wie das ụụsd’drü̦ckte und das zu Pressende ist, so ist der Bäck das Gemengsel von Saft, Hü̦ltsche und Grappe, das nun der folgenden Behandlung unterworfen wird:
Die mit der Mosthaue ( S. 387) schön glịịchlig verzogeni Masse erleidet die erste Pressung, und es wird ihr sodann zum ụụslạuffe Zeit gelassen, bis sie vertropfnet het. 2 Dann wird der Trüel ụụftoo und der Bäck seiner Packung entledigt, um die kostbaren weinbildenden Stoffe, zumal die Gerbstoffe, auch dem Innern der Masse zu entreißen. Man schnịịdet oder (zer-) hạut der Bäck z’zwäine Mool zu etwa vier Prismen und preßt ihn neuerdings. Eine dritte und letzte Prozedur dieser Art ist das Zerschneiden und Auseinanderrücken der Teile, so daß kleine Chä́nel oder «Kanäle» (Ins: Karnääl) als Abflußrinnen entstehen: man chäänlet, chäärnlet, chäärnet (in Tw.: spaltet) den Bäck. Es werden nämlich bei dieser Gelegenheit mit dem als eine Mostschroote in Dienst genommenen Häüschroote am Platz des ehemaligen Schrootịịse (Tw. 1791, 1823) 393 oder der Traubenschrote (1829) die riesigen Preßkuchen auch z’ri̦ngsetụ̆́m g’schroote, abg’schroote. Gerade, wenn’s guet mostet, verlạuft nämlich der Bäck gärn: er flieht unter der Presse weg; d’s u̦ssere flieht, nämlich un͜der den Lade fü̦ü̦re. Dieses G’flohnne und Abg’hạune wird mit den Händen zerzupft: verru̦pft — mi ru̦pft der Bäck — und verri̦i̦be, so daß er körnig oder chäärnig sich anfühlt. Dann wird es über den neu z’sämmeg’stoßne und verääbenete (veräbbnete) Bäck hin verstreut.
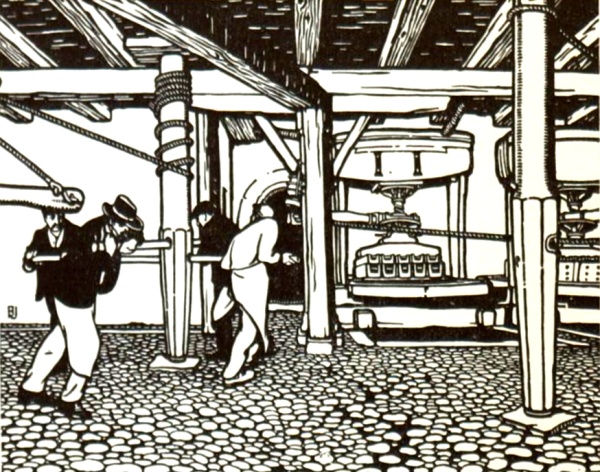
Weinpresse alten Systems im Hause Max Engel in Klein-Twann
Vom ersten ụụfdue bis zum definitiven abdue eines Bäck soll solcher uf d’s allermin͜dste vierezwänz’g Stun͜d unter der Presse liegen. Bei kärglichem Leset, wo es die möglichste Ausnutzung des Stoffes gilt, gäit’s lenger, bei sehr reichem und demgemäß rascher zu bewältigendem Leset min͜der lang, bis e neue Bäck ụụfg’schü̦ttet wird und der alt ab chunnt. We nn mḁ pressiert ist, muß man darum der Bäck e chläi jaage, indem man ihn in kürzern Fristen preßt. Es heißt dann: er ma g’s no äinisch erlịịde; mir wäin ihm no äis gää! mir zieh no äinisch oder no ne Chehr; 394 mir wäi ’nḁ no äinist näh. Aber hübscheli, er chotzet süst (zerläuft)!
1
Verwandt mit picken; vgl.
schwz. Id. 4, 1111.
2
Über solche Inchoative mit -n- s.
Braune, got. Gr. § 194;
Wrede § 126.
Der quadratische, etwa 1½ m lange und breite Hohlraum, welcher den Bäck aufnimmt und am Boden oder seitlich die Flüssigkeit entläßt, heiß der Trüel im engern Sinn oder die Trüelmuelte, auch d’s Trüelbett. Das ist nach heutigem Bau ein durch sorgfältiges ịịschaale mit Brettern glattwandig gemachtes Betonstück mit einem 10 bis 15 cm hohen und breiten Rand, d’s Boord oder d’s Böörtli oder d’Verhööchig geheißen. Der Holztrüel älteren Baues läßt sich zum tröchne usenand näh. Seine Einfassung, der Chaste, Trüelchaste, besteht aus vier Brettern von 4 dm Höhe, welche mittelst Höögge oder Strụụbe mit Schließe zusammengefügt und wieder gelöst werden. Durch große Löchli fließt d’s Dünne ab. Während der Pressung müssen die Schließe durch umlaufende Ịịsestange, wo e chläi Spi̦i̦s häi (nachgeben können) oder wie früher (z. B. 1852) durch Spanntrogchöttine, wo z’sämmezoge häi, gesichert werden. Vier eigene ịịsigi Strụụbe (Schrauben) erhöhten vormals die Sicherung.
Die holzige Trüelmuelte erlächche über den Sommer und bedürfen des Stopfens (des vermache) der Ritzen. Hierzu dient der dreistrangig ’zü̦pfet oder ’trü̦tschet (zu Trü̦tsche geflochtene) Chnospel oder die Chnospe (Tw.), in Vermengung mit dem zum Verstopfen der Schiffsritzen gebrauchten Bast, früher vo wilde Lin͜den im Wald ( S. 23), auch etwa d’s Li̦nt geheißen. Dieser Chnospel — oder d’Chnospe — ist der Rohrkolben: Typha angustifolia und Shuttleworthii, dessen weibliche Exemplare die fingerslangen braunen Cholbe oder Tru̦mmeschleegeli tragen. Diese faltsche Chnospe taugen nicht zum vermache, sondern nur die wahre: die männlichen Exemplare mit den schwertlilienartig oben auseinander gehenden schönen Bletter, welche mannshoch und fast armsdick, glatt wi n e Sabel, weich, elastisch und haltbar gewachsen sind. Die Äänerländer enthoben vormals dem stillen, fụụle Mooswasser ganzi Wäägeli voll dieser Pflanzen, um sie links des Sees an Mann zu bringen. Links des Sees holte man den seltenen Stoff sogar ob em Fụ̈ụ̈rstäi hinter dem Gästler.
Die Mulde wird getragen von dem sehr stark gebauten ächig Chlötz als der Schwelle, Trüelschwelle.
Diese heißt auch das Rößli. Die Teile der uralten Keltern, welche in verschiedener Aufschichtung zur stärken oder schwächern Pressung aufeinander lagerten, trugen ebenfalls Tiernamen mit symbolischer Deutung 395 und heute vielfach verdunkelter Bedeutung. Wie der Welsche von einer «chèvre» (tserva) und einem «poisson» (peso) 1 sprach oder spricht, so die alte Seeländersprache namentlich in und um Ins von der Chatz, namentlich aber von Baarge in der Grundbedeutung junger Eberchen 2 (vgl. unten) als kleinen Balken, über welchen quer gelagert die halbi Moore (Mutterschwein) und die darauf placierte Moore eingetrieben werden: g’schlaage. Die Stücke heißen zusammen d’s G’schlächt, dessen Umdeutung zu « sexus» solche Benennungen der gebräuchlichsten Haustierzucht entlehnt haben kann. 3 Noch in den heutigen Weinbau und von hier aus tausendfach verzweigt in das übrige Gewerbsleben hinein reichen zwei Ausdrücke, deren Herkunft aus der Schweinezucht mḁ nid wu̦u̦rd glaube: Schraube und (Schrauben-) Mutter. Aber «Strụụbe» und «Strụ̈ụ̈bli» 4 geht über «Schraube» und scrōba 5 zurück auf die lat. scrōfa. 6 (Vgl. die Umwandlung des Skorpion in den Storpion.) Und die Bezeichnung des Müeterli als des «Muttergewindes», innerthalb dessen das «Vatergewinde» seine Spiralen zieht, ist durch die technische Sprache gegeben. In die nämliche Symbolik der Weinbausprache gehören Schloß und Schlüssel, schlüßle.
1
Gign. 37.
2
Mhd. WB.
3
Wie aber «
sexus» (zu
secare:
Walde 707) und gr.
týpos, Typus (zu
typ-t-ein, schlagen), ist «Ge-schlech-t» zunächst eine Zusammengehörigkeit von «Schlägen», die nach Art des
Iischlaag von Zaunstützpfählen die Bildung eines «Verschlags» (
Verschlacht, Underschlacht) und damit die Absonderung von in der Reinzucht zu erhaltenden «Schlägen» (Rassen) erzwecken. Diesen soll das
g’schlacht bleibende Individuum
naag’schlaa, es soll nicht
ung’schlacht «aus der Art schlagen», soll nicht gleich dem verwilderten Zuchtgenossen
vom Näst g’schlaa.
4
Mit Explosivstütze wie bei S-t-rom usw.
5
Walde 690.
6
Kluge 413;
M-L. Wb. 7748 ff., vgl. 7747.
Die Teile des Ụụfsatz, mittelst dessen die moderne Pressung vollzogen wird, tragen nun durchwegs prosaisch bildlose Namen. Da legen sich über den Bäck zunächst vier bis sechs gewichtige Latte von der Art der die Ziegel und Schindeln tragenden Dachlatte. Über sie kommen chrụ̈tzwịịs, für daß es rächt guet z’sämmebin͜dt, dünnere und breitere ( Trüel-) Laade. Es folgen, wieder über Chrụ̈tz und also gleichlaufend mit den Latten, je nach dem Druckbedürfnis in ein bis drei Schichten zu je vier Stück, und zwar nach oben immer dünner (und dafür hertholzig), die ( Trüel-) Lääger. Diese an Orgelbaßpfeifen erinnernden Holzstücke sind, damit man beim daartue und dänne näh si ch nid ganz chlemm oder su̦sch blessier, mit Gri̦ffe versehen. Das nämliche gilt vom Leist: dem wieder über Chrụ̈tz auf die Lääger gelegten massiven, harthölzernen Klotz von etwa 150 cm 396 Längi, bis 50 cm Bräiti und 25 bis 30 cm Hööchi. Er wird oft noch mit Eisenschrauben verstemmt, für daß es ’nḁ nid verjaagi (bei zu starker Pressung verspräng). Es kann dies auch verhütet werden durch die untergelegte Sohle, welche die oberste Läägerschicht ersetzt.
Die Pressung erhält ihren Aasatz, sowie ihre Lenkung ụụse un aabe in der Strụụbe, Trüelstrụụbe ( S. 395). Die besteht beim Holztrüel aus Nußbạum. Das Nußholz ist nicht spältig, poliert sich gut und lạuft gäärn, weil es nicht wie andere Hölzer rụụch ist. Im Nootfaal läßt es sich ersetzen durch Bergahorn oder Ulme (I̦lm). Solche Schrauben von etwa 25 cm Durchmesser können gelegentlich mitten in strenger und dringender Arbeit lo goo — das chlepft! — (das könnte bei schlechtem Guß auch den ältesten Eisenschrauben passieren) und das Werk aufs verdrießlichste unterbrechen. Nun sind alle Kelterschrauben gu̦ßịịsig (bestehen aus Gu̦ß) und gestatten, obwohl dreimal kleiner (10 bis 15 cm im Durchmesser) eine viel flinggeri Arbeit. Unvorsichtiges forßiere kann sie allerdings chrümme; de nn sị sị nụ̈t meh.
Auf dem Boden des Trüelraums verstemmt und in der zementenen Mulde ịizịmäntet, bedürfen die eisernen Schrauben weder der alten Strụụbezwinge (1791) noch der Verfestigung an der Trüelraumdecke. Eine solche Sicherung gegen das ụụsschlụ̈ffe (Erl.: -schlịffe) oder uụṣrü̦tsche verleiht dagegen der Holzschraube das Müeterli, Strụụbemüeterli, Holzmüeterli. Dieses «Schraubenmütterchen» ist ein ganz gewaltiges Balkenstück aus Äiche (z. B. 1803) oder Nußbaum von 3 m Länge und fast 1 m² Stirnfläche, verbi̦sset mit dicken Verschlußkeilen. Das Klotzige dieses «Mütterchens» wird aber im Trüel der alte Länti zu Kleintwann (Haus des Großrats Max Engel) künstlerisch behoben durch das geschickt angebrachte, schöne Wyttenbach-Wappen.
Die Standfestmachung der Kelterschraube durch das a d’s holzig Müeterli aag’schrụụbet ịịsig Müeterli verlegt den Schwerpunkt des Hebeldrucks nach oben; die erhöhte und dafür einzige Verfestigung im Boden und in der Mulde verlegt ihn nach unten. So wird die Presse alten Stils zum Oben-ábe-trüel, die Presse neuer Bauart zum Un͜den-ụụf-trüel. 1
Auf und ab nun dreht sich am G’win͜d der Schraube der einarmige, lange Preßhebel. Als Aasatz dient ihm ein dreifaches eisernes, früher auch möschigs (s̆s̆) Gebilde, bestehend aus dem Chraage, dem Chranz und der Pfanne. In letzterer lag z. B. 1829 die Nuß, 397 ähnlich dem runden Scharnierstück am Flintenschloß, welches den gespannten Hahn hielt. (Die Nuß ist überhaupt es Gläich, welches aus Gelenkkopf und Gelenkpfanne besteht; in dieser dreht sich jener.) Die wie eine Kuppel aussehende Pfanne stützt den gezähnten Chrage, welcher in seinen beiden außerordentlich starken Schlaufen ( Öhri) den durchgesteckten Trüelspaa rre aufnimmt.

Weinpresse aus neuerer Zeit im Hause Hubacher, Twann
Sehr einfach arbeiten nach diesem System neue kleinere Pressen, indem der etwa 2 bis 3 m lange eiserne Hebel des Hebeltrüel bei seinen hin und her vollführten Bewegungen von etwa 30° bis 40° in die Zän͜d des Chrage eingreift, bis erstens (zuerst) links und de nn rächts unter lautem Klixen eine der beiden Schließe (ein Versteller) ịịfallt. De nn het e̥s’s (es hält)! indem der Sparren nicht ụụsrü̦tscht. Nach ähnlichem Prinzip scheinen alte kleine Spanner (1804) am Spanntrüel (1827) gearbeitet zu haben.
Für die Bewältigung großer Ernten dagegen wachset der Trüelspaare oder -spaate (Balancier, oder Darm, 1827) zu 10 m Länge an. Er trägt am freien Ende einen Eisenring mit Schlaufen zur Aufnahme eines Trüelsäili, an welchem mehrere Männer zieh. Es gab 1776 im Twanner Ängelbärg rịịstigi Säil von 25 m Länge, ja, 398 zu Tw. 1797 solche bis zu 119 Bärnschueh. Auch kürzere Seile älterer Pressen lassen sich bloß anwenden mittelst des zum Doppelzug ausgebauten Rollensystems. Eine an möglichst weit entfernter Wand angebrachte Schịịbe, Trüelschịịbe, nimmt das Seil auf. Sein noch freies Ende lịịret si ch spiralig um die mitten im Trüelrụụm senkrecht aufgepflanzte und in starker Fassung drehbare Wälle, Trüelwälle (den Haspel 1797, die Win͜de 1797). Zu ihrer Handhabung bedarf es der heißen Arbeit von vier Männern, welche durch die zwei Loch des durchbohrten Trüelbaums zwei sehr starke Stangen du̦u̦restecke und nun jeden dieser vier Trüelaarme als eine Handheebi zum drääije brauchen: als eine manivelle, woraus das Mắniwell und schließlich glücklich der Mắnuel geworden ist. 2
Kindern dienen diese vier Manuele etwa als Rößlispi̦i̦l zu dem — allerdings recht gefährlichen — rößle.
1
Vgl. die «D’s-under-obe Schweli»
Lf. 63.
2
Vgl. die nächtliche Kelterszene zu Spiez in
Robert Scheurers, des Seeländer Dichters, herzigem Büchlein «Heinrich von Strättlingen», Kap. 16.
Mi sött mäine, die so gründlich ausgetorkelten Traubenrückstände wären nur noch guet für u̦f d’s G’schöör. Aber ŭ̦́haa! Noch sind die Chäärne nicht völlig ausgenützt. Was sie als e̥s g’wü̦sses Chü̦stli noch bieten, liebt zwar der Weinhändler nicht, wohl aber seit dem Anhalten der langen Mißjahrreihe derjenige kleine Rebenbesitzer, dessen Bedürfnis nach wenigem Haus- und Feldtrunk mit den Ernteerträgnissen sehr wenig Schritt hält. Er übergießt darum den Bäck mit Wasser und wirft in die neu ausgepreßte Flüssigkeit Staubzucker (alt: Zugger). Er gewinnt mit solch nochmaliger scharfer Pressung den Nachpreßwein, Nachwein, Tresterwein, Treeberwịị, Spülwein. So heißt die lat. « lav-ura» 1 oder lūra, lōra, ahd. auch lurra, mhd. lûre, liure, leur, lohr, glûre, der Lauer, die Lurke, von welchen Peter Suchenwirth behauptete: Trebern und glawrn sind peßßer vil denn chriechisch wein. 2 Da man mit solchem Nachwein französische Rotweine verschneidet ( pique) oder biggiert, heißt er auch piquette, rechts des Sees Pị́ggett, linksseeisch aber Pị́ggette (-wịị), mit welcher Wortform das noch Ungewohnte dieser Prozedur angedeutet ist. Das nämliche besagt die sarkastische Umstellung des Grund- und Folgeverhältnisses: Wo si̦ Pị́gget g’macht häi, het’s käi Wịị meh g’gää. Ein anderer 399 Sarkasmus liegt in der Korrektur: Dier müeßet nid säge: Piggette; dier müeßet säge: Bŏ́schŏlee ( Beaujolais) oder Hal lauer oder Grenoble. (Er wirkt «schnällziehend» wie der aus Grenoble kommende beste Zemänt.) Zum Trinken alli Stun͜d konnte allerdings eben nur die Piquette verführen. Die frühern Weinbauern verbesserten verdorbenen Wein, indem sie ihn auf den bezuckerten Trestern neu preßten. Solche Umgärung behebt namentlich den Schimmelgeruch (das grääiele). 3 Für den bernischen Weinhandel ist indessen dieses Manöver (gleich dem Gallisieren) verboten; nur Pị́ggette (Pịggétte) z’berchoo (zu «bekommen» = zu erzielen) ist erlaubt.
Aber auch nachdem der Trüel abprotzt 4 (1834: «aufgeräumt») ist, sind die Träber oder ist der Treeber 5 noch vielfacher Verwendung fähig. Er liefert Grünspan (spanisches Grün für Siegel, Spắgrüeni, Spanngrïen, Erl.: Spanggrüen), Potasche, Essig, besonders aber den Treeber als Branntwein.
Zum Treeber brönne bestand vormals beinahe in jedem Haus eine Brönnerei mit einfachstem Brönnhaafe, dessen Bedienung im Winter mit dem Stickel mache u. dgl. im Trüel in äim zue g’gangen isch. Heute dienen hierzu kompliziertere Appḁräät, mit welchen auch edlere Schnäpps ( S. 269) sich herstellen lassen. Ein solches Großgeschäft samt einem Apparat für ’bbrönnte Trääsch und Treeber z’tröchne betreibt eine Aktiengesellschaft beim Nußhof zu Gampelen.
Zum vorgängigen ịịbäize (um die Gärung hervorzurufen) dienen Treeberbü̦ttine von 6000 bis 7000 l Wassergehalt, welche früher im Boden uf Lätt ịịgg’loo gsi̦ sịị, heute frei in stolzer Parade zwäg stan͜de. Bitze wie Quadersteine, von den Bäcke abg’schroote, werden ịịg’macht, ịịp’hackt, ịị’bbanket, uf enand ’tischet (s̆s̆; nur leichte Gegenstände werden ’bbịịget) und fest g’stampfet, so daß kein Luftzutritt das graaue (die Schimmelbildung) hervorrufen kann. Eine das Ganze deckende Lehmschicht hilft nötigenfalls dieser Abwehr nach: mi verlättet der Techchel.
Der im Brönnhaafe oder -chessel entwickelte Dampf muß vor seiner Entlassung noch Kochdienste leisten. In ere Halbstun͜d wird als 400 spezifisch seeländischer Leckerbissen der Treeberwụụrst (Ins) 6 gar: eine ganz gewöhnliche, aber von Träberdunst durchsättigte Wurst. Sogar Katzenbraten soll bei dieser Bereitungsart so trefflich herauskommen, daß es keiner Tschịngge bedarf, um ihn als sehr gut zu taxieren. Ein in dieser Beziehung erfahrenes Landeskind erklärte bei Anlaß eines solchen «Zweckessens»: I ha scho Chatz g’chá, aber dás isch nid Chatz!’ 7
Keine Rääte̥ch (Randen) ferner schmecken so gut, wie die zugleich mit den Trestern übertoonne und ụụseg’noonne. Zum Herausbefördern dient die eigene Treeberzange (gebaut wie eine doppelte Grabgable, deren Zinken aber gegeneinander greifen).
Die bbrönnte Treeber dienen, gleich warm mit Runkelrüben (Erl.: Bŭ̦́ndangße, Ins: Bódangße) vermischt und mit Salz aag’macht, als milchreiches Viehfutter. Die rạue (rohen) 7a dagegen machen die Tiere schnääderfrääsig und wirken vi̦ll z’hitzig: sie erzeugen Ụụsschleeg. Erkaltet, geben die erstern noch guten Rebendünger oder auch, zu Chääsli gepreßt, torfähnliches Brennmaterial. Es brönnt aber besser weder Tu̦u̦rbe.
Auch trefflichen Wiesendünger liefern die Abfälle: si̦ gäbe guete Wase. Die twannerischen Besitzer von Matten äänet dem See und zu Nidau ( S. 36) kauften darum b’brönnti Treeber z’Wäidligewịịs für zehn Franken, führten sie wohl auch gelegentlich (z. B. 1769) wider altes Verbot u̦s em Amt ụụse, um jedoch mit de bloße Chöste ab der Zetti z’choo. 8
So lehrt mḁ bi’m Räbmḁ d’s chlịịnste Dingeli z’Ehre zieh, zumal wenn so viel Schweiß und Fleiß dranne (d’raa) hanget.
1
Walde 441;
Columella 12. 40.
2
Mhd. Wb. 1, 1054. Wohl in der gleichen Meinung, wonach das Kofentbier (Klosterbier) als nachgebrautes Getränk zuträglicher ist als Vollbier.
3
Schellenberg: die Behandlung der schweizerischen Weine (Frauenfeld, 1905) 124.
4
Der «zwei-räderige» Karren: l.
bi-rotus wurde it.
biroccio (wie
caroccio Karosse), venez.
birozzo, deutsch militärisch der Protzwagen und die Protze (
Seil. 4, 9). Im (gelegentlich stürmischen
uf- und
abbrotze) mischt sich das
protzig tue des
Protz, Brotz (bayr.-östr. svw. Kröte:
Kluge 357) ein. (
He, i cha jo goo!)
5
Setzt ein verlornes
trast voraus als Parallele zu «der Trääsch» (ostschweizerisch) und
der Traast (bernisch) — d. h. Geruch und Geschmack fauliger Gärung — woraus Trester geworden ist. (
Kluge 464.)
6
Vgl. «das»
brâtwurst (
mhd. Wb. 3, 827). Das sonstige Deutsch sagt nur «die» Wurst.
«Der Hanswurst» ist der Hans, welchem alles «Wurst» ist: dessen «absolute Wurstigkeit» alles nur vom Standpunkt guter Eßbarkeit aus beurteilt.
7
Vgl. hierzu
«du» porc, «du» veau usw.
7a
«Roh» ist rou, rau,
rạu, «rauh» ist
rụụch. Von diesen total verschiedenen Wörtern ist rauh, altdeutsch
rûch svw. haarig,
ghoorig («haarig auch im übergetragenen Sinn von «widerhaarig», unangenehm befremdlich), wie noch das «Rauchwerk» und der mit ihm betriebene «Rauchhandel» besagt. Auch «struppig» und «runzlig» ist svw. rauh,
rụụch. Roh =
rau dagegen, altdeutsch
rô, ist
ung’chochchet wie im Ursinn des Wortes das blutige, rohe Fleisch und das rohe, dicke Blut: der l.
cruor, welchem die ahd. Grundform
hravēr für «roh» entspricht. (
Walde 203 f.;
Kluge 366. 376.) Wie nun aber
usööd (eigentlich: was sich nicht «sieden» läßt) zu der Bedeutung «unbehandelbar» (
intraitable), unhandlich,
uhantlig gekommen ist, so «roh» zum Sinn von «ungebildet», indes man sich durch
rau eher an rauh (
ru̦u̦ch als «unfein», «unsanft») erinnern läßt.
8
NB. 3, 248.
Auf dem Wege der Gärung (s. u.) soll das Most im Trüel zum Wịị im Faß werden. Er kommt zu diesem Zwecke bei großen Weingeschäften in den bis auf 20° erwärmten Gärkeller, von hier in den schön chuele Wịịchäller von gäng glịịcher (glịịchliger) Weermi (7-10° R) und, ab’zoge, in den Fläschechäller. Schon mittelgroße Geschäfte vereinigen alle drei als Abteilungen in einem G’halt oder G’chalt, das aber als ein Hauptgegenstand ihres Berufsstolzes der Rede ruft: I ha meh Fräüd a mene schöne Chäller, weder a mene schöne Sắlong. 1 Warum auch nicht bei peinlicher Chälleroornig, wo man alls fịịsterlige a sị’m Platz fin͜dt? Wo auch kein Sụụrzụ̈ụ̈g oder dergleichen die (allzeit erneuerte) Chällerluft verdeerpt? Zumal links des Sees, wo die Keller fast zu ebener Erde liegen müssen (so daß es auch kein abeschlụụche des Weins gibt).

Am Zeugstock
Studie von Anker
Die guten alten Keller sị alli g’wölbt und stoßen etwa noch an das G’wölbli für Erdfrüchte, wenn nicht dies als Flaschenkeller dient. Ein von Zeit zu Zeit wiederholtes b’schieße mit Chịịslig erhält sie chüel und vermittelt den so nötigen energischen Luftaustausch ( d’Ärdweermi) dur e Bode. Zi̦mäntböde sind geradezu verwerflich, wo 402 sie nicht in täüffe Chällere doch das Grundwasser abhalten müssen. Zu den selbstverständlichen Dingen gehört das peinliche sụber haa durch den im Faß- oder Chällerchi̦ttel vo schwarzer Zwilche (1790), wenn nicht in blaau bạu wo̥l liger Chüefferblụụse steckenden Arbeiter.
Keller wie der des Bellelay-Klosters, in welchem man unter mächtigen Böge und G’wölb durch mit Roß und Wagen ịịneg’fahren ist, 2 bilden (wie alte riesige Pressen, S. 391) eigene Gebäude. Man denke an den auf eigenem Chällerwääg (1808) erreichbaren Tschugger Keller, an die Villa et Ruelle de la Cave (Nv.). Ihre Sicherung erforderte bravi doppelflüglige Chällerdoor, Chällerpforte n (1803) mit uberschieße ntem Oberrand, mit festem Saarschloß und Hohlschlüssel, gegenüber welchem ein gewöhnlicher Kellerschlüssel bloß wie das Ịịseli erscheint, mit welchem man in alter Zeit es Hööggli ụụsdoo het.

Fügbaum im Gebrauch
Keller-Etat-Bücher (z. B. von 1824) verzeichnen ein ganzes Register verschiedenartigster Faß oder Fesser nur schon als Weinfässer. Im weitesten Sinn ist ja Faß = Gefäß alles, was fasset: das altdeutsche pei- oder biefaß als Beijichorb; das liechtfaß als Ampeli; das handvaß als Wäschbecki; das lügevaß ein Lugner; das schandevaß als der Tụụ̈fel, das tugentvaß dagegen als der Tugendbold. 3 403 Als Fässer benennen wir bis heute das Salz-, Mehl-, Essig-, Öl-, Wasser-, Zucker-, Dịnte-, das Je̥ps-, das Bschü̦tti- usw. -faß.
Aber selbst der so enge Begriff des Wịịfaß und -feßli legt sich in eine lange Reihe von Einzelbegriffen auseinander. Das Herbstfaß und -feßli barg Herbst- oder Trüelerwịị für das Leservolk, das Her refaß den Her rewịị; und Schaffner Irlet verfügte 1722 über 5 große Pensionsfaß. Das Fuerfaß (1569) oder das fuederig Faß (um 1482) brachte als großlächts (1698), als immer noch ganzes, oder aber als Halbfaß (1743 u. ö.) oder sogar zịhligs (d. h. heute in Tw. mittelgroßes, sonst aber kleines) Faß Wein aus der Ferne. Das Rịịffaß, 1734 Ryfffaß (1732 Reiffaß) führte Ryffwein aus La Rive, und so speziell aus «Vyfiß» 1562 bis 1565 unter dem Landvogt von Thorberg. Der erhielt jährlich 20 bis 30 «ryffaß» = 10 bis 15 Landfaß mit «rotem ruchem wyn». Aus alter Zeit begegnet uns ferner das Wärmuetfeßli (1700 Wermetfeßli) zu 20 bis 40 l «Wermetwyn» (1699). Das alte Fuerfaß heißt heute Transportfaß. Eine Art desselben ist das als Last für n es Roß berechnete Landfaß von 1000 bis 1200 l.

Verzierung
am Fügbaum
Dagegen lagert im Keller als Schenkfaß der Schänkbohler. Er ist, wie der Branntewịịbohler (1791) und Lụ̈trigbohler, der Herbstbohler (1778) oder -boller (1837), das Bohlerli (1791 von 109 Maß) 4 von Gestalt chu̦u̦rz u dick, was freilich der Grundform des Booler oder Bŏler 5 widerspricht. Denn dies ist ein langes und schmales Rohr, aus welchem unter knallendem pole (Erl.: paale, Grundwort zu «poltern») g’schosse wird: eine Art Chatzegrin͜d, «Schießprügel» oder dgl. Eben dieser Prügel oder Knüppel ist l. der fustis, frz. le fût, pv. aber die fusa, und es gehört zu allerlei nur erdenklichen Vergleichungen mit seinem Aussehen 6 auch die fuste de vin (Li. 1797), die Fụ̈ụ̈ste, Fị̈ị̈ste als Schenkfaß, die anderwärtige Fụ̈ụ̈te als das tụụsiglịterige länge Landfaß, die futaille als die Tonne. Auch vom «Stück», welches wohl wie «Stock» eigentlich «Abgehauenes» 7 bedeutet, sprechen der Artillerist und der Weinhändler. Jenem ist das Stu̦ck die von Stu̦ckchnächte bediente Kanone (wie z. B. 1712 das Stücklein, Stückli), diesem in Deutschland das Stückfaß das so und so viel Stück (Maß) Wein enthaltende Gefäß. Nicht anders ist die gallische « pettia», frz. la pièce, 8 die länglich 404 gebaute, 100 bis 500 l fassende Bieße, sowie die (etwa 600 l starke) Sprịtbieße und das etwa 200 l große Bießli. Die gleichwohl ansehnliche Dicke kommt zur Geltung in der gut beleibten Weibsperson als der rächte, der dolle, feerme Bieße und dem etwas bedenklichen Bießli,
Wie aber echtes und deutsches Französisch zuweilen recht sehr auseinandergehen, so ist jenem unsere pièce = Bieße vielmehr die piepende pipa, pipe, von uns auch wieder als die Bị̆pe (von 500 bis 700 l) entlehnt. (Zu den anderweitigen Übertragungen der pipe 9 gehört z. B. das Pí̦wott ( le pivot der Uhr.) Nicht rund wie alle Transportfässer und Däili Lagerfässer sind, sondern fast wie ein Blettli flach gedrückt, also sehr stark ówal, war ursprünglich die (jetzt ebenfalls bauchig zylindrische) feuillette (100 bis 200 l fassend), sowie die halb so große mifeuillette: d’s Feullietli.
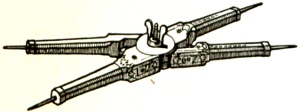
Schön verzierter Zirkel
Im Zusammenhang mit dem graubündnerischen Ponz 10 und Ponzji steht das Pu̦nsche̥rli. In solche Fäßchen von 10 bis 30 l verteilten Weinhändler, wenn sie große Lagerfässer mit einem Mal leerten: abg’füllt, debitiert, verpu̦nscherlet häi, Wein unter Landwirte, welche mit ihren Heuete- und Sichlete-, gelegentlich auch mit Chindbetti-Pu̦nsche̥rli oder Pu̦ntsche̥rli sich einstellten. Die sogleich mit silberige Füflịịber aus den mitgebrachten Söiblootere oder Tuechseckli bezahlten Portionen machten solches verpuntscherle zu einem guten Geschäft.
Die Punscherli kamen indes u̦s der Mode, wie die ihnen ähnlich gebauten Löögel, angeblich, wi̦l si̦ schwäär sị z’bu̦tze g’si̦i̦. Das war allerdings der Fall, wenn man sie mit Trueße und sogar mit Unrat mancher Art verschmierte. Richtig gepflegter Wein aber erhielt sie selber in gutem Stand und blieb in ihnen ganze Tage über schön frisch. Darum bildeten die doppelsäumigen (zweihundert Maß haltenden), aber auch kleinern und ganz kleinen Löögel (s. u.) vormals zu Amme̥rzwịl-Wịịgaarte bei Großaffoltern den Gegenstand einer beträchtlichen Hausindustrie 11 und wurden von Heuern und Weinbauern gerne zur Bergung des Vespertrunks oder Kochwasserbedarfs auf ferne Arbeitsplätze 405 mitgetragen. Zum Magglinger-Häiet (s. u.) wanderte das ovale, 10 bis 15 l haltende Magglinger-Loogeli aus Tannenholz mit, indes das rund (zylindrische) Wịị-Loogeli aus Eichenholz, 1-5 l fassend, «stärkere» Bedürfnisse befriedigte. Es gab auch Loogel aus Chestene- und aus Chirschbaumholz, jene sehr billig, diese sehr angenehm. Aber jene häi’s nid lang g’haa, und beide waren rasch verschlịịmmt. «Loogeli» 12 ist eine Verkleinerung aus Loogel = Lŏgel, Lĕgel. Dies ist als lagella (eigentlich lagenula), selbst verkleinert aus lagēna, lagœna, lagāna, lagūna aus gr. (der oder die) lágȳnos: tönernes, gläsernes oder aus Weiden wasserdicht geflochtenes Gefäß mit flaschenartig engem Hals und weitem Bauch, an Henkeln tragbar, 3½ l haltend. 13 Nach solchen Loogel bezog man z. B. 1535 14 und 1555 in Twann den Lehenzinswein, wenn er nicht nach dem alten Viertel ( quart, Ggaart, nicht twannerisch), d. h. 75 l ụf d’s Ma̦l eingefordert wurde.

Rundhobel
Den Gegensatz zu solchen Zwergfäßchen bildet das Lägerfaß, welches über 10 alte Säum haltet, im Heidelbergerfaß aber die Kapazität von fast ¼ Million Liter erreicht. Solche Riesen werden in Twann nid gäng voll. Sie bergen dann in ihrem Bauche ganze Türme von Flaschen Qualitätsweins. Auch der moderne Welsche nennt das Lägerfaß le (oder, wie in Chexbres, la) lêgrefas, wenn er es nicht, wie in La Vaux, als l’égrefas deutet, 15 oder gar, wie im Neuenburgischen, die deutsche Kürzung d’s Lääger als le lĕgr 16 nachspricht. Vor dieser allgemein durchgedrungenen Deutung von «Lääger» auf das Faß mußte die Grundbedeutung «Faßunterlage» weichen, und diese mußte mit der schriftdeutschen Benennungsform d’s Laager vorlieb nehmen. Bloß der Verkleinerung Läägerli bleibt die Grundbedeutung, und auch die Verbalformen läägere, g’läägeret haben teil an ihr. 17 Auch die g’hạune Läägerstäine als unmittelbare Stütze des Lager sind nach der mundartlichen Grundform benannt.
Das Lager ist in der Regel äichig. Es trägt das Läger derart, daß letzteres (also das Faß) mit seinem freiliegenden Bụụch durch zwei 406 keilförmige Schließe vor dem Hin- und Herrollen gesichert bleibt. Es wird vor dem Füllen i d’Schließe g’lüpft. Ein Speerlig verstemmt das Faß gegen die Mauer: er het e ntggääge (in Tw.: erggääge).
1
Emanuel Ritter.
2
Beinahe erinnernd an den Weinkeller Ramses’ II. (Hesse-Warlegg, Wunder der Welt 1, 82) oder den valikanischen Keller vor der Zeit des Abstinenten Pius X.
3
Graff 3, 727 f.;
mhd. Wb. 3. 230 ff.
4
Irlet
5
Schwz. Id. 4, 1178.
6
S.
M.-L. 3618.
7
Kluge 450.
8
M-L. 6450.
9
Ebd. 6520.
10
Schwz. Id. 4, 1412.
11
Marti 49: Berner Tagblatt.
12
Gotthelf, Rabeneltern 221.
13
Prellw. 256 f.;
schwz. Id. 3, 1167-9.
14
DBE. 37.
15
Tappolet in
Bull. 2, 41.
16
Gign. 43.
17
schwz. Id. 3, 1169 ff.
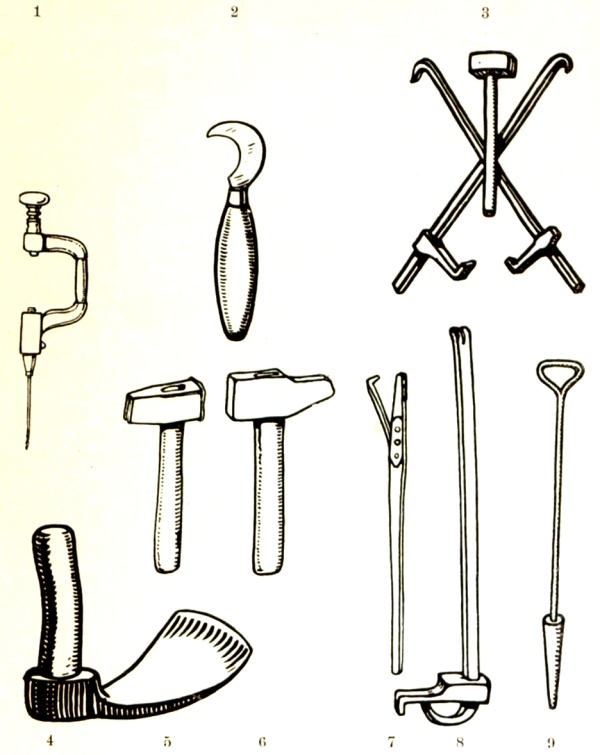
|
Abb. 1. Windelbohrer
|
Abb. 5. u. 6. Setze u. Hammer (Setzgeschirr)
|
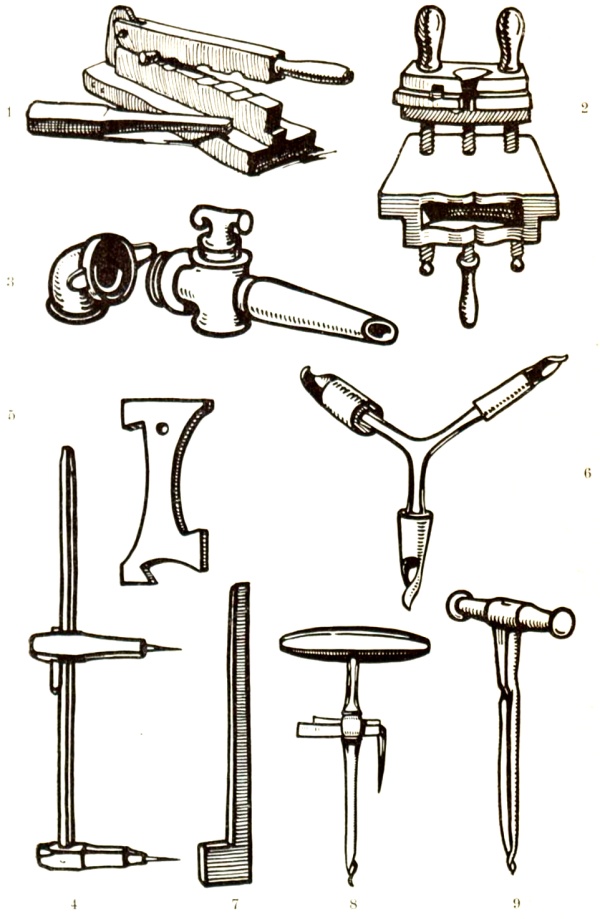
|
Abb. 1. Zapfendrucker
|
Abb. 6. Spuntenbohrer
|
Der Grundfläche nach sind die Fässer rund oder (was eine beträchtliche Platzersparnis ermöglicht) ŏ́waal (1762: «ablang», oblong). 1 Zum Schịịn rund können auch die inwendig vierg’eggete Fässer sein, welche als Zemä́ntfesser oder Stäifesser, Zemäntchäste aus Eisenbeton mit Glasfütterung bestehen. Ein Doppelfaß dieser Art ist auf der Insel zu sehen; andere stehen im Dienste städtischer Weinhändler und großer ländlicher Mostereien (s. « Aarwangen»).
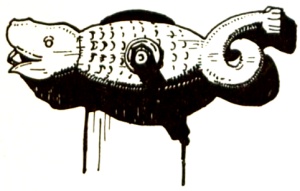
Faßriegel im Keller
von Albert Krebs
in Wingreis
Sie ersetzen nicht sowohl das tannig Holz der sehr großen Transport-, wie auch der Treeberfesser, als vielmehr das äichige. Das als nicht spältig und nicht verdrääit sich empfehlende Eichenholz kam früher vom Wäldli wie hin͜der der Chroos, wie zu Treiten u.a.O. Heute muß es g’spalte aus Ungarn bezogen werden, um doch gäng no chläi eine so intelligente und sorgfältige Arbeit wie die des Chüeffer (s. u.) nid la̦ z’erga̦a̦.
1
Exakte Sprachweise unterscheidet natürlich zwischen «eiförmig» als
ōvālis (gut l.
ōvātum) und «länglich rund» als ausgedeutetem
oblongus (was gut l. nur länglich heißt).
Denken wir nun schon an die Dauben: Dụụge (Tw.) Tạue, Doue (Erl.), Tu̦wwe (allg. seeländisch und bernisch). 1 E Tauen abḁ g’soffe oder — etwas ziviler — e Doue oder es Douli g’läärt hat eine Kellergesellschaft, die beim Wịị versueche den Inhalt eines vollen Fasses derart verminderte, daß nun ein um eine Daube engeres Faß damit gefüllt würde.
Die Bogenform eines Daubendurchschnitts zeigen z. B. die Bụụchdouli: Bretterstücke, mit denen gebäuchte Wäsche bedeckt wird, damit sie nicht überquelle. Als natürliche Erdrinne gibt sich die Tụụbelochschlucht, sowie der Daubensee; über einer solchen liegt das Dauben Horn. 2
409 Eine besonders starke, darum immer aus Eiche gefertigte Faßdaube ist die den Spund tragende Spu̦ndtu̦u̦be. Sorgfältigster Arbeit aber bedürfen alle: zunächst ein sträiffe der Außenseiten mit dem Hobel; dann ein vorläufig grobäänisches dächsle (s. u.) der konkaven Innenseite, gefolgt vom verpu̦tze mit dem scharf schneidenden Verpu̦tzhobel. Der Dickeunterschied der Daubenränder, welcher beim Fügen als die Überzän͜d sichtbar wird, ist auszugleichen mittelst des abdächsle. Hierzu dient das kurzstielige Biel, dessen quer zum Halm gerichtete Schneide an die Wagnerhạue zum Aushauen der Radfelgen erinnert. Es ist das ahd. dehs- isarn, «die» dehsa oder dehsala, dehsila, mhd. dëchsel oder dëchse, der Dexel (1834: Zimmerdäxel) oder Dächsel. 3

Studie von Anker
Sorgfältiges ab- und ụụsdächsle erlaubt erst das wasserdichte füege mit Vermeidung der Spitz-, Rauh-, Ịị-, Ụụs-, Walzfuege. Unvermeidliche Risse, wobei d’Fuegen offe sịị, darf bloß das erlächche hervorrufen; mit Watte u. dgl. lassen sie sich vermache. Die fehlerhaften Fuege aber sind z’verchnospe mit den einfachen Strähnen der S. 394 beschriebenen Chnospe oder des Chnospel. Hierfür wie für viel weitere Manipulationen wird das Faß g’lü̦pft mittels des 410 Rịthoogge, dessen verschiebbarer Versteller an der etwa meterlangen Eisenstange hin- und her- «rịtet».

Peter Krebs,
Küfermeister in Twann
In die Dauben werden d’Böde ịịg’fueget mittels der eingeritzten Rịịßi. (Vgl. den Reiß 4 als liniierte oder dü̦pfleti Abgrenzung des Randes, z. B. eines bläächige Chessel.) Rịße = reißen, ritzen = chritze, Riß und Ritze und Reiz, engl. write (schreiben) und Reißbrett ( Rịịßbrätt), Reißblei ( Rịß- oder Lịịsblei), Grund- und Auf- und Abriß usw. gehört zu writ und bekommt erst durch das einfließende Moment des Widerstandes auch den heutigen Sinn des kräftigen schrịße, des Schrịịs, z. B. im Tanz ( S. 376) u. dgl. Die derart gerissene Rinne, K-rinne, d’Chrinne ( rainure, jable) heißt gut fachmännisch am Jolimont und zur Linken des Sees der Gaargel, häufiger nun freilich mit singularisierter Mehrzahl die Gaargel oder Gaargle (zürch. Aargle), 5 das Gaargli. Dazu gehört das Verb gaargle: das neue Faß, der neue Zuber usw. wird g’gaarglet, ein altes Faß u̦mme g’gaarglet. 6 Die beiden Ausdrücke für die Rinne vereinigen sich im Rịịßer = Gaargelrịịßer als dem 411 «Gaarglekamm», von dem es im Küferlied (s. u.) heißt: (Mit dem Gargelkamm) reißt man die Gargel hinein.

Frau Peter Krebs in Twann
Als die Gaargel oder Gaargle bezeichnet man abkürzend auch den Gaargelchopf (Chopf), der über den eingefügten Boden frei hervorragt. Die innere halbe Holzstärke dieses «Kopfs», welche durch die Gargel abgeschnitten ist und bei unsorgsamem abstelle des Fasses gärn abg’sprängt wird, heißt der Frösch 7 (Ins) oder d’Schu̦bblaade (Erl., Tw.). Die durch Abschelferung entstehenden Überzän͜d werden 412 mit dem Schi̦fflihobel abg’hoblet. Zu stark verderbti Chöpf aber müssen abg’săgt und durch das umschaffe des Fasses (neuen Bodeneinsatz, der natürlich das Faß chlịịnner macht) ersetzt werden. Zur Not können abschelfernde Schubblaade aag’neegelet werden.
Schäden solcher Art werden vermieden bei du̦u̦r e̥wägg genau gleicher Breite der Gaargel und des Bodenrandes, so daß dieser exakt in jene ịịne baßt. Der Küfer sichert sich solche Genauigkeit mittels der Lehr. 8 (Vgl. «d’Lehr» als Lehrgerüst der Brücke.)
Ein an die Wissenschaft des Ingenieurs ( I̦nschi̦nöör, ö́) erinnerndes Kunststück ist das G’wölb (die Wölbung) des voortere Bodens an (liegend gedachten) großen Fässern. Wer e̥s păr Schritt wịt unter sehr spitzem Sehwinkel nach diesem Boden hinschaut, gewahrt seine nach dem Faßinnern gerichtete Sänkig, Sänkung (Konkavität): der Bode loot sich i der Mitti ịịne. Dadurch wird verhindert, daß die Last der Füllung der Bode ụụsedrü̦ck. Der Küfer 9 belehrt uns, daß diese Einwölbung mit drei Linge (Linien) u̦f de n Fueß (1 cm auf 3,3 cm) berechnet ist — genauer also als das π, 10 welches sonst dem Küfer mit hinreichender G’naaui «3» bedeutet.
Zur Kunst des Faß ụụfsetze gehört ferner, d’Tạue so fest im Boden ịịz’chlemme, daß das Faß sogar ohne einen Reiff, Räüff (Ins) oder Räifft (Tw.) solid und fest dostäit. So kann er nach bekanntem Wortwitz uns zeigen, wie er die Tauben füeglich setzt und faßlich darstellt.
Die Räüffe oder Räifft sind tannig (z. B. 1779 von einem Räiffmacher in Alfermé aus Tannest gefertigt) oder — zumal bei alten Lääger — aus Bandịịse geschmiedet. Solches schmịịde besorgte vormals der Küfer ebenfalls selber; heute ersetzt ihn der Schmi̦i̦d. Die i der Schmi̦tti mit warmen Nieten z’sämmeg’schmi̦i̦dete n Reifen häi Chöpf wi n e Fụ̈flịịber. Diese Bänder müssen nun der bauchigen Faßform je nach der Ründi ihres ideellen Durchschnitts so sorgfältig angepaßt werden, daß sie in allne Däile straff aufliegen. Bi̦’m ówaale Faß muß der Reifen auf den (die größte Krümmung oder am mäiste Bụụch aufweisenden) spitze Sịte größere Dehnung erhalten: meh Lạuf ’berchoo, u̦f der flache Sịte min͜der. Solches Dehnen heißt Lạuf gää, läüffe; die Bandeisenreifen werden g’läüfft. Große Küfereien bedienen sich hierzu der Läüffmaschine. Der Landküfer muß sich diese durch Hämmern ersetzen, wobei Familienglieder die Reifenden festhalten. Da pflanzen sich wohl die Hammerschläge von den 413 krampfhaft zugreifenden Händen durch den Vorderarm nach der empfindlichen «Maus» des Ellbogengelenks: daas grä̆mü̆selet äi’m im Naar rebäinli, daß mḁ wäiß, was weh tue isch!

Paul Krebs
in Twann (
S. 22)
Nach solcher Vorbereitung werden die Reifen aag’läit. Der Küfer langt aus dem Setzg’schi̦i̦r die Setzi oder die Setze n hervor: den Hammer und den Stumpfmeißel mit dem die Dicki des Reisen scharf anfassenden Hi̦ck, und dem die Hammerschläge auffangenden andern Ende. Ähnlich werden die Reifen der erlächchnete (Erl.) oder verlächchete (Tw.) Fesser, welche lu̦gg über die Dauben hinrutschen, vor dem verschwalle aatri̦i̦be, damit sie wieder fest anliegen.
Über die beiden Chöpf des Fasses kommen die Chopfräifft, welche mittels der Räiftzange oder des Räiftaazieijer besonders fest aa’zoge werden müssen. Über die Mitte des Fasses, dem Spund zunächst, legt sich der Bụụchräifft. Zwischen diesem und den beiden Kopfreifen bringt man je einen oder bei Erfordernis noch einen zwäite Halsräifft an.
Ein Werkzeugskatalog aus der Chịefferlạube des Bu̦chsihụụs ( S. 203) aus dem 18. Jahrhundert verzeichnet an hier noch unerwähnten Geräten: Vor allem 2 Fügböcke ( Füegblöchcher), welche an die Zimmerböck der Zimmerleute erinnern. 3 holzig Chị̈efferzi̦i̦rkel; 414 6 Schlicht- oder Gletthëëbel; 1 Schropp- oder Vorhobel (entsprechend der Vorachs des Zimmermanns); 2 Ab-änd-hëëbel, um d’s Änd z’mache oder um z’ände: die den Boden berührenden Kopfflächen des ụụfg’stellte n Faß glatt zu hobeln; 1 Putzhobel aus Eiche zum ụụsbu̦tze oder absụ̈ụ̈fere der Daubenfügungsstellen am fertigen Faß; 1 Backehobel zum Entfernen der Überzän͜d am Frösch; 1 Gesimshobel. Ferner: 3 Reifzange und 4 Reifkluppen ( Schrụụbzwinger) zum provisorischen aastrụụbe der g’nu̦mmerierte Tạu be an die Böde. Ein Du̦belmässer «in Form eines Rassiermässer» statt, wie heute, als auf einem Holz aufgereifte, oben scharfkantige Eisenröhrchen verschiedenen Kalibers, durch welche getrieben die abg’spaltnige holzige Du̦belnegel z. B. zum ve̥rniete der Bodenbretter ihre sechskantig prismatische Form erhalten, um schließlich mit dem Chïefferschni̦ttzer noch g’spitzt zu werden. Wir nennen gleich hier auch den Bohrerschaft (Bohrerschrank), der eine ganze Reihe verschiedenartigster «Lochmacher» sehen läßt: 2 Zungebohrer mit verstellbarer Zunge und starker Handheebi, zum Bohren großer Löcher, wie z. B. der Ösen am Zuber; den (als Delphin geschnitzten) Bohrwindel oder Windelbohrer mit Aastächbohrer, in welchem der herausgebohrte Zylinder ganz haften bleibt, um als Zapfe das gebohrte Loch zuez’mache (Erl.) oder z’vermache (Tw.) — nämlich an Transportfässern zumal aus Frankreich, wo eine dem Uneingeweihten verborgene Zwäär chschịịbe den Spund ersetzt, sowie bei Lagerfässern ohne Hahn; den Spuntebohrer; 2 Löffelbohrer (löffelähnlich) und 3 Hülsen für solche. 3 Schaber ( Ziehchlinge) dienten für abz’sụ̈ụ̈bere, 3 Zü̦ü̦gmässer zu allerlei Gebrauch.

Lina Krebs,
nun Frau Siegfried
Eine eigene Einrichtung besitzt der Küfer zum dämpfe des Daubenholzes, damit es sich in die zur Faßform nötige Gestalt bringen lasse. 415 Die erspart ihm aber nicht die Müej, dem fertigen Faß durch drị wäärme oder drị fụ̈ụ̈re und sorgfältiges ablösche das erforderte Aussehen zu erteilen. Noch wichtiger ist freilich das bụ̈ụ̈nde 11 der neuen Gebinde mit siedendem ( chochchigem) Sodawasser, damit das Holz dem Wein nicht seine Abchu̦st gääb. 12 So werden auch g’graaueti Faß, wenn nicht ein allzulanges graaue höchstens noch zu inwendigem abhoble rät, mit Schwäfelsụ̈ụ̈ri und chochchigem Wasser oder mit chochchiger Trueße b’bụ̈ụ̈ndet. Namentlich wenn ein Transportfaß mit neuem, süßem und darum viele Gärstoffe hinterlassendem Wein gefüllt war und nun ältern Wein fassen soll, ist es unbedingt geboten, vorher eine Bụ̈ụ̈ndi dri z’mache und umme n ụụse z’näh.

Johanna Krebs,
Oberrichters
Eine letzte Prozedur, die aber darz’lege vil zu ’ne längi G’schicht wäär, ist das föörme des Fasses mit dem Stahlsäili oder dem Faßzu̦u̦g. Dieser dient auch als Notverband für einen g’sprungne Räift.
Noch seien die Brandzäiche (Brandstämpel) und die ụụfg’ma̦a̦lene Initialen als Eigentumszeichen erwähnt.
1
Urverwandt mit gr.
doché (Behälter, zu
déchesthai, aufnehmen) ist ml.
dōga. Über mailänd.
dogva kam es zu it.
dōva, frz.
douve, um Landeron
döv. (
Kluge 87;
M-L.)
Wb. 2714 (Bedeutungsfülle!) und Einführung 126;
Atl. ling. 422;
Seil. 3, 214.
Gatsch. O. 117. 156, wo auch
Tụụbeloch und Horntụbe. Taufers (aus
Tuverasca), ferner Tobel (
tubil) herangezogen wird; ebenso Daubensee.
2
Vgl.
Jaccard 138.
3
Graff 5, 124;
mhd. Wb. 1, 321;
Kluge 89. Die Arbeitsweise mit dem Dächsel veranschaulicht schön, wie sie ein «Schwingen» (
dihsen dahs dâhsen gedohsen) ist.
4
Lf. 325.
5
Vetter 261.
6
La gargouille und
le gargoyo (Landeron; vgl.
Atl. Ling. 655;
ZfrPh. 38, 51;
Gign. 45),
la dz̆erdz̆i (Neuenburg) und
dz̆ardz̆i, la gordj (Büderich) führen über romanisches
garga (Schlund) zum Schallwort
garg (gurgeln,
se gargariser) und schließlich zu Gurgel. (
M-L. 3685 f. 3921 ff.;
schwz. Id. 2, 416; Grimm Wb. 7, 1357.)
7
Vgl.
schwz. Id. 1, 1333, wo treffend an die Ähnlichkeit mit den hervorstehenden Hinterbeinen des ruhenden Frosches gedacht wird.
8
Schwz. Id. 3, 1366.
9
Krebs und Engel in Twann.
10
Gr.
peripheria, genauer: deren Verhältnis zum Durchmesser (3,1415926... : 1).
11
Nach dem
schwz. Id. 4, 1321 zu vgl. mit l.
imbuere, durchtränken. (
Walde 379.) In der Bedeutung «eingießen» bildete
imbuere das it.
imbuto usw. (
M-L. 4286) als Trichter
12
Vgl. die Behandlung der Arvengeschirre in
Gw. 652.
Do hätti mer d’s Faß. So z’sääge ein Kunstgebilde, das als fertiges Werk den Meister lobt: den Binder oder in echter Stammbildung: den Bind, alt Bindo, genauer: der Faßbind. Der Berufsname konnte natürlich nur in einer weinbautreibenden Gegend entstanden sein, breitete sich aber als Geschlechtsname auffallend weit aus. Bereits 1390 erscheint in Schwarzenburg Cuno der Binder, schon 1356 aber Heinrich Bindo, wie 1373 der Thuner Bürger Johannes Bindo, 1451 der Bind zu Baden (Aargau). Besonders aber begegnet uns im Amt Schwarzenburg die Weßfallform: (Sohn oder Tochter) «des Binden», und diese als neuer Werfall hingestellt: der Binn de (noch um 1890). 416 Gewöhnlich aber faßte man «des» = d’s als «z’» und schrieb dies mit «Binden» als éin Wort: Zbinden, Zbinne; und zwar so häufig, daß es 1883 im Amt Schwarzenburg bei 2000 Zbinden gab. In Luzern stand 1403 Jennis Faßbinden-Hus, und dort wohnte 1456 Hans Grebel, der Vasbind. In der Ostschweiz ist der Name Fäßler üblich, in der Westschweiz der Titel Chüeffer (als Geschlecht in Bern: Küffer). Der Her rechüeffer besorgte den obrigkeitlichen Wein. In der Funktion als Weinbesorger überhaupt ist er Faßchüeffer. Im Seeland freilich und namentlich in dessen Bụụreland muß der Faßküfer, wenn er zu sị’m Mues u Brot choo will, als Chüeffer überhaupt sich mit dem Chü̦ü̦beler (Kübler, Schäffler) 1 in seine Arbeit des chü̦ü̦bele teilen, die als solche allein ihm z’gäggelig, z’ni̦ffelig, als ein ggäggele, niggele und ni̦ffele vorkäme. Er muß anderseits zusehen, wie der Bụụrechüeffer beim Wirt als «Dokter» kranker Weine ihm ins nöblere Handwerk eingreift. Eine Würdeabstufung zeigt übrigens auch die Wortgeschichte nicht: «Faß» als Gefäß ( S. 402) ist in keiner Weise fü̦rnähmmer als l. cūpa oder cōpa, woraus «Chopf», 2 coupe und cuve, sowie cup-ella, Kübel, Chü̦bel und chub-il-i, Chü̦beli, Chü̦bli 3 geworden ist.
Das sagen sich denn auch die vier näbebịị stark mit Weinbau beschäftigten Twannerküfer: Peter Chrẹbs (Krebs), Fritz Engel (der Fri̦tzi Chïeffer oder der Häiri), sowie die beiden Rueff (Ruff) aus einem alten Twanner Küfergeschlecht, dessen Vertreter Daniel Rueff ein weit herum berühmter Meister seines Faches war. Das gleiche sagte sich selbst der um 1830 zugleich als St. Urbaner Rebenpächter stark engagierte Vingelzer Küfer Sigmund Mühlheim von Scheuren bei Gottstatt. Alle sind, wenn’s sịị mues, auch Kübler.
Das hindert nun keineswegs das berufsstolze Aufmarschieren in blauer Chüefferblụụse und schwarzem, schwerem Chüefferschụụrz, das Tschäppi kunstgerecht lässig aufgesetzt, den Chüefferschlegel als Berufsinsigne an der Linken. Noch spricht beim umschaue der auf der Walz befindliche Chüefferbu̦u̦rsch den Meister an: «Grüeß Gott, Meister und Gesellen! Grueß vom letz̆te Meister! Gott bring euch Glück und Segen ins Haus und G’schäft! E fremde Chüeffer spricht um Arbeit!» Noch wird er einem kurzen Examen unterworfen. Etwa: Cha nnst aastäche ohni Liecht? Cha nnst du hölzigi Reiffte bande? (Aus Weiden — Wịịdli — gefertigte Reife als Band um eine Kufe legen, so daß sie richtig schließen.) Cha nnst u̦f Holz schaffe? 417 (Verstehst du etwas von Holzbearbeitung überhaupt?) Aus dem Ton und Tempo des selbstverständlichen «Ja» schließt der Examinator sicher auf das wirkliche Können. Lautet der Befund günstig, so kann das ịịstelle mit der Formel erfolgen: Du chaast aaschiebe!
Noch streiggt seinerseits der Bursche, indem er wortlos mitts i der Arbäit den Schụụrz abzieht, fu̦rt g’heit, ụụfli̦s’t, un͜der en Arm nimmt und gäit.
Noch singen sie bei frohmütig kollegialischer Zusammenkunft, z. B. der Verbandssektion Biel-Neuenburg, ihr Chüefferlied. Jede Strophe schließt mit der von einem im Chehr Dirigierenden unverhofft vorgeschriebenen Zahl von Sträich. Wer das Äins! oder Zwäi! oder Drei! verpaßt und isoliert wịter fahrt, ist i der Bueß. Er zahlt einen Liter oder eine sonstwie zuvor verabredete Buße. «Gewäßte» Küfer, wie Fritz Engel, wissen das Lied meisterhaft mit dem trommelnden Chüeffersträich zu begleiten. Das Lied führt sich ein als Selbstbeglaubigung wandernder Gesellen vor Meistern in Wien:
Lustig seins wir Handwerksleut, Handwerksleut,
Lustig seins wir Küfer heut!
Warum sollten wir nicht lustig sein,
Trinken stets vom besten Wein?
«Wer trinkt vom besten Wein?»
Die Küfer!
«Wo sind sie?»
Hier bin ich!
«Laßt euch hören!» Auf einen Streich!
Auf zwei! drei!
(Küferstreich!)
Wir Arbeiter, Fürst’ und Grafen,
Klein und große Fässer laden.
Ist das nicht ein Küferstolz?
Macht ein Faß von Eichenholz!
«Wer macht ein Faß von Eichenholz?»
Der Küfer usw.
Man tut streifen, man tut fügen,
Feur und Wasser muß es biegen.
Ist das Faß gewärmt und genetzt,
Wird es auf die
Rollen gesetzt.
«Wer setzt es auf die Rollen?»
Der Küfer usw.
Drauf fängt man zu enden an,
Setzt an, den Hobel herzhaft.
Ergreift die Säge mit frischem Mut.
Dann wird auch das Ende gut.
«Wer macht das Ende gut?»
Der Küfer usw.
Darauf reißt man die Gargel hinein.
Hier muß sie ausgehobelt sein.
Dann tut man die Zirkel stellen,
Daß man kann die Böden
sellen,
4
Nicht zu groß und nicht zu klein,
Daß sie passen in die Gargel hinein.
«Wer paßt sie in die Gargel hinein?»
Der Küfer usw.
Dann tut man den Reif abschlagen,
Was sie mögen wohl ertragen,
Und
macht dann die Böden ein.
Fest müssen sie eingebunden sein!
«Wer bindet sie ein?»
Der Küfer usw.
Dann tut man das Faß i’n Keller,
Füllt es gleich mit Muskateller
Und macht auch den Hahnen an,
Daß man ihn
versuchen kann.
«Wer versucht ihn?»
Der Küfer usw.
418 Das nämliche Biel, aus welchem uns 5 dieses Küferlied zugekommen ist, kannte auch einen eigenen Chïeffer-, Schiffer- und Fischertanz. Die hier entfaltete Beweglichkeit erscheint um vieles gesteigert bei dem Kunststück, auf das Unterende eines in der Hand gehaltenen Reifens ein Glas oder sogar zwei platschvoll Wịị zu stellen und, ohni e Tropf z’verschütte, den Reifen eine bestimmte Anzahl Male mit voller Armslänge im Kreis umzuschwingen.
D’s Mäisterstücki aber vollführte an der Berner Landesausstellung 1914 der schweizerische Küfermeisterverband mit dem Faßstäche. Zwanzig bernische und zwanzig freiburgische Reiter «aus der Zeit des 30 jährigen Krieges» umritten in bunten Sammetwamsen und blanken Panzern je ein mit Lanzen zu zertrümmerndes Faß, wo’s-nid vil isch schad gsi̦i̦ drum. U das het gäng e chläi müeße waggele oder troole. Wär im rịte mit der Lanze d’s Faß droffe het, het e P’hunkt ’berchoo. E jedere Bitz Holz, wo z’Bode g’fallen isch, het zwe P’hunkte g’macht. Wär e Räifft het abg’stoche, däm sị drei P’hunkte z’guet g’schribe worte. Fị̈ị̈f het’s g’gää fïr ’ne Räifft, wo z’Bode g’fallen isch u fïr n e jederi Dụụge, wo abg’stoche worden isch, u zääche für di letz̆ti Dụụge, wo dụụreg’macht worten isch. Dḁrbịị het mḁn aber o drụf g’luegt, daß si̦ i der Oornig rịti. Es isch nid e Viertelstun͜d g’gange, ist d’s Bäärnerfaß fụ̆́tụ̈ụ̈ g’si̦i̦, und uf der Stell drụụf d’s Frịburger oo.
Leider endete die hier beschriebene Feete mit dem Betrug des ụụsg’schäämte österreichischen Schwindlers Völkel.
1
Schwz. Id. 4, 1342;
Gb. 632;
Font. 8, 131. 9, 324.
2
Gw. 471.
3
M-L. 2401 f.;
Kluge 258. 269. 270.
4
einsetzen. (
Schwz. Id. 7, 737.)
5
Durch Peter Krebs in Twann (
S. 410)
Nun vom Gebrauch des Fasses: seinem ụụffü̦lle und entleeren. Wie wird es gefüllt?
Vorab verhindert das richte durch ein Si̦i̦b oder Si̦i̦bli, wenn nicht noch besser dur n e bĭ̦rchige Bääse das Mitlaufen von Dickem samt dem Most in das Trüelloch oder das in demselben stehende Bü̦tteli. Aus diesem wandert bei modernsten Einrichtungen das Most durch die Wịịpu̦mpi in das Faß. Eine äußerst bequem zu handhabende Pumpe ist die Flü̦gelpu̦mpi. Der Leitungs -Schlụụch aus Gạutschụụ, Gátschụụ (Erl.), mit Sụụger versehen, ist bei Wanddurchlässen mit (in Twann fabrizierten) Rohrschälle versehen. Wo der 419 Kellerbau darna̦a̦ ch isch, wird der Schlauch durch den im Boden ịịg’la̦a̦ ßnige Chänel aus Tannenholz ersetzt. In ältern Betrieben aber besteht das ịịtu̦nke eines Chü̦ü̦beli in den Mostbehälter fort, wenn nicht ku̦mooder: eines (ursprünglich als Flüssigkeitsmaß dienenden) congius, 1 ital. cogno, Goon, in Ins: Goorn (Mehrzahl: Göörn), der speziell als Mostgoon gebaut ist. Mit diesem füllt man, ohne z’vergü̦ü̦dere, die Bränte ( S. 365). Diese nimmt der mit dem abtraage Betraute a’ n Rügge; er ersteigt die ans Faß aag’stellti Chällerstääge und läärt mit geschickter Rückendrehung die Brente in das der Spundöffnung des Fasses aufgesetzte trajectorium: den Drachter, Wịịdrachter, Trächter (wie basl.), Trichter, das Trachterli, Trichterli. Durch Größe zeichnet sich der Landfaßdrachter aus. Verschiedene von all diesen Fülltrichtern aus Holz ist der bläächig Drueßedrachter zum Entfernen der Hefe (s. u.) aus dem Faß.
Beim ụụffü̦lle kleinerer Gebinde ersetzt den Trichter das lange Ausflußrohr der gallēta (afrz. jaloie und jale), ahd. gellita, Gelte, 2 Wịịgelte.
Jegliche Faßfüllung mit Most hat mit dem, stịịge derselben infolge der Gärung zu rechnen. Sie läßt daher einen leeren Raum un͜der em Bu̦nte (s. u.), dessen auf Erfahrung gegründete untere Grenze durch eine etwa kleinfingergroße Öffnung: den Wecker (Erl.) oder das Wächterli (Tw.) mit dem ebenso geheißenen holzige Zäpfli verschließbar, markiert ist. Ein hier beginnendes ụụselạuffe belehrt den Zufüllenden, daß er soll hööre (aufhören).
1
Eigentlich Muschel,
Mu̦schle (s̆s̆), (
Prellw. 232;
Walde 185). Vgl.
M-L. 2146.
2
M-L. 3656.
Im Fasse sich selber überlassen, wirt nun us em Most Wịị. Wie?
Unter den Fadenpilzen, welche der Boden des Weinberges z’Miliarde birgt, werden insbesondere die Weinhefepilze ( S. 328) 1 auch auf die Hü̦ltsche und Grappe der Weinbeeren verschleppt und geraten damit i d’s trüelet Most. Das ist ihnen ein so zusagender Wohn- und Kostort, daß sie sich in ihm erst recht, ja fabelhaft vermehren. Sie wirken dabei in ähnlicher Weise wie die Lebewesen, welche das sụụr wärte, das sụụre des ịịg’machte Sụụrzụ̈ụ̈g, der Milch usw. hervorrufen, und wie die Spaltpilze, welche z. B. das Li̦nti vom Flachs lösen. Sie bewirken, daß der Wein rääzt und ü̦ü̦bere gäit, 420 auch recht bald ü̦ü̦beren ist; sie erregen die Gärung, den Jääs, den Jast. Das letztere Wort bezeichnet auch die «stürmische Gärung» in einem zur Übereile gedrängten Menschen, der jastet und hastet.
Das Gären heißt jääse, jä̆se. 2 D’s Most het verjääs’t (verjä̆set) oder verjääse. (Alt: «Der Wein ist gehren.») 3
Für «gären» gilt lat. fervēre (fervĕre). Dieses erhielt über frz. fervent, unser ferwä́nt und ferwä́ngt, die Funktion eines Steigerungspartikel. Etwas außerordentlich Schönes ist ferwä́nt schön, ja gar ferwänt schön.
Worin nun aber besteht die Gärung oder bestehen vielmehr die beiden Gärungen? Die erste ist eine Umwandlung des allermeisten Traubenzuckers halb in Alkohol und halb in Kohlensäure, verbunden mit der Entwicklung von Eiweißstoffen und organischen Säuren, welche dem Wein Aroma und Wohlgeschmack verleihen. 4 Die zweite Gärung ist ein Säureabbau. Der frische Traubensaft enthält: vorzugsweise Apfelsäure, wie sie auch in Äpfeln, Pflaumen und Kirschen steckt: sodann Weinsäure, unter Umständen auch aus Alkohol entstandene Essigsäure, und entwickelt beim Vergären auch etwas Bernsteinsäure. Diese Säuren sind zum Teil frei, zum Teil gebunden an Natrium, Kalzium und Kalium. So ist der Wịịstäi nụ̈ụ̈t an͜ders weder saures, weinsaures Kalium, welches in der alkoholhaltigen Flüssigkeit sich nur schwer löst und daher im Wein teilweise ausfällt. Die Apfelsäure nun wird bei wärmerem Lagern durch bestimmte Bakterien, wie namentlich das stäbchenförmige Bacterium gracile, in Milchsäure übergeführt, welche nur halb so sụụr ist wie die zersetzte Apfelsäure. So wird der Wein mild, 5 er mụssiert.
Der Gärung entgeht auch der «alkoholfreie» Wein trotz Bazillenabtötung durch Erhitzen (dank welchem er anfangs unangenehm g’chöchelet het) nicht ganz; er untersteht einer Alkoholgrenze von ½%. 6

Keller im Hause Max Engel in Klein-Twann
421 Die Kohlensäure entweicht in bekannter Weise unter Brausen und Schäumen ( schụụmme), dann unter Werfen kleiner «Korallen». Der Wịị chrallet, wird chrallig. Diese Gärung verteilt sich auf verschiedene Zeiten, welche nach fester Überzeugung der Weinbauer mit den Vegetationsperioden der Rebe im Einklang stehen. Im Blüeijet und im zwäite Saft(-strom) wott der Wịị zur Mueter z’rugg (zur Rebe). Der Wịị stooßt (oder stooßt si ch) im Faß, wenn du̦sse d’Räbe stooße (oder drü̦cke, S. 274); und wieder, wenn d’Räbe blüeje, «verkehren sich die Wein in den Fassen.»
Der Wein im Fasse fühlt,
Wie der Wein am Stocke blüht.
Do lï̦pft si ch d’Trueße, und der Trueb chu̦nnt wieder i’ n Wịị. Ruhiger als bei dieser stürmischen Gärung rüehrt si ch der Wịị im Augste, und — no der Saag — in dem mit seiner Witterung ihm «antwortenden» Dĕ́zämber ( S. 424), speziell i der häilige Nacht. «Wen n es do d’Trueße lüpft oder ụụfrüehrt, so gi bt 422 es nach altem Glauben d’s nööchst Johr guete Wịị.» Gewitter üben natürlich starken Einfluß, der sich zum Teil verhüten läßt. Zur Zeit des Blüeijet machen — dank der frühzeitigen Lebenshöhe der Gärungserreger — besonders Schaumweine G’späß, denen auch mit den stärksten Schampanierfläsche nid z’wehren isch. Selbst über den «Serwanier» ( S. 285) mußte Irlet 7 am 24. Juni 1775 melden: «Er ist diß jahr wiedrum recht wild. Ich fand 13 Flaschen versprungen, und in meiner Gegenwart sprangen noch zwo. Ich glaubte, sie wollten alle nacheinanderen verspringen. Ich öffnete die Zäpfen und ließ eine kleine Weile die Flaschen ( Fläsche) offen. Aber sie hatten doch nicht Frieden. Fand wieder 19 Flaschen gesprungen. Eine zerspang mir in der Hand zu Stücken.» Daß laut Bericht vom 9. Juni 1778 die «niderlag» unter dem selbst fabrizierten «Shampagnier» nicht geringer war, isch käi Wun͜der. Erst das Verblühen der Reben brachte «Waffenstillstand».
Namentlich mastigi und in der Überreife faulende Elsäßer-trauben, die man überhaupt nie zum Guetedel g’heie sött, machen den Wein gummiähnlich, zääh, läng, lin͜d, plump und öölig. Er öölelet auf der Zunge und lạuft fast wi Öl. Dieser Zustand darf insofern als Merkmal gut werdenden Weines gelten, als es sich um einen ungewöhnlichen Anteil ung’jäsnige Zucker handelt. Der wird (samt den ätherischen Ölen) durch schü̦ttle i der Fläsche oder durch peutsche mit dem Bäse im Faß in der Masse verteilt, so daß das Fäde zieh vergäit. Im Fasse selbst wird länge Wịị mit dem Stooßịịse behandelt: An einen senkrecht eingeführten Eisenstab schließt sich waagrecht ein etwa 3 dm langes, 5 cm breites, 2 bis 3 mm dickes Eisenband mit hundert und mehr Löchli, durch welche die zerrissene, zähe Masse ausfließt.
Um aber beim Zufüllen halbleerer Schenkfässer nicht die Hefe ụụfz’rüehre, wird das senkrecht eingeführte Füllrohr mit seiner sehr stark verlöcherete Unterhälfte langsam in den alten Wein getaucht, so daß der neu zugegossene in nur ganz schwachen Strahlen ausfließt.
Als Merkmal gut werdenden neuen Weins gilt etwa der Bock, das böckele. Das ist aber doch lediglich eine widrige Beigabe von Schwefelwasserstoff, herrührend von mißbräuchlichem ịịbrönne: überschwääfle. Beim richtigen Abzug vergäit der Bock vo sälber, sehr selten aber in der fehlerhaft aufgefüllten Flasche.
In mangelhafter Gärung unverarbeitet bleibende, daher z’fast fü̦ü̦reg’chehrti mineralische Bestandteile verursachen die Häärtchu̦st. 423 Diese ist besonders eine Beigabe roter Weine, haftet aber auch gerne am Insler (Inselwịị) besonders trockener Sommer wie von 1893. 8
Wird solche Häärtchust — auch im übertragenen Sinn als «Häimḁtschịịn» einer geschätzten Sache — je nach Umständen gerne in Kauf genommen, so ist dagegen der bei Luftzulaß von Essigbakterien 9 befallene essigstichig Wịị, wo Stich het, ein hoffnungsloses Ding; gibt er doch nid emol gueten Essig, der ja aus gutem Wein hergestellt werden will. Weniger bös ist der Milchsäurestich.
Nicht gefüllte Schenkfässer, die im Aastu̦ch ( S. 428) bleiben, bedürfen des kundigen ụụfbrönne (des Schwefel-Bran͜d «auf» dem Wein gegenüber dem ịịbrönne des leeren Fasses). Unterbleibt es, so bildet sich eine Dechchi von jenem Kahmpilz ( Saccharomyces Mycoderma), dessen Fetzen im schlimmern Wortsinn (s. u.) Blueme heißen werden.
Ein nicht rasch mit Schwäfelsụ̈ụ̈ri von Schimmelgeschmack befreites Faß wird namentlich am hin͜dere Bode grääụelig (Erl.) oder grääielig (Tw.) und macht auch den Inhalt z’grööiele oder z’grääiele. Da dies nicht ansteckt, kann solcher Wein allenfalls mit anderm Wein g’gụppiert werden. Eine vormalige Behandlungsweise vollzog sich mit frisch gebrannter Laubholzkohle, insbesondere aus Pfaffehüetli oder Spindelbaum: mit Fụsịn (1852: « fusain») 10 — scharf zu unterscheiden von Fuchsin als Mittel schändlich trügerischer Fuchsrot-Färbung verdorbener Weine. —
In jedem Fall aber ist solche Verschimmelung des so mühsam gewonnenen edlen Nasses e böösi Sach! Am besten luegt mḁ darmit furt z’choo. Er dient im knixerigen Haushalt etwa, wie auch der essig- oder milchsäurestichige Wein, als Getränk bei heißer Feldarbeit, wo für e Durst hurti öppis soll guet gnue sịị. Nur sollten da doch Magen und Eingeweide mit Sohllääder g’füeteret sịị, um nicht mittelst schwer heilbarer chronischer Katarrhe der Lebens- und Arbeitsenergie schwere Schädigungen aaz’due.
1
Schellenberg 50.
2
Die mundartliche Form bedeutet als ahd.
jer-ian eigentlich gären machen neben
jës-an gären (mit
gi-ner-ian nähren neben
ge-nës-an «gnäse», genesen, am Leben bleiben). (
Lf. 439.) Die Endsilbe
i-an schwächte zur Anähnlichung der Artikulation und zum Ausgleich des Drucks das stimmmhafte
s zum weichen
r (wie in
war aus
was). Form und Bedeutung vermischten sich aber (wie in
hangen und hängen =
hänke, in brẹnnen und brënnen =
brönne). So wurde mhd.
gir gar gâren gegoren gleichbedeutend mit
gise jas jâren gegoren, inden auch weiches
g mit
j wechselte wie in gäten = jäten, Genf = Jänf usw. (
Kluge 159;
mhd. Wb. 1, 529 f.;
Graff 1, 611.) Endlich beginnt auch die starke Biegung
es ji̦st (altnhd. der Most «gieret») der schwachen zu weichen:
es jäset.
3
Dieser Einbruch in die starke Biegung ist zugleich eine Erschütterung ihres Typensystems:
g’jääse ersetzt «gegoren», wie «geweben» umgekehrt
g’wobe wurde, und wie «geschienen»
g’schune wurde. (Vgl.
Lf. 263;
Gb. 479.)
4
OW. 25, 258;
Schellenberg 50.
5
OW. 22, 25. 41 ff. 202. 336; 23, 137. 288. 387 ff.; 25, 401 ff.
6
OW. 23, 271.
7
Laut Brief.
8
Vgl.
Jahn, Glossen und Reime 178 ff.
9
S.
Schellenberg 113;
OW. 24, 68.
10
Irlet.
An der Grenze des Krankhaften bewegen sich neue Weine, in denen die Gärung von Zucker während des folgenden Sommers wegen schwach gewordener Hefe nicht vollständig und richtig verläuft, sondern durch bloße Schleimbildung ersetzt wird. Der Wein wird brụụn oder schlịịmmig. Da hilft man vor em Neujohr nach durch ụụfrüehre der Trueße mittelst der Rüehrchötti, welche, an einem Stäcke 424 hangend, ein- oder zweifach tieff i’ n Wịị ịịne eingeführt und tüchtig geschwungen wird.
Das radikale Mittel ist freilich kundiges abzieh. Ein erstes solches findet bei sehr kundigen und sorgsamen Rebleuten bereits statt um oder nach Neuja̦hr. Dabei wird aber die auf der Hefe gelagerte Schlịịm-Trueße (Tw.) oder der Schlịịchwịị (Erl.) entfernt, der bloß noch halb vergorene Bodesatz dagegen als richtige chöörnigi Trueße der delikat behandelten Wiedereinfüllung des nun vierteljährigen Weins beigegeben. Allerdings ist es dabei häikel, häiklig, äikel 1 z’träffe, daß daas guet ụụse chu̦nnt. Überhaupt ist der Wein häikel, äikel (empfindlich) für d’s abzieh. Der Seeländerwịị sött lang löie (Erl.), rüeije, li̦gge, sagen darum andere Kenner.
Bis zur Zeit des Früchligsabzug erfolgt ein neuer Wechsel von trüeble (si ch trüebe) und si ch hälle. Noch einmal sodann: im Blüeijet, antwortet der Wein im Faß dem erneut starken Saftlauf der Rebe 2 und erwartet, nachdem er im Séptämber tüchtig Wịịstäi aag’hänkt und damit sich bleibend geklärt hat, den allfälligen Herbstabzug zwecks Platzbeschaffung. Dieser muß unter strengster Vermeidung von Luftzutritt — am besten mit der Wịịpumpi — vor sich gehen. Ein anderes ist die Zufuhr von Druckluft über dem Schänkwịị, wozu man sich vormals ( «no bi mi’m bsinne») des Bla̦a̦sbalg, Blooschbalg (Erl.), Blooschbalt (Ins) bediente.
Auf Flaschen ab’zogne r Wịị wird gewöhnlich während der sechs ersten Wochen e chläi chrank, um dann wi längers wi meh an Güte zu gewinnen, bis zu einer von der Art des Weins abhängigen Zeit ein Stillstand und ein abnäh eintritt. Gute Rotweine bessere si ch gäng no bis ins vierte Jahr. Ist der Trueb, d’s Trüebe, wo am Wịị zehrt, durch Abzüge entfernt, so rịffet der Wịị auf dem Wege der stillen Nachgärung von Stoffen, welche den Wein zum fü̦rnähmste aller Getränke erheben. Spaltpilze von der Art derer, die dem Tụ̆́back (Erl.) oder Tụbáck (alt Tw.), dem Kakao, dem chinesischen T’hee ihren Duft, bzw. ihren Wohlgeschmack verleihen, schaffen ihm die Bluemme 3 im bessern Sinn des Worts. Von ihr unterscheidet die Chemie — nicht die Laiensprache — le bouquet: das Bụ̆́ggee. Dieses ersetzt an den bessern Sorten und Jahrgängen des Seewii aufs vorteilhafteste die Chlịịnni des Weingeistgehalts.
D’s Bụ̆́ggee sött mḁ chạuffe, nid der Alkohol! rief ein Kenner des Seeweins aus. Das würde allerdings diesem um so mehr 425 zugute kommen, da zu der hohen geographischen Breite im Seeland teilweis das Steilgehäng und der Chalchbode treten, um Jahrgängen wie 1906, 1911, 1915, 1917 zum Bụ̆́ggee auch Fụ̈ụ̈r z’gää.

Weintransport
(Küfer Engel u. a.)
Von solchem Weine heißt es dann: Er het e̥ wch es Bụ̆́ggee! Mi schmeckt’s i der ganze Stuben u̦mme, we nn mḁn e̥ wch ịịschänkt! So z. B. der Joggeliwịị der Inser Jahrgänge 1906 und 1911, so geheißen nach den von Maler Anker originell hingeworfenen Schiltli (in Ins svw. Flaschen-Etiketten). Der wirkliche Joggeli von «1906» lieh seinen Namen auch dem Tschä́ppel Hans (Hans Anker) von «1911». Beide Jahrgänge unterschieden sich bei’m proobe so, daß der von 1906 an Alkoholgehalt bedeutend hinter dem Neueburger und Wadtländer zurückstand (är isch nid so starch g’si̦i̦) und bloß durch Wohlgeruch hervorragte, indes der von 1911 (gleich dem von 1893 und 1895) im Wịße volle 12%, im Roote sogar 13% (Alkohol) ’zoge het. Der Dreienụ̈ụ̈nzger (von 1893) hinwieder war am Bättag gụldgääl b und süeß wi Huṇ’gg.
Das war allerdings der strikte Gegensatz zu Ernteergebnissen, deren Säuregehalt zu den bekannten Allerweltswitzen Anlaß gab. So zu den bereits S. 278 f. wiedergegebenen die folgenden: Inser gaben in einer Kellerrunde 426 (s. u.), indem sie im geheimen es G’sicht g’macht häi wi sịịbe, das gemeinsam gebrauchte Glas von Hand zu Hand weiter: Nimm du̦u̦ (Tw. und Erl.: dụụ), i ha g’haa! Nach dem Trunk besonderer Jahrgänge soll man, für nid es Loch i’ n Mage z’berchoo, nit di ganzi Nacht uf der glịịche Sịte li̦gge, sondern dem mitternächtlichen Ruf des Nachtwächters folgen: Halbi Wändung — g’chehrt!
Vgl. die «Nebelspalter»-Witze vom Entgleisen eines Zuges durch auf die Schienen geratene Weinbeeren u. dgl. 4 oder die Historie vom Weinbauer am Zürichsee, der mehrere Körbe voll Trauben über Nacht im Freien stehen ließ im festen Vertrauen, es nähm sị g’wüß nịe̥mmer. Richtig fand er z’mornderist die Trauben in voller Anzahl vor; nu̦ma d’Chëërb si fu̦rt g’sịị.
1
Verhältnis zu Ekel:
Kluge 200;
schwz. Id. 2, 1118.
2
Vgl.
Schellenberg 77.
3
Schmeil 27, 409.
4
«Anz. v. Saanen» 1888, 44.
In großen, dicken, kristallinischen Krusten haftet an der Faßwand der Wịịstäi ( S. 420). Er ward im Sommer 1916 massenweis aufgekauft zwecks Verwendung im Kriege sowohl (für Sprengstoffe), als im Lazarett (für blutstillende Mittel). Die letztere Verwendung in Ehren! aber die erstere het für di par Batze vi̦l Wịị u Faß verdeerpt. Denn der Weinstein chu̦nnt vom Wịị u g’hört dem Wịị. Er ist ein wichtiger Erhalter der edlen Flüssigkeit. Noch nicht festgesessener, sondern wi San͜d an der Kruste klebender, mit dem Besen abwischbarer Weinstein heißt der Floos (Tw.) oder der Flooz (Erl.). Er gehört dem das Faß reinigenden Arbeiter ( Chüefferbụụrsch, S. 416) als Steuer a d’Schueh, deren der so häufig im Nasse z’stoo Genötigte vi̦l brụụcht.
Werde nun die Sụ̈ụ̈ri des Seeweins als «angenehm» 1 ( S. 279) gepriesen oder gegenteilig verschätzt: 2 unverkürzt bleiben ihm die Attribute pétillant (moussierend), brụụselig oder brụ̈ụ̈selig nach Art des Brụ̈ụ̈seler, grĭ̦fig (Erl.) oder gri̦i̦fig (Tw., mit dem Nebensinn von etwas rụụch), piggánt, und jedenfalls rezä̆nt. Recens ist, 3 was grad äbe von seinem Ursprung herkommt, wie z. B. das frisch und hell aus seiner Quelle sprudelnde Wasser. Ein raffinierter Kenner umschrieb das Wort mit dem Wunsch: Jetz wett i, i hätt e Hals so läng wi ne Rächesti̦i̦l! Bei derart verlängertem Gaumenreiz kann wohl auch das Urteil herauskommen: dää Wịị het Lịịb! Es isch öppis draa! (Wie am vollmundigen Bier.)
Leider ist der Weg der Geschmacksempfindung (Gaumen und Hinterzunge) nur kurz und wird obendrein durch rạuke, durch starkes Biertrinken 427 und scharf gepfefferte Speisen am rächt ụụschü̦stige wirklich chü̦stiger Sachen und am Herauserkennen ihrer Chu̦st so häufig abgestumpft, daß auch die Chu̦st als Abchu̦st, als der Abgụụ verdorbener Dinge sich unerkannt einmischt. Da kann ein noch unverpfuschter Geruchssinn korrigierend eingreifen. Ein in dieser Beziehung fein gebliebener Twanner Kenner het äis Lëchchli zue, um Sorte und Jahrgang herauszuwittern, wie der Schütze äis Auge̥ zue het, um mittels scharfer Abgrenzung des Blickfeldes das Ziel um so fester ins andere Auge zu fassen. Dääsälb (jener) kennt es auch heraus, ob in relativ unanfechtbarer Weise Neueburger mit Tschu̦gger verbesseret worden ist, oder ob man Änglefer (von 1911) durch Gallisieren mit Zucker und Wasser g’streckt het. Da im übrigen di Gụ̈ụ̈ ( les goûts) verschi̦de sịị, kann auch der Chu̦ttlerụgger 4 (der die Eingeweide, Chu̦ttle, zum quietschenden rụgge bringt), der Sụ̆́ru̦gger, der Rachepu̦tzer und Rü̦ppizwicker, 5 das räinste Sụrchabiswasser, der Sụụrimụụs (Erl.), Suremus ( S. 279) und der chasse-cousin als e chläi chächch (keck: Tw. 1777), chratzig im robụ̈ßtere Sinn und vielleicht wohl rääs immer noch Gnade finden, wenn er nur real ist. Um so schärfer verurteilt jeder geborene Seeländer jeglicherlei verdorbenen Wein. So den durch verdorbene Kellerluft mit Milchsäurestich oder gar Essigstich ( S. 423) behafteten, der nach Essig sticht (1785) oder u̦f Essig zieht und damit wi längers wi sụ̈ụ̈rer wirt. Wie der aus gänzlich ungereiften Trauben gewonnene — Essig von 1816, oder die 1910er Ernte eines noch sehr begünstigten großen Rebguts (vgl. S. 248), welche, i mene Tüechli verarbeitet, no rächt stịffen Essig g’gää het! (Aber nid guete!)
Doktere mit brụụnem Süeßbrand (1768: Süßfluß) ist als unter Umständen unumgänglich ebenso unbeanstandbar, wie dagegen verwerflich das bis zum Schwäfelgụụ aufdringliche ịịbrönne = schwä̆fle (Ins: schwööfle) von Weinen, welche trüeble. Immerhin reicht auch jener halb oder fast geheilte Patient nie an den gesund gegorenen und gereiften Wein heran; er kommt ihm nicht gleich: är gäit nid mit ihm (Tsch.). Mit Entrüstung aber weist der Weinbauer jeden Pantschwịị, z’sämmeg’schü̦ttete Wịị, ’pfu̦schete Wịị, jedes G’mischmasch und alle Schmierereien, die den Wein capiteux machen sollen, von sich. In seinen Kreisen entstanden Spottverse wie dieser bielerische:
Der Brunne hai si vorne, hinte d’Schị̈ị̈ß. 6
428 Um so mehr erfreut er sich an dem durch kundiges Einschenken hervorgezauberten Stäärne, welcher «auf der dunklen, würzigen Flut im hohen gebuckelten Glase prickelnd zusammenkräuselt.» 7
1
Meiners (1782) 1, 162. 202;
Wagner 34.
2
Vgl.
Karl Jahn 178 f. über den Inselwein.
3
Walde 644.
4
Aus den Bieler Reben:
Molz 27; aus dem Berner Altenberg: R. v. Tavel, GG. 16.
5
Bührer 3.
6
Molz 1.
7
Frey
Das ụụffülle als ein ịịnedue fordert als sein Gegenstück das ụụsenäh als ein ụụseloo («herauslassen») des unter dem Druck von Last und Luft mächtig nach Freigabe verlangenden Weins. Diese vollzieht sich als aastäche. Der Ausdruck deutet auf primitives ụụfdue des Gebindes wie irgend eines vermachte Behälters mit dem Nagel. 1 Sein stäche reflektiert sich in pungere, 2 wie Stich ( Aastich) im punctus samt dessen Lehnformen: der P’hunkte und das P’hunkt, sowie der Bụnte (Tw.) und (mhd.) der punt, der pfunt, der Spu̦nte 3 (Mehrzahl: Spünte, Erl.) und der Spund 4 zunächst als die oberste Faßöffnung. Diese heißt (als « puncta») la bôd in Landeron und Grissḁch; vgl. la pointe. Bis zu dieser angefüllt, also bụntevoll oder spuntevoll ist das volle Faß, wie auch der volle Mensch. Wie einen Haarschopf aber, an welchem z’voller Han͜d zugreifend man einen tschụppet, ergreift man als den Tschuppe, in St. Blaise le ts̆üpŏ́, 5 den Spundzapfen, — wenn er nicht vielmehr des ụụseschloo bedarf — zum Öffnen des Spundlochs. Diese Öffnung und ihren Verschluß bezeichnet man als zusammengehörig gleicherweise als den Bu̦nte (Spu̦nte).
Noch immer ist das Spundloch gemeint, wenn man zum völligen Entleeren des auf dem Wagen ruhenden Landfasses, nachdem der Syphon (s. u.) seinen Dienst getan, das Gebinde über de n Spụnte läärt, wenn nicht einfach überläärt (ä́). Sonst aber heißt die Öffnung jetzt ausdrücklich (und also unbewußt pleonastisch) d’s Bu̦nteloch, Spu̦nteloch, Spu̦ntloch (Erl.), und die einfache Benennung Bu̦nte, Spu̦nte gilt dem Spundzapfen.
429 Spricht man jedoch von der Spu̦nttụụbe als der wo möglich immer äichige und damit die Öffnung unzerschlissen erhaltenden Faßdaube, so zeigt die konservierende Kraft der Zusammensetzung auch hier unser Wort wieder in der Grundbedeutung «stechen», «anstechen». Von solcher reden ausdrücklich der Aastächbohrer und der messingene Aastächhahne.
Dieser stoßt beim Eintreiben in den Unterteil des Fasses den verschließenden Bantoffelzapfe (s. u.) ịịne, wenn nicht gerade der Schlụụchzapfe ihn ersetzt hat.
Dieser Schlauchzapfen — er besteht aus Akazien- oder Eibenholz, damit er nicht durchlässig schwäiß oder doch an der Stirnseite Schwụmm aasetz — tritt nämlich beim Füllen eines Transportfasses aus einem Lagerfaß mit dem Anstechhahn in Wechselfunktion. Zunächst wird aag’stoche. Der Schlauchzapfen macht Platz dem Hahn, an dessen Gewinde der Schlauch zum ü̦bereschlụụche gedreht wird. Ist das Transportfaß voll, so wird abg’stoche. Der Anstechhahn wird ụụsezoge und der Schlauchzapfen wï̦der ịịne too.
Eine chu̦tzeligi Arbeit ist dabei das ịịnestäche sowohl des Zapfens wie des Hahns, weil natürlich dabei das vorzeitige Heraussprudeln des Weins zu verhüten ist. Solches ịịnestäche hat u̦f den erste Stich, also mit zielsicherer Gewandtheit zu geschehen. Sonst heißt’s vom Ab- wie vom Anstechenden: är het g’fählt! Damit er das Schlụụchzapfeloch besser bb’räich, ist das Vorderende auch des Anstechhahns wie das des Schlauchzapfens schreeg abg’schnäärzt 6 (abg’schnạuzt, abg’schreegt, in Erlach: abg’schreeget): die eine Seite der Öffnung steht meißelartig vor. Zugleich kann beschränkter Platz im Keller es wünschbar machen, daß der mit dem abzieh Beschäftigte das neu zu füllende Gefäß zur Seite des Hahns stellen könne. Der Wein soll also sịtlige — und zugleich ruhiger — auslaufen. Drum wird dem Hahn eine kurze, halbbogenförmige Verlängerung angeschraubt: der Hundschopf. Es darf dann allerdings nicht vorkommen, daß der Wein noch in zwei weitern Strahlen ausfließe und der von seiner Vergäßligi Überraschte um Hilfe rufe: Himmeldonner! drei Loch u nu̦me zwo Hän͜d! Dem rasch wieder zur Geistesgegenwart Gelangten isch es aber du̦ z’Sinn choo, statt der fehlenden dritten Hand äis Chnäü daarz’haa — oder der Schu̦u̦rz ịne z’stoße, wie eine Frau in ähnlicher Situation tat — und damit dem überreichen Segen ganz z’verhaa, bis er aus der peinlichen Lage erlöst wurde.
430 Für kleinen Abzug aus dem Schenkfaß dient der hölzerne Ụụsschänkhahne.
Sind für diese beiden Hähne im Țü̦ürli (s. u.) Loch angebracht, so bohrt sich wịter oben ins Faß das zum Entheben von Versuecherli geeignete Probierhähneli. Statt dieses wirklichen Hähneli französischer Fässer haben die seeländischen ein Zäpfli: eine zum drehenden ụụsezieh und ịịnestoße eingerichtete Hornspule, welche sich mit der hornigen Kapsel: dem Chäppli oder Chäppeli verhüllen und sichern läßt. So wird die Einladung «wäi me̥r e chläi ga̦ rịịberle?» mühelos befolgbar. Diese Spule samt dem Chäppli heißt nämlich das Rịịberli, auch modern frz. le riberli. Zugrunde liegt also rịịbe: unter Widerstand, darum kräftig über einen Gegenstand hinfahren. Die Urform « wrib» 7 bedeutet aber drehen, drääije, wie denn auch der Tü̦ssel des Hahne oder die Chịịde des Messinghahns mit der sie befestigenden Schịịbe, mittelst dessen oder deren Viertelsdrehung die Flüssigkeit entlassen wird, der Reiber genannt wird. 8
Gewissermaßen ein kleiner Schlauchzapfen ist der zum zieh eingerichtete Zü̦ü̦gel oder das Zü̦ü̦geli. 9 Dieses kann den Ausschenkhahn des im Aastu̦ch befindlichen Fasses ersetzen, kann aber auch mehrfach an demselben angebracht werden. Mit seinem spitzen Vorderende in das ụụsbrönnt Loch eingeführt, heißt es (in Ins) auch wieder das Zäpfli, zu Landeron aber le gyĕt, d. i. das Chäigeli, die « kegilitta».
Zwecks völliger und rascher Abzapfung dagegen gäit am Landfaß zum Bu̦nten ịị der kupferne Sị́ffu̦ng ( syphon), der mittelst eines Röhrli aazooge wird. Ebenfalls oben i̦nn, am Spund, läßt sich im Mindestmaß Wein entheben mittelst der Spuele: eines Schilfrohr- ( Röhrli-)Stücks oder eines Strạuhälmli. Frühere Begleiter reisender Fässer ließen es nie an paraatem «Material» zum gemächlichen spuele fehlen, erfuhren aber am Ende der Fahrt, wie unversehens vil weeneli o vil gi bt. Gut eißerisch heißt solches «spuele» su̦gge (Intensiv zu sụụge). Ein schlụ̈ụ̈chele (Tw.: schlị̈ị̈chle) wird dieses «saugen» an Hand des Schlụ̈ụ̈chli aus Gắtschụụ. Der Name fausset erinnert an den (ebenfalls am Spund angesetzten) Stechheber als den Wịịdieb oder Wịịschelm namentlich ehemaliger Ohmgeldner, Schiffsleute und Küfer (1825 n. ö.). Unverfänglicher klingt die Bezeichnung als «Weintaster»: tâte-vin, Tắtwäng, 10 Taatewäng (Erl., Tw.).
431 Der «Politik der offenen Türe» huldigt schließlich doch einzig, wer zwecks verschiedener Manipulationen zum Dü̦ü̦rli ịịne schlụ̈ft oder mit der Hand ganz ịịne langet (Erl.: reckt) oder auch nur zum Bergen und Herausholen eines Gegenstandes das Türchen um Handhöhe aufhebt: d’s Dü̦ü̦rli bricht.
Dieses Faßdü̦ü̦rli ist ganz un͜der am vortere Bode des (liegend gedachten) Fasses angebracht. Und zwar ist er aus dem Mittelstück desselben, dem deswegen auch Dü̦ü̦rlistück genannten Bodenteil konisch ụụseg’sa̦ggt. «Konisch» mäint hier: mit Säge-Schnittflächen, welche von außen nach innen schreeg ụụfe gerichtet sind, so daß ihre Fortsetzung schließlich ein aus dem Faß hervortretendes, dem Kegel (gr. kōnos) ähnliches Gebilde ergäbe. Dank dieser Schnittart vermacht das Dü̦ü̦rli soweit wasserdicht, als es nach dem ịịnesetze mit dem übrigen Faß eine Fläche darbietet. Es wird hierbei zunächst an der eisernen Strụụbe, deren Muetere zugleich als Handheebi dient, ergriffen und voorzooge. Dieses «vorzieh» wird aber auf das Faß übertragen: mi zieht d’s Lääger voor. 11 Bis aber d’s Düürli du̦sse gnue g (auswärts gezogen) ist, bedarf es noch der Sicherung gegen das z’rückrütsche. Drum legt sich an die Schraube waagrecht der hölzerne (durchlochte) Faßri̦i̦gel, welcher links und rechts über das Dü̦ü̦rli hinaus ragt und fest aa’zoge wird. Dieser Rịịgel ist zuweilen hübsch geschnitzt: er zeigt ein Ornament, wohl gar ein Föörneli, einen Drach u. dgl. ( S. 408.). Schließlich legt sich vor den Riegel die Schraubenmutter, welche zum Zweck des handlichen Anfassens und zugleich als Schutz der Schraube sich schlauchartig verlängert über die letztere legt. Sie wird mittelst des Ängländer: des englischen Schlüssels als Faßschlüssel fest aazoge. Auf der Innenseite ist die Schraube gesichert mittelst eines kleinen T-Eisens, das Chrụ̈tz geheißen. Über dieses legt sich, damit es nicht dem Wein en Abchu̦st gääb, eine hölzerne Querleiste: d’Brï̦gg (Tw.) oder d’s Brüggli (Erl.). Diese «Brücke» wird mit hölzernen Nägeln: Dü̦ble (vgl. den Du̦bel S. 414) ụụfd’dü̦̆blet, nachdem man die hierzu nötigen Löcher vorb’bohrt het. Eiserne Nägel würden den Wein in unangenehmster Weise schweerze.
Selbst alle diese Sicherungen würden indes für sich allein das ri̦nne, rü̦nne des gefüllten Fasses nicht verhüten. Das Türchen muß verstriche werden mit dem Tü̦̆ü̦̆rlistri̦i̦ch. Dieser Tï̦ï̦rlistri̦i̦ch ist eine sälber g’machti oder g’chạufti Mischung aus Unschlitt ( ụ̆́schschlĭ̦g), gäälem Wachs und Tannehaarz. Er erinnert mit seinem Abstu̦ch von appetitlichem Kochfett den Twanner und Erlacher 432 an ungenießbar harten Magerkäse, welcher in seltsamer Umdeutung des vor allen Türen musizierenden Bettlers der Tï̦ï̦rligịịger geheißen wird. 12
Noch ist der — bisweilen zierlich geschnitzten — Querleiste zu gedenken, die als Trắwäärße oder Spaale sich waagrecht über die ganze Mitte des Faßbodens legt. Ihre Hauptfunktion ist der Gegendruck gegen das ụụsechoo des Bodens bei allfällig unrichtiger Sänkung ( S. 412), welche dem Druck der Weinlast nicht Stand hielte. Augenfälliger ist ihre Chu̦mmligi für n es Liecht oder es Glas drụf z’stelle.
1
Vgl.
clavus und
clavis bei
Walde und
claudere (167 f.), und das Verhalten von
clou und
clef bei
Gilléron (N’stadt, 1905).
2
Zu
pugil (Boxer):
Walde 621.
3
Doppelformen wie
Bunte = Spunte erinnern an
läcke und
schläcke, Chuchimutz und (emmental.) -schmutz,
Mützer und
Schmützer, Nägg (Simmental) und
Schnägg, riiße und
schriiße, an
brööd und spröde, an Rumpf,
rumpfe, rümpfe und schrumpfen, an l.
pictus (bunt) und Specht, an gr.
typhos (Qualm) und ml.
stuba, Stube als urspr. Schwitzbadraum (
Kluge 449) usw. Das zugehörige
ex-tufare (étouffer, vgl.
étuve) legt Sachverwandtschaft dieses beweglichen
s = s̆ (Fick 78) mit «
ex» und «aus» nahe. Vgl. das s-prechen als ein «aus-brechen» des nicht mehr «im Busen zu bewahrenden» Seeleninhalts.
4
Kluge 437;
mhd. Wb. 2, 1, 544. 2, 2, 554;
Graff 6, 362; Grimm Wb. 7, 2244;
schwz. Id. 4, 1399 ff.
5
Gign. 46.
6
Der Schnaarz: oberes oder vorderes Ende eines Gegenstandes, Orts, Berges usw. Näheres in «
Aarwangen».
7
Kluge 369.
8
Schellenberg 110; vgl.
schwz. Id. 8, 64.
9
Laß etwas guets zum züglin user! («ausher» = heraus, uuse) ruft in Rudolf Manuels Weinspiel (202) dem Wirt sein Gast Heini Fresenrotzig zu.
10
Lg. 163.
11
Wieder eine der Objektverschiebungen
12
So heißt anderwärts auch schlechter Wein (
Schwz. Id. 2, 153.)
Der genügend häll oder lụtter gewordene Wein wird also (aus dem Faß) abzoge ( S. 428 ff.) bis auf die Hefe: d’Truese (Ins, Erl.) d’Trueße, Drueße (Tw.). Ein auf die Neige gehender Weinvorrat ist, wie ein in Geldknappheit geratener Mensch, u̦f der Drueße.
Einem dem Lebensende nahen Menschen isch der Wịị o bal d u̦f der Drueße. So singt von sich in tief empfundenen Versen Der alt Räbmḁ unseres Erlachers Robert Scheurer:
Der Wii isch uf der Drueße,
I g’spüüre’s all Daag meh.
Chuum mäü di drüeben Auge
Der Stärn im Glas no g’seh.
Die g’rumpfte Zatterfinger
Mäü
d’Haue ni-mme b’ha.
Un wott i
Halschorbb drooge,
Chunnt d’Chnäü e Schwechi aa.
O d’s
stickle duet mi
müeke:
Der
Bickel wird mer z’schwär;
Un ersch bi’im
Säärmele schniide
Chunnt d’Hand fasch ni-mme z’Chehr.
D’Rangscheie häi käis höre,
Z’bräit schiint mer jede Joon.
Winn ’s no no’m schaffe giengi,
I hätt, wäiß Gott, käi Lohn.
Der Wii isch uf der Drueße,
I g’spüüre’s all Daag meh.
’s wird Zit, daß i bal äinisch
Der
ober Räbbärg g’seh.
Das weinleere Faß ist auch dieser Hefe (Hefen) zu entledigen. Der Küfer naht, duet d’s Faß ụụf, indem er d’s Dü̦ü̦rli bricht ( S. 431) und schließlich ụụse zieht.
Zunächst loot mḁ die wohl fußhohe Hefenschicht i d’Bränte lạuffe. Der Räste wird mit der Trueßechru̦cke, deren Handhebi ein der Faßrü̦ndi angepaßtes Schabholz trägt, herausgeholt und mittelst des Drueßedrachter in den Drueßeboller geschafft. Ganz zuletzt kommt der mit Trüebwịị gefüllte Schwänkchü̦ü̦bel dran; mit ihm wird na̦a̦cheg’schwänkt (nachgespült).
433 Nun greift der Küfer zum Schlu̦pfbrätt, das ihm die Eermel und nötigenfalls das ganze Gewand gegen die gröbsti Verunreinigung schützt. Denn bei großen Lagerfässern heißt es zum raanße der Arbeiter: Chaast dụ das Lääger schlụ̈̆ffe? 1 (Erl.: schlịffe.) Kannst du in dasselbe hineinschlüpfen?

Albert Krebs,
Rebbesitzer, Wingreis
Die Hefe enthält als wertvolle Rückstände Fette, welche von der Kriegschemie in Deutschland zur Behebung der Ernährungsnot ụụsg’nutzet worden sind, und unvergornen Zucker. Dieser wird nach einiger Lagerung zu Trueße als Drusenbranntwein b’brönnt.
Läär aber sollten Lagerfässer nie sein, sondern gä ng wịịgrüen (grüen iSv. « Ins» 49). Denn der Wịịgäist erhaltet d’s Faß. Auch verlangt das Holz desselben, welches ja gäng sụ̈ụ̈ferli schlü̦ckt und demgemäß schwäißt (Erl.: schwi̦tzt) oder ri̦i̦set (Tröpf loot falle, S. 239), von Zeit zu Zeit Nachguß von Fü̦llwịị mittelst des Fü̦llrohr ( S. 418). Leere Fässer, die nicht bald gefüllt werden können, müssen wiederholt ịịb’brönnt werden: e Monḁt na̦’m erste Ma̦l wieder, u de nn gäng all drei Monḁt.
1
Gleichsam es «schlüpfend behandeln», es «beschlüpfen». Vgl. z. B. Note 11,
S. 431.
Während der Reihen guter Weinjahre ( S. 248) blühte auch den Seeländer Wịịbụụre ihr Weizen. Vorab kamen die ohni Räbe wirtschaftenden Bụụre und Bụ̈ụ̈rli aus dem weitern Seeland und dessen Umgebung, um ung’määrtet und gleich i silberige Fụ̈ụ̈flịịber (Fünffrankenstücken) bar bezahlend den liechte und demnach billigen, 434 gleichwohl aber gehaltvollen Wein für Heuete, Sichlete, Fleglete, Neuja̦hrete gleich vom Trüel e̥wägg oder bei den großen Frühlingsabzügen vom Lääger e̥wägg zu kaufen ( S. 404). Alljährliche Abnehmer aber aus allen Teilen des mit der Aareschiffahrt unschwer zu bedienenden Oberaargaus bestellten jeweils rechtzeitig wi letz̆lich g’haa («wie gehabt»). Ein Herbstwäidlig us em Oberland (1829) kam ins Seeland, den Ausfall des eigenen Landesteils zu decken. Andern Ku̦ndine n (Kunden) aus weiterer Ferne kamen große Weinproduzenten wie z. B. die Klosterschaffner ( S. 198 f.) aus Ligerz und Twann mit große Herbstschiffe nach Lattrige oder Gerlafingen ( S. 114) entgegen. Das war in den Zeiten der Oktoberstürme (wie z. B. 1779) ein außerordentlich schwieriges und zeitraubendes Geschäft. Im Choorn- und Läntihŭụs Lattrigen ließ die Obrigkeit den ihr zukommenden Wein durch einen Inspäkter in Empfang nehmen und befördern. 1 Bei der Fuhr nach Bern durfte nicht in Gümminen, sondern mußte z’Allelüfte übernachtet werden, 2 um den Unsicherheiten des Verkehrs auszuweichen.

Grossrat
Max Engel-Hubacher
Klein-Twann
Nächtlichen Heimfahrten gingen ostseeländische Waadtlandfahrer aus andern Gründen aus dem Wege. Großi Pụụrewi̦i̦rte (bäuerliche Wirte) altbernischen Schlags, wo’s g’ha häi, riefen ihren Söhnen, welche erstmals die mehrtägige Reise mit Roß und Wagen unternahmen, zu: Daß me̥r nid d’Schan͜d anne machisch u z’Nacht hei chömist! Am heiterhälle Daag mußten die flotten Gefährte und Gefährten das heimische Dorf durchwandern, durch chlepfe mit der Gäißle die Gaffer rechts und links ans Fenster lockend. Z’Arbäärg aber wurden mit Hilfe wohlgespickter Beutel d’Nächt dụụreg’jụheiet. Dem bbrochne ( S. 431) Landfaßtü̦ü̦rli enthob man, nebst den Seckli voll Fụ̈ụ̈flịịber, g’salznigs Rindfläisch und Laffli als Wịịsụụger.
Die gegen fremde Konkurrenz ( S. 214) mächtig geschützten bernischen Wịịbụụre und die durch Weinreisende ( «Wịịhängste») mit ihrer 435 Kundschaft im Verkehr stehenden Wiihändler mußten sich aber einer strengen Kontrolle über Unverfältschheit und richtigs Määs unterwerfen. Der Spott: «Das isch starche Wịị, er trịbt d’s Määs ụụfe!» (Die Füllung erreicht das Meßzeichen nicht) durfte keinen Grund und Anlaß finden. Die Kontrolle galt allerdings in erster Linie dem obrigkeitlichen Zehnte (Tw.) Zehnn te (Ins) oder Zähntel (Tw.). Da ging mit seinem Visierstab: mit der Beile, 3 der Ambeiler (Erl.), der Ambäiler, gekürzt: der Beiler — und im Geschlechtsnamen auf den Imker umgedeutet: der Beyeler von Wahlern und Rüschegg, der Byeller (um 1700), Pyeller (1493), Pyeler (1571), der Hennsli Breyeler (1484) 4 — von Weinberg zu Weinberg. Da mußte er zuhanden des Zehnten d’Züber verglịịche ( S. 385) und nötigenfalls auch zäichne. So laut Erlassen wie vom 20. August 1669. Die Zehndpächter von Buchsi, Sant Jhánns, Eerlḁch und Bippschól hatten vielerlei geferd (Trug), geschwindigkeit 5 (Kniffe) und vortheil ( Vöörtel, vgl. vöörtele) erfahren. Drum mußten «hinführe» die züber, deren die bernischen Untertanen «sich gebrauchen», «gleichlich» auf 55 mas «gerandet» oder «gesinnet» sein.

Frau
Clara Engel-Hubacher
Klein-Twann
In den drei Ausdrücken glịịchlig, «gerandet» und g’si̦nnet erkennen wir zwei auf den Handel und ein auf die Alpwirtschaft 6 angewandtes Wort auch der Gegenwart. «Gleich» ist l. aequus, «gleich machen, ụụsglịịche» ist aequare, ahd. îkon, mhd. îchen, eiche, 7 alttwannerisch aber eichte; är het g’eichtet. Ein Eichmeister oder Eicher besorgt solche Eichi: solches «Ausgleichen», glịịchlig mache der Maße und Gewichte in jedem der 1912 geschaffenen endlif bernischen Eichkräise (z. B. Seeland) an seiner Eichstätte (z. B. in Biel).
436 Dabei erhalten die im Handel gebrauchten Gefäße augenfällige Maßzeichen (die hölzernen z. B. Negeli, Negel, S. 386). Sie werden mit Zäiche versehen: ’zäichnet. Solches zäichne heißt l. signare, frz. signer, si̦nne, sinniere (Tw. 1796). Die Si̦nni (1687), Sinn oder Sinnierung (1827) wird durch den Sinner angebracht auf dem zehnlitrigen Sinnchü̦ü̦bel und den Chü̦bli — sogar die Schwänkchü̦ü̦beli — älterer Zeit (z. B. 1824), auf den Bränte, auf den Gelte, auf den Land- (1827) und Wi̦i̦rtsfesser (1711). Er stellt hierfür seine Sinnzedel (1827) aus und trägt sie im Sinnrodel (1784) ein. Auch Landstädte wie Aarberg stellten bereits 1537 einen Sinner an. Es gab also, wie eine Berner-, auch eine Aarbärger-, eine Bieler- usw. Si̦nnig oder Sinni oder Sinne n, G’si̦nne, d’-Sí̦nne = Zi̦nne (altseeländisch), durch den Zinner, welcher zinnet (basl.: sinnet, er het g’sinnt), vollzogen mittelst der Wasser- oder der Stabsinni.
Dem Basler ist aber der amtlich geprüfte Liter auch «e g’fochtene r Liter»; er ist «g’fochte»; es wurde an ihm das «fächte» vollzogen: das Anbringen der «Facht». 8 Im Bernischen erlitt dieses «fächte» 9 eine Umstellung 10 zu «fätche», «fägche», fäcke und wurde 11 zu fecke. Solches fecke 12 übt der Fecker, Faßfecken als die Fecki alle fünf Jahre neu.
Die Handhabung dieser Maße ist Sache weitgehenden Vertrauens. So der Bränte. Wenn mit ihr der Chüeffer mißt, so tarf mḁn ĭhm nie i d’Bränte luege.

Marguerit Engel
in Klein-Twann
Das Vertrauen rechtfertigt sich auch schon durch die heutige schweizerische Maßeinheit. Welche Unstimmigkeiten erzeugte die frühere Ungleichheit! So entstand 1744 und 1750 zwischen der Stadt Erlach und der Landschaft Ins, 1710 zwischen jener und der Landschaft Gals Zwist wegen des Brü̦gg(zoll)määs und des Bru̦nnmääs (für Wasserzuteilung aus öffentlichen Quellen an die Berechtigten). Am meisten litten freilich die Wịịzäichnige (1760 u. ö.) durch die ihre Funktion als Ehrenamt 13 ausübenden Wịịschetzer (1716 u. ö.), diese Vorgänger unserer Sinner und Fecker, unter der Ungleichheit der Hohlmaße. Waren die doch selbst in unserm kleinen Seeland recht verschieden. 437 Es kamen im Jahr 1846 auf 100 (seit 1838 bestehende) Schweizermaß 89,55 Bernmaß oder 103½ Bielmaß (also 100 Bielmaß auf 107,89 Schweizermaß), wie 1787 auf 320 Bernmaß 358 Bielmaß. Diese Bielmaß (1498: mesure de Bienne) neben welcher aber z. B. 1377 auch die Maß von Landeron und z. B. 30 Mütt weißen Weins des Maßes von Landeron 14 anerkannt waren, galt in der Regel (z. B. 1779) auch zu Twann, was aber nicht hinderte, daß gelegentlich eine Twann- oder Twanner-Mooß zur Anwendung kam. So galt am 21. November 1787 die Twanner-Maß vierjährigen Weins 13½, die Bielmaß dagegen am 21. Dezember desselben Jahres bloß 13 Kreuzer. Stolz sprach Twann auch 1779 von der «hiesigen Maß». Von der eigenen alten Herrschaft her schreibt sich auch das Ligerz-Määs von 1390. Älter noch ist die Neuestadter Wiimooß (1310), und vor ihr bestand z. B. 1284 die mensura de Neuren ( Nugerol, s. u.). Etwas größer als die Bieler- war die bereits 1372 erwähnte Erlach Mooß und das Erlach-Määs. Jene faßte 1,89846 Liter, so daß 65 alti Erlachmooß 66 Schweizermaß des Jahres 1850 ausmachten. 15 Das war etwas mehr wie die 90 Liter, auf welche 1877 — nach Einführung des Metersystems (1875) — die im Privatgebrauch noch heute üblichen Züber normiert wurden. 1882 wurden dieselben fakultativ und erst 1900 — damit nicht allzuviele der teuren Geräte abg’schetzt werden müssen — für den Handel obligatorisch auf 100 Liter erhöht. So auch wurden 438 die Bränte auf 40 l, die Gelte auf 15, das Most- oder ehemalige Zehntechü̦ü̦beli auf 10, das Schwänkchü̦ü̦beli auf 2 l normiert.
Auch ein Nidaumääs bestand natürlich. Wie dieses, mußte das Erlachmäß als originales Schla̦a̦fmääs 16 im landvögtlichen Archiv ruhen oder «schlafen», während seine Kopien oder Doppel dem öffentlichen Gebrauch zur Verfügung standen. (Ähnlich enthält das Schlafbuech die beglaubigten und daher mit den Originalien gleichwertigen Rechtsurkunden eines Orts oder Bezirks.)
1
NBS. 103 (1783).
2
Lüthi, Gümmenen 23.
3
Zu l.
pa-n-gĕre (festmachen) gehört auch die
pag-ella: der im Wasser aufgepflanzte Höhenmesser als
Pegel, sowie — über pv.
pagela als Weinmaß (
M-L. 6144) — das Flüssigkeits- und Flächenmaß: die
Beile.
4
Schwz. Id. 4, 1161-6;
Mül. 4, 242.
5
Kluge 170.
6
Vgl. die «Randung Alp» im Oberhasli. (
Schwz. Id. 6, 1024.)
7
Kluge 107; vgl.
M-L. Wb. 239;
ZfrPh. 38. 11.
8
Diese Facht ist eine durch die Lautverschiebung gegangene, also ältere «Pacht» gleich dem neuen «Pakt». Das sind Lehnformen aus l.
pactum («fest gemacht») zu
pac-iscor und damit auch wieder aus
pa-n-gĕre (fest machen).
Walde 551. 558;
schwz. Id. 1, 660. 726.
9
Ganz verschieden von dem mit l.
pugnare verwandten (noch durch «fuchteln» hieran erinnernden) «fechten»; vgl.
Kluge 129.
10
Etwa wie Bottich über Bottchi zu Bocki und Bocke.
11
Wegen des Anscheins eines Faktitivs etwa wie schrẹcken aus altem schrëcken
12
Als probieren:
Gw. 665.
13
Kasser,
Aarwangen 173.
14
Taschb. 1903. 140 f. Wie der l.
modius als Scheffel, ist auch der ahd.
mutti und das oder der mhd.
mutte, mŭtte, der Mütt, zunächst ein Getreide-, überhaupt ein Trockenmaß. Wie es aber mhd. auch einen
öl-mütte gab (
Wb. 2, 1. 280), so 1523 und 1571 laut d. eidg. Abschiede (
schwz. Id. 4, 574) und also bereits 1377 zu Landeron den
Mütt Wein. (Über den alten Getreide
-Mütt zu 12
Määs neben dem
Malter zu 10 Määs s. «
Oberaargau».
15
Schon 1383 gab es auch ein
Erlach Määs. Ihr genaues Volumen nach Scheurers Arbeit
S. 252 hiervor.
16
Schlaffb. 1, 303. 206.

Frau
Martha Jäger-Engel
in Klein-Twann
Wie nun heute der Lịter als Trocken- und als Flüssigkeitsmaß den alten Viertel und das alte Sester 1 erneuert, so spiegeln die Mooß und das Määs mhd. «die» máßa (mâße) und «das» (spätere) mâß in deren ursprünglich gleichem Sinn des Gemessenen. «Über die Mas und Zeit» saßen 1658 und 1683 Inser im Wirtshaus, und noch 1783 ist das Maß = die Maß. 2 Hier aber ist, wie z’Oorte nwịịs schon im 15. Jahrhundert, 3 an ein bestimmtes Flüssigkeitsquantum gedacht. Diese Mooß wurde 1848 allgemein schweizerisch auf 1,5 dm³ festgesetzt, 1877 aber in amtlicher Geltung durch den Liter (s. u.) ersetzt.
Hundert Mooß waren e Sạum: eine Saumtierlast (1444 in Nv. une chevallée). 4 Noch heute spricht man vom neue Sạum (150 l = 1,5 hl oder Hekto) im Gegensatze zum alte Saum, dessen Quantum entsprechend den verschiedenen Maß ( S. 437) schwankte, jedenfalls aber größer war, als das des neuen. Für Twann gilt die Gleichung: 100 alti Mooß u Säum = 111 neui. Drum die scharfe Instruktion 439 eines Weinhändlers noch vor wenig Jahrzehnten an seinen Sohn: Was dieses Faß birgt, das sị de nn ált Säüm!
Ursprünglich eine Schöpfkelle voll Bier war im 14. Jahrhundert die schoffe, schufe, welche in der Schueffe und dem Schueffli z. B. des Schiffers ( S. 22) wiederklingen. 5 Das zugrunde liegende «schöpf-en» führt über zu der mittelniederdeutschen schope, 6 welche sowohl als «die Schoppen» z. B, von 1789, wir als frz. la chope und une chopine = es Bier entlehnt wurde. Wir sagen nun der Schoppe n, wie der Zapfe n, der Rüggen usw. La chopine und chopinette aber geben wir mit «das» Schöppli und Schöppeli wieder:
Manndeli, Fraueli Hochzit haa,
Chumm, mier wäi [alli Jahr]
es Schöppeli haa.

Frau
Clara Mürset-Engel
in Twann
E Schoppe näh, es Schöppli haa war sonst das Sonntagnachmittagsvergnügen, welches der die ganze Woche über seinem Berufe lebende bäuerliche Mann sich gönnte, während sein dreifaches Quantum: d’Mooß, ja auch nur deren Hälfte: e Halbi erst von einer größern Gesellschaft b’stellt wurde. Der Liter des Metersystems degradierte den Schoppen und sein doppeltes Quantum: die Fläsche (s. u.) zum bloß noch stillschweigend geduldeten Maß und Behälter verschlossener besserer Weine für nöbleri Gastig, deren Einer z. B. es Schöppli roote Dwanner, e Fläsche Fü̦fzää chner aufmarschieren läßt.
Das kleinste Wirtshausmaß war e halbe Schoppe, es halbs Schöppli. Grade damit kann freilich der Hálbschöppler, wenn er den Pintechehr (s. u.) macht, der gröößt Süffel werden, der sich einen frühen Tod oder langes Siechtum antrinkt. Wie dann erst einer, der in den gewohnten Pinten schöppelet? 7 Er ist also keineswegs solider als jener Berüchtigte, welcher den Schwänkchüübel der spitz Wääg (an einer der schmal ovalen Seiten) oder den unten mit einem Härdöpfel gestopften Trachter a d’s Mụụl g’setzt het.
440 Es war dies «d’s schwarz Glas» (s. u.) gegenüber dem wirklichen Glas, das etwa noch heute am Platz eines 2 dl Fläschchens voll Wein b’stellt wird, doch es Fụ̈ụ̈ferli (5 Rappen) min͜der kostet. Es ist ein Fueßglas ähnlich dem Gaffịglas. Für Verabreichung von Wein auf dem Arbeitsplatz füllt man in der weiter unten vorgelegten Häufigkeit das 1/ 10 bis 1/ 14 l haltende Strịchglas = z’Im bbißglas (Erl.) (mit Gräätline: schmalen Schliffflächen zwischen Boden und halber Höhe). Auch das Chällerglas ist von nämlicher Größe.
Z’früechere Zịte verlangten Gäste einen Meiel Bier. Dieser (fußlose) Meiel oder das Meieli 8 dient noch als Mäß für 1/ 8 Määß Sa̦a̦mzi̦bele (Steckzwiebeln).
Das schwarz Glas gehörte übrigens zu der schwarze Mooß und schwarze Fläsche (7½ dl), neben welche erst 1852 schweizerisches wĭßes G’schi̦i̦r trat. Jenes schwarze G’schi̦i̦r zeigte mit einem B die bernische Hoheit an.
War e Halbi = e halbi Mooß, so ist nunmehr e Halbe r der halbe Liter 9 oder der Fụ̈ụ̈fer (Tü., Vg.: Feufer). An diesen schließen sich in der Wortform der Dreier, der Zwäier und das Äinerli. Letzteres ist das baslerische Stämpfeli, das inserische und neutwannerische Rŏ́ggịịnli, das ältertwannerische Rŏ́ggịịli, das tessenbergische roquil, das sonst unterbernische Rŏ́ggụ̈̆li, Rŏ́gge̥li, aus frz. roquille. 10 Es heißt auch das Baggeli. (Tw. 11 )
Zur Zeit, als mit dem metrischen System der Liter seine gesetzliche Geltung erlangte, reizte sein Name die Twanner zu einem phonetischen Späßchen. Ihr Si̦ge̥rist hieß nämlich nach seiner Hauptfunktion der Lị̈ter; muß er doch täglich einmal und sonntäglich mehrmals die Kirchenglocken in Schwung setzen: läuten, lị̈te. Der dennzuma̦a̦lig alt Sigrist, namens Jakob Engel, war der Lị̈ter-(ị)Joggi. Diesem sehr soliden und geschätzten, etwas würdehaft sich gehabenden Mann klang nun allemal, wenn er etwa ein Wirtshaus betrat, der Spaß entgegen: Du bisch abg’setzt u nị̈t meh wäärt. Mier häi jetz en an͜dere Lịter und du bisch bloß no der Halblịter, oder wăs wäiß i, waas!
In der mundartlichen «Literatur» bedeutet der Liter auch die Liter-Flasche oder Fläsche (s̆s̆), wie die durch s̆s̆ velarisierte Mundartform 441 (vgl. wäsche, Täsche, Äsche usw.) lautet. Die gut germanische flasca oder das flascum 12 wurde romanisch entlehnt: afrz. la flasche, it. la fiasca usw., um als it. il fiasco (Rückbildung aus fiascone, flacon) in der Redensart «Fiasco machen» (das Schicksal einer Glasflasche haben) rückentlehnt zu werden. Wir denken dabei vorzugsweise an die gleesigi (gläserne) grüeni Fläsche im doppelten Gegensatze zum (glasartigen) glaasige Kunstgebilde (z. B. dem glaasigen Auge als Ersatz des natürlichen), sowie zur kristallhellen und wohl auch durch Sandgebläse künstlerisch geschmückten Chindbetti- u. dgl. Fläsche. Der Form nach unterscheidet man an der grünen (unrein gläsernen) Flasche die flûtes oder Länghälsler (Rheinwein- und Walliserflaschen) von der normalhalsigen. 13 Ferner unterscheidet sich die flachbödigi oder Flachbode-Fläsche, die (gleich dem Rundlöffel und andern Ersätzen des erst neuen Glettịịse) vormals zum Bügeln der Wäsche diente, 14 von der ehemaligen bauchigen Schlegelfläsche (7½ dl haltend), sowie von der hohlbödige oder Hohlbode-Fläsche, welche wegen des heraufragenden Gụpf schwär z’butzen ist. Durch besondere Sterchi zeichnet sich die Schampánierfläsche aus. Eine bei Ligerz gefundene Steingutflasche aus dem 17. Jhd. 15 leitet über zu der ganz anders gebauten Lederflasche alter Zeit und zu der metallenen Bettfläsche (Wärmeflasche), deren Herstellung Sache des Flaschners (Klempners), des Spänglers ist. Jenes Dienstmädchen, welches auf den Befehl der Meisterin, dem Eheherrn e Fläsche i d’s Bett z’tue, fragte: e rooti oder e wị̆ßi? konnte unter Umständen sehr wohl unter dem Mäntelchen der Einfalt ein bißchen Schalkheit verstecken; zumal wenn 442 es auch bereits wußte, was e läbigi Bettfläsche bedeutet. — Ähnlich vermittelt ein Fläschli aus Rubinglas mit silberfarbenem Ornament 16 den Übergang von der auf 2/ 3 l geeichten Fläsche der alten Gastwirtschaft zur halbmäßige Fläsche (1788), zum Viertelfläschli (1789) und zu den flachgedrückten Fläschchen mancher Art, die sich bequem in der Busentasche ( Schiebtäsche) bergen lassen oder aber dem standesbewußten Wehrmann, Touristen, Jäger als Ordonnanzwaffe an der der Rechten nächsten Leibesseite bammeln. So die Fäldfläsche oder das Fäldfläschli, in neuster spassiger Soldatensprache 17 der Wehrmannskaländer geheißen. So die als Regimäntsuhr bezeichnete Wäntele, die aber nur der mit Schnapps g’füllt bei sich finden läßt, dem es nụ̈ụ̈t macht, i d’Chi̦ste z’flụ̈ụ̈ge (im Polizeizimmer oder Loch Arrest abzusitzen).

Peter Schumann
in Twann
der alt Peter
Das Grindelwaldner Dorfgu̦tterli 18 ist eine Spezialität des unterbernischen Gü̦tterli, der bis achtmäßige Essig-Guttere (1794) oder des Gụtter (Lg.). Der Gü̦tterli (oder Gü̦tterler) im spezisisch seeländischen Sinn des G’frü̦ü̦rlig ist allgemeiner der wehleidige Mensch, der immer zum Gü̦tterler als dem Wasserdokter läuft. Sowohl den Urin als das Heilmittel faßt das ursprünglich blasenartige Gefäß, das eben nach dem Chropf (in romanischen Dialekten die guttura, frz. le goître, 19 aus l. guttur, Kehle) die Gụttere heißt. Den Weinschlauch ( S. 418) ersetzte die ihm ähnlich aus irgendwelchem Stoff gefertigte gr. buttis 20 zu sehr vielseitigem Gebrauch. Die Verkleinerung butticula 21 wurde la bouteille, die alttwannerische Bụ́tele (1775), die 443 unterbernische Podä́lle, die Bụ̆́tälle (Tw.). ( Bringet no ’ne Bụ̆tälle!) Der « la botte» übersetzende Stịfel diente gleich wie Stotze, Stumpe. Stein um 1548 22 als Ersatz des Bechers; ebenso die Kanne, d’Channe, deren Grundform «Chante» ( Ins 1667, wie das käntly, Tw. 1678, heute Chännli) aus den l. cantharus, den gr. kántharos (Humpen) zurückgeht.

Witwe
Krebs-Brand, Twann
«Bärenwirtin», 86 jährig
Ähnlich lautet der cantherius 23 (Sparrwerk mancher Art): der Ganter des 16. Jhd. als Kellerlager und Bierfässergestell, das östlich seeländische und unterbernische Gänterli. Ihn ersetzt heute im Seeland der Fläscheschaft oder aber der Standort für Fläschechöörb, g’flochteni Fläsche und Gu̦ttere (früher bis 12 Maß haltend, für Schiffsladungen), für Flaschenhülsen, Fläschebutz- und Fläschefüllmaschine, für Bŏ́mboone und Bŏ́mbŏneli (an die Form der Bombe, bombe erinnernd) usw.
1
In Ga. 1238
Sexter: zu
sextarius. Das war 1. der «Sechstel» des
congius (
Goon,
S. 419) oder ½ Quart, sowie 2. des
modius (
Mütt). Später wurde er dessen
Viertel.
2
Meiners 1, 202.
3
Schwz. Id. 4, 438.
4
Der strotzend volle (vgl.
Prellw. 403. 406) Packsattel heißt gr. das
ságma, vulgär l. das
sauma; die darauf gesattelte Last ist frz.
la somme, altdtsch. der
soum. Vgl. Dr. Fritz Staubs Vorarbeit zum
schwz. Id.
5
Schwz. Id. 8, 393 ff.
6
Seil. 4, 439.
7
JG, Geld und Geist 3, 121.
8
Das ml.
miolum, lombard.
miolo, mhd.
miol, Mijel. (
Schwz. Id. 4, 137;
Lf. 317.)
9
Gleichberechtigt mit amtlichem «das» Liter (wie «der» neben «das» Meter) aus frz.
«le» litre, welches selbst durch ml.
litra und gr.
litra (Pfund) aus unteritalisch-griechisch
lithra (neben
libra, livre) zurückgeht. (
Seil. 3, 261.) Neben die Bezeichnung von Maß und Gewicht tritt die der Münze als
libra (vgl.
Pfund und
pound),
livre, der
Füfliiber
10
Schwz. Id. 5, 774
11
Eb. 4, 1073 f.
12
Wenn nicht
hl-:
M-L. 3355; vgl.
Kluge 139.
13
Flaschenformen:
Schellenberg 130.
14
MB.
15
MB.
16
MB. Nr. 5227.
17
Vgl. die Sammlung von Dr. Hanns Bächtold.
18
Gw. 471.
19
M-L. Wb. 3930.
20
Ebd. 1427.
21
Ebd. 1496.
22
H. R. Manuels Weinspiel (s. u.)
23
M-L. Wd. 1615.
Das verrạuchne (verrüche) der Füllungen aller Art verhindern Dechchel oder Zäpfe. Statt der Strạuzäpfe kam im 15. Jhd. der Korkzapfen, Kork auf. Das holländische Wort Kork stammt aus dem span. corcho, und dies aus lat. cortex: Rinde — vgl. écorcher — nämlich der Korkeiche, Quercus suber.
Diese immergrüne Eiche gedeiht nämlich vorzugsweise in Katalonien und liefert jährlich bei einer Million Kilozentner des heute so kostbaren Stoffs, der allerdings sehr langsam wächst. Die harte, borkige Oberschicht: der «männliche» Kork, wird bloß zu Dekorations- u. dgl. zwecken abg’noo, und ebenso ihr Neuersatz, mit welchem man dem Baum während drei bis vier Jahren sich zu schützen Zeit läßt. Erst unter ihm legt er während etwa füfzäche Johr die etwa 6 cm dicke Johrring-Schicht 444 des «weiblichen» Korkes an, der feine wunderbaren Eigenschaften entfaltet: Er ist liecht (0,12 bis 0,195 sp. G.); elastisch, loot d’s Wasser gar nit du̦u̦r und Schall und Wärme nur schwer, ist auch geschmack- und geruchlos. 1
Korkeiche und Kork heißen gr. und byzantinisch «der» phellós. Aus panto-phellós («ganz Kork») fertigte man in Byzanz (Konstantinopel) Schuhsohlen, welche in Sache und Namen als la pantófola nach Italien, als la pantoufle nach Frankreich, und gegen Ende des 15. Jhd. als Pantoffel ins Deutsche kamen. 2 Wie aber «der Holzböde» uns den Schuh mit Holzsohle und Lederüberschuh bezeichnet, so ist uns der Pandóffel und d’s Pandö́ffeli der leichte, dünne Hausschuh, den vorzugsweise die Hausfrau trägt. Er versinnbildlicht darum (wie das Gloschli, der Unterrock) die Hausherrschaft der Frau, welcher der un͜der em Pantoffel sich duckende, der pantófflet Ehemann einen Teil oder das Ganze seiner Schöpfungsherrschaft zum Opfer bringt. 3 Auf diesem Umweg der «pantoffelholzernen Schuhsohlen» (Tw. 1788) kam zu uns der Korkzapfen als der «pantoffelholzerne Zapfen» (1788) oder Bandóffelzapfe. Auch dieser dient als Sinnbild: Ein charakterloser Mensch, der im Widerstreit belangreicher Grundsätze sich immer vom «Oberwasser» auf der das bequeme Fortkommen sichernden Lebenshöhe tragen läßt, ist e Bandóffelzapfe.
Wie ferner Fläschewịị, welcher beim lịgge von einem unreinen Zapfen aag’noo het, na̦’m Zapfe schmeckt, Zapfechụst het, vom Zapfe het, oder zäpfelet (Ins: zapfelet), was der Kenner 445 mit verzogener Miene feststellt, so bedeutet zäpfle, einen uuszäpfle 4 svw. ihn ausspotten.
Aus dem dreißigjährigen Krieg aber stammt der Zapfesträich oder Zapfenschlag. 5 Wallenstein soll als der erste durch Befehl des weithin hörbaren Streichs oder Schlags auf den Spund des angestochenen Fasses die Soldaten zum Aufbruch gemahnt haben. Hieraus ist das treffliche mititärische Musikstück geworden.
Zum Entkorken von Flaschen dient der Zapfeziejer oder Tị́rebụschung ( tire-bouchon). 6 Der welsche bouchon stimmt zu bouché als deutsch entlehntem bụschiert (Tw., Lg., s̆) oder anklingend an das bụ̈tschiere mit Bütschierwachs und dem Petschaft als verschließen: bụ̈tschiert (Tw.), bü̦tschiert. Man trinkt bei besondern Anlässen, z. B. zu einem Abschied oder zu einem Ereignis, das uns tääfel (munter) stimmt oder einfach, um für seine verzapfti Wịịshäit Hörer zu finden, e Fläsche Bụ̈tschierte oder Verzäpfte.
Ehemalige Zapfewi̦i̦rte häi bi’m Zapfe g’wi̦i̦rtet: nach der Zahl der verkauften Flaschen ihre Schankgebühren bezahlt oder auch ihren Gewinnanteil bezogen. Der betrug z. B. für den Batzewi̦i̦rt einen Batzen. Die heutige Batzewi̦i̦rti arbeitet überhaupt um ständigen Monatslohn.
Endlich sei um des Namens willen hier noch Theobald Weinzäpfli 7 erwähnt. Es ist der 1654 als Kandidat samt seinem boshaft verschụ̈ụ̈chte Roß von der Bernermünster-Plattform in die Matte hinunter gestürzte, aber mit einigen Knochenbrüchen davongekommene Berner Sprachlehrer und nachmalige Kerzerser Pfarrer (1665-1695). 8
1
OW.
2
Seil. 2, 213;
Kluge 340.
3
Vgl.
schwz. Id. 4, 1293. Das dort angeführte
Ringeli Ringeli Rose ist, wie weit herum, so auch in und um Biel verbreitet.
4
JG, Geld und Geist 3, 5.
5
Kluge 502.
6
Ein Korkzieher mit Silbergriff und Silberscheide aus dem 18. Jhd. im
MB. (Nr. 5206).
7
Vgl. auch Berner Geschlechtsnamen wie «die Ölezapfin» (aus ursprünglichen Spaßschelten nach Art der heutigen «Cerevis»).
8
Meiners 1, 169 f. Vgl. die Gedenktafel der Plattform. Freys Jungfer von Wattenwyl hat ihn als Jonathan Schilpin verewigt.
Noch vor zwei Jahrzehnten trugen Rebleute ihren z’I̦mbiß-Wịị im Chrueg oder Chrüegli mit. Damit er nicht als zerbrochener Krug anlange, versorgte man ihn im Chratte. Nun ist der Krug im Norddeutschen bis zur Bedeutung der Dorfschenke vorgedrungen — genau wie bei uns die Pịịnte (Ins), Pi̦nte (Ins), Bi̦nte (Tw.) und das Bi̦ntli. Eigentlich ist das die frz. pinte, die it. pinta, an welcher das l. pingere (peindre): das ụụfmoole des Weinmaßes vollzogen worden. Das ( bläächig) Gefäß konnte in der Folge auch andere und unkontrollierte Flüssigkeiten aufnehmen. So das Tụ̆́lung ( toulon) als die Milchbịnte, Wasser-, Betrólpinte, das Ölpi̦ntli. Als geeichtes Weingefäß aber diente es zum Ausschenken (1669 in Erl.: verschenken) 1 und fu̦rttrage n über d’Gaß von solchem Wein, welchen der Verkäufer sälber ’pflanzet und sälber ’trüelet hatte. Solcher Ausschank, wie bereits 1269 die Abtei St. Johannsen ihn übte, 2 war allerdings, wie überhaupt in bernischen Landen seit unbekannter Zeit jeglicher Handel mit geistigen Getränken, an eine obrigkeitliche Bewilligung gebunden. Diese war verzeichnet durch einen für jedermann lesbaren «offenen Brief»: literae patentes, «eine Patenten» oder «Padenten» (Tw. 1829), das Padä́nt (in Ins auch Pu̦dä́nt). Die berufsmäßigen Wịịhändler, zu denen als einzig standeswürdigen Genossen bekanntlich Patrizier mitgehörten, waren aber auch gegen solche Konkurrenz der Weinbauern, wie gegen die der Wirte (s. u.) weitgehend geschützt. Wie die Stadtberner Wirte ihren Weinbedarf nur in den noch heute so laufbare (gangbaren) Chäller der Stadt 3 decken durften, so genossen auch Keller der Landschaft, wie z. B. das caveau zu Bi̦ppschól (1837) ihre Privilegien.
Die Wịịbụụre aber durften, wie eine Erklärung vom 19. Dezember 1688 darlegt, äigets G’wächs in ihrne Hụ̈ụ̈ser verchauffe, aber i mene Dorf gäng nu̦men äine n im Chehr um. Daß z. B. auch der Pfarrer zu Erlach in diesen Chehr eintreten und den Ertrag seiner Reben verwi̦i̦rte n durfte, wie bis zum Verbot von 1687 die Amtleute und die Pfarrer überhaupt, besagen noch heute zwei stumme Zeugen an der Pfarrhaustür. Rechts hängt das Fueter heraus, in welches das zur gäistige Erquickung einladende Fähnli gesteckt wurde, links deutet ein Eisenring auf das aabin͜de des Tannli als aufgepflanzten Zeichens für erteiltes Ausschankrecht. 4 Auch der vermauerte, einst eigene Aus- und Eingang, sowie die vergitterten Fenster 447 der nunmehrigen Bụ̈rozimmer sprechen von Übung des Schankrechts. Das Recht erfuhr jedoch immer größere Einschränkungen. Zunächst allerdings zugunsten der chlịịnne Bụụrli. So wurden 1740 ihrere 14 aus Mett, die bloß Räbli von 1½ bis 8 Mannwerk besaßen, angewiesen, ihren Wein gemeinsam z’vertrüele und «by der Pinten zu verdebitieren». 5 Eine Verordnung vom 21. September 1804 schränkte aber das Ausschankrecht auf die Kirchgemeinde ein. Am 8. März wurde u̦f di dritti Rappe vo der Moß Ohmgält ( S. 214) gelegt. Anno 1809 beschränkte die Regierung den Ausschank z’Bintewịịs auf die Zeit vom Läset-Aafang bis z’Silvester. 6 1811 ward die Frist auf sächs Wuche verkürzt. 7 Endlich kam 1833 das Wirtschaftsgesetz, welches allen solchen Ausschank dahin und dawägg verbot. Die Landschaft Ins opponierte höflich, wiewohl vergäbe, gegen solche Auslieferung des Rebmanns an den Weinhändler. 8

Lina Roth
in Twann
Wirtin und Sängerin
In Wahrheit handelte es sich denn doch um die Beseitigung fürchterlicher Mißbräuche. Wurde doch ganze Nächte durch gezecht, und wurden Weinverkäufer, welche Speis und Trank verweigerten, durch Beschädigung der Zụ̈ụ̈n und allerlei Schabernack geplagt. 9 Im Haus einer Inser Wi̦ttfrau, die Böbeler genannt, haben «Bacchusgesellen» e ganze Sụnntig dü̦ü̦r bis z’Mitternacht getrunken, dann der Eignerin es füfz’gmooßigs Feßli abg’chạuft, uf ene Trog gestellt und fu̦rt g’soffe bis no der Määntigpredig. Bußen von einem Pfund bis zu einem Gulden waren die Folge. 10
Fortan war also alles Pintenschenkrecht oder Pintenrecht (Ga. 1799) mit dem Besitz eines Pintenschenkhauses, einer Pintenschenke (1797), 11 noch kürzer: einer Pịnte verknüpft. Ein solches Pintenschenkhaus war z. B. das Bad Oberworben (1783). Das «Pintenschenk»- und damit 448 verbundene Backrecht in Feisterhénne wollte 1797 ein dortiger Bürger als wohlbestallter «Pintenschenk» erwerben. Dies wurde ihm freilich 1797 ebenso verweigert, wie im Jahr zuvor einem andern Bewerber (Joh. Probst), der zum «Bindtenschenkrechten» noch ein «Better-Rechten» (also Herbergsrecht) hatte üben wollen. 12 Die Landschaft Ins hatte hiergegen opponiert, wie sie 1820 auch zwei neue Pintenschenkrechte in Ins selber bekämpfte. 13
Kein Wunder: Die Landschaft Ins übte in ihrem Ra̦a̦thụụs zu Ins selber eine Wirtschaft (s. u.), die sie nach Gefallen mit einem angestellten Wirt betrieb. Berief sie sich doch auf ein von 1558 datiertes Vidimus, daß Ein Wihrt auf daß Raht- oder Landhauß zu Innß Ohne Eines Jewesenden Herrn Landvogts befragen noch Bysein bestellt werden möge. 14 Noch 1871 waltete der Rathauswirt Peter auch im Twanner Ra̦a̦thụụs (der heutigen Metzgerei Engel) als Angestellter der Gemeinde, welche zudem bis 1879 noch den «Räbstock» besaß, wie Ligerz das 1835 vom Berner Ratsherr Fischer erworbene wị̆ß Chrụ̈tz. Gleicherweise betrieb die Stadtgemeinde Erlach noch 1786 ihre zwei Wirtschaften zum Bäre (s. u.) und zur Erle, welch letztere ursprünglich mit zum Rathaus gehörte und erst am 12. November 1742 in die damalige Vorstadt, das heutige hübsche Un͜derstedtli verlegt wurde und 2 H Tavernenzins entrichtete. Die Gemeinde Siselen durfte 1831 zum Behelf ihres Armenguts ihre dortige Wirtschaft (die erst nach der Revolution eine Konkurrentin erhielt) errichten, gegen 2 Mäß Weizen als Bodenzins. 15 So stehen sich dort seit 1805 der «Wilhelm Tell» und der «Leue» gegenüber.
Dem Namen nach hat noch Lattrigen sein Landhụụs (sonst den «Anker»), Nidau sein Stadthụụs. Diese Stadt besaß bis 1628 auch die Freiheit, ihre Offen- oder Zapfenwirte und Metzger selber zu bestellen. 16
Einige dieser Gemeindewirtschaften sind als Gasthäuser verblieben, andere eingegangen, dritte als Pinte verblieben. Als Spezialname haftete «Pinte» am «alte Schwịzer z’Dwann» (s. u.), und das heutige Café Roth war vormals «Rŏ́sselis Binte» (von einem Rosselet gehalten). Pinten aber in dem weitern Sinn von Wirtschaften, zu deren Pinterächte bloß das Darreichen kalter Speisen zu den Getränken gehört, zählt heute die Einwohnergemeinde Twann fị̈ị̈fe, die von Ligerz zwoone. Eine dritte daselbst: ein nunmehr als Postbureau dienender kleiner Vorbau nach der Straße hin, hieß d’s Drụckli: Es war nụmmḁn e̥s Dru̦ckli, sogar «e̥s Schnụpfdru̦ckli», lebte 449 aber dem Spruch: Rächt Lụ̈t häi rächt Sache. Es ist ersetzt durch das Restaurant Lắriau, welches sich äußerst niedlich in den neuen «Ring» des Oberdorfes einfügt. Eine Pinte bestand vor 1903 auch in dem seither wirtshauslosen Schaffis (Tschaafĭ̦z). Es war l’auberge des clefs mit dem Neuenstadter Wappen der zwei überchrụ̈tzte n Schlüssel. An seiner Stelle stand seinerzeit das gegen die Ligerzer Grenze schauende Wachthụụs. Auf dem Chapf über Twann bestund 1898 bis 1901 ebenfalls eine ganzjährige, wie zuvor eine Sommerwirtschaft. Zu Wingreis, dem Weiler bei Twann, lebte 1546 der Wyrtt Hans Kräps ( Chrebs), in dessen Hause bis um 1850 Sigmund Ruef letztmals g’wi̦i̦rtet het.

Wirt aus Siselen
Ersetzt sind diese Wirtschaften nicht. Es gibt ohne sie Gelegenheit genug zum pi̦nte ( pinter, pintailler) und der Pintechehr z’mache. Zumal in Twann, wo eine Wirtschaft auf 70 Einwohner kommt, wie im gesamten Bernerland auf 245,7, in der Schweiz auf 149.
Neben «Pinte» gibt es eine Reihe verwandter Bezeichnungen. Einmal entspricht ihr der norddeutsche, vom Krüger gehaltene Krug, Dorfkrug, der vormals auch ohne «Patent» Gästen gelegentlich Nachtlager bot. Freilich welcher Art!
«Ein Nachtlager?» Dat könnt Sei hebben! Leggen Sei sick man hier rin. Da is eben de Kettelflicker ’rutkrapen, da is et noch schön warm drin. 17
Auf ungefähr gleiche Stufe alter Hotellerie deutet das zu chạuffe veredelte cauponari des römischen caupo (Weinhändler und -pantscher, s. u.), ferner die alte Gántine 18 (vgl. d’Gántine räiche als fertige Mahlzeit aus der Speiseanstalt) aus der it. cantina (Weinkeller) aus 450 canto (Winkel), 19 und das aus canaba (Verkaufswinkel) für Wein und andere Waren nach Italienerart) zu canabra und schließlich cabaret 20 verdrehte Wort, das endlich «g’läntet het» in unserm Ggắbaree als hölzernem oder metallenem Servierbrett.
Das aus dem café chantant u. dgl. ebenfalls veredelte café (café Mürset usw.) aber leitet über zum Réstorant, Restaurant, das seinen Ursprung in der Blasphemie des Pariser Garkochs Boulanger von 1765 hat. Der brauchte als Wirtsschild die Worte Matth. 11, 28 in deren Übersetzung... et ego vos restaurabo (und ich will euch erquicken). 21 Ein Wirt der Gegenwart, der diesen faulen Witz wiederholte, ward vom Wirteverein ausgestoßen: eins der Zeugnisse von der Hebung und Solidarität dieses Standes.
1
Schlaffb. 1, 166.
2
Ebd. 1, 164.
3
Vgl. Bernische Kellerwirtschaften. Von Lechner im
Taschb. 1910, 278-301.
4
Scheurer; Jenzer.
5
NB. 3, 1 ff.
6
ABN. 2, 101-115.
7
Ebd. 11-29.
8
LBI. 167.
9
Chorg. Ins.
10
Vgl.
NSW. 1911: Akten zur Gesch. d. soloth. Wirtschaftswesens, publiziert von Staatsarchivar Dr. Lechner.
11
LBI. 63.
12
Ebd. 60.
13
Ebd. 138.
14
Schlaffb. 1, 210.
15
Ebd. 2, 425.
16
NB. 2, 65 ff.
17
Niedersächs. Volksk. 143-7. S. 450.
18
Seil. 1, 107:
Kluge 234.
19
M-L. WB. 1616.
20
Seil. 3, 288.
21
Ebd. 181.
Seit dem XII. Jahrhundert gibt es berufsmäßige Herbergen, in welchen zunächst Krieger ịịg’chehrt häi (Tw.) oder sịị (Erl.). So ist noch die afrz. herberge als Soldatenzelt ( castrum), in der Mehrzahl das Heerlager ( castra), während nfrz. héberger «beherbergen» überhaupt ist. 1 Neben der fränkischen Grundform dieser Wörter ( heriberga) geht auf die hari 2 (vgl. got. der harjis, das Heer) zurück das it. albergo (Gasthaus) und frz. auberge (Wirtshaus). Das Wi̦i̦rtshụụs, dessen Wi̦i̦rt 3 Gest jeglicher Art und im Gasthof auch Übernächtler niedern und höhern Ranges bedient, findet seine romanische Parallele im hospitale. 4 Dieses wurde aus dem (gastlichen) Wohnhaus, südfrz. ustal, 5 tessenb. ŏtō und ótasse (i der Otasse: Schärnelzer Rebstück als Platz eines ehemaligen Hauses) das Gasthaus und der Gasthof: l’hôtel, das Hŏ́täll. Nicht sein Eigentümer oder Pächter, wohl aber in beiden Fällen sein « propriétaire», ist der hôtelier, Hŏ́tẹliẹ.
An den Platz dieses Allerweltstitels tritt im Seeland immer noch der an Behäbigkeit und Häimeligi alter bäuerlicher Wirtschaften gemahnende «Gasthof»: der Gasthof zum Bären (s. u.) in Twann und Ins, zum Kreuz in Ligerz, für nid wịter z’goo. Der «Gasthof» bleibt freilich weg in der kürzern Bezeichnung «zum Bären», im Bäre, der Bäre, «zum Kreuz», im Chrụ̈tz, d’s Chrụ̈tz. Die Herübernahme 451 der Dativs (Lokativs) in den Werfall entspricht der Kürzungsweise, die auch in den Ortsnamen z. B. auf «ing-en» statt hat ( S. 105).
Im Hôtel-Dieu dagegen finden ihren Anhalt der Spitál als öffentliches Krankenhaus, zumal als Bezirksspital wie für das Seeland in Biel, und der Spịtte̥l als Armenhaus alten Stils. Einen solchen hatte auch Twann. Es ist das nachmalige Elementarschulhaus und die jetzige Wirtschaft samt Bäckerei zur Sonne: d’Sụnne. Der ehemalige Erlacher- Spittel aber ist das jetzige Amthụụs des Bezirks ( Ins 553).
1
Das eng spezialisierte
héberge s. im Wörterbuch.
2
M-L. 4045.
3
Kluge 496:
Graff 1, 932 (wonach der «Wirt» sogar als Elefantenmännchen den «Eheherrn» darstellt):
mhd. Wb. 3, 748.
4
Der vorgerm.
ghostis, l.
hostis war als Fremdling dem Römer der Feind, dem Germanen der Gast:
Kluge 160 f. Erst der «Gast-herr». «
hosti-potis»,
hospes, übt am Fremden, dessen Gast er gegebenen Falls auch wieder werden kann (vgl. fr.
hôte als Wirt und Gast) Gastfreundschaft («Gegensinn der Urworte»).
M-L. Wb. 4197-4200:
Walde 370.
5
Atl. ling. 801.
Die Pịnte n, welche während einer zugemessenen Frist Wein ausschenken durften ( S. 446), kennzeichneten sich auch durch ein vor der Haustür aufgepflanztes Tannli ( S. 446). Nachmals konnte die Tanne 1 auch auf dem Wirtsschild figurieren, wie solche bisweilen zu wirklich künstlerischer Ausführung gediehen. So aus Gerlafinge (1677), 2 so aus Gü̦mmene (der «Bären» von 1750). 3 Die meisten Wirtsschilde zeigen allerdings bloß in gezierter Schrift eine «Wirtschaft» des und des Namens an; so die konkurrenzlosen Wi̦i̦rtshụ̈ụ̈ser von Weilern und entfernten Gehöften wie Geicht, wie d’Mühline, wie der Twannbärg.
Es ist ja auch die taberna im Ursinn des Gebälks, 4 der Bretterbude, des primitiven Wohn- und Geschäftsraums, welche als die spätere taverna, Tafférne (1551 zu Biel) 5 eine mit dem Tắffäärerächti (Rechten) ausgestattete Wirtschaft bedeutete, als Tắffääre aber bloß noch den Wirtsschild bezeichnet. (Er ist das Schildli und der Schild des Insers.) Der Twanner geht noch weiter mit spassiger Übertragung auf das Gesicht (vgl. das «Zif ferblatt»): Wart, i will de̥r d’Tắffääre verblääie! (oder vertääfele!). Ein durch plumpes Hinfallen oder durch Schlägerei im Gesicht Verwundeter ist Taffä́rewịịrt worte.
Abgesehen von bloßen Ortsnamenswiederholungen wie d’Laube (Alf.), wie Wirtshaus zur Brügg und du Pont, du Port (vgl. die Hafepinte), die alte Meyenrieder Galääre ( S. 20), war das Wirtsschild ein wirklicher Schild im Sinn der alten Wappenschilde, wie als Erben der Ritterzeit die Zünfte sie weiterführten. Es waren ursprünglich die Genossen einer Familie, die im Krieg «wie Löwen» zu fechten «im Schilde führten» und die auch «im Leue» 6 da oder dort gemeinsam 452 sich Mut antranken. Viel häufiger löökt aber natürlich in Bernerlanden «der Bäre» (der Gasthof «zum Bären») seine menschlichen «Kampfgenossen». So z. B. der 1889 verbrönnt und nicht erneuerte Bären zu Erlach und der 1837 von der Twanner Bärelänti nach der jetzigen Stelle versetzte Bären. Zum wị̆ße Bääre heißt ein Wirtshaus zu Gerlafingen. Einen Ochse hatte Nidau, bis sein Schild 1698 aberchennt und er selbst als Pinte abdekretiert wurde. 7 Auf Tapferkeit deutet aber auch der frühere Wilhelm Tell in Erlach: die heutige Wirtschaft Zülli, und die noch heute dieses Schild führende Wirtschaft Roth in Twann mit ihrem kunstreich ausgestatteten Twannerstï̦ï̦bli. Verschiedene wị̆ßi Chrị̈tz (Li., Bl. u. a.) rufen «zum stille Gang i dunggler Nacht», 8 um wenigstens in Biel «zur Krone» fortzuschreiten: insbesondere zur alte Chroone (Brasserie Moll) in der «nüwen Statt» von 1293 — welches interessante Gebäude 1915 für die städtische Verwaltung hergerichtet worden ist. Zu Erlach stunden sich früher als Pintenwirtschaften gegenüber d’Sunne und der Moon. Letzteres ist der heutige Gasthof «Frohsinn», ersteres die Wirtschaft Knechtli ( Chnächtli).
Als Gasthaus mit Wirtschafts- und Scha̦a̦lrächti führte Twann als Gemeinde bis zum Konzessionsloskauf von 1879 seinen Räbstock. Es war der alt Bäre (s. o.). Auch Ins hatte einen solchen Räbstock, welches älteste Haus im Dorf als Privathaus den ursprünglichen Scherznamen Himmelrịịch weiterführt.
Der Twanner Räbstock (s. o.) bildete — zugleich als Metzgerei — einen Annex des Ra̦a̦thụụs, welches später eine Zeitlang zwei obere Schulklassen herbergte und nun zu Privatwohuungen dient. Die Wirtschaft aber wurde in ein nahes Gebäude verlegt, vergrößert und 1862 mit dem Saal bereichert, der insbesondere seit seiner Erneuerung von 1912 (durch Heer-Mürset) trefflich zu theatralischen, musikalischen und turnerischen Aufführungen dient.
1
Wie auf dem schönen Schild zu Trachselwald:
Lf. 245.
2
MB. 1894.
3
MB. 1904, 18.
4
Nach
Walde 759 zu
trabs, trabēs, Balken.
5
«Bühel»:
NB. 5, 7.
6
Vgl. Marti, Die liebe alte Straße 256.
7
RM. 1698, 56. 156.
8
Molz 10.
Sein Erbauer war der Twanner Jakob Krebs (1811-1865), ein durch persönliches Ansehen, durch seine Verdienste um das Gemeindewohl (s. u. im Abschnitt über Verkehr), sowie durch die Qualität seiner Anfwartung noch heute viel und in Ehren genannter Mann. Es ist der Trị̈ị̈beljoggi oder (1841) der Trị̈ị̈belwi̦i̦rt. So hieß er nach seinem Wirtsschild, der einen von Laub umwundenen Chlepferstock zeigte. Derselbe ist nun durch eine undefinierbare Traubenart ersetzt.
453 Durch persönliche Geschätztheit, sowie durch die von seiner Witwe musterhaft fleißig und kundig fortgesetzte Weinbergsarbeit, welche eine Aufwartung mit weit und breit gesuchtem äigetem Gwächs ermöglicht, machte auch der Lị́lie-Fu̦rer sich einen Namen. Es ist Ludwig Furrer von Goldiwil bei Thun (1859-1909). Die 1837 an ihren jetzigen Platz versetzte und nachmals von ihm geführte Pintenschenke z’chlịịnne Dwann trägt als Schild eine riesig in Blech gefertigte Lilie als sonstiges Symbol des Handelsstandes: eine fleur de lys — sprich lys welschschweizerisch als lị und fleur de lys als Flöörte̥li (-ö́), gut twannerisch als Flẹẹrte̥lị̆. Man ging aber nicht zụ’r, sondern zụ’m Fleerteli als dem mit seinem seltsam klingenden Wirtsschildnamen identifizierten Wirt. An dem derart mundgerecht zugestutzten Wort gab es aber zweierlei zu korrigieren. Einmal ist das -e̥li ja doch eine entmännlichende, verkindlichende Verkleinerungsendung; der Name Fleerti paßt besser zu seinem Träger. Sodann sagt doch keiner, der etwas von Sprache versteht, «kartolisch» statt katholisch oder Fleerti statt Fleeti. Also: chämmet, mier gangen e chläi zum Fleeti!

Wirt aus Tschugg
Daß aber bei Menschengedenken eine zü̦gigi Persönlichkeit sogar zur U̦u̦rhab eines Wirtsschildes werden kann, beweist der alt Schwịtzer in Twann. Im Jahr 1830 kehrte nämlich der Twanner Jakob Rudolf Spittler ( S. 444) aus der Pariser Schweizergarde zurück, in welcher er als Pfịffer seinem Familienzweig den Unterschiedsnamen Pfịffers erworben hatte. Er kaufte ein Haus mitten im Dorf, baute es zur Beckerei und Wirtschaft ( Pfịffers Binte) um und gab letzterer zum Aushängeschild den uniformierten Schweizergardisten. Mit einer Tochter Tschantré ( S. 445) aus Tüscherz verheiratet, betrieb er neben seinem Doppelgeschäft den Holzhandel und ließ sich wiederholt zum Weibel der Gemeinde wählen. — Gefeierte Gäste 1 hinwieder verschafften der Wirtschaft Steiner-Heß zu Schärnelz, welche vorher «zum Rebenkranz» und noch früher einfach «Pintenwirtschaft» geheißen hatte, den in sinnreiches Rebus gehüllten Titel «aux trois amis». 2
454 Geben heutzutage noch die an Padä́nt gebundenen Bewilligungen zum Gastwirtschaftsbetrieb e schöne Batze in den bernischen Fiskus, so war bis zum 1. September 1887 das Ohmgält eine weitere ergiebige bernische Einnahmsquelle. 3 Wie wenig die aber bei den weinbauenden Nachbarkantonen beliebt war, zeigte z. B. Neuenburg mittelst der 22 Kanoneschütz, die es am Tag der Aufhebung des Ohmgeldes durch die Bundesversammlung im Nachbarstädtchen Landeron losbrennen ließ. Getröstet wurde indes Bern für die Einbuße durch den kantonalen Alkoholgeldanteil, der seit Erlaß des eidgenössischen Alkoholmonopols (für den «Bundesschnaps») auch ihm zur Bekämpfung des Mißbrauchs geistiger Getränke alljährlich zufällt.
1
Arnold Rossel aus St. Immer, Dr. Armin Kaiser in Bern und Apotheker Fueter in Burgdorf.
2
o =
aux; √9 = 3; a + mi. Am 24. April 1894.
3
Verschiedene idg. Sprachen haben ein gemeinsames Wort für «Gefäß», das z. B. gr.
ámē (
Prellw. 33), l.
âme (Feuereimer), alt rheinländisch
âme oder (wegen des
m) auch
ôme (
mhd. Wb. 1, 28),
schwz. Id. 1, 211) Ahm, Ohm lautet und im Verb
âmen, amen (visieren) das Vorbild zu «nachahmen», «nachohmen» (
Kluge 325) iSv. nachvisieren, nachmessen und schließlich
nacha machen abgab. Speziell als Weinmaß = ½ Saum konnte «Ohm» das Bestimmungswort zu
Ohmgält abgeben, wenn es nicht (nach
schwz. Id. 2, 241-5) auf dem Umweg über «Um-geld» (als Gebühr auf «Am»-satz) auf «Ungeld»
ohni Rechtsgrund und Gegenleistung zurückzuführen ist.