
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Schiff und Fisch, Fischerei und Schifferei gehören zusammen in Wortklang und Sachbestand. So auch und erst recht im Seeland, wo eine tiefgründige Wissenschaft nach ernsten Studien und Laboratoriumsversuchen herausgebracht hat, der Fisch well drụ̈ma̦l schwümme: im Wasser, im Schmu̦tz, im Wịị. Daß vorab das erste der drei Medien in einem Land nicht fehlt, das nach den vier Weltgegenden vier Quellströme sendet, sagt die Unzahl seiner Schiffer und Fischer. Hören die nicht mit Erstaunen, daß eine so wasserreiche Schweiz für jährlich an͜derhalbi Mil lion Fische u̦s em U̦ßland (u̦s frömde Land) beziehe? Was sagt dazu vor allem ein Lü̦sche̥rzer? Sein Ort ist allerdings zum stattlichen Chüehbuuredorf ụụfeg’chräblet, das wie mit jenen drei Elementen auch mit äigetem G’wächs und äigeter Milch aufwartet — schon zur Pfahlbaufundperiode damit willkommener als mit seinen Määritchörb voll Antiquitäten. Solchen Aufschwung dankt er aber dem unerchánnte hụụsen u wäärche jener ökonomisch noch chlịịne, aber überaus g’wäärbige (g’wịi̦rbige) Lị̈̆tli, die vor Zeiten um eine Einsiedlerhütte ihr unansehnliches Mooshüttendorf gruppierten, um mit dem Fischfang ihr Brot aufzubessern.
Der richtige und daher mit der allenthalben üblichen Ortsneckerei wohl vertraute Lüscherzer unserer Tage wiederholt denn auch lachend selber, wie solch ein Jahrhunderte dauernder Aufschwung durch arbärgische Stadtwitz in folgender Zusammendrängung auf einen einzigen, allerdings wohl zwänz’gstündigen Arbeitstag veranschaulicht wurde: Wenn e Lüscherzer am Morgen am zweu mit der «Fischmälchtere» am Rügge gäge Bärn zue gloffe (g’lü̦ffe) isch, für deert von ei’m Chundehụụs zum an͜dere sịner Fisch abz’setze oder aaz’traage, do 44 het er, we nn mḁ ’nḁ gfrogt het, wo n er här chööm, ḁ lsó schier mit ere Brieggistimm zum B’scheid g’gää: «Vo Lü̦sche̥rz, lieber, laider.» Aber wen n er de nn vo Bärn über e Frienis̆bärg z’rugg choo isch un im Chlooster es batzigs Mü̦tschi überchoo het un das z’Arbäärg i ’mene Schoppe Roote z’lin͜de ’too, de nn het de nn d’Antwort an͜ders töönt! De nn het’s de nn g’häiße: «Vo Lü̦scherz, bi Gott! Worum? Bin i ch de̥r öppis schull dig? So säg’s graad!» Zu solch angedichtetem Hochmüeteli würden allerdings die Gründe erst in paar weitern Jahrhunderten reichen, wenn überhaupt jemals strebsamer Fleiß und Hochmut enand aanähmti wi Wasser un d Ööl.
Zum Emporkommen ganzer Ortschaften durch fast oder ganz ausschließliche Fischerei, wie auch Lüscherz selbst es mit seinem (obere) Wirtshụụs zu de drei Fische andeutet (vgl. das Hôtel des trois Poissons zu Neuenstadt, den «Fisch» zu Ins, den «Hecht» zu Montilier), böte übrigens der Bielersee nicht mehr die Hand. Wi ne Fisch im Wasser lebten die Bielersee-Fischer und -schiffer bloß vor der Juragewässerkorrektion, als der See sịs gä ng glịịchlig warm Wasser in sanftem Dahinfließen bei einer Mindesthöhe beibehielt, die das heutige Durchschnittsniveau um mehr als 2 m überschritt. Das tiefer gelegte Wasser bekam raschern Zug und ungḷịichi Weermi. Zudem wurden zahllose frühere Laichplätze trocken gelegt bis auf die noch immer gedeihlichen, ja idealen am Inselrohr (dem Häidewääg) namentlich auf dessen Nordseite, sowie im Häftli: der alten Aare zwischen Meyenried und Büren. Dank diesen Verjüngungsstätten und dank der Nidauer Schleuse ( Ins 142) hat der Fischbestand sich wieder um öppis gehoben. Nicht beheben aber läßt sich der Übelstand, daß der Hagnikanal mit seinen Geschiebemassen einen Teil der Wasserpflanzen und Wassertiere deckt, die sonst als Nährstoffe und zu Verstecken der Fische dienten.
Stärker entvölkert ist der Neuenburgersee. Einmal hat die Jagd sogar auf die winzigsten Bondelles (s. u.) ihn uụṣg’fischet, und dann ist auch er mächtig z’ruckgange. Mit seiner Umgegend der Einmündung der alte Zịhl reichte er bis i d’s Gample-Dorf, drang vielen Orts hin u wider, ja oft (1422: offt vnd dick) i d’Chuchine, daß e̥s den Hausfrauen dóch de nn z’dick choo isch, und gestaltete das heutige feerme Bụụredorf zum wahren Fischerdorf. Hin͜der jedem Hụụs isch e Wäidlig g’schwumme. Auch Erlach badete seinen Fuß im Bielersee. Dääwääg erklären sich Flurnamen wie d’Hụ̈ụ̈rlimatte (1806) und die Hụ̈ụ̈rliachere (von einem Bächlein durchflossen) zu Müntschemier. Sie gewährten Hụ̈ụ̈rlig (s. u.) in 45 so reicher Zahl, wie andere Fische der Fischbrünnacher zu Finsterhennen, ja wie die Fisch weiere zu Gottstatt (1783) und im «Vychweg» zu Gampelen (1799). Auf dem Umweg dagegen, der über den Geschlechtsnamen Hẹchtli führt und die einstige Erlacher Hechtligaß erklärt, wird die Hechtleren-Hofstatt zu Müntschemier (1362) verständlich. Wie aber sind der Achcher im Fịịschi und die Fịịschiräbe zu deuten?
So fischreich, daß die Angelfischerei frei gegeben werden dürfte, ist immer noch di alti Zi̦hl. Ein dankbarer Wirkungskreis für die drei Fischereivereine der alten Aare: Aarberg. Lyß und Büren, ist der alt Aarelauf. Zu seinen besonders guten Stellen gehört z. B. das Häftli bei Meinisberg (s. o.). In diesem Strich hat die Juragewässerkorrektion für die Ansiedlung einer reichen Wild-Flora und Fauna grad förderlich gewirkt. Die seit Jahrtausenden hier angeschwemmten Geschiebemassen sind freigelegt worden und bieten wahre Dorados wie für Chrụ̈terler (Herboristen) und Chäferler (Entomologen) und Schmetterlingskundige, für Beieler (Imker) und für Jeeger, so in den zahllosen Bäch und Bächli, Glu̦ngge und Gieße (Altwasser) auch für Fischer.
Der Durchstich des Dammes, der bei Meieried die alte Aare abschließt, würde den Fischen eine große freie Wasserstraße schaffen. Er kann aber erst mit dem solothurnischen Korrektionswerk choo. Diese muß jedoch anderseits wohl neue Schädigung des Fischbestandes bringen durch Verkürzung und raschern Zug des Flußlaufs, sowie durch Zerstörung der Auskolkungen ( Glu̦ngge und Glü̦nggli) und Schilfplätze ( Rohr und Röhrli) des Ufers, der Schlamm- und San͜d- und Kies- ( Grien-) Stellen des Grundes. In den korrigierten Fluß werden sodann neue Fabrigge ihre vergiftige n Abwässer senden dürfen; neue elektrische Kraftwerke hinwieder müssen die natürlichen Flußläufe durch künstliche Anlagen ( Fischpäß) zu ersetzen suchen, nach Art der 1885 im Rheinfall erstellten Lachsleitern.
Was so im Dienste der Landwirtschaft und Industrie als der Hauptnährquellen unseres Landes si ch nid an͜ders loot mache, luege d’Fischereivereine (s. u.) guet z’mache durch Erhaltung der noch bestehenden und Schaffung neuer Existenzgrundlagen für ein gleichfalls hochwichtiges Element nationaler Selbsterhaltung und Selbstbehauptung.
Aus 56 Fischarten setzt sich die schweizerische Fischklasse zusammen. Die meisten derselben sind auch im Seeland vertreten, und zwar in den folgenden näher bezeichneten Lokalitäten: 46
Bl. = Biel,
Bs. = Bielersee,
Ga. = Gampelen,
Ins,
Li. = Ligerz,
Lü. = Lüscherz,
M. = Muntelier bei Murten,
Ms. = Murtensee,
Ns. = Neuenburgersee,
S. =
Sugiez und überhaupt Wistenlach,
Tü. = Tüscherz,
Tw.= Twann und Umgebung.
1
Alle gehören in die Ordnung der Knochenfische mit Ausnahme der Bach- und Flußneunaugen: Nị̈ị̈näigler (alt Bl.) oder Stäibịsser ( Petromyzon Planeri und P. fluviatilis, Lamproie de rivière, Lamprete, d. i. «Stäiläcker», quia lambit petras, in S. suço- oder perça-pierra). Der wie ein riesiger (Regen-) Wurm oder auch wie ein junger Aal (Ööl, s. u.) aussehende, durch bloßen knorpeligen Rückenstrang gestützte Leib zeigt in der Halsgegend sieben rundliche Kiemenlöcher, ein Naseloch und ein Auge, zusammen neun «Augen». Der wie am Bluetsụụger röhrenförmig vorgestreckte Saugmund ist von einem Kreis runder Hornzähne umrandet, mittelst deren das Flußneunauge sich zum Frühlingslaich an aufwärtswandernde große Fische aasụgt, ja sich in sie hineinfrißt. 2 Wohlschmeckend, aber schwer verdaulich, werden sie meist verschnätzlet als Richtfische für Aale.
Diese Ääl (M.) oder Ööl, Eël (Lü., Tw.). Ööle n, Eële (Ga., Tw.). Ööler (gelegentlich in Ga.) 3 — die einsilbige Mehrzahl wurde auch Einzahl, etwa wie «Öpfel» — galten ursprachlich 4 als Schlängli. Wohl als solche verbannte 1474 ein päpstlicher Machtspruch die Aale, 5 wie ein bischöflicher aus Lausanne die Maikäfer zitierte. Drum heißt der europäische Aal Murena anguilla oder jetzt Anguilla vulgaris (Anguille commune, in S.: Anguilla). Eine andere Bezeichnung A. fluviatilis gilt dem uns 47 einzig als «Flußaal» bekannten, noch nicht fünfjährigen Weibchen. Näheres unten.
Die Ordnung der Häringe ist im Süßwasser vertreten durch den im Mai bis zum Juli fangbaren Mäifisch ( Alosa vulguris) 6 oder Wịßfisch. 6a Bezeichnungen, die allerdings zu Lü. umfassendere Geltung haben. Dort ist Wịßfisch überhaupt ein Träger weißer, sogar silberglänzender Schuppen, und Mäifisch im Mai gefangener Fisch.
«Hechtgrau» wie Goethes Doppelgänger 7 schimmert auch das Schuppengewand des Esox lucius: des Hẹcht, brochet, brotschet, brotzet, betsché (S.). So benennt sich der Hai der Süßgewässer, damit aber auch der Umwandler schlechten Fleisches in gutes, nach seinem fürchterlichen Bi̦i̦s. Die Unterkieferränder sind nämlich ein ganzes Zụ̈ghụụs hechel-scharfer, gebogener Fangzähne. 8 Diese Waffen ersetzen die Kräfte des schwachen Hirns hinter dem Entenschnabel als Ausläufer des torpedoartigen Leibes. Unzähligemal unbelehrt nach jedem Köder und darum auch nach jedem blinkenden Löffel (s. u.) beißend, übt er als einzige List im alten Sinn des Könnens, daß er mụ̈ụ̈slistill im Rohr und Bins des Ufergeländes auf ungewitzigt nahende Beute lụụßet. Alles fressend, was ihn nid frißt, und bei sperriger Beute es draufankommen lassend, weeles Tier d’s an͜der fräß, kann er gelegentlich ob unverschluckbarem Fang erwoorgge. (Man erinnere sich der Szene in der Landesausstellung von 1914.) Seine G’frääsigi verhilft aber dem Fischer zu gelegentlich reichem Zug. So erwischte 1915 einer bei Neuenstadt i dreine Tage mehr als sechzig Hechte, deren größter 33 Pfund wog. Aber das isch no nụ̈ụ̈t g’si̦i̦ gegen den vierzigpfündigen Hecht mit 6 cm langen Zän͜d, welchen 1885 der Genfersee auslieferte. Von 30- und von 26-pfündigen Bielerseehechten erzählen die Zeitungen hin und wieder. Überhaupt ist dieses Tier des Fischers Brotfisch, Brotchorb.
D’s Mụụl ụụftue wi ’ne Lüscherzerhecht (wie ein Gähnender tut) kann übrigens auch die Forelle, selbst wenn sie nicht so groß wi ’ne Gartepfoste wird. An Raubsucht und Schwịttigi (starker Freßlust) steht dem Hecht die Forelle ebenfalls nicht nach, sie übertrifft ihn aber noch an Leckerkeit des Fleisches. Wie guet zumal d’Schị̈ị̈ßfëërneli sịị, wußten ja die alten Bieler. Gleich bekannt ist die Parallele dieser Verkleinerung: «das Föörne-li, Föörnli» aus 48 «di Foorne» mit der Verkleinerung Fŏ́rälle statt «Foren-le» aus mhd. vorhen. (Die dynamische Betonung Forä̆lle, Forélle erinnert an «lebéndig» 9 neben holl. lévendig, an individuell oberhaslerisches «u̦sserordä́ntlich» u. dgl.) «Die vorhen» (ahd. forhana) aber stimmt letzten Endes mit gr. perknós, d. i. bunt; 10 der Name gilt also der prächtigen Färbung der Hụ̆t unter den wie Bärlimueter (Perlmutter) glänzenden, seinen Schüepe (Tw.: Schiepe), die man ihrer Feinheit wegen vor der gewöhnlichen Zubereitung nicht abmacht. (Die Forelle wird nicht g’schï̦epet oder g’schu̦ppt.) Vorzugsweise wird als Foorne die Bachforelle bezeichnet: Trutta fario, truite de ruisseau, in S.: trētǝ de rü. 11 Namentlich durch länger g’streckte Chopf und größere Lịịb unterscheidet sich von ihr die Trutta lacustris, in S.: trētǝ do lē. 12
Diese Seefoorne ist «ein emanzipierter Meerfisch», 13 der mit seiner bis 20 Pfund erreichenden Schweeri und demgemäßen Gröößi dem familiengenössigen Lachs 14 oder Salm ( Salmo Salar, saumon) sich nähert. Diese glotzäugigen Wanderer vom Meer her bis in die mittlere Aare fingen im Jahr 1749 einige Orpunder Fischer an der Chilchmụụr z’Arbärg oben a der Brügg nicht weniger als 26 in einem Zug. Sie wogen 20 bis 30 Pfund. 15 Nun sind diese Gesellen rar geworden. Hie und da gerät einer aus der Aare durch den Hagnikanal in den Bieler- und Neuenburgersee und verfängt sich da. Die Fischer unterscheiden solche Fremdlinge von den einheimischen Seebewohnern a der Faarb: die der Bielersees sind bläichlocht; die des Murtensees schön root ’du̦pfet, wi g’ma̦a̦le, die Truites saumonnées des Neuenburgersees dünn ’düpflet.
Im Gegensatze zu der sehr langsam wachsenden Bach- und Seeforelle wachset sogar im Weier die importierte Regenbogenforelle ( Salmo iridens) sehr rasch: aber si het lang nid so guets Fläisch. Mit Vorteil dagegen führte man den Bachsaibling ein als nächsten Verwandten des Röötel und insbesondere des leckern Zuger Rööteli: Salmo salvelinus oder Salvelinus Umbla. Dieser Name kehrt wieder im omble chevalier ( Salmefoorne), dem Omberli und der ombretta, welch letztere noch in Bächen und Flüssen gedeiht. Das bis 20 Pfund Schwere erreichende, dabei zierlich schlanke und prachtvoll gefärbte Omberli dagegen (das oberländische Hamel oder Emeli) 16 soll nur noch 49 den Neuenburgersee zieren. Die gut lokalen Namensformen Ambeli (Lü.) und Ampe̥li (M.) sind denn auch antiquiert.
Der von omble scharf zu unterscheidende Name ombre (o. commune) gilt dem im Murtensee fehlenden, überhaupt aber läuffigs Wasser bevorzugenden, doch im See zwischen Twann und Wingreis nicht seltenen (und nun auch in den neuen Aarensee gewanderten) Äsch (s̆s̆). Er wird auch das Äschli, im 18. Jahrhundert der Esch geheißen, altdeutsch aber der Asch (Felix Dahn), der asche, asco. Wer den bei gewissen Beleuchtungen irisierenden Goldglanz 17 dieser Äsche nicht kennt, wohl gar mit kennerhaft-dreistem «grad vo dene wott i!» vom schelmisch uf de Stockzänd lachenden Händler sich etwa eine Nase (s. u.) als Rohräsch, Rohräschli aus dem Seeschilficht vorsetzen läßt, hat bloß ein Auge für das Aschgrau 18 dieses Fisches. Die Eintönigkeit der Farbe bildet aber die Folie zur prächtig g’ma̦a̦lne Längsbänderung der langgestreckten und abgerundeten Rückenflosse, nach welcher das Tier der Fahnetreeger heißt: Thymallus «vexillifer». Der Gattungsname dagegen besagt, das sonst so treffliche Fleisch rieche zur Laichzeit (s. u.) nach Thymian (richtiger: nach Gŭ̦́ggu̦meresaft).
Zu der Raubfischgattung der Forellen und Lachse oder der Salmoniden im engern Sinn, sowie zur Gattung der Äschen, zählt sich als dritte die der Coregonen, welche mit den vorigen die natur- und die wirtschaftskundliche Einheit der Salmoniden im weitern Sinn ausmachen. Als gemeinsames Merkmal zeichnet alle drei Edelfischgruppen die Fettflŏsse aus: die fettig verdickte Rückenflosse.
Dieser Coregonen 19 (oder Felchen), welche mit den Hechten und den Brachsmen (s. u.) den Hauptreichtum des Bielersees ausmachen, gibt es in unsern drei Juraseen die folgenden Arten und Unterarten.
Zunächst unterscheidet man (nach dem Genfer Fatio) die zwei Typen Coregonus dispersus und Coregonus balleus. Zum C. dispersus zählen die Arten Coregonus Wartmanni und C. exiguus. Zu der erstem Art gehören die als C. confusus vom Albock des Thuner-, Brienzer- und Zugersees, sowie vom Blaufelchen des Bodensees und dem Bläulig des Zugersees unterschiedenen Pfä̆rit (Lü), Pfeerit (Tw.), Pfeeri̦t (Ins), Pfä̆rig oder Pfäärig (Tw., Li.), Fäärig (M.) des Bieler- und des Murtensees, soweit dieser Fisch im letztern no nid erödet ist. Zu der Art C. exiguus zählt man die Bondelle, die Bóndelle (Ins) oder das Bu̦nde̥li (1559, 1715, 1727) des Neuenburgersees und Chropfer (s. u.) zumal des Murtensees. (Ihre Artgenossen sind der Gangfisch des Bodensees, das Albeli des Vierwaldstättersees, der Brienzlig 50 und das Kropflein des Brienzer- und Thunersees.) Vom andern Typus, dem Coregonus balleus, lebt in unsern drei Seen bloß der Coregonus palea: die palée oder der Balch. («Balch», «Balche» heißt im Thuner-, Brienzer-, Zuger- und Vierwaldstättersee der C. helveticus, zum Unterschied vom C. fera als der féra Genfersees und vom C. duplex als einer Bläulig-Art des Zürichsees.)
Alle diese Coregonen oder Felchen (Renken), deren vielfache Kreuzungen das Bestimmen der festen Typen so schwierig machen, sind charakterisiert durch dä spitz Chopf u das chlịịn Muul, dessen Armut an Zähnen durch dicht gestellte Reusenzähne an den Kiemenbogen ersetzt wird. Ob diese äi Reie oder zwoone bilden, gehört mit zur Unterscheidung der beiden Haupttypen, die wir für den Bielersee einfacher als Balche und Pfärig auseinander halten können. Jene gehören zu Goeldis 20 Großrenken, diese zu den Kleinrenken, die auch sonst mehr oder weniger entschieden sich von einander abheben. Der gleichmäßige Silberglanz der Schuppen verbindet sich insbesondere beim Pfärig mit außerordentlicher Niedlichkeit und Beweglichkeit der Leibesgestalt, während der schwärzlicher aussehende Balch durch ausgiebigere Leibesgröße des Brotfischers «Fall» ist. Dazu kommt des Balchen festeres Fleisch, wo meh i d’s Mụụl gi bt, indes das weichere des Pfärig vorzugsweise den Feinschmecker befriedigt. Auch ist der Balch insofern liechter z’fa̦a̦, als er zum Laichen (s. u.) d’s Land oder doch d’Dünni aufsucht, indes der Pfärig seine marine Urheimat immer noch durch Bevorzugung größerer Tieffi kund gibt. 21 Dieser Unterschied scheint der Bezeichnung « bondelle» als «Tiefenbewohner» 22 zugrunde zu liegen. Aus entsprechendem Grunde trägt der Chropfer seinen Namen: Beim Heraufholen aus der Tiefe nimmt der Wasserdruck so rasch ab, daß die in der Schwimmblase enthaltene, stark komprimierte Luft nicht mehr den genügenden Gegendruck findet. Darum schwillt die Schwimmblase so gewaltig an, daß sie wi n e große Chropf die Kehlgegend ụụftrịbt. Aus ähnlichem Grunde, sagt man, trete bisweilen einem Egli (s. u.) der Mage zum Mụụl ụụs. 23
Aus der Familie der Grundeln bloß die Grụmmele (Lü.) oder den Schnauz (M.) der Moosbäche erwähnend, gehen wir zu der reichen Karpfenfamilie über, welche ebenfalls — wenigstens teilweise — sich durch prächtige Schuppenfärbung auszeichnet. Vor allem erwähnen wir die Naase ( le nase in S.) oder den Naasel (M.) mit dem abwärts 51 gerichteten und vom stumpfen Vorsprung der Schnauzenspitze überragten Spalte des knorpeligen (den Namen Chondrostoma nasus veranlassenden) Maules. Genannt sei ferner der Aalet ( Squalius cephalus) oder le «chevesne», le chevaine: der Schwenn (M.), le tzéveno (S.), 24 auch le meunier und der Müller geheißen, weil er sich gern in den Strudellöchern der Mühlräder verbirgt. Sodann der auch im Moos heimische, wie der Hase bewegliche und außerordentlich lebhafte Hääsel ( Squalius leuciscus), aus der gleichlautenden Mehrzahl etwa auch als der Haasel «rekonstruiert» und so dem schriftdeutschen Hasel angeglichen. Er heißt zu S. le ronzon, zu M. der Ru̦ngsu̦ng, neuenburgisch le rondion. Das grazil 25 gebaute Tier heißt sonst westschweizerisch la vaudoise.
Namentlich d’Nase, wohl auch der Aalet, werden um Laupen als Äßfisch der Sense massenhaft enthoben, während sie sonst, gleich dem Hääsel, bloß als Richtfisch (s. u.) geschätzt sind. Das letztere gilt auch vom Squalius Agassizi: dem Riesling oder Ịịscher, Ịịscherli, Strömer, blageon, der allerdings am Bielersee bloß durch die von Bern über Biel gewanderte Redensart hét e n Iischer! («hát ihn schon!») bekannt geworden ist. Nicht mehr gilt auch der Wịnger (Ga.) oder di Wi̦ngere (Lü.), le vengeron, veîzero (S.), der Wänserung (M.). Dieser «rötliche» Leuciscus rutilus erinnert an die roote Feedere (Ins) oder Flŏsse der ebenfalls stark grätigen Rotten, Rottele, Röötele (M.), auch das Rotteli, Rottli (Ga., Lü., Tw., Li.), la rotta (S.), le rotengle oder Gardon commun geheißen, mit dem Namen Scardinius erythrophthalmus genauer als «rotäugig» bezeichnet. Die goldgefärbte Iris zeigt nämlich meist einen roten Augenfleck. 26 Der oben erwähnte Name «Müller» vereinigt sich in anderm Sinn (die Schüppchen bleiben an der Hand des Fängers kleben) zur Bezeichnung des Alburnus lucidus mit Schnịịder (M.) und tailleur. («Schneider» heißt aber sonst das Bambeli, der Spirlinus bipunctatus. 27 ) Andere Namen dieses Alburnus sind: der «Blääülig», le bleu und das «Albeli» (Lü.), le blanchon und blanchet, la bȳre und l’ābya (S.), ablette und able, l’aube = le laube, d’s Laubeli und d’s Laugeli. 28 Alle dienen zur Bezeichnung schlanker Köderfischchen mit blaugrünem Rücken und rein silberigen, dünnen Schuppen, welche Perlenessenz liefern. 29 Dagegen ist der Rhodeus amarus, Bitterling das wirtschaftlich wertlose, aber naturgeschichtlich interessante, 30 zierlich winzige Bachbu̦mmerli. 52 Anderwärts teilt es mit der Ellritze ( Phoxinus laevis) die Benennung d’s Bụtzli.
An die Worteinheit von Blick und Blitz (leuchtender Strahl) erinnert die Blicke ( Blicca Björkna), die twannerische Plagge. Dieser kleine Fisch ist nach Namen und Sache nächstverwandt der Brasse oder dem Brachsmen (Abramis brama): la brème, die Brachsme oder die Brachsle, Brachsmele (Bl.), was an altgermanisches brëhwan (glänzen) 31 anklingt, den Dichter Ganghofer aber zur Schöpfung seiner «Brachtmannen» anregte. Wie in dem durch die Scheitelung doppelt wirksamen Glanz des Schuppenkleides, gleichen sich die beiden Karpfengattungen Blicke und Brachsme auch durch ihren auffälligen, seitlich plattgedrückten Leib mit dem hohen, steil ansteigenden Rücken. Das verschaffte ihnen die weitern Namen le haut, le dos, sowie la platelle, le platel, le plattŏ (S.), der Blattell (M.), das Blattli, die Blacke (Mö.), während das Blackli (Lü.) als die chlịịni (jungi) Brachsle gilt. Darum die auf geringern Wert des Blickenfleisches gestützte Rede: wi gröößer d’Brachsme, wi besser. Die stark ausgeschnittene Schwanzflosse veranlaßte zudem die Bezeichnung der Mu̦tzel (M.). Alle diese Eigenheiten lassen sich genügsam studieren an Riesenzügen, wie sie z. B. an den beiden ersten Aberelle 1899 und 1913 zu Lüscherz gelangen. Wie wenig damals die dortigen Fischer i’ n Abrelle g’sprängt wurden, zeigten die Züge von 35 und von 70 Zentnern. Erstmals (1899) wurden d’Brachsle wi Härdöpfel u Ru̦nggle im Chäller a Hụ̈ffe g’heit, zweitmals in Biel, Bern und Neuenburg fast vergäbe verpartischiert (Ins) oder partaschiert (Tw.). Zu 25 Rappen verpfün͜dlet wurden die 3500 kg Brachsle, welche in der Nacht vom 29./30. März 1916 durch Lüscherzer gefangen wurden.
Langgestreckten Leib zeigt hinwieder der Greßling (Gobio fluviatilis), goujon, gŏ́ts ō (S.), Gósung (M.), der Ggü̦tsch (Tw., Lü.), d’s Gụ̈tschli (Mö.), das Grụndeli (der Gründling). Welschen ein Leckerbissen, ist er dagegen sonst ein so verschätzter Fisch, daß er auch schlechten Trauben (s. u.) seinen Namen leihen muß. Interessant ist am Greßling des Luganersees seine Verwandlung der Bauchflossen in einen Saugnapf, womit der ruhende Fisch an glatten Steinen aachläbt. 32
In Höhlungen dagegen gräbt sich mit ihrer dickwulstigen, rüsselförmigen Schnauze, deren Oberlippe vorn und hinten mit den vier Barteln besetzt ist, die Barbe, das Baarbli, le barbeau, bárbiyo 53 (S.), der Barbus fluviatilis 33 oder plebejus (mit dem nach der Laichzeit schlechten, immer doornige Fleisch und dem giftigen Rogen.) 34
Zwei Bartfäden trägt die zum Sommer- und Winterschlaf im Muer vergrabni Schleihe, Schleeie. Den an Schleim 35 erinnernden Namen mag der Fisch vom aalähnlich fetten Fleisch, wenn nicht von der sattbronzen durchsichtigen, dicken Oberhaut und den fleischig verdickten, abgerundeten Flosse haben. Die Bezeichnung aber als das Ti̦nzli (M.) führt auf Tinca vulgaris und la tanche, la tange (S.).
Die ganze große Sippe der Karpfen schließt ab mit dem eigentlichen und zugleich wirtschaftlich wertvollsten Kaarpfe (M.), Chaarpfe, la carpe, le cārffō (S.), Cyprinus carpio. Die an die 36 Cypris oder Venus gemahnenden Spiegelkarpfen mit ihrem Goldglanz und den malerisch verteilten dunkeln Flecken sind freilich ausschließliche Zierden der Prunkstube. So insbesondere das im 17. Jahrhundert aus China über Italien zu uns gekommene Gu̦ldfischli ( Carassius auratus) als Abart der einheimischen Karausche. Eine eigentliche Nutztierzucht trieben dagegen Klöster mit dem durch Römer vom schwarzen Meer importierten Edelkarpfen als dem Äßfisch, der über 30 kg schwer und angeblich hundert Jahre alt werden kann. Mit seinen abgeflachten Mahlzähnen verbịßt er jegliches Gewürz und Gewürm des Schlammes, in welchem die Sau un͜der de n Fische n jetzt listig u gschịịd die Beute erhascht, jetzt behaglich walet und nun in exemplarischer Fụụlki̦t Schmutz (Fett) aasetzt.
Nicht fleischige Barteln, wie der Karpfen, sondern zwei wurmartig schlanke Geißeln streckt die Oberlippe des Wels heraus. Ihre spielende Bewegung, die wie das zable eines Wurms sich ansieht, lockt etwa Vögeli an, nach denen das Ungetüm wi n e Hun͜d schnellt, um sie zwischen den zahlreichen Hechelzähnen der riesigen Maulspalte verschwinden zu lassen. 37 Hie und da wird er bi hööchem Wasser aus dem Murtensee durch die Broye und den Neuenburgersee und von hier durch den Zihlkanal in den Bielersee verschwemmt. So — als ein Prophet schlimmer Zeit — im November 1560, so (70 kg wiegend und 2,1 m messend) im November 1921. Bei solchen Gelegenheiten ausgestellt, läßt ein Exemplar dieses Silurus glanis, le silure, sarkastisch le salut, 54 le s̆s̆álü (S.), der Sälụtt (M.), d’Sălụtte (Tw.), der Sä̆lụ̈ụ̈ (Lü.) oder Sä̆lụpp (Lü.), in ehemaliger Lokalsprache auch la balaina 38 und «teutscher Walfisch» 39 geheißen, si ch z’g’rächtem aaluege. Der räuberische Riese macht auf den ersten Anblick einen schreckhaften, bald aber einen ergötzlichen Eindruck durch den mächtigen rundlichen Grin͜d, unter dessen plattgedrückter Sti̦i̦rne ein winziges Hi̦i̦rni Einklang sucht mit den fast gar erst zu suchenden Säüäügli. Mit dem Kopf steht in ähnlichem Rapport der den Rumpf an Länge übertreffende, seitlich zusammengedrückte Schwanz. Jedenfalls ein einzigartiger und zum Glück seltener «Pionier» einer belangreichen einzigartigen Fischfamilie, 40 deren mehr als 80 Jahre lebende Riesen bei stärkerer Zahl unserm Fischbestand bald der Ggărụụsch g’macht haa wurdi. Ist auch das Fleisch dieses ungschlachte Räubers von zweifelhafter Güte, so gilt dagegen der Zwärgwels als sehr genießbar. Gleichwohl wird er eher als Zierfisch gehalten und z. B. im Häftli bei Meinisberg kolonisiert.
Aus der Schellfischfamilie, die der Schwimmblase entbehrt, kommt bei uns die auch schuppenlose, daher als en Art Schlangefisch mit weicher und schleimiger Aalhaut 41 erscheinende Quabbe, Aalraupe (d. i. «Froschfisch») 42 vor. Mit dieser Lota vulgaris, la lotte, d’Lotte (M.), gewöhnlicher la môtēla (S.) und die Trüsche, Trịsche (Lü., Tw., mit s̆s̆), Trịịsche (s̆s̆) oder Trịịschele (s̆s̆, M.) geheißen, wird oft die Grundere- oder Grundelen-Art Cobitis barbatula oder loche franche verwechselt. Das Fleisch der beiden kann möösele: «moorisch» schmecken und riechen, wie übrigens auch das der Wịßfisch ( S. 47) und aller rụụche (nicht edlen) Fische. Zumeist jedoch wird das weiße und feste Fleisch der Trüsche als sehr schmackhaft vom Kenner hochgeschätzt, und ihre Leber gilt dem Feinschmecker als Leckerbissen. Im Garten des Rebgutes Thormann in Wingreis steht ein Birnbaum, dessen vorzügliche Früchte als Trị̈ị̈scheläbere (s̆s̆) benannt werden.
Die sonderbar spießig ụụszogne Brustflossen der Trüsche führen aus der Abteilung der Weichflosser über in die der Stachelflosser. Zu diesen gehören zunächst, als Vertreter der Panzerwangen, bei denen fast alls nụmme Grin͜d isch, der Cottus Godio, chapot, chabot, cabot, Breitgrind (M.), Motsch- oder Mu̦tschchopf, der Mu̦tschi (wie überhaupt alles unförmlich große genannt wird), der Mostchopf (in Lü. als Sprecherleichterung). Der Gropp oder die Groppe heißt der Fisch 55 zu Twann und anderwärts, wo sein Fang als Futter nicht ein fische, sondern ein groppe ist? 43
Ein sehr geschätzter Backfisch ist dagegen der Barsch, die Perca fluviatilis, la perche, la pērtze (S.), als erwachsenes Tier (vgl. unten) das Egli geheißen. Beiderlei Namen gelten der «borstig» 44 stacheligen Beschaffenheit der vordern Rückenflosse, deren 13 bis 15 harte Strahlen er zugleich mit dem rückwärts gekehrten Dorn des Kiemendeckels gegen den ihn zu verschlingen suchenden Hecht spannt, so daß dieser dra cha erwoorgge. Dagegen legt er sie nieder, wenn er nach Katzenart eigene Beute beschleicht, um sie mit seinen gleichmäßig feinen Sammetzähnen zu zermalmen.
1
Hilfsmittel für Einordnung, Benennung und Beschreibung:
Goeldi, s. Quellen;
Asper und Studer: Die Fische der Schweiz und die künstliche Fischzucht (Bern, 1890); Baron von Ehrenkreuz-Borchart: Das Ganze der Angelfischerei (Lpz. 1904);
P. Savoie-Petitpierre: Carte piscicole du lac de Neuchâtel (1904);
J. Jud: Les noms des Poissons du Lac Léman (Lausanne 1912);
Schmeil: Zoologie S. 304 bis 341;
Brehm: Tierleben V, S. 447-812; Mündliche Belehrungen durch Karl und Großrat
Max Engel, Albert Krebs, Karl Irlet u. a. in Twann; Fischer
Grimm (Schueljoggi), Wirt
Dubler und Gutmann (Jöggi Bänz, 1821 bis 1915) in
Lüscherz; den 74jährigen blinden
Jean Bourguignon und seine gleich alte Ehefrau in
Sugiez; die 80jährige Kahnfahrerin
Liselotte Bovet zu
Môtier-Vully; die Fischer
Auguste
Faßnacht und Samuel
Faßnacht zum «Hecht» in
Montilier bei Murten; Gemeindeschreiber
Tschilar in Gampelen, Postbeamter
Rihs in Biel u.a. Spezieller Dank gebührt noch dem
Fischereiverein vom Bielersee und seinem Präsidenten: Sekundarlehrer
Witschi in Brügg.
2
Weiteres:
Goeldi 595 ff.
3
Das l wirkte mit zur Verdunkelung des ă zu ŏ.
4
Vgl.
Hoops 1, 3.
5
AhV. 25, 13.
6
Asper 39.
6a
Amerikanische Weißfische wurden 1885 (unter der nötigen Beachtung unaufhörlichen Bewegungsbedürfnisses) im Thunersee ausgesetzt. (Anz. von Saanen 9.)
7
Vgl. einerseits Sokrates’
daimónion, anderseits den «sündengrauen Hecht» in G. Kellers «Taugenichts».
8
Vgl.
Goeldi 589 und Ehrenkr. 200 ff. mit
Kluge 108 und Grimm Wb. IV, 2, 739.
9
Vgl. auch «barmhérzig» u. a.
10
Kluge 146.
11
Von ihrem
merkige, gewandten und freiheitsdurstigen Wesen erzählt in blühendem Stil im «Bund» vom 2. September 1920 der Feuilletonist von «Petriheil» (am Forellenbach, vom Riedgänger).
12
Näheres: Jud 30 f.
13
Goeldi 577.
14
Hoops 2, 175.
15
NB. 5, 85.
16
Goeldi 585; Jud 40.
17
Goeldi 273;
Lf. 17 f.
18
Vgl.
Kluge 25.
19
Goeldi 561-572; vgl. Asper 50-58.
20
566 ff.
21
Max Engel.
22
M-L. Wb. 1392; Jud 19 f.
23
Vgl. das buchstäbliche Ertrinken der ostindischen Kletterfische (
Anabantidae) und das Ertränken des Hechts durch die Mexikaner. («Bund».)
24
Zu diesem Namen stimmt der
Squalius cavedanus (enetbirgischer Aalet). Der Aalet heißt mhd.
alant, und ahd.
alunt, as.
alund.
25
Goeldi 545.
26
Ebd. 539.
27
Ebd. 536.
28
Vgl.
schwz. Id. 3, 962.
29
Asper 67.
30
Goeldi 530 ff.
31
Kluge 68.
32
Prof. Studer.
33
Bhardâ als gemeinsame Grundform von
barba und Bart:
Kluge 40.
34
Ehrenkr. 174 ff.
35
Kluge 401.
36
Zuerst auf der Insel Cypern (Kupferinsel) verehrt.
Carpa aber (s.
Walde 153) gehört mit «Karpfen» zu einer Wortsippe, in welche auch «Chrapf» (
schwz. Id. 3, 842 ff.) sich stellt. Man denke an den
Haagge, welchen die Oberseite des Fisches darstellt.
37
Paul
Teutsch zu Bipschal bei Ligerz enthob dem See eine 140pfündige, gegen 2 m lange Welsleiche. Über einen zu Scheuren bei Gottstatt gefangenen Wels s.
Taschb. 1911, 310. Von Welsen von 45 und 33 kg vernimmt man hie und da.
38
Bridel 25. 243.
39
Gessner bei
Brehm 630; vgl. Wal und Wels (mit «welsch» verwaudt) bei
Kluge 484.
40
Goeldi 590/2.
41
Sie gibt z. B. in Sibirien Fensterscheiben und Kleidungsstücke. (
Goeldi 597.)
42
Kluge 1.
43
Vgl.
Lf. 40.
44
Zu
bars/burs Borste:
Hoops, 1, 171;
Kluge 40.
Hansjoggeli am Bach
Het luter guet Sach:
Het Fischeli z’Morge u
Chräbseli z’Nacht.
Solche glückbringende Bäche sind, trotzdem die vor vier Jahrzehnten in der Schweiz wütende Krebspest noch nirgends ganz verwunden ist, gä ng no ch der Twann-, der Lüscherzer-Mühli-, der Feisterhenne-, der Bibere-Bach. Wie aber der letztere 1912 in Bern mit Chrẹbse eine kaiserliche Tafel besetzen half, wie ferner (z. B. 1581) «Grünvisch vnd kreps» zum landvögtlichen Aufritt zu Thorberg mitgehörten, so zierte weiland der Chrẹbs städtische Wappen. Die Stadt Nidau führte z. B. seit 1348 in grünem Felde pfahlweise eine silberne Forelle, die einen goldenen Krebs im Mụụl het. Seit 1485 bestehen beide Flußtiere frei nebeneinander. 1
Noch heute ist ein Twanner Geschlecht im Namen Krebs (Chrẹbs) gut vertreten. Der auch hier zugrunde liegende Zuname galt Menschen, welche chrebse. Das bedeutet zwar zunächst: Krebse fangen (s. u.), besonders aber (wenn auch nicht zu Tw.) bildlich: Mit Anstrengung aller Kräfte aus schlimmer Lage wieder in gedeihlichen Stand zu kommen suchen, wie unter zaable und spoore ein in hilflose Rückenlage geratener Krebs wieder u̦f d’Bäi z’choo trachtet. Ist solches dem Tier gelungen, 56 so schwimmt es unter kräftigen Schlägen mit dem ruderartigen Ende des Schwanzes seinem Versteck zu. Diese Bewegung vollzieht sich demgemäß nicht vü̦ü̦re̥tsi ch, sondern auffallenderweise hin͜dertsi ch, weshalb das bekannte Bild vom hin͜dertsi ch chrebse so vielfach auf üblen Haushalt (er gäit der Chrebsgang) und auf das Handeln nach veralteten Grundsätzen, das Sichversteifen auf überwundene Standpunkte übertragen wird. 2 Als fernere Bewegungsglieder arbeiten in bekannter Weise die Schäärine mit kräftigem chlemme zur Abwehr von Feinden und zum Packen der Beute, die, wenn nötig, zum Ertränken ’tünklet wird.
Ein so energievolles Tier ist (wie die Aale, Steinbeißer u. a. Fische, S. 46. 59) sehr empfindlich für luftelektrische Entladungen. Daher die Redensart von einem, der eine Widerwärtigkeit verwindet: Er macht es G’sicht wi Chatzen u Chräbse, wenn’s donneret. 3
Bemerkenswert ist die Sorge des Krebsweibchens für seine wị̆ße, runden Eier und die aus ihnen ụụsg’schloffnige Jungen. Jene legt es im Herbst, und der ganz Winter du̦u̦r schleppt es sie unter dem Schwanze mit sich herum. Eben hier suchen auch die im Frühling ausgeschlüpften Jungen immer wieder Schutz, bis sie, vierwü̦chchig geworden, die zweite Häutung überstanden haben. Auf dieser Beobachtung ruht die bundesgesetzliche Schonzeit für Krebse vom 1. Oktober bis 30. Juni. Es verbleiben also für z’chrebse (s. u.), wenn dies nicht als Raubfischerei wott g’stra̦a̦ft sịị, lediglich Häumonḁt, Augste und Herbstmonḁt, von denen bloß der letztere einer der angeblich guete Chrebsmonate mit dem r ist.
Zur Zucht 4 eignet sich der Edelkrebs ( Astacus fluviatilis), dessen Spielart fontinalis 5 sich im Neuenburgersee findet.
G’fischet wird, um die Schläckmü̦ü̦ler ungezählter Fröschegnaager außerhalb des Seelandes z’g’schweigge (rechtsseeisch für: schweigen zu machen), auch die Rana esculenta (der «eßbare» grüne Wasserfrosch), nicht dagegen doch die Rana temporaria (das Wätterfröschli: der braune Gras- oder Laubfrosch). «Wí» (sehr) gönnen wir den harmlosen Hüpfern das vor ihrer Abschlachtung geführte frohe Leben, auf welches schon ihre Namen deuten! 6 Sie nützen es denn auch 57 nach Nooten aus, d. h. gehörig, wie «nach Noten» als Vorschriften der Stimmführung der Sänger singt. So stimmen Vorsänger und Chor der von abendlichen und frühmorgenlichen Frühlingslüften wohlig angeregten Fröscheschar ihr durch Jahrmyriaden alte Tradition streng programmäßig festgelegtes Konzert in Ur-Esperanto an: Breggeggee! breggeggee breggegee! ggoax, 7 tun! quarrr, breggeggee, tun! Breggeggee ggoax ggoax tun tun! Nidau und Müntschemier, welch letzterem Ort die früher fast «nach Millionen» zählenden Froschansiedlungen den Namen Fröschindie n 8 eingetragen haben, würden wohl nicht ungern auf manche dieser Gratisvorstellungen verzichten. Sie würden sich jedoch damit des Vorteils begeben, an mit Spätfrost oder Reif bedrohten Tagen schon vor deren Anbruch hören zu dürfen, es sig de hü̦̆t käi G’fa̦hr um e Wääg. 9 Übrigens gewähren die muntern Springer und Schwimmer dem Beobachter auch feine Augenweide. Diese klugen, muntern Augen, von guldige Ringe zierlich umrandet: wie erli̦cke und g’seh die vo wịtems den rotbeinig daherstelzenden Storch! Die Alten warnen die Jungen, und blitzschnell ist das Versteck erreicht. Aber sogar ethisch und politisch ist das Froschgeschlecht bemerkenswert. Wie nötig in kritischer Zeit, z’sämmez’haa wi Frëscheläich (Tw.) oder wi Fröschmolter (vgl. «Malte» unter «Wein»), wenn nicht wi Gịịgeharz!
Wirtschaftlich ferner lehrt der Frosch nid schnäderfrääsig z’sịị. Nu̦mmḁ Tootnigs nimmt er nụ̈ụ̈t; aber alls, was zablet, ist ihm recht: Fleuge, Mu̦gge, Chääfer, Spinnele, Schnägge, jung Mụ̈ụ̈s, freilich auch ganz jungi Fischli, Änteli, Räbhüenli, Wachteli, Leerchli.
Trotz ihrer Wachsamkeit gehen aber unzählige dieser Froschlurche ungenutzt, leider auch qualvoll, zugrunde. Zumal vor der Entsumpfung wurde z. B. in den Nidaumatte beim Häu mäie fast bei jedem Sensestreich eins dieser im Gras verborgenen Tiere ụụfg’schränzt oder sonst jämmerlich verhaue, und die mit dem drụsg’heie der armen Opfer aus dem von ihnen zu säubernden Futter Beschäftigten hatten oder nahmen nicht Zeit zu einem Gnadenstreich für die noch lebenden. Vollends ihren Winterschlaf aber büßen die Wasserfrösche z’Tụụsige, nachdem sie vor das breite Maul den schneckenschalenartigen Dechchel geschafft und sich in den Schlamm eingewühlt haben. Dann beginnt das frösche (s. u.).
Eßbar ist bekanntlich auch die bei Gelegenheit bis in Moosgräben 58 sich verirrende Teichschildkröte ( Emys orbicularia): die Schildchrott. 10 Mit «der Chrott» zusammengehalten bringt «die Schildchrott» uns i’ n Si̦i̦n, was die Mundart mit einem Worte wie «der Blindeschlịịch» fü̦ü̦rg’noo het. Es handelt sich nämlich um eine gute alt deutsche Stammbildung: der blint-slîcho, der blint-slîche ist (als Zusammenschreibung) «der blinde Schleicher». Die neuschriftdeutsche Zertrümmerung dieser Stammrückbildungsklasse (vgl. der Beck, Deck, Fürspräch analog l’envoi, il porto u. dgl.) brachte aber auch unser Wort in Form, Geschlecht und Deutung ins Wanken. Hierzu trat eine neue Benennung: der Blin͜desti̦i̦ch (Erl.), der Blin͜dsti̦chch (Tw.), welche die oder den « Anguis fragilis» 11 ebenso als «Schlange» hinstellt, wie der Aal ( Anguilla) ein Schlängli sein sollte. Die Schlange «sticht» aber nach uralter Anschauung, 12 also tut es auch der B lin͜dstich, nur allerdings ohne Schaden: «blin͜d». (Vgl. «blinder Lärm» u. dgl.)
Soviel als reinsprachlicher Anhang zum Kapitel vom Fisch als ääsiger Spịịs. 13
1
Taschb. 1904, 254. Das
Amt Nidau dagegen führt in weißem Feld eine rote Bärentatze. Ein steigender Fisch hinwieder zierte, wie zu erwarten, seit 1256 das Prioratssiegel der
St. Peters-Insel. War doch der Apostelfürst in doppeltem Sinn (Luc. 5, 1-10) ein Fischer. An Joh. 21, 1-14 aber klingt das Stehen Christi auf einem Fisch an, wie ein späteres Siegel der Abtei
St. Johannsen es darstellt. Man denkt dabei an die griechische Namenssymbolik, wonach die Anfangsbuchstaben des Titels
Jesŭs
Christos,
Thëŭ H
yós,
Sŏtër (Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser) sich zu dem Losungswort
ichthys (Fisch) zusammenstellen.
2
Z. B. in Christoph Salzmanns Krebsbüchlein mit den ironisch verkehrten Ratschlägen zur Kindererziehung.
3
Leuenberger, Heiraten 39.
4
Vgl. Asper 121/6; Ehrenkr. 288 ff.
5
Nach
Bourgeois-Petitpierre.
6
Sowohl
Frösch (mit s̆-Umlaut wie Äsche. Täsche usw.) aus Frosch, d. i. «Frogsch» (engl,
frog), wie auch
rana aus «
ra-cs-na» (
Walde 641), weitergebildet zu
raine und
ranacula, renallye, grenouille (
M-L. Wb. 7038) sind Schallwörter, die das Quacken nachahmen. Auch
la chanteraine ist «der Quacker». So ist auch
la reinette der «froschfarbige» Apfel.
7
Vgl. l.
coaxare, fr.
coisser, quacken und krächzen (
M-L. Wb. 2007).
8
Analog zu «Mostindien» (nach «Ostindien»).
9
Stauffer 62.
10
Wäre (s. jedoch
Kluge 268) die «Kröte» die singularisierte Mehrzahl von
«der Chrott» (wie Tücke von Tuck, Träne von Tran u. dgl.), so ließe sich «die Schildchrott» erklären als halb mundartliche, halb schriftdeutsch beeinflusste Form.
11
Die Blindschleiche
zerheit bekanntlich gern: lässt in der Hand des sie Ergreifenden den Schwanz zurück usw.
12
1. Mos. 3. 15 u. ö.
13
«Speise» gehört (vgl. «Glockenspeise», eine Kasse oder eine Versicherung «speisen») gleich wie «Spesen» zu it.
spesa aus
spensa, wie dies zu l.
expendere = spenden (eigentlich «auswägen», mit der Waage zuteilen).
Des Meeres Salzflut ist der meisten Fische Lebenselement; nur wenige bewegen sich in den Seen und Lachen, in den Flüssen und Bächen unseres Binnenlandes. Und einige Gattungen führen zwischen beiden Medien ein Wanderleben, das sie mit der Zugvogelwelt in wunderbare Parallele setzt. Flußauf zieht der Lachs aus dem Meer zum Laichen in bewegten Gewässern; junge Aalweibchen aber suchen ihre fünfjährige Kinderpension im Schlammgrund unserer Seen und Moore und Tümpel. Ihre Wiege dagegen ist des Meeres tausendmetrige Tiefe, die den glashellen, weidenblattähnlichen Urformen eine Wärme von zirka 7° und einen Salzgehalt von etwa 3¼ % darbietet. 1 Das alles finden sie schịịnts am schönsten im Sargassomeer südlich von Neufundland und östlich von Neuyork. Von dort treten die entwickelten Jungen im Frühling ihre erstaunlich weite, etwa 4000 km messende Reise quer durch 59 den Ozean bis zu uns an. Als fünfjährige Amazonen unternehmen sie die Spätsommerreise nach der Stätte ihrer künftigen Mutterschaft.
Zu solcher Leistung befähigt die Tiere ihre zum Anfassen g’schli̦i̦ferigi, aber durch ganz kleine ŏ́vali Schüepli derb gemachte Haut und die wie ein Motor wirkende eläkterischi Ladung des rudernden Schwanzes. Der soll einmal einem badenden Knaben es Bäi verschlage u d’s an͜dre g’lehmt haa. 2 Dazu kommt die bekannte Zääiji (Lebenszähigkeit) des Aals. Der Ööl isch nid z’tööde. Allerlei Mụ̈sterli, von der Phantasie g’hörig aufgebauscht, sollen dies bekräftigen: Von einem Fischotter verschlü̦ckt und ihm wieder entwischend, fahrt er nụ̈ụ̈n Mool du̦u̦r ị̈hn dụụre, selbst wenn ihm der Grin͜d ịịdrückt ist. Nach dem Schlitzen des Halses zum Abziehen der Haut ( ụụshụ̈ttle) in einem Ruck läbig g’schu̦nte, chrümmt er si ch noo, u der Chöchchi gu̦mpet er ụs der Schmụtzpfanne. 3 Alle Quälereien werden vermieden durch Zerschneiden der Schwanzarterie, wobei ein Vermischen des vergiftige Aalblutes mit Menschen- (oder Säugetier-) Blut zu verhüten ist, oder durch a’ n Bode schmättere mit aller Kraft.
Mi sött mäine, ein Geschöpf so großer Meerestiefe chönnt nid en Augeplick u̦ssert dem Wasser sịị. Ooha lätz! Ein gefangener und im offenen Fischkasten verwahrter Aal groogget dier, du wäisch nid wie, die nasse Schiffswand auf und plumpst ins Wasser zurück. Von einem Wässerli wandert er über Land in ein benachbartes anderes, nụ̈ụ̈t schöoners. Warum sollte er dann nicht, was ebenso oft behauptet wie bestritten worden ist, 4 zum Naschen zarter Pflanzentriebe Äärbs- und Haberblätze absuchen, bis das Hinstreuen von Äsche ihm den Beutezug unterbricht? Hundert Meter vom See weg fand man einen Aal im Staub verschmachtet.
Wie Aale, können anch Grundeln, Schleien und Brachsmen ’s mängi Stun͜d ohni Wasser haa (aushalten). Einfach auf füechtem Miesch oder nassem San͜d verpackt, transportieren Twanner Fischer sie mittelst der einstündigen Eisenbahnreise nach Neuenburg im Gepäckwagen. Steinbeißer und Labyrinthfische zieh der Oote n i der Luft, deren Mangel sie ersteckt ( S. 50). Empfindlichere Fische g’spü̦ü̦re wenigstens den Unterschied zwischen dem ihnen zusagenden milte, lööije (lääie) Zustand des Süßwassers und dem gewitterhaft topphäiße. Bei letzterm gi̦i̦ne (gähnen) sie, um sich vermehrten Sauerstoff zuzuführen, oder sie lassen sich vom Wellenschlag bụụtele (wiegen).
60 Zur Lebenszähigkeit mancher Fische kommt eine bemerkenswerte G’schịịdi. Der Ööl loot si ch zehme und frißt seinem Pfleger aus der Hand. Der Chaarpfe im Teich u d’s Guldfischli, die auch sonst ihrem Pfleger durch Gewandtheit, Schlauheit und Zutraulichkeit viel Vergnügen bereiten, kennen die Glocke oder den Pfiff, welche zum Futter rufen.
G’chööre si̦ dee nn? Nicht mit dem «Ohre», das unsichtbar im Hi̦i̦rni dem Gleichgewichtssinn dient und mit der Schwimmblase ( Blootere) in Verbindung steht. Wohl aber schlagen ( schlöö) die durch das Wasser gedämpften Schallwellen noch genügend stark an die dunkelfarbigen Stränge der beiden Seitennerven, welche als Empfindungsorgane für den wechselnden Wasserdruck gedeutet werden. 5 Schaarff dagegen g’seh die meisten Fische, indem ihr meist sehr großes Auge mit der kugeligen Linse hinter der flachen Hornhaut zum scheinwerferartigen Beherrschen eines kegelähnlich abgegrenzten Raumstückes eingerichtet ist. Geschulte Angler, die nicht bloß im Trüebe z’fische bigähre, hüten sich darum, ihren eigenen oder auch nur den Schatten des Gerätes in dieses Blickfeld fallen zu lassen.
Sehschwachen Augen (z. B. des Welses) kommen die der Schị̈epe (Tw.), Tschüepe n (Ins) oder (in M.:) Tschiepe n (Schuppen) entbehrende Haut, ferner die Lippen und die äußerst empfindlichen Barteln (der Schnauz) als Tastorgane zuhilfe. So bewegen sich mit ihren als Steuer und Ruder arbeitenden Feedere n (Lü., Ins) oder Flŏsse n die meisten Fische in ihrem Revier, in welchem sie sich wunderbar auskennen, vorsichtig und munter zugleich. Spiellustig ( sie ganggle n gäärn), aufmerksam und neugierig ( g’wun͜derig) eilen z. B. Karpfen nach jedem hingeworfenen Gegenstand, g’schaue n ’nḁ rasch, schnappen danach und gää n ’nḁ u̦mme, wenn er ihnen nicht behagt ( ku̦nfe̥niert, g’schmöckt). Bei Tage sehr scheu ( schụ̈ụ̈ch) und vorsichtig, entfaltet gegen Abend die Foorne n als Bachforelle ihre ganze Munterkeit. Sie läßt sich flußab treiben oder schießt wi n e n Pfịịl dur ch d’s Wasser nach einem verheißungsvollen Jagdrevier. Sie hat, gleich dem Karpfen, e n Chaibe n Schutz (Lü.). Das Revier überblickt sie mụxstill und lụụßet (lauert), bis ihr ein Kerbtier auf Sprungweite nahe gekommen. Jetzt schlägt sie mit der Schwanzflosse das Wasser, um [es] z’trüebe n und erhascht die Beute im Sprung. Bei der geringsten Gefahr aber schießt sie abermals wi n e Pfịịl durch die Hauptströmung des Wassers nach einem ihr bekannten Schlupfwinkel. Das ist 61 am eerste die von einem Rụ̈ụ̈schli (s̆s̆: rauschenden Wasserfall kleinsten Maßes) oder Läüffli: ausgenagte Höhlung, welche zugleich als Lauerposten auf unvorsichtig nahende Wịßfisch, auf Mücken u. dgl. dient. Solche beliebte Nähe eines Bru̦u̦del (Sprudel) hat der Rede gerufen, d’Foorne müeßi d’s Wasser g’chööre rụụsche, um am Leben zu bleiben. Der Fischer dagegen weiß, daß Forellen bis fünf Wochen lang in fli̦ßig gewechseltem Wasser als Gefangene leben — so zornig sie auch anfangs mit polterndem aapụtsche der Schwanzflosse an die hölzerne Gefäßwand Chrachch schlöö.
Die Salmoniden verfügen aber auch über äußerst starke Muskeln der Leibesseiten und des Schwanzes. Das sött mḁ chönne g’seh, wie Lachse und wie Forellen auf ihrem Zuge nach der Laichstätte (s. u.) Wasserfälle im Strom oder Fluß, Schlụ̈ụ̈se von Wasserwerken und Fischläitere von Elektrizitätswerken wie Hagneck und Kallnach ( Ins 227) als Hindernisse «nehmen». Z’eersch luege si das Zụ̈ụ̈g aa. De nn nähmme si̦ en Aalạuf, und schwupps! schlängge si̦ si ch empor zu einer Höhe, welche, senkrecht gemessen, volle zwei Meter weist und in einem Ggu̦mp von vier Metern erreichbar ist. 6 Dabei überschlöö si ch die Lachse und Forellen, weil sie mit dem Schwanz chrafte. Man sieht dies deutlich bei der Forelle am Angel. Da wehrt si̦ si ch und zablet und schnellt mit dem Schwanze gleich energisch, wie der Hecht es mit dem Kopfe tut.
Die Forelle verfügt auch über ein ungewöhnliches Geschick der Farbenangleichung an ihre Umgebung. ( Si änderet Faarbb.) In langer Gefangenschaft wird sie überhaupt mißfarbig gelblich, statt grüen (farbenfrisch) zu bleiben. Bei bloßer Berührung aber, ja schon bei Schrecken ( Chlu̦pf) und Angst erweist sie sich als das Chamäleon unter den Fischen. Bei Egli (s. u.) und Groppe steht es ähnlich; 7 und nur ein geschultes Fischerauge erspäht unter Seerosenblättern oder zwischen den Pösche (s̆s̆) des Moores den behaglich sich sonnenden Hecht.
Dieser allzeit schwi̦ttig Räuber frißt im Tag sịs äiget G’wicht. Darum macht er si ch hin͜der alls; sogar gegen badende Menschen und Roß schnappet er. Nur die Foorne ist noch rạubiger. Nach eigener Jagdmethode schlụ̈üft der Ööl mit seiner g’schli̦i̦ferige Hụ̆t in Uferhöhlen, hinter G’wü̦ü̦rz (Wurzelwerk) und jeglicherlei Schlupfwinkel, um Beute zu überraschen. Den Blicken und Brachsle kommen beim Verzehren der Nahrung eigenartige Chlemmzänd im Schlund zustatten.
62 Ihre Gefräßigkeit machte sie namentlich vor der Entsumpfung des Mooses zu dessen hochschätzbaren Sanitätswächtern. Mit all dem Ug’sụ̈fer (Ungeziefer) und g’fụụlete Zụ̈ụ̈g si die schön abg’fahre!
1
Goeldi 593; Dr. v. S. im Berner «Intelligenzblatt»; Ehrenkr. 200 ff.
2
«Weltchronik»
3
Brehm 743 f. Über bestialische
Schinterei durch Italiener:
Goeldi 594.
4
Asper 35; Ehrenkr. 211 gegen Floericke 44 u. a.
5
Schmeil 314;
Berdrow 1913 190; Naturw. Wochenschr. 1904, 871; 1903, 13; Ziehen, Psychologie 81; Richard Hesse, der Tierkörper (1910) 627.
6
Bärenwirt Laubscher in Täuffelen besitzt eine Photographie fliegender Forellen.
7
S. die Farbzellen bei Asper 7.
Für jeden noch so rạubige Fisch kommt aber einmal im Jahre die Zeit, wo er sich als Hungerkünstler auftut, und wo nicht einmal der Hecht bịßt (nach der Angel schnappt). Das ist die Zeit, wo d’Fisch uf e Läich gange, wo sie läiche.
Dies Wort entfaltet begreiflich im Fischerleben wie nirgends die Fülle seiner Bedeutung. 1 Es läichet ein zahlreicher Zug von Fischen der nämlichen Art und Gesellschaft nach den Stätten der Eierablage. Da ist vo Wingere alls brandschwarz, wenn die zu solchem Geschäfte am Uferrand des Sees du̦sse sịị. Ebenso wimmelt es von Albeli, von Brachsle, von Hụ̈ụ̈rlig. Hinter der Schar der Kleinen, welche zieh, sind aber die noch nicht oder nicht mehr laichreifen Räuber her, und das gibt dem Twanner Anlaß zu einem eigenartigen Wortspiel. Der Laichzug wird nämlich durch Einmischung des Schriftdeutschen zu einem «Leichenzug»: einer Lịịcht, und der in scharf abstechender Größe hinter ihnen her schwimmende Hecht, das isch der «Pfarrer» oder «Schu̦ lmäister», welcher, ohne Sprache, gleichwohl eindringlich genug der in höchster Spannung «lauschenden» Schar das Sterben nahelegt. Das Bild erinnert an das vom Egli als «Landvogt», dem auch sonst Jahr aus Jahr ein die kleinen Albeli u. dgl. respektvoll drei Schritt vom Lịịb blịịbe, um dennoch eins ums andere die Szene vom Hecht im Karpfenteich wiederholen zu lassen. — Endlich aber sind es die Lachse und die Forellen, welche mit ihrem so eigenartig auffälligen Springen ( S. 61) die Bezeichnung aller Fischeierablagen als Läich und läiche, Leich und leiche, Laich und laichen veranlaßt haben. Das konnte um so mehr geschehen, da andere Fische ihr Laichgeschäft 63 mit andern Spargimänter begleiten. D’Hechte und d’Brachsle z. B. schwaadere, daß mḁ ’s wịt umenand g’höört: sie pflochte oder pflatschen; und d’Wi̦ngere rede: sie tätschle oder schnappen schmatzend, während sie unter dem behaglichen Gefühl der Entspannung etwa über ’ne Stäi sträipfe, um der Unzahl ihrer Eier (s. u.) sich zu entledigen. Besonders drollig gäit daas beim Neunauge ( S. 46) zu: Am Laichplatze saugen sich die Weibchen an Steinen fest. Ein Männchen erfaßt sie am Äcke (Genick) und erhŭ̦dḷet si̦, bis sie ihre Tausende von Eiern ablegen. 2
Derlei Szenen lassen sich natürlich nur beobachten, wenn sie sich im durchsonnten Wasser einer Dü̦nni (Untiefe) abspielen. Hier läßt sich auch das Tun der Mä̆ni̦ne (Männchen, Milchner) beobachten. Man gewahrt z. B., wie einem Weibchen (der Rogner, in Ins der Roge̥ner geheißen) im Hechtenzug zääche bis zwänz’g der viel kleinern Männchen folgen, um die Befruchtung zu sichern. Bei den Äschen zangget etwa äi Mani mit eme zwäite um die «Ehre», indes ein Knirps, von dessen darzue choo sü̦st bi wịt u fern käi Reed wär, sich tĭ̦fig zueche macht, um die Rolle des tertius gaudens zu spielen.
Und an diesem tĭ̦fig hängt der ganze Erfolg des Läichs: der Eierlage und dessen Produktes: des «Geleges». Denn in weniger als einer Minute werden die Eier zur Befruchtung untauglich und gehen dann zugrunde. Darum mißra̦a̦tet zumal die natürliche Forellenzucht allermeist. Gleichsam im Ggalopp vollzieht sich auch die Entwicklung der Embryonen. Coregoneneier z. B. g’schwallen ụụf nach einigen Stunden, 3 und in kurzem sieht man die bloß aus Chopf u Sti̦i̦l bestehenden Fischchen ụụsschlụ̈ffe. Forellen brauchen längere Zeit: je nach der Temperatur des Wassers 30 bis mehr als 60 Tage. 3a
In der für die verschiedenen Fischgattungen so ungleichen Laichzeit vereinigen sich die besten Daseinsbedingungen für die Brut und die mageri Zịt für die Alten. Die natürlichen und die von früherer Gesetzgebung als Schontage festgesetzten Laichzeiten 4 sind in der Hauptsache die folgenden: Die Foorne laicht zwischen Michistag (29. September) und Näüja̦hr; der Pfäärit und der Chropfer vor em Näüja̦hr (nach früherer Meinung jene vierzeeche n Tag vor u no ’m Martistag); die Balche vo z’mitts im Wịịmoonḁt bis ụụsgänds Wintermoonḁt. Im Meerze und Aberelle läichet 64 der Äsch, 5 der darum im Herbst am besten isch. Als Meerzehecht nimmt der Hecht seine gewöhnliche Laichzeit im Aberelle (April) vorweg. Im April, wenn d’s buechig Laub fü̦ü̦rechu̦nnt, chämme d’Egli draa, welche ausnahmsweise durch die Eierablage nichts am Wert des Fleisches verlieren. Im April und Mai, wenn d’Wịßtanne blüeije, laichen die frühesten Summerläicher: d’Wingere und d’Nase, im Mäie u Brachmonḁt d’Blaggli und Brachsle, d’Baarbe und d’Salụtte. Im Juni tun dies die Schleie des Teiches, zu Ende dieses Monats d’Albeli (Blääülig), und ebenfalls, wenn d’Räbe blüeije, die alsdann am leichtesten zu fangenden Aale.
Wels und Trüsche legen ihre Eier z’Milione, Barsch und Karpfen und Hecht z’Hunderttụụsigwịịs, auch Forelle und Lachs gäng no bis zu fü̦fezwänz’g Tuusigi. Aber wo chämme die Äier alli hi̦i̦? Selbst die größte Sorge für die Brut schützt ihre Großzahl nicht vor dem verdeerpe, obwohl zu deren Schutz Erstaunliches geleistet wird. So sehen wir die Bachforelle durch seitliche Hiebe mit der Schwanzflosse den grienige Bode zu einem Näst zurüsten; ja die Seeforelle schafft sich eine Grube, wo n e Maa chönnt dri li̦gge. 6 Das Stichlingmännchen baut und deckt ein wirkliches Nest mit Wurzelfasern (s. u.). Der Groppemani wählt sich unter Steinen ein Loch aus, das er ingrimmig verteidigt selbst gegen Feinde, wo vil stercher sịị weder äär; we nn’s sịị mueß, bis in den Tod. Vier bis fünf Wochen lang schützt er so hingebungsvoll die Eier des Gropperögener. Dagegen könnten die Foornemanine die sich entwickelnden Eier talpiochtig schädigen. Die übermächtigen Weibchen jage si̦ drum alli furt bis an äis, das mit Gestalt und Gehaben Gnade gefunden hat. Beiderlei Karpfeneltern hinwieder bereiten den Jungen mit sichtlicher Sorge das Winternest. Äschleich wird in Menge von den Barben aufgefressen. Der Äschmani aber vergreift sich sogar an der eigenen Brut.
Es sind also widrige Naturverhältnisse, welche den allergrößten Teil der Fischbrut löö z’nụ̈ụ̈te goo und bei den Edelfischen zum wohlerwogenen Eingreifen (s. u.) auffordern. So vornehmlich bei den Forellen, welche mit ihrer Eierablage nid i paar Tage fertig sịị, sondern lang dra (u̦mme) mache, lang darmit z’tüe häi. Si legge z’acht Tage wịịs von enand, weil sie — gleich den Lachsen — die Eier na̦ ch der Rịịffi aus dem geschlossenen Sack in die Bauchhöhle gelangen lassen. Hol’ der Kuckuck solches Warten!
1
Vgl.
Kluge 276. 284;
mhd. Wb. 1, 958 ff.;
schwz. Id. 3, 1009-1013;
Lf. 41. Zugrunde liegt die Bedeutung hüpfen, springen, tanzen (got.
laikan, mhd.
leiche liech gedeihen) und Sprung, Tanz (got.
laiks, mhd.
leich: Tanzlied, dann: Gesang von ungleichen Strophen). So ist das als «Wetterleuchten» umgedeutete
wätterläiche und der
Wätterläich der am Horizont «hüpfende» Blitz der Mythologie. Wie aber die modernen
Tanzsuntige bloß auf bestimmte Zeiten fallen, so auch die alldeutschen Leiche, und es schreibt sich daher die als
saison zu übersetzende Bedeutung der Ernte- und Genußzeit gewisser Naturgaben: es ist (oder wir sind im) «Chi̦i̦rschileich». «Ärdbeerileich» usw. Zum Vergnügen gehört ferner zahlreiche Beteiligung, starke Geselligkeit: ein
z’säme läiche, mi läichet mit der und der Person oder Gesellschaftssorte.
2
Goeldi 597.
3
Wie die Darstellung der Lebensalter bei Wirt Brenzikofer in Nidau es veranschaulicht.
3a
Heuscher im Geogr. Lex. d. Schwz. 1, 733.
4
Lieb. 128
5
Dessen gesetzliche Schonzeit jedoch vom 1. März bis 15. Mai dauern soll.
6
Brehm 536.
Gewisse Fischarten werden nach ihren Entwicklungsstufen verschieden benannt. Als vermeintliche solche Stufen betrachtete man in Lü. die Platte und Brachsle ( S. 52). Wirkliche solche stellt dagegen der Flußbarsch dar, obwohl auch sie — wie bei der Äsche des Bodensees 1 — sich bloß auf Leibesgröße, nicht — wie beim Aal 2 — auf Leibesgestalt beziehen. Der erst hụ̈ụ̈r (heuer, dies Jahr) aus dem Ei geschlüpfte Barsch ist der Hụ̈ụ̈rlig. «Gebachen Hürling» (1650) füllten die Hụ̈ụ̈rlibụ̈ụ̈ch der Lüscherzer alter Zeit, die sich noch nicht zum heutigen Wohlstand emporgearbeitet hatten ( S. 43 f.). Unter den zahlreichen Übertragungen 3 finden wir eine eigentümliche aus dem Jahr 1699. 4 Da hießen «Hürlig» die nach dem «vßmäßen» auf dem Kornmarkt zu Erlach in der Bü̦tti verbliebenen Getreidereste. Der Hụ̈ụ̈rlig heißt anderwärts «der Bụtz» (gleichsam der Nästbụtz, der als Letztgeborner no hin͜der drịị choo isch).
Der Heürling «oder» das Eggli, hieß es 1727, sollte zu fischen erlaubt sein «außert den Tausend Mägetli, so von allerhand gattung fischen harkommt». 1777 galten Hürlig und Tausendmägetli als «der Samen von den meisten Fischen», die zu fangen also verboten sei. Schon 1411 werden die Tausend Mägetli in der Murtener Fischerordnung erwähnt. Über den Namen lesen wir 5 die Erklärung, es stecke in ihm die bekannte Übertragung des «Backfisches» als des vor seinen «tausend» Wochen stehenden «Mägetli», was im eigentlichen Sinn das Tischgebet des St. Galler Abtes Ekkehard IV. (Ende 10. Jhd.) verstanden habe: Gott, segne uns (auch) die tausend kleinen Backfischchen! ( Millia coctorum benedic Dee pisciculorum.) Der Hụ̈ụ̈rlig gibt (Tw., Lg.) seinen Namen auch an junge Menschen ab. Er erwächst zum Chnụ̈sserli, Chnịsserli (Tw.) und Chnụ̈sser, Chnịsser (Tw.), dessen Name sich im menschlichen Chnụ̈ụ̈ß und Chnụ̈ụ̈ßer als vierschrötigem Burschen, 6 wohl auch in den Eigennamen Knüsli und Knaus widerspiegelt. Ungefähr dasselbe bedeuten die Grŏ́bee und die Si̦i̦ze̥ni (als Plurale tantum zu M.), sowie das Chri̦tzerli, der Chri̦tzer (Lü., M.), der bereits die Schärfe der Flosse durch chritze zu fühlen gibt. Vollends nach der scharfen Spitze ( acus, vgl. aiguille usw.) dieser Wehr benannten sich das Halb-Eegli (wie man in Tw. allerdings bloß «u̦s Schindlueder» sagt) und das Eegli als ausgewachsener Flußbarsch. Prächtig getigerte Egli tummeln sich in Scharen zumal um die verschiedenen 66 Egliplätz und namentlich die Eglistäine des Bielersees: Findlingsblöcke, die gegen stürmische Wogen und kalte Strömungen bei niedrigem Wasserstand einigen Schutz gewähren.
Wie ausgiebig an solchen Stellen der Eglifang zumal im Juni, nach Verfluß der Schonzeit wird, zeigt der Anblick von mehr als zwanzig Wäidli, aus welchen an den vom Wetter begünstigten Sonntagsmorgen nahe und ferne Seeanwohner ihre Angelruten strecken. Die meisten dieser Fahrzeuge markieren mit ihrer geraden Linie die etwa 1 km lange und 1 m breite unterseeische Fortsetzung der Bielerinsel gegen Osten hin, welche in lokaler Sprache di Aạuele geheißen wird. Vergleichbar den «Röötelichlötze» des Ägerisees, setzen sich solchen Untiefen als Ausstrahlungen der Insel mehrere Eglistäine auf. Diese sendet einen solchen gleichsam als «Vorgebirge» gegen Twann hin. Einen zweiten nahe dem Neuenstadter oder Schaffiser Damm gestaltete mittelst eingehauenen Trittes am 27. Oktober 1784 der Knecht des Inselpächters Engel zum damaligen Wasserstandsmesser. Ein gewaltiger Eglistäi ragte auch bei Erlach aus dem See heraus. Er mußte 1884 dem modernen Verkehr weichen: er wurde als Schiffahrtshindernis g’sprängt.
Als g’hụ̈ụ̈sleten Eegel bezeichnen Inser den Blutegel ( Bluetsụụger). Um solche Tiere in possenhafter Verwegenheit sich an die blu̦tte Bäi zu locken und dann unter hilfesuchendem brüele wieder abz’rịịße, häi albḁ d’Bue̥be i de Glu̦ngge ’pflotschet (Tw.), g’flochtet (Ins) oder g’flotschet.
1
Vgl. Kreßling, Bollauge, Knab, Iser, Äschling, Mittler, Brandäsch im
schwz. Id. 1, 565.
2
Vgl. «Glasaal» b.
Brehm.
3
Schwz. Id. 2, 1585 f.
4
EB. A 285.
5
Jud 34 nach
Gazette de Lausanne 28. Juli 1902 (F. A. Forel).
6
Schwz. Id. 3, 761.
Me het doch o si liebi Not
U mues ihm’s um si’s täglich Brot
Mängsmoole suur lo werde!
Doch brächte mier di Fisch no gern,
Ihr Hereliit, zu n eich go Bern,
Wenn iehr geng ordli tätet.
Triische! Fääret! Alböck! Fääret!
Wi mänge Maa i Sturm u Wind
Mues für sis Wib u sini Chind
Si Lib u Lebe wage!
Jetzt regnet’s u jetz stürmt der See;
Mi mäint allwil, jetz isch es g’scheh!
. . . . . .
Triische! Fääret! Alböck! Fääret!
Jo, seligs isch fir gwiß käi G’spaß,
We mier mit G’fohr so mied u naß
Dur Sturm u Wälle fahre!
Ier ässet d’Fisch u dengget niit,
Was mier, mier arme Fischherliit,
Darfir häi mieße liide.
Triische! Fääret! Alböck! Fääret!
U chemme mier derher go Bern
U mechten iisi Filschli gern
Um billigs Geld verchauffe,
So märtet mängs so hert mit iis!
Der Tiitschel mecht eich uf die Wiis
D’Fisch foo u here chrääze!
Triische! Fääret! Alböck! Fääret!
67 Doch wohr isch wohr, i säge niit
’s git o no bravi Hereliit,
Die n iiser si erbarme.
Si zahle, daß mer z’fride sii
U gään is z’ässe d’riber ii.
Gott well ’ne das vergälte!
Triische! Fääret! Alböck! Fääret!
1
1
Gottlieb Jakob Kuhn 1775-1849. (S. u. a. seine Biographie von Georg Langhans im
KJb. 4, 110-141 und von Romang in d. Bern. Biogr. II, 455 f.) Der zu Sigriswil seine Laufbahn beginnende «Schulmeister», Pfarrer und Volksdichter schaut über den Thunersee (mit dessen auch dem Bielersee beigeleglen «Aalböcken», vgl.
S. 50) teilnahmsvoll hinüber zu den einen schweren Daseinskampf führenden Fischhändlerinnen im Bereich seines Amtsgenossen, des Dichterpfarrers
Molz in Biel.
«Fischen» — was wird nicht alles g’fischet! Aus einer verworrnen Menge von Personen, Dingen, Gedanken das Gesuchte mühsam herausfinden heißt: es ụụsefische; man fragt verzweifelt: Wi will mḁ jetz daas ụụsefische! Man fischet Kumplimänt, indem man sich zu fünfzig Altersjahren bekennt, aber zuvor vierzig raten läßt. Man fischet Gold aus der trüben Flut des Massenelendes, wie die raren Brocken aus der dünnen Wassersuppe. Man fischet aus einer Flüssigkeit, was nicht zu ihr gehört oder länger gehören soll.
Und so spricht man ohne das Gefühl einer Übertragung z. B. von der Krebsfischerei, welche freilich in der Mundart chrebse heißt. Man chrebset auf elementarste Weise, indem man ohne Furcht, g’chlemmt z’wärte, mit de Fingere in das vermutete Versteck der Krustenträger langt. Wer aber das im Augste duet, zieht eine Menschenhand heraus! Als vor der Entsumpfung der See auch Krebse barg, wurden sie mit der Fischgabel aag’stoche. Weniger quälerisch werden sie mit Läbere wo aazieht, (nach Aas zu riechen beginnt), angelockt und gefangen. Am obern Ende einer in den Bachrand gesteckten Rute in eine Spalte ịịg’chlemmt, löökt (Tw. lëckt) der Köder das gierige Tier, das nun an jenem mit de Schäärine b’hanget. Läßt es sie doch fahren, um den Boden zu gewinnen, so fallt es in das untergehängte Schnellbäärli und wird vom «Fischer» als dem Nachfolger des frühern Chrebsmannli in Empfang genommen. Zuweilen wird der übel duftende Köder in e Weedele (Reiswelle) ’too; die lüsternen Krebse kriechen hinein und werden z’samt der Weedele useg’noo.
Auf andere Weise fröschet (s̆s̆) der Fröscher oder der Fröschemaa aus Lüscherz und Gerlafinge (eine Tochter eines solchen diente als d’s Fröschemaaiji̦ zu Twann), wenn nicht sogar aus 68 Poortu̦bank ( Port Alban) u̦f em Bäärg (Tessenbärg) und anderwärts i de Mööser. Mit dem engzahnigen Fröscheräche haaggle sie die Schläfer ( S. 57) aus den Gräben und stecken sie in den umgehängten Fröschesack. Daheim werden die (noch nicht erwachten) Tiere in e Zü̦ber voll Wasser ụụsg’läärt. Wer sodann nicht ein Scheusal von Tierquäler ist, schloot die ausersehenen Opfer an der Züberwand z’Tood oder schneidet ihnen den Kopf ab, bevor er ihnen di hin͜dere Schänkel (nicht bloß d’Bäi als die Unterschenkel) abschi̦i̦rt. Was von diesen Froschschenkeln nicht an private Besteller abgeht, wandert zum Comestiblehändler. Bei diesem gibt es eine Mathematik, die kein Professor lehrt. E Fröscheschänkel wird erst als Profit voor ewäg g’noo und dann kommen (wie beim Pfärit, S. 91) auf den Vierlig (d. i. ein Viertelhundert) 26 Stück. Die gelten zu normalen Zeiten achtz’g Rappe bis es Fränkli zwänz’g. Die sachverständige Chöchchi aber bra̦a̦tet (brät) die allenfalls mit Mähldäigg angereicherten Höösli so chru̦spelig (knusperig), daß z. B. an Inser Wịịstäigerige auch Einheimische sich mit dem G’schläck befreunden. Den übrigen Kadaver lassen sich Italjäner schenken, falls er nicht doch lieber brüeijt de Söü g’fueteret wird.
Allzu starkes möösele macht die in warmer Zeit gefangenen Frösche ungenießbar. Sonst ließen sie sich trotz ihrer Meerkigi ( S. 57) auch angeln, wen n am Angel es roots Lü̦mpli um enan͜d fländerlet.
Ein eigentliches fische von Fischen, aber ein wildes, übten ehedem junge Moosbụtze. Ihre Kunst war ein foo vo blooßer Han͜d, ein verwü̦tsche und erp’haa mit de Fingere, wozu allerdings der Tölpi, der tolpig (Tw.) oder tolpe̥dig (Lü.) Tollpatsch unfähig war. Galt es doch dabei, den ụụfg’jagte Fische jeglichen Rück- und Ausweg mit Stäine z’vermache und die z’beedne Hän͜d erhaschten ụụsez’schlängge (Ins), ụụsez’schli̦ngge (Tw.).
So wurde vor der Entsumpfung durch Bueben im Moos g’fischet. Dert het’s gäng öppis g’gää z’foo, zumal nach starkem Zurückweichen sehr hohen Wasserstandes. Da ließ sich dünn fische: in dünnem, d. h. seichtem Wasser. Und zwar sogar uf Hẹchte z’fische gelang ohne jegliche fachmännische Ausrüstung; warum denn nicht ụf Ööle, Schleie, Chaarpfe, Hụ̈ụ̈rlig. Hilflos blieben diese, aus dem normalen See ins Moosbereich geschwemmt, in den Glu̦ngge liegen und gingen (etwas kriegssprachmäßig z’vollem Mụụl g’säit) «z’Miliarde» zugrunde, wenn niemand sich ihrer «erbarmte». Da fuhren denn Buebe mit Misthu̦u̦rde (die Misthuurd: 69 die aus zwei Balken und quer darüber genagelten Brettern bestehende, abnehmbare Brü̦̆gi eines Düngerwagens) von Tümpel zu Tümpel und holten aus den Gieße (ablaufarmen Buchten) ganzi Hu̦tte voll der leckern Beute. Nachdem sie solche b’bään diget (durch Töten «gebändigt»), ward auf dem nächsten trochene Blätzli gesotten und gebraten. In die Beutezüge teilten sich aber gelegentlich die Moosheuer ( Ins 163 f.). Ihnen fiel dann an Hechten der Löwenanteil zu, und in heißer Asche b’bra̦a̦teti Härdöpfel gewährten trefflich mundende Zukost. Solche ersetzten sich die Jungen durch aus dem Nest gehobene, noch nicht flügge Chraäije. Die sị drum gar chäibisch guet. 1 Und das « à la guerre comme à la guerre» kam dabei aufs feldmäßigste zur Geltung. War keine Pfanne zur Hand, so tat’s eine alte Schoorschụụfle (Grienschụụfle) auch. Und hatte einer, der heute a sị’m Chehr Späck herbringen sollte, keinen zu ergattern vermocht, so markierte wịßi Chrịịde den Schmu̦tz (das Fett). Het’s welle bränte oder o nu̦mmḁ scho bräntele, he nu, so het mḁ Wasser dra g’heit. Zur Feuerung diente bei Holzmangel dü̦ü̦r re r Chüeblätter. (Der heißt geleckter twannerisch die Chïedeische, s̆s̆.) 2

Der kleine Fischer
(Knabe Gaßmann in Erlach)
die Beute stolz präsentierend
G’metzget, d. h. ụụsg’noo und b’butzt, wurden bei solch freiwillig militärischem Vorunterrichte kleine Fische wie die Hụ̈ụ̈rlig selbstverständlich nicht. Auch die Döörn (d’s G’gräät) brachten weder Beschwer noch Not; die wurden unter äxbräß recht lautem chrachche mit de Zän͜d verchnätscht. So schmeckten sie nicht weniger gut, als 70 vormals den Twanner- und Insel-Gästen am letz̆te Herbstsu̦nndig die z’Chörbe-wịịs gefangenen und b’bachchne oder b’bachchete Hụ̈ụ̈rlig. Den Moosg’schmack (das möösele) der Schleie aber het mḁ gar nụ̈ụ̈t g’achtet.
Auch Berufsfischer teilten sich — waas su̦st? d. h. selbstverständlich — in die Beute und brachten, wenn nicht mehr ganzi Chäär re voll, doch ganzi Chöörb voll Hechte nach den Städten. Die Riesenräuber in Moostümpeln zu fangen, lehrten sie hinwieder gelegentlich die jungen Moosbụtze. Es galt, dem Hecht ein Säili nach Art des Llasso umz’wäärffe, 3 nötigenfalls — das flótschnaß werden nicht achtend — es blitzschnell und un͜derdu̦u̦r z’zieh und das Tier ụụsez’schläipfe (Tw.) oder ụụsez’schläike (Ins).
Eine Reihe wildernder «Brootnịịdere» sind durch das Gesetz mit Bußen (bis auf fünftausend Franken) bedroht. So das schieße auf Hechte. Das ist freilich, wo das Wasser die Stoßkraft der Chru̦gle oder des G’schrööt zu sehr ablenkt und abschwächt, kein erschieße, sondern nur ein sturm mache des Tieres durch den krachenden Schu̦tz, den erregten Wasserstrudel und die Erschütterung durch den rasch sich fortpflanzenden Wasserdruck. Der Hecht liegt, betäubt, hilflos uf em Rü̦gge. Schwer bestraft wird natürlich das Hantieren mit Dynamit, aber auch das Fischen mit der Doggeliwang. 4 So heißt um Biel ein Teigpräparat aus Brot, Käse- und zerriebenen Kokelsnußsamenstücken, welches die es verschluckenden Fische betäubt. Sie chämmen ụụfe und drääije si ch wi ’ne Chatz, wo sich i’ n Schwanz wott bịße.
Verboten ist ferner das stäche (besonders von Forellen) mit dem Ger, wie es vormals im Moos zwischen Gampelen und dem Neuenburgersee 5 massenhaft geübt wurde. Statt dieses kurzen Spießes bedeutete «Ger» später 6 die (nun ebenfalls verbotene) vier- bis sächszinggigi Fischgable, la foëne oder fouëne (aus l. fuscina, Dreizack), 7 71 in S. la ffoĕ́myǝ. Bei Twann aber fand man neben acht Fischergeräten aus Eisen und Blei, sowie einem Schifferstachel, drei Fischharpune (in S. búkyār) aus dem 16. Jahrhundert. 8 Eine Art Fischgabel war auch das Groppenịịse. 9 Knaben bedienen sich beim groppe einer Äßgable. Damit spießen sie Fischlein an, die dann als Aaschlag am Setzangel größere Beute heranlocken sollen.
1
Adverbialisierter Zwischengedanke: Ich sage das «darum», weil...
2
Spezialisierungen des gr.-lat.-germ.
discus (Wurfscheibe); vgl.
M-L. Wb. 2664;
Kluge 459.
3
Favre 130; Ehrenkr. 204 ff.
4
Aus dem Morgenland (der Levante: dem
levant du soleil) stammt der
coque du levant: der
cocculus indicus. Der gr.
kókkalos war der Samenkern der Pinie (des Kieferngewächses
Pinus pinea); der
cocculus aber ist die Kokelsnuß, welche in Indien zum Vergiften von Krokodilen und Wölfen dient. Als Fischgift gefährdet sie auch Menschen durch Genuß der mit ihr betäubten Fische, die man nicht sofort nach dem Fang
ụụsnimmt. Als solches Betäubungsmittel in seiner Form einigermaßen an die keltische
toc (Mütze) und die frz.
toque (
M-L. 8763) erinnernd, wandelte sich der
coque du levant um zur
toque oder
doque du levant, und das Bielerische gestaltete aus ihr glücklich
die Doggeliwang. (Witschi nach einem Vortrag von Dr. L. Pittet in Freiburg über die Kokelsnuß.)
5
Daher der Fund aus dem 17. Jhd. im
MZ.
6
Vgl.
schwz. Id. 2, 400 ff.
7
Bei
M-L. 3610 auch: Harpune; afrz.
foisne Heugabel, npv.
funo Aalgabel.
8
MZ: Anz. N. 7, 51.
9
Schwz. Id. 1, 539.
Wie die Harpune bereits altsteinzeitlich ist, findet sich in der neueren Steinzeit 1 die Angel oder der Angel (Mehrzahl z. B. 1843: Ängel), in S. la trēna, als Hauptwerkzeug des Fischfangs gebraucht. Er bestand aus Hirschhorn oder Fụ̈ụ̈rstäi, später aus Bronze, wie nunmehr aus Eisen. Gleich dem ihn tragenden Pandoffelstück hängt er am Ha̦a̦r, genauer Roßhoor, welches fingersläng Stück älter twannerisch das Maarterpesch (s̆s̆), baslerisch der Maarterpescht genannt wird. 2 Der seinem Grundbegriff 3 gemäß spitz Angel (Verkleinerung aus altdeutsch ange, ango, l. uncus) trägt entweder — als Hoogge — einen glatten Spitz, oder aber ein, zwei, wenn nicht mehrere Wi̦derhööggli. An diese wird, wenn es — tierquälerisch — ein lebender Köder sein muß, nach welchem der zu fangende Fisch schnappt oder bịßt, ein Wurm oder ein Richtfisch (Setzfisch, Setzlig) gespießt: g’setzt. D’Wü̦ü̦rm oder Wü̦ü̦rmli lassen sich buchstäblich, wie Armeen bildlich, aus der Erde stampfen, wenn sie nicht i der Nessi und Chüeli von selber obenụụf chämme. Die Erschütterung des trockenen Bodens scheucht sie gleicherweise aus ihrem Versteck hervor, wie das Rasseln der Ankerkette im Fischerkahn, das Peitschen des Wassers mit Rudern oder Stangen die Fische ụụfjagt. Es läßt sich daher bei jeglicher Witterung kurzerhand befehlen: gang räich Wü̦ü̦rm! Auf den angespießten Wurm z’speue ist eine chemisch 4 erklärliche List, ihn als Lockspeise noch begehrenswerter zu machen. Von den Köderfischen, deren jeder für den Fang einer bestimmten Speisefischart guet ist, war im Mittelalter der lebende Gụ̈tsch mittelst der Strafe des Hand abhạue ausgeschlossen. Jeglicher lebende Fischköder aber wurde 1715 in Bern durch Buße von 20 Pfund verpönt. Man war also schon damals an den 72 künstlichen Ersatz gewiesen, dessen Herstellung heute mit erstaunlicher Naturtreue gelingt. 5 Da gibt es täuschend ähnliche Fläüge, Mụgge, Häügü̦mper, Mäiechäfer usw., und gibt es Wi̦ngere, Hääsel, Aalet, Chni̦sser usw., welche übrigens wegen ihrer Tụ̈ụ̈ri von handfertigen Fischern sälber g’macht werden.
Diese die Angeln in oder hinter dem Leib versteckenden künstlichen Köder, sowie die angespießten natürlichen werden nun «vom sichern Bord» oder dem bergenden Schiff oder der Brücke aus in verschiedener Weise den zum Anbeißen eingeladenen Fischen nahe gebracht. Die älteste und gewöhnlichste Angelfischerei ist die mit der Zock-Ruete und der daran hängenden Angelschnur samt allfälligem Aufwindehaspel usw., deren Beschreibung sich erübrigt. Mit ihnen geht der Fischer zu Lü., Hagneck, Erlach usw. go socke oder zocke: den schnappenden Fisch mache z’zöggle, daß es e Juck gi bt. Es ju̦ckt äine n, i g’spü̦ü̦ren öppis! sagt der bisweilen «nach der Angel ruhevoll» Sehende, schlängget sein achtsam und kundig ụụfzognigs oder ụụfeg’hasplets Opfer u̦f d’s Trochene und kürzt mit raschem Tod sein Leiden.
Eigens eingerichtete Angelgeräte sind: der Otter oder der Hund oder d’s Mu̦ggebrätt. Dieses ist verboten. Warum? Nicht nur läßt es vi̦l z’vi̦l Mu̦gge verwenden; diese können auch mittelst der schwebenden Schnur so natürlich g’füehrt werden, daß das Gerät viel zu mörderisch ist, um geduldet werden zu dürfen. Erlaubt ist dagegen das — durch die Wasserströmung wie eine Flugdrache vom Ufer oder Schiff weg getriebene — Löffelbrätt. Es wird wie jenes geführt; allein, anstatt der schwebenden Mu̦gge trägt es einen einzigen Löffel an 30 m langer, über dem Wasser schwebender Schnur. Dieser Löffel oder das Löffeli ist mit einem oder mehreren Doppelangeln bewaffnet. Mit ihm löffelet der Löffeler. Das Gerät ist ein g’silberets, p’häärlmueterigs oder sonstwie gli̦tzerigs Schịịbli von der Gestalt eines länglichen Löffels ohne Stiel, dessen beständiges schraubenartiges si ch drääije oder spinne an der Schnur namentlich gegen Mittag und Abend ungewitzigte junge Hechte ganz ohne andern Köder ( amorce) zum bị̆ße anlockt.
Zum beständigen Sichdrehen um die eigene Achse eigens eingerichtet ist das Spinnschiffli oder der Spinner, das stadtbernische «Bụtzli». Dieser vairon métallique umschließt das Trụ̈ụ̈beli: ein System von zwei- und dreifachen Angeln, welches mit seiner sehr raschen Drehung dem Raubfisch Floßen vortäuscht. Die Drehung: d’s spinne 73 wird ermöglicht durch das zwischen Leine und Spinner eingeführte Drehgelenk: d’s Wü̦ü̦rbeli, l’émerillon. 5a
Undenkbar ist ohne lebende Richtfische an Angeln das schäuble mit dem Schäüblig, besser: Schäübli. Diese Verkleinerung weist auf die Urform des Schaub: des auf ruhigem See schwimmenden Strohbündels, an dessen heraushängenden Ködern sich Fische fangen, um an langer Leine herangezogen zu werden. Das Schäübli oder der Schäüblig ist nun freilich etwas ganz anderes: ein etwa fußlanges, hämpfeligs (eine Hand voll ausgebendes) Bündelchen Si̦mpeli oder Röhrli, will hier sagen: kleinfingerdickes Binseschi̦lf. Dieses wird ’tröchnet u g’färbt, um keine Nessi eindringen zu lassen, und zwar so g’färbt, daß die Art des Auftrages als Eigentumsmarke dient. Um das Bündel lịịret mḁn e Schnuer, die am einen Ende festgemacht ist, am andern freien Ende die ziemlich große, gewöhnlich fast rechtwinklige Angel trägt.
Neben diesem Schäubli handhabt der Fischer die Setzschnüer. Derselben gibt es drei Hauptarten. 1. Gü̦felischnüer mit vielen Gu̦u̦fe (Stecknadeln), in Abständen von 50 cm mittelst Schwänkel an der Hauptschnur befestigt. Sie werden ganz in der Nähe des Ufers gesetzt und dienen zum Fang von Köderfischen. Als Köder benützt man Wü̦ü̦rm. — 2. Öölschnüer mit oft mehreren Hunderten von Angeln, in einer Distanz von 1 m mit Schwänkel von 30 cm Länge an der Hauptschnur befestigt. Sie werden auf den Grund des Sees gesetzt. Köder: Kleine lebende Fische wie Gütsch, Albeli u. dgl. Gefangen werden mit Öölschnüer: Aale und alle andern Raubfische. — 3. Hechteschnüer (deren genaue Beschreibung zu weit führen würde) mit 13 oder mehr Angeln, auch Doppelangeln. Sie werden nicht auf den Grund gesetzt, sondern schweben frei. Köder: größere lebende Fische, wie Hasel, Winzer, Aalet. Damit fängt man Hechte und Forellen.
Die Art, wie man die Richtfische aamacht oder aaschla̦a̦t, ist allerdings eine brutal quälerische: die Angel geht unter der Rückenflosse und dem Kiemendeckel durch und langt zum Mụụl ụụs. Nun wird ein Stück des Fade (der Schnur) auf 2-3 Chla̦a̦fter abgli̦ịret und 74 ausgeworfen, das in der rechten Hand behaltene Stück aber ganz lose ( lu̦gg) zwischen zwei Röhrli des Bündels auf der Seite der ihn haltenden Linken ịịg’steckt. Nun scharf aufgepaßt! E Hecht bị̆ßt. Offenbar ein sehr schwerer; er mag bis 24 Pfund wiegen. Er schnappet nach dem Opfer, kann es aber natürlich nur vo hin͜de packen. Da aber kein Fisch einen andern dääwääg verschlü̦ckt, weil er ja an den voortsi ch gerichteten Flossen (namentlich eines Stachelflossers) müeßt erwoorgge, so chehrt unser Hecht seine Beute samt der Angel im Mụụl um und befördert ihn regelrecht in seinen Magen. Die Mitgabe schadt ihm nüüt. Sie wird nicht bloß in alle denkbaren Formen und Unformen verbogen und verknäuelt wie im Hühner- und Straußenmagen, sondern direkt verdaut, so daß das nach einer Weile geschlachtete Tier bloß noch ärmliche Rästeli aufweist. 6
Der Hecht lebt also söüliwohl an seiner Beute und schießt mit ihr un͜der dem Wasser du̦u̦r wi verru̦ckt. Die Schnur rollt ab. Lue g, wi’s rollet! Vorausgesetzt nämlich, daß sie ganz lose eingeklemmt war. Widerstand spürend, hätte der Hecht das Opfer unverschluckt fü̦re g’speut, es verbisse, g’schränzt dem Fischer gelassen und sich auf französisch empfohlen. Nun aber ist im Schnụtz (Schnụụß) der Schäüblig offe = es isch offe: die Schnur ist abgerollt. Sie wird vom Fischer scharfen Auges verfolgt. Durch die Bạumeler, gewöhnlich drei an der Zahl, wird bei der Insel die Maximaltiefe (sechs Chloofter) abgesteckt, in welcher das oben beschriebene schäuble noch Erfolg verspricht. An einem ziemlich schweren Stäi wird eine Schnur von sechs Klafter Länge befestigt, welche am obern Ende den Baumeler trägt. Dieser Baumeler ist e Wü̦ü̦sch Röhrli oder ein Stück Holz, welches baumelt oder bammelt (schwankt). 7 Doch des Flüchtigen goldene Freiheit ist eine kurz bemessene. Plötzlich ist der Widerstand da. Der Hecht zablet und zerrt mit aller Gewalt, bis er ermüdet und erschöpft ist und mit wenig Widerstand an der ụụfglịịrete Schnur sich heranziehen läßt. — Immer etwa zwänz’g bis drịß’g Schäüblig ( torchons) dienen, in ere Rẹie bi n enand, zu großzügigem schäüble.
Fischzüge im großen gewährt auch der Setzangel, bei welchem an einer bis 80 m langen Schnur zwei- bis dreihundert Angeln, ein- oder mehrfache bis zur Vierzinggangle, hängen. Man sprach in 75 diesem Sinne früher vom Hechtesatz, von den Hechtesetz. Ähnlicher Art ist das Zäumli.
Sehr einfach gestaltet sich der Fang des Aalet mit schwarzi (s. u.) Mụụlbeeri oder Chịịrße oder Zwätschge, an welchen versteckte Angeln hängen.
1
Hoops 1, 85 f.;
Lieb. 3.
2
Ein spanisches Glossarium (vgl.
M-L. 478) legt arab.
marr (Strick) zugrunde für holl.
an-marren (anbinden), frz.
amarrer, woraus die
amarre als Ankertau und Strick, Seil überbaupt. Daher (vgl.
schwz. Id. 4, 1792)
l’amarre de pêche, das
Maarterpesch, anderwärts (z. B. zu
Brenets) als
le mort al-pêche umgedeutet.
3
Kluge 10.
4
Man denke an die Alkalizität.
5
Vgl. die Tafeln in Katalogen wie z. B. von Henri Martin & Co. in Lausanne (1914); Ehrenkr. 26 ff.;
Pêche et Sport S.A. Genève u. a.
5a
Dieser
émeril oder
émerillon, it.
smeriglio (
M-L. 8043) ist eigentlich die Schmerle (
Nemachilus Barbatula:
Schmeil 297, 298), dieses dem Schlammbeißker sehr ähnliche, aber kleinere und im klaren, schnell fließenden Wasser sich sammelnde karpfenartige Weißfischchen, welches mit seiner Kleinheit den Zwergfalken mitbenannte. (
Kluge 405.) Auch
le vairon (véron) ist ein Fisch: die dem Flussbarsch verwandte, ihn aber an auffälligem Farbenwechsel noch übertreffende Elritze (
Leuciscus phoxinus,
S. 51, vgl.
Schmeil 305), deren Name an Aller und Erle erinnert (
Kluge 113); «
vairon» seinerseits ist mit «
varius» verwandt.
6
Bloß der edelmetallene «Ring des Polykrates» bleibt intakt.
7
Vgl. das Ablautspiel bammeln, baumeln, bummeln (schwankend, unentschieden, ziellos sich bewegen) und bimmeln (
Stucke S. 12 f.), neben bäumeln svw. taumeln (
schwz. Id. 4, 1253). Analog verhält sich
Schwänkel zu schwanken.
Um gleich eine Menge Fische dran zu kriegen, lockte man sie ehemals in trügerische Verstecke von Höhlungen der Uferwände. In Übung waren hierfür aller Gattig Weedele (Reiswellen) oder Gŏlerung ( golironds, collis 1 ronds), sowie (besonders um Landeron) die Heegli oder Zụ̈ụ̈n: mit Ruten umflochtene Schwiere. Einen Fischzụụn baute 1728 der von Neuenburgs Regierung begünstigte Kastlan und Zollner Clottu halb in die Zihl hinaus und verschlämmte damit den Moos-Entwässerungskanal, welchen die Gampeler, Inser und Galser durch den pré des Prussiens unterhalb der Zịhlbrügg in die Zihl geführt hatten. Das rief einen langen Streit mit der Landvogtei St. Johannsen hervor. 1a Die Berner stützten sich dabei auf die Vorschrift von 1480: Niemand hat Gewalt, die Zill In Gräben vß Irem Runss abzefüren (um zu fischen). 2 Der Nidau-Büren-Kanal wird zu ähnlichen Zwecken etwa mit Fächern: Faach, 3 Uferflechtwerken aufgewühlt, in welchem Unterschlauf suchende Fische sich fangen. Solche Fächer können als Grundform beweglicher «Fallen» gelten: des Fischerchorb (1587) und insbesondere des korbartigen berffou (S.): der Reuse oder Rụ̈ụsche. (Es gab 1533 in Twann ein Geschlecht Rüschenmacher. 4 ) Ursprünglich aus Rohr, Schilfrohr gefertigt, benennt sich diese riuse, rūsa, nach einer Schwesterform von «Rohr», die noch das ältere s statt r bewahrt. 5 Dieses Schilf wird nun weit besser durch Weidenruten oder Eisendraht und Garn ersetzt: es ist drohtig oder garnig. Es ist ein trichterförmig über Reifen gespanntes Netz, 6 das die herangetriebenen Fische aus dem Ịịschlupf in die immer ängger werdende Schlußöffnung lockt. So fingen alte Lüscherzer Trüschen in dem 1 m 76 langen, aus Wịịdli geflochtenen Golle̥rung, 7 wofür 1394 in Murten perfollet einsteht. Noch als fixe Rüschen begegnen uns 1775 und 1781 im Streit der Seeländer mit obgenanntem Clottu die in die Zihl hinausgesetzten. Sie mußten fortan in genau vorgeschriebener Distanz gehalten werden. 8
Mit der drohtige oder aus Garn g’fịloschierte (s̆s̆) Rụ̈sche nächstverwandt ist das Sackgarn: der Feimer, Feumer zum Herausfischen von Tieren aus dem Fischbehälter oder Netz. 9 Gewöhnlicher sagt man allerdings alttwannerisch und noch nidauerisch der Bääre, der Beere (Ins), die Behren. 10 Sowohl die gr. und lat. Vorlage, «die» pera (Quersack, Ranzen), wie auch der Gleichklang mit «die Bähre» (Tw.) und «die Beere» (Ins) als Bahre rechtfertigen die bei uns größere Geläufigkeit der weiblichen Artikulierung 11 unseres Wortes: die Bääre (neu Tw.). Allein Niklaus Manuel läßt eine Frage lauten: Was gemeinst du mit dem Fischerbeeren? 12 und vermittelt mhd. «der bër(e)» mit vorwiegend neuschweizerischem «der Bär(e)». Eine eigene Art Fanggarn für Gü̦tsch ist die Jagdbääre (Lü., Gerolfingen) mit den Flügeln zur Seite, dem Sack am Grund und dem stabartigen Stofer. G’viert, spitz, mit Reifen, mit zweene Bööge über d’s Chrụ̈tz und einer Stange als Handhabe versehen, ist die Schnellbääre oder das Blatt ( le carrelet) des heutigen Fischereigesetzes. Es legt sich flach ins Wasser. Zum Ausfischen der Fischtröög dient das Unterfangnetz ( l’épuisette), womit mḁ d’Fisch lü̦pft; es heißt mundartlich d’Schöpfbääre oder d’s Gäärnli, d’s Staṇggäärnli (Äg.).
Eine Drahtreuse als kleine Art Handschwebenetz war die « wate-luf». Die wate für sich war «eine Art Zugnetz ( tragula) mit einem Sack ohne Spiegel»; 13 der luf (Faden) erscheint auch im Wort «Har-laufe», 14 emmentalisch: der «Häärle̥f» (starker Zwirnfaden). 15 Die Zusammensetzung « wate-luf» begegnet uns 1548 und 1715 als Wartolf, 16 und der neunzigjährige Ägerter Lieni Hans sagte der Wartloff. Erleichternd spricht man heute das Waartle̥f, Waarle̥f. — In «Häärle̥f» aber steckt das nämliche Haar iSv. Flachs, 17 wie im Namen die Hääre. Das ist ein Jägergarn, insbesondere ein Vogelschlinggarn. 18 «Ich kumm dir 77 nit so wit in die hären!» ( I lạuffe der nid i d’Hääre, daß de̥ mi chaast i d’Hääre näh!) So lautet eine Versicherung bei Niklaus Manuel. 19
1
Der als Träger des Kopfs aus dem Rumpf herausragende Hals (vgl.
celsus bei
Walde 100, sowie der
Chällerhals usw. im
schwz. Id. 2, 1208) ist l. der
collus (col und
cou) und das
collum (col
sum:
Walde 176). Der it.
collo ist zugleich die auf dem Nacken getragene Last (
M-L. 2053) vgl. «kol-portieren». Die in der Speditions- und Kaufmannssprache vorherrschende Mehrzahl
colli (Gepäckstücke) verdrängte die Einzahl «
il collo» und nahm ihre Bedeutung auch in der frz. Entehnung «
le colli, le coli» an (vgl. der «Öpfel» usw.) Eine wirkliche Nackenlast ist noch die runde Reiswelle als
der Gŏ́erung.
1a
SJB. D 235 ff.
2
SJB.A 456.
3
Schwz. Id. 1. 638 ff.
4
PuTw.
5
Vgl.
Kluge 372. 376;
M-L. Wb. 7096 (
roseau).
6
Schwz. Id. 6. 1476/80.
7
Gleichsam frz. «
le colleron» als Nebenform zu
la collerette (Halsring), zu unterscheiden vom
Golirung S.
8
SJB. D 235. 251.
9
Allgemeiner: zum Herausschöpfen aus einem Behälter, speziell: Obenabschöpfen von Schaum oder Feim. (
Schwz. Id. 1, 825. f.) Abgefeimt,
abgfịịmt kommt so zur Sachverwandtschaft von raffiniert. Die Form mit «eu» ist modern «angezeigt» scheinende Entrundung.
10
Brehm 705.
11
Vgl.
schwz. Id. 4, 1453/8;
Lf. 39.
12
Papst 1615.
13
Mhd. Wb. 3, 537.
14
Schwz. Id. 3, 1142; vgl. Jud 45.
15
Lf. 384.
16
Vgl.
Waartsack aus Watsack (Gewandsack), Karnaal statt Kanal u. dgl.
17
Kluge 185.
18
Schwz. Id. 3, 1317 bis 1379;
Lf. 374.
19
Papst 1614.
Diese den Bielerseefischern unbekannte Hääre führt uns zu einer Trennung der See- und der Flußfischerei überhaupt. Es versteht sich ja von selbst, wie die ganz verschiedene Tieffi und Bräiti und der ganz ungleiche Zug ( Ru̦ngs) von beiderlei Gewässern es mit sich bringen, daß hier und dort der glịịch Fisch nid gä ng glịịch g’fange wirt. Reden wir zunächst von der Flußfischerei z. B. und insbesondere im Aare-Zihl-Kanal.
Da trat vormals an den Platz des Waarlo̥f oder Wartloff (welchen Namen das Bundesgesetz von 1888 im Art. 15 mit «Bäären» gleichsetzt) das kreisrunde, im Durchmesser 4 m große Spreitgarn oder Gloggegarn. Wie eine Zipfelkappe ( Zöttelichappe) aussehend, wurde es vom Schiff aus g’spreitet, um mit ihm die Egge und Gieße der Zihl abzufischen. Keine kleinern als zweipfündige Hechte, Forellen und Salme fängt man dagegen mit dem Stanggarn. Dieses bis 20 m hohe Großgarn, wie es auf dem See heißt, wird auf zweine Wäidlige in das offene Flußwasser hinausgeschoben. Zwei Männer lenken die Fischerboote, zwei andere halten die Stange. Durch Pụtsche, unter pụtsche ( pousser, pulsare) werden die Fische ins herunterhängende Netz gejagt. Fahrzeuge und Netze wurden früher durch Fischer wie Lieni-Hans ( Ins 539) 1 und Jöggi-Bänz ( Ins 543) sälber g’macht. Ebenso die mächtige Droogle ( S. 78), deren Entfaltung mehr als eine ganzi Stubeslängi einnimmt. Mit ihr werden H echte, Nase, Barbe, Äsch, Aalet, Schleie gefangen.
Eine senkrechte Wan͜d von 1 m Höhe und mehr als 6 m Länge mit quadratzollgroßen Öffnungen zeigt das Netzgarn. Der ober Rand wird besetzt mit ungefähr 1 dm langen Rindenstücken ( Flosse, Tw.) aus Saarbạum (Schwarzpappel) oder Fäälbạum ( Salix alba), welche Chlötzli oder Flosse (Lü.) ihn schwebend erhalten. Der un͜der Rand lạuft ụụs in den Fangsack, welcher behufs Versenkung mit flachen, dünnen Chi̦i̦selplatze (vgl. die emmentalische «Platzge» = Eisenplatte), bei Meyenried mit Aareblättli b’schwaaret wird, damit die Wandseite straff erhalten bleibe. Auf dem Neuenburgersee erreicht die Länge dieser Art von Droogle 35 m, die Höhe 7 m. Die Maschen 78 sind frühere Zolllätsche: sie sind von äim Chnopf zum an͜dere 3 cm weit. Früher durften sie viel ängger sein. Der Bau ist wi bi’m Groppiergarn (1442), der gropeyre, grópère ( S. 54).
Mit dieser seit 1881 im Neuenburgischen verbotenen Droogle konnte man, die Schiffe nach allen Richtungen drehend, fụ̈ụ̈f Zü̦ü̦g tue, ohni äinist der Anker z’lü̦pfe. So fing man Wịịzü̦bere voll di glịịchi Nacht. Denn bloß z’Nacht isch mḁ g’fahre: vom zää chni bis ḁm drụ̈ụ̈ (Tw.: drei) oder halbi vieri.
1
Dem wir auch hierin reiche anschauliche Belehrung verdanken; vgl. übrigens
schwz. Id. 2, 419. 426.
Zum Tagesfang fährt man auf dem Bielersee im Sommer ḁm fụ̈ụ̈fi, im Winter doch ḁm si̦bni mit dem Garn: dem große Garn, Schläik- oder Zuggarn, in Wort und Sache gleich der bereits erwähnten Droogle. 1 Als feinfädiges ( flächsigs oder bau mwo̥l l’igs) Riesengewebe stellen sich ihm zur Seite: das (zu tractus, Zug gehörende) «Trachtgarn», z. B. im Brienzer Vorort «Tracht» gebraucht, und das — vil z’tụ̈ụ̈re, auch gärn faulende — Spiegelgarn oder das Trắmai. Wie die Einfassung eines kleinen Spiegels nehmen sich an diesem tré-mail (trámail) die «Maschen»-Gewebe aus, deren viel längeres, engmaschiges Mittelstück von 30 (bis 38) mm Maschenweite dur ch ( trans, tra, tré) die beiden Seitenstücke schlüpft, welche viel weitmaschiger sind. Durch einige ihrer Maschen wird das innere Netz sackartig hindurchgezogen, und so entsteht ein Sack, in welchen die Fische ịịneschlụ̈ffe. Den Ausweg versperre sie sich selber, indem durch ihr zaable der Sack verlịịret, so daß manchmal der Fischer selber Mühe hat, das G’hü̦rsch zu entwirren. 2
Mit dem Trámai zu fischen war ehemals, mit zuerịtigem (z’sämerịtigem, sich zusammenziehendem) Lätsch Fische z’lätsche, ist 79 noch jetzt eine der verbotenen Fangarten. Gleicherweise war das zum Gütschfang sehr engmaschige «Groppiergarn» früher (z. B. 1777) verpönt. Es galt als Wildgarn (zum Wildern) oder als (an den Fischermäie, s. u., verpöntes) Mäiegarn. 3 Jakob Grimm (Schueljoggi) in Lüscherz führte das Trámai in der beschriebenen Beschaffenheit vor einigen Jahren auf dem Bielersee neu ein, während dasselbe im Aarekanal seit einem Vierteljahrhundert im Gebrauch steht. Er handhabt zur Winterszeit die zu solch feiner Knüpfarbeit eigens hergestellte holzige Nadle ebenso geschickt, wie er im Sommer kräftig das Ruder führt.
Verpönt waren früher auch das Stangegarn ( S. 77), Läitergarn, und auf Murtensee und Broye das unten mit bleiernen Kugeln behängte Rundgarn (in S. le filāryō, filardrion). Zugelassen waren dagegen dort um 1465 zwischen dem 20. April und Mi̦chistag (8. Mai) die Zịnne̥te ( zinetta 4 des Genfersees), und vom 20. Mai bis Michaeli das 750maschige revin, Rerwin. Noch arbeiten auf dem Murtensee: la cáffēra auf Chaarpfe; la gútzenēra ( S. 52), goujonière auf goujons, Gụ̈tsch. la páleiyōsǝ fischte palées ( S. 50), welche nun leider aus dem Murtensee verschwunden sind.
1
Zu
trahĕre, ziehen: die
traha und
trahula, trāgula, trāgala, (S.). Vgl. Jud 44 f. Eine mit Fischereirecht ausgestattete Siedelung heißt (z. B. bei Brienz) die «Tracht».
2
Der zweite Wortteil von
Tra-mai.
tré-mail, geht zurück auf l.
macula. Das ist 1. Makel i. S. v. Fleck (
M-L. 5212;
Walde 452), der fremdartig - sei’s verunreinigend wie der
Fläcke, sei’s als Lückenbüßer, «Flick»-Stück,
Fläck (aus Leder) an einer Unterlage haftet. (Vgl.
Kluge 140.) Die
macula ist aber 2.
la maille, was ebenfalls zunächst andersfarbige Flecken mannigfachster Art (vgl. die frz. Wörterbücher), dann speziell das bedeutet, was unsere aus
macula, afrz.
mache, alldeutsch
masca masga (
Graff 2, 877; vgl.
Kluge 305) überkommene
Masche (s̆s̆, Mz. die
Masche [Tw.] oder die
Mäsche) besagt. Entlehnt wurde aber auch das aus
maille gebildete «
le maillot» als nochmalige Verkleinerung das
Máiotlli (Tw.). Das ist ein Tragkissen, in welches man Säuglinge «
enmaillote». Nach dem Schlingen des Fadens zur Masche heisst diese in Safnern
der Schli̦ck; vgl.
Strick mit Strang und streng, angestrengt. (
Stucke S. 240 gegen
Kluge 448.) Als Strick im Sinne des tückisch angelegten Fallstricks (
Walde 405) ist l.
laqueus der it.
laccio (frz.
lacs), unser
Lätsch. (
M-L. 4909:
schwz. Id. 3, 1530.)
3
Lieb. 127; vgl.
schwz. Id. 2, 422.
4
Zaubererin? (Vgl.
M-L. 2624.)
Alle diese Geflechte, deren Hauptbestandteile der Sack, die zwo Wän͜d und zwe Flügel sind, und bei deren zieh ab äi’m oder zwei Schiff eine Blootere das sie bindende Schiffsseil schwebend erhält, heißen — außer dem Tramai — Garn im Gegensatze zum Netz. 1
Vom einen zum andern über führt zunächst der Bantner, Pantner. Um «allerlei Gattung» 2 zu fangen, sowohl Vögeli wie Kleinwild und Fische, diente dem Fischer und Jäger die gr.-l. pan-thēra, die it. pantera, die frz. pantière. 3 Als Schwebe- oder Hängegarn ist dieser Pantner, dieses Bantnergarn oder Hechtgarn z. B. 1750 für den dem Nidauer Landvogt vorbehaltenen Fischfang frei im Wasser g’hanget. 4 Wie häufig aber der Pantner im 15. Jahrhundert im Gebrauche stand, zeigen die folgenden Zitate aus dem Archiv der Stadt Biel. 5
Partnersatz. 1486: Vnnd söllend dieselb (vorgenannten) beyd partey by den pantnern belyben, wie die mit manchen vnderscheiden sind, vnd die yben und bruchen nach lutt vnnd sag des bernamenttenen Rodels. — 1487: Vnnd sust dero vonn Byell 80 vnd ir Vischeren halb, bey haltung der Marchen vnnd pantneren nach yßwysung desselben Artickhels [...] vngehindert vnnd vngeendert bestan. — 1470: Eß soll ouch der genant Herr von Basel sein Stift vnd die von Biel der Pantner halb vischenzen vnd Vischfängen blyben, als von allter har kommen ist.
Auch dar heutige Pantner des Bielersees ist mit seiner bis 3 m erreichenden Höhe wesentlich ein Garn, ist aber als Setznetz eingerichtet. Mit seiner Maschenweite von 50-70 mm fängt es als Halbpantner außer großen Hechten auch Seeforellen von wenigstens drei Pfund. Engmaschig dagegen — als Drịß’ger bis Vierz’ger (mit einer Maschenweite von 30-40 mm) — ist die Wịtnetze.
Di Netze̥, wie man links und rechts am Bielersee das Netz benennt, indes das alttwannerische « Netzi» (Mehrzahl: Netz) aus ahd. «das nezzi» zurückgeht, 6 charakterisiert sich überhaupt durch ihre (gesetzliche) Beschränkung auf 150 cm Höhe, welcher eine Maschenweite von 38-80 mm entspricht. Nach solcher Weite benennt man Netze als Drịßger, Fụ̈fedrịßger, Fụ̈fevierz’ger usw. bis Achtzger. Die engmaschigsten sind natürlich die Richtfischnetze: Gü̦tsch-, Albeli-, Hääselnetze zum Fang von Köderfischen. «Äßfische» (nicht in Tw.) werden z. B. gefangen mittelst der Pfärig- oder Pfäritnetze, in welche aber auch kleinere Seeforellen und Hechte schlüpfen. Eine solche féreyirǝ oder orbaz des Mistelach kommt bis auf 1800 Maschen von 30-65 mm. Enger sind die beiläufig 2400 Maschen der tschasōsa oder tsarschōsa (« chasseuse», Jagdnetze), auch die höchstens 2000 des blavin 7 ( Aaletnetze). 1500 zählt die paleyōsǝ, paillousa 8 (auf palées S. 79) und die paillanza als Eglinetze; 900 die retorsa, rétōrtsǝ, rétorschǝ als Brachslenetze.

Zum Trocknen der Netze. Geschwister Dubler, Fischer
Ausbreiten, Aufhängen und eventuell Flicken der Netze am Landungsplatz in Lüscherz
Vergegenwärtigen wir uns 9 das chnü̦pfe (mache) einer Netze. Das mit einem eigenartigen Chnopf (es gibt deren etwa zwanzig; einer von ihnen ist der Wäberchnopf 10 ) gefertigte Geflecht nennt sich d’s Garn oder noch fachmännischer d’s Tuech. 11 So u so mäṇge Lätsch (Masche) des Netzes (bis 2000) bestimmt des letztern Lengi, so u so mängs Räisi bestimmt die Hööchi. Die oberste Maschenreihe, der Aawu̦u̦rf geheißen, hanget, wenn d’Netze montiert oder aag’stellt isch, an einem durchgezogenen Zwirnfaden aus sehr starkem Garn, dessen herausragende Ände links und rechts am Zäiche (s. u.) 82 befestigt werden. Dieser Faden heißt der ober Ääre. 12 Der un͜der Ääre dagegen besteht aus g’spu̦nnigem Roß- oder Chüestịi̦lha̦a̦r und nụmme, wenn’s sịị mueß, aus Garn. Er bekommt nämlich zur Belastung — zum b’schwääre als Netzsenker — Bleili zu tragen: in verschiedenen Weiten aufgereihte, etwa fingerslängi aufgerollte Bleiplättchen. An die Stelle derselben treten am oberen Ääre gegenteils Schwimmer oder Flosse: etwa 8 cm lange und 3 cm breite, dünne Blättli aus dem sehr liechte Saarbaum- (Schwarzpappel-) Holz.
So feine und zugleich so starke Gewebe, in denen sich bis 35pfündige Hechte fangen können, lassen sich Netzmacher in Lüscherz, in Lausanne usw. natürlich tụ̈ụ̈r zahle. Sie werden daher in fleißige Pflege genommen: g’wäsche mit Säiffilaad (in Tw. für basl. Säiffilaab, 13 emmentalisch Seiffe̥laa) u. dgl., moderner Weise mit Vịdriól u. dgl. imprägniert und g’hänkt. Letzteres geben die in ihrer Art malerischen Gestadeszenen z. B. in Lüscherz zu schauen.
E Wältswösch (s̆s̆), gestützt durch eine ganze Reihe von in das lange Seil ịịddrääite oder paarweise drun͜der gestellte Stŏchle (emmentalisch: Stŏgle) nahm hier vormals die Hänkiachchere in Beschlag, welche nun nach Tieferlegung des Sees trocken liegen. Nicht weniger malerisch nahmen sich vormals 14 die ausgehängten Netze um die Fischerhütten am Gerolfinger Gestade aus. Praktisch z’Nutze z’zieh weiß man aber auch die zum Fischfang untauglich gewordenen Netze und Garne. Sie werden ụụftrönnt (vertrönnt, wie umgearbeitete Gewandstücke) und zu Wöschsäili gedreht, die beim säile (spannen) sich immer noch als ausgiebig erwiesen. Was auch hierfür unbenutzbar ist, dient doch noch zum abputze von Fläschen u. dgl. im Keller, zum Hän͜d abtröchchne und wird noch einer alljährlichen Wäsche wert gehalten, bis es rắdibus z’Hụdle u z’Fätze verbrụụcht isch. Das ist gegenwärtig bei den nur zu feinen Garnen, welche allerdings besser fische, aber bloß etwa zwei Jahre halten, glịị g’scheh. Bis zwänz’g Johr hielten dagegen die früher in jedem Trüel und Chäller hängenden alte Handgarn.
1
Vielleicht ursprünglich aus der Nessel, ahd.
neßßila und
nassa:
Hoops 3, 310; vgl. dazu «Garn», vielleicht zu «
ghar», drehen:
Kluge 159.
2
Matth. 13, 47.
3
M-L. 6208.
4
NB. 2, 203 f.
5
Tom. 8. 9 CCXLVII, S. 69. 121. Wir verdanken den wegen schwerer Leserlichkeit mühevollen Auszug dem sprachkundigen Gymnasiallehrer
Wyß in Biel.
6
«Die Netze» kann als singularisierte Mehrzahl von
«das Netz» gedeutet werden (
schwz. Id. 4, 886). Vielleicht spielt auch l. «die»
nassa, «la»
nassa als Reuse (vgl.
Walde 508:
M-L. 5838) hinein.
7
Jud 14.
8
Jud 22.
9
An Hand einer Skizze von Albert Krebs.
10
Lf. 387.
11
Vgl. die umfassende Bedeutung von «weben» (mit den Händen «hin und her fahrendes») Wirken, Flechten, Spinnen, im engern Sinn Weben (
Kluge 484.)
12
Das
schwz. Id. 1, 388 f. stellt
«der Ääre» (frz.
la vêtre) samt weidmännischem (besonders bair.-östr.) Arch, Ärch zu «Arche» aus l.
arca zu
arcēre einschließen, einhegen, verschließen,
iib’schließe. Die Arche ist allerdings ein Behälter, Kasten, aber z.B. frz.
arche zunächst ein (Brücken-)Bogen, ein Joch u. dgl. (
Kluge 22;
Walde 5756;
M-L. 611.) Es kommt
der ober und der under Ääre zu der sehr passenden Bedeutung des Abschließens und Einfassens. Vgl. «d’s usser Ääri» (die Oberhaut).
13
Heisse Seifenlösung, erinnernd an das Käselab (vgl.
Lf. 488;
Gw. 399;
Gb. 177. 180;
Ins 354)
14
Wagner, l’Île de St-Pierre 11.
Wie nun wird das fü̦ü̦r g’noo, für n e Zu̦u̦g z’mache? Das zeigten uns an einem gewitterschwülen Juni-Nachmittag Großrat Engel und Kunstmaler Jaeger-Engel. Und zwar ohne die geringste Aussicht auf Erfolg. Es hieß nicht bloß: e̥s wird spu̦cke, äb’s g’ra̦a̦ti; man erwartete gar nicht, auch nur e Schïepe z’foo, oder z’gspü̦ü̦re, daß (am Netz) öppis ju̦ck, und ’s g’seh z’wịßgele (daß öppis wịßgeli: der Schimmer eines Fisches zum Vorschein komme). Was vo Fisch zu erblicken war, war einzig e chäibige 1 Hecht, der wohl schon längere Zeit tot auf der Wasserfläche schwamm. Warum ohne Aussicht? E Halbstun͜d vorhär waren die zu unsern Lehrblätze ausersehenen Stellen vor der Twannbachmündung, vor der Brunnmühli (s. u.) und vor dem Schilficht zu Bippschól ausgefischt worden. Daher waren es auch bloße Manöver, mit schweren Steinwürfen, Ruderschlägen, Kettenrasseln d’Fisch uufz’jage ( S. 77). Allein die Stellen zeigten sehr schön und bequem, wie man im Summer uf d’Dünni (Untiefe) oder über e Bärg abb setzt (d. h. nahe am Ufer, wo es in rascher Senkung i d’Tieffi gäit), im Winter dagegen i d’Tieffi selber.
Die am Schärme u Schatte sorglich ausgebreitete und gehängte Netze wird also sorgfältig abg’noo u g’chnü̦pft: am Aawurf gefaßt, in Bräitine von Unterarmslänge lose z’sämmeg’läit und am armslangen, leise aufwärts gebogenen Netzestäcke aag’hänkt. So läßt es sich bequem u̦f der Achsle traage. In den zum Wäidlig mitgenommenen Netzechnächt, d. i. ein schulterhohes, schlankes, mehrfach durchbohrtes Hartholzstück, welches in der Rinne zwischen zwei Krummhölzern (s. u.) festen Stand bekommt, wird der Netzestäcke als Träger des Netzes ịịg’steckt. Der Goon oder das Schueffli ( S. 22) zum Wasserschöpfen wandert mit. Ebenso und erst recht d’Bääre ( S. 76), obschon die ja heute nụ̈ụ̈t z’düe het. Um so unentbehrlicher ist auch jetzt ’s Zäiche: ein fußlanger, trotz seinen Kanten ( Egge) an einen Spielkegel erinnernder Holzpflock, an welchen die vom oberen Ääre herausragenden Enden ( S. 82) befestigt werden. An ihnen erkennt der Fischer, wo d’Netze li̦ggt, wenn er sie für längere Zeit sich selber überlassen hat, vielleicht gar über d’Nacht het lo sịị. Bisweilen aber findet er, zumal nach stürmischer Nacht, d’Zäichen ni̦i̦d. Was macht er? Er greift zum eigens gebauten kleinen Ankerli, womit auch Tote auf dem See zum Schiff gezogen werden. Mit ihm sucht er in verdrießlicher 84 Mühe nach dem verlorenen Netz, bis es an einem der vier Höögge hängen bleibt.
Jenes Warten hat nun für uns ke Zwäck. Das Netz wird also drabb g’haa: vom Stecken abgewickelt und langsam, auch lu̦gg, nicht g’spannet in das heute abso̥lut ruhige Wasser gesenkt: g’setzt. In locker hängendem Netz b’hange die vom Ufer nach dem Blaaue hin wandernden, bzw. geschreckten Fische ehnder. Statt ihrer gibt es heute, da der Aarekanal viel Unrat in den See geschwemmt hat, es Ghu̦u̦rsch aus dem Netze zu lesen: Räspe (kleine Holzstücke) u. dgl. Die im Netze zappelnden Fische aber bringen in das feine Gewebe Näster (verhu̦u̦rscheti — s̆s̆ — Stellen). Staine hinwieder (wie die alten Lüscherzer sagten) entstehen durch verhu̦u̦rsche mehrerer Blei beim setze oder bü̦ü̦re der Netze. Solche Näster und Stäine lööse heißt: d’Netze lööse (eine bekannte Objektsverschiebung).
Nach kurzem wird aber das Netz wieder b’bü̦ürt: dem Wasser enthoben, aufgefaltet und an den Netzestäcke g’hänkt, um es schließlich an seiner Tröchni z’veröörtere. Wir verlassen das Schiff unter warmem Dank für die Lehrstunden, welche die Männer von ihrer kostbaren Zeit unserm Buche zugewandt. Mit ihnen hat dies auch ohne Fisch e guete Zug g’macht.
1
Wie
Schelm (
Kluge 394; vgl. die
Schelmenachern als Schindanger), ist der
Cheib (
Kluge 236: vgl.
«Cheibefleisch») zunächst svw. Aas. Von hier aus (vgl. Rabenaas) erklärt sich der so häufige Gebrauch als Schimpfwort. (
schwz. Id. 3, 100-5).
Zum Netze setze durfte vormals der Fischer bloß der groß Wäidlig besteigen, nie aber das Waideli (Lü.), Wäideli (Tw.) oder das Lö̆gett(Lü.), die Loggette (M.) das Logettli (Erl.) la loquetts ( S. 21). Den Hechtenfang betrieb er insbesondere vom Hechtfloß aus. Der gewöhnlichere Name hierfür ist noch erhalten im twannerischen Grangß. Der mhd. grans und der schweizerdeutsche 1 Granss(e n) bedeuten in erster Linie Schnabel und damit auch Schiffsschnabel; der Grangß jedoch ist zunächst der an diesen Schnabel angrenzende Fischkasten, dann aber ein solcher für sich allein, wie er verankert in einer Länti oder sonstwo am Ufer schwimmt. In älterer Sprache erscheint er — mit dem bekannten n-Ersatz durch u 2 als der Graus, waadtländisch als la crausa, crausaz (1395) 3 entlehnt. Jeglicher Graus — heißt es in der bernischen Fischerordnung von 1777 und 1806 (s. u.) —, der 85 mit Fischen unter der Nidaubrügg durchfährt, schuldet dem Amtmann den Fischgriff: Ein Brückenwächter oder sonstiger Angestellter übte das Rächte, i’ n Chaste ịịne z’grịffe u der schönst Fisch für e Landvogt ụụse z’näh. Das brutale Recht wurde nachmals mit Fischen für es guets Ma̦hl losgekauft, noch später mit einem Pfun͜d in Geld. Ein bloßer Wäidlig zahlte hiervon die Hälfte. Der Amtmann leistete als Entgelt hin und wieder es Mü̦tschi.
Derlei Rechte flossen aus der einstigen königlichen Reichshoheit, die auch über den «Fisch im Wasser» verfügte. So verschenkte 817 König Ludwig der Fromme der Marienkirche in Lausanne den Fischfang in der Zihl bei Bürglen. 4 961 erhielt das Kloster Peterlingen ( Payerne, Báijeere) vom König Konrad den Bi̦berebach. 1249 kam die Zi̦hl zwischen dem Neuenburger- und Bielersee durch den Grafen von Neuenburg an das Kloster Sant Jhánnse, welches bald auch die Befischung des Bielerseeufers an sich brachte. 5 Es hatte aber solche Fischerei-Regale, ahd. das fisg-izzi 6 die Fischẹze (s̆s̆), (nicht in Tw.), mit «n»-Einschub mhd. die vischenze, Fischenz (Fischénz) 7 geheißen, schon 1223 und 1238 sich angeeignet und ließ deren später noch häufig (1442, 1471, 1523, 1648 usw.) 8 sich schenken oder bestätigen. Es übte die Hoheitsrechte durch Erhebung von 2 bis 8 Hechte n von den Garnen verschiedener Größe. Als zeitweiliger Oberherr der Grafschaft Erlach (s. Ins) bezog auch Savoyen durch seinen Kastlan z. B. 1396 und 1397 je auf Grüendonnstig sechs Hechte. 9 Ein Nachklang hiervon waren die acht Kronen Schiffzins, welche noch 1787 dem Landvogt von Neuß zu entrichten waren. 10 Der Fürstbischof von Basel hatte sich 1551 «die niedere Herrlichkeit» des Nydauwer See und die Garnzinsen angemaßt. Allein Bern erklärte sie am 7. Juni 1559 als die seinigen und bekräftigte dies durch eine energisch gehandhabte Seeordnung. 11 Es sicherte sich nach langen Streitigkeiten 12 auch die Zihl-Fischezen und verpachtete sie (wie noch heute di alti Aar, den Twannbach usw.) oder versteigerte sie (z. B. 1794 das Vanel oder die Poissine an zwei Käufer aus dem Emmental um 2900 Pfund). Es beschlagnahmte zugleich (z. B. 1777) die Schiffe zur Hilfeleistung bei Feuersnöten und Schiffbrüchen. Das Fischen in andern Gewässern wird analog der Jagd padendiert. Die Gesetzgebung Berns drang immer strenger auf 86 «Wiederbesamung» der durch Raubfischerei erödete n und erarmete n Seen und «rünnenden Gewässer». So folgten sich die Verordnungen der Jahre 1548, 1559, 1570, 1581, 1672, 1703, 1715, 1777, 1803 und das bernische Gesetz von 1833. 13 Zugrunde lagen die polizeilichen Dinggerichte der Fischer: die Meientage, Fischermeyen, Meyengedinge, Meyen des 14. bis 17. Jahrhunderts. Wie nämlich Schützen, wie Schneider und Schuster, so versammelten sich auch Fischer an Meiesunntige 14 zu festlicher Geselligkeit, zu Messen und zu ernst fachmännischen Abmachete mit gesetzlich bindender Kraft. Diese bezogen sich z. B. auch auf die Meyegarn mit streng vorgeschriebenen Maschenweiten. Die Fischermeyen (-Vertreter) im Stromgebiet der Aare genehmigten 1470 eine gemeinsame Fischerordnung, und einen großen Fischermeyen (-Tag) hielten am 12. Mai 1510 die Fischer der Städte und Landschaften Bern, Solothurn und Freiburg zu Freiburg ab. An demselben erschienen auch Abgeordnete aus Erlach (Schultheiß Heimo Ruffs und Benedikt Kolers), aus Ligerz (Meyer Tschan Maliert, sonst Maillard), aus Twann (Hans Krebs), aus Nidau (Rudolf Schmalz und Bastian Eyen) u. a. 15 Die zwölf wichtigsten Beschlüsse dieses Tages wurden 1570 durch die Fischereiordnung des Nidauer Landvogts Hans Spätig für sein Amt gesetzlich festgelegt. 16 Verboten waren da u. a. im Boden des Wassers Chri̦tze machende Schleppnetze, welche «Krissern» hießen. Es wurden der Pfruendgieße zu Bürglen und die Schöpfi zu Zihliwil als Schonplätze erklärt usw. (s. u.). Schläikfischer (Fischwilderer) wurden übrigens auch von den Chorgerichten ụf d’Mu̦gge g’noo. Sowohl Begünstigung wie «Beladnuß des Meyen» (1548) bekamen also alle rechten Fischer z’g’spü̦ü̦re.
1
Wb. 1. 565;
schwz. Id. 2, 782. Als «äußerstes Ende» berührt sich mit «Grans» die «Grenze» auch im Slawischen. (
Kluge 179. 180.)
2
Vgl. Trank und Trauch, chrank und Chrauch usw.
3
Bridel 89. 90.
4
Font. 1, 226; Th. v. Liebenau, Gesch. d. Fischerei auf einem verschwundenen Schweizersee. («Schwz. Fischerzeitung» 1893, Nr. 8. S. 17.) Im folgenden, wie bereits vorn, zitieren wir «
Lieb.».
5
Lieb. 19. 34.
6
Graff 3, 170; vgl. l.
-itia, it., sp.
-ezza.
7
Schwz. Id. 1, 1106 f.
8
SJB. A 453 ff; 507 f.; C 10-13; alt Polizei-, Eid- und Spruchbuch Bern (15. Jhd.), Blatt 116.
9
Taschb. 1901, 13.
10
Einkünfte 93.
11
NB. 1. 15 ff.
12
Noch bis
SJB. D 279 durchklingend;
RM. 11. Juni 1606 (231) u. ö.
13
NB. 2, 147-152; 1, 15 ff; 2, 5 ff; 2, 91 ff; 2, 187.
14
Schwz. Id. 4, 7;
Lieb. 84 ff.
15
Lieb. 87 ff.
16
Veröffentlicht durch Lehrer
Hirt in Twann in der «Schwz. Fischereizeitung», IV, 367.
In dem Maße, wie Bern auch im Seeland festen Fuß faßte, nahm es sich durch Verordnungen seiner Fluß- und Seefischerei an, um der Bevölkerung diesen Erwerbszweig zu erhalten. Damit «niemand weder Mißverstand noch Unwissenheit vorwanden könne», sammelte es alle die im Lauf der Zeit erlassenen Vorschriften in der «Fischerordnung über den Nydauer-See und die Zihl, wie auch über den Fischhandel» vom 16. Jenner 1777 und erneuerte sie am 9. Juni 1806. 1
87 Danach durfte «auf Gewinn und Quest» nur fischen, wer vom Nidauer Landvogt (als dessen Amtsnachfolger der G’richtsbresidänt vo Nidau noch heute alle Gerichtsbarkeit über den bernischen Großteil des Bielersees ausübt) als e Fischer aag’noo war. Solche «padäntierti» Fischer mußten zu den Fischerordnungen g’lobe, im Fischerrodel si ch lo ịịschrịịbe, den Seezins zahle und den Fischgri̦i̦f ( S. 85) oder (1806) Fischgriff gewähren.
Die Erlaubnis zum Gebrauch von Garnen und Netzen wurde u̦f̦ d’Gmäine verdäilt. Es durften haben: Nidau 1 Grobgarn, 3 Droogle ( S. 78), 3 Spreitgarn. Ligerz: 1 Grobgarn; ebenso Twann, Sutz-Lattrigen, Erlach, Gerolfingen: 2 Großgarn, Lüscherz 3, und dazu 5 Summergarn; Tüscherz und Alfermé: 1 Großgarn und 1 Sommergarn. Ụf Pfärit sollten nur je 20 Netz g’setzt werden. Neben diesen Seedörfer n wurden die Zihldörfer wie folgt bedacht: Orpund mit 4 Troglen und 4 Spreitgarn, Aegerten und Brügg mit je 2 Troglen und 2 Spreitgarn.
Für den Hausgebrauch darf — nur nicht im Läich und immer unter polizeilicher Aufsicht — mit Netzen, Angeln, Schnüren und (1806) Wartolf von jedermann gefischt werden. Heute bloß mit dem Angel und dem Blatt.
Jede Stadt und jedes Dorf am See und an der Zihl hat einen Fischvogt (Fischereiaufseher) zu stellen. Der Amtmann wählt und beeidigt sie. Sie sehen u. a. darauf, daß die Fischer uf d’Nacht ihre Fahrzeuge aaschließe und d’Rueder wäggnähmme .
Verboten sind alle «Fischerkünste»: mit dem Groppiergarn mit zwäine Häägge oder Schiffen; mit den dreiteiligen Wild- oder Meiegarn (Trámal: S. 78); mit lebenden Gü̦tsche zum Trüschenfang vor dem 1. Augste; mit Fụ̈ụ̈r oder Gluet zum Blenden der Fische; mit dem Kügelin ( Cuculi, la coque) zum sturm mache der Fische ( S. 70); mit den Stang- oder Läitergarn der Orpunder; mit Groppierer oder Grobgarnen von mehr als 1200 Mäschel in der Hebne und 450 an der Wand; mit Summergarn von mehr als 700 bzw. 300 Mäschel; mit Seck, welche mehr als 8 Mannschla̦fter lang und 28 d’Wan͜d ụụf, 25 an den Sommergarnen messen; mit Troogle, deren Sack mehr als 3 und an der Wandlänge 18 Mannsklafter mißt; mit Spreitgarne, welche mehr als 15 bis 18 Schueh hööch und unten 15 Chla̦fter breit sind; mit Reuschen (1806) oder Reussen (1777) oder Wartolf, welche samt der Abrichti mehr als 100 Mäschel zählen. Die Mäschel der Droogle, Spräitgarn und Wartolf dürfen nicht ängger sein als 1 Bärnzoll; ebenso die Pfäritnetze.
88 Fịịsterlig (1777: zwischen Unter- und Aufgang der Sonne) darf kein im Wasser liegendes Garn, Netz noch Schnur aag’rüehrt wärte. Die Schonzeiten ( S. 63) sind streng einzuhalten.
Aus jedem Graus (Granse, Grangß; S. 84) und Wäidlig soll der Bärnschụeh mit seinen zwölf Zoll ịị nbbrönnt sịị. Das Brandzeichen liegt als Schla̦fmääs im Schloß Nidau auf: jeder Fischvogt erhält ein Doppel (1777). Nach diesem Määs wird das Längenminimum der fangbaren Fische bestimmt auf; 10 Zoll für Forne, Hecht und Barbe, 8 Zoll für Äsch. Von Michistag (29. September) bis z’Wienḁcht dürfen (1777) Hụ̈ụ̈rlig und Tausendmägetli ( S. 65) als «die Saamen von den meisten Fischen» und als Raubfischfutter höchstens in den Herbsthụ̈ụ̈ser (s. u.) verkauft werden. Die besonders vor der Brunnmühli bei Twann zahlreichen Albeli oder Blääülig dürfen überhaupt nicht gegarnt werden, außer für Hechteweiere und Fischtröög (1777). Fangbare Hääsel, Wingere, Aalet, Blacken oder Rottli müeßen uf d’s min͜dste sächszöllig sịị.
Jahraus, jahrein im Bann für Netze und Garne bleiben; eine Distanz von zwe Stäiwü̦ü̦rf i der Lengi u Bräiti vor em Twannbach und vor der Brunnmühli ( aux sept fontaines, welche Quellen am Ufer diesen Seestrich zu einem Paradies für Jungfische machen). Ferner der durch Pföhl abgegrenzte, in die 200 Schuh breite südliche Seerand «i de Rohre» von Nidau bis Erlach; die Zihl vom Einfluß der großen Zihl bis zu der Allmatten; die Schü̦ụ̈̆ß, vo der Sandbrü̦gg bis i d’Zihl; die Schloßfischezen Nidau in der Schüß vom Chatzestääg bis Burgerezi̦i̦l Nidau; die Klosterfischezen Gottstatt zwischen Orpund und Meyenried; die Pfruendgieße zu Bürglen.
Twanner-, Ligerzer- und andere Hechtesetz dürfen die seezinspflichtigen Garne und Netze nicht beeinträchtigen. Fächer in Wasserabläufen sind zu entfernen.

Johannes Dubler Fischer,
alt Gemeindspräsident
Landwirt in Lüscherz, nun gestorben
Keine gefangenen Fische dürfen u̦f schwäbe ntem Schiff verkauft werden; sie müssen ab aab’bun͜dnem Schiff in den bernischen Städten und Dörfern am See fäilg’haa werden; so besonders im Herbst. Und zwar dürfen (1777) gelten das Pfund: Foorne 3 Btz. 2 Krz. vom 1. Januar bis 1. April; 3 Btz. vom 1. April bis 1. November; vom 1. November bis 25. Dezember 2 Btz. 2 Krz. die magere, 3 Btz. die fäiße. Hechte 3 Btz. vom 1. Januar bis 1. März; 2 Btz. vom 1. März bis Neujahr; doch bloß 6 bis 10 Krz. die bloß 1 Ell = 1 Schueh langen. Das Stuck: Tryschen (Trụ̈sche) kleine 2 Krz.; mittlere 3 bis 4 Krz.; gar große 5 bis 10 Btz. Balche 3 Btz.; Balchpfärit 1 Btz.: 89 der Vierlig (25 Stück) Pfärit 5 Btz. Das Stuck: Egli, 4 bis 8 Zoll lang, 3 Krz., 1 Schuh und mehr lang 4 bis 6 Krz.; Äsch und Föörnli: kleinere 2 Krz., größere 1 Btz.; gar schöne und große 2 Btz. Das Bụ̈ckli (20 bis 22 Stück) g’salzni Pfärit und das Bücklein (20 bis 21 Pfund) g’salzni Forne hatten ebenfalls einen bestimmten Tax. 2 Die lebenden Fische waren (1777) im Summer von 2 bis 4 Uhr, im Winter wenigstens zwei Stunden vor 1 Uhr feilzuhalten: an der Länti z’Nidau, an den Nidauer und Bieler Wuchemärite am Mäntig und Donnstig, und an der Länti z’Erlḁch an den Erlacher und Neuenstadter Wochenmärkten am Mittwuche und Samstig. Außer diesen Zeiten dürfen die Fischer nicht «um Fische angesprengt werden». Dooti Fisch, deren Ohren inwendig bläich anssehen oder mit Blut g’fäärbt sịị, dürfen nicht fäil g’haa werden. Nasen für Äsche, Balche oder Pfärit auszugeben, war speziell verboten.
Der Amtmann zahlte (1777) für Erlegung eines Reiger (Reiher, Reigel) und eines Weyhen ( Weih) 10 ß; für einen Otter, dessen 90 rächte Tatze er aber behielt, 1 Pfund. Ohne Prämie waren preisgegeben: 3 d’Gịrịtze, «Taucheten» (Tauchenten oder Tụnkäntli) und «Pelpen». Bei Feuersnot und Schiffbruch mußten die Schiffer ihre Fahrzeuge zu sofortiger Verfügung stellen.
1
Zu Gebote stehen uns die seltenen Exemplare, welche Herr Großrat Max Engel besitzt.
2
Vgl. «der» Preis.
3
Nach it.
dar presa (en prise):
Kluge 356.
Der große Spielraum, dessen sich die Fischerei für den eigenen Hausverbrauch erfreute, ward uverschánt ụụsg’nu̦tzget. Es wurde nebenbei auf Wassergewild gepirscht, es wurden Gärten und Reben geplündert. 1 In Orpund fischten (1727) selbst Kinder, «um den Müßiggang zu meiden», und die «armen» Eltern, die ganze Nächte in den Wirtshäusern lagen, 2 zu «unterstützen» (1751). Auch die Vingelzer, hieß es 1727, seien zu überwachen, sonderlich aber die Landerer, welche (1715) mit Hilfe von Schaubliecht und engmaschigen Netzen sogar im Läich Hechte fingen. Auch rechts des Sees geschah allerlei Unfug, besonders zu Lüscherz mit seinen Hechteweiere. Arge Schädigungen erlitten dabei auch die Seemụụre und Bü̦ü̦rine ( Ins 145 f.) der Rebleute durch Pföhl und Ringe zum Anbinden der Schiffe. Jene mußten seit 1559 durch den freien Anker und die Schalten ersetzt werden. Zwecks der Schonung der Strandkulturen wurde 1559 auch das Verfolgen der Egli in ihren Laichplätzen uf der Pey 3 und schon 1548 das Fahren mit dem «Scharben» ohne «abgeschlagenes Haupt» verboten. Ohne solches durfte dies Fahrzeug gegen Erlegung von 2 Plappart benutzt werden. 4
Auch mit solchen Einschränkungen kamen die Fischer durchụụs nid z’chu̦u̦rz. Mit großem Profit übten sie als «Weidtlüth» (1548) oder Wytmanne (1548) ihr Wäidrächt (1751) 5 im Ursinn des ersten Wortteils. Mit weithin schallendem «Hụ̈ụ̈rlig! Hụ̈ụ̈rlig! Späckbreegel!» durchzogen vormals Lüscherzer die Seelandsdörfer, welche nicht selten ganze Scharen dieser Jungbarsche ( S. 66) bis zum gääl b werden des Wasserstrichs vorüberziehen sahen. Ganz Chöörb voll wurden i de Läntine use’zoge, b’bachche (oder b’bachchet) 91 und unụụsgnoo samt den Döörn verzehrt. Sollen doch die Gräät der Fische überhaupt das Rückgrat der Menschen stärken! (Wie Tierzüngli sie redselig machen.) Aber auch Pfäärig kamen im Winter i ganze Chöörb zum Konsum in Wirts- und Privathäusern. Der Vierlig (ein Viertelhundert, das aber vom Käufer auf 26 und vom Verkäufer aus 24 «normiert» wurde, vgl. S. 68) kostete um 1880 achtzig Rappen, stieg jedoch auf zwei Franken. Die Wirte stellten acht Tage lang vor und acht Tage lang nach Neujahr Pfäärigfraas an und servierten Portionen zu sächs Stück. Im Privathaus wurden diese Felchen in eigenem Hafe ịịg’salze und während der vierzehn Tage ihrer Haltbarkeit vor und nach verzehrt.
Machten Zü̦belesooße mit Äier und Anke die Coregonen zu Leckerbissen, so wurden von Feinschmeckern die Ööle (Aale) i Schịịbli uf der Gluet b’bachche oder i Rääbebletter geröstet. D’s Ja̦hr du̦u̦r halfen, wenn nicht die den Forne in Güte nahe kommenden Äsche und Hechte, so doch Brachsle und Barbe den Tisch decken. Ganzi Chörb voll min͜deri Fisch aber wurden de Söüe g’fueteret; die wetzten an den Döörn mit Wollust ihre Zähne.
1
NB. 2, 5.
2
Der Aarberger Landvogt in
NB. 5, 84.
3
Vielleicht schon baskisch, dann kelt.-lat.
baia, frz.
baie, Bai. (
Walde 81.)
4
NB. 2, 5.
5
NB. 5, 80. Auf der Wurzel
vï (auf etwas losgehen:
Kluge 486, vgl. auch
vēnāri jagen,
Walde 816) beruht «die Wei-d-e» als 1. Nahrungssuche des im Weidlig fahrenden Fischers (vgl. die anmutvolle
Wasserweid der Bieler-Insel, sowie des Jägers, der als «Weidmann» sein Beutetier bis auf die «Eingeweide» «ausweidet»; 2. Nahrung, vom «weidenden» Tiere selbst gefunden, vom «weidenden» Hirten ihm angewiesen. Die bei alle dem an den Tag gelegte Lust und Lebendigkeit wird als «weidlich», «wäidli», «wäideli» bezeichnet.
Die S. 86 erwähnten Fischermäie klangen gelegentlich aus in Fischerfest. Auch Erlach und Lattrigen feierten solche. Der Fischereiverein vom Bielersee wiederholte sie letztmals 1911 als eine Art Waldfest.
Hinter ihnen standen die Zünft der Fischer oder «zu Fischern». So zu Biel, wo allerdings die Chïeffer und die Wäber mit dazu gehörten. 1 In Erlach tat sich eine Fischerzunft zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges auf 2 und gab sich ihre Statuten am Stäffestag (26. Dezember) 1622. Nur g’hüra̦teti Männer und wenigstens drịßgjährigi Leedigi von verträglichem Charakter durften als Stubeg’selle mit Eintrittsgeld und alljährlicher Speisung des vom Stubemeister verwalteten Stubeseckel sich ịịchạuffe. Der Inhalt des Dröögli (1837: 17,123 Kronen) wurde seit 1837 noch zweimal ver’däilt. Ụụffahrt und Neujohr wurden jeweils festlich begangen, und der mit dem Delphin, Salm oder Hecht geschmückte Zunftbecher ging fleißig um. Die Mähler und Wịịversuechete wurden allerdings später damit ersetzt, daß jeder Zunftgenosse es Pfun͜d in Geld, e Mooß Wịị und es Bröötli erhielt. Dagegen nahm die Zunft der G’mäin die Ausrüstung und den Unterhalt eines Dragụụner ab. (Die ungefähr 92 gleichzeitig mit der Fischerzunft gegründete Rebleutenzunft übernahm zwe Dragụụner.) Sie steuerte ferner an die noch heutige Kirchen- Oorgele (1779: 150 Kronen), an den obern und un͜dern Schú lmeister (12 und 16 Kronen), an den Nachtwächter (6 Kronen), an den Brüggewächter bei St. Johannsen (8 Kronen) usw. — Zum schmucken Zunfthaus stand in eindrucksvollem Gegensatze die malerische Fischerhütte gegen Vinelz hin. 3
Bloß aus Fischern bestand schon vor dem Jahr 1597, in welchem ihr der Berner Rat ein Wappenfenster schenkte, 4 eine der drei Zünfte zu Neuetstadt. Sie verewigte sich durch die im dortigen historischen Mụ̆́sium aufgestellte Holztafel, welche (1742 erneuert) in Gesichtsausdruck und Väärsli die Lebensalter von zehn zu zehn Jahren darstellt. Der Zehnjährige ist uschuldig wi n es Lämmli, der Zwanzigährige läbig wi n e Hi̦rz; später ist man stolz wi n e Läü, dann schlau wi n e Fuchs, weiter gịzig wi n e Wolf, nachher fụụl wi n e Hun͜d, darauf rụmpelsu̦u̦rig wi n e Chatz, endlich dumm wi n en Esel, und nụ̈ụ̈nz’gjährig: wịß wi n e Schwan. 5
1
Lieb. 80.
2
Ihre kurze «Geschichte» schrieb Fürsprech Th.
Simmen (Bern 1868).
3
Ein Bild von ihr besitzt der ehemalige Erlacher Gerichtspräsident Hüssi, nun in Thun.
4
Anz. Nr. 5, 202. Es kostete 13 H 5 ß 8 d.
5
Im Original:
Innocent comme un agneau, vif comme un cerf, fier comme un lion, rusé comme un renard, avare comme un loup, paresseux comme un chien, grognard comme un chat, bête comme un âne, blanc comme un cynge.
Der Krone der Schöpfung als dem Haupte der Raubtierwelt hilft eine ganzi Chu̦ppele von Vertretern der höhern und niedern Fauna dem Fischbestand zu Leibe gehen. Vor allem ist es der Fischotter, dessen ungezügelte Mordlust und dessen nur die leckersten Beutestücke verzehrende Schnäderfrääsigi sich um menschlichen Nutzen und Schaden nid e Pfịịfferling 1 (nun natürlich auch Pfi̦fferling) kümmert. Dazu kommt die Schlauheit, mit welcher er die Eingänge seiner verschiedenen, mit Gras bequem ausgepolsterten Baue un͜der em Wasser aaläit und als Chemmi und Ventilator zugleich eine engere Röhre in die freie Luft hinaufführt. Äußerst gewandt schwimmt und taucht er dank seinen Schwimmhäuten, und gesellig jagen sich die Flußnachbarn unter lautem pfịffe im Wasser herum. Zahm und anhänglich werdend, 93 könnten die klugen Tiere mit de Hün͜d als Begleiter des Menschen ku̦nkeriere. 2 Als Fischräuber kommt ihm die Wasserspitzmụụs nahe. Ebenso, wenn auch zugleich durch die Anmut und Zierlichkeit seiner Bewegungen, der namentlich den Häidewääg absucheude Hauben-Taucher oder Länghals (Tw.) oder Haubensteißfuß. Im Namen erinnert an ihn das Tünk- oder Tu̦ngg- (Tw.) oder Touchänteli. Würdehaft langsam und steifbeinig, mürrisch und griesgrä̆mig, aber mit den tückisch blitzenden, gelben Augen gierig nach Fischen spähend, um sie mit seinem spitzen Schnabel zu harpunieren, 3 stolziert in seichtem Wasser unter chịịsterigem räägge der Reiher Fischräigel. Im Wääse gleicht ihm mehrfach der in metallischem Farbenglanz schillernde Ịịschvogel (Eisvogel), der gewöhnlich wertlose Fische verzehrt, 4 jedoch fast ebenso häufig der Jungbrut von Edelfischen arg zusetzt. Ein großer Schädling ist auch der «wild» Schwan, sodann der Milan (Gabelweih).
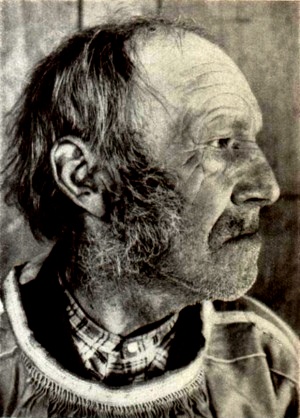
Johannes Mügeli-Perrot,
Fischer und Landwirt
82 Jahre alt, in Lüscherz
kürzlich gestorben
Mit der Fischbrut räumen gierig auf: die Teichfrösche und Kammmolche (eine Art Chrott), eine Reihe Wasserkäfer, Bluetsụụger 94 und su̦st allerlei «Sumpfgeziefer». 5 Gefährliche Forellenbruträuber sind der Gropp und der Äsch, während die Trüsche der Coregonenbrut zusetzt — wie denn überhaupt die Fischwelt ihre Hauptfeinde «im eigenen Hause» hat: der Größer frißt der Chlịịner. Schlimme Feinde haben aber nicht wenige auch im äigete Lịịb. Der Bandwurm, grob wi n e Bänggel, kann von ungenügend gesottenen Hechte, Brachsle, Grun͜dere in Menschen übergehen. Egel, Rotseuche, Blootere (Pocken), die glücklich bekämpfte Furunkulose (Haut- und Muskelbakterien) usw. wurden 1914 in der Ụụsstellig lehrreich veranschaulicht.
Zum Glück besteht zwischen Fisch und Vogel auch teilweise, obwohl unbewußte Freundschaft: jenen nützt durch Verzehren schädlicher Wasserinsekten die lustige und liebenswürdige, im Emmental allerdings als Fischbrut- und Rogenräuber angesehene Wasseramsle, welche der (Twann-) Bach ụụf sich etwa bemerkbar macht, der bewegliche Bachstälz und der dem See noo wippende Wasserstälz.
Immer zielbewußtere und tätigere Freunde aber findet die volkswirtschaftlich wichtige Fischwelt unter Menschen. Der schweizerische Fischereiverein zählt mehr als 7000 Mitglieder. 16 Vereine zählt allein der Kanton Bern. Diese sind in zwei Lager geteilt, den «kantonal bernischen Fischereiverein» mit vorwiegend sportlicher, netzfeindlicher Tendenz und den «Verband bernischer Fischereivereine», welcher neben der sportlichen namentlich die wirtschaftliche Seite der Fischerei mittelst intensiver Fischzucht fördern will. Diesem «Verband» gehören im Seeland an: der Fischereiverein vom Bielersee, die Fischereivereine an der alten Aare in Büren, Lyß und Aarberg, und der Fischereiverein von Laupen, während der Sportfischerverein vom Seeland die andere Richtung vertritt. Das schweizerische Fischereiinspektorat, das von der Landesausstellung inspirierte Fischerei Museum in Zug, die eidgenössischen Fischereilehrkurse z. B. in Luzern, die vom Bund subventionierten Fischbrutanstalten, welche bloß im Jahr 1913 70,8 Millionen Felchen, 7,37 Millionen Bachforellen, 8,37 Millionen Hechte, 4,35 Millionen Rötel usw. in öffentliche Gewässer aussetzten, wirken anfeuernd auch auf die bernische und speziell seeländische Tätigkeit. U̦f der Rütti bei Bern lernen auch d’Bụresü̦hn Fischzucht.
Seit 1892 besteht der an der schweizerischen Landesausstellung 1914 mit der silbervergoldeten Medaille als erstklassig anerkannte Fischereiverein vom Bielersee und Umgebung. Er hat aus seiner Fischzuchtanstalt im Paßge̥rt, welche bald darauf dem Umbau der Bundesbahnen het müeße Blatz mache, im Jahr 1915 wieder 95 1,737,000 Jungfische (worunter 866,000 Balche n, 81,200 Foorne, 790,200 Äsche) in die benachbarten Gewässer ausgesetzt.
Am 7. Februar 1920 hat dieser Verein an dem schönen neuen Strandplatz bei der Dampfschifflänti in Biel die ganz aus eigenen Mitteln erstellte und betriebene neui Fischbruetanstalt eingeweiht. Sie ist in einem bescheidenen, aber geschmackvoll errichteten Stäihụ̈ụ̈sli untergebracht. Die Anstalt kostete rund 14,000 Franken. Die Stadt Biel gab den Baugrund und liefert aus der städtischen Wasserversorgung das nötige Quellwasser. Die Anstalt enthält 56 Si̦i̦bchäste für d’Foornen-Äili, eine starke Batterie (24) Zuger-Gleeser für Fälche, Ferras, Pfä̆rit, Bondelles. In dem kleinen Aquarium an der Außenwand stellen kleine Rägebogeforälle, mit prachtvoll schimmerndem Farbenkleid angetan, ihr munteres, possierliches Leben und Treiben zur Schau. Im vorherigen Spätherbst g’sträipfti Forelleneier, ¼ Million, sodann 200,000 Eier der oben spezifizierten Balche, Eier von Äsche und Hechte sind der Hauptgegenstand sorgfältiger Zucht. Die von diesem Bielerseeveräin unter der langjährigen Leitung von Sekundarlehrer Witschi in Brügg mustergültig erstellte Anstalt ist dem Fischereiaufseher Benguerel in Ligerz, vormals in Nidau, anvertraut.
Im Jahr 1920 hat der Verein in seiner neuen Anstalt gezogen: 8¼ Millionen Jungfische, nämlich: 196,700 Forellen, 385,800 Äsche, 3,148,000 Balchen, 4,500,000 Hechte. Alle wurden seeländischen Gewässern übergeben. 6
Im Jahr 1920 trat der Bielerseeverein aus dem kantonalen Fischereiverein aus und schloß sich an die Sektionen Bern-Stadt, Oberländischer Fischerverein, Sportfischereiverein Thun, Fischervereine Laupe n, Arbärg, alti Aare Lyß, Riverains de la Suze, Bụ̈ụ̈re an. Alle diese schließen sich zusammen zu einem neuen Verband für rationelle Gewässerbewirtschaftung. 7
Schon im August 1917 fand in Biel die Hauptversammlung des Schweizerischen Fischereivereins statt, an welcher Maurice Vouga, Generalinspektor der Fischerei des Neuenburgersee, sich für richtige Hege und Pflege und Nutzung des Fischbestandes verwendete. Daß 1918 dieser See allein für fast e halbi Milion Fische uf e Märit lieferte, beweist glänzend, daß die Schweiz dem Ausland Fische chönnt abgää statt von ihm z’cha̦uffe. Für eine große Zukunft der schweizerischen Fischzucht bürgt die Tätigkeit eines Dr. Surbeck als eidgenössischen Fischereiinspektors.

Im Strandboden bei Erlach
Birken und Erlengebüsch
(links Ausblick nach See und Insel)
Ein Haupterfolg der künstlichen Fischzucht besteht darin, daß nü̦ü̦n 96 Zäche̥tel der Jungfische die heikle Dottersackperiode überstehen, während in freier Natur bloß 8% befruchtete Eier und 3% lebensfähige Fischchen dḁrvo chämme n (fi̦i̦r chämme). 8 Auch wird dem Überwiegen der Männchen vorgebeugt. Die weibliche Foorne z. B. — mit der graade anstatt ịịg’hi̦ckte Schwanzflosse und dem geraden statt in e Ha̦a̦gge auslaufenden Unterkiefer — erreicht an Zahl annähernd die der Milchner. Um so lehrreicher gestalten sich demgemäß die Veranschaulichungen der Entwicklung von Bruten, Sömmerlingen, Jährlingen, Zuchtfischeu in Anstalten und an Ausstellungen. Wer die sieht, wird zwischen Vreenedag und Mitti Aberelle keine Forelle mit dem Hungerchopf als Zeichen des erschöpfenden Läich mehr zu essen begehren. Und Foornesetzlig für Fischzucht im Weier bezieht er bloß durch Vermittlung staatlicher Anstalten, welche die allenfalls nach alter Methode g’sträipfte Rögener zäichne. Solches ụụsdrü̦cke übt der Seevogt auch an den laichreifen Balchen, worauf er sie mittelst des «c» (« contrôlé»), welches durch pärfforiere im Schwanz angebracht wird, als verkaufsfähig erklärt. Vormals geschah dieses mittelst des plombiere: der Seevogt brachte am Tier eine Art Bleisiegel an.
Solche See- und Zihlvögt, zusammen nunmehr Fischvögt geheißen, treffen wir schon vor 1559. Sie stehen nun im Kanton Bern unter dessen Fischereiụụfsäher, wie dieser unter dem eidgenössischen Fischereiinspektor.
1
Man «pfeift» auf den geringwertigen Schwamm, der nur zu auffällig nach «Pfeffer» schmeckt.
2
Flörike 57; Ehrenkr. 282.
3
Flör. 99; Ehrenkr. 284.
4
Flör. 6; Ehrenkr. 285.
5
Spitteler
6
«Berner Woche» 1921, Nr. 20, S. 240.
7
«Bund».
8
Goeldi 507.
Diesen Beamten steht nunmehr eine doppelte Befugnis zu: neben der vormaligen bloßen Schonung des Fischbestandes eine positive Förderung desselben. Zu jener gehört vor allem die Überwachung der neu gelegten ständigen Bänne. Das sind die durch Boje 1 abgegrenzten, die alten zwe Stäiwü̦ü̦rf (s. u.) weiten Seeịịläüf vo de Flüß, und die Vorblätz zo de Fischläitere, welche den laichenden Forellen zum Anlauf für ihre Sprünge ( S. 81) zugemessen sind. — Der Schutz besteht ferner in scharfem büeße des Übersehens von Schonzeit und Schongebiet, des Fangens untermäßiger Fische, des schränze (seitlich einschneidender Verwundung) von Fischen mittelst der Jụckschnuer. 97 — Ein besonders leidiges Kapitel ist aber die Vergiftung der Flüsse mit Fabrikabfällen. Diese hat freilich ihr großartiges Vorbild in unserm städtischen und diesem nachgeahmten dörflichen Kloakensystem. In späteren Jahrhunderten wird man d’Hän͜d über em Chopf z’sämmeschloo über die Gedankenlosigkeit und Liederligi, mit welcher Abfallstoffe menschlichen Haushaltes und Stoffwechsels kurzerhand in Flüsse und Seen geschwemmt werden. So gehen Millionen von Franken wirtschaftlicher Werte nicht nur verloren, sondern sie gefährden zumal im Flußfischbestand Millionen anderer Werte. Dazu kommt die Vergeudung herrlichen Quellwassers, mit welchen durch Teichfischerei sich neue Werte anlegen ließen. Unsern Flüssen aber könnten noch ungeschätzte elektrische Kräfte abgewonnen werden, auch für Aufsparung der bisher zum fụ̈ụ̈re verwendeten Du̦u̦rbe zum sanitarisch richtigen ụụfsụụge und ịịmache (einhüllen) besagter Abfallstoffe. Diese hinwieder ließen sich, wie das Vorgehen in St. Gallen beweist, in einer dreifachen Abstufung von Senklöchern mit Ein- und Abfluß zu wuehlige Pflanzblätze gestalten für tiefwurzelige Futterkräuter, für ebensolche Futtergräser und schließlich für das Plankton, an welches namentlich die jungen Coregonen ( Balche und Pfärig) gewiesen sind. 2
Dieser sogar in der Lebensmittelnot der Weltkriegszeit so grandig versouete (verschwendeten) Stoffe hat sich kein Geringerer als der großwürfige Viktor Hugo angenommen. Was er in seinen « Misérables» 3 über das Schwemmsystem von Paris sagt, gilt nicht weniger von dessen Nachahmung in unsern Städten und städtischen Dörfern:
Paris g’heit alli Johr fụ̈ụ̈fezwänz’g Milione i d’s Wasser. Ung’växiert! Wie den n? u worfüür?
Tag u Nacht g’heit’s Gält furt. Für nụ̈ụ̈t. Was dänkt es darbịị? Nụ̈ụ̈t. Was wott’s dḁrmit? Nụ̈ụ̈t. Wormit macht es das? Mit sim Bụụch. Was isch dä «Bụụch»? Si Kanalisazion.
Fụ̈fezwänz’g Milione u̦f d’s min͜dste! So säge die, wo’s chönne wüsse.
Daß von allem Dünger i der Wält dä vo Mentsche der best isch, wäiß mḁ langisch. Aber d’Chinese — mueß mḁ si ch nid schäme, ’s z’sääge? — häi’s vór üüs g’wüßt. Aber die schiniere si ch ni̦i̦d, dä Dräck z’bruuche. U drum isch ihres Land hü̦t no so jung, wi zu Vatter Abrahams 98 Zite. Der Wäize gi bt füüfezwänzmol der Soommen umme... Die wüsse, wo d’s Guld li̦ggt, u sie brụụche’s. Mier wüsse’s oog, u mier g’heie ’s furt.
G’heie furt, wo mer numme bruuchti d’rụf z’recke, u räiche mit Ledischiff fü̦r n es Sündegält der Mist vo Sturmvöögel u Fettgäns fast gar am Südpool.
Di G’hü̦derhụ̈ffe i den Eggen usse a der Stadt maarchi, u di G’schöörhụ̈ffe, wo d’Fuehrlüt z’Nacht i de Gasse z’sämmeru̦mple, u dä stinkig schlammig Ablạuf un͜der de B’setzistäine, wụ̈ssit der, was das isch? Das isch alls äi bluemigi Matte! Das isch saftig grü̦ens Chrụt u Gras! Das isch Chölm u das sị Fäälbäüm. Das isch Haas u Hirz, das isch Chue u Roß. Un isch das häimelig möögge vom Stier, wo guetmüetig u z’friide, wen n er vo der Waid chunnt, sim Mäister gueten Oobe säit. Das isch Heu, es schmeckt, dir möchtit sälber dḁrvoo; das si Wäizenääri, gääl wi Guld; das isch Brot i der Tischdru̦cke, dir bruuchit nummen abz’haue! Das isch warms, roots Bluet, wo in äünen Oodere lạuft; isch G’sundhäit u Lust u Lääbe.
So ist d’Wält. Die wunderbári Welt voll G’häimniß un d Unergrü̦ndlichkäit. Hie nide Verwandlung, dert obe Verklärung.
Den Ruf des Poeten in die nüchterne Praxis umzusetzen, haben Fischzuchtvereine bereits begonnen. Schauen wir nun aber einem ihrer Mitglieder zu, wie sie in der Pflege der künstlichen Brut ’s aachehre.
Auch den Laien interessiert schon die Ernährung der Brut mit g’schabtem Milzi, mit g’chochetem Bluet und andern im stru̦dlige Wasser entgifteten Schlachthausabfällen, sodann mit Fischmehl u. dgl. Den ausgesetzten Jungfischen kommen alsdann Fläüge, Wü̦ü̦rm und Chrebsli aller Art, ferner Pflanzen, wie z. B. der Brunnchresse̥ch aus dem Brunnmï̦hliweier und dem Chroosbrï̦nneli zugute. Sie lassen sich auch den in Gefangenschaft gefütterten Fischen bequem zuehaa. Einzig der Äsch verschmäht Kunstfutter. Das ist drum gar es schụ̈ụ̈chs un es mißtreus Tier, wo niemmerem nụ̈ụ̈t trauet. Ergiebiger und bequemer läßt man ihn in Fluß und Bach sich tummeln, wie den Hecht, das Egli, die Brachsle, die Seeforelle, die Coregonen als die Brotfische der Juraseen, deren Läich in erster Linie zu schützen ist. Zur Förderung der Fischzucht sollte das bernische Gesetz vom 28. Horner 1833 mit dem schweizerischen vom 21. Christmonat 1888 in bessern Einklang gebracht werden. So fordern es die Fischermannen am See.
1
Wie die
Gráwatte,
cravatte eigentlich «die Kroatin» ist, so vielleicht (nach
Walde 93) die l.
boia eine den Boiern abgesehene, leinene oder eiserne jochartige Halsfessel für Sklaven und Verbrecher, später Fußfessel (
M-L. Wb. 1190). Die nd.
boje, Boje ist sodann zunächst ein auf dem Wasser schwimmendes, mit einem Seil festgehaltenes Stück Holz (
Kluge 64) und nun eine Ankertonne
2
Über das besonders im Bieler- und Murten-, aber auch im Neuenburgersee reiche Plankton (Zusammensetzung von etwa 30 niedrigen Tier- und 40 Pflanzenarten), welches 4 bis 5% des Seewassers ausmacht, referierte am 18. Juni 1916 in bahnbrechendem Vortrag auf der Bielerinsel Prof. Fuhrmann in Basel.
3
Paris, Nelson. Im 5. Teil (
Jean Valjean), 2. Buch (
L’intestin du Léviathan), S. 134 ff. (
La terre appauvrie par la mer).