
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Karl Brendel wurde 1871 in einer thüringischen Stadt geboren, als Sohn eines Fuhrunternehmers, der noch acht andere Kinder – drei Söhne und fünf Töchter – hatte. Beide Eltern wurden über 70 Jahre alt und scheinen gesund gewesen zu sein. Von »Nervenleiden« in der Familie ist nichts bekannt geworden. Über seine eigene Entwicklung gab Brendel 1906, im Beginn seiner Erkrankung an, er habe frühzeitig gehen und sprechen gelernt und keine auffallenden Entwicklungsstörungen oder krankhaften Erscheinungen in seiner Kindheit gezeigt. Er wuchs im Elternhause auf und besuchte vom 6. bis 14. Jahre die Volksschule, in der er gut vorwärts kam, da er schnell auffaßte und ein gutes Gedächtnis hatte. Er meint, er sei lebhaft und gutmütig gewesen als Kind. Nach der Schulzeit erlernte er das Maurerhandwerk und war an verschiedenen Orten tätig, u. a. in Westfalen und in Lothringen. Neuerdings behauptet er, verschiedene Berufe ausgeübt zu haben: er sei nicht nur Maurer, sondern auch Stukkateur und Former in Eisenwerken gewesen. 1895 heiratete er eine Witwe mit drei Kindern. Aus dieser Ehe stammen noch zwei eigene Kinder, die 1906 als körperlich und geistig gesund bezeichnet wurden. Die Ehe soll angeblich gut gewesen, jedoch 1902 wegen einer Gefängnisstrafe, die Brendel abzubüßen hatte, geschieden worden sein. – Brendel ist seit 1892 wiederholt mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen und 12 mal bestraft wegen Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt, Beleidigung, Kuppelei, Sachbeschädigung. – 1900 erlitt er eine Quetschung am linken Bein. Danach (ob im Zusammenhang damit, ist zweifelhaft) hatte er 1902 an diesem Bein mehrere Operationen durchzumachen – anscheinend wegen Abszeßbildung im Anschluß an Furunkulose –, und schließlich mußte das Bein ganz hoch amputiert werden. Mit der Krankenkasse hatte er später lange Auseinandersetzungen über seine Rente, wobei er seine Interessen mit großer Hartnäckigkeit verfocht. Im übrigen scheint er nie krank gewesen zu sein, auch keine Geschlechtskrankheiten durchgemacht zu haben.
Über den offenkundigen Beginn der Krankheit liegt das Gutachten eines Kreisarztes vom 2. Oktober 1906 vor, der Brendel in der Haft beobachtet hatte und ihm als Geisteskranken den Schutz des § 1 des BGB. mit Bezug auf seine Straftat vom 30. Juni 1906 (Körperverletzung und Widerstand) zubilligte. Darin heißt es: »Uber die Zeit ist er klar, weiß, wo er sich befindet, kennt die Beamten und zeigt auch leidliche Schulkenntnisse. Meist sitzt er ruhig in seiner Zelle, ist heiterer Stimmung und liest entweder viel in Büchern, in denen er stets Berührungspunkte mit seinen Ideen findet, oder schreibt seine Erlebnisse auf, und zwar mit Vorliebe in gebundener Form. Richtet man eine Frage an ihn, so beantwortet er diese zunächst richtig, läßt man ihn aber weiter reden, so äußert er, zunächst im Zusammenhang mit der gestellten Frage, später ganz sinnlos, Ideen, die zum Teil Verfolgungs-, zum Teil Größenvorstellungen sind. Je länger er spricht, je verworrener werden seine Äußerungen. Wenn man ihn aber öfter hört, bemerkt man doch, daß keine völlige Ideenflucht besteht, sondern daß es immer dieselben Personen sind, mit denen sich seine Gedanken beschäftigen. Er hört Stimmen zu ihm sprechen: ›ich bin dem Kaiser sein Bruder, ich bin ein Monarch, was hat die Geistlichkeit für ein Recht, aus mir einen Heiland zu machen; die Polizei ist der allmächtige Gott, Pastor Schmidt ist der Gesetzgeber, die Geistlichkeit der Totengräber.‹ Man hat ihn auf alle mögliche Weise zu vergiften versucht: ›Schwefel, Lysol, Alaun, Hirschbrunnwasser, Augenverblende, Opium, Arsen.‹ Ganz wunderlicher Mittel haben sich seine Feinde bedient, um ihn zu töten. Sein Bett sei mit Edelsteinen belegt gewesen, dann seien ihm Platten auf den Kopf gelegt worden und der elektrische Strom durch ihn geleitet. Im Gefängnis unterhält sich andauernd ein Bauchredner mit ihm. Alle diese Dinge werden von Brendel sehr geläufig vorgebracht, als ob es ganz selbstverständliche Dinge wären. Äußert man Zweifel, so sagt er ganz ruhig: ›Ach, Herr Doktor, das verstehen Sie nicht.‹ Gesichtshalluzinationen will er nicht haben. Während der Zeit der Beobachtung verhielt sich Brendel stets gleich. Niemals gelang es, auch nur 5 Minuten lang ein vernünftiges Gespräch mit ihm zu führen; stets schweifte er sofort ab. Die gleiche Beobachtung haben auch die Beamten des Gefängnisses gemacht, die in der Regel gleichfalls eine heitere Stimmung an ihm beobachtet haben. Einige Male soll er allerdings auch wegen geringfügiger Dinge hochgradig erregt gewesen sein und sehr geschimpft haben.«
In der Krankengeschichte heißt es kurz darauf (Nov. 1906): »Patient hat sich bis jetzt ruhig verhalten, der Gesichtsausdruck ist heiter, er ist stets vergnügter Stimmung. Er antwortet auf alle Fragen mit großer Weitschweifigkeit und großem Wortschwall, schweift leicht ab, und kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Örtlich und zeitlich ist er gut orientiert; ebenso gibt er über seine persönlichen Verhältnisse richtige Auskunft. (Wochentag?) ›Mittwoch, da wird die Woche geteilt.‹ (Warum so oft bestraft?) ›Das ist stets durch die Polizei gekommen.‹ Zuletzt habe er ein Jahr und einen Monat wegen Körperverletzung gehabt. Er solle seine Frau geschlagen haben, da sei er aber unschuldig. ›Pastor Göbel wollte alle Menschen schmeißen, ohne sie zu berühren. Der ist nachts an mir gewesen, hat mir Schwefel und Lysol ins Wasser getan.‹ Er hätte oft gedacht, der Arzt hätte ihm Morphium in den Kaffee getan. ›Das war 1900 den neunten. 1903 haben sie eine Auferstehung Christi mit mir gemacht, d. h. durch den Erzkönig und die Elektrizität. An einem großen Schwungrad sind viele Riemen, das nennt man den Erzkönig. – Am Abend haben sie mir Opium durch die Tür geblasen, und mit Weihrauch vor der Tür geräuchert, um mir den Atem abzunehmen. Ich sollte meinen Tod lassen für den Pastor Göbel, also einen Opfertod.‹ – Er hätte angegeben, er hätte seine Strafe unschuldig angetreten; er hätte seine Frau nicht geschlagen. (Stimmen?) Er habe Stimmen gehört; der Stimme nach war es der Pastor Göbel gewesen, ob ich Gesetz, Gericht und Polizei anerkennen wolle. ›Durch die frohe Botschaft und durch das Lesen wisse er das.‹ – (Vergnügt?) ›O ja, immer sehr lustig.‹ – (Verfolgt?) ›Ja, unterwegs, wie ich von Barmen nach Mühlhausen wollte. Sie wollten mich hinterkünftig totstechen: Sie riefen: ›Wenn du da hingehst, tun wir dich totmachen.‹ Der Pastor Göbel stellte sich hin für Jesus Christus; er könnte allen Menschen für sieben Jahrtausende die Herzenskammer offen machen; er hätte die Schlüssel dazu.«
Aber die hier vermerkte harmlose Umgänglichkeit ist von kurzer Dauer. Nach wenigen Tagen mischt Brendel sich vorlaut in alles, was in seiner Umgebung vorgeht; schimpft und droht, so daß er mehrmals auf andere Abteilungen verlegt werden muß. Sein Verhalten wechselt im Laufe des Winters noch wiederholt: immer wieder werden Zeiten, in denen er sich ruhig, geordnet, gefällig, munter benimmt, von Erregungszuständen unterbrochen, in denen er laut und streitsüchtig wird. Dabei sind dann seine Äußerungen von Wahnvorstellungen verschiedener Art, besonders im Sinne des Größenwahns erfüllt, z. B.: »Ich bin Jesus Christus selbst, ich arbeite für Kaiser und Reich, ich bin Sieger in Christus, ich bin Gott, ich brauche Kaiser und König nicht anzuerkennen« usw. Uber Sinnestäuschungen findet sich leider aus dieser Zeit keinerlei Angabe. – Im Frühjahr 1907 wird Brendel in eine andere Anstalt überführt, in der er seither geblieben ist. Auch dort wechselt seine Stimmungslage und entsprechend sein Verhalten in der geschilderten Weise. Die Krankengeschichte berichtet nun über die Symptome etwas ausführlicher. Wieder stehen im Vordergrunde Wahnvorstellungen in bezug auf seine Person: er besitze ein Fürstentum, ein Herzogtum, ein Königreich. Dazu treten Erlebnisse, die auf wahnhafter Umdeutung von körperlichen Sensationen beruhen: er habe schon einmal den Opfertod erlitten. Leute, die sich als Pfleger ausgäben, hätten ihm die Knochen kaputt gemacht, den Hals zugeschnürt. Durch fremde Beeinflussung leide er an absonderlichen Körpergefühlen. Nahrungsverweigerung deutet auf Vergiftungsfurcht hin. Er führt erregte Selbstgespräche, schimpft laut, droht mit Schlagen – kurzum, die meisten Anzeichen einer akuten halluzinatorischen Psychose sind gegeben.
Zugleich aber tritt schon eine Gruppe von Symptomen auf, die es wahrscheinlich macht, daß der akuten Erkrankung bereits ein längeres Vorstadium vorausgegangen ist, in dem für einen Kundigen bei genauer Prüfung die Diagnose wohl schon zu stellen gewesen wäre. Brendel war nämlich sowohl in seinem äußeren Benehmen, wie in seinem Sprachschatz durchaus maniriert und verschroben. Er gebrauchte eine »Menge neugebildeter, größtenteils ganz unverständlicher Worte«. Der Fortgang der Krankheit beweist, daß es sich nicht um den akuten Schub einer in Phasen mit Remissionen verlaufenden Krankheit handelte, sondern um einen fast stetig fortschreitenden schleichenden Prozeß, der nicht zu einem deutlichen Abschluß im Sinne eines schizophrenen Endzustandes führte. Brendels Verhalten hat sich in fast 15 Jahren so wenig mehr geändert, wie seine Stellung zur Außenwelt. Immer wieder erschwerten heftige Erregungszustände, die deutlich mit halluzinatorischen Erlebnissen zusammenhingen, den Umgang mit dem sonst willigen, munteren und bei all seiner Verschrobenheit in praktischen Dingen sehr anstelligen Mann. Er muß deswegen stets im festen Haus gehalten werden, wo er eine Zelle bewohnt, in der man ihn zu erregten Zeiten leicht isolieren kann, während er sich sonst unter den anderen Kranken bewegt und bei der Hausarbeit nützlich macht.
Bei zwei Explorationen, die wir 1920 und 1921 in der Anstalt vornahmen, war Brendel überaus zugänglich und gesprächig. Die riesige Gestalt, auf einem Beine in schnellen, wippenden Sprüngen sich fortbewegend, bietet einen grotesken Anblick. Das etwas krampfhaft verkniffene Gesicht mit tiefliegenden hellen Augen erinnert im Ausdruck an Bilder des späten Strindberg. Beim Sprechen belebt es sich durch eine äußerst bewegliche und präzise Mimik mit schauspielerischem Einschlag. Parallel damit geht eine ebenso prägnante Gebärdensprache. Alles, was er sagt, stellt er mit dem ganzen Körper dar, und zwar mit so ausladenden wuchtigen Bewegungen, daß man den Wärtern gern glaubt, wenn sie versichern, zu fünft kaum mit Brendel fertig zu werden, wenn er erregt ist und etwa einen Mitpatienten, der ihn reizt, zu erwürgen sucht. Obgleich er anscheinend im Gespräch bereitwillig auf den Partner eingeht, so ist es doch sehr schwer, auch nur einen zusammenhängenden Satz von ihm zu erlangen. Er wendet sich sogleich zu weitausholenden Erzählungen, wird lebhaft, mischt verschrobene Ausdrücke und Wortneubildungen ein und ist in wenigen Sekunden tief in seiner persönlichen Vorstellungswelt. Seine Sprache ist, von den eigenen Worten abgesehen, ebenso prägnant wie seine Gesten. Auch mitten in sonderbar verschrobenen Gedankenkomplexen gelingen ihm zahlreiche gut pointierte allgemein-weltanschauliche Aussprüche. An den intensivsten Stellen hat sein Gebaren etwas echt Dämonisches von großem Stil, nicht im Sinne eines Pathos, sondern eines fast wilden Zynismus, der alles Erleben als Spielball grotesk-launischer Einfälle vergewaltigt.
Brendel ist während des ganzen Verlaufs seiner Krankheit zeitlich und räumlich völlig orientiert gewesen. Auch für die erste akute halluzinatorische Phase wird dies in den Akten ausdrücklich betont. Sein Gedächtnis ist sehr gut; er weiß auch entlegene Dinge, wie die Adresse eines Bruders vor 15 Jahren, sogleich zu reproduzieren. Die reichliche Verwendung von Zeitereignissen in seinen neueren schriftlichen Äußerungen und in der Unterhaltung zeigt an, daß auch seine Merkfähigkeit gut erhalten ist. Wenig Sicheres läßt sich über die Treue seines Gedächtnisses sagen, sofern es sich auf den Zusammenhang seiner Erlebnisse, ihre Bedeutung, kausale Verknüpfung u. dgl. bezieht. Aber die Quellen dieser Unsicherheit liegen auf verschiedenen Gebieten. Da durch halluzinatorische Erlebnisse seine Stellung zur Umwelt seit langem bestimmt ist, so kann man vom Beginn der Erkrankung an, also bereits einige Jahre vor dem Manifestwerden 1906, nicht mehr mit einer nüchternen Buchung der Erlebniskomponenten im Sinne des Normalmenschen rechnen. Und wenn einmal eine derartige Lockerung im Verhältnis zur sinnlich wahrnehmbaren Umwelt eingetreten ist, wenn jeder einfache Eindruck in phantastischer Weise über seine rationale Bedeutung hinaus ins Vielsagende oder ins Unheimliche gesteigert werden kann, so ist auch der nachträglichen Umbildung zuerst schlicht erlebter Ereignisse Tor und Tür geöffnet: Erinnerungstäuschungen und Konfabulationen aller Art werden den »objektiven« Erlebniskern – wenn man einen derartigen Hilfsbegriff einmal in Kauf nehmen will – überwuchern. In der Tat ist es bei Brendel völlig ausgeschlossen, über irgendwelche Ereignisse seines Lebens bündige Auskunft zu erlangen. Einige formale Daten erhält man leicht (Zeit, Ort, Personennamen). Sobald aber das Inhaltliche aufgerollt wird, entgleitet er in seine chaotische Vorstellungswelt, die uns nur noch in Bruchstücken unmittelbar verständlich ist und vorsichtiger Analyse die allergrößten Schwierigkeiten entgegensetzt. Trotzdem muß dieser Versuch mit Hilfe der mündlichen und schriftlichen Äußerungen Brendels gemacht werden, ehe wir es unternehmen, den einzelnen psychopathologischen Phänomenen nachzugehen.
An schriftlichen Aufzeichnungen liegen vor zwei dicke Quarthefte, eng mit Bleistift beschrieben, ferner einige 30 einzelne Blätter, Briefe u. dgl. Das meiste stammt aus den letzten Jahren, doch sind ein paar Stücke früher datiert. Einige Beispiele sagen mehr als Beschreibung. So heißt es November 1906 in einem Gesuch an den Abteilungsarzt der Anstalt: »Da ich meiner Pflicht bin nachgehgangen u. hatte mich darauf verlassen, das ich meinen Betriebs Unfall nach der dreizehnte woche angeh Meldet wurden ist von Brendel so wahrren die Infaliden Alters Versicherungs Anstahlt verpflichtet das der Behrufsgehnossenschaft in Erkenntniss zu setzen, auch ein Gefängnis, denn derselbe ein Unfall erlitten hat, der Berufsgenossenschaft in Ergennis zu setzen, nicht den Armmen Menschen vor die türe zu setzen, Wenn derselbe in ein Krankenhaus überführt wird zur einer Opheration, dann dritt das Gefängnis hin und sagt, er hat kein Unfall bei uns erlitten, da derselbe sich soll an die Geistlichkeit halten; Warum hat der Geistliche den Armmen Menschen zu dem Artz geschickt zu einer Opheration. Da der Geistliche doch nicht, der Lebendige Jesus ist, auch nicht mein Gott for stehlt da die Geistlichkeit blos mit starke gesunde Menschen Arbeiten thut, durch das Himmottisieren, auch wieder wass dem Geistlichkeit seine Diener anbelangen, die Menschen zu verflogen, das sind die Weißsager, das kommt davon, wenn der Mensch sein Mund zu hält, die Stimme dann Weider schald, ist zu sagen Bauchrettenner wass andere Leute eine Engstlichkeit beförten tut, den Armmen Menschen eine Wuth zu bringt, ist er in der der mite verliert er seine kraft, so sind die Armmen Menschen dringend geh zwungen von dem Artz kräftig zu Essen.«
Juni 1912: Großartige Liebe: »Himmelshölle in unterirtischen Grünte der Tieffession in Gewerbs mäßig zu bringen Kohle gaas Himmels Regen Naftalin Fasstalin Regen Wasser zur Erde am Rande Schmirgel bei den kultussfähigkeiten, die man an dem Kopfe des auspumpen gebraucht durch Blitz Donner Hagel Strom Gewitter unter der Kreatur der Allmächtigkeit Allwissent. Treibt in Wesen durch Wolken Luft Wind Hauch in der Zitone Bonjobilato Wirbel durch dem Geheul Uber nuss Süd Ost Nord West durch Kugel Schlangen Zeichen in der Sichtbarkeit, bei Aldem Ihreseits en kam Herscht Ahtrobant Licht der das Wimern erhöret in dem Glühkörper Vaktior Poesie Also Sündflut Zions Leute an rufen dem Scheinwerfr in Silben Unfruchtbarkeit, in Wort Chrisstal in sein Allein beobachtung in Leitung seiner führung in dem Pastorer Jugjektief Weissrosse. Frakekatur tapfere Helden Abt Ab in der bewohnerschaft. Leicht Geisteskrank genannt in Gifhäuser. Sozialgenossenschaft durch den Schatzfreund. Hipschmann bitte bei Drumo Bart Elbert ohne diese andern bemerkt in der Seuche schön Geschmag Liebchen kunst Dinger. Eiweiss Essigess strakt Wein Eßstrakt Blutstal Eicksstrackt Mopfjum Opfjum Bleiwasser Jutiformbulwer Gloriform Zinkblei wasser fliessigen Höhnstein Brunzwasser Hirschwasser. Oh wih fiel Sachen habe ich noch –«
April 1919: »... meine Herrn, ich ersuche die korratie, dem's gefällt, die gesetze zur Last Ruht, die Fikuri zu leisten, aber da mit hin, bin ich augenblicklich, schon betreff, von 22. 4. 07 in einer Heilanstalt überführt über aussder Ambitasieon, mein lingen Bein der Hüfte u. Nervisitot Retur stelte, in dem die hände der die Oberation aussstellte mein Chef Bardeleben, u. kein Fürsorge Institut zur, Last dem Gedächtniss, ich der strafe um Not ausging. –«
(? 1919): »Von einer Haide! In einer Wüstung, sind auch Grass Kraut und Fruchtbare bäume drüber gewachsen, der Rede, u. nach der auferstehung, sind es derselben Wüstung fon Gott, erkant anerkennung Zirte Asspotomj; Geistesseele fon Herr; führe dich selbst du t; in heiligen Geiste lebt ewiglich, u. nicht fon unabhenglichen geiste, in einer unseebare zeit, fir dein dun und Wessen in einer anseeliche Persion krenklich erlebt du gehst Irrent, Wir exzerrdieren in ein Sütpohlparriks in dem yuqistriwierdigen Lebenssetzskraft ewiglich lio lomathi reflexs rögeen rerenz lelenz Afent fon Gott in himel eine Masascec über Volke der Erde memesser aus eine Guiahnuss keiner Denkt, woh raus es lang, Planeth ist Weisseslicht in Kometh die erde fon Kompaden erhöret Ziliede ein gang Diplomat, lio ist der höchste Horizont wass keine Affiäre Gott; Stiry Dexterry. Indanz J. Subdanz Joryom. die weit steht wih Asstromj. Der Abril hat fon Elf Monat 101. Eklebtisie, Verfolgung Geistes zerstörrung fon ein Wahnsinnigen, mit andere Geister schärtz u, witz darauf axtrezirt, aretirt geisteskrank, an dem es glaubt geheilt seist du bist in ewigkit fon deine leiteine lorelei bei leid von infrorenz fon Gott in himel zum Krieg zur Erde sein Kaiser geachtet die Welt aber noch nicht an dem Ort der Ruhe befart ewig.! ...«
Aus einem Heft: »Eine frage, so auch alle Tiere sind mit menschlichem Geiste verwant, aber bloß darin da der menschliche Geist wirksamer an die Tiere herraufzieht zu tun der menschliche Laute (?) zu leben zu einsieht die Tiere im geiste seele unschult in Menschen verstehen zu beurteilen die Tiere auf Erden für gewitterscheun wie Menschliches gehöf an die Tiere der geist for Menschen aus der land Tier ein hegt ...« Auf einem gelben Blatt: »»Ich tringe hier mit noch mahl geoframst das ich nicht berechtigt bin mir Haimadt beruhtigt irgent in ein Orte wegen des starke Kreutzvernägellung, die an Brendel geleistet ist, so wih der evangelische, & der katholische Geistliche auch öffentlich in dem Obpfrkreutz dem Platz verläst so auch der dan da unter klätert macht das selbe Spiel im unterrock – – So auch der Artz der in ein Menschen auf dem Tisch Nagelt kratz auch aus auf ein ander hosten woh die Masten & Schiffe an höchsten stehn in der Augen Welt so haben sich die Pfleger den Trilch und Schuhe selbst bei dem Geistlichen und dem Artz zu butzen lassen – –«
Die Schrift (vgl. Abb. 168) steht auf tiefem Formniveau, ist recht unleserlich, schwerflüssig, in runden Zügen ausfahrend. Von Rechtschreibung kann kaum die Rede sein. Die einfachsten Worte erscheinen in eigener Schreibweise (z. B. schreibt er stets »woh«), große Anfangsbuchstaben stehen stellenweise ebenso oft am falschen wie am richtigen Platze. Eine große Zahl von Worten schreibt er lautlich-mundartlich (meist thüringisch), z. B. »kleicher Massen, Sitzblatz, irtisch, betekt usw.« Diese Eigenheiten bewegen sich durchaus im Normalen. So schreiben zahllose Menschen mit geringer Schulbildung. Sobald wir jedoch die Satzbildung prüfen, reichen diese gewohnten Maßstäbe nicht mehr. Einfache, übersichtlich geschlossene Sätze kommen überhaupt nicht vor. Hat man wirklich einmal einen verständlichen Satzanfang, so geht er, häufig mit scheinbarer grammatikalischer Bindung, alsbald in eine endlose Wortreihe über, die oft genug erst nach einer Seite und wie zufällig mit einem Punkt endet. Die grammatikalischen Schemata, die in diesem Wortgewirr angewendet werden, sind höchst primitiv. Vollständige Urteilssätze, in denen Subjekt und Objekt durch ein Verbum verbunden sind, (auch adverbiale Sätze) kommen vor, machen jedoch nur einen geringen Teil der Texte aus. Adjektive sind in manchen Abschnitten überhaupt nicht aufzufinden. Wenn nun auch die Aneinanderfügung der als Vorstellungskomplexe auf zufassenden Wortgruppen häufig als regellose Reihung nach assoziativen Vorgängen, ohne formal-sprachliche Bindung erscheint, so kann man bei genauerer Prüfung doch unschwer einige grammatikalische Schemata finden, die mechanisch, ohne dem auszudrückenden Inhalte gemäß zu sein, sich dem Schreibenden aufdrängen. Derartige Schemata sind nun nicht etwa für diesen Fall besonders bezeichnend, sondern lassen sich in den meisten Fällen von »Sprachverwirrtheit und Inkohärenz« aufweisen: z. B. »spräche durch der Luft, in der künstliche Antwort segen läßt, in der Hauch Nähe & trogen läst der Frucht der früchte in dem Heissen Otzian von der Last andere helfen, in der anhaltente Tragkraft betacht, ertacht, in dem Jahren gewimelten Erdlaufen, etc.«
Daß die fünfmalige Bindung dieser Vorstellungskomplexe durch die Präposition »in«, die man räumlich oder in übertragendem Sinne begrifflich subsumierend verstehen kann, nicht etwa wörtlich gemeint ist, bedarf keines Beweises. Vielmehr muß man sie entweder als völlig leeres Schema für die Reihung solcher frei assoziierten Komplexe nehmen oder aber eine Reihe von Bedeutungen als mitschwingend anerkennen, etwa: worauf, wobei, in der dann, durch (= indem dadurch), um (räumlich zuordnend) u. a. Ähnlich formelhafte Bindungen sind: wogegen, der aber, und nicht (einfache Antithese). Und schließlich die einfachste, ganz locker nebenordnende, typisch für die Sprache des Kindes und des Kindermärchens – und der Bibel – das »und«. Eine Prüfung des Vorstellungsmaterials, das auf solche undifferenzierte Art aneinandergefügt ist, führt nur bei einem kleinen Teil der Komplexe zum Verständnis. Trotzdem ist der anfangs ganz aussichtslos scheinende Versuch lohnend, da aus den Bruchstücken verständlicher Sätze immerhin ein Teil des Vorstellungslebens klar wird.
Nehmen wir etwa den Abschnitt: Pastor Göbel usw., der allerdings besonders durchsichtig ist. »Pastor Köbel briefträger Sohn habe ich ihm gehaun u. wuste nicht das ehr in gefängniss Passtor wahr, habe ich im sein auf sehr auch noch geprügelt hartmann, ein Thüringer, schuster, so auch hier in X diess selbe zum Forspillung falsche Tatsache beurteil ich rufe mein Bein in himelan. um dem empfang X. Gnade der Umgebung für dem Einsitler fon mir die Wahrheit Du Mein eitlich Teut est, oh ihr mansarte Opfer wahrrum ich die geistliche verneinte wollen wir kein Infaliden Rente käm. Ein lam hält still, wih Brendel ess dem ärtzten in Krankenhaus tat dem zu vertraun ich selbst for mich, der Katostrophe ein Trat, sah ich mein Tot for augen ...« Aus mündlichen und sonstigen schriftlichen Äußerungen geht hervor, daß Brendel anscheinend in der Haft gegen den ihn besuchenden Geistlichen und gegen Aufseher tätlich geworden ist, was in dem Gutachten von 1906 ohne Personennennung auch kurz erwähnt wird. Dadurch wird der Satz bis: »Hartmann, ein Thüringer« inhaltlich mühelos verständlich, außer der Einschaltung »briefträger Sohn«, die sich auf den Pastor zu beziehen scheint und entweder als Personen verkennung (die dann den Angriff erklären könnte) oder als eine spielerische assoziative Einschaltung (z. B. Ähnlichkeit des Namens oder der äußeren Erscheinung mit einem dem Patienten bekannten Briefträger-Sohn). Im übrigen sind die inhaltlichen und grammatikalischen Beziehungen dieses Satzes trotz der Umstellungen, die wohl kaum über die volkstümliche Sprechgewohnheit hinausgehen, klar, »schuster, so auch hier dasselbe hier in X.« heißt: Sch., der hier in X. Aufseher ist, beurteiltes (meine Verkennung des Pastors?) als Vorspiegelung. – ich rufe mein Bein im Himmel an (– daß dies nicht der Fall ist –). Weiter etwa »der Empfang in X. brachte von der Umgebung Gnade für den Einsiedler. – Du deutest die Wahrheit meineidlich – ich verneinte die Geistlichkeit als Opfer, weil sie mir keine Invaliden-Rente geben (= käm) will.« So bleibt als ganz unverständlich nur das Wort »mansarte« übrig.
Prüft man in dieser Weise Brendels Schreibereien durch, so findet man vorwiegend folgende Vorstellungskomplexe: von rein biographischen Tatsachen kehren in seinen Betrachtungen immer wieder sein Unfall, die Operationen und die Amputation des Beines, besonders aber die Kämpfe um die Rente. Wiederholt mischt sich Erbitterung gegen die Geistlichkeit hinein, der gegenüber er sich als Opfer fühlt, offenbar in dem Sinne, daß sie, während er im Krankenhaus war, für die rechtzeitige Aufstellung des Rentengesuches hätten sorgen müssen – durch ein solches Versäumnis soll später ein Rentenverlust eingetreten sein.
Ein ganzer Komplex von Erinnerungen und Wahnvorstellungen untrennbar ineinander gewirrt, knüpft sich an die Person des Chirurgen von B., der Brendel länger behandelt hat und nun in dessen Vorstellungsleben eine solche Halbgottrolle spielt, wie etwa früher im Leben eines Kleinbauern der Hauptmann, bei dem er als Soldat die ganze Dienstzeit über als Bursche war. Tatsächlich scheint Brendel sich in der langen Zeit, die er im Krankenhaus zubringen mußte, auch betätigt zu haben. Denn eine große Menge von Medikamenten und chirurgischen Apparaten ist ihm ganz geläufig, wobei es freilich oft Schwierigkeiten macht, das Gemeinte in so entstellten Formen wie Barfimsalbe (= Paraffin), Jutiform (= Jodoform), Brangasse (= Brandgaze) wiederzuerkennen. Neuerdings behauptet er, er habe schon 1889 als Krankenpfleger bei von B. gelernt und gearbeitet. Es läßt sich leider nicht sicher feststellen, was wahr ist und wie weit die mythisierende Tendenz hier wirksam ist, die um solche, für das Leben eines Menschen wichtige Persönlichkeiten (nun gar bei einem Schizophrenen!) stets eine Hülle von Konfabulationen webt. Jedenfalls ist für Brendel der Chirurg von B. Repräsentant der großen Zeit seines Lebens, da er etwas galt, von einem hochstehenden Manne rücksichtsvoll, anerkennend oder gar kameradschaftlich behandelt wurde. In dieser Zeit hat wohl sein Geltungsgefühl den höchsten Gipfel für seine gesunden Tage erreicht. Diese psychische Bedeutung scheint uns nachhaltiger zu sein als die grob-körperliche, daß er in jener Zeit sein Bein einbüßte. Gewichtiger ist wohl die andere Folge seines langen Spitalaufenthaltes: daß er über Krankenpflege und anschließend über die Körperlichkeit im allgemeinen eine Reihe von Einzeltatsachen sich geläufig machte, die ihm später bei seinen phantastischen Vorstellungsspielen eine gewisse Erfahrungsgrundlage boten.
Nicht so leicht zu überblicken sind die Äußerungen Brendels über seine Ehe. Meist beschränkt er sich auf verhüllte Anspielungen. Nur an einer Stelle »schildert« er etwas: »Eine Frau Wittwe vergeht versuch kein leben mit im zu beschließen (d. h. bekommt der Versuch nicht, ihr Leben ohne einen zu beschließen?) sich an Jüngling um zu gehn, zu besuchen, wih er das tut, wih so es verlangt, in der gemietlichkeit, sempaty – ist so treiste an dem Jüngling, als wenn nichts for gefallen wahr, des in die Welt ein gesetze hat. Da geht das frische liebes verfahren wih bei dem Ersten und letzten Abentmahl auf eine entfäste Zeitraum – so wirt dem Arzt und Direktor u. Passtor for gesprochen um die ein wandfrage ...« An einer anderen Stelle verzeichnet er einige Daten aus seiner Ehe: Heirat 1895, Kinder geboren 1897; 98; 1900; 1903 und andere, schwer identifizierbare Angaben. In der Hauptsache scheint in seiner Vorstellung die Frau als aktive Persönlichkeit zu leben, gegen die der Mann einen schweren Stand hat. Irgendein Ausspruch, der auf eine gewisse Anhänglichkeit an die Familie schließen ließe, ist nicht bekannt. Ebensowenig läßt sich erkennen, wie weit die später zu besprechenden grob-sexuellen Phantasien etwa schon vor dem Ausbruch der Erkrankung eine Rolle gespielt haben.
Eine dritte Vorstellungsgruppe umfaßt die Erlebnisse aus der akuten halluzinatorischen Phase seiner Krankheit, und zwar offenbar vom Tage seiner letzten Verhaftung an. Die anschaulichste und relativ geschlossenste Schilderung dieses Tages gab Brendel bei einer Exploration, die wir Mai 1920 vornahmen. Sie folgt im Auszug: »in Lothringen, Herr! da wurd mir auf einmal so ängstlich, ich hätt fast in die Hose gek –, ich tappte wie ein blinder König, hab gezittert wie ein Hund – – – lauter Leute mit Kapuzen kommen daher – nur die Augen zu sehn – nachts wars, ich bettelte an einem Hause und ging weiter gegen den Wald – eine Nachtigall fing an zu singen – auf einmal ging vor mir ein Deckel in die Höhe – ein paar Menschen kriechen raus! – schnell weiter fort – hörte pfeifen, schießen – lag auf dem Felde wie tot, – dann kommt ein Mann auf mich zu und sagt: ›Sie, Männeken, Sie haben lange nichts gegessen, ich hab' Ihnen was aus Berlin gebracht.‹ – Auf einmal seh ich ein Mädchen im Busch mit einem Reh, die springen gleich davon, ich ihnen nach durch die Büsche, – fort sind sie. – Dann kam die Gendarmerie zu mir und sagt: »Ruh' n Sie sich etwas aus.« – da hatt' ich schon eine Funkstation und fühlte jeden Schlag und Strom in der ganzen Leitung. – – Im Wald ist überall ein Pfeifen und Zischen, Herr, hab' ich eine Angst gehabt! Abends waren wir in einer Wirtschaft, da frag ich, wie ich so bin, die Frau wird doch wohl keine Kalte haben? – Hupp, haben sie mich und weg war ich. – Im Gefängnis hieß es: Junge, raus, du hast gestohlen! – legte meine Pfeife auf den Tisch – und da kitzelte und stach es drin, wie nicht klug.« – »In einer Wirtschaft auf einem Ring steht geschrieben, daß der Sohn im Bett liegt bei der Mutter – und sie wollten mich abstechen – ich nach Haus und ihn vertobackt – ha! das knallte! – im Kopf macht alles rrrr – ich griff zum Messer, ä – da war Lothringen mein – ich los, versteckte mich in einem Haus – da wohnt grad der Gendarm drin, und den höre ich mit seiner Frau machen – das schrieb ich auf und hefte es an die Tür – der hat geflucht! – damals hat alles mich abgehört und war alles voll Händler und Betrüger, das war eine Katastrophe!«
Über die Deckelerscheinung im Walde gibt er noch folgendes an: »das sind Leute, die in einem Tunnel wohnten, um sich einen Napoleon zu gründen. – das kann man ja, wenn man die Hilfstruppen hat – in der Zelle, da hab' ich mal einen Geistlichen geschlagen, weil er einen Schlüssel in der Hand hielt und damit schießen wollte.« Aus dem Jahr 1906 berichtet er noch: damals habe er eben gelernt, verborgene Geister zu sehen, die nicht jeder sehen kann. »Wenn man draußen wandert, sieht man sie immer – – Im schwarzen Wasser sieht man genau, daß lauter Mordgeschichten vorgekommen sind, – Schwarzwaldgeschichten – der Himmel drüber ist eine Motte oder Made, wenn er weiß ist. – In Höhlen und Brunnen rumoren nachts Menschen, wenn wir schlafen; man kann hingehen, wenn man Courage hat und einen Strick; ich verlasse mich nicht auf den Zauber. – – Entweder Krieg, Tod oder Leben, oder Ergeben; Krieg oder Kreuz – Jesus, (das ist Pastor Göbel) der hat einen Tisch, darauf sind lauter Köpfe und Schwerter übers Kreuz – da fangen die Köpfe an zu sprechen, springen auf die Erde und wieder rauf durch Elektrizität – dadurch darf man sich nicht erschrecken und Krankheit holen.« Bruchstücke ähnlichen Inhalts findet man öfters unter seinen Schreibereien.
Schließlich mögen die Erinnerungen aus der Zeit seines Anstaltsaufenthaltes noch für sich aufgeführt werden. Bei diesen ist sicher anzunehmen, daß sie durchweg von den Trugwahrnehmungen beeinflußt sind, denen er bis zum heutigen Tage unterworfen ist. Um so mehr muß betont werden, daß er über eine Fülle von sachlich richtigen Daten verfügt, die auf die Regsamkeit, mit der er Nachrichten über geschätzte Personen aufnimmt, ein helles Licht werfen. Besonders bringt er aus dem Privatleben seiner Ärzte gern Einzelheiten vor; er weiß, wo sie studiert haben, kennt ihre Familienverhältnisse, und unterhält sich überhaupt gern in einem kollegialen Tone mit ihnen. Wahnhafte Einstellung gegen Ärzte kommt bei ihm gar nicht vor. Im Gegenteil betont das Krankenblatt immer wieder, wie er auch in erregten Zeiten stets dem Arzt beigesprungen ist, wenn etwa ein anderer Kranker bedrohlich wurde. – Anders steht er zum Wärterpersonal, dem er, wie das bei Kranken mit erregten halluzinatorischen Phasen gewöhnlich ist, Mißhandlungen vorwirft, insbesondere für die erste Zeit seiner Krankheit sexuelle Mißhandlungen. Wie lebhaft sexuelle Phantasien, wohl auch in Form echter Halluzinationen, ihn beschäftigt und gequält haben, geht aus der Angabe hervor, daß er wochenlang immer wieder unter wüstem Schimpfen aus dem Fenster nach einem Arzthause hin gedroht habe, weil sich dort ständig eine nackte Frau zeige. Damit sind die stärkeren Erlebnisse, die wir aus Brendels Leben kennen, schon erschöpft. Es bleibt übrig, nunmehr einen Grundriß seiner seelischen Persönlichkeit nach ihrer Hauptstruktur, ihrer Temperamentsanlage und ihrem Besitzstand zu entwerfen, wobei die vom Normalen abweichenden Symptome von selbst die Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.
Brendel ist ein ausgesprochen expansiver Mensch mit lebhafter Affektivität und meist gehobener Stimmungslage. Es fehlt ihm die Tendenz, sich stetig in die bestehenden sozialen Verhältnisse zu fügen, gleichmäßig zu arbeiten, seine Familie zu ernähren. Ob ein gewisser Hang zur Phantastik ihm schon früher eigen war, ist nicht sicher nachweisbar, aber sehr wahrscheinlich. Auch die leichte Reagibilität, die bei seiner etwas selbstherrlichen Kraftnatur so leicht zu Konflikten mit dem Strafgesetz führte, spricht dafür. Und hiermit steht die Hemmungslosigkeit seines Verhaltens in Zusammenhang, die offenbar nicht erst in der Psychose aufgetreten ist. Sein Grundstreben geht auf aktives Ergreifen der Umwelt, auf Lebensfülle, Macht, auch auf Wissen. Es ist nicht schwer, die erotische Triebkraft in seinem Gebaren nachzuweisen. Dagegen fehlt ihm durchaus jede Tendenz zu religiöser Ausweitung seines Wesens. – In ganz überzeugender Weise aber meinen wir bei Brendel eine nicht weiter zurückführbare Gestaltungskraft am Werke zu sehen, die schon in seiner Gebärdensprache, zumal wenn er Begebenheiten schildert, eine gewisse Leistungsstufe erreicht hat. Sie herrscht auch in seinem ungefügen sprachlichen Ausdruck und sie bemächtigt sich überhaupt bei ihm aller denkbaren Gegenstände, um sie – formend zu vergewaltigen. Soviel sich heute beurteilen läßt, hat Brendel ursprünglich über eine gute, vielleicht etwas mehr als durchschnittliche Intelligenz verfügt, die aber durch seine Unstetheit nicht zur Geltung kam. Auch heute noch spürt man durch alle Verschrobenheiten hindurch eine gewisse Sicherheit und Schnelligkeit im Auffassen. Die Anstalt rühmt seine Gewandtheit und Findigkeit bei der Ausführung von allerhand praktischen Arbeiten. Auch in seiner Beurteilung von Menschen und Dingen findet man oft genug eine in dem Wust schwer verständlicher Worte auffallende, Wesentliches treffende Erkenntnis.
Damit haben wir die Grundzüge von Brendels Persönlichkeit und Intelligenz allgemein dargestellt, ohne den Krankheitsbegriff zu Hilfe zu nehmen. Es ist nun zweifelhaft, an welcher Stelle wir die krankhafte Abweichung vom Normalen zu lokalisieren haben. Daß die Intelligenz irgendwie Schaden gelitten hat, wird niemand bezweifeln, der einige seiner Schriftstücke gelesen hat. Die Frage ist nur, ob dieser Schaden wirklich die Funktion der Intelligenz selbst betrifft, oder nicht vielmehr die Inhalte des Denkens. Das Erinnerungsmaterial, das ihm zur Verfügung steht, wurde schon einfach berichtend durchgemustert. Man könnte noch fragen, inwiefern seine Vorstellungen von allem Üblichen abweichen. An die biographischen Komplexe anknüpfend, müssen wir in erster Linie, als ausgesprochen pathologische Erlebnisse, die echten Halluzinationen näher betrachten. Besonders lebhaft scheinen diese beim Ausbruch der Psychose 1906 aufgetreten zu sein, wie die spontane Schilderung beweist, die Brendel im Mai 1920 entwarf. Damals stürmte eine Fülle von Gesichts- und Gehörshalluzinationen auf ihn ein, zu denen sich offenbar noch massenhaft Umdeutungen wirklicher Wahrnehmungen gesellten, so daß er in einen Angstraptus hineingeriet und später aus seinem Erregungszustand heraus im Wirtshaus gewalttätig wurde. Dieses primäre Wahnerlebnis, in dem der Unheimlichkeitscharakter und der Verfolgungswahn vorwiegt, ist heute noch so lebendig in seinem Vorstellungsleben, und zwar mit diesen Haupteigenschaften, daß er bei der Schilderung immer noch in eine gewisse Erregung gerät. Mit anderen Worten, er vermag bis heute noch nicht den Wahncharakter dieses akuten halluzinatorischen Erlebnisses zu erkennen, er steht noch nicht kritisch dazu. Oder, positiv ausgedrückt: in seinem Vorstellungsleben kommt auch heute noch mit Wirklichkeitscharakter vor: rätselhafte, unheimliche Erscheinungen, Deckel auf dem Waldboden, die aufklappen, Menschen und Tiere, die im Gebüsch verschwinden, ein Zischen, Pfeifen und Schießen in der Luft, das einem Angst macht, ein Gendarm, der einem Essen aus Berlin bringt usw. – Aus späterer Zeit wissen wir von nackten Frauen, die ihm erschienen, von einer Wasserjungfrau mit phallusartigem Körper, die noch jetzt täglich im Grase und auch im Zimmer umherhüpft.
Hier schließen sich ferner an zahlreiche abnorme Körpersensationen: im Primärerlebnis hat er »gleich eine ganze Funkstation im Leibe und fühlt jeden Schlag und Strom in der ganzen Leitung«. Ferner spürt er häufig ein Kitzeln und Stechen im Körper, besonders im Genitale – das Essen schmeckt nach allen möglichen Chemikalien, meist Giften usw. In das Gebiet des Verfolgungswahns fallen noch eine ganze Reihe von Einzelerlebnissen: der Pfarrer will ihn erschießen, zeitweise stehen Wärter und Mitkranke im Verdacht, ihm übel zu wollen, Christus will ihn kreuzigen und vergiften. Müssen wir uns so die Auffassungssphäre gelockert, bereichert, voll unheimlicher Erlebnisse vorstellen, so ist er seiner Natur nach diesen nun doch keineswegs hilflos ausgeliefert. Vielmehr setzt er der andrängenden übermächtigen Außenwelt, deren sein Verstand nicht mehr Meister wird, stärkere Kräfte entgegen; unversehens finden wir den Maurer in vollem Zuge, sich durch Magie und Zauberei mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Manche Äußerung könnte unverändert aus dem Munde eines Primitiven kommen, z. B. seine Schilderung des Spiegelzaubers: »Die Sonne ist ein ›Korbel‹, d. h. soviel wie Kurve. Sie dreht sich blitzschnell. Hält man sie fest, kann man einem Menschen den Hals damit abschneiden oder die Nieren, das nennt man den Harten Strich – da ist die Sonne ein Tod, ein Südpol-Parix. Oder man macht es mit dem Spiegel aus dem Schatten. Da kann man einen Strahl fangen, einen Menschen damit lähmen, oder ihm den Hals zudrehen. Bekennt er dann seine Schuld, so kann man ihn wieder loslassen – sonst muß er sterben.« Außer dieser einfachen Verzauberung oder Vernichtung eines anwesenden Menschen, vermag er jedoch auch entfernte Personen zur Ergebung zu bringen, und zwar ebenfalls mit Spiegel und Vergrößerungsglas. – »Hypnose kann man auch weittragend machen bis an's Weltende.«
Zusammenfassend ist zu sagen: bei Brendel passen die schizophrenen Hauptzüge so gut in seine charakterologische Struktur, daß ›die Veränderung der Persönlichkeit‹ nicht so tiefgreifend zu sein scheint, wie wir es zu sehen gewohnt sind. Gerade solche Fälle könnten die Frage nahelegen, ob etwa bestimmte Typen dem schizophrenen Prozeß gegenüber sich besser behaupten als andere, und welche Eigenschaften dafür wichtig sind. Sicherlich hat Brendel sich bei seiner autistischen Abkehr von der Außenwelt einen ungewöhnlich reichen Schatz an lebendigem Vorstellungsbesitz gerettet oder neu erworben. Das bezeugen seine Werke, denen wir uns nunmehr zuwenden.
Soviel sich feststellen läßt hat Brendel schon früher Neigung zum Formen und Schnitzen gehabt. Als Maurer will er auch bei Stukkateurarbeiten geholfen haben. Ferner behauptet er, plastischen Schmuck für Schränke u. dergl. aus Blut und Sägemehl geformt zu haben – diese Technik habe sich sehr gut bewährt. Nachprüfen lassen sich diese Angaben nicht, von der Familie werden sie bezweifelt. Ein Verfahren, aus Blut und Sägemehl plastische Dekorationen zu pressen, besteht tatsächlich und wird fabrikmäßig ausgenutzt. Seinen Kindern habe er nicht nur Rahmen geschnitzt, – sie mögen der im Krieg neu aufgeblühten Art an Scheußlichkeit nichts nachgegeben haben – sondern auch Puppen. Die Frau habe das gern gehabt und ihn immer dazu angetrieben. Auch will er eine Zeitlang als Former in einer Eisengießerei tätig gewesen sein. Aus diesen Angaben, die von ihm selbst stammen, geht hervor, daß er in seinen Berufen wiederholt Gelegenheit hatte, die Technik des Formens aus weichem Material zu üben, wodurch zweifellos die bewußt plastische Auffassung der Außenwelt über das gewöhnliche Maß gefördert worden ist. Dagegen spielt bei derartigen Tätigkeiten die eigene Erfindung so gut wie gar keine Rolle, zumal, wenn man wie Brendel mehr aushilfsweise mit dem fremden Beruf in Berührung kommt.
Anders zu werten ist das Schnitzen für seine Kinder. Dabei ist er spontan bildnerisch tätig und sucht ein noch so einfaches Anschauungsbild (Puppe kann ein durch wenige Kerben belebtes Holzstück sein!) zu verwirklichen. Wenn diese seine Angaben also zutreffen – man ist nie sicher, ob er nicht seine jetzige Tätigkeit aus irgendeinem Grunde in die Zeit seines Familienlebens zurückprojiziert –, so müßte man zugeben, daß er nicht völlig unvorbereitet, mit einem gewissen technischen Können, mit einiger Erfahrung über Bedingungen und Möglichkeiten des Gestaltens das Schnitzen wieder aufgenommen hätte. Erkundigungen bei der Familie haben freilich gar keine Bestätigung für irgendeine dieser Angaben gebracht. Eine recht gescheite Schwägerin, die über Brendel bestimmte und überzeugende Nachrichten gab, wußte nichts von solchen Neigungen, meinte vielmehr, er würde dazu nie Geduld gehabt haben. Wir dürfen also, selbst wenn wir aus Gewissenhaftigkeit damit rechnen wollen, daß Brendel bereits früher geschnitzt habe, diese Vorkenntnisse keinesfalls als sehr gewichtig in Anrechnung bringen.

Fall 17. Abb. 79. Kopf (Brot, geknetet). 24 h.
In der Anstalt begann Brendel 1912/13 Figuren aus gekautem Brot zu kneten, die sich nach Mitteilung der Ärzte und älterer Wärter meist durch Obszönität auszeichneten. Erhalten ist von diesen ersten Versuchen gar nichts. Das einzige Stück in Brottechnik, der Kopf Abb. 79, gehört an den Anfang seiner Produktion. Er ist mit Kalk überstrichen, so daß man ihn erst beim Betasten von einem Gipskopf unterscheiden kann. Der säulenförmige Hals, in eine Art Teller übergehend, wie der Fuß einer Vase, weist auf den Zusammenhang mit solchen stereometrischen Raumformen hin. Der Kopf selbst ist wenig durchgeformt. Nur die hervorquellenden, stark divergenten Augen sind sorgfältig und fast realistisch gebildet, was die beunruhigende Wirkung noch erhöht, zumal im Gegensatz zu den greulichen drei Mundspalten, die man nun auch realistisch zu nehmen geneigt ist. Die Hirnschale fehlt. Statt dessen sieht man Furchen und Windungen des Gehirns freiliegen, die jedoch von vorn nach hinten verlaufen. Erklärungen über die Entstehung der »Pystie« (– Büste) waren nicht zu erhalten. Etwa in der gleichen Zeit scheint er mit dem Holzschnitzen begonnen zu haben. Der damalige Abteilungsarzt, der Brendels Neigung unterstützte, berichtet, er habe nicht etwa erst tastende Versuche gemacht, sondern von Anfang an seine charakteristische Art gezeigt. Vorbilder interessierten ihn nie, selbst wenn man ihm eigens welche gab. Als ihm später einmal Bilder von Kunstwerken verschiedener Zeiten gezeigt wurden, gefielen ihm ägyptische besonders.
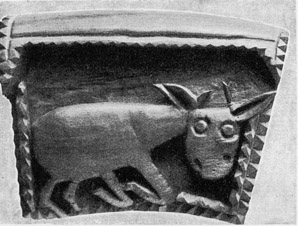
Fall 17. Abb. 80. Das bescheidene Tier (Holz). 14,5x11.
Von den Schnitzwerken, die im Besitz der Heidelberger Sammlung sind, ist das erste, soviel man weiß, das bescheidene Tier, Abb. 80, aus einem flachen Stück hellen Mahagoniholzes (offenbar von einem Möbel stammend, die Rückseite ist poliert). Ein Tier, seiner Körperform nach nicht näher bestimmbar, von der Seite gesehen, den flachen, breiten Kopf ganz herumwendend, so daß man von vorn auf ihn schaut. Große Ohren und kurze Hörner weisen auf ein Rind hin. Die Vorderbeine sind geknickt – das Tier scheint zu knien. Formal fällt auf die außerordentlich strenge Gebundenheit dieses Reliefs. Das ursprüngliche Volumen des Brettstückes wird als Idealraum sorgfältig beibehalten, indem durch stehengelassene (oben) und angesetzte, leicht gekerbte Umfassungsleisten eine vordere Grenzfläche, ein Proszeniumrahmen sozusagen gebaut wird, über den die Wölbung des Reliefs nicht hinauswächst. Diese Umrandung, die gerade unter den Füßen ausläßt, und dadurch der Gefahr entgeht, als Raumandeutung im realistischen Sinne, als Stall etwa, genommen zu werden, und wegen dieser Unterbrechung auch nicht als Bilderrahmen gelten kann, macht jedoch nur einen Teil der Gebundenheit aus, den äußeren, materiellen Teil. Die Körperformen an und für sich tragen denselben Charakter, auch wenn man ihre Konturen nicht auf den dicht andrängenden Rand bezieht. Fast als reine Horizontale zieht der Rücken dahin und setzt sich sogar als obere Stirnabgrenzung beinahe stetig fort, obwohl der Ohr- und Hornansatz die Kontinuität der Form unterbricht.
In ganz einfacher Kurve verläuft auch der Bauchumriß des wunderlich birnförmigen Körpers, der eher an Insektenleiber erinnert. Von dem flüchtig betonten Schwanzansatz sich steil senkend bis zum hintersten Beinansatz, dann umbiegend und sachte bis zu Augenhöhe aufsteigend; die vier Beine (nur durch die Richtung, nicht durch Abstand oder Überschneidung in vordere und hintere geschieden) aus sich entlassend, wie Konturausbuchtungen. Wie am Leib, so fehlen auch an den Beinen alle Formdetails und alle an irgendeinem realen Tier nachmeßbaren, richtigen Proportionen. Die Beinpaare sind nur durch strenge Parallelität der Haltung einander zugeordnet. Denkt man sich die geknickten Vorderbeine gestreckt, so würde diese Kuh einer Giraffe sehr ähnlich werden. Und schließlich der riesige, platte Kopf, an der Stirn ebenso breit wie am Maul, mit großen kreisrunden Knopfaugen, die wie durch Brillenränder mit sanftem, etwas glotzendem Staunen zu blicken scheinen. Die Nasenlöcher weit auseinander, ungleich hoch, ein Maul nur bei steiler Unteransicht zu bemerken. Breit, nur sacht ansteigend dehnen sich die mächtigen Ohren, zwischen denen zwei kärgliche Hornstumpen als einzige, ganz vom Grunde gelöste Details sich einander zuneigen.
Bei flüchtiger Betrachtung der Umrißform (sehr instruktiv ist es, sich diese durchzupausen!) könnte es scheinen, als stehe diese völlig auf der Stufe des Kindes. Aber je näher die Bekanntschaft wird, desto sicherer fühlt man einen Unterschied, der freilich schwer zu umschreiben ist. Gemeinsam ist beiden die Realitätsferne, die Vernachlässigung des charakteristischen Details, die auf geringer Klarheit und Fülle des Anschauungsbildes beruht. Gemeinsam dementsprechend die gleichmäßig hinziehende Umrißlinie, die »Aufzählung« der vier Beine in der Bildfläche nebeneinander. Aber hier stoßen wir auf den Punkt, wo die Wege sich scheiden. Mustert man die große Menge von Tierzeichnungen der Kinder durch, die durch Publikation allgemein zugänglich sind, so findet man leicht eine ganze Anzahl, die in dem Anschauungsbild oder der Gestaltungsstufe nahe verwandt erscheinen. Aber wie viel leerer sind diese Kurven der Körperumrisse durchweg! Wie fallen die Körperteile als zufällige Anhängsel eines walzenförmigen Leibes auseinander! Dann liegt nun in der Tat der Kern des Unterschiedes, der sich etwa so formulieren läßt:
Verglichen mit den äußerlich ähnlichen Tierdarstellungen der Kinder zeichnet sich Brendels kniendes Tier aus: 1. Durch bestimmtere Konturführung bei fast gleicher Armut an Detail. 2. Durch eine Gliederung des Körpers, die trotz der Naturferne den überzeugenden Eindruck eines Tierorganismus macht, (dieser Eindruck scheint vorwiegend durch eine Abwägung der Massen, also durch eine spezifisch plastische Rechnung mit Raumgebilden erreicht zu sein). 3. Durch die zwingende Gestaltung eines wunderlichen Motives, des Knieens, bei einem Tier. 4. Dazu kommt dann die anfangs erörterte konsequente Reliefgestaltung und die bei aller Strenge erstaunlich natürlich und schlicht ansprechende Komposition in die umrandete Fläche. Und jetzt, nachdem wir den formalen Qualitäten des Werkes nachgegangen sind und eine ganze Reihe ernsthaft zu wertender Momente aufgespürt haben, dürfen wir auch wohl die Frage nach dem unmittelbar im Formerlebnis mitgegebenen Gefühlston stellen, ohne befürchten zu müssen, daß wir einer Suggestivwirkung auf Grund unkontrollierbarer Assoziationen zu rasch unterlägen. Aus zahlreichen Reaktionen von Persönlichkeiten verschiedener Art sind folgende gemeinsamen Züge hervorzuheben:
Sobald das erste Stutzen überwunden ist, während dessen man sich fragt, ob das Werk nicht einfach ein Ausdruck kindlichen Unvermögens sei, rührt der Eindruck des Rätselhaften den Beschauer in steigendem Maße auf. Obgleich über die Realitätsferne des Tieres, in dem man nur ganz schwach Einzelformen der Kuh anklingen fühlt, kein Zweifel möglich ist, so überträgt sich doch unentrinnbar der Eindruck dieses Tierwesens als einer nicht nur denkmöglichen Abart, sondern als eines schlicht überzeugenden Organismus. Über diese Einheit im Sinne eines Tierindividuums hinaus spricht aber noch ein anthropomorpher Zug im Blick und in der ganzen Haltung, wozu auch die Vorderbeine in Kniestellung gehören, die man umsonst als ein Knieen vor dem Niederlegen rational zu deuten trachtet. Noch allgemeiner gesagt, berührt uns aus diesem Werk ein Hauch von jener Einfalt, die uns still macht, wo immer sie uns begegnet, sei es in den Augen eines Tieres, eines Kindes, in Werken der Primitiven und früher Kulturen häufiger als in neuerer Zeit, im Osten häufiger als in Europa.
Gleichgültig ob der Autor nun bewußt ähnliches gefühlt oder gedacht hat, es liegt etwas von der seelischen Haltung in diesem Tierrelief, die man heute als den neuen Tiermythus zu bezeichnen pflegt und an den Namen Franz Marc knüpft. Damit ist nichts weiter ausgesagt, als die Tatsache, daß dieses Werk, abseits des Tageslärms hinter Anstaltsmauern von einem ungelernten und ungebildeten geisteskranken Maurer gearbeitet, viele Beschauer an eine bestimmte seelische Haltung in der Kunst der letzten Generation gemahnt, von der er keine Ahnung haben kann. Und vorher wurde gezeigt, daß dies selbe Werk eines Ungelehrten, eines derben Eigenbrötlers in seiner formalen Gestaltung eine souveräne plastische Auswägung der Massen, eine ansprechende Komposition, eine sichere und überzeugende Durchführung der spezifischen Relieftechnik ohne Entgleisung ins Plattrealistische, kurzum Qualitäten bewährt, die man nur mit Ausdrücken aus der Kunstbeschreibung schildern kann. Zusammengefaßt: dieses Bildwerk überträgt auf den Beschauer eine bestimmte seelische Haltung, indem es einen mageren, kindlich-beschränkten (Natur-) Formenschatz durch Gestaltungsmittel der Kunst zu einer scheinbar planvollen formalen Einheit fügt. Bei diesem Resultat mag die Analyse einstweilen haltmachen. Fragt man nun den Urheber selbst nach Erläuterungen zu seinem Werk, so macht man wiederum, wenn man will, eine »Normal-Erfahrung!«: daß nämlich eben der Urheber häufig genug der unzulänglichste Interpret seiner Schöpfung ist. Hier steigert sich diese Diskrepanz ins Groteske, indem Brendel nach einem unverständlichen Satz über Herodes, der gern Kühe auf der Weide habe, nur eines findet: dies ist »die Kuh, die auf katholisch geht«.
Aus dem Anfang seiner Tätigkeit stammt auch das größere ganz flache Holzrelief »der Arzt am Krankenbett«, Abb. 81, aus hellbraun gebeiztem Tannenholz. Von derben Rillen ist die rauhe spleißige Holzplatte kreuz und quer durchfurcht. Doch überträgt sich bei der Betrachtung alsbald der Eindruck einer gewissen Ordnung trotz aller ungefügen Derbheit. Wiederum wirkt dabei mit, daß die Vorderfläche maßgebende Formträgerin geblieben ist, und daß die Raumtiefe nirgends exakt angegeben wird. Der Raum im Sinne der Tiefendimension ist überhaupt nur links von dem Kopfe der Mittelfigur durch eine stärkere Aushöhlung angedeutet, die nun sogleich wieder einen formalen kompositorischen Wert erhält. Sie hilft diese Mittelfigur akzentuieren, was im übrigen durch die zahlreichen parallelen Vertikalen im Rücken schon nachdrücklich besorgt wird. Zu der Mittelfigur gehört enger die linke Bildhälfte. Darauf weisen die Kurven des Reliefs ebenso sehr hin, wie die Linkswendung der Figur und die inhaltlichen Beziehungen. Das strahlige Abziehen der Linien vom Zentrum nach rechts, in das der Tierhals einbezogen ist, und dem sich der schräge Baumstamm auch noch zur Not einfügt, vereinheitlicht die rechte Bildhälfte und ordnet diese Teileinheit doch dem Ganzen genügend unter.

Fall 17. Abb. 81. »Arzt am Krankenbett« (Holzrelief). 21x13,5.
Das Detail steht auf derselben Stufe der Formarmut wie bei dem demütigen Tier. Nirgends ein Versuch, Naturnähe zu erreichen, Individuelles zu charakterisieren. Der so nachdrücklich hervorgehobene Mann – durch das Spitzzulaufen nach unten und die Querlinien in der Mitte der Gestalt (Rockabschluß?) als solcher gekennzeichnet – verfügt nicht über klar umrissene Extremitäten, An ihm ist überhaupt nur die riesige Nase und das Auge eindeutig aufzuzeigen. Die kleinere menschliche Gestalt, die mit schräg emporgereckten Armen auf dem kahlen Schrägen mit der Inschrift: D O IX liegt, könnte als Christuskind gedeutet werden, zumal da auf der rechten Bildhälfte ein eselähnliches Tier die Szene ergänzt. Aber sie wäre dafür reichlich groß, und eine Krippenszene ohne Maria wäre selbst für einen Schizophrenen reichlich absurd. Brendel selbst läßt diese Auffassung zwar gelten. Aber als er längere Zeit, nachdem er die Arbeit abgegeben hatte, eine Reproduktion davon sah, bezeichnete er sie wieder, wie schon früher, als »Arzt am Krankenbette, unter dem ein Nachtgeschirr steht«. Das Eseltier sei ein Reh, dahinter ein Baum; zwischen beiden ein Fenster.
Die Figur, die wir also wohl als Kranken verstehen müssen, hat einen Arm, der annähernd zu seinem Recht gekommen ist und sogar in die Hauptformen einer Hand mit vier Fingern ausläuft. Die andere Hand, W-förmig, taucht aus einem nicht näher bestimmbaren Gewirr von Kurven auf. Über die gemeinte Tätigkeit des Arztes gibt Brendel keine Auskunft. Das Nächstliegende wäre eine Amputation, oder wenigstens das Hantieren an einem Beinstumpf. Dabei mag der sexuelle Vorstellungskreis seiner größeren Intensität nach sich etwa in Gestalt einer Vaginaluntersuchung hereingedrängt haben. Unter dem Schrägen erkennt man das Nachtgeschirr nicht gleich, da seine zylindrische Rundung konkav gegeben ist und der Henkel nach rechts etwas emporsteigt. Die Inschrift D O IX ist wohl als Versuch einer Jahreszahl in römischen Ziffern aufzufassen, als eine Art wichtigtuerischer Gebärde, wie das Notenschreiben von Leuten, die sich im Tonsystem nicht auskennen.
Ein Lieblingsmotiv sind die Treppenstufen, die auch auf neueren Schnitzereien noch oft wiederkehren, ohne jemals eine klare inhaltliche Funktion zu haben. Bei der Schilderung seines halluzinatorischen Primärerlebnisses erwähnte er einmal, daß ein Reh und eine Frau aus der Erde heraufkämen. Auf Frage gab er zu, sie seien eine Treppe heraufgestiegen. Aber auf den Zusammenhang mit dem Treppenmotiv in seinen Bildwerken ließ er sich nicht festlegen. Immerhin darf man diesen Zusammenhang mit großer Wahrscheinlichkeit gelten lassen, zumal er für andere gleichzeitige Erscheinungen unbezweifelbar ist, nämlich für Reh und Frau. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß dieses Primärerlebnis überhaupt erst auf Grund dieser häufig wiederkehrenden Motive in der Exploration herauskam, so daß in diesem Falle die klinische Verwendbarkeit des Materials erwiesen ist.
Wie Reh und Baum auf der rechten Seite des bisher besprochenen Reliefs, so führen Reh und Frau auf einem anderen Stück (Abb. 82, braunes Holz) sicher auf jene halluzinatorische Szene zurück. Das Reh ragt hier als Hauptfigur über die ganze Fläche bis an alle vier Ränder, während über seinem Rücken ein weibliches Gesicht mit haubenartiger Umrandung und darunter eine breite, kegelförmige weibliche Brust ohne organische Beziehung zueinander aus dem Grunde gerade nach vorn drängen. In der rechten unteren Ecke erscheint wieder die schräge Treppe. Wie weit das selbst verfertigte Blechglöckchen am Halse des Rehes auf die akustische Komponente jenes Erlebnisses von 1906 hinweist, ist nicht zu entscheiden. Das Werk schließt sich in seiner ganzen Art eng an die beiden zuvor besprochenen an. Die Aushöhlung des Grundes dringt etwas mehr in die Tiefe, so daß das vorgesetzte Hinterbein sogar vom Grunde gelöst ist. Auch das Beiwerk ist durch stärkere Betonung seines realen Volumens verselbständigt worden, so daß es, vom Körper des Rehes rings durch einen tiefen Graben getrennt, eine Sonderexistenz erwirbt und auch in der Linienführung eigenwilliger, ja geradezu sperrig wirkt. Das Reh selbst ist dagegen diesmal eindeutig durch so richtige Details gekennzeichnet, daß man wohl an die Benutzung eines Vorbildes denken muß: Kopfhaltung, Beinstellung, vor allem die Spitzstellung der Zehen und das spitz auslaufende Hinterteil sind von ganz anderer Naturnähe als die Formen des vorigen Reliefs.

Fall 17. Abb. 82. Reh und Frau (Holz). 10,5x11,5.

Fall 17. Abb. 83. Pfeifenkopf (Holz). 17 h.
Durch die Vereinigung von formaler Gewandtheit und größter Präzision der Durchführung ist die ansprechendste Schöpfung Brendels der ›Pfeifenkopf‹ (Abb. 83, Ahorn, innen mit Blech ausgeschlagen). Besonders verdient bei diesem streng symmetrisch angeordneten Werk die sichere, abwechslungsreiche und dabei höchst diskrete Schnitztechnik hervorgehoben zu werden, z. B. die verschiedene Schnittrichtung und -tiefe, die zur Belebung der Oberfläche des Adlers verwendet werden. Bei einer so reifen Plastik muß man schon Werke großer Kulturen zum Vergleich heranziehen, wenn man den Charakter des Endgültigen wiederfinden will, der diesem schlichten Relief eigen ist.
Zu der phantastischen Figur: ›Fischjungfer‹ (Abb. 84, Ahornholz) sei nur angeführt, was Brendel bei einer Exploration äußerte: »Seejungfern oder Wasserweibchen sind jeden Tag da – auf der Wiese oder im Zimmer.« Phallische Bedeutung des Schwanzteiles leugnete er. An der Figur Abb. 85 tritt ein neuer Zug hervor. Sie ist sozusagen aus isolierten Körperteilen grob zusammengefügt. Ohne Rücksicht auf die naturgegebene Gliederung und das kontinuierliche Auseinander-Hervorwachsen der Teile liegen diese Fragmente kaum dem Aufriß des Organismus entsprechend beieinander, etwa wie Knochen in einem alten Grabe. Die Gesamtform ist bestimmt durch das Volumen der benutzten Holzleiste, das nirgends durch Ansätze überschritten wird. Die Proportionen weisen auf den Grundtypus aller primitiven Menschendarstellung hin: großer Kopf, kurze Beine. Dieser Kopf mit Helm nimmt mehr als ein Drittel der ganzen Gestalt ein, während der Abstand von dem Punkte, der die Gesäßvorwölbung bezeichnet, bis zu den Füßen knapp ein Viertel des Ganzen beträgt. Von den Einzelformen fallen am meisten die Teile des Rumpfes auf: ein ganz niedriger Brustkorb, an dessen unterer Grenze die Arme beginnen, ein birnförmiger Hängebauch und eine Art Stütze oder Sehne, die vom Gesäß aufsteigt. Die Konstellation dieser Teile wird aber noch wunderlicher, wenn wir von Brendel selbst hören, der birnförmige Appendix sei nicht als Bauch, sondern als Lunge zu verstehen – und zwar mit der klassischen schizophrenen Begründung »die Lunge ist außen, weil sie innen ja doch nichts nützen würde«. Daß dies kein einmaliger Einfall, sondern eine systematisierte Vorstellung ist, beweist die Figur mit hochgehaltener Uhr, Abb. 91. Hier tritt aus dem deutlich erkennbaren Bauch ein ähnliches lappenförmiges Anhängsel hervor, das Brendel wiederum als Lunge bezeichnete. Zur Sinndeutung der behelmten Figur – man denkt an eine Zwitterbildung von preußischer Pickelhaube mit bayrischem Raupenhelm – kann nur ein nachträglicher Ausspruch herangezogen werden. Er nennt die Figur »mit dem Kugelhelm« einen »Wetterpropheten« und schließt die zitierte Erwägung an, warum er die Lunge außen trage.
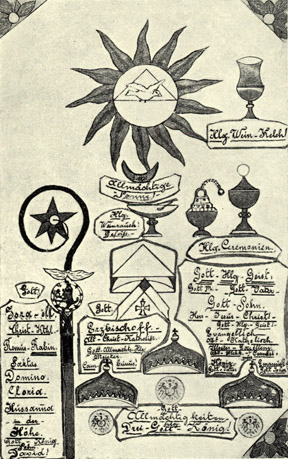
Fall 17. Abb. 84. Wasserjungfer (Holz). 17x12.
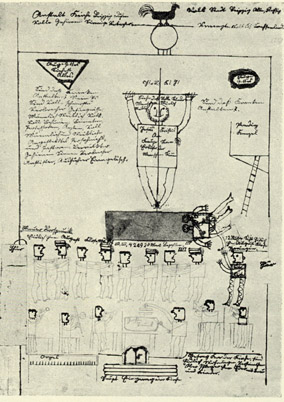
Fall 17. Abb. 85. »Wetterprophet« (Holz). 24 h.

Fall 17. Abb. 86. Kruzifixus (Holz). 16x14,5.
Viel ergiebiger ist der »Gekreuzigte« (Abb. 86, Fichtenholz), bei dem nun einmal das Motiv durch tausendfache Tradition eindeutig gegeben ist, so daß sicherer als bei irgendeinem anderen Stück die persönlichen Zutaten des Schnitzers in formaler und inhaltlicher Richtung aufgezeigt werden können. Die Größenverhältnisse von Rumpf, Kopf und Gliedern sind denen des Wetterpropheten einigermaßen ähnlich: sehr großer Kopf, der fast ein Drittel der Gesamtlänge einnimmt, kleiner Rumpf mit ganz selbständigem, durch tiefe Querfurche abgegrenztem Brustkorb. Dagegen haben die Beine fast ihre normale Länge mitbekommen. Und die Arme von Fingerspitze zu Fingerspitze haben ebenfalls ihre normale Erstreckung, von der allerdings die riesigen Hände einen ungebührlich großen Teil bestreiten. Die Anfügung dieser stulpenförmigen Arme nun an den Körper gehört zu den eigenartigsten Zügen in Brendels Schaffen.
Das Querholz des Kreuzes mitsamt den Armen ist für sich gearbeitet und von hinten an das Langholz angepaßt. Dadurch ergab sich das Problem, wie diese Vereinigung wohl zu bewerkstelligen sei. Dem rational gerichteten Wirklichkeitsmenschen wäre es wohl natürlich gewesen, die Armstümpfe des Mittelteiles in kontinuierlichen Zusammenhang mit den äußeren Armstücken zu bringen, die am Querholz haften. Dann wäre vielleicht eine Nahtstelle sichtbar geblieben, die man zur Not durch eine Kerbe hätte verdecken können, aber die Illusion der naturwahren organischen Einheit des Körpers wäre gesichert worden. Solche Erwägungen lagen Brendel offenbar völlig fern. Außer solcher naturalistischer Tendenz, der sich technische Schwierigkeiten zu fügen haben, wäre noch eine oberflächliche Angleichung der selbständig gearbeiteten Querstücke denkbar, ein nachträgliches Korrigieren. Auch davon kann hier keine Rede sein. Vielmehr hat die technische Schwierigkeit hier überhaupt nicht als Störung gewirkt, die überwunden und verdeckt werden muß – sondern gerade als formanregender Faktor. Den realen Hergang in der Psyche des Schnitzers können wir uns freilich nicht rekonstruieren, wohl aber spricht die Eigenart des Resultates eine verständliche Sprache. Gleichgültig, ob Brendel sich nun dies oder jenes gedacht hat, als er sein Kreuzproblem löste, oder ob er »sinnlos« drauflos geschnitzt hat – klar ist, daß keine naturalistische Tendenz seine Hand führte, sondern eine Tendenz zu realitätsferner, durch die Formgegebenheiten »Stumpf und Gliedansatz« determinierter Lösung. Bei dieser Einstellung nun waren wieder mehrere Varianten möglich: er hätte die Arme, nur den Abstand so bemessend, daß sie an die Stümpfe anschlossen, ganz für sich schnitzen können, ohne Rücksicht auf formale Beziehungen zu den Stümpfen. Dann wäre eine rohe, formal betrachtet sinnlose Nebenordnung ohne Bindung entstanden. Dies aber ist das Entscheidende: die von realistischem Standpunkt aus absurden, stulpenartigen Arme reichen in weiter Trichterform vom Kiefer bis zu den Brustwarzen, schließen die Stümpfe nicht ein, sondern lassen sie nach vorn herausragen und entsprechen diesem Ausweichen nur mit einer einfachen winkligen Kerbe – und trotz aller Einsicht in diese Absonderlichkeiten, die jeder rationalen Deutung widerstreben, kann sich der für Formen empfängliche Beschauer dem Eindruck nicht entziehen, es spreche hier ein Gestaltungswille, dem man sich beugen müsse, wie man sich dem Gestaltungswillen beugt, der aus einem Kunstwerk von großer Qualität sich als Gesetz der Form uns auferlegt. Von den Problemen, zu denen diese Erwägungen zwingend führen, wird im dritten Teil dieses Buches zu handeln sein.
Auch am Körper fehlt es nicht an sonderlichem Detail. Während die tief eingezogene Taille und die Brüste auf weibliche Formen weisen, betont ein Riesenphallus, der gar noch, den Knien ähnlich, eine Art Gelenk bekommen hat, das männliche Prinzip. Die Behandlung der Beine als weiche biegsame Masse wundert in dieser realitätsfernen Sphäre kaum mehr, zumal da die Masseneinheit dieses ganzen Unterteils recht abgeschlossen und ansprechend wirkt. In dem eckigen Gesicht sind alle Einzelformen für sich behandelt: Augen, Mund, Kinn, wie von außen angefügt, die dicken Backen wie Säckchen ringsum abgesetzt. Mit bemerkenswerter Sicherheit bringt die Stellung der Brauenbögen und des Mundes (obere Lippe hochgewölbt, untere flach) einen bei aller animalischen Dumpfheit, schmerzlichen Zug in das Gesicht. Der Heiligenschein trägt die Initialen des Schnitzers eingekritzelt.
Einen neuen Beitrag zu dem Charakter der Realitätsfernheit liefert der aufrechte Kreuzesstamm, den man vielleicht gar nicht näher beachtet, da seine Hauptqualität, die Vertikalerstreckung, durch den Körper mitgegeben ist, während das Querholz die Wesenheit des Kreuzes dem Beschauer unzweideutig vor Augen führt. Allerdings ist das Folgende nur von der Rückseite deutlich zu sehen. Das Langholz nun ist bei näherem Hinschauen wohl unterscheidbar als Platte, die den Körper und Kopf beiderseits an den meisten Stellen einige Millimeter überragt. Aber – und hier wird die Gesamtvorstellung zugunsten eines Formimpulses durchbrochen – den Konturen des Körpers in freier Parallelität folgend, ist diese Grundplatte (nun nicht mehr Kreuzesstamm!) in Kurven ausgeschnitten. Ja noch mehr: nach der Rückseite zu ist sie abgerundet und im unteren Teil sind die seitlichen Einkerbungen soweit auf die Fläche fortgeführt, daß der Eindruck einer flachen Profilgestalt mit deutlichem Fuße entsteht. Schwerlich läßt sich dieser sonderbare Zug anders deuten, denn als ein Hinausschießen des Gestaltungstriebes über die natürlichen Schranken, die der Grundvorstellung ›Christus am Kreuz‹ eigen sind. Und zwar mögen etwa diese Phasen in dem Ablauf der Gestaltung enthalten sein: 1. Kreuzesstamm, 2. reicher sähe er aus, wenn er auch ausgeschnitten wäre, 3. Drang den Umriß parallel dem Umriß der Figur auszugestalten, wie einen Schattenriß, 4. wenn der Stamm vorn abgerundet ist, muß er hinten ebenso sein, 5. das ist ja wie ein Mensch von der Seite geworden.

Fall 17. Abb. 87. Kniender Christus (Holzrelief). 13,5x13,5.
Ehe die inhaltliche Bedeutung des ›Gekreuzigten‹ mit Hilfe von Brendels wörtlichen Äußerungen dazu erörtert wird, sollen noch zwei verwandte Werke kurz betrachtet werden: Einen ›Knienden Christus‹ meint das Flachrelief Abb. 87. Die Komposition zeichnet sich durch einfachen Aufbau und eine natürliche Beweglichkeit bei aller Strenge der symmetrischen Hauptanordnung aus. Auch die menschliche Gestalt ist viel ausgeglichener in den Proportionen und trägt sogar einen zu kleinen Kopf, was sonst bei Brendel nie vorkommt. Sie ist mit Brüsten versehen und ganz ohne Genitale. In ihrer rechten Hand hält sie etwa ein Stück Brot, in der link en einen Vogel, dessen Gefieder ganz wie bei den oben erwähnten zwei Exemplaren behandelt ist, dessen Kopf jedoch nur als muldenförmige Vertiefung erscheint. Ein Aluminiumring schließt sich um den linken Arm und ragt weit aus der Bildfläche hervor. Die Inschrift heißt: Lio LomatiXX+III und hat einen Zaubersinn, der aber aus Brendels Erklärungen nicht deutlich verstehbar ist. Zum dritten Male tritt das Christusmotiv in drei etwas späteren Figuren (Abb. 88) auf, die wir zunächst formal betrachten. Alle drei sind aus flachen Brettern geschnitzt, aber stark abgerundet. Die beiden kleineren entstanden vor der mittleren. Benannt waren sie zuerst »die Frau mit den Elephantenfüßen«, und »die Frau mit dem Storch«, der auf der Rückseite in Relief angebracht ist. Später nannte er auch die eine Figur Jesus, die andere Jesin. Diese beiden Namen aber wendet er ständig auf die größere mittlere Figur an, die auf der Rückseite ein bartloses Gesicht hat, und zwischen den langen, offenbar mehr nach dekorativen Gesichtspunkten geknickten Beinen zwei Hände trägt, während die kleineren mit einem lappen- oder auch skrotumartigen Gebilde ausgestattet sind. Die große Figur meint Jesus, der in ein Schiff gestiegen und zum Staunen des Volkes hinausgefahren ist. Tatsächlich steht die Figur lose in einem schiffartigen Fußstück. Diese Kopffüßer gehören zu den merkwürdigsten Werken des Maurers. Über die psychologischen Grundlagen des Motivs und seine Beziehungen zu anderen Gebieten bildnerischer Gestaltung wird später zu handeln sein. Hier sollen die drei Figuren als Zwitter und als Christusdarstellungen herangezogen werden.
Denn diese wunderliche Zwittervorliebe, die im Zusammenhang mit der Christusvorstellung, aber auch für sich in einer ganzen Reihe von späteren Werken wiederkehrt, verlangt eine nähere Untersuchung. Brendels Aussprüche über diesen Vorstellungskomplex sind folgende: (zu dem letzten Stück:) »man sieht nur den Kopf, weil der Leib am Kreuz angeschlagen worden ist – hinten ist die Jesin – er ist im Geschlecht gerade wie wir auch – nur läßt er das Mädchen ins Kloster – nichts Überirdisches ist dabei«; ferner auf die beiden anderen Kopffüßer der Abb. 88 bezüglich, die wiederholt als Frauen bezeichnet wurden: »auch so viel wie ein Jesus – weil jeder Mensch ein Jesus ist und sich dafür ausgibt. Jesus ist ein Teckel gewesen; – der Sack, das sind die Sakramente. Er trägt alles im Sack, wie der Nikolaus.« (Wieso sind das Frauen?) »Die Jesin will eben die Vorhand haben; sie hat den Religionsvogel. Sie glaubt und glaubt doch nicht.« Zu dem Flachrelief Abb. 87: »Jesus hat was in der Hand und verspricht seinem Vater was – natürlich hat er Brüste, weil das Weib die Vorhand haben will.« Schließlich zu dem ›Gekreuzigten‹: »Das ist ein gekreuzigter Heiland, – Die Arme sind für Abstumpfung – dann hat er Memmen, weil das Weib die Vorhand haben will. – Zu dem Jesus gehört doch eine Jesin; – auch der Bruder Barnabas ist hinter ihm und die Hauer (?) – daher kommts, daß der Zabbedäus her muß – die Zone oder Notiz (gleich Phallus!). Die Brüste sind für die Milch, und das ist die Sünde (der Phallus) Einer hat die Sünde mit dem Sabbedäus hinter dem Altar gemacht.«

Fall 17. Abb. 88. Drei Kopffüßer, Vorder- und Rückansicht. Holz. 19 und 26 h.
Nehmen wir dazu einige zum Teil häufig wiederkehrende Äußerungen, wie: »der Mensch muß eine Opferung machen« – »der Geistliche Jesus Christus kommt nachts und macht mit dem Messer Löcher in die Hände« – »Lazarett heißt Nazareth, das ist so viel wie Jesus und beten; und der Lazarus bin ich – – »Wenn ich ans Kreuz komme, gibts keinen Krieg mehr« – die Phantasien über Zwitterbildungen, die er bald auf ein Erlebnis mit einem abnormen Mädchen, bald auf Fälle, die er bei seinem Chirurgen v. B. gesehen habe, zurückführt – schließlich noch seine Stellung zur Ehe; so läßt sich der Vorstellungsgrund, aus dem diese Christuszwitter erwachsen, etwa so umschreiben:
Mit großer Wahrscheinlichkeit wurzeln in Brendels normaler Zeit zwei Komponenten: die Erfahrungen über Schwierigkeiten im Eheleben, oder besser allgemein gesagt, im Verhältnis von Mann und Weib. Der letzte Sinn seiner mannigfachen Äußerungen zur Problematik dieser Lebensgrundlage ist Gefühl mehr als Erkenntnis. Nämlich das weltanschaulich alles Vorstellungsleben durchdringende Grundgefühl der unentrinnbaren sexuellen Gebundenheit. Soweit er nur seinen eigenen Anteil daran völlig subjektiv betrachtet, läßt er ohne jede Scham schrankenlose Begierde sehen, die bei der Wucht seiner ganzen Persönlichkeit oft etwas urtümlich Grandioses hat, aber auch häufig den Charakter faunischer Lüsternheit annimmt und sich in derben, wenn auch relativ witzigen Zoten gefällt. Wendet er sich dagegen seinen Sexualobjekten zu, so hat er deutlich zwei Wertungen bereit: es gibt für ihn passive Sexualobjekte, die seine Phantasie am lebhaftesten umspielt, junge Mädchen, Kinder, Tiere – über reale, zugrunde liegende Erlebnisse ist nichts zu erfahren – und auf der anderen Seite die selbständige, als Person mit eigenem Willen auftretende Frau. Dieser gegenüber nun fühlt er sich unfrei – sie nutzt die »sexuelle Bindung des Mannes aus, um Macht über ihn zu erlangen (»die Frau will die Vorhand haben« ist eine stereotype Wendung). Der Sexualtrieb wird dabei nur positiv gewertet. Er wird ohne Einschränkung anerkannt als über den Menschen verhängtes Los, wie als Quelle des Genusses. Daher wird er auch nicht als Sünde entwertet, oder in seiner Keimform, als Keuschheit, verehrt. Die völlig schrankenlose, brutale Gewalt des Triebes aber erscheint in den Erlebnissen, die mit Halluzinationen und körperlichen Sensationen, besonders in der Genitalsphäre, verbunden sind: in homosexuelle Handlungen und grausame Quälereien (den Penis mit Haken herausreißen usw.) deutet er das Verhalten der Wärter in seinen Erregungszuständen um. Hier fühlt er sich als Opfer ausgeliefert, vergewaltigt in einer Lebenssphäre, die er als Domäne der Kraft und Willkür kennt – mit Ausnahme jenes Abhängigkeitsverhältnisses zu seiner Frau, das eben durch die sexuelle Bindung fundiert ist.
Zu diesen zwei Erlebniskomplexen, in denen sich Brendel als Vergewaltiger und als Opfer fühlt, kommt ein dritter mit ähnlichem Charakter, nur ohne Beziehung zur Sexualität. Das ist die langwierige Leidensgeschichte, die sich an die Krankheit und Amputation seines linken Beines knüpft, wobei er wieder, zunächst körperlich, dann aber auch im allgemeineren Sinne bei den nachfolgenden Rentenkämpfen sich als Opfer überlegenen Mächten preisgegeben fand. Ob die Phantasien über Zwitterbildungen wirklich auf praktische Erfahrungen zurückgehen, wie Brendel behauptet, läßt sich nicht entscheiden. Wir müssen uns deshalb darauf beschränken, die auffindbaren psychischen Determinanten dieses ungeheuer zäh wirksamen Vorstellungskomplexes zu zeigen. In dem Gutachten von 1906 wird erwähnt, Brendel sei angeblich in geschlechtlichen Dingen sehr lange unaufgeklärt geblieben. Das macht es wahrscheinlich, daß er damals viel davon gesprochen hat, wie das aus der nächsten Zeit denn auch ausdrücklich betont wird. Jetzt erzählt er eine ganze Reihe von kindlichen sexuellen Erlebnissen spontan, bei denen man nicht feststellen kann, wie weit er konfabuliert, z. B. wie er den Unterschied zwischen Knabe und Mädchen im Bette an seiner Schwester studiert habe. Ferner kehren häufig wieder Erwägungen oder zynische Witze über Selbstbefriedigung bei beiden Geschlechtern, über das Sexualleben der Geistlichen, der Nonnen und Schwestern. In alle diese Betrachtungen trägt er seine eigene starke Sexualität hinein und stellt sich nach diesem Maßstabe ähnliche Erlebnisse überall vor. Dieser ganze Wust von sexuellen Phantasien hat nun bei Brendel nicht den kontemplativ lüsternen Charakter, der gewöhnlich dabei vorherrscht, auch nicht den Zug ins Moralisierende, die Verhüllungstendenz mit dem Gefühl der Sündhaftigkeit, sondern durchaus eine heidnische Diesseitigkeit und derbe Urwüchsigkeit. Der Sexualtrieb, den er meint, ist der Zwang, als unentrinnbarer Drang über alles Lebendige verhängt, richtet sich unbedenklich auf alles Lebendige, das ihm begegnet, und herrscht auch im Bereich der Religion – soweit eben Menschenart in Frage kommt. Daher sind nicht nur Nonnen und Geistliche, sondern auch Christus ihm unterworfen.
Hier führen wir nun eine analytische Hilfskonstruktion ein, deren Haltbarkeit leicht nachzuprüfen ist, da alle Glieder der Vorstellungskette in anderem Zusammenhang aufgezeigt worden sind. Uns scheint, die Zwittervorstellung ist etwa so verankert: in jedem Lebewesen herrscht das Verlangen nach dem anderen Geschlecht, als Grundtrieb immerfort, alles durchdringend – sind aber zwei vereinigt, so will das Weib die Vorhand haben – ist einer für sich, so wird die Unruhe noch größer – wie, wenn nun Doppelwesen das weibliche und männliche Prinzip in sich trügen, dem Drange entrückt wären und dem Machtstreben des anderen Teils? so nur kann man sich auch höhere Wesen vorstellen. Auf dem Grunde solches affektiv betonten Vorstellungsspieles mag dann eine Einzelerinnerung fast sinnliche Deutlichkeit und Intensität gewinnen – jedenfalls wird die beherrschende Rolle dieses Vorstellungskomplexes kaum ohne einen solchen Versuch, die affektive Grundlage aufzudecken, einigermaßen verständlich zu machen sein. Und hier an der Unmöglichkeit einer Deutung festzuhalten, darf man sich nicht mehr gestatten, außer einem Dogma zuliebe.
Es bleibt noch übrig, die Äußerungen Brendels über Christus als Gekreuzigten zu vereinigen und auf ihren tieferen Sinn zu prüfen. Da ist vor allem vorauszuschicken, daß Christus durchaus nicht so sehr als Gottmensch oder Religionsgründer im Sinne der Kirche aufgefaßt wird, sondern vielmehr als Repräsentant einer höheren Menschenart, die aber alle Eigenschaften und Leiden des Menschen in gesteigertem Maße besitzt. Auf der anderen Seite identifiziert Brendel sich selbst, wie das bei Schizophrenen ganz gewöhnlich ist, in seinen Wahnvorstellungen mit Fürsten, Königen und auch mit Christus. Nur haben wir in diesem Falle, wo er seinen eigenen abgeänderten Christus besitzt, viel anschaulicher die psychologische Einbettung dieser Identifikation in direkte Parallelvorgänge und Eigenschaften: wie Christus fühlt er sich geopfert, der weltlichen Macht schutzlos preisgegeben, obwohl er sich im Besitz überirdischer Kräfte weiß, Menschen mittels eines Sonnenstrahles hinrichten kann, sie freisprechen, wenn sie bereuen u. dgl. Umgekehrt projiziert er in dieses ihm so nah verwandte Christusbild die eigenen Gefühlserlebnisse und Triebe, vor allem die sexuelle Bindung, die er nun als Forderung formuliert. »Zu jedem Jesus gehört eine Jesin«, »er ist ganz wie wir«. Der Christuszwitter würde sich dann aufbauen aus dieser für ihn jetzt unerfüllten Forderung nach dem ergänzenden Weibe und der utopischen Wunschphantasie; wäre nicht alles gut, wenn Mann und Weib in einem Körper vereinigt wären, wodurch der Kampf um die Vorhand aufhören würde und der sexuelle Drang des Suchens überhoben wäre? Wenn der Begriff der Sünde überhaupt eine Rolle spielt in Brendels Vorstellungsleben, so fände er in dieser geschlechtlichen Zweieinigkeit des Gottessohnes ein entlastendes Symbol – dieser hat aus gleicher Not eine souveräne Rettung gefunden. Ein solcher Gedankenunterbau, gewiß nicht in Form logischer Schlußreihen, sondern mehr in freiem Spiel der affektiv am stärksten betonten Vorstellungen, kann wohl kaum als gekünstelte intellektuelle Konstruktion abgewiesen werden, sondern darf, da er sich eng an die objektiv gegebenen bildlichen und wörtlichen Äußerungen des Schnitzers hält, einen hohen Grad von Evidenz für sich in Anspruch nehmen. Diese rein psychologische Ausdeutung der Zwitterphantasie wäre nun noch durch eine Umschau in der Geschichte des menschlichen Geistes zu ergänzen Wir haben inzwischen ein großes Vergleichsmaterial zu dem Thema gesammelt und besonders bei Leo Frobenius, der uns in seinem Afrika-Archiv ganze Serien einschlägiger Bildwerke zugänglich machte, und bei Prof. Warburg (Hamburg) vollstes Verständnis für das Problem gefunden. und gewänne erst dadurch ihre Bedeutung (vgl. S. 317 f.).

Fall 17. Abb. 89. Doppelfigur, mann-weiblich (Holz). 70 h.
Hier seien noch einige Schnitzwerke angereiht, in denen die Doppelgeschlechtlichkeit wieder als inhaltliches Hauptmotiv wirkt. Abb. 89 (Holz, hellgrün gebeizt, mit schwarzem und rotem, gelbem und blauem Detail) schildert Brendel so: »Mann und Frau; sie hat den Maßstab zur Hand und führt ihn zum Mund, hat Bärenfüße, trägt das rote Kreuz vor dem Kopf; er hat den Hobel, trägt Kehlkopfkanüle und hat auch Bärenfüße.« Die Doppelfigur hat zwei eher reliefartig flach behandelte Fronten. Die Seitenflächen treten in der Bedeutung ganz zurück; so kann von einem Profil gar nicht die Rede sein. Man sieht von der Seite einfach fast gerade, kaum eingekerbte Linien als Repräsentanten der Frontflächen. Wo die gegebene Form durch ihre Kurve die stetige Verbindung von Seiten- und Vorderfläche in realistischem Sinne herbeiführen könnte, ist dieser Möglichkeit ganz entschieden ein Riegel vorgeschoben, indem z. B. der Ellenbogen ganz einfach bis in die virtuelle Kante des ursprünglichen Zylindervolumens vorgedrängt und in schematischer rechtwinkliger Knickung gegeben ist. Die Betonung der Genitalien, formal eher zurückhaltend, wird durch feuerroten Anstrich gesteigert. Es verdient erwähnt zu werden, daß in der breitklaffenden Vulva zwei konusförmige Körper, offenbar Blasen- und Uterusmündung darstellen, und daß genau in der Mitte des gemeinsamen Dammes eine Aftermündung sorgsam ausgehöhlt und rot angemalt wurde. Die Neigung, menschlichen Figuren Tierfüße zu geben, tritt bei Brendel wiederholt auf.

Fall 17. Abb. 90. Doppelfigur mit vier Gesichtern (Holz). 30 h.
Eine neue Spielart des Zwitterbildes bringt die Doppelfigur: Husar und Frau. (Abb. 90, weinrot gebeizt, mit feuerrotem, blauem und schwarzem Detail.) Nur ist hier die eminent plastische (in künstlerischem Sinne) selbständige Durchgestaltung aller vier begrenzenden Flächen noch weiter getrieben worden. Nicht nur ist das für »Husar« assoziativ naheliegende Motiv des Pferdekopfes nebst einem ebenso naheliegenden eisernen Kreuz auf die Seitenfläche komponiert, sondern die zwei Paar Beine sind in Seitenansicht so gestellt, daß je eines von der männlichen und weiblichen Seite zusammengefaßt werden können als Beingestell einer neuen Gestalt. Und in konsequenter Durchführung dieses Einfalls trägt jede Seitenfläche ein eigenes Gesicht, so daß deren vier an der Figur entstehen. Ein kurzer Bürstenpinsel krönt an einer Ecke der männlichen Seite die sonderbare Kopfbedeckung des »Husaren«. Merkwürdigerweise tragen hier beide Geschlechter den Hobel quer vor der Brust, während er bei der vorigen Figur den Mann zu kennzeichnen schien, wobei die volkstümliche sexuelle Bedeutung des »Hobelns« mitgespielt haben könnte. Für die überraschende Kehlkopfkanüle hat Brendel selbst die sexualsymbolische Bedeutung in anderem Zusammenhange ausgesprochen, indem er für Penis synonym »Konüle« gebrauchte. – War bei der vorigen Figur die Frau durch spitze Hängebrüste eindeutig charakterisiert, so sind hier beiderseits kleine Andeutungen von Brüsten, und zwar jederseits nur eine durchgeformt, und auf der Mannesseite deutlicher und größer. Das Genitale ist auf beiden Seiten derber geformt als bei der grünen Figur. Eine neue Spielart bringt der Übergang, indem nämlich eine Art Skrotum oder hängender Damm von der weiblichen Seite her ungeheuerlich klafft und mehr nach der männlichen Seite hin einen After trägt.

|

|
|
Fall 17. Abb. 91. Doppelfigur (Holz). 24 h. |
Fall 17. Abb. 92. Zwitter (Ausschnitt) Holz. 38 h. |
Zwei weitere spätere Doppelfiguren entfernen sich wieder von dieser allseitigen Gestaltungsweise und nähern sich mehr dem plattenförmigen Typus der Kopffüßer. Die eine (Abb. 91, Holz, grau-braun gebeizt, mit blauem und rotem Detail) beschreibt Brendel so: »Mann und Weib sitzen auf einem Storchbein, welches auf einem Felsen liegt, in welches sein Haus eingehauen ist. Aus der Brust ragt die Lunge heraus, in der Hand hält er die Uhr mit Blume und Zeiger.« Dieses Stück wirkt besonders ansprechend durch die bei allem abstrusen Detail überzeugende Art des linearen Aufbaues und die diskrete Tönung. Von bekannten Motiven tritt wiederum die Treppe, diesmal als Doppeltreppe mit einem ausgesparten Raum in der Mitte auf, und die heraushängende Lunge (vgl. S. 141). Die Brust ist in diesem Falle beiderseits völlig neutral behandelt, das Genitale diskreter, auf der männlichen Seite durch ein kleines Loch, vielleicht um einen Phallus anzusetzen. Die hochgehaltene Tonne, auf der einen Seite mit farbigen Blechmaiglöckchen unter gewölbtem Uhrglas, auf der anderen mit zwei Zeigern, weist auf das alte Zieruhrmotiv hin. Wie konsequent im Sinne der Erscheinungsform, nicht im Sinne des nachrechenbaren Organismus, beide Seiten selbständig durchgeführt werden, zeigt die Gestaltung der erhobenen Hand, die zwar außen nur einmal vier Finger, innen aber jederseits einen Daumen besitzt.
Eine völlig groteske Abwandlung dieser wenigstens formal eher ausgeglichenen Figur bringt die letzte Doppelfigur Abb. 92 (Holz, orangegelb, in Ölfarbe gestrichen). Brendel sagt dazu: »Weib und Mann, oder Adam und Eva, sollen sich im Geiste gegenseitig verstanden haben. In der einen Hand eine Uhr, welche mit dem Gehirn gleichbedeutend ist. Wie die Gedanken ablaufen, läuft auch die Uhr ab. Dextry-Stery heißt Gehirn.« Niemand wird leugnen, daß gerade diese Gestalt, die als geformte Plastik sicher hinter den meisten anderen zurückstehen muß, nicht einfach absurd, sondern in viel stärkerem Maße grauenerregend wirkt. Hierbei vereinigen sich die trotz aller verzerrenden Gewaltsamkeit irgendwie überzeugenden Deformationen dieses scheußlichen Körpers mit ein paar Einzelzügen, wie dem Parallelismus der beiden halboffenen Augen an Kopf und »Gehirnuhr« und der wahrhaft irrsinnig pointierte Gegensatz zwischen dem runden Mondgesicht auf der Uhrseite und dem verschrobenen Karikaturprofil auf der Kehrseite. Besonders widerlich wirkt die verhältnismäßig materialistische, vollrunde Durchmodellierung der Unterpartie, zu der die phantastisch freie Behandlung der oberen Partie, die wieder streng auf reliefartige Wirkung gearbeitet ist, in peinlichem Gegensatz steht. Die gassenjungenhafte, plumpe Genitaldarstellung (mit Vulva von der Rückseite) vermag neben dieser tief beunruhigenden Diskrepanz kaum noch sonderlich abstoßend zu wirken.
In ein ganz andersartiges Vorstellungsgebiet mit viel freierer Formenphantasie führen einige Tierdarstellungen Brendels. Da ist das »Nilpferd mit zwei Köpfen auf dem Stiefelknecht«. Abb. 93 (Holz, mit Ölfarbe rotbraun und graubraun angemalt), eine vollrunde Plastik, die man von allen Seiten betrachten kann, wobei aber doch einige Hauptansichten nachdrücklich hervorgehoben sind. Der Zwang, diese zu bevorzugen, wird vor allem durch den streng symmetrischen Aufbau des Fabeltieres ausgeübt. Ja, man möchte sogar von axialer Komposition sprechen: um eine von vorn nach hinten verlaufende Achse scheint der walzenförmige Körper zentriert. Dies Gesetz aber gab nicht der Bildner sich freiwillig, sondern es wurde ihm von dem Volumen des Holzblocks auferlegt, aus dem heraus er die Gestalt formte. Er nahm dies Gesetz an und dadurch legte er den Grund zu der ungewöhnlich strengen und doch nicht unfreien Geschlossenheit, die das Nilpferd (abgesehen von dem Untersatz) auszeichnet. Von der rein psychologischen Seite dieses Gestaltungsprozesses wird an anderer Stelle noch zu reden sein. Hier handelt es sich um die formalen Komponenten des Gesamteindrucks. Da fügt sich dem Charakter des Monumentalen, den die Herrschaft des ursprünglichen Blockvolumens konstituiert, die Gestaltung der Einzelformen in völlig gemäßer Weise ein. Entschiedene Dreiteilung der schweren Tiergestalt in eine lastende paukenförmige Rumpfpartie mit plumpen Beinstumpen, die über die Wölbung des Bauches nicht vorragen, ein gedrungener, konzentrisch verengter, ringsum scharf abgesetzter Hals mit einer Kurve des Nackengrates, die ein mühsames Tragen des wiederum scharf abgesetzten Doppelkopfes suggeriert – und dieser selbst im Profilkontur zum Ausmaß des Ursprungsvolumens zurückkehrend – das sind die wichtigsten formalen Komponenten der Seitenansicht. Ihnen ordnet sich die derbe Basis des Stiefelknechts als gut abgewogene Bodenmasse unter und die leichte Winkelstellung hebt nur den sonst etwas geneigten Kopfteil zu mächtigerer Wirkung. »Es steht mit den Vorderbeinen auf der Futterkrippe und frißt die Wurzel«, erklärt der Autor. Die »Wurzel« (westfälisch für Rübe) füllt den Zwischenraum zwischen Maul und Stiefelknecht ganz passend aus – das ist ihre formale Funktion.

Fall 17. Abb. 93. »Nilpferd mit 2 Köpfen auf dem Stiefelknecht«. Holz, bemalt. 32x23.
Die Vorderseite aber offenbart erst den ganzen Reichtum an phantastischem Detail, wiederum in strengster Bindung, nämlich eingefügt in den noch deutlich spürbaren Kreisumfang. Über sie, dem Darstellungsgrundsatz gemäß, nicht zu schwärmen, bedeutet einen gewaltsamen Akt der Selbstzucht für den, der in Geformtem frei zu leben gewohnt ist. Die sanfte Zuwendung der Schnauzen zueinander, die Sonderung der Nasenhälften zu eigenen Körperteilen, der schwermütig glotzende Ausdruck der ungleich gestellten Augen, die streng symmetrische Wendung der zwei Einzelohren zu einer Giebelkrönung, vor der noch eine Art Zierstrauß prangt – das alles regt aufs lebhafteste zu umschreibenden Schilderungen an. Nicht vergessen sei die Rückfront des mit reliefartig behandelter Satteldecke geschmückten Nilpferdes: da spreizt sich ein Hampelmann, ganz schematisch flach geschnitten. Brendel erklärt: »Am Hinterteil ein Mann, der aufpaßt, weil er (es?) kein Loch hat.« Die Logik dieses echt schizophrenen Satzes wird kaum rational zu ordnen sein. Daß er eine Sphinkterphantasie enthält, liegt auf der Hand. – Im Stiefelknecht, unterhalb des Bauches, findet sich noch ein Haus mit einer Toreinfahrt, das er auch in seiner Beschreibung eigens hervorhebt. Die Entstehungsgeschichte dieses formal so reichen und geschlossenen Werkes ist leider nicht zu klären. Über die Anregungen von außen ist ebensowenig zu erfahren wie über die Einfälle, die zur Ausgestaltung des Details gerade in dieser Weise geführt haben. So bleibt nur die unsichere genetische Formel: das Werk ist entsprungen wahrscheinlich aus freiem Vorstellungsspiel, ohne Plan, Sinn und in Worten ausdrückbarem Gefühlsinhalt, gewissermaßen in blindem Gestaltungsdrang, dem freilich durch frühere Arbeiten der Weg bereitet war.
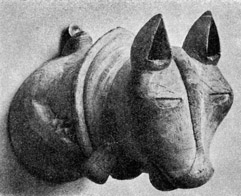
Fall 17. Abb. 94 »Dachhase«(Holz). 19x15.
Von ähnlicher Bestimmtheit in der plastischen Durchgestaltung ist auch der »Dachhase«, Abb. 94, in dem die alte Tradition des Wasserspeiers an romanischen und gotischen Bauwerken wieder aufzuleben scheint. Der Körper zwar mit den flossenartigen Füßchen auf engstem Raum zusammengepreßt, bleibt Spielerei. Aber der Kopf, jedem Naturvorbild entwachsen, ragt in seiner strengen Geschlossenheit unversehens in den Bereich des Monumentalen.
Bei der gleichzeitig mit dem »Nilpferd« entstandenen Gruppe Abb. 95 (Holz, grün und gelb mit Ölfarbe angemalt) muss der Entstehungshergang in vieler Hinsicht ähnlich geschildert werden wie dort – und doch ist das Resultat in seinen formalen Qualitäten ganz grundsätzlich verschieden von dem Nilpferd. Gerade die Diskussion dieser Unterschiede wird auf die Komponenten des Gestaltungsvorganges ein erwünschtes Schlaglicht werfen. Brendel beschreibt das komplizierte Schnitzwerk folgendermaßen: »Eine Ruine, daran ein Sopha mit Pudelhunden, davor ein Mann, der einem Vogel die Eier herausholt; oben auf der Ruine ein Ochse, wie ein Engel aufgestellt, mit eigenem Mantel, welcher zugleich für ihn ein Dach ist.«
Zum ersten Male bei dem Schnitzer ist hier der übersichtlich klare Aufbau vernachlässigt, der die anderen Werke auszeichnete. Die verschiedenen Motive reihen sich ohne Rücksicht auf den Beschauer rings um den Stamm der »Ruine«, ohne daß man klare Ansichtsseiten herausfinden könnte. War sonst eine, wenn auch nicht rational fassbare, so doch unmittelbar erlebbare immanente Formgesetzlichkeit jedesmal stärker als der Realitätscharakter des Motivs, so muss hier von einer schwankenden Wirkung gesprochen werden: obgleich im einzelnen keine platte Naturnähe, sondern formale Abstraktion herrscht, liegt in der spielerisch zufälligen Zusammenordnung doch ein ganz kunstwidriger Zug von formaler Nachlässigkeit. Wodurch mag diese ungewöhnliche Eigenschaft verursacht sein? – Für die Entstehung des Werkes sind zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder die eben zitierte Schilderung gibt ein dem Schnitzen vorausgehendes Erlebnis wieder, das nach Art eines Traumes, ohne streng logischen Zusammenhang, als freispielende, lockere Assoziationsreihe vorübergezogen ist – vielleicht an irgendeine Trugwahrnehmung sich anschließend. Oder aber auch hier ging der Formantrieb von dem Volumen des Ursprungsblockes aus, ohne Zielvorstellung, so daß von einem Schnitt zum anderen neue Impulse auftraten, die auf unklare Volumänderung gerichtet waren und am Entstandenen erspähte neue Möglichkeiten ausdeutend verwerteten. Diesen zweiten Typus glauben wir in vielen Fällen (z. B. August Klotz S. 168 ff.) annehmen zu müssen. Doch stellen sich solcher Annahme bei diesem Stück immerhin ernsthafte Bedenken entgegen.

Fall 17. Abb. 95. »Ruine« usw. (Holz, bemalt). 31 h.
Das spielerisch fortschreitende Verfahren ist nämlich zweifellos dort zu Hause, wo der Bildner zum Vorhandenen frei zufügt, also beim Zeichnen, Malen und Modellieren in weichem Material. Da kann in jedem Augenblick noch die Marschrichtung geändert werden: in einer Landschaftsskizze erscheint plötzlich ein Gesicht angedeutet – ein paar Striche und das Blatt stellt nur noch ein Gesicht dar. Bei dem wegnehmenden Verfahren der Holzschnitzerei verlegt jeder Schritt eine Reihe von eben noch vorhandenen Möglichkeiten. Der Spielraum wird immer enger. Es muß deswegen das stets lebendig wachsende Anschauungsbild dem nächsten Schnitt sein Ziel setzen, weil er nicht korrigiert werden kann. An unserem konkreten Beispiel: der Ochse mit seinem eigenen Mantel, den er auch als Dach benutzt, kann nicht wohl aus einem gewöhnlichen Ochsen sekundär entstanden sein, wie das beim zeichnerischen Hergang denkbar wäre. Sondern hier liegt eine primäre Formvorstellung vor: Ochse mit Anhang, der nach Art der Wampe sich aus dem Körper entwickelt und vom Rücken nach einer Seite überfällt. Für die grünen Dachziegel mag man dann sekundären assoziativen Ursprung gelten lassen. Ähnlich verhält es sich mit dem Sofa und den spielenden Pudeln darauf: wir vermögen nicht an dem primären Anschauungsbild zu zweifeln, und ebensowenig bei dem Mann, der dem Vogel die Eier herausholt. Spielerische Ausgestaltung als Folge momentaner Einfälle mögen die Pferdemähne, die Hufe und den Schweif aus Roßhaar bedingen. Hier haben wir die öfters erwähnte Neigung zur »Kontamination« oder Verdichtung aus irgendwie verwandten Vorstellungen. Auch daß der Ochse nachdrücklich als Stier gekennzeichnet ist, gehört hierher, wenn es auch in den geschilderten erotischen Phantasien fester wurzelt als die übrigen Einfälle. So bleibt hier im Gegensatz zu den anderen Werken als eigentliches Problem nicht die formale Qualität, sondern das Rätsel des zugrunde liegenden psychischen Vorgangs, der die Motive bestimmt hat. Wie entsteht aus einer solchen lockeren Assoziationsreihe nach Traumart ein vollplastisches Bildwerk?
Diese Frage läßt sich nur auf psychopathologischem Boden behandeln. Von jedem, auch dem weitherzigsten, normalpsychologischen Gesichtspunkte aus muß die Zusammenordnung der drei Motive formal und inhaltlich als gleich absurd angesehen werden. Dagegen ist uns das Symptom der »Inkohärenz« in den sprachlichen Äußerungen Geisteskranker, besonders Schizophrener, geläufig. Dies haben wir bereits in Brendels schriftlichen Aufzeichnungen konstatiert, aber zugleich an einem Beispiele gezeigt, wie bei genauer Kenntnis des zugrunde liegenden Vorstellungsmaterials Partien solcher inkohärenter Produkte sich aufhellen lassen. Die Vorstellungen, die in dem zur Diskussion stehenden Werke unmittelbar verkörpert sind, lassen sich leicht aufzählen: Ruine, Sofa mit zwei Pudeln, ungleichäugiger Mann, der einem Vogel ein Ei herausholt, Stier-Ochse mit Mantel. Über die logische Inkohärenz dieser Vorstellungen kann kein Zweifel bestehen. Ein psychologischer Zusammenhang, etwa in einem halluzinatorischen Erlebnis, war nicht feststellbar. Eine formale Einheit durch die anschauliche Zuordnung der Teile zu überzeugendem Gesamteindruck entsteht nicht. Hiernach läßt sich das Werk definieren als ein körperlich räumliches Individuum, von einem Menschen gestaltet, mit mehreren erkennbaren Formdetails, zwischen denen weder objektiv-logisch noch psychologisch, noch formal eine verständliche Einheit herzustellen ist.
Was das Detail anlangt, so mögen schon die Pudel auf dem Sofa, der Mann mit dem Vogel, als Einfall und in der Gestaltung etwas absonderlich anmuten. Erst bei dem krönenden Ochsen in der Stellung eines Engels usw. fühlt man den Boden des normalen Phantasiespielraums schwanken. Und in der Tat bietet die psychopathologische Terminologie allein die Begriffe, unter welche die Qualitäten dieses Fabeltieres zu subsumieren sind. Wie schon erwähnt, entspricht die Kombination von Ochse, Stier und Pferd genau dem, was man im Gebiet der Sprache als Kontamination bezeichnet. Brendel selbst nennt z. B. einmal das Verlangen der Frauen nach Unterhaltung »auffällig«, d. i. einfältig + auffällig, welche beiden Bestandteile durchaus in den Sinn des Satzes passen. Ob die etwa bereitliegenden Roßhaare den Anstoß zu der Verschmelzung gegeben haben, oder ob vielleicht die ohne deutliches Leitbild einfach abstrakt stempelförmig gemachten Hufe die Assoziation »Pferd« heraufriefen, oder ob von vornherein das Doppelwesen geplant wurde, steht wieder dahin.
Schwerer ist der Mantel, den er auch als Dach benutzt, in seinem Entstehungsmechanismus verständlich zu machen. Wie schon oben ausgeführt, kann ein solches Formdetail nur nach einem Leitbild entstehen. Für diesen Fall scheinen uns drei Möglichkeiten vorzuliegen: 1. Das Fabelwesen, so wie es da ist, erschien, wenigstens mit seinem Hauptmerkmal, dem Mantel, halluzinatorisch. 2. Der Mantel entstand bei spielerischem Formphantasieren in der Vorstellung, wobei Analogien, wie Wampe, Decke, Dach mitgewirkt haben mögen. 3. Als freisteigende Assoziation (= Intuition). Alle drei Entstehungsarten haben gleichviel Wahrscheinlichkeit für sich. – Damit sind die verständlichen Zusammenhänge wohl ziemlich vollzählig angedeutet. Bleibt die Kernfrage, auf die wir gerade an diesem besonders befremdlichen Stück eine Antwort zu finden hoffen: In welchen Qualitäten steckt nun eigentlich das spezifisch »Geisteskranke« oder »Schizophrene«?
Gehen wir die Qualitäten noch einmal durch, vom Detail zum Gesamtbild aufsteigend. Jedes Motiv ist ungewöhnlich. Pudel pflegen nicht auf Sofas zu spielen, die Pointe dieser besonderen Zuordnung leuchtet nicht recht ein. Doch widerspricht nichts der real gedachten Situation. Wenn eine saloppe Formel für diesen Realzusammenhang gestattet ist, so wäre es etwa diese Frage: »Warum denn nicht?« – diese gleichgültig spielerische Frage scheint uns die innere Haltung des Bildners, als er diese Gruppe erfand, recht nahe zu treffen. Das zweite Motiv: Mann, dem Vogel Eier herausholend, mag auch zu einem Teil dieser Einstellung »warum denn nicht« entspringen, ist aber zweifellos von erotischen Vorstellungen her determiniert, was weniger aus dem Werk, als aus der Kenntnis des Autors zu belegen ist. Hier aber sprechen leicht auch rein formale Hilfsanlässe mit. Es ist sehr wohl denkbar, daß etwa die Rückenlinie des Vogels bei der ornamentalen Ausschmückung des oberen Ruinenstumpfes noch ohne die Leitvorstellung entstand und zu der Ausdeutung assoziativ Anlaß gab. Aber es spricht wenig für solchen Hergang. Ein paar Einzelheiten an beiden Gruppen weisen nochmals auf das spielerische »warum denn nicht« hin: der Roßschwanz des einen Pudels und die Hand des Mannes, deren vierter Finger die übrigen weit überragt. Hier freilich tritt ein technisches und ein formales Hilfsmotiv hinzu, so daß jene Einstellung eine noch passivere Rolle spielt als sonst: der Umfang der Hand ist mit drei oder vier großen Schnitten angelegt, wobei die Spitze an den Rand der unteren queren Rinne zu liegen kam. Nun wirkte offenbar einmal die Bindung dieser Gesamtform an den queren Grat, und dann der Parallelismus zu dem grobrilligen Spitzbart verpflichtender als das reale Handvorbild.
Anders sind die ungleichen Augen des Mannes zu beurteilen, die als völlig selbständige Individuen behandelt sind. Eines liegt in weiter, kreisrunder Höhle, das andere ist nach Art eines Froschauges halbkugelig aufgesetzt und seine Pupille besteht aus gelbem Glas. Hier genügt es nicht, einen spielerischen Einfall zur Erklärung aufzurufen. Denn hier handelt es sich um eine Tendenz, die tiefer verankert ist, in einem Bereich, wo magische Vorstellungen bestimmend wirksam sind. Der unmittelbare Eindruck weist schon darauf hin. Während die anderen Details wegen ihrer Absonderlichkeit ein affektloses Interesse erwecken, gewinnen diese völlig selbständigen Augenindividuen bei längerer Betrachtung etwas Grauenhaftes, gegen das kein intellektueller Einspruch schützt.
In der krönenden Tierfigur fanden wir bereits eine Verschmelzung aus Ochse, Stier, Pferd und setzten dies Gebilde damit in Parallele zu ähnlichen Wortneubildungen, die bei Schizophrenen häufig sind. Auch hier ist die spielerische Einstellung unverkennbar, eine verbindliche Aufrollung des Entstehungsvorgangs unmöglich, weil sich keine Ordnung nach dem Gesichtspunkt ergibt: er wollte das und das darstellen. Wie man nun auch das zugrunde liegende Formerlebnis sich vorstellen mag, als Halluzination, als kombinatorische Spielerei, als freisteigende Assoziation, immer bleibt es so ungewöhnlich, bizarr und fremdartig, daß man auch im Traume nur selten ähnlich anmutende Erscheinungen antrifft. Ein Vergleichsbeispiel aus dem Traum eines Normalen mag immerhin zeigen, wie nah verwandt diese eine Hauptqualität in beiden Fällen ist: das Urteil »dies Sonderbare ist ja ganz natürlich«. (Vgl. oben: »warum denn nicht?«)

Fall 17. Abb. 96. »Kirche« (Holz, bemalt). 30 h.
Der Traum lautet: »Ich reite in Uniform, links von mir ein Kamerad auf einem Goldfuchs, rechts ein steil ansteigender Wiesenhang. Mein Pferd bleibt etwas zurück, vielleicht, weil das Pferd links etwas andrängt. Ich treibe wiederholt an mit Schenkel und Sporen, merke aber, wie das Tier immer mehr nachläßt – dann rutsche ich rückwärts etwas ins Leere, ziehe mich an den Zügeln, die ich hochhalte wie beim Sprung, mehrmals in die Höhe, muß aber einsehen, daß alle Bemühungen aussichtslos sind. Da merke ich zu meinem Schrecken, daß mein Pferd nur halb ist – die hintere Hälfte fehlt! Als ich mir ganz entgeistert klarmachen will, wie das nur möglich sei, fällt mir plötzlich ein: ach, natürlich, das ist ja das Hinterpferd!« Man wird zugeben, daß diese, aus zwei Sätzen entspringende kurzschlußartige Verschmelzung, die mit dem Gefühlston einer erleichternden Erkenntnis eintritt, in allem Wesentlichen mit den erwähnten schizophrenen Verdichtungen übereinstimmt.

Fall 17. Abb. 97. Hindenburg (Holz). 15,5 h.
Eine ähnlich lockere Aneinanderreihung von Einfällen wie bei der »Ruine« scheint auch bei der »Kirche« (Abb. 96) vorzuliegen, doch lehrt eine Prüfung der einzelnen Motive, daß hier ein viel klarerer innerer Zusammenhang zwischen diesen Motiven besteht, und daß nur in der freien, von der Realität gelösten Behandlung die Willkür des Schnitzers ein wenig befremdet. Zugrunde liegen durchweg persönliche Erlebnisse, die wir bereits kennen. Die »Kirche« mit ihren pagodenhaften Türmchen und der übergroßen Taube ist gleichzeitig als Altar gemeint. Vor diesem Altar steht der zu einem Fabeltier entstellte Pfarrer auf dem hochgeklappten Deckel des Grabes, in dem Christus liegt. An der Seite finden wir wieder die Treppe, hinten eine Art Gefängniszellen, die zugleich das Grab Christi und das Gefängnis wie die Anstaltszelle Brendels bedeuten.
Wenig Probleme werden von der kleinen halbrunden Holzfigur (Abb. 97, dunkelbraun gebeizt) geweckt, die wie ein Wurzelmännchen aussieht und auch an manche Ahnenfigur aus Neuguinea erinnert. Auf den Hinweis, daß diese Figur als Porträt eines allbekannten Zeitgenossen gemeint sei, haben einzelne Personen ohne weiteres – Hindenburg erkannt. In der Tat ist es nicht schwer, mit Hilfe der Äußerungen des Schnitzers die einzelnen Züge des Figürchens mit dem Urbild in Zusammenhang zu bringen: der Panzer, technisch wie der Vogel (Abb. 83) ausgeführt, kennzeichnet ihn als Krieger, die phantastische Krone symbolisiert die Hochschätzung, die ihm vom Volke widerfährt. Einmal sagte Brendel sogar: »Die trägt er für alle Fälle, wenn Wilhelm einmal abdankt.« Da die Figur noch zur Kriegszeit geschnitzt ist, mag man nach Neigung die Prophetie des Maurers einschätzen. Die großen Ohren hat er, weil er alles hören muß, die Nase steht nach vorn, weil er alles riechen muß. Der typische Offiziersschnurrbart spricht für sich, die dicken Backen entsprechen besonders der Schilderung, die man von dem behaglichen Familienvater populär entworfen hat. Halskrause und gefaltete Hände sollen darauf hinweisen, daß er mit den Soldaten beten muß.

Fall 17. Abb. 98. Wilhelm I. und II. (Holz). 30 h.
Wie man sieht, ist durchweg ein recht sinnvoller Zusammenhang zwischen den anschaulich gegebenen, zunächst etwas absurd wirkenden Einzelheiten und dem Vorbild nachweisbar, ganz unabhängig davon, ob diese Erklärungen nun tatsächlich den Hergang der Produktion klarlegen oder ob ein Teil nur als nachträglicher Einfall in Rechnung gestellt werden kann. Immerhin erlebt man hier doch in ganz konzentrierter Form etwas wie die Mythisierung eines Zeitgenossen. Und dieser Vorgang, der dem letzten Jahrhundert zum mindesten völlig fremd geworden ist, da es noch nicht einmal Napoleon, geschweige denn Bismarck aus dem auflösenden Licht rationaler Sachforschung zu befreien wußte, vollzieht sich bei diesem Manne in seiner Weltabgekehrtheit so überzeugend, daß mancher lieber dies Ahnenbild des Schizophrenen, denn die übliche Wirtshausphotographie als gültiges Bild des volkstümlichsten Zeitgenossen gelten lassen wird.
Hier schließen thematisch zwei große neue Stücke an: der »Militarismus« (Abb. 99, Holz, dunkelbraun gebeizt) und »Wilhelm I. und II.« oder »Lehmann aus Berlin« (Abb. 98, braun gebeizt). Die letztgenannte Büste zeichnet sich ebensosehr durch die plastisch klare sichere Gestaltung wie durch die Schlagkraft des grotesken Einfalles aus: die Vereinigung der beiden Kaiser in einem Kopf, der von dem ersten Wilhelm den Backenbart, von dem zweiten Schnurrbart und Mundpartie trägt, ist sicherlich nicht geistlos. Weniger vermag die sonderbare Rotkreuz-Mütze irgendwie auf normalem Assoziationswege anzusprechen. In zwei Richtungen ist uns das Werk theoretisch bedeutsam. Es beweist einmal, daß sehr wohl bestimmte inhaltliche Pointen vor oder während der Arbeit lebendig sein können, die den Zufallstreffer mit nachträglicher Deutung ausschließen. Und dann finden wir hier in ganz anderer Weise die besprochene Neigung wirksam, mehrere Personen zu verschmelzen. Handelte es sich bei den anderen Fällen aber um Zwitterbildungen, die bald mehr oder weniger aus zwei Körpern bestanden, bald auch in einem gefunden wurden (z. B. die bärtige »Frau mit den Elefantenfüßen«), so sind hier nun Großvater und Enkel vereinigt. Unter den möglichen Vergleichsmomenten würden wohl zwei in erster Linie zu erwägen sein: die von beiden geführten großen Kriege, und dann als Kontrastmoment die bescheidene Friedlichkeit des einen, die großsprecherische Arroganz des anderen – die denn auch den Ausdruck beherrscht.

Fall 17. Abb. 99. »Militarismus« (Holz). 43 h.
Der »Militarismus« ist nicht so einfach zu erfassen. In dieser Gruppe sind ganz verschiedenartige Einfälle zusammengeschossen. Der große Kopf, nach eingebürgerter Gewohnheit wieder doppelgesichtig angelegt, trägt den Helm mit Spitze. Dies plastisch höchst unangenehme Motiv ist, wie einige Bildhauer besonders betonen, fast mustergültig gelöst, wobei die Verkürzung der Spitze und die leichte Kurve des Grates von Wichtigkeit sind. Rein allegorische Zutaten sind die Gewehre an beiden Kopfseiten, die formal mit der Helmkette zur Trennung der beiden Kopfhälften dienen. Die unteren Gruppen aber sind schwer verständlich. Warum streckt der Militarismus die Zunge heraus bis auf den Rücken eines Pferdes? Formal wirkt diese Kurve gut, indem sie von der Seite gesehen einen sockelartigen Kontur anklingen läßt. Brendels Erläuterungen sind ganz unbestimmt. Nur die kleinen Figuren beschreibt er verständlich: ein Pferd frißt aus einer Krippe; an der Kinnkette des Helmes hängt mit einer Hand, die so groß ist wie der ganze Körper, ein Mensch, der mit dem Tiere ein Stuprum begehen will. Diese beiden Funktionen der Pferde scheinen also in Brendels Vorstellung vom Militarismus zu überwiegen.
Mit der großen Büste des Teufels (Abb. 100, dunkel gebeizt) mag die Reihe der plastischen Arbeiten des Maurers geschlossen werden. Dieser magere, etwas ziegenartige Kopf spricht für sich selbst. Ein hübscher schizophrener Zug hat die Ausgestaltung der Hörner bestimmt: er trägt nämlich statt des einen Hornes seinen – Pferdefuß auf dem Kopfe, da der Schnitzer ihn bei einer Büste sonst nicht anzubringen wußte und ihn doch wohl ganz unentbehrlich fand. Dieses scherzhafte Detail mildert den Ausdruck starren Grauens ein wenig, der sich auf manche Beschauer mit großer Gewalt überträgt.

Fall 17. Abb. 100. Teufel (Holz). 60 h.
Gezeichnet hat Brendel fast gar nichts. Die Mehrzahl der erhaltenen Blätter ist auf Abb. 101 wiedergegeben. Die obere Reihe zeigt sehr schön, wie er mit einem Vorbild verfährt, das in der Mitte zu sehen ist, während rechts und links seine auf Pausen fußenden Nachzeichnungen sind. Zunächst scheint ihn das Thema »Mann und Frau« an dem Vorbild zum Widerspruch gereizt zu haben, indem er einmal beide Personen bärtig, das andere Mal beide bartlos macht, während er jeder einzelnen eine Brille zuerkennt. Aus der Fülle von Umdeutungen der durchgepausten Konturen sei nur hervorgehoben die helle, kugelige Fläche in der Bauchgegend der bärtigen sitzenden Figur und das Gewimmel von drei kleinen nackten Beinen bei der entsprechenden unbärtigen. Diese Neigung, Gliederkonglomerate unabhängig von allem organischen Zusammenhang zu bilden, trafen wir ja schon wiederholt an. In höchster Steigerung zeigt sie die tolle Figur mit drei Köpfen, einem aus der Hüfte und einem aus dem Oberschenkel wachsenden Arm. In die Christus-Motivreihen paßt die gorillaartige »sonn kreuts« und die ähnliche »Mondstabkreuz« benannte Zeichnung, während das »Sternwartestab« genannte Zentaurenuntier nicht seinesgleichen hat. Die Beischriften weisen wohl auf irgendeine Anregung durch Lektüre hin. An die persönliche Prägung der plastischen Arbeiten gemahnt am meisten die dunkle Gestalt mit der Inschrift »O du« zwischen den gekrümmten Beinen. Die schematische Ausgestaltung der Genitalpartie zu einem wie umklappbaren rhombischen Schild ist besonders auffällig. Die Pferdchen sind natürlich durchgepaust.
Zu Erklärungen war Brendel nicht zu bringen. Er erinnerte sich nicht mehr recht, die Blätter gezeichnet zu haben. Im ganzen sind die Zeichnungen sehr wohl mit den plastischen Arbeiten in Einklang zu bringen. Sie gehen durchaus auf klare körperliche Formung und zumal auf Konturwirkung aus. Die Tendenz, die Körper in der Fläche sozusagen auszubreiten, mag durch die Reliefgewohnheit gestützt sein. Der plumpe, schwerflüssige Strich zögert an keinem Detail und trifft gerade durch solchen Wagemut manches ganz überzeugend.

Fall 17. Abb. 101. Acht Zeichnungen (Bleistift). je 8x10.
Es bleibt noch übrig, von einem Ausspruch Brendels über sein Schaffen zu berichten, der sich in voller Übereinstimmung mit den berühmtesten Worten der großen Bildhauer befindet. Ja, die beste Formulierung, möchte man sagen, die überhaupt für das Formen aus dem Block geprägt worden ist, stammt von ihm: »Wenn ich ein Stück Holz vor mir habe, dann ist da drin eine Hypnose – folge ich der, so wird etwas daraus – sonst aber gibt es einen Streit.« Man kann wohl Intuition und strebendes Ringen nicht anschaulicher beschreiben.
August Klotz, geb. 1864, ist der Sohn eines Kaufmanns mit eigenem Geschäft in einer wohlhabenden schwäbischen Mittelstadt. Unter dessen Geschwistern und Schwägern befindet sich ein Anwalt und ein Pfarrer, ein Großhändler in Marseille – Amsterdam. Der mit 44 Jahren an Schlaganfall gestorbene Vater war: »lautstimmig, befehlend und jähzornig«, seine ganze Familie sanguinischen Temperaments. Die Mutter, aus anderem Volksstamm, lebt noch und scheint gesund zu sein. Von Nerven- und Geisteskrankheiten in beiden Familien ist nichts bekannt geworden. Geschwister des Patienten sind gesund. – Klotz besuchte das Gymnasium seines Heimatortes bis zum Einjährigenexamen und ging nach 2½jähriger Kaufmannslehrzeit und Erfüllung seiner Militärdienstpflicht 1886-1891 ins Ausland (besonders Belgien und England), wo er in Exportgeschäften als Korrespondent tätig war. Von 1891-1903 gehörte er dem väterlichen Agenturgeschäft an, und zwar vorwiegend als Wein- und Sektreisender. Körperlich war Klotz immer gesund, bis auf das »Antwerpener Fieber« (= Gonorrhoe).
Bei guter geistiger Begabung machte Klotz nach seiner Meinung doch eine schwere Jugend durch, da er sehr zurückhaltend, ja verschlossen war. Genaues ist darüber nicht bekannt. Gegen einen Geschichtslehrer ist er noch heute erbittert, weil der ihn zurückgesetzt habe. Er hat Klavier und Violine gespielt. Sein Musiklehrer habe ihm geraten, er solle Förster werden und dann im Walde seine Violine spielen. Anscheinend hat er ziemlich flott, wenn auch in bescheidenem Maßstabe, gelebt. Wenigstens versicherte er öfters, er habe nur für »Wein, Weib, Gesang« Interesse gehabt und die »gynäkologischen Anfangsgründe mit der jeunesse dorée kennen gelernt«. Sein Benehmen zeichnete sich stets durch große Formgewandtheit und Höflichkeit aus. Dem entspricht auch seine schriftliche Ausdrucksweise, die sich zwar im Geschäftsstil bewegt, aber von zahlreichen anschaulichen und originellen Wendungen durchsetzt ist. Ganz unerschöpflich und drastisch ist sein Wortschatz auf sexuellem Gebiet. Man darf wohl annehmen, daß auch dieser in gesunden Tagen schon angelegt wurde. Seine Tätigkeit als Weinreisender mag dazu Gelegenheit genug geboten haben. Wieweit er Alkoholist im vollen Sinne gewesen ist, läßt sich nicht sicher sagen. Er bestreitet es. Alles in allem erscheint er vor seiner Erkrankung als betriebstüchtiger Kaufmann, als Weinreisender von erheblicher Gewandtheit, als derb-origineller Mensch von vorwiegend sanguinischer Anlage, jedoch mit einem Einschlag von Schwerblütigkeit, wie das besonders in seinem Verhältnis zum Freimaurerorden sich zeigt, und in einer Liebesgeschichte, die kurz vor seiner Erkrankung spielt. Eigenartige schwäbische Stammeszüge sind unverkennbar. – Die Erkrankung hat wohl schon vor dem Jahre 1903 angefangen. Man hatte bemerkt, daß er in seinem Wesen verschlossener wurde. Nach einer schweren Influenza geriet er in Depressionen mit Versündigungsfurcht, glaubte seine Familie in Unglück und Schande gestürzt zu haben, aß nicht mehr, trank dagegen viel und fürchtete sterben zu müssen. Halluzinationen traten auf und versetzten ihn in heftige Erregungszustände. Eines Tages brachte er sich plötzlich einen Schnitt in den Bauch bei.
In der Anstalt herrschte anfangs die depressive Stimmung noch vor. Er weinte viel, sprach von traurigen Geheimnissen, brütete lange stumpf vor sich hin, oder aber er starrte mit ängstlichem Ausdruck und gefalteten Händen nach der Decke, wobei die sehr weiten Pupillen auffielen. Nach wenigen Tagen änderte sich das Bild, indem er nun Größenwahn erkennen ließ: er gab sich für Christus aus, schilderte die Leiden der Kreuzigung und zeigte auf die Speerwunde (vom Suizidversuch), predigte und zitierte Bibelverse. Von seinen Augen sei das eine das Auge der Liebe, das andere das der Wahrheit. Andererseits benahm er sich plötzlich ganz läppisch und machte einfältige Streiche, oder las laut die Zeitung vor, wobei er jede Interpunktion mit ausdrücklicher Betonung mitteilte. Zwischen den angedeuteten Extremen schwankte sein Benehmen in raschem, oft stundenweisem Wechsel hin und her. Dazu gesellte sich noch immer häufiger eine mürrische Gereiztheit, aus der er zunächst in wüstes Schimpfen und Poltern, später in plötzliche Gewalttätigkeiten ausbrach. Allmählich treten die Trugwahrnehmungen immer deutlicher als Anlässe seines absonderlichen äußeren Benehmens zutage. Er hört ständig gemeine Schimpfworte, Anklagen, Beschuldigungen, Drohungen – er sieht im Tapetenmuster Teufelsfratzen, die ihn angrinsen. Alles bezieht sich auf ihn. Die Wärter und Mitpatienten machen bedeutungsvolle Gesten, sprechen über ihn, verschwören sich, ihn umzubringen, verlocken ihn zu Unzucht, die Bilder im Saal enthalten gemeine Anspielungen. Sein Körper ist völlig verändert, das Herz herausgenommen, falsches Blut eingefüllt, und was dergleichen hypochondrische Wahnvorstellungen mehr sind.
Früher als die meisten Fälle, von denen hier berichtet wird, betätigt Klotz sich zeichnerisch. Die Fratzen im Tapetenmuster scheinen ihn nicht mehr losgelassen zu haben. Schon zu Anfang des zweiten Anstaltsjahres fand man eines Tages mit Fett eine Reihe schwer deutbarer Figuren in die Tapete eingerieben, die Klotz »Freimaurerzeichen« nannte. Bald darauf wird wieder erwähnt, er beklage sich, daß er überall Totenköpfe sehe. Zugleich beginnt er außer endlosen Schriftstücken an Behörden, in denen er sich über die ihm zugefügten Quälereien beklagt, kaum verständliche Berechnungen und schematische Aufzeichnungen, Listen und dergleichen aufzustellen. Sein Zustand ist nunmehr gleichmäßiger geworden. Die anfänglichen schnellen Stimmungsschwankungen sind vorüber, die engeren Beziehungen zu seiner früheren Umgebung, zur ganzen Außenwelt sind gelöst, er hat sich ganz auf seine Wahnvorstellungen eingerichtet und ist so zu dem typischen schizophrenen Weltbild, zu einem ausgesprochenen Autismus gelangt. Damit ist die akute Phase der Krankheit abgeschlossen. In der Folge verändert sich Klotz nicht mehr in Grundzügen seines Wesens, sondern steigert nur noch die Verschrobenheiten, die 1905 bereits vorliegen.
In der neuen Anstalt, die ihn 1905 aufnimmt, findet man, er sei in hohem Grade abgestumpft, schwachsinnig, voller Wahnvorstellungen phantastischer Art ohne System, sehr eingenommen von sich selbst, voll absonderlicher und geheimnisvoller Züge. Abgesehen von Zeiten der Erregung, in denen immer wieder sein »explosives« Losbrechen in Schimpfen und Drohungen gegen Patienten, Wärter, Pfarrer hervorgehoben wird, beschäftigt er sich seither mit Lesen, besonders in der Bibel, mit Briefschreiben, wobei er es bis auf 18 ausführliche Episteln an einem Tage bringt, und mit Zeichnen. Auch in den ruhigen Zeiten ist er äußerst reizbar und schlägt gelegentlich unversehens jemanden nieder, sogar in der Kirche. Nach wie vor steht er dauernd unter der Einwirkung seiner Wahnvorstellungen und Trugwahrnehmungen. Seine Umgangsformen sind von etwas feierlicher Höflichkeit. Im Gespräch folgt er scheinbar sehr aufmerksam, beantwortet Fragen zunächst präzis mit genauen Daten und vielen Einzelheiten, schweift aber unversehens auf phantastisches Gebiet ab, vielleicht von Halluzinationen veranlaßt, da er mitten im geordneten lauten Sprechen oft seitwärts murmelt, als antworte er Stimmen. Obgleich Klotz kein eigentliches Wahnsystem entwickelt hat, wie etwa der Patient Neter (vgl. S. 204), so ist sein Vorstellungsleben doch von einigen unveränderlich feststehenden Tendenzen und Meinungen beherrscht, deren Kenntnis uns vielleicht die Erfassung seiner persönlichen Art zu zeichnen erleichtert. Wie erwähnt, fühlte er sich schon in der akuten Phase getrieben, auf die Teufelsfratzen und Totenköpfe, die ihm hauptsächlich im Tapetenmuster erschienen, aktiv zu reagieren, indem er Freimaurerzeichen unverwischbar – mit Fett – in die Tapete prägte. Auf die Wände kritzelt er auch weiterhin gern »fächerförmige, fädige Figuren«, denen er geheimnisvolle Bedeutung unterlegt. Diese starke Anregbarkeit seiner Gesichtseindrücke bleibt auch fernerhin ein Grundzug seiner bildnerischen Tätigkeit. In zweiter Linie ist Klotzs Systematisierungsdrang zu erwähnen. Schon 1905 schickt er seinem Onkel sein »Farbenalphabet«, das ihn vielleicht für seine Färberei interessiere. Es lautet folgendermaßen:
Daran schließt sich eine andere Liste, in der die Beziehungen von Chemikalien, Drogen und Farben gruppiert werden. Z. B. richtig: Blausäure = Arsenik = Apfel-, Pfirsich- und Mandelkerne. – Dann: hypermang. Kali = blaues Farbholz Quebracho = Heidelbeer, Bairisch Kraut, Rübe. – Strychnin = Lauch, Schnittlauch, Knoblauch, grün. – Safrangelb = Gelberübenkraut. – Silber = Kalk, Eiweiß, weiße Blutkörper, Mondlicht, Aarische Rasse. – Stahl-Eisenerzquellen = Menschenblut von den Schlachtfeldern früherer Zeitläufte. – Schwefel = Eigelb, Stickstoff, Epidemieleichen; usw.
Ein zweites Farben-Zahlen-Buchstaben-System wurde 1914 im Krankenblatt aufgezeichnet und ist heute noch im Gebrauch. Es lautet:
Klotz verfährt nun so, daß er nach diesem Schema bei Hauptworten die Quersumme der den Buchstaben entsprechenden Zahlen errechnet (was bei ihm sehr geschwind geht) und diese in Klammern hinter das Wort setzt. Also etwa: Land (= 10 + 8 + 4 + 11 = 33) schreibt er Land (33). Nun aber beginnt erst das Kombinationsverfahren. Entweder nämlich sucht er mit großer Virtuosität ein Wort, das die gleiche Quersumme ergibt und fügt dieses auf Grund solcher kabbalistischer Beziehung an, oder aber er verwendet viel kompliziertere Verfahren, die offenbar immer neu erfunden werden. Z. B. nimmt er von der Quersumme nochmal die Quersumme (6 im Beispiel) und setzt dafür eine Farbe, die ihrerseits neue Assoziationsketten wachruft. Z. B. (im Gespräch): 4 = grün = Egland, Spanien, Portugal und Frankreich = Westeuropa. Oder nach Kr.-Gesch.-Notiz von 1914: Er erklärt »11 ist alles Silberne: si = Silber, d = Dattelhautsilber, n = naturweissilber, o = Eiweissilber, w = weissilber. Oder 12 = alles Goldene: g = gold, f = feuergold, z = zinnobergold«. Damals schrieb er gern lange Zahlenreihen und deutete z. B. so: (80) (8) (19) (10) (1) (0). Es ist nämlich in der ersten Klammer: 8 + 0 = 8; 8 + 0 aber auch = 19, wenn man die 0 nicht als Ring, sondern als Ei nehme und dementsprechend dafür 11 (= eiweissilber) setze. 1 + 9 = 10. Schreibt man diese getrennt als (1) (0), so ist das der aufgelöste Kristall oder die getrennte Ehe. 1 ist er und 0 sie. – Es läßt sich denken, daß Klotz durch fortwährende Beschäftigung mit solchen Spielereien sich eine erstaunliche Fertigkeit darin erworben hat. Merkt er einmal einen Rechenfehler, so ist er sehr ärgerlich und führt ihn darauf zurück, daß jemand mitgerechnet habe. Wir buchen diese Neigung des Klotz als Tendenz, Systeme und Ordnungen zu errichten, wobei er sich durch kein überkommenes Wissen gehemmt fühlt, sondern rein spielerisch, nach äußeren Beziehungen willkürlich vorgeht. Der Einzelschritt in der Formulierung: »dafür kann man auch sagen« ist logisch einwandfrei, die Deutung jedes schrittweise erlangten Resultates jedoch ebenso willkürlich, wie die zugrunde gelegte Ordnungsreihe.

Fall 36. Abb. 102. »General von Wölkern« (Bleistift). 16x20.
Die Zeichenweise des Klotz stellt in ganz seltener Weise einen Typus rein dar: das spielerische Kritzeln, das Stück für Stück ausgedeutet wird. Dabei dient meistens ein Gesichtseindruck als erste Anregung, z. B. ein Fleck an der Wand, ein Blatt oder Stein, im Garten aufgelesen, eine Wolkenform (vgl. im theoretischen Teil S. 24 ff.). So trug er eine Zeitlang einen nierenförmigen flachen Stein von 6 cm Größe in der Tasche, der nun auf zahlreichen Blättern einfach mit dem Stift umfahren wurde. Auch ein kleines Lineal, das er immer bei sich hat, wird oft zu Hilfe gezogen. Wesentlich ist, daß er zu Beginn des Zeichnens keine Gesamtvorstellung hat, sei sie noch so unklarer Art, daß er vielmehr grundsätzlich sich sozusagen mit geschlossenen Augen treiben läßt. Dies trifft für einen Typus seiner Bilder buchstäblich zu, z. B. Abb. 102. Niemand wird sich gedrängt fühlen, für dieses Konglomerat von Köpfen, Armen, Fischen, einem Wurm usw. eine andere Entstehungsart als die geschilderte zu fordern. In der Tat konnte sie bei einem ähnlichen Bilde von Anfang bis zu Ende beobachtet werden. Dieses Blatt wurde hier wiedergegeben, weil es schon von 1912 stammt und daher eine leichter verständliche Erklärung trägt als die späteren Stücke. Eine solche Erklärung fehlt bei kaum einem der sehr zahlreichen Blätter, die Klotz im Laufe der Jahre angefertigt hat. Sie steht auf der Rückseite, oder, da er sehr gern auf Papier zeichnet, das in Briefbogenform geknickt ist, auf den drei übrigen Seiten eines solchen Bogens; der Anfang oder ein besonderer Titel oft auch auf der Bildseite, wie in dem vorliegenden Falle: »General v. Wölkern Exc. Orden, Ritter pp. Phantastische Zeichnungen nach dem Gewölk.« Der Text lautet dann weiter:
»Ein Glas Bier«. – ›Der Septant‹.
Die Madonna sieht aus einem Orden,
Der Karneval nach der Feierabendglocke,
Der Wintersmann vom hohen Norden,
steht über dem Hosenanzieher Herrn Korday:
Die Dame bewundert den Schlangenhund,
die auferstandene Schönheit beschattet:
zwei Karpfen sind da, mit dem Fragemund:
Wird denn in einer Heilanstalt auch begattet?
erschrocken siehet das Ganze darein,
für Dich ist es eben, du, ohne Ranzen,
an der Herbstwagendeichsel steht im Faß der Wein,
die Nase ist dabei, mit Zinken zum Tanzen,
das Wesentliche nur hinein in die Natur,
man schiebe am Herzen der Blase,
der Vierwindensack hilft auf die rechte Spur,
ist es nicht beim Wein, dann beim Bier im Glase.
W., 16. August 1912
Aug. Klotz von H.
Warum wetzen Herr Schied und Herr Grotz meinen Arm?
Hier ist noch eine Tendenz spürbar, die zufälligen Formen der Zeichnung in irgendeinen lockeren Zusammenhang zu bringen, wie es etwa Justinus Kerner mit seinen Klexographien machte. Der Vorgang dabei ist nicht viel anders, als wenn man sich vornimmt, von anderen gegebene Worte in einem Gedicht unterzubringen, oder ein Akrostichon oder sonst ein Verskunststück auszuführen. Wobei erfahrungsgemäß die äußere Virtuosität des Gelegenheitsdichters und Tafelredners am besten zum Ziel kommt. Klotz besitzt nun zweifellos solche Anlagen und besitzt vor allem Witz und drastischen Humor, wie sich bei einigen anderen Blättern noch zeigen wird. Dies Gedicht ist jedoch weitaus das klarste, das er produziert hat. Auch hat er sich sonst nicht mehr so nahe an das zugehörige Bild gehalten, sondern nach wenigen unterschriftartigen Worten alsbald frei assoziiert, wobei er natürlich dann gleich ins Uferlose gerät.
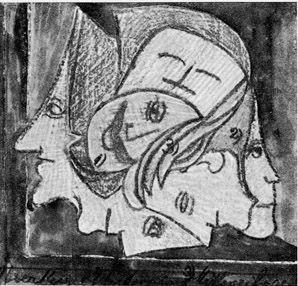
Fall 36. Abb. 103. Sechs Gesichter (Bleistift und Aquarell). 19x19.
Von den sechs Gesichtern, die auf Abb. 103 zu einem dichten Gewirr verschlungen sind, tragen drei die Zahlen 1-3. Die Beischrift beginnt: »1) Oberkugel 2) Unterring 3) Mitteneibogen«. Ferner in anderer Richtung: »Die Conglomeratseele »Fichtdichsan« dem Spitzwart: Reuchhaupt, Loisset, Flammer,« usw. Und auf der dritten Seite dann die von Klotz so geliebten Wortungeheuer: »1) Halmdolchfischgradtropfeneiweiss; 2) Weidenfleischgansspringerbogendotter 3) Ameisengoldvogelschnabelzwickeglas: Sternhautbrenemabspinnennetzkorbgeflechteschtantlederfinnenteppichlaushautfett.« – Ferner: »7000 Morkblätter einspinnen, daß er den Baum falle, wie ein Nachtwächter des Tages das Licht ausbläst = am Malvendocht der Häringsseele seilet sich der abgefallene Fischschwanz und Transportleuchtestiel in das Mutterat = den Mehlbürzel der Bierzellenkreide – – als er in den Wald stieg und zog am Ätherleinenwurzelfaserluftgewebe wie ein Moessmer an der Samenglocke, rammelte er als Affe in den Haarfedern des Mimosenfleisches Rührmichnichtan vom Boxhornapothekerstrich im Mädchenscheibenglas den Schädels Nasenherz, die Jagdstube ...« Die möglichen Beziehungen dieses zum Teil immerhin amüsanten Gallimathias zu dem Sechskopfblatte zu ergründen, sei dem Leser überlassen. Dies Bild, mit Aquarell, Kreide und Buntstift (vorwiegend blau-rot) stammt wie das folgende aus dem Jahre 1915.
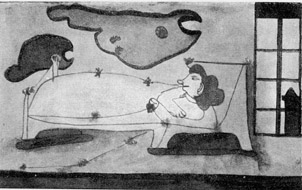
Fall 36. Abb. 104. »Frau im Bett« (Aquarell). 23x14.
Von den vorigen unterscheidet sich Abb. 104 dadurch, daß hier eine ansprechende dekorative Gesamtwirkung erzielt worden ist, die sogar etwas Bildmäßiges hat. Wahrscheinlich haben hier Wolkenbilder als Anregung gedient; das Fenster wird wohl zum Schluß hinzugefügt worden sein, als die Frau im Bett entstanden war. Man kann dem Stück einen gewissen fragilen Reiz nicht absprechen, der wohl vorwiegend in der spärlichen, aber irgendwie suggestiven Verwendung langer, matter Linienzüge beruht, die durch grüne Tupfen auf hellblauem Grunde bizarr belebt werden. Die wolkenartigen Gebilde sind mattrot gehalten, der Grund gelbbraun. Die Unterschrift des Bildes beginnt so: »Der Taschenschaden ist Apostel: Du hättest die zwei Hüte zu Karpfenfallen unter dem Bette – der Wagner ist auch Bremser: aus Bremen? Probelant: Die führen die böse That gegen sich womit sie den Richter zum Blocken zwingen wollen in einem allgemeinen Doppelsprachensystem-Zeichen gar nicht aus ... Die Frau Sch. am Strick liegt da im Bette (– deshalb bist Du der Bräutigam –)« Später notierte er, was die Stimmen ihm offenbar während der Arbeit sagen: »Zuruf: Schererschensky ist es, der so etwas unterschreiben würden – Scheere auf dem Linolboden gegen oberen Abtritt M 7 – Alette – Valet: Kleinsaalwerth«.

Fall 36. Abb. 105. »Kaminfegerschnee« (Aquarell). 16x11.

Fall 36. Abb. 106. »Harnröhrenöffungshelm« (Aquarell). 11x12.
Ganz ungeformte Spielerei ist wieder Abb. 105 mit der echt schizophrenen Unterschrift: »Kaminfegerschnee im Frühling«, in der zweimal Gegensätze vereinigt sind: schwarz-weiß und Winter-Frühling. Dagegen macht der auf Zeitungspapier mit Aquarell hingeworfene Kopf Abb. 106 wieder einen überraschend sicher geformten Eindruck. Damit aber das Groteske nicht fehle, heißt das Blatt: »Der Harnröhrenöffnungshelm«. – Andere Blätter, wie Abb. 107, lassen kaum bestimmte Formen erkennen. Ein Kopf hier, ein Arm dort, ein Tierleib, alles vom Zufall gefügt und nur durch Beziehung auf den Rand und durch die Farbverteilung zu einem Gesamteindruck gebracht – das irrlichtert oft auf engem Raume. Selbst bei so aufgelöstem Formspiel aber muß man sich hüten, einfach als verantwortliche Stelle die Krankheit zu zitieren. Ein Blick auf die Wand des bekannten mykenischen Goldkästchens (Abb. 179) lehrt besser als Worte, daß auch freiestes Formenspiel im Dienste dekorativer Flächengestaltung noch nicht – schizophren genannt werden darf.

Fall 36. Abb. 107. »Fuchsschnecken« (Aquarell). 15x6.
Aus der großen Zahl dieser fast immer originellen Bildchen ragen einige Blätter durch stärkere Pointierung heraus, bei denen man mit rein spielerischer Entstehung schwer auskommt, ohne daß doch eine rationale Komponente aufzustellen wäre, die solche Zuspitzung in karikaturistischer Richtung erklärte. Denn wir finden ja nicht eindeutige Pointen, sondern schizophrene, d. h. vieldeutig dunkle. Etwa auf der fast eleganten aquarellierten Zeichnung: »Keller, Wirtshaus, Salon, Stall in Einem. Cigarre weg!« Abb. 108. So überraschend dieser Titel auch klingt, so läßt sich in diesem Falle doch zeigen, daß er sich eng an das anschaulich Gegebene hält. Der Keller wird offenbar durch die Bogenlinien links repräsentiert, die man wohl als Faßrand verstehen muß. Das »Wirtshaus« mag in dem Gegenüber der zwei Profile liegen. Der Salon ist durch den stutzerhaften Mann gegeben, der Stall durch den Ochsenkopf rechts unten. Und das »Cigarre weg!« bezieht sich auf den grotesken ganymedartigen Knaben, der auf dem Adler sitzend tatsächlich eine Zigarre aus der Hand fallen läßt. Daß der eine Flügel des Adlers zugleich die Haartolle des Gecken darstellt, wundert uns nicht mehr. Wir haben solche Doppeldeterminierungen als charakteristisch für schizophrene Vorstellungsweise wiederholt angetroffen. Das ganze Bild zeigt in selten drastischer Weise, was uns als Verdichtung, Verschmelzung, Kontamination aus der Sprachsphäre geläufig ist. Nicht weniger als vier Örtlichkeiten werden auf der Bildfläche vereinigt. Aber nicht wie auf alten Bildern, daß mehrere Örtlichkeiten nebeneinander dargestellt wären. Sie werden einfach symbolisch repräsentiert durch einen Bildteil, und damit muß der gleiche Bildraum für alle vier Orte gleichmäßig dienen und obendrein noch den Ganymed aus sich entlassen. Das klingt unglaublicher, als es bei genauerer Überlegung ist. Denn genetisch verhält es sich doch so, daß der Mann sicher nicht vorher überlegt: dies Blatt soll mir vier Orte repräsentieren. Sondern er zeichnet, wie immer, spielerisch »ins Blaue hinein« und hört dabei Stimmen, die in ihrer Wirkung nicht prinzipiell anders zu werten sind, als jeder beliebige Einfall – sie drängen sich nur zwingender auf. Indem er nun, solchen »Einfällen« verschiedener Art preisgegeben, die Formen prüft, die er mechanisch abzeichnend oder aus unbedachten Impulsen spielend mit dem Stift hingeworfen hat, klingen (bislang noch) anonyme Formteile mit Vorstellungen, Gefühlen und allem möglichen psychischen Material zusammen. Was dabei siegt, hängt gewiß von affektiven Faktoren und der seelischen Konstellation des Augenblickes ab. Vermutlich wird öfters ein Kampf zwischen einfachem Erinnerungsmaterial und halluziniertem Material entstehen, wie wir das aus Selbstschilderungen von Kranken (aber nicht in bezug auf Zeichnungen) wissen. Und dabei ist zu bedenken, daß der Inhalt der Halluzinationen ja ebenfalls vorhandenen seelischen Besitz verwertet. Können wir demnach den Strom der Einfälle materiell dem des Gesunden gleichsetzen, so muß das Spezifikum im Gestaltungsprozeß selbst liegen. Auch die Fähigkeit, spielerisch, ohne Zielvorstellung, zu zeichnen, enthält nicht die besondere Komponente. Vielmehr steckt sie zweifellos einmal in der Art, mit der jedem auch nur in einer Richtung zutreffenden Einfall volle Wirkungsfreiheit eingeräumt wird. Und dann in der Freude an vielfältigen Pointen, die sich nicht zu einer Hierarchie vereinigen lassen, sondern gegeneinander streiten und ständig jene Spannung vor Entscheidungen aufrechterhalten, in der noch alles möglich ist. Von diesen rein psychologischen Versuchen, in das schizophrene Weltbild einzudringen, ist an einer anderen Stelle noch ausführlicher zu handeln.

Fall 36. Abb. 108. »Keller, Wirtshaus, Salon Stall« (Bleistift und Aquarell). 23x30.

Fall 36. Abb. 109. Spielerisch-dekoratives Blatt (Aquarell). 26x34.
Wir gehen nun über zu einer ganz anderen Art von Bildern, in denen Klotz eine Strenge der Komposition zeigt, die man wohl kaum von ihm erwartet hätte. Große, nach allgemeinen Gestaltungsprinzipien aufgebaute Blätter, wie Abb. 109 hat er über zwanzig gemacht. Und wiederum müssen wir eine Abwandlung seiner ursprünglichen, ziellos spielerischen Gestaltungsweise feststellen, wenn wir gleich auch hier noch diese als vorherrschend betrachten. Denn eigentlich geschieht ja nichts anderes, als daß dem Zeichner der Reiz symmetrischer Anordnung um eine Mittelachse aufgeht. Und nun wiederholt er, was er sonst ganz frei phantasierend entwarf, immer rechts und links von dieser Achse. Es spricht für die Beweglichkeit des Mannes, daß er dabei nie pedantisch verfährt, sondern sich Ungleichheiten gewandt anpaßt, und auch Profilformen wie den Vogel unten ohne Mühe einzuordnen weiß. Dieser Vogel gehört zu den wenigen Objekten, die er häufig in gleicher Weise zeichnet, obwohl sie aus ganz verschiedenen formalen Situationen hervorwachsen. Daraus geht hervor – was für jeden Zeichner selbstverständlich ist –, daß ein gewisser Umkreis von Formen ihm so geläufig ist, daß er sich häufig in irgendeinen Zeichnungsablauf hineindrängt. Dabei könnte man sich wohl vorstellen, daß, sobald der Vogel ihm einfällt, der vagabundierende Stift auch schon eine Kurve macht, in die Kopf, Schwanz oder Füße hineinpassen. Oben auf dem Bild bemerken wir übrigens beiderseits den Umriß jenes nierenförmigen Steines, von dem schon die Rede war (S. 172). Die Punktmanier, zumal die weiße Punktkette auf farbigen Streifen, erinnert an manche Miniaturen aus Irland z. B. und kommt auch auf mykenischen Vasen vor. Die Beischrift auf der Rückseite hat denselben Charakter wie die sogleich wiederzugebende zu dem folgenden Bilde, Abb. 110.
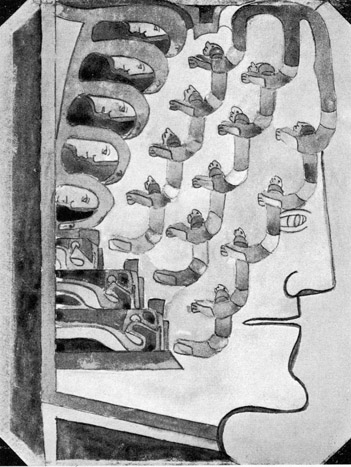
Fall 36. Abb. 110. »Wurmlöcher usw.« (Aquarell). 25x33.
Die Vereinigung aller bisher erwähnten Tendenzen müssen wir in diesem großen Kopfe mit den äußerst sonderbaren Bogenformen sehen. Als Gesamtbild nämlich ist er von einer monumentalen Feierlichkeit erfüllt, die, in solcher Schlichtheit zumal, ungewöhnlich ist. Wir danken sie wohl der an den streng dekorativen Blättern erworbenen Sicherheit. In den Bogen aber, die eine absurde Kombination aus Wurmleibern, Fingern mit Nägeln und Raupenköpfen sind und zugleich als Haare auftreten, haben wir die Verbindung mit dem spielerischen Verfahren des Anfangs. Nun aber wendet er auch auf dies Motiv das Prinzip der Reihung an, an dem er inzwischen Freude gefunden hat. Das Blatt stammt aus dem Jahre 1919. Seine Beischrift gibt Klotzens heutige Art frei zu assoziieren gut wieder und folgt im Auszug: »Wurmlöcher (Badegesichter) Wurmzüge (Klaviermusikstockzähne) Wurmbänder (Speichelbadeleben der Erzleiergallerie-Zinn-Zeitler-Spieglereien: ad Mutterzuckermond im Siebensalznasenwasser. Die Sehzunge ist in den Kopfmandeln der Unterleibhoden im Wechselzuckfünfer der Nasenspitze ad Sehsim-Kalender 1905 Jordon ad Biblia = Leib = Ja = Eselsbrücke = Heytrajekt = Stalenlöcherstecher = Kastanienholzgeistameisen = Kupferroth = Glasmilch = Lakmus = Lakaien = Kalium: Lamm – Ohr am Stein Aug am Herz = Scholle unter dem Brunsteiter = Krebs: Gottfels = Sohn = salzsule = Hymengeist = Dreiheit Ammoniak Salmiak Spiritus veris (Ameisengeistwurmdrehe) Igelfisch = Kaviarstaterlocher = im = Magennasenaftermaul»auge« = Politur = Polizze = Daumen = Damenschlafsilberhandel = ad M. 500 000 Y ad Eschrich Zimmermann. 27. März 1919 Fingerhackeldaumendamenniere = Frl. Schwarz (30) Y »Siehe dies an und unterstütze« (206) Untergesichts – Taster – Strontiam – Salat Dr.«
Es bleibt noch übrig zu zeigen, wie weit Klotz, der unermüdlich seit Jahren eine Zeichnung nach der anderen entwirft und aquarelliert, mit seiner großen Übung sich in das Gebiet ernsthafter künstlerischer Gestaltung vorarbeitet. Die ›Germania‹, Aquarell auf Zeitungspapier, Abb. III, aus den letzten Jahren stammend, ist ein Beispiel dafür. Wiederum wimmelt die Fläche von verschieden gerichteten Köpfen, die wohl nach alter Gewohnheit aus zufälligen Liniengeweben ausgedeutet wurden. Aber die Gesamtform dieses Riesenkopfes in gelb-schwarzem Strahlenkranze, in der Schlichtheit der Konturen wie der Haltung an eine Athena gemahnend, verlangt als künstlerische Leistung von ansehnlicher Qualität gewertet zu werden und hält jeder Kritik stand.
Das ›Ägyptische Krankenbett‹ Abb. 112 aber, rein als farbige Komposition ein Akkord aus hellgrün und hellviolett von einem milden Zauber subtilster Art, gehört trotz wunderlicher Unstimmigkeiten in den Formelementen doch auch als szenisches Bild zu jenen wenigen Werken der Sammlung, vor denen man mit einer gewissen Erschütterung stehen bleibt. Die derben Ornamente unten mögen sich immerhin mit einer starren Sinnlosigkeit als Kulisse aufbauen, wie wenn das Ganze eine dekorative Phantasie werden sollte. Der Sperberkopf des Gottes Osiris, den er wohl in einer Zeitschrift gefunden hat, mag zunächst etwa wie ein Majolikaaufsatz erscheinen, sein liegender Körper als ein zufälliges Gefüge der Farbflecke – die Wiederholung des Kopfes (links) gar wie ein unpassender Scherz; dennoch zwingt die Kopfreihe dahinter, auch nur derb angedeutet, aber gegen die kristallinische Farbenpracht vorn fast grob-realistisch wirkend, alles zu apostolischer Feierlichkeit zusammen. Manche dieser Köpfe, wie der dritte vorn rechts, aus dem etwas weich Ekstatisches zu sprechen scheint, erinnern etwa an Apostelköpfe von Emil Nolde. Daß der Umriß der hellen Fläche oben in seinen Kurven den Köpfen folgt und so eine Art Heiligenschein-Reihe suggeriert, erhöht die sakrale Grundstimmung.

Fall 36. Abb. 111. ›Germania‹ (Aquarell). 23x29.

Fall 36. Abb. 112. Ägyptisches Krankenbett (Aquarell). Originalgröße.
So wenig man bei diesem Bilde von formal einheitlicher Gestaltung reden kann, so offen die »Fehler« zutage liegen – seine packende Wirkung, besonders auf Künstler sehr verschiedener Richtung, ist vielfach erprobt. Wenn man sich klar werden will, was denn eigentlich diese Wirkung hervorbringe, so ist zwar der ansprechende Farbenakkord gewiß zum Teil dafür verantwortlich zu machen. Aber darüber hinaus muß doch in der »Grundstimmung« der Szene, wie wir ganz allgemein sagen, noch eine faszinierende Komponente stecken. Irgendwie rührt gerade der Kontrast zwischen der farbigen Kristallwelt – in der unser Gefühlston für ägyptische Kultur wohl frei anklingt – und den dumpf bewegten Köpfen dahinter uns noch besonders auf. Mögen darin nun Zeitstimmungen zum Ausdruck kommen – mag Metaphysisches durchtönen – oder die schwebende Doppeldeutigkeit schizophrener Denkart uns fesseln, die Tatsache ist nicht zu bezweifeln. Wahrscheinlich wirken alle drei Komponenten zusammen.
Klotz repräsentiert uns, so können wir zusammenfassend sagen, den ungeübten Zeichner mit einiger Begabung und lebhafter Ansprechbarkeit der visuellen Sphäre, in dem spielerischer Betätigungsdrang durchaus vorherrscht. Er läßt sich grundsätzlich von Augenblicksimpulsen treiben, so daß seine Bilder, allgemein gesagt, die unbewußten Komponenten des bildnerischen Gestaltens in seltener Reinheit verkörpern. Dabei fanden wir eine deutliche Entwicklung vom einfachen chaotischen Wühlen in Einzelheiten bis zu bildmäßigen Schöpfungen von ansehnlicher Qualität – zugleich aber einen fortschreitenden Verfall seiner Persönlichkeit, soweit diese aus seinen schriftlichen Erläuterungen zu den Bildern zu erschließen ist. – Man kann seine Eigenart auch so formulieren: er schafft völlig passiv, als Zuschauer fast, und sucht nachträglich zu deuten, was da entstanden ist. Darin liegt, daß Klotz eine Art inspirierter Haltung einnimmt, ohne daß eigentlich ein Inspirationserlebnis erfolgt. So wenig Plan und Absicht bei ihm vorhanden ist, so könnte man doch auch sagen, er verhalte sich, als ob er in den Niederschlägen seiner Augenblicksimpulse Offenbarung erwartete. Er will nicht gestalten, was sich auch in Worte fassen ließe (wie etwa der Mystiker, von dem Abb. 78 stammt) oder was ihm überhaupt in irgendeinem Sinne als seelischer Besitz bewußt ist. Sondern Gestalten ist ihm nichts anderes als ein endloses, planloses, irgendwie erfreuendes Formendeutespiel, aus dem dann unversehens unter zahllosen nichtssagenden Schmierereien einige Bilder sich ernsthafter Kunst nähern.
Peter Moog, 1871 geboren, wuchs in ärmlichen Verhältnissen in der Eifel auf. Der Vater, der 81jährig starb, soll nach Angabe der Mutter zeitweise geistesgestört gewesen sein, war aber anscheinend nicht in einer Anstalt. Ein Bruder hat sich zu Wohlstand und einiger Bildung emporgearbeitet. Andere Familiennachrichten fehlen. – Moog wird als gutmütiger, gescheiter Junge geschildert, schnell auffassend, mit gutem Gedächtnis, immer einer der besten Schüler. Er wurde Kellner, soll sehr flott gelebt und als lustiger rheinischer Bursche sich an Wein, Weib und Gesang reichlich ergötzt haben. Von diesen Erinnerungen zehrte er später noch lange. Es fehlte auch nicht an dem körperlichen Denkzeichen jener liederlichen Zeit in Gestalt einer Gonorrhöe mit Drüsenaffektion usw. Seine Militärdienstzeit machte er größtenteils als Bursche eines Majors durch. 1900 heiratete er als Oberkellner. Die Ehe war aber schlecht. Nach seinen Angaben hat die Frau alles vertrunken und ist 1907 an »Trunk- und Wassersucht« gestorben. Ein Kind lebt und ist gesund, zwei sind klein gestorben. In den Jahren 1902-1907 führte er eine eigene Wirtschaft, die dann in Konkurs geriet. Nachdem er nochmal einige Monate als Geschäftsführer eines größeren Hotels gearbeitet hatte, wobei wieder reichlich getrunken wurde, brach die Krankheit 1908 plötzlich an einem Tage mit einem »Nervenschlag« aus, der dann ärztlicherseits bald als »Nervenschock«, bald als organischer Schlaganfall aufgefaßt wurde. Nach den sogleich näher zu beschreibenden Begleiterscheinungen war dies aber nichts anderes als ein schizophrenes Primärerlebnis, über dessen körperliche Grundlagen wir ja allerdings nichts wissen.
Moogs Persönlichkeit läßt sich aus diesen Daten in den Hauptzügen wohl erfassen: ein begabter, geistig beweglicher Mensch, der sich aus kleinen ländlichen Verhältnissen durch den Kellnerberuf vielerlei Kenntnisse und eine große Weltgewandtheit erworben hat. Sein rheinisches Temperament führt ihn zu einem etwas lockeren Leben, zu Alkoholismus und sexuellen Ausschweifungen, eine schlechte Ehe macht ihn vollends haltlos. Seine gesellige Neigung scheint immer auf einer stärkeren Begabung zu jenen Wortspielereien, schwungvollen Phrasen und zu jenem Bramarbasieren beruht zu haben, das den als »Original« beliebten Studentenwirt ausmacht. Aber dem lag von Kind an eine gewisse Neigung zum Gestalten zugrunde. Durch den Bruder ließ sich Moogs eigene Angabe bestätigen, daß er als Schüler viel Freude an Handfertigkeiten bewiesen habe. So hat er für den Unterricht in der Körperlehre Pyramiden, Kegel, Zylinder, Würfel u. dgl. sauber aus Holz geschnitzt und gern gezeichnet, besonders Häuser und Kirchen. Später will er als Soldat einmal eine Festung abgezeichnet haben. Auch Gedichte hat er öfters gemacht. So viel läßt sich aus seinen gesunden Tagen feststellen.
Der Ausbruch der Krankheit spielte sich nach Moogs eigenen Angaben so ab: er hatte wieder gekneipt – ein paar Flaschen Burgeff –, da fuhr es morgens beim Kontrollieren der Bücher auf einmal wie ein elektrischer Schlag in sein Gehirn, wie 100 000 elektrische Strahlen vom Himmel. Er ließ die Arme hängen und rief: »Ich bin ein Künstler, hurra, ich bin ein großer Dichter, ein großer Mann, habe eine halbe Million.« Andauernd gingen Zuckungen durch den ganzen Körper. Auf dem Wege zum Klosett sah er plötzlich vor seinem geistigen Auge die Büsten Schillers und Goethes und dachte, er werde nun auch so einer werden. Das Gehirn drehte sich wie eine Kaffeemühle. Er mußte aufspringen und rufen: »Es lebe der Hauptmann von Köpenick und Zeppelin!« (die beide damals gerade Tagesgespräch waren). Bei alledem war er immer ganz orientiert, eher besonnen. Ohne Hut rannte er nach Hause, wo ihm nachmittags zwei Ärzte Beruhigungspulver gaben. Er glaubte, das Zimmer sei eine Bühne und sah »seine eigenen Bücher und Gedichte« vor sich. Man wollte ihn in eine Anstalt bringen, er weigerte sich aber, weil er sich riesenstark fühlte. Seine Herztätigkeit war »furchtbar«. Er meint Fieber gehabt und 10 Flaschen Mineralwasser getrunken zu haben. Gegen 2 Uhr nachts »vollzog sich langsam, bei vollem Bewußtsein, der Abschied vom Leben und der Gang zum Schafott mit all seinen seelischen und körperlichen Qualen«; er hörte das Sterbeglöcklein läuten. »Mit der Tagessonne fühlte er seinen Humor wieder steigen.« Er hatte sich nachts »reif für das Irrenhaus« gefühlt, aber nun waren Körper, Gedankenwelt, Aussprache, Tun und Handeln wieder vollständig in seiner Gewalt, als er früh in seine Heimat fuhr – um nach einer unheimlichen Nacht wieder in die Stadt zurückzukehren. Auf der Fahrt war alles befremdlich. Er bekam ein ganz besonderes Billett, das 30 Pfennige mehr kostete. Die Schaffner klopften eigentümlich mit ihren Zangen auf, das bedeutete: »da kommt ein Geisteskranker oder ein Verbrecher«. Bei dem Wirt, mit dessen Tochter er sich damals (schon vorher) verloben wollte, trank er viel, fing aber nicht von der Verlobung zu sprechen an, da er merkte, daß man sich gegen ihn ablehnend verhielt. – Er verlor seine Stellung, war aber durch dies Erlebnis »zum Dichter geschlagen«, es war »so eine obere Mystik« über ihn gekommen und er schrieb nun aus dem Stegreif ohne Mühe die schönsten Sachen.
In den folgenden Wochen trieb er sich in den verschiedensten Städten umher. Seine Schilderungen dieser Zeit widersprechen sich und stimmen in den Daten nicht. Vermutlich verlegt er einzelne frühere Erlebnisse in diese akute Phase seiner Krankheit. Jedenfalls scheint er den Ort aufgesucht zu haben, in dem er mit seiner Wirtschaft Bankrott gemacht hatte, und seinen Nachfolger belästigt zu haben – und zugleich nach einem Streit mit »Hausfriedensbruch« aus seiner Schlafstelle hinausgeworfen worden zu sein. Dann wollte er angeblich literarische und humoristische Vorträge halten, mietete viermal einen Saal, der ihm dann im letzten Augenblick verweigert wurde usw. (dies ist nicht bestätigt und kann konfabuliert sein). Als er alles Geld durchgebracht hatte, zog er sich zu seiner Mutter in die Heimat zurück. Es war eine große Änderung mit ihm vorgegangen, innerlich und äußerlich, geistig und körperlich. Er wollte Schriftsteller werden und zur Veröffentlichung seiner Werke, von denen angeblich vier Bände fertig dalagen, eine eigene Druckerei und Buchhandlung einrichten. Damit sollte dann eine Kunsthandlung verbunden werden. Einen Grundstock von alten Kunstgegenständen hatte er angeblich schon vor zwei Jahren gekauft, aber bei einem Händler versetzt. Nach Streitigkeiten mit seinen Angehörigen, die schließlich zu nächtlichen Raufereien führten, wurde er 6 Wochen nach jenem »Nervenschlag« in die Anstalt eingeliefert.
Sein Verhalten entsprach dem, was wir als »flotte Manie« bezeichnen: er fühlte sich außerordentlich wohl, freute sich, zur Erholung in eine so angenehme Umgebung geraten zu sein, fand das Essen vorzüglich, machte fortwährend Witze und Wortspiele, wollte ein Versöhnungsfest mit der Familie feiern, der ganzen Welt verzeihen usw. Dabei machte er Andeutungen über seine Abstammung, prahlte mit seinem Reichtum – er habe Altertümer im Wert von einer Million, ein Hotel, eine Burg. Sein Betätigungsdrang richtete sich vorwiegend auf ein Kunstmuseum, das er in seiner früheren Wirtschaft einrichten wollte. Die Einrichtung sei schon bestellt, 2-3 Bilder werde er selbst täglich dafür malen. Der Madonna seines Heimatortes stiftet er einen Purpurmantel und ein goldenes Szepter nach eigenem Entwurf. Nebenbei konstruierte er ein lenkbares Luftschiff aus Aluminium und Marienglas für 3600 Personen. Sein Vermögen steigerte sich bald auf unsinnige Beträge: »hunderte von Milliarden, hundert Hotels, ebensoviele Schlösser und Burgen, Tabakplantagen, Hochwald und -wild, Obstwälder – ein Herz voller Liebe – eine Königskrone! Hermelinbekränzt! Brockatgeschmückt! Ein aufgehendes Morgenrot, Meiner Göttin, gez. Friedrich von Schiller.« – Damit kommen wir zu Moogs schriftlichen Äußerungen. Feierliche Send- und Bittschreiben an die Anstaltsdirektion, den Bürgermeister des Heimatortes, an »Carmen Sylva, Kronprinzessin von Griechenland«, und vor allem an eine Phantasiebraut Amalie von Pisack (von dem volkstümlichen »pisacken« = necken, ärgern, quälen abgeleitet), deren Adresse einmal lautet: »Himmelreich, Paradiesstraße Nr. 500, bei den Englein in der Zuckerdose.« Die Unterschrift meist: »Schiller«. Einige Stilproben in Vers und Prosa mögen die äußerliche Gewandtheit zeigen, die über hohle Stellen hinweggleitet, Entgleisungen halb verdeckt, oft aber einen gewissen literarischen Anstrich erzielt.
»Doch stille, stille schleichen die Schatten an meinen Augen vorbei und malen mit ihren Fittichen liebe schöne Bilderbogen auf die Wolken des Himmels, auf das blaue Firmament. Wenn dann gelegentlich die Muse kommt und ein brütendes Menschenkind aufrappelt, dann zupft auch schon so ein kleiner Kobold mich an beiden Ohren. Ich schlief – ich träumte vom Himmel – vom Glück – vom Siegeszug der Liebe!«
»Das schönste Schloß im deutschen Reich,
Ich bring es meiner Liebe dar,
Der Lilie diesen Palmenzweig,
Und was mein Land noch sonst gebar,
Forellen blau, im Enten-Teich.
Der Fürstin einen Zollern-Aar,
Auch treuste Liebe bis zum Tod
Mein Morgenstern, mein Abendroth.
Friedr. von Schiller.«
Gegenüberstellung von grobsinnlicher und idealer Liebe, ein recht lüsternes Schwärmen von Jungfrauen, ist häufig:
»Wo immer dann die lichten Zwiegestalten,
In Ruhm gebahrt, die zarten Hände falten,
Da flieht der Wüstling, wird ihm nichts ergänzt –
Urkundlich fehlt ihm dort das höchste, schönste Recht –
Was ihm ein zottig Weib oftmals kredenzt –
Am Freudentisch genießt's manch' loser Specht ...
Ein Heiligtum sei jene schönste Welt,
Ein Lorbeerhain! Ein Ruhm! Ein Sternenzelt!
Grace et Gloire, wer immer sich vergißt
Mit Liebe nur und Liebesgleichen mißt,
Dem wird der Himmel hier auf Erden blüh'n
Ein Kampf ums Paradies muß Männerschultern zwingen,
Es soll am Herd die Sonnenblume glüh'n
Die Anmut fleht, schier betend soll er ringen,
Um jene Freuden – sittsam – reich – gepaart,
Wo blüht das Glück! Wo Liebe aufgebahrt!«
»Wilde Rosen sind schön, lassen aber leicht die Blätter fallen, haben lose Blüthenstiele, duften nicht, werden von vielen gepflückt und dann bei Seite geworfen. Achtlos – bis ein Sturm sie zerdrückt, zerpflückt, – vollends – Schade! – Deshalb Cultur – Kunst – sie veredelt, bringt erst den Duft, mit der vollen Götterknospe, die jeder unberufenen Menschenhand sich verschließt, und lieber im Sturm zerfliegt, oder vom Zeus sich vernichten läßt, und zum Himmel schreit, um Hülfe, eh' sie sich – ergibt!« – »Ich ahnte Stürme, und kam Dir zu Hülfe. So ein Kerl, wie ich, hat Erfahrung. Ich habe schon öfter wie einmal am Bettchen einer schönen holden Jungfrau gewacht, ohne zu disponiren. Eine Heilige Stätte ist mir immer heilig gewesen. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen.« »Hören Sie nicht die Harmonie meiner Seele und meines Geistes. Ich stehe im Begriff Großes und Schönes aufzubauen, zum Ruhme der Menschheit, zum Triumphe
des deutschen Volkes,
die Palme meiner selbst,
dem deutschen Weibe sei der Lorbeer,
der Jungfrau die Myrthe,
dem Jüngling die Freiheit,
dem Manne das Eichblatt,
dem Alter die Krone,
dem Tod und dem Grabe der Sieg
in der Auferstehung. Spott dem Feigling.
»Es lebe das jüngste Gericht!«.
Alle diese Schriftstücke haben, auch in der flüchtigen, ungleichen Schrift und ihrer Anordnung auf dem Blatt, manischen Charakter. Dementsprechend wurde in der ersten Anstalt auch die Diagnose gestellt. Mancher Passus mit dem gewissen Kriegervereins-Pathos könnte geradezu als ein Musterbeispiel manischer Ausdrucksweise gelten. Z. B. an die Anstaltsärzte: »Es hat mich gefreut so viel ausgezeichnete Herrn, soviel Liebenswürdigkeit, Opositionsgefühl, stahlharte, kernfeste Männer, kennen und schätzen zu lernen. Es sollte mich sehr freuen, mich demnächst, als Einer der Ihrigen, aufzunehmen, in einem gewissen Sinne, soweit es Herkunft und Bildung zuläßt. Sie werden in mir nur den liebenswürdigen, allzeit zuvorkommenden Gesellschafter finden, dem es auf eine gehörige Dosis Humor und Künstlerpech und Spott und Draht, nicht ankommt.«
Seinem Heimatort stiftet er feierlich 12 Exemplare seiner gesammelten Werke, nachdem er im Interesse der »Wohlfahrt des Landes« und »seiner lieben Landsleute« auf eine gerichtliche Verfolgung seiner Geschwister wegen ihres Benehmens gegen ihn verzichtet hat. – Die Unternehmungslust und euphorische Stimmung hielt jedoch nicht lange einheitlich an. Bald setzten Zeiten der Gereiztheit und gedrückter Stimmung ein. Man fand ihn öfters in Tränen, er beklagte sich über nächtliche Quälereien. Dann wieder lobte er die nächtlichen Besuche von »Geistern, Genien und Grazien, die ihm das Genie des Drama's verheißen«, fühlte sich »rein elektrisch von dichterischer Begabung und Schaffenskraft durchströmt« oder es wurden »wie durch Explosionen wunderbare Gedanken und Dichtungen in seinem Kopfe frei«.
Die Abgrenzung einer akuten Krankheitsphase bei Moog ist nicht möglich. Er arbeitete schon in den ersten Jahren zeitweise im Hause und im Garten ganz friedlich, zu derselben Zeit, in der er als »Dichterfürst« so viel Papier beschrieb, als ihm zugänglich war. Die reizbare Grundstimmung nahm im Laufe der Jahre zu. Er neigt zu unvermittelten Wutausbrüchen gegen Mitkranke, Pfleger und Arzte. Nur die Gegenwart von Frauen erzeugt sogleich gute Stimmung, ja schwärmerische und etwas alberne Verzückung bei ihm. Über die Rolle halluzinatorischer Erlebnisse ist gegenwärtig nichts Sicheres von ihm zu erfahren. Doch berichtet die Krankengeschichte gelegentlich, er verlobe sich alle paar Tage neu, spreche eifrig mit seiner Phantasiebraut und höre sie sprechen. Dann zeigen sich wieder einmal Züge von Größenwahn: er nennt sich Rittergutsbesitzer und will einen seiner Beamten telegraphisch befördern: jeder Spatenstich von ihm sei eine Million wert. Oder er fühlt sich verfolgt: ein die Anstalt inspizierender Herr hat ihm Fußangeln gelegt. In einer Periode ruhiger Arbeitsamkeit gerät er plötzlich in manische Erregung, verkündet in einem Wirtshaus, wo er sich in Abwesenheit des Wirtes so viel Bier abzapft, wie er hinunterzuschlucken vermag, jetzt komme der schönste Augenblick seines Lebens; telegraphiert und schreibt nach allen Richtungen unsinnige Nachrichten. – Eines Tages sammelt er Glasstücke und Steine im Garten und berechnet den Wert dieser »Kleinodien« auf Millionen. Ein Metallstückchen ernennt er zur Reliquie, die ihn vor Tod und Verderben schützt. Während mehrerer Jahre hat er trotz solcher verschrobener und illusionistischer Handlungen als Büroschreiber der Anstalt wertvolle Dienste geleistet, bis sein reizbarer Eigensinn und seine Wahnvorstellungen ihn wieder an die Abteilung fesselten.
Heute ist Moog hauptsächlich mit Hausarbeit beschäftigt, die ihm Zeit genug läßt, Messen zu dichten und Bilder zu malen. Er ist ein untersetzter, etwas abgemagerter Mann, mit großem Kopf, spärlichem dunklen Haar, etwas stechenden, mißtrauischen dunklen Augen. Mit vorsichtig-schleichenden Schritten bewegt er sich nur zögernd, wenn ein Besucher kommt, verneigt sich sehr devot und spricht in salbungsvollem Tone in gesucht höflicher, süßlicher Weise, wobei er gern die Augen senkt. Öfters spielt ein flüchtiges, überlegenes Lächeln um seine Mundwinkel, als beziehe er sich auf geheimes Wissen. An den Hauptstellen spricht er in dozierendem oder predigendem Ton und macht dann auch einige weiter ausladende Gebärden. Auch nachdem er im Gespräch etwas freier und natürlicher geworden ist, läßt er immer wieder seine höhere Berufung durchblicken. Seine sprachliche Ausdrucksweise ist sehr gewandt und enthält wenig Verschrobenheiten.
Suchen wir uns nun zu vergegenwärtigen, welche Vorbedingungen zu bildnerischer Betätigung bei Moog gegeben waren, so läßt sich mit einiger Sicherheit dies sagen: er zeigte schon als begabter Junge in der Schulzeit eine ausgesprochene Neigung sich formend zu betätigen. Neben Gebäuden, die er (nach eigener Angabe) aus Kalendern abzeichnete, zogen ihn stereometrische Elementarformen an, die er für den Unterricht schnitzte. Später, bis zum Jahre 1912, scheint er sich nur in seltenen Ausnahmefällen im Zeichnen versucht zu haben. Dagegen hat er offenbar sehr gern Bilder betrachtet, zumal in den Kölner Kirchen und im Museum; wenigstens betont er dies jetzt. Und von seiner Vorliebe für Antiquitäten war im Beginn seiner Krankheit viel die Rede. Aus alledem geht hervor, daß er ungewöhnlich lebhaft auf anschaulich Gestaltetes anspricht und sich von jeher betrachtend und gelegentlich auch ausübend darum bemüht hat. Zu diesen Anlagen in der anschaulichen Sphäre gesellt sich aber bei ihm der sprachliche Gestaltungsdrang. Und hier überwiegt über Abbilde- und Ordnungstendenzen Neigung zu Spiel, Symbolik und Metapher, während im Versbau sich eine gewisse Gewandtheit und Vielseitigkeit im Rhythmischen, also auch auf Ordnung abzielende Bestrebungen, kundtun. Wenn man will, kann man in der Neigung zu blumenreicher Sprache auch das Wuchern einer Schmucktendenz finden.
Im Jahre 1912 nun zeichnete er zunächst einige Ansichtskarten ab, von denen sich leider keine mehr auffinden ließ. Dagegen ist etwa aus jener Zeit ein brauner Karton vorhanden, auf dem er, ebenfalls nach einer Postkarte, ein villenartiges Gebäude unter Bäumen mit Buntstiften und Wasserfarben dargestellt hat. Das Bild zeigt wohl, daß relativ klare Formvorstellungen und einige Erfahrung in der Wiedergabe von Formdetail vorhanden war. Aber es verzichtet durchaus auf Perspektive und Raumdarstellung, was den geübten Zeichner sogleich verraten würde. Er hat schon seine ersten Arbeiten als »pompöse Gemälde« von Millionenwert gepriesen. Kurzum, er ging an die Malerei im Vollgefühl, daß er, der große Dichter, auch ein ganz anderer Maler sei, wenn er sich nur die Mühe nähme, das, was in ihm lebte, in Bildwerke umzusetzen.
Und nun stehen wir vor der höchst überraschenden Wendung: dieser süßliche Frauenschwärmer, lebemännische Kellner und derb-originelle Studentenwirt fühlt sich berufen zum Heiligenmaler! Der genaue Zeitpunkt für diese Wandlung ist nicht aufzufinden. In seinem Benehmen hat man auffallende Veränderungen nicht bemerkt. Wir können daher nur nachträgliche Äußerungen Moogs aus dem Jahre 1920 beibringen zur Erklärung der Tatsache, daß er, mit Ausnahme des eben erwähnten Stückes, nur Heiligenbilder feierlichster Art gemalt hat. Er behauptet, er habe vor zwei Jahren ein Gelübde getan, nicht zu rauchen, nicht zu trinken und wie ein Mönch zu leben. In der Tat stammen seine Bilder wahrscheinlich alle aus dieser Zeit. Wir müssen die Erörterung der seelischen Zusammenhänge an den Schluß stellen, da wir bei der Betrachtung der Bilder einige wichtige Aufklärungen erhalten werden.
Von den abgebildeten Werken sind das »Abendmahl«, »Das jüngste Gericht« und die »Zerstörung Jerusalems« früher, nämlich von 1918, die drei übrigen von 1920. Am klarsten im Aufbau und am verständlichsten in den Motiven ist das Abendmahl (Abb. 113). Auf dem Altartisch in der Mitte thront die riesige Madonna, den Kruzifixus samt Kreuz quer auf dem Schoß haltend. Vor dem Altar der kleine, christusähnliche Priester mit Bart und Heiligenschein, mit dem Kelch in der Hand. Vorn knieen Gläubige. So türmt sich streng in der Mittelachse ein Motiv auf das andere, jedes möglichst vollständig flächenhaft ausgebreitet, so daß Überschneidungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Die Leuchter zu beiden Seiten des Altars stehen in der Luft. Ihre dekorative Aufgabe im Bildganzen ist wichtiger, als die Sorge um eine reale Stütze für sie. Links unten der große Engel mit dem Schwert hält Wache, daß sich kein Unwürdiger herandrängt. »Am linken Rand in der Mitte ist die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten dargestellt, Joseph und Jesus tragen Rucksäcke«. Gegenüber rechts: »der Abschied nehmende Tobias wird von seinem Vater gesegnet. Tobias trägt einen Ranzen, auf dem er einen Stiefel festgeschnallt hat. Daneben steht der ihn begleitende Engel.« Die im Segnen noch demütige Gebärde des Vaters gehört zum Feinsten, was Moog gelungen ist. Oben sind einander gegenübergestellt der gute Hirte und der Pelikan, der seine Jungen mit seinem Blut säugt. Diese anscheinend ganz originelle, von namhaften katholischen Mystikern rückhaltlos bewunderte Gegenüberstellung, und der nicht minder originelle Aufbau der Pelikangruppe sind inhaltlich die merkwürdigsten Bildteile. Während nämlich die Wanderung nach Ägypten und die fast ebenso geläufige Wanderung des Tobias eine solche Parallelisierung nahelegen und tatsächlich öfters gemeinsam vorkommen, gilt der gute Hirte in der Tradition meist als krönende Einzelgruppe, oder aber er ist einer anderen Erscheinungsform Christi zugeordnet, angeblich jedoch nie dem Pelikan. Wenn diese tief sinnvolle Kombination wirklich Moogs Eigentum ist, so muß man darin einen echt schöpferischen Zug anerkennen. Denn diese Wahl ist nicht nur sinnvoll, sondern fast geistreich und zeigt einen hohen Grad von Freiheit im Schalten mit kirchlichen Symbolen an: der gute Hirte, der sich jedem Lamm völlig widmet – und der Pelikan, der die Seinen mit Herzblut säugt.
Der Aufbau der Pelikangruppe aber zeugt wieder von jener traumhaften Sicherheit, mit der Ungeübte, Unverdorbene, Lösungen großen Stils zu finden vermögen. Mittelachse und Diagonalen des Rechtecks tragen allein die Körper- und Flügelachsen. Die obere Hälfte gehört dem Muttertier mit herabgebogenem Kopf und hochgeschlagenen Flügeln. Von unten strecken die drei Jungen ihre langen, spitzen, rüsselartigen Schnäbel mit gieriger Bedächtigkeit nach der Brust. Die glüht in roten Tupfen wie ein Rosenbeet aus der stahlblauen Umgebung heraus. Alles ist knitterig, unsicher, ohne bestimmte Formvorstellung gezeichnet. Und dennoch dieses Mystisch-Erhabene in der Gesamtwirkung, etwas, das man in alten lateinischen Hymnen am ehesten wiederzufinden vermeint. Moog behauptete einmal, die Pelikanidee habe er, solange er denken könne; sie werde wohl auf ein Symbol in seiner Heimatkirche zurückgehen – aber, er wisse doch nichts davon, daß dort eine derartige Darstellung vorhanden sei – vielleicht gehe sie auch auf eine Vision zurück. Sie meine zugleich die Dreieinigkeit. – »Alle Ideen wurzeln ja in der Kindheit.« Die Kirche seiner Heimat ist neu, daher in den Kunstdenkmälern nicht verzeichnet, direkte Nachricht war nicht zu erhalten, da sie jetzt belgisch ist.
Im übrigen fesselt das Gewand der Madonna die Aufmerksamkeit noch besonders. Es setzt sich zusammen aus lauter schmalen, sehr bunten Streifen, die in loser Anlehnung an Körperformen geführt, aber jeder ganz für sich mit eigenem Ornamentmuster geschmückt werden. Und aus dieser spielerischen Buntheit, in der niemand ein Gesetz wird finden können, erhebt sich das Ganze zu fast monumentaler Wirkung. Die Gesamtordnung folgt, rein formal gesehen, am meisten Teppichprinzipien. Das ganze Blatt ist völlig übersponnen mit Formteilen. Jeder leere Raum, den die Hauptszenen nicht bedecken, wird mit geometrischen Mustern ausgefüllt, die sich jedoch vielfach zu stereometrischen Körpern zusammenschließen, besonders Türmchen von allen Ausmaßen darstellend, oder kristallinische Formen. Da kehrt nun auf einmal die Liebhaberei des Knaben wieder, der beim Viehhüten solche Körper schnitzte. – So löst sich die ganze Fremdartigkeit, die dem Blatt auf den ersten Blick eigen ist, in lauter verständliche und sogar sehr verständige Einzelheiten auf. Und die Teppichbuntheit belebt sich, wenn man die Teile kennt, zu einem zwar vielfältig verschlungenen, aber doch keineswegs sinnlosen, ja in vieler Hinsicht durchaus als Geformtes ansprechenden – Bildwerk oder Kunstwerk? Von diesem Problem später.
Zu dem »Jüngsten Gericht« (Abb. 114) hat Moog ausführliche Erklärungen gegeben, die hier im Auszug wiedergegeben werden sollen: »In der Mitte über dem Kruzifix kommt Christus mit der Wage vom Himmel herunter, in großer Macht und Herrlichkeit, umgeben von Engeln mit Posaunen und Racheengeln mit Schwertern. Darüber Gott Vater in den Wolken, wie er Gericht hält; er hat das große Schuldbuch der Menschen aufgeschlagen und ist auch von Engeln umgeben. Auf dem ganzen Mittelstück des Bildes stürzen Sterne und Feuerregen vom Himmel – ebenso auch die Sonne oder Jupiter und der Mond oder Venus (die großen Köpfe rechts und links von Christus in Brusthöhe). Unter den 7 Racheengeln sitzt David auf dem Balkon seines Hauses im Kreise seiner Getreuen und nimmt am jüngsten Gericht teil. Um das Kruzifix herum ist das Fegefeuer gemeint und die Seligen, die in den Himmel eingehen werden. Diese steigen z. T. erst eben aus den Gräbern und sind daher noch nicht gereinigt. Einige sammeln das Blut aus den Wunden Christi. Unten sieht man züngelnde Flammen. Die in ganzer Figur Sichtbaren schreiten schon aus dem Fegefeuer heraus; darunter drei Gelehrte, zwei Patriarchen mit Palmen und Krone, einige alte Jungfern, die sich ihr Leben lang geplagt haben. Links am Rande der Hölle geht es die Leiter hinauf in den Himmel. Zu Füßen des Weltenrichters zwängt sich ein Mensch durch, der eben noch an der Hölle vorbeigekommen ist – das soll der Rechtsanwalt Cohn aus X. sein.

Fall 16. Abb. 113. Altar mit Priester und Madonna (Aquarell). 20x28.
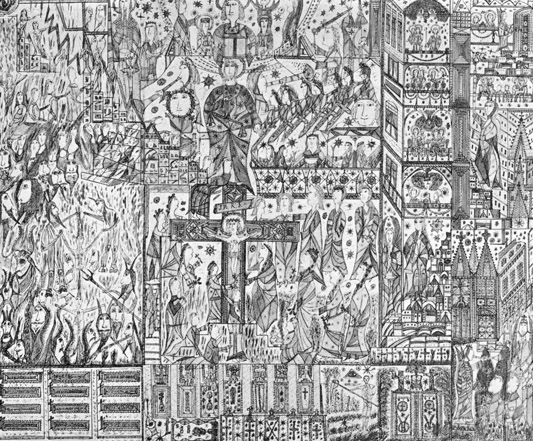
Fall 16. Abb. 114. Jüngstes Gericht (Tinte und Aquarell). 45x36.
Die linke Seite stellt die Hölle dar. In der Mitte rutschen die Verdammten auf einem langen Rasiermesser herunter. (Nach der Schreckenskammer in Castans Panoptikum!) Satan, Luzifer und alle Großen der Hölle sind versammelt, dazu das ganze Teufelsgewürm, wie es in der Hauspostille abgebildet war. (Aus seinem 8. Jahr sei ihm dies haftengeblieben.) Über den Teufeln verdammte Weiber, die Unzucht getrieben haben, in ihrer verführerischen Schlechtigkeit, dekolletiert. Oben ganz nackte Leute, die schon verdammt sind und daher ihre Kleider nicht mehr zu holen brauchen. Andere Verdammte hoffen vergebens hinter Gittern und in Verliesen auf Erlösung. Die rechte Seite stellt den Himmel dar. Ganz unten zwei Heilige mit zwei Engeln. Darüber die Peterskirche in Rom, durch welche die Seligsprechung erfolgt. Links neben der Kirche das himmlische Jerusalem, wie es sich allmählich in die Himmelsburgen erweitert und verschönt. Darüber vier himmlische Balkone. Rechts davon klettert eine Heilige hinauf, zieht einen Glockenzug, um zu den oberen Regionen des Himmels zu gelangen.
Unten die Reihe verschiedenartiger Gräber bedeutet vielerlei. Links 12 dunkle Gräber der Verdammten. Daneben Gräber seliger Auferstandener, mit schönen Grabsteinen geschmückt und einem Weihrauchfaß dabei. (Weiterhin eine hübsche biedermeierische Gruppe: Tod, mit Hippe, Sternen, dem Auge Gottes, wie er unverhofft kommt und auf uns niedersaust, und weiter das Familiengrab für die Eltern seiner Jugendfreundin.) Die fünf kleinen glashellen Denkmäler darüber bezeichnen die Grabstätten von kleinen Geisteskindern, die gestorben sind. Man sagt gewöhnlich, wenn ein Mensch Onanie treibt, tötet er einen Engel. Gemeint sind also die Gräber der kleinen Kinderseelen, die auf diese Weise gestorben sind. Darunter ist auch der 7 Monate alt gewordene Sohn Emil.« – Wiederum ist das Resultat der eingehenden Bildbetrachtung an der Hand eigener Erläuterungen des Autors, daß er vorwiegend recht verständige Einfälle illustriert. Die einzelnen Szenen werden nun zwar etwas spielerisch aneinandergesetzt, wie man als Kind ausgeschnittene Bildchen zusammenkleben würde. Und immer wieder als Füllstücke geometrische und kristallinische Formen. Die einzige Absurdität stellen die kleinen Grabmäler der durch Onanie getöteten Kinderseelen dar, und diese ist, richtig genommen, nicht unwitzig.

Fall 16. Abb. 115. Georgsritter-Kampf und Madonna (Ausschnitt). Tinte und Aquarell. 50x18.
Von der »Zerstörung Jerusalems« gibt Abb. 115 nur den oberen Teil, der zwei Fünftel des sehr komplizierten Bildes ausmacht und allein gut übersehbar ist. Diese Szene sollte zuerst darstellen: »Elias entführt auf feurigem Wagen seine Braut Aphrodite aus den Trümmern Jerusalems.« Von diesem Plane kam Moog jedoch aus verschiedenen Gründen ab. Er als Kirchenmaler dürfe keine nackten Gestalten malen und Aphrodite könne man doch nicht anders als unbekleidet wiedergeben. Schließlich kam er darauf, Elias lieber die Madonna entführen zu lassen, denn »die Madonna ist die Beschützerin der christlichen Kunst, und wenn ich diese hineinbringe, erhalte ich die meiste Kraft zur Schaffung des Bildes.«
Moogs ausführliche Erläuterung dieses Bildteiles ist so kennzeichnend für seine Art, daß sie vollständig zitiert werden soll: »Der Kopf mit dem Drachen ist eine Dichtung von Schiller oder Goethe – ich weiß es nicht so genau – und es muß eine gewisse Assoziation bestehen zwischen der Dichtung als Weissagung und der Ausführung meines Bildes. Der Kampf mit dem Drachen ist eine Tragödie – an und für sich ist diese das Höchste, was es gibt – auch bei den Ärzten gibt es Tragödien – und wenn diese überwunden sind, erreicht man die Erkenntnis. Dieses wollte ich durch die Tötung des Drachen darstellen. Vorn auf dem Wagen sitzt der Prophet Elias; die rechte Hand hat er an der Bremse, mit der er den Wagen sofort aufhalten kann. Mit dem rechten Fuß kann er auch bremsen. Die Bremsen sind meine Konstruktion. Der ganze Wagen ruht auf Spiralfedern, die auf den Achsen angebracht sind. Dies ist auch meine eigene Konstruktion. Der Wagen bewegt sich so in seiner Federung, daß man ihn herumkippen kann, wodurch der Schellenbaum läutet. – Hinten auf dem Wagen sitzt der Prophet Habakuk, die Kreuzesfahne in der Hand. Er ist der Schutzheilige des ganzen Gefährts. In der Mitte sitzt die Madonna mit dem Jesusknaben, in der Hand hält sie ein Schriftstück, die Bestätigung der Weissagung von der Zerstörung Jerusalems. Die Madonna habe ich auf Reisen dargestellt, deshalb Koffer und Schachteln und alles mögliche (über der Madonna). Auch der Anstrich des Wagens ist der einer Postkutsche. Vor dem Wagen sieben Georgsritter auf Pferden, die z. T. mit dem Drachen kämpfen und ihn töten. Die zwei hintersten Ritter haben keine Lanzen; hier sind auch die Pferde fester bespannt, an der Deichsel. Diese können den Wagen allein retten, selbst wenn die anderen fünf Pferde zugrunde gehen. Am zweitletzten Pferd eine Karabinertasche, sonst Zaumzeug, Sattelzeug, alles luxuriös, sonntäglich. Die zwei hintersten Ritter haben nur zu fahren, die fünf vordersten kämpfen mit dem Drachen. Sie haben Lanzen mit besonderem Schutzschild. Wenn sie den Drachen verwunden, kann ihnen das Blut nicht ins Gesicht spritzen. Dann hemmt das Schutzschild aber auch den Stoß, daß er nicht zu tief eindringt. Dies Schutzschild ist meine eigene Konstruktion. Der eine Ritter dirigiert sein Pferd durch Schenkeldruck. Dieses beißt den Drachen, tritt ihn tot. Außerdem ist es in Paradestellung, wodurch es dem Ritter den Stoß erleichtert. Unter und zwischen den Pferden ist der Drache mit vielen Köpfen, Schwänzen und Beinen. Mit einem Bein hat er sich in die Erde verankert. Oben auf dem Bilde ist der feurige Widerschein in den Wolken von dem brennenden Jerusalem. An einer Stelle sieht man soeben noch die aufgehende Morgensonne, an anderer Stelle den Abendstern. Dies soll versinnbildlichen, daß der Kampf von morgens bis abends dauerte.«
Bewies die genaue Betrachtung der ersten Bilder, wieviel Verständiges in dem Manne lebendig ist, so wird in dieser Erläuterung zu dem Georgsritterkampf ein ganz andersartiger Gegensatz klar. Wie plump und kindlich und falsch das Detail, besonders der Pferde, auch ausgefallen ist, niemand wird sich besinnen, dem ganzen Bildausschnitt einen Zug ins Grandiose zuzusprechen. Und demgegenüber ist alles, was Moog zur Erklärung beibringt, nicht nur gleichgültig oder durch das Spielen mit Nebensachen lästig, sondern man muß es schon als objektiv schwachsinnig bezeichnen. Daran können auch die wenigen originellen Einfälle – daß der Drache sich mit dem Schwanz in den Boden verankert, daß die Ritter an ihren Lanzen Schutzschilde gegen das spritzende giftige Drachenblut tragen – nichts ändern. Es bleibt die überraschende Tatsache, daß aus einem ungeübten Geisteskranken, der voll von törichten und schwachsinnigen Spielereien steckt, doch etliche originelle und dabei sinnvolle Formgedanken hervorbrechen und auch gestaltet werden. Zwar schalten seine Einfälle so frei und willkürlich mit gewohnten Vorstellungen, wie wir es sonst nur in ganz phantastischem Kunstschaffen, zumal in Grotesken kennen. Wir vermögen zur Not statt des hl. Georg eine ganze Rotte von Georgsrittern im Kampf mit dem vielköpfigen Drachen hinzunehmen, da die Gruppe als solche uns interessiert. Auch den kaleidoskopartig bunten Wagen mit den Propheten und der Madonna lassen wir uns vielleicht gutwillig gefallen. Aber die Vereinigung beider Gruppen zu einer Szene bleibt als Einfall sinnlos, als Gestaltung klaffend. Wir weigern uns, anders ausgedrückt, die Bildeinheit, die uns hier zugemutet wird, zu vollziehen, da wir uns weder von der formalen noch von der stofflichen Seite dazu aufgefordert finden, sondern lediglich von der Willkür des Bildners. Und die haben wir als wenig überzeugend kennen gelernt.
Die Anbetung (Abb. 116) ist ein ganz einfaches Blatt, das sich stofflich schlicht an die Konvention hält. Dadurch ist die Bildeinheit von vornherein gesichert. Auf eine genauere Besprechung des in ganz hellen Farben gehaltenen Bildes können wir verzichten. Nur auf einen hübschen Einfall muß hingewiesen werden. Die Strahlenfiguren, aus hellen, buntfarbigen Punkten und Strichen, die den Rand links und oben beherrschen, aber auch an den Menschen und zwischen ihnen reichlich angebracht sind, leitet Moog von Schneekristallen ab – ist doch die winterliche Weihnacht gemeint. Daß diese Strahlensterne mit rotem Zentralpunkt am Halsansatz der Menschen prangen, könnte manche Erwägung in okkultistischer Richtung wachrufen, da von jener Seite solchen Ausstrahlungen, zumal aus der Halsgrube, tiefe Bedeutung beigemessen wird.
Die zwei letzten großen Bilder Moogs zeigen ihn erfolgreich bemüht, eine Hauptszene beherrschend in den Mittelpunkt zu stellen. Die »Kreuzabnahme« (Abb. 117) zeichnet sich durch die übersichtliche Komposition des Ganzen und besonders der zwei Hauptteile aus. Man ist versucht, an ganz bewußte Anwendung raumschaffender Mittel zu glauben. Die schräg gestellten Leitern täuschen fast einen Kuppelraum vor. Die großzügige Anordnung der Pietà darunter mit den leuchtenden gelben und blauen Kreisen paßt zwar nicht recht in die vorwiegend auf rot-grün abgestimmte Gesamtfarbe, ordnet sich aber wenigstens im Format der selbständigen oberen Hälfte völlig unter. Die Grabkammer mit den zwei Hütern links und der Garten rechts sind leicht verständlich. Man wird nicht leugnen, daß dies Stück etwas von echter, feierlicher Größe hat. Komposition und Farbe vereinigen sich zu solcher Wirkung.

Fall 16. Abb. 116. Madonna (Tinte und Aquarell). 21x32.
Auf der »Bergpredigt« (Abb. 118) ist »Christus kurz vor Antritt seines Leidensweges dargestellt. Hinter ihm steigt Jerusalem auf. Vier Sonnenblumen wenden sich ihm zu und empfangen ihr Licht von ihm. Ich wählte sie als Königin der Blumen, natürlich symbolisch gemeint. Daneben sieht man Königskerzen, die, wie Sie jedenfalls wissen, mit der Medizin eng verknüpft sind. Und dann habe ich ringsum Rosen aufgebaut. Zwei Engel halten die Krone. – Rechts und links sieht man Zuhörer. Rechts vorn ist die Zeit der Schwangerschaft dargestellt; ganz vorn eine Dorfälteste, zum Schützen berufen, dann eine alte Jungfrau oder auch Bergfrau, vertraut mit Kräutern – eine Kräuterbabe, wie man bei uns sagt. – Alle Dargestellten sind Heilige aus jener Zeit. Ich darf als Heiligenmaler nur die Heiliggesprochenen suchen, nichts Gegenwärtiges. Hinter diesen Figuren die schützende Garde – eine Art römischer Liga – dahinter wieder die Altväter, ebenfalls schützend, und auch als Gatten der Frauen gedacht. Es sind Patriarchen oder Patrizier – das hat was Verwandtes. Rechts vorn junge römische Garden zwischen 20 und 30 Jahren. Für diese Köpfe ist mir manches haften geblieben von Studenten in X. Links oben fünf Privatdozenten zwischen 30 und 40. Die Glocke lädt zur Andacht ein, von Petrus geläutet. Daneben habe ich mich selbst porträtiert, auch am Strang ziehend. Über mir ist ein Seraph d. h. ein wachhaltender Engel.« – Auch zu den kleinen Szenen, die am oberen und unteren Rande angebracht sind, hat Moog ausführliche, aus hübschen Einfällen und grotesken Absurditäten gemischte Erläuterungen bereit. Hier sei davon nur angeführt, was auf seine seelische Grundhaltung ein so überraschendes Schlaglicht warf. Nachdem er nämlich schon zu der Schafherde links oben mit dem Lamm Gottes darunter von den verschiedenen Rassen und Geschlechtern mit Betonung gesprochen und es »ein Fach für sich« genannt hatte, die Widder zu erkennen, verbreitete er sich über Stier, Ochse, Kuh in der rechten oberen Ecke und blieb dann an dem Einhorn haften, das ihm das Zölibat bedeute, wie es auch für Apotheker, Männer der Wissenschaft und solche, die Geheimnisse erkennen wollen, von großem Wert sei.
Mit einigem Widerstreben gab Moog an dieser Stelle schließlich als offenbartes Wissen, von dem außer ihm kaum jemand etwas ahne, eine Art Theorie der geschlechtlichen Differenzierung zum besten, für die der Widder von Bedeutung sein soll: er habe nämlich einmal »in einer Vision ein Wesen gesehen, halb Mensch, halb Tier, zwischen Wissenschaft, Künsten und Menschen vermittelnd, etwas wie ein Zentrum, harmonisch nach allen Seiten, korrespondierend; auch die Physiognomie war Mensch und Tier zugleich«. Diese Erscheinung also gilt irgendwie als ideeller Mittel- und Richtpunkt seines Systems von den »drei Rassen in jedem Geschlecht«, das in anderem Zusammenhange noch erörtert werden soll. Hier nur so viel: unter den Männern gibt es außer der mannbaren, zeugungsfähigen, zur Ehe berufenen Rasse, eine zweite, die zwar körperlich gleich gebaut und veranlagt ist, aber ihre Kräfte im Beruf vergeuden muß (»die Leidenschaft erfüllt sich dann im Geistigen, in Reinheit im Beruf«) – das sind die Zwitter(!). Und drittens die Theologen – die sind rein geboren und sollen nicht fallen, sind auch körperlich anders gebaut. Unter den Frauen gibt es 1) Ehefähige, 2) Zwitter, die gebaut sind wie Männer und als Nonnen oder Lehrerinnen im Zölibat dem Dienst der hohen Sache obliegen sollen, 3) solche mit noch anderem Bau, vor allem die Haushälterinnen der geistlichen Herren, sie tragen wie diese einen Hoden als Heiligtum in sich. Daß nicht nur eine vage Erotik, sondern die platte körperliche Geschlechtlichkeit in Moog sehr rege ist, ging schon aus mehreren Zitaten hervor. Auf einem anderen Bilde gibt es eine Szene, die er so beschreibt: »Die Vanitas hat ein geistiges Lasterkind geboren und weiß damit nicht aus noch ein. Die Walküre, eine hoch weise Frau und Schützerin, hält die Hand über das Kind, um die Vanitas, eine Geisteskranke, zu heilen. Darunter Gesichter, die von Lastern durchseucht und verzerrt sind; sie stellen die vererbten geschlechtlichen Erkrankungen dar und zeigen die verschiedenen Charaktere des Lasters. Ferner angedeutete Gebrechen des Körpers, z. B. geschwollene Drüsen, Mandeln usw. Mitten darin das Bild des versöhnenden Messias.«

Fall 16. Abb. 118. »Bergpredigt« (Tinte und Aquarell). 58x30.

Fall 16. Abb. 117. Kreuzabnahme und Pieta (Aquarell). 40x45.
In der Tat erhält man nach diesen Stellen im Gespräch mit Moog noch stärker den Eindruck, er lebe in dauerndem Kampfe mit seiner Sexualität. Daß er seine Berufung zum Heiligenmaler so krampfhaft betont, entspringt offenbar einem Bedürfnis, seine Sündhaftigkeit wettzumachen, indem er verstiegenen Idealen zustrebt. Dazu paßt, daß er eigens ein Gelübde tat, keusch wie ein Mönch zu leben, Alkohol und Tabak zu meiden. Durch solchen Lebenswandel glaubt er die Urkraft wiedergewonnen zu haben und wieder wie mit 18 Jahren zu sein. Dem Beichtvater und der Kirche verdankt er, daß er jetzt im dritten Jahre so rein lebt. »Nun brauche ich von alter Kraft, was ich im früheren Leben erübrigt habe, daraus schaffe ich die heiligen Bilder. Die religiöse Kunst wird angeboren und hängt ab vom sittlichen Lebenswandel, nicht etwa vom Lernen. Das erzeugt nur Dilettanten. Der Herrgott hat mir einfach gesagt: Kerl, ein Fehltritt und du kriegst nichts mehr. – Damit ist mir mein Weg vorgezeichnet.«
Diese plump-direkten Formulierungen für das alte, rätselhafte Kräftespiel zwischen Inspiration, Berufung, Verwendung der eigenen Kraft (eindeutig als Sublimierung sexueller Libido oder gar noch derber der Sexualprodukte gefaßt) scheinen uns über den Fall Moog hinaus von Belang zu sein. Angedeutet finden wir derartige Vorstellungen häufig bei Gesunden und Kranken, aber selten in solcher Plattheit, bei so pathetischer Haltung, wie er sie als Heiligenmaler zur Schau trägt. Die Alternative Sexualität = Sünde und Reinheit = Kraftüberschuß kehrt bei Moog noch in zahlreichen Spielarten wieder, ja »standesgemäße Ernährung« und Brotzulagen werden dann gemeinsam mit göttlicher Berufung auf der Seite des Kraftüberschusses gebucht. In dem Bestreben, sich der Reinheit und Kraft zu versichern, geht er so weit, daß er seine Ehe wegzuleugnen sucht. Er sei zweimal verheiratet gewesen, aber »nur morganatisch, in künstlicher Ehe. Seit dem Tode der Frau lebe ich isoliert und dies Abgesperrtsein beweist, daß ich nur in der Seelenwanderung verheiratet war.« Aus der Seelenwanderung kennt er auch Ozeanien, den 6. Erdteil – »manchmal kommt doch etwas zustande, was nie existiert hat; ein Berufsphotograph z. B. kann aus einem Wasser tropfen, einem Blutstropfen, aus dem Äther alles Mögliche herausnehmen, was nicht materiell, sondern nur immateriell besteht. So wird auch manches vielleicht nie materiell bestanden haben, was wir jetzt kennen.« – Der Sinn solcher Betrachtungen, die wiederum typisch sind, ist doch offenbar etwa: »Was ›wirklich‹ ist, und was nicht, weiß ich nicht; was mir am wirklichsten schien, nannte man Trugwahrnehmung; was mich noch in der Erinnerung leiden macht, soll ich als erlebte Wirklichkeit weiter mit mir schleppen. Kann meine Erinnerung nicht ebensogut Trug sein, wie meine Halluzinationen –?«
Über sein Verfahren beim Zeichnen und Malen berichtet Moog folgendes: Den Hauptplan hat er ungefähr im Kopf, wenn er anfängt. Mit Bleistift gibt er zuerst die Köpfe und äußeren Umrisse und etwa noch die Faltenwürfe an – nun erst bedenkt er, was diese Gruppen wohl bedeuten könnten und legt ein Motiv unter, das gelegentlich wieder vertauscht werden kann. Für die großen Stücke hat er etwa zwei Monate gebraucht. Vorlagen hat er nie benutzt. Aber »aus einem Bodenmosaik, aus der gesprenkelten Wand finde ich hunderte von Gesichtern – Gott kommt mit seinem Zufall den Menschen zu Hilfe. Das sind Geschenke für die, die ihm dienen durch die Kunst.« – »In der Hand fühle ich oft vibrierend die Kraft, so daß oft sogleich etwas mit Tinte gelingt; aber meist muß ich erst mit Blei vorzeichnen.« Ursprünglich waren alle seine Bilder angeblich für den Kreuzgang des Kölner Doms bestimmt. Auch für den Festsaal der Anstalt plante er Bilder. – Er gibt alle Bilder ohne weiteres her. »Mit dem Augenblick, wo ich Geld verlangen wollte, ist meine Berufung dahin; das wäre Simonie. Wenn ich die Sachen abgegeben habe, sind sie bezahlt. Das alles dient zur Tilgung meiner Schuld – ich habe ja damals ein Hotel gekauft und muß einen Teil der Kaufsumme noch abtragen.« Die »Schuld« ist also wieder in doppeltem Sinne genommen, einmal als Sündenschuld Gott gegenüber und dann als Geldschuld den Menschen gegenüber.
August Neter, geboren 1868, ist der Sohn eines schwäbischen Sparkassiers, der schon 1871 an Pocken starb. Die Mutter wurde über 80 Jahre und war gesund. Nerven- und Geisteskrankheiten in der Familie sind nicht vorgekommen. Neter ist der jüngste von 9 Geschwistern. Er war als Kind aufgeweckt und lernte auch, nachdem er 7 Jahre eine Realschule besucht hatte, als Mechaniker gut. Er diente zwischendurch als Einjähriger, wurde aber nicht befördert – aus Mangel an Interesse, wie er meint. Seine Unternehmungslust trieb ihn als Elektromonteur weit in der Welt umher: nach der Schweiz, Frankreich und sogar Amerika. Nachdem er noch in verschiedenen großen deutschen Städten als Mechaniker gearbeitet hatte, gründete er 1897 ein eigenes Geschäft in einer Universitätsstadt, das 10 Jahre lang leidlich ging. Aus den Wanderjahren ist nur bekannt, daß er eine Lues durchgemacht hat und mit Schmierkuren behandelt worden ist. Später heiratete er. Die Ehe blieb kinderlos. Soweit es die spärlichen Nachrichten über die Persönlichkeit zulassen, können wir uns etwa dies Bild von Neter machen: Er war ein gut veranlagter, strebsamer Mensch, mit einem Zug ins Abenteuerliche. Dem entspricht, daß er zwar zeitweise energisch seinen Plänen nachging, aber eigenwillig auf seinem Kopf bestand, und daher gleichgültig wurde, wenn eine Tätigkeit seinen Neigungen nicht entgegenkam. Eine gewisse Gewandtheit, die nicht gerade weltmännisch ist, aber doch den Weitgereisten in ihm vermuten ließe, ist in seinen ersten Briefen erkennbar. Ferner eine höchst temperamentvolle pathetische Ausdrucksweise von großer Anschaulichkeit. Soweit dürfen wir wohl in den ziemlich geordneten Briefen der ersten Krankheitszeit eine Spiegelung des ursprünglichen Charakters sehen. Leider fehlt jede Möglichkeit, über die sexuellen Schwierigkeiten, die konstitutionell zu sein scheinen, einige Klarheit zu gewinnen. Für eine gewisse Derbheit seiner Bedürfnisse spricht alles. Und dabei nimmt er eine schwächliche, feiner organisierte Frau, an der er mit Verehrung hängt, und zu deren Schonung er gewohnheitsmäßig Dirnen aufsucht.
Im Jahre 1907 ließ seine Arbeitslust nach; er »konnte nichts mehr anregen, hatte seine Gedanken nicht mehr bei der Arbeit«. Angeblich trug er sich die Zeit vorher mit verschiedenen Erfindungen und Patenten, die ihm schlaflose Nächte verursachten, so daß er glaubte, sich überanstrengt zu haben. Schon im Frühjahr suchte er deswegen ärztlichen Rat. Im Verlauf des Sommers verschlimmerte sich der Zustand. Er war deprimiert, machte sich hypochondrische Gedanken und äußerte sich über das bevorstehende Weltgericht in ängstlich-erregter Weise. Nachdem er versucht hatte, sich die Pulsader zu öffnen, wurde er einer Anstalt überliefert, wo sich alsbald zeigte, daß er in der akuten Phase eines schizophrenen Prozesses stark expansiver Färbung mit zahllosen Wahnvorstellungen und einem großen halluzinatorischen Primärerlebnis stand.
Im Mittelpunkt der ganzen Krankheit bleibt dauernd dieses halluzinatorische Erlebnis, das Neter zu verschiedenen Zeiten immer wieder geschildert hat, und zwar jedesmal in gleicher Weise, so daß man dem wohl Glauben schenken darf. – Es war in einer Residenzstadt an einer Kaserne, Montag mittag um 12 Uhr, da trat am Himmel eine »Erscheinung« auf: »Zunächst sah ich in den Wolken einen weißen Fleck in nächster Nähe – die Wolken blieben alle stehen – dann entfernte sich der weiße Fleck und stand während der ganzen Zeit wie ein Brett am Himmel. Auf diesem Brett, oder dieser Leinwand oder Bühne, folgten einander nun blitzschnell die Bilder, wohl 10 000 in der halben Stunde, so daß ich nur mit äußerster Anstrengung die wichtigsten auffassen konnte. Der Herrgott selbst erschien, die Hexe, welche die Welt erschuf – dazwischen weltliche Szenen: Kriegsbilder, Erdteile, Denkmäler, Schlachtenbilder aus den Befreiungskriegen, Schlösser, wunderbare Schlösser, einfach die Herrlichkeiten der Welt – aber dies alles in überirdischen Bildern. Sie waren wenigstens zwanzig Meter groß, deutlich zu sehen, fast farblos, wie Photographien, manche auch etwas farbig. Es waren lebende Figuren, die sich bewegt haben. Zuerst meinte man, daß sie eigentlich kein Leben hätten, dann wurden sie mit einer Verklärung durchdrungen, es wurde ihnen die Verklärung eingehaucht. Es war schließlich wie in einem Kino. Die Bedeutung wurde sogleich klar beim Anschauen, wenn auch das Einzelne erst viel später beim Zeichnen bewußt wurde. Das Ganze war sehr aufregend und unheimlich. Die Bilder sind Offenbarungen des Weltgerichts gewesen. Christus konnte die Erlösung nicht vollenden, weil ihn die Juden vorzeitig gekreuzigt haben. Christus sagte am Ölberg, daß er unter den dort erschienenen Bildern gezittert habe. Das hier sind also Bilder, wie die, von denen Christus gesprochen hat. Sie werden mir zur Vollendung der Erlösung von Gott offenbart.«
Auf den Inhalt der Erscheinungen werden wir später eingehen, wenn wir Neters Bildwerke zu besprechen haben. Hier ist seine Psychose und die Entwicklung des paranoischen Wahnsystems zu verfolgen, das sich in diesem Falle besonders durchsichtig aufbaut. Bei der Aufnahme war Neter völlig orientiert und zeigte gute Kenntnisse. Mit dem Rechnen stand es schwach, die Merkfähigkeit war sehr gering (wohl Aufmerksamkeitsstörung). Im Vordergrund standen seine wortreichen und hartnäckig vorgebrachten Klagen über körperliche Sensationen. Nach dem Krankenblatt gab er an: »es sei ihm, als fege ein Kehrbesen in seiner Brust und in seinem Bauche herum; seine Haut sei zu einem Fell geworden; seine Knochen und Kehle versteinert; im Bauche habe er einen Baumstamm; sein Blut bestehe aus Wasser, aus seiner Nase kommen Tiere herunter. Er sieht den Teufel in Gestalt einer Feuersäule Tänze vor ihm aufführen; legt er die Hand auf den Tisch, so ist es, als ob er mit den Knochen das Holz berühre; in der Zeitung kommen Gedichte über ihn; er ist der Antichrist, der echte; er müsse ewig leben, er könne nicht sterben; er habe kein Herz mehr, seine Seele sei herausgerissen. Starkes Knarren in den Kniegelenken erklärt er als Telephonieren, wodurch dem Teufel stets sein Aufenthalt nach unten berichtet wird. Er behauptet nie zu schlafen; Stuhlgang habe er – seit er hier sei – noch nie gehabt. Er ist meist in gedrückter Stimmung, weil er viel über sein Schicksal infolge einer Todsünde nachdenke.« Es würde zu weit führen, die drastischen Briefe, die er aus Zerknirschung und Wut über diese »Todsünde« an die beteiligte Dirne und den Bürgermeister jener Stadt geschrieben hat, zu zitieren, obwohl die groteske fast pantagruelisch derbe aber anschauliche Ausdrucksweise, die er für seine tollen Wahnerlebnisse findet, ungewöhnlich fesselnd ist.
Der Verlauf der Krankheit brachte in dem äußeren Benehmen Neters wenig Abwechslung. Wohl schwankte die Stimmung in Phasen von einigen Monaten. Bald standen die depressiven und hypochondrischen Vorstellungen im Vordergrunde, er war unfähig zu arbeiten, gereizt gegen Arzte und Personal – bald wieder drängten sich die expansiven Seiten mehr vor: Größenwahn in verschiedener Richtung (er ist Fürst, König, Kaiser, Christus) Unternehmungsgeist, Neigung zu arbeiten, kleine Erfindungen zu machen. Durch alle Phasen hindurch aber entwickelt sich und systematisiert sich immer mehr das Wahngebäude, das nunmehr noch in seinen Hauptzügen zu skizzieren ist. Es ruht erstens auf der Entdeckung seiner wahren Familiengeschichte: er weist mit der formal bestehenden Pseudologik, die den Paranoischen eigen ist, umständlich nach, daß seine Großmutter ein uneheliches Kind Napoleons I. und der Isabella von Parma gewesen sei. Als Gräfin Wolgschaft in einem Stift aufgewachsen, habe sie noch später Beziehungen zum Hofe des Landes gepflogen. Möglicherweise liegt dem zugrunde, daß sie als Näherin etwa tatsächlich solche »Beziehungen« gehabt hatte. Allerlei Kindheitserinnerungen klären sich ihm, wenn er sie im Lichte dieser Entdeckung sieht. Er richtet seine Herrschaft im eigenen Lande auf, unabhängig von Frankreich und Deutschland und nennt es »Marquise Wolgschaft«. Sich selbst unterschreibt er meist »Août IV-Napoleon«, indem er seinen Vornamen mit dem gleichlautenden Monatsnamen vertauscht und übersetzt. Er macht Anspruch auf verschiedene Throne und erläßt Sendschreiben an Regierungen und Fürsten, besonders während des Krieges, der vorwiegend zu seiner Befreiung aus schmählicher Internierung geführt wird. Stets laufen dabei ausgezeichnete Einfälle mit unter, die sich über Politik oder kulturhistorische Wertmaßstäbe oft in witzigen Glossen ergehen.
Während er so sein Reich auf Erden ausbaut, spielen auch seine himmlischen Beziehungen weiter, wenn sie auch zeitweise etwas zurücktreten. Immerhin drängt es ihn von Zeit zu Zeit, eine gewisse Verbrüderung zwischen beiden Bezirken herzustellen, sei es mit Gott selbst, sei es mit einem anonymen Weltenlauf. Dafür findet er jenes grandiose Bild, das uns in anderer Form bei Strindberg begegnet und vor allem das Drama des Grauens aus seiner Spätzeit »Damaskus« trägt: die rückwärts gehende Weltuhr. Die Untertanen sollen nur »Vertrauen auf die künftige Weltregierung setzen (– nämlich seine –), da die Weltuhr im Ablaufen ist und rückwärts geht, indem die Zeiger derselben immer vorwärts gehen, um die Menschen über die Unordnung des Werkes im Inneren hinwegzutäuschen, das nur ein Weltuniversitätsmechaniker verstehen kann«. An einer anderen Stelle heißt es: »auch zeigte mir Gott das Bild Napoleons, Christus und anderer, was Ich teilweise auch nachgezeichnet habe, und die steinernen Gesetzestafeln der Zukunft und der Vergangenheit, so daß mit Sicherheit anzunehmen ist, daß Napoleon I. eine Erscheinung ähnlich wie Christus in der Welt war, als Kriegsgott, und Ich dessen auserwählter Sohn und Erlöser von Welt zu Welt, von Wolgschaft zu Wolgschaft v. Folgschaft.« – Auch nach erotischer Seite baut er phantastische Beziehungen aus und verquickt seine Wahngestalten mit der nächsten Umgebung. Eine ganze Reihe von Gemahlinnen tritt im Laufe der Zeit in Erscheinung und er gewöhnt sich daran, in allen Frauen, die er sieht, einschließlich der Ordensschwestern, verkleidete Gemahlinnen zu erkennen, die er nun mit ausgesuchter Ehrfurcht behandelt und zugleich mit erotischen Phantasien umspielt.
Unter seinen Schreibereien, die durchweg mit sauberer, pedantischer, wie gestochener Handschrift sorgfältig abgefaßt sind, finden sich einige burleske Gedichte mit manchen witzigen Wendungen unter albernen Klangassoziationen. Zu der wiedergegebenen Probe erläutert er: »Das von mir reparierte Klavier der I. B.-Abteilung war von Schaben stark zerfressen und soviel Staub darin, daß es sich lohnte denselben zum Andenken aufzuheben, was Mich veranlaßte, ihn der Anstaltsmutter als Kaiserliches Lehen zu vermachen.
Diese Schachtel mit Verlaub
Ist gefüllt mit »Musikstaub«
Seiner höchsten Majestät
Hurrah – prima Qualität
»Nahrungsmittelmehlersatz«
Ist gerad am rechten Platz
Für das beste Auszugsmehl
Schlägt »Piano« gar nicht fehl
Putzt man es nach Jahren aus
Zieht man einen Nutzen draus
Was die Schaben nicht gefressen
Dient der Mutter jetzt zum Essen
Wird sie von dem Mehl nicht dick
Machts vielleicht doch die Musik
Ist sie brauchbar reparirt
Wird bezahlt und dann probiert.
S. M. Août I.«
Kurz zusammengefaßt ist von der Persönlichkeit Neters, sowie sie uns heute, nach 13 Jahren der Krankheit entgegentritt, etwa dies zu sagen: Das erste, was einem an dem kräftigen, etwas untersetzten Mann auffällt, sind seine raschen, sicheren Bewegungen, sein bestimmtes, selbstbewußtes Auftreten. Dem entspricht der gerade, lebhafte, etwas flackernd-glänzende Blick seiner hellen Augen. Er ist sehr höflich und zugänglich in der Unterhaltung, spricht schnell, mit energischem Nachdruck, als wolle er von vornherein jedem Widerspruch begegnen und drückt sich gewandt und präzis aus. Und doch fühlt man vom ersten Augenblick ab, daß er einen nur mit Vorbehalt gelten läßt und nicht bereit ist, wechselseitigen Kontakt zu suchen, sondern einen willigen Hörer, den er vielleicht besser von seinem Wissen, seinem Lebensgefühl und seiner Mission überzeugen könnte als seine dauernde Umgebung. Er spricht daher nur mit etwas äußerlicher Geschäftigkeit von seinen tatsächlich guten technischen Erfindungen, ungern von seinen Zeichnungen, solange man nach nüchternen Tatsachen fragt. Dagegen bricht er ungestüm los, sobald man seine Wahnvorstellungen berührt.
Wir finden also auch heute noch den gewandten, gutmütigen, aber eigensinnigen Techniker, als der er früher geschildert wurde. Temperamentvoll, affektbetont (eher cholerisch), dabei zäh in der Verfolgung seiner Ziele, die nun einerseits praktischer Art sind: allerlei kleine Erfindungen und Leistungen im Anstaltsbetrieb; andererseits aber völlig ideeller Art: höchste Steigerung des Selbstgefühls. Im Dienste dieses Grundtriebes hat er alle Erlebnisse und alles Wissen, das ihm zugänglich ist, zu einem System aufgebaut, zu einer Welthierarchie, in der er selbst die höchste Spitze darstellt. Suchen wir psychologisch zu erfassen, welche Funktionen ihm fehlen, im Vergleich zur normalen Verhaltungsweise, so drängt sich gerade hier jene »Fonction du réel« auf, die in der französischen Psychologie und Psychiatrie eine so große Rolle spielt, und mit unserer »Wirklichkeitsanpassung« nur schlecht in Einklang zu bringen ist. So viel ist jedenfalls sicher, daß er die sonst verpflichtenden Einigungstendenzen zwischen Vorstellung (Phantasie) und diskutierbarer »Wirklichkeit« nicht besitzt. Die wirkliche Umwelt hat für ihn keinen Objektivitätscharakter, sondern liefert ihm nur Material, das er beliebig im Sinne seines Grunddranges verwertet. Er hat sich von der Umwelt weg ganz auf sich selbst gewendet, ist autistisch geworden. Daß er dabei die beiden Vorstellungssphären, die wahnhafte, in der er Fürst, Kaiserherzog von Frankreich, Welterlöser usw. ist, und die andere, auf einfacher Wahrnehmung beruhende, in der er Mechaniker, Patient und Bürger ist, ohne Konflikt nebeneinander erleben kann, ist wiederum schizophrener Grundzug. Nur liegt hier die Gewichtsverteilung anders als bei den übrigen Fällen: für ihn hat die wahnhafte Sphäre weitaus das Übergewicht und ist in systematischem Aufbau geordnet, während er sein bürgerliches Dasein gering achtet, aber von dem Wahnsystem konsequent freihält. Daher benimmt er sich in seiner praktischen Tätigkeit wie ein Normaler, hat sich auch keine verschrobenen Stereotypien angewöhnt. Viel geringer als bei den meisten anderen Fällen ist dementsprechend die allgemeine assoziative Lockerung. Allem, was er tut und denkt, ist eine gewisse Straffheit eigen, eine fast sachliche Konsequenz, im Praktischen wie im Wahnsystem.
Die Rolle der Erotik in diesem Leben zu erschließen, ist im Rahmen dieser beschreibenden Darstellung nicht möglich. Die uns bekannten Tatsachen sind spärlich und derb: Dirnenumgang als Gewohnheit in einer gefühlsmäßig eher hochstehenden Ehe; heftigste Reuereaktion auf eine leichte Perversionshandlung hin (allerdings erst in der Psychose). In neuerer Zeit zwangsmäßig stark sexuelle Auslegung aller Worte und Handlungen weiblicher Personen seiner Umgebung, auch der Ordensschwestern. Dabei werden diese jedoch in Zusammenhang mit dem Wahnsystem gebracht und als Gemahlinnen usw. angesehen, ohne daß er praktische Konsequenzen daraus zöge.
Die Bildwerke dieses Mannes, zu denen wir uns erst jetzt wenden, entsprechen in ihrer Faktur dem soeben umrissenen Persönlichkeitsbilde auf das vollkommenste. Durchweg nüchtern klare Sachlichkeit im Strich, nach Art einer technischen Zeichnung. Hier sollen Tatsachen exakt mitgeteilt werden, so scheint es. Die Erklärungen, die Neter nach langem vergeblichen Bemühen der Anstaltsärzte schließlich einer intelligenten Patientin gab, bestätigen das. Sie decken sich mit den von Anfang an häufig wiederholten Teilangaben, die er den Ärzten und in seinen Sendschreiben an verschiedenen Stellen gemacht hat. Denn es handelt sich durchweg um die Wiedergabe der Halluzination, die ihm unter jenen 10 000 Bildern in der halben Stunde seines großen schizophrenen Primärerlebnisses haften geblieben sind (vgl. oben S. 204).
Neter hat seit dem Jahre 1911 gezeichnet. Bei ihm sind nun ganz überzeugend zwei durchaus verschiedene Arten von Bildern zu unterscheiden. Die für uns wichtigsten gehen nach seinen Angaben alle auf jenes oben erwähnte halluzinatorische Erlebnis zurück, in dem er eine ungeheure Fülle der Gesichte deutlich draußen am Himmel in den Wolken wahrgenommen haben will. Außerdem aber hat er eine Anzahl von Bildern in Aquarell gemalt, die ganz nüchtern realistisch gemeint sind, mit größter Geduld und Pedanterie ins Kleine gehen und sich nur hierdurch von gewöhnlichen dilettantischen Versuchen unterscheiden. Ein Blumenstück nur ragt durch geschmackvolle Vereinheitlichung bei aller Buntfarbigkeit über das Niveau der anderen hinaus.
Wenn Neter nun von Anfang an versichert, er zeichne die halluzinatorischen Erscheinungen, die er etwa sechs Jahre zuvor gehabt habe, so müssen wir von vornherein einige Bedenken gegen die Zuverlässigkeit dieser Zeichnungen als sachlicher Dokumente erheben. Was stellt er, psychologisch betrachtet, wirklich dar, wenn er die sechs Jahre zuvor gesehenen Bilder auf Papier zu bringen vermeint? Es soll hier keineswegs der meist ungebührlich betonte Einwand gemacht werden, der Mann werde doch sehr viel von dem vergessen haben, was er damals erblickte. Wir finden immer, daß gerade Schizophrene für Erlebnisse, die ihnen bedeutsam waren, so nichtig sie auch allen anderen scheinen mögen, ein ganz außerordentlich gutes Gedächtnis haben. Viel wesentlicher ist aber bei paranoischen Kranken der umgekehrte Einwand: was mag sich im Verlaufe von Jahren alles an einen Erinnerungskomplex von so ungeheuerer affektiver Wucht, wie es das schizophrene Primärerlebnis ist, noch angegliedert haben? Zumal da wiederholt betont wurde, wie kurz die einzelnen Gestalten (»über 10 000 in einer halben Stunde«) sichtbar geworden seien. Und zweitens: was mag ein Schizophrener mit seinem Drange, jeden Augenblickseinfall in irgendeine Verbindung mit seinen Hauptvorstellungen zu bringen, an spielerisch hingeworfenem assoziativen Material in eine solche Darstellung mit hineinverarbeiten? Da wir keine Instanz kennen, vor der solche Fragen gültig gelöst werden können, so müssen wir uns auf Vorsichtsmaßregeln beschränken. Wir werden also vor allem die Schilderungen, die Neter vor der Anfertigung der Bilder in Worten gegeben hat, als sicherste Grundlage annehmen. Und werden ferner nur diejenigen Äußerungen, die er zu verschiedenen Zeiten fast gleichlautend tut, als beweisend für die Echtheit seiner Visionen gelten lassen. Diese Vorsicht ist hier um so mehr geboten, als zwei der gleich zu besprechenden Zeichnungen, soweit wir ermitteln konnten, die einzigen bisher bekannten sind, in denen erstens der Urheber Halluzinationen direkt abzubilden behauptet, die er auch in Worten genau beschreibt, und die zweitens völlig eigenartige, phantastische Kombinationen von abbildenden Formelementen zu starker Wirkung gestalten.
Wir erinnern uns, daß die Visionen am Himmel, wie auf einem Brett, oder einer Leinwand, oder auf einer Bühne erschienen. »Es wurde immer wieder ein Teil abgewaschen und was anderes aufgezeichnet, wie wenn ein schneller Zeichner ganz rasch zeichnen würde.« Als erste Gruppe nennt er die »Rockverwandlungen«, von denen vier auf Abb. 119 wiedergegeben sind. Bei diesen vor allem muß man annehmen, daß die sehr detaillierte Schilderung, die Neter im Jahre 1919 zu dieser Serie gab, eine große Menge Augenblickseinfälle enthielt, weshalb hier nur wenig daraus mitgeteilt werden soll. Der Rock entstand in mehreren Phasen. Zuerst in Form von Orgelpfeifen, dann als Musikinstrumente, als Gesetzestafeln, die wie Backsteine geschichtet lagen, als Fels und steinerne Kanzel. Das Mittelstück sah aus wie ein umgestürzter Korb: an ihm erschien ein Gesicht, die Götterdämmerung, die sich umwandelte in eine Teufelsmaske, in Moses, Christus, Napoleon I. und zuletzt in den Patienten selbst, und zwar als Kind. Unten am Rock bildete sich eine liegende 8, dann eine Schlange, schließlich eine Muschel wie ein Regenschirm. Ferner war in den Rockfalten ein N und ein A zu sehen, und andere wunderbare Schriften, darunter »Mann-Weib« von hinten nach vorn ganz gleichlautend zu lesen, und seine sämtlichen Titel.
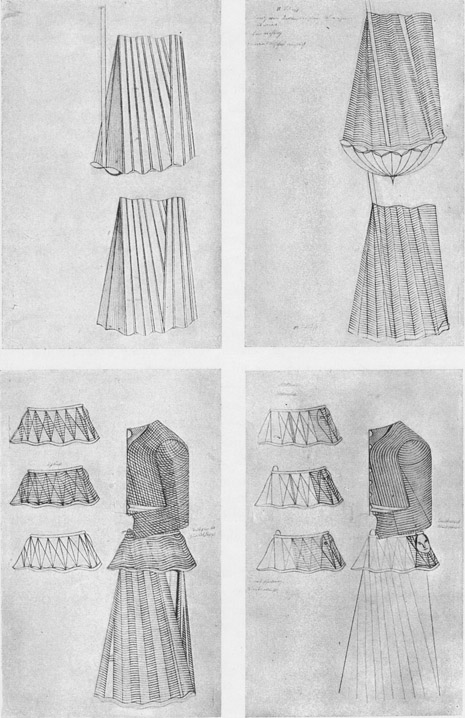
Fall 18. Abb. 119. »Rockverwandlungen« (Bleistift). 10x16.

Fall 18. Abb. 120. »Hexe mit Adler« (Bleistift). 20x25.
Das Schlußstück dieser Gruppe ist Abb. 120. Hierzu folgt einiges aus Neters Erläuterungen wörtlich: »Das Gesicht erschien mir als Totenkopf, hat aber doch Leben gehabt – – Die Nähte vom Schädel haben eine Nachthaube gebildet – An der Nachthaube kam dann ein Rüsche aus lauter Fragezeichen und diese wurden verwandelt in Federn – das Auge hat wie ein Glasauge ausgesehen, hat ganz gefunkelt; es war frei in der Augenhöhle. – Am Halse wurden auch verschiedene Veränderungen vorgenommen, und zwar wurde ein Ort damit versinnbildet, die Stellung über einen geheimnisvollen Ort. – Die ganze Figur ist eine Hexe: versinnbildlicht die Schöpfung der Welt als Hexenwerk. – Die beiden Tiere: Adler und Krokodil sind der Hexe ihre Boten – – Sie sind immer bereit und gefaßt auf den Wink der Hexe, immer sprungbereit. – Der Adler wurde in alle möglichen Gestalten verwandelt. Die Federn wurden abgeteilt durch Striche schwarz und weiß. Auf dem Adler waren alle möglichen Erscheinungen: zwei Schlösser, die verschlossenen Schlösser der Hölle jedenfalls – Dann ein Keller mit zwei Eingängen, die Pforten der Hölle – Einmal war darauf ein wunderschöner Kahn, dieser Kahn hat eine Feder als Segel gehabt; dann kam ein Sturm und der Kahn, das Schifflein wurde umgeworfen, es hat ihm aber nichts gemacht. – Den Kahn kann man vergleichen mit dem Schifflein, in dem die Jünger Jesu waren und gefischt haben, und Petrus zum Herrn gerufen – Auf dem Halse des Adlers hat sich ein Herz gebildet, – und der Adler ist mit dem Herzen in den Himmel geflogen. Das Herz war durchstochen, ein Zeichen, daß es leiden mußte – und ich war drinnen gesteckt! Auf dem Kahn war ein 4er: führen, ich soll führen, – Führerschiff der Welt.! Das ganze Bild der Hexe war eine Zeitlang wie von Gips – und dann erschien es in einem Glaskasten und war wie von Stein – und zuletzt wurde es eingefaßt und – – – – weg war es! Und dann kam Regen (Füllhorn oben rechts) wie aus einer Gießkanne und hat sich über das Krokodil ergossen – und dadurch hat das Krokodil die Schattierung bekommen.«
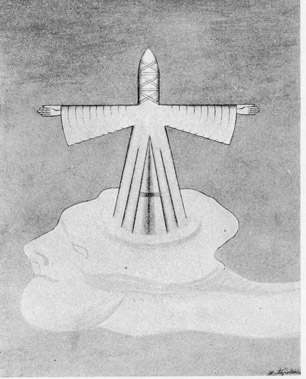
Fall 18. Abb. 121. »Antichrist« (Bleistift). 20x26.
Auch zu der Abb. 121, dem »Antichrist«, »Prophet«, »Kanonischen Papstrock«, »St. Thomas« oder dem »Geist Gottes in den Wolken« sind ausführliche Erläuterungen vorhanden. Es folgt eine von 1917, die er eigenhändig aufgeschrieben hat, nachdem er die Gestalt nochmals als Laubsägearbeit angefertigt und bemalt hatte:
»St. Thomas der Geist Gottes in der Gestalt des falschen Propheten verkündigte dem Erlöser auf einer Wolke stehend das über die sündige Menschheit verhängte Weltgericht im Anfang Nov. 1907. Ich habe diesem unbekannten Geiste den Namen Thomas, Geist des Unglaubens, beigelegt, weil seine Gestalt einem T gleicht, das aus drei (,) Kommas zusammengesetzt ist, den Kopf bildete etwa eine 42 cm Granate, die sich in eine päpstl. Tiara u. zuletzt in einen prachtvollen Strohhaufen verwandelte. Wenn das Kreuz groß am Himmel erschienen ist, werde ich alles an mich reißen. Dasselbe war etwa drei Meter hoch und wurde dadurch gebildet, daß der Geist aus den Hemdärmeln die nackten Arme wagrecht ausstreckte und durch rasches Wiegen derselben die Kreuzesform erzeugte. – Daß der Prophet falsch (zornig) war, erhellt daran, daß er das geweissagte Weltgericht (von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten) durch seine Erscheinung ankündigte, was für die ungläubige Menschheit einen falschen Profit bedeutete, dessen Folgen sie auch bald zu spüren bekam, als sie sich von der Wahrheit überzeugen mußte, nachdem sie den Erlöser aus Unglauben für geisteskrank erklärte, indem sie von den Erscheinungen der Offenbarung Gottes behauptete, das gebe es nicht u. den Erlöser Napoleon ins Narrenhaus verbrachte, damit er kuriert werden solle. Dieser Geist ist nun aber in seiner Wiedergabe von ungemeiner Bedeutung u. unbezahlbarem Werth, damit jeder Ungläubige durch ihn nicht verloren gehe oder ins Narrenhaus komme, weil er ihn gesehen u. doch nicht geglaubt hat. Wenn aber die Doctoren nicht geglaubt haben, sondern diese u. andere Erscheinungen in das Reich der Fabel gezogen haben, so werden sich dieselben an diesem hölzernen Geisterbild spiegeln können u. ihr Unwissen leuchten lassen, indem sie für die Aufklärung das Lehrgeld bezahlen, um ihre Wissenschaft durch Wort und Bild zu bereichern, dann erst sind sie gemachte Doctoren, die sich für ihr Geld sehen lassen können, (auf dem Potsdamer Ausstellungsplatz).
Als Ich Meinem Schwager u. Meinem Bruder von den Erscheinungen der Offenbarung Gottes, (wozu auch die hlg. Maria oder des Teufels Großmutter mit ihren Hausthieren, dem Adler »Phönix« u. dem Krokodil, welche von Mir ebenfalls im Bilde dargestellt) Mitteilung machte, wurde Ich kurzer Hand für verrückt erklärt und ins Narrenhaus zur Beobachtung Meines Geisteszustandes gebracht, welche denn auch etwas lang ausgedehnt wurde, während Ich überhaupt keine Beobachtung verlangte, indem Ich ja selbst am besten wußte, woran Ich war, namentlich da Mir Gott auch Mein Standesverhältnis als Kaiser von Frankreich und Deutschland geoffenbart hatte. Zum Schluß der Vorstellung gab Mir Gott die Weisung auf Meine Gedankenfrage: »König von Württemberg, geh' nicht von Württemberg.« Darauf bauend wollte Ich zu König »Wilhelm« zwecks Aufklärung, wovon jedoch Mein Bruder nichts wissen wollte und deshalb Meine Verbringung in eine Anstalt beschleunigte, was Mir zwar unangenehm war, aber trotzdem ein Trost, indem Ich Mir sagte, Gott wird Mein Schicksal nach seiner Offenbarung so lenken, daß Ich als dessen Sohn auch im Narrenhaus als König ausgehen kann, da seine Macht keine Grenzen kennt und die Spitzbuben auf den Fersen verfolgt, falls sie Mich Meines hohen Standes als Napoleon wegen nicht mehr herauslassen wollen. Die ganze Reihe von Meinen Gemahlinnen war Mir als lebende Figuren auch geoffenbart, sodaß Ich dieselben theilweise erkannte, sofern Ich deren Bild noch im Gedächtniss hatte, obwohl Ich nicht wußte, was diese Menge von Damen eigentlich für eine Rolle spielten, worüber Ich erst später klar wurde, namentlich da zuletzt auch Schwestern in Ordenstracht erschienen waren. Aber diese Frage dürfte sich dadurch gelöst und aufgeklärt haben, daß eben die Schwestern als versprochene Bräute des Heilandes den göttlichen Erlöser geheirathet haben, nachdem er persönlich unter ihnen erschienen war und konnten sie auch gar nichts besseres thun, um von ihm erlöst zu werden aus Noth, Bedrängniss, religiöser Nacht und Dummheit unter dem Joch der Knechtschaft.
Zur höheren Ehre Gottes und seiner lieben Mutter zu R. geschrieben und dargestellt von »S. Majestät« Août I. – IV. Napoleon.«
In diesem Falle nun zeigt eine zweite Schilderung von 1919, wie Neter offenbar seine Einfälle weiterspinnt: »Bei diesem Bild erschien zunächst ein Pfeifenkopf und zwar von einer Pfeife, die im Besitze meines Bruders ist und von Napoleon I. herstammt. Das Pfeifenröhrle stellt einen Wanderer dar mit einem Tornister. Der Wanderer sitzt auf einem Baumstumpf und trägt in seinem Tornister ein ganz kleines Fernrohr und – ein nacktes Weib. – Dann kam aus dem Pfeifenkopf Rauch heraus, d. h. wenn der kanonische Papst erscheint oder der Antichrist, dann raucht es. – – Und dann hat sich auf den Rauch, der wie Wolken aussah, eine menschliche Figur gestellt im Hemd. Die Figur hatte die Form eines Kreuzes. Aus den Rockfalten hat sich der Buchstabe A gebildet. Die Arme haben sich bewegt, statt dem Kopfe war eine Granate – und aus der Granate wurde die Tiara – und zuletzt ein Strohhaufen, d. h. daß die Granate losgehen kann wie Stroh: die Nichtigkeit der Welt!«
Für das Blatt »Weltachse und Hase«, Abb. 122, liegt eine Beschreibung von 1919 vor, die Neter 1920 in der Hauptsache wiederholt hat: »Da war eine Wolke heruntergezogen und die Weltachse stand da. Dann wurde ein Brett daraus – und aus diesem Brett ein Baum mit sieben Ästen: der siebenarmige Leuchter. An dem Baum wurden die Füße angesetzt: Bocksfüße und diese m Pferdefüße verwandelt – der Teufel –. Auf diesem Baume erschien mein Stammbaum. Der Baum wurde durch die Hände Gottes beschützt (das Bild aufrecht stellen – über dem Baum), das waren ganz zarte wunderschöne Damenhände. Die Ringe bilden die Jahresringe. – Nun hat der Baum nicht überall gefallen und die Schweine haben sich über den Baum gemacht – und haben sich über Gott gestellt – und haben Gott verachtet (über den zarten Händen zwei Eberköpfe). Das Ganze war wie ein lebendiges Tier, ein Nagetier! Nun bekam der Baum Blätter – und die Blätter wurden in Gold verwandelt. Dann kam der Sturm und hat die Blätter heruntergeschüttelt. Der Baum wurde gedreht im Sturm wie eine Walze. An Stelle des Baumes kam der Kopf des Jupiter, des Kriegsgottes.« Das ganze Bild habe auf den Weltkrieg hingedeutet, – er habe alles vorausgewußt, auch das Ende des Krieges. Überhaupt seien viele der Verwandlungen, die er gesehen, noch nicht in Erfüllung gegangen; das komme alles noch; dann werde er erst wissen, was alles bedeutet habe. – »Aus einer Wolke ist auf einmal ein Hase herausgesprungen und mit einem Satz war er auf der Walze.« Der Hase bedeutete »das zerbrechliche Glück. – Er hat auf der Walze angefangen zu laufen – und die Walze hat sich gedreht, d. h. daß sich die Sache um den Stammbaum dreht.« »Der Hase wurde dann in ein Zebra (oberer Teil gestreift) und dann in einen Esel (Eselskopf) aus Glas verwandelt. Dem Esel wurde eine Serviette umgehängt: er wurde rasiert. Während der ganzen Zeit dieser Erscheinungen war auf der Seite ein Kelch.« (sein Leidenskelch!) –.
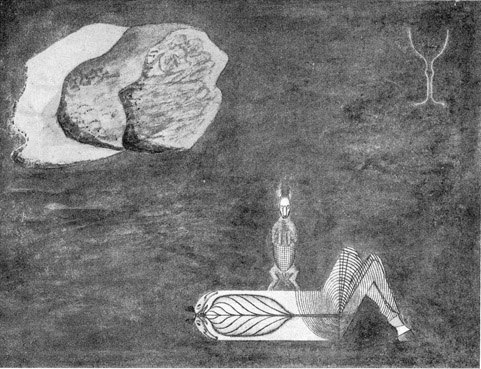
Fall 18. Abb. 122. »Weltachse und Hase« (Bleistift). 25x20.

Fall 18. Abb. 123. »Wunderhirte« (Bleistift). 20x26.
Den »Wunderhirten« (Abb. 123) ließ er zwar einmal von dem Kopf-Baumstamm aus entstehen, behielt aber sonst diese 1919 gegebene Beschreibung bei: »Da stand zunächst eine Brillenschlange in der Luft, grün und blau schillernd. Und daran kam der Fuß (der Schlange entlang). Dann kam der andere Fuß daran. Der wurde aus einer Rübe gebildet. (Auf Befragen:) Das Märchen von Rübezahl: Reue bezahl! – An diesem zweiten Fuße erschien das Gesicht von meinem Schwiegervater in W.: das Weltwunder. Die Stirn wurde in Falten gelegt – und daraus wurden die Jahreszeiten. Dann wurde ein Baum daraus. Die Rinde des Baumes wurde vorn abgebrochen, so daß die Lücke den Mund zu dem Gesicht gebildet hat. Die Haare haben die Äste vom Baum gebildet. Dann erschien zwischen Bein und Fuß ein weiblicher Geschlechtsteil, der bricht dem Manne den Fuß ab, d. h. die Sünde kommt durch das Weib und bringt den Mann zu Fall. – Der eine Fuß stemmt sich gegen den Himmel, das bedeutet den Sturz in die Hölle (– an diesem Fuße sind die Zehen Noten, warum, weiß er nicht –). Dann kam ein Jude, ein Hirte, der hat ein Schaffell um sich hängen gehabt. Auf diesem war Wolle, das waren lauter W, d. h. es kommen viele Weh. – Diese W wurden in Wölfe verwandelt; es waren reißende Wölfe. Und diese Wölfe wurden in Schafe verwandelt: das waren die Wölfe in den Schafskleidern. Und die Schafe sind dann um den Hirten herumgelaufen. Der Hirt bin ich – der gute Hirt – Gott!« (– Er sagt dies ganz feierlich. –) – »Die Wölfe sind die Deutschen, meine Gegner.« Diese Bilder waren alle nur für ihn allein; andere hätten sie zwar auch sehen können, aber »es wäre ihr Tod gewesen«. Gott hat durch diese Erscheinungen direkt zu ihm gesprochen. Vieles muß sich erst in der Zukunft erfüllen. –
Wegen der Einzigartigkeit dieser Blätter schien es notwendig, Neters Äußerungen ausführlich wiederzugeben. Denn hier ist nun wirklich einmal das Stoffliche weitaus wichtiger als das Formale. Um dieses vorauszunehmen: der nüchterne, präzise Strich, häufig in parallelen Kreisen (offenbar mit Zirkel) geführt und häufig mit dem Lineal gezogen, weist auf die technischen Zeichnungen des Elektrikers hin. So sehen Kraftlinien auf graphischen Darstellungen magnetischer oder elektrischer Felder aus. Diese Art des Striches entspricht seiner pedantisch sauberen deutlichen Schrift. Wir fanden ja derartige Züge auch in der pedantischen Konsequenz, mit der er sein Wahnsystem ausbaute. Während nun bei den »Rockverwandlungen« und der »Hexe« mehr oder weniger realistische Motive, die als solche Allgemeinbesitz sind, durch die Zeichenart stilistisch vereinheitlicht und obendrein sozusagen zum Überfluß noch mit symbolischer Bedeutung beladen werden, stehen die drei letzten Blätter ganz für sich. Denn sie stellen nicht erstens bekannte Gegenstände dar und sind zweitens Symbolträger, sondern sie sind von realistischem Standpunkt aus gesehen unsinnig und leiten ihre Daseinsberechtigung lediglich aus einem schizophrenen Erlebnis ab, nicht aus einer, auch anderen Personen zugänglichen »Wirklichkeit«. Als Gestaltungsphänomen besonderer Art muß der »Antichrist« Abb. 121 noch für sich betrachtet werden, weil er sich nicht in seiner Gesamtform vom Boden des allgemein Vertrauten entfernt, sondern seine überraschende, monumentale Wirkung einfach einer rücksichtslos kühnen Abstraktion verdankt. Sind doch diese Konturen mit dem Lineal gezogen. Fast noch stärker wirkt eine andere Fassung desselben Motivs, in der die vom Rücken ausgehenden Linien fehlen. Man kann darüber streiten, inwiefern nun das halluzinatorische Erlebnis für die grandiose Wirkung der Prophetengestalt verantwortlich gemacht werden dürfe, da man doch die nüchterne Methodik ihrer Entstehung klar demonstrieren könne. Wir stellen nur fest, daß niemand sich dieser besonderen Wirkung entziehen konnte und daß wir nahe Vergleichsstücke nicht kennen – es sei denn etwa der Natureindruck eines Kreuzes im Hochgebirge, das gegen den Himmel steht.
Für die beiden letzten eigenartigsten Bilder käme außer der halluzinatorischen nur eine spielerische Entstehung in Frage, wie bei dem Falle Klotz (S. 168). Aber ein Vergleich mit den Bildern jenes Falles lehrt sofort eindringlich, daß wir hier etwas anderes vor uns haben: der Charakter des Fremdartig-Unheimlichen, das uns unbegreiflich und faszinierend quält, fehlt dort fast ganz. Vergleichsstücke finden wir vielmehr vorwiegend bei dem Holzschnitzer. Irren wir nicht, so liegt das Charakteristische darin, daß hier aus Organteilen organismenartige Bildungen entstanden sind, die doch nirgends zentriert werden. Zwar wird der Scheinorganismus sauber zu Ende gezeichnet, allseitig geschlossen, – aber wieder mit jener pointenlosen Konsequenz, die den Nach-Denkenden in eine Art Irrgarten ohne Ende führt. Hier sich mit Behagen zu bewegen, ist das Vorrecht des Schizophrenen, weil er jeden Augenblick sein Denkprinzip umstellen kann; weil er über eine Doppelorientierung zu jedem Gegenstand verfügt. Bei keinem anderen Bildwerk vielleicht sind wir dem spezifisch schizophrenen Seelenleben so wehrlos ausgeliefert wie hier. Denn hier bietet sich nicht eine anschauliche Gestaltung dar, der wir uns einfach in ästhetischer Betrachtung hingeben könnten, ohne nach der Bedeutung zu fragen. Hier werden schizophrene Erlebnisse ganz nackt illustriert, und was etwa Zutat ist, wird in keiner Weise rationalen Vorstellungsmethoden angepaßt. Beide Hilfswege also, die uns sonst die Möglichkeit boten, uns in schizophrene Vorstellungskomplexe hineinzufinden, sind hier versperrt, der rationale wie der ästhetische. Jener brachte uns bis zu der Grenze, hinter der das Fremdartige begann. Dieser, der ästhetische, lieferte uns im anschaulichen Erlebnis ein Gestaltetes mitsamt der schizophrenen Komponente aus, und wir konnten dann im Erlebnis ausscheiden, was uns befremdete.
Johann Knüpfer wurde 1866 als der jüngste von vier Brüdern in einem Odenwalddorf geboren. Eine Vaterschwester soll religiösen Wahn gehabt haben, sonst weiß man nichts von Belastung in der Familie. Der Vater starb früh, nachdem er schon einige Zeit von der Mutter geschieden gelebt hatte. Knüpfer kam in der Schule als mittlerer Schüler leidlich mit, lernte nachher 2½ Jahre das Bäckerhandwerk und ging in die Fremde. Vom Militär kam er wegen Leistenbruchs frei. Von seinem 20. bis zum 30. Lebensjahre arbeitete er in einer großen Stadt anscheinend regelmäßig, wenn er auch die Fabrikgattung zweimal wechselte: nach einer Brotfabrik folgte eine Zementfabrik für 2½ Jahre und dann für 6½ Jahre eine Maschinenfabrik, in der er die Schlosserei erlernte.
Er lebte nach eigenen Angaben nebst einem Bruder bei der Mutter und scheint ein stiller, solider Mensch ohne besondere Neigungen gewesen zu sein, eher weltscheu, wenn seine eigenen Schilderungen zutreffen. Mit dem Tode der Mutter, 1895, änderte sich Knüpfers stetige, arbeitsame Lebensweise. Er heiratete, überredet von Bekannten, ganz gegen seinen Willen, wie er später meint. Leider liegen über diese Jahre der Veränderung keine ausführlichen Daten vor, außer einer weitschweifigen biographischen Schilderung aus der Zeit seines Anstaltsaufenthaltes. Objektiv steht fest, daß er seither sehr oft die Arbeitsstelle wechselte, häufig aussetzte und zeitweise reichlich trank, obwohl er wenig vertrug. Allerdings war die Ehe, wie beide Teile versicherten, von Anfang an schlecht. Er faßte schon früh gegen die Frau und andere Personen mißtrauische Gedanken, aus denen sich immer deutlicher ein ausgesprochener Verfolgungswahn entwickelte. Was darin an richtig beobachteten Tatsachen steckte, läßt sich nicht mehr entscheiden. Er wurde immer unsteter, arbeitete wenig mehr, blieb von zu Hause fort; wenn er kam, waren Prügelszenen an der Tagesordnung. 1902 trieb er sich nur noch herum, wurde siebenmal wegen Bettelns bestraft und schließlich in ganz verwahrlostem Zustand in die Anstalt eingeliefert, nachdem er sich »durch die schwere Schikane, durch die Marter« hatte hinreißen lassen, sich mit dem Taschenmesser in die Brust zu stechen. Aber »der Tod ist für sich, er hat nicht die Fahrt wie der Geist« äußerte er bald nach der Aufnahme.
Es zeigte sich, daß Knüpfer sich mit einer ganzen Reihe wahnhafter Vorstellungen seit Jahren trug und daß seine Stellung zur Umwelt ganz auf diesen basierte. Er glaubte sich von zahlreichen Personen verfolgt und hatte alle möglichen Wahrnehmungen gemacht, die ihm die Richtigkeit seines Verfolgungswahns bewiesen: auf einen Schnaps, den seine Frau ihm gab, wurde ihm völlig übel – es war eben Gift darin. Auch im Wasser hatte er deutlich Gift bemerkt. Aus dem Ofen blies man Rauch ins Zimmer, der war wie Chloroform. Er hörte, wie man sagte: man muß ihn morden, er ist zu reich. Man schoß mit feurigen Pfeilen nach ihm. So mußte er leiden, wie Christus, der Heiland. Der kam nun sehr oft zu ihm, so daß er ihn deutlich sah. Er sprach durch seine Poeten und durch Botschaften und Eingebungen. Er klärte ihm vieles auf, auch über seine Verfolger. Um diesen und den Quälereien zu entgehen, war er die letzte Zeit von Ort zu Ort gereist, – aber, wo er hinkam, da war das »Ding« auch schon.
Knüpfer brachte seine Erlebnisse zwar in starken Worten vor: gräßliche Quälereien, es war der Kelch des Leidens usw., aber ganz monoton, affektlos, in manierierter Sprechweise (mit Betonung der Auslaute und Endsilben), die oft etwas Feierliches annahm. Dabei gebrauchte er gern etwas geschraubte oder pastorale Wendungen. Das zeigt sich auch in seiner ausführlichen, 1903 selbstgeschriebenen Lebensgeschichte, aus der hier einige Proben folgen: »Euer unsserm allverehrten Landesfürsten Seiner Königlichen Hoheit Höchste Ordere Euer aller ergebenst bitte Euer Gnade und Würde Hochachtungsvoll mir beistand geben, ich war allezeit vor Jugend auf bis heute im alter von 37 Jahre 6 Mont. Euer Gnade und Würde für Fürsten und Vaterland, für Kaisser und Reich,, und alle hohe wirde, im Lande und der ganz auf der ganzen Erden, Euer Hoheit möchte bitten meinen Lebenslauf zu beschreiben, von Jugend auf bis ans Ende, bin in V. im 18 März 1866 geboren Amt W., und habe allezeit recht gehandelt gegen hohe und alle Leute zuvorkommen gewessen in aller achtung, und bin in die Volksschule gegangen bis zu 14 Jahren und dann bin ich in die Leher gekommen und habe die Bäckerei erlernt in Heilig+Gsteinach und bin Rechtschafen aufgezogen worden, habe nicht gestohlen und habe sonsst allerwege meiner lebentszeit recht gehandelt und der Vater ist früh gestorben – – Etwas hätten ich nicht geklaubt auf welche Sachen sollche Leute ausgehen das ist was altes bei diessen, aber die Gerechten, die haben sich schon früher daß ich Geheirath gewessen bin schon alles schön ein verzält, die Frau wo sie mir aufgebracht haben, diesse Gerechten schprechen die Wahrheit nicht, diesse sagten wir sagen zu unsserm HeuStorh und zu unssern Storh Heu, ja wenn so was alles gehet da weiß ich nicht was ich sprechen soll, Menschen von der Unschuld ins Unglück zu bringen. Ich J. habe alle zeit nichts schlimmes geschprochen wie heute noch. – – – aber meine Frau Wolte haben daß ich eingekerckert werde aber scheiten wolde sie sich nicht lassen sondern ihr Verbrechen mit mir ausführen, da haben sie die Leute im hausse schon gut unterrichtet wie sie es machen soll, aber Herr J. hatte sich geeussert er wolte mich kreuz und Überzwerg die Gelenderrie hinunter schmeissen und mich lebendig ihn seinem Keller begraben das haben aber damals die Leute in der Nachbarschaft gehört so laut geschrieben, Ich hätte mal das Gerücht hin nein führen wollen in sein Hinderhaus. – –«
In der Anstalt entfaltete sich nun der bislang noch verhüllte religiöse Größenwahn. Er teilt dem Arzt noch geheimnisvoll mit, er sei schon in der Jugend auserwählt worden. Niemand auf der Erde hätte lebend das erringen können, was er errungen habe, niemand habe auch so viel gelitten, nicht einmal Christus. Zwischendurch bittet er wieder, man solle doch das Martyrium nicht länger fortsetzen und ihn lieber gleich vollends umbringen. In der Folgezeit ändert sich das Krankheitsbild nicht mehr wesentlich. Knüpfer bleibt ein schwieriger Patient, der zwar gelegentlich auch zur Arbeit geht, aber meistens in seine Wahnwelt so eingesponnen ist, daß er auf jede Anforderung von außen gereizt reagiert. Bemerkenswert ist seine Liebe zu Tieren. Er beobachtet sehr aufmerksam, setzt aber alles mit seinem Wahn in Beziehung. Die Stimmen der Vögel behauptet er genau zu verstehen.
Das ganze Krankheitsbild ist typisch: es ist eine stille Schizophrenie, bei der sich keine akute Phase deutlich abgrenzen läßt. Dementsprechend fehlt auch den Erlebnissen des Patienten offenbar jener Charakter großartiger Visionen, die über einen hereinbrechen. Vielmehr ruht sein schizophrenes Weltbild auf zahllosen kleinen Wahnerlebnissen, Umdeutungen, die sich langsam zusammenschließen, ohne jedoch eigentlich systematisiert zu werden. Im Mittelpunkt steht der religiöse Vorstellungskreis. Seine Vorahnungen, seine halluzinatorischen Erscheinungen, seine Leiden, seine Reflexionen über sich und sein Verhältnis zur Welt – alles eint und klärt sich ihm in der beherrschenden Vorstellung, er habe als Berufener unendlich leiden müssen, werde aber dafür eine Rolle wie Christus in der Welt zu spielen haben. In solchen Erwägungen – mehr noch in den entsprechenden Gefühlskomplexen (besonders in der Richtung der Selbstwert- und Geltungsgefühle) erlöst Knüpfer sich aus der, auch für einen Schizophrenen keineswegs gleichgültigen Zwangslage des Anstaltsaufenthalts wie aus seinem gescheiterten Leben. – Knüpfer erscheint uns also seiner Anlage nach als ein stiller, etwas in sich gekehrter Mensch, temperamentschwach, ohne besondere Veranlagungen. Vielleicht muß man ihn zu den Sensitiven rechnen – dafür spricht, daß die Wendung zur Krankheit nach dem Tode der Mutter eintrat, wodurch er offenbar den Halt verlor. Dafür spricht auch die liebevolle Beschäftigung mit Familienerinnerungen, auf die wir sogleich stoßen werden.
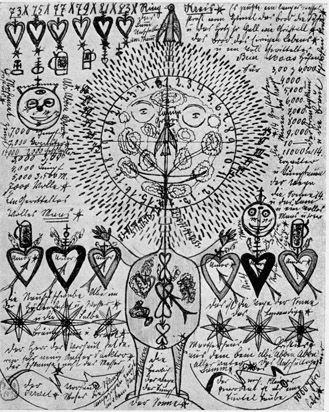
Fall 90. Abb. 124. »Lamm Gottes« (Tinte). 16x21.
Knüpfer begann schon bald nach seiner Aufnahme in die Anstalt zu zeichnen, wobei er sich in den Motiven eng an das hielt, was er mündlich und schriftlich unermüdlich äußerte. So könnte man bei ihm den Mitteilungsdrang als entscheidenden Impuls auch für sein Zeichnen auffassen, würde aber damit an das Wesen des zeichnerischen Aktes nicht herankommen. Wir betrachten einige der Blätter, die Knüpfer mit Tintenstift, Tinte und Farbstiften angefertigt hat. Abb. 124 gibt ein ganz typisches Beispiel. Und da bemerken wir sogleich, wie stark formale Prinzipien in ihm lebendig sind. Die recht strenge, symmetrische Anordnung verleiht dem Blatt eine gewisse feierliche Würde. Der große Kreis mit Strahlenkranz ist, wie aus anderen Blättern hervorgeht, als Monstranz gedacht, zu der das winzige Körperchen den Griff abgibt. Zugleich ist der Kreis aber ein Uhrblatt, die Sonne und das Gesicht des Männchens, das nach der Inschrift das Lamm Gottes, also Christus bedeutet, mit dem er selbst sich zu identifizieren pflegt, so daß wir bereits fünf oder sechs Bedeutungen dieses einen Formteils annehmen müssen. Von dem Gesicht sind Mund und Augen als solche erkennbar, an Stelle der Nase sitzt eine Art Wappenvogel. – Das Hauptherz mit dem Pfeil hat offenbar so suggestiv gewirkt, daß er von dieser Form nicht mehr loskommt. Aus dem einen Herzen werden drei Paar Herzen übereinander, dazu kommen je drei zu beiden Seiten des Körpers, mit absonderlichen Aufsätzen, und links oben noch ein halbes Dutzend: ein drastisches Beispiel für das »Perseverieren« einer Form, die nun auf der ganzen Zeichnung sich immer wieder vordrängt. Unter den Zahlen, die auf dem Blatt verteilt sind, scheint der ungeraden Reihe 73-83 eine geheimnisvolle Bedeutung innezuwohnen, da sie nicht weniger als fünfmal auftritt. – Auch die Beischriften sind vorwiegend orakelhaft: »Das ist die Vega der Sonne das Inwendige aus dem Bein, Abi Abbia Abba – Muhamet zeugt Christus –« oder die Benennung der Beine als Maria und Marta usw. – Wie hier Monstranz, Hampelmann, Sonne, Uhr und Christus in den einen »Ringkreis« verdichtet sind, so ist es auf dem anderen Blatte (Abb. 125) ein Baßhorn und eine menschliche Gestalt: der »große Bumperton am Sabath« heißt es.

Fall 90. Abb. 125. »Bumperton« (Tinte). 16x21.
Herrschen in diesen Blättern Knüpfers religiöse Wahnvorstellungen, wobei der pathetische Anteil in die formale Feierlichkeit eingegangen ist, der spielerische mehr in dem bunten Gewirr von orakelhaften Sätzen erscheint, so finden wir andererseits eine große Gruppe von Bildern, die aus einem ganz anderen Vorstellungskreis stammen: aus der Erinnerung an die heimatliche Umgebung seiner Jugendjahre. Wir erwähnten schon, daß Knüpfer ungewöhnlich eng an seine Mutter gebunden war und nach ihrem Tode einer gewissen inneren Haltlosigkeit verfiel. Mehr und mehr flüchtete er sich später, als sein eigenes Leben zerbrochen war, in Familienerinnerungen; seine schriftlichen Aufzeichnungen, zu denen er ständig geneigt ist, umkreisen in den letzten Jahren fast ausschließlich die Bauernhöfe seiner Verwandtschaft, in der sein Großvater mütterlicherseits als wohlhabender Besitzer eines größeren Hofes die Hauptrolle spielt. Diese Hauszeichnungen, die meist in großem Format mit Bleistift angelegt und mit Rot-, Blau und Grünstift derb »angestrichen« werden, enthalten eine Unmenge Detail, das immer sorgfältig gleich nebenan in Worten benannt oder gar beschrieben wird, so daß wiederum Text und Zeichnung sich fast die Wage hielten, wenn diese nicht durch die Farbe das Übergewicht bekäme. Der Text beschränkt sich aber keineswegs auf sachliche Erläuterungen, sondern ist ganz überwuchert von bombastischen Sprüchen: »Stapfeltreppenaufgang der Auferstandenen – 12 Geschlechter rote Treppensteine – der geheimnisvolle Hinterhof nach den Pferdeställen – der Herr ließ Feuer regnen grausam wie Sodom und Gomorra – die 3-5 Schäferhütte bei Großvater R., nun habe ich schon von der Herrlichkeit dem Sonnengott und der Sonnengöttin von 1866; 68; 69; u. s. f. –«
Der Gestaltungsvorgang liegt bei diesen Zeichnungen besonders übersichtlich zutage. Als seelischen Untergrund haben wir die Tendenz, sich Vertrautes aus der Jugend zu vergegenwärtigen. Diese Erinnerung ist feierlich-religiös gefärbt durch Wahnvorstellungen und verbrämt mit Bibelsprüchen. In der anschaulichen Sphäre erscheinen nun ausschließlich Teil Vorstellungen – Stall, Brunnen, Birnbaum, Hundehütte usw. – und zwar offenbar mit einer gewissen Lebendigkeit, aber nie ein einheitliches Gesamtbild. Dagegen wirkt die räumliche Anordnung er Gebäude nach, und zwar im topographischen Sinne. Er hat von den Höfen eine Art Lageplan im Gedächtnis, auf dem er im Geiste spazierengeht. Sein Zeichenblatt wird ihm alsbald zu einem solchen Lageplan. Und indem er seine Häuser und Ställe darauf anbringt, geht er auf diesem Zeichenblatte genau so umher, wie auf dem vorgestellten Lageplan. Nur daß er jetzt nicht sich wendet, um sich rings umzuschauen, sondern das Blatt. Nichts kann diese Deutung schlagender beweisen als die Reihen von schwer benennbarem Federvieh auf den Wegen der Abb. 126. Sie sind weder mit dem dahinterliegenden Bau in eins gesehen noch in einer Lage des Blattes darüber hin verteilt. Sondern sie entstanden wiederum, indem der Zeichner auf seinem Lageplan sozusagen spazieren ging, d. h. ihn drehte und dabei, ohne der Häuser zu gedenken, einen Vogel nach dem andern darstellte.
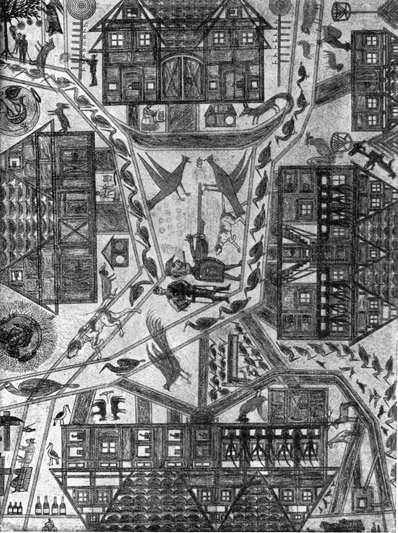
Fall 90. Abb. 126. Bauernhof (Blei- und Buntstift). 95x70.
Aber auch die vorher erwähnte Neigung zu formaler Strenge in der Flächenteilung kommt zu ihrem Recht. Wir wissen nicht, wie die Höfe in Wirklichkeit angeordnet waren. Daß er nicht ein Schema anwendet, sondern eine ganze Reihe von Grundrissen, spricht für eine gewisse Realitätstreue. Aber nun greifen die formalen Tendenzen ein. Wo es irgend geht, werden symmetrische Achsen aufgerichtet, sowohl für das ganze Blatt wie für die einzelnen Häuser. Daß bei allen Häusern beide Seitenflächen sichtbar sind, als wären sie nach vorn geklappt, muß man wohl ebensosehr auf dieses Bedürfnis nach symmetrischer Gleichheit der Hälften zurückführen, wie auf das Streben nach Vollständigkeit. In der Tat findet man auf Zeichnungen von Kindern und ungeübten Erwachsenen, die ja Häuser stets ähnlich wie Knüpfer machen, öfters nur eine Seitenfläche berücksichtigt, zumal, wenn sich an die andere etwa ein kleiner Anbau schließt. Übrigens ist das »ideoplastische« Streben nach Vollständigkeit durchaus einseitig konstruiert. Sonst müßte ja die Rückseite auch dargestellt werden. Viel wichtiger scheint uns zu sein, daß ein Dach seinem Wesen nach gegiebelt ist, weshalb der Giebel sich in der Vorstellung des Zeichners durchsetzt, auch wenn er ein Dach von der Breitseite her abbildet. Ob er nun einen oder zwei Giebel anbringt, darüber entscheiden dann wohl formale Tendenzen mit, wie das bei Knüpfer ganz deutlich wird. Der Gesamteindruck der Häuserbilder ist so, als ob die Gebäude nach außen umgeklappt wären, was der Darstellungsweise von Primitiven, frühen Kulturen, Kindern und ungeübten Erwachsenen entspricht. Im einzelnen ist durchweg die Tendenz zu abstrakten Formen charakteristisch. Sogar kreisrunde Fensterluken und Hundehaustüren, wie sie in bäurischen Gegenden gewiß kaum vorkommen, bringt er oft an. Kehrt ein Motiv in Reihen wieder (Fenster), so wird es pedantisch genau wiederholt. Sonne und Mond erscheinen häufig in den Bildecken. Noch häufiger aber Vögel von der Art wie auf Abb. 127.
Damit kommen wir zu der eigentlichen Leistung des Knüpfer, die uns veranlaßt, ihn an dieser Stelle ausführlich bekannt zu machen. Alles bisher Besprochene konnte unabhängig von der Persönlichkeit des Urhebers gezeigt werden, ohne daß wesentliche Züge verlorengegangen wären. Die Gestaltung des Vogelmotivs muß die Frage nach der Person des Zeichners wachrufen. – Auf dem großen Hofbild wimmelt es von Tieren, unter denen entenartige, allerdings langgeschnäbelte überwiegen (der gewandt umrissene Vorstehhund ist natürlich durchgepaust!). Diese Enten usw. sind einfach kindlich gezeichnet. Von ihnen unterscheiden sich in jeder Hinsicht alle jene Vögel, die ins Heraldische stilisiert sind. Der eine Typus, aufgerichtet, mit symmetrisch hängenden Flügeln, wie auf Abb. 124, scheint am ehesten von der Taube abgeleitet zu sein. Für den anderen (Abb. 127) ist es schwer, Vorbilder ausfindig zu machen. Aber es ist auch nicht wichtig. Denn die Bedeutung dieses Vogels mit den steil aufgerichteten schmalen Flügeln liegt rein auf Seiten des Gefühlstones, den er schon einzeln, vor allem aber in der seltsam faszinierenden Anordnung der Abb. 127 und 128 erweckt.

Fall 90. Abb. 127. Vögel (Bleistift). ca. 32x42.
Ein großer Wurf ist Knüpfer in dem Blatt mit den sieben schwebenden Vögeln gelungen, einem der wenigen ohne Schrift, und dem einzigen, das fast ohne befremdende Zutaten geblieben ist. Die Dolche und Gewehre beziehen sich offenbar auf einen Kugelzauber, dessen Beschwörungsformeln er öfters aufschreibt. Sie deuten damit an, daß wir hier mit zauberischen Mächten verkehren. Und in der Tat, auch bei ganz nüchterner Betrachtung gewinnen diese starren Schattenvögel Unheimlichkeitscharakter. Worin mag der liegen? Gewiß bewirkt die zwischen Ordnung und Willkür die Mitte haltende Verteilung der Tiere auf der Bildfläche schon eine leise Unruhe im Betrachter: der mittlere Vogel schwebt nicht in der Mitte, die äußeren sind zwar paarweise vereinigt, die beiden größeren Paare, die oben und unten stehen, sind nicht gleichgerichtet, sondern so, daß die beiden linken mit den Schwänzen zusammenstoßen, während die rechten so viel Platz lassen, daß ein kleineres Paar sich noch dazwischenschiebt. Das wären die wichtigsten nachrechenbaren Komponenten, die nun aber sicher nicht etwa dem Zeichner bewußt waren. Vielmehr hegt das fesselnde Problem eben darin, daß dieser Mann zu solchen ungelösten Spannungen in seiner Komposition gezwungen wurde und daß wir nicht umhin können, einen Widerschein seiner schizophrenen Seelenverfassung in einem solchen Bilde unmittelbar zu erleben.
Das große Bild mit weißen und schwarzen Vögeln (Abb. 128) vereinigt die Hauptmotive der Abb. 126 und 127 zu einem reich verschlungenen dekorativen Ganzen, in dem die starre Teilung durch kreuzförmige Streifen und der pedantische Gartenzaunrand bedenklich lahm wirken, während die Vögel selbst viel beweglicher und freier sind als auf den übrigen Bildern. Die schwarzen sind hier offenbar von Krähen abgeleitet. Unter den weißen finden sich überraschenderweise echte Harpyien, die dem Manne wohl kaum aus der griechischen Mythologie bekannt waren. So sehr der dekorative Eindruck des Bildes überwiegt, so müssen wir doch bedenken, daß dem Zeichner selbst wohl affektiv betonte Erinnerungen am Herzen gelegen haben. Höchstwahrscheinlich schwebte ihm ein heimatlicher Garten vor, Tauben und Krähen, die er als Knabe oft betrachtet haben mag, die guten Obstbäume, der Most, der alljährlich gepreßt wurde – darauf weist die Inschrift hin, die er auf den wenigen Äpfeln angebracht hat (die aber sicher repräsentativ gemeint sind für die ganze Obstmenge): Apfelmoststoff. Das ist zugleich eine charakteristische schizophren verschrobene Begriffsbildung, die aus mehreren verwandten Wortbildungen formal-analogisch zu erklären ist: Anzugstoff für Tuch wäre die nächst verwandte gebräuchliche Parallele, die das Gerüst geliefert haben könnte, oder genauer »Wollanzugstoff« für »Wolle«, womit schon wieder ein ähnlich verschrobenes Gebilde wie der Apfelmoststoff entstanden wäre. Man könnte das Wort auch einfach als Zusammenziehung eines Urteilssatzes in ein Wort auffassen: der Apfel dient als Stoff für den Apfelmost und läßt in der Wertschätzung des Mostes das Motiv für die zwecksetzende Umschreibung der Frucht vermuten. –

Fall 90. Abb. 128. Dekorative Zeichnung mit Vögeln (Kreide und Buntstift). 102x72.
Viktor Orth, geb. 1853 als Sproß einer altadeligen, angeblich gesunden Familie, entwickelte sich als Kind normal. Er war durchschnittlich begabt, aber von jeher sehr ehrgeizig, auch früh mißtrauisch, verschlossen und reizbar. Als Seekadett fiel er einmal von der Raa auf das Deck, und als Seeoffizier erhielt er im türkisch-russischen Krieg einen Kolbenschlag auf den Kopf, sonst soll er gesund gewesen sein. Er war meist auf einem Schulschiff, mit dem er auch nach Westindien fuhr. Zeitweise trank er stark und lebte unregelmäßig. Schon 1878 war er von Verfolgungswahn geplagt, besonders gegen seine Angehörigen. Zwei Jahre später entfloh er vom Schiff, brachte sich in der Eisenbahn einen Schuß in die Seite bei und wurde, als geisteskrank pensioniert, in eine Anstalt verbracht. Kurze Zeit versuchte die Familie ihn nochmal aufzunehmen, seit 1883 war er jedoch dauernd interniert bis zu seinem Tode 1919.
Seine Verfolgungsangst nahm vorwiegend den Charakter der Vergiftungsfurcht an und ging mit schweren Erregungszuständen einher. Schnell fixierte sich auch die Wahnvorstellung, als Persönlichkeit verändert zu sein. Er leugnete schließlich seine Familie ab und hielt sich seither für einen Fürstensohn, Herzog von Luxemburg, König von Polen, was sich auch in stolz-herablassendem Benehmen gegen seine Umgebung kundgab. 1883 war er bereits stark verschroben, affektiv nicht mehr ansprechbar, im Verhältnis zur Umwelt völlig autistisch. Er halluzinierte reichlich, sprach mit Papst und Kaiser, teilte Befehle aus, und murmelte manchmal: »ich bin der König von Sachsen, Kommandeur sämtlicher europäischer Truppen; ich bin Piast; das ganze Geschlecht ist verflucht – ich bin kein Freimaurer, sum – sum – sum – sum – eli – eli – eli – Enoch – Amen. Er glaubte, man setze ihm Menschenfleisch vor, donnerte die »Hammerschläge für die Ewigkeit« gegen die Tür, nennt den Direktor »Mon Prince«, den zweiten Arzt »Prinz Piast« und wollte von ihnen geduzt sein, während er dem Assistenzarzt grob die Tür wies. Erregungszustände waren häufig. Vom Malen ist noch keine Rede.
Um 1900 ist er der Typus des verblödeten Endzustandes: teilnahmslos, stumpf, unsauber, voller Verschrobenheiten. Er kleidet sich selbst an und aus und zieht seine Uhr auf – zu allen anderen Verrichtungen, sogar zum Essen muß das Personal ihn mühsam anhalten. Auf manche Fragen antwortet er noch sinngemäß mit leiser Stimme, er selbst stellt öfters völlig absurde Fragen mit größter Höflichkeit. In diesem Stadium nun beginnt er zu malen, und zwar mit ungehemmtem Eifer. Keine leere Fläche ist vor ihm sicher. Tiere, Landschaften, vor allem Seestücke, entstehen mit großer Geschwindigkeit auf Papier, Holz und Mauern. Wenn es an Farben fehlt, so zerquetscht er grüne Blätter und benutzt den Saft. Oder er zeichnet mit Ziegelstein auf die Gartenmauer. Seine Erklärungen dieser Bildwerke sind so närrisch, wie alles, was er äußert. Ein Vogel z. B. bedeutet: dankbar kanns wieder werden, – eine Landschaft: »drei Drachenberge für den Magen« oder »die 7 Rumänierlose«. Ähnlich erläutert er seine Sammlung von Gebrauchsgegenständen: ein Stück Pappe ist ein Katharinenpanzer für Kriegsschiffe, ein Zweig ist Artillerie, zwei Figuren sind Alpensteiger, die nach Italien gehen und dort sterben. Ein Ziegelstein, mit dem er zeichnet, ist »von einem Planeten gefallen, der größer ist, als die Erde. Der heißt Amor und nicht Becker von Sardinien« usw. Er hat Schmerzen im »holländischen Goldammernerven«. – So bleibt er nun bis zu seinem Ende. Ein kindischer, gutmütiger, zerfahrener alter Mann, der meist auf dem Boden herumliegt, keine verständliche Antwort mehr gibt, mit Knöpfen und Steinchen spielt und keinen andern Wunsch kennt, als alles bemalen zu dürfen.
Orth hat vier Arten von Bildwerken produziert: Seestücke, Figuren, »katatonische Zeichnungen«, »Geister«, von denen einige Proben besprochen werden sollen. Die Seestücke entspringen am verständlichsten seinem Erinnerungsschatz. Ein ehrwürdiger Dreimaster, wohl als Bild seines Schulschiffes gemeint, kehrt in immer wechselnder Umgebung wieder. Bald nur als eine Art Piktogramm in dürftigen Umrißlinien, bald mit gelb-braunen geschwellten Segeln auf einem Aquarell, das fast nach der realistischen Talmieleganz eines W. Stöwer hinneigt, Wasser und Himmelsraum trennt, kurzum sich der Normalskizze nähert. Häufiger aber sind die Erinnerungsbilder nur Rohmaterial für das Flächenbild, das nach eigenen Gesetzen aufgebaut wird. Da wird auf Abb. 129 die Fläche in mehrere schräg gegeneinandergesetzt blaue, rote und graue Teilstücke zerbrochen, die miteinander den Farbenklang eines milden Sonnenuntergangs auf See geben – und mitten drin, etwas verdrückt, verbogen, schemenhaft, sitzt der Dreimaster. Von einem »Können« darf wohl nicht die Rede sein – von einem Wollen? Manche Bemerkung des Krankenblattes könnte dafür sprechen. Aber mehr in dem Sinne, daß Orth sich in die Haltung des Künstlers äußerlich hineinsteigerte, etwa mit den Worten: »kolossales Können, kolossale Begabung.« Dennoch kann man einer Anzahl dieser Blätter einen gewissen Reiz nicht absprechen. Sie haben bei allem saloppen Unvermögen etwas natürlich Gewachsenes, Einheitliches, aus einem Guß, das wir am Kunstwerk besonders hochschätzen. Etwas von der »Gebärde« der sicher hingeworfenen Aquarellskizze haftet ihnen an. Beim Durcharbeiten eines Werkes würde vielleicht das Unvermögen des Malers entlarvt.
Man fragt sich: Was rettet den ruhelosen Allesbemaler denn vor jener Entlarvung? Überlegung? Instinktive Sicherheit? Es mag etwas davon in ihm lebendig sein. Dafür spricht, daß eine bestimmte Arbeitsweise ihm eignet. Man erkennt seine Hand von ferne. Aber die psychologische Grundhaltung läßt sich doch noch etwas deutlicher aufzeigen. Ihm bedeutet offenbar die Umwelt mit ihrem überreichen Spiel von Formen und Farben nicht viel. Alle Nachrichten über Orth stimmen darin überein, daß er stumpf, teilnahmslos sei, gleichgültig herumliege, mit seinen Kleidungsstücken spiele, vor sich hinrede. Das ist die Art eines Menschen, der sich aus dem Zusammenhang mit der Umgebung gelöst hat. Sie hat keinen Wert für ihn, und er fühlt sich ihr nicht verpflichtet. Ganz auf sich selbst gewendet brütet er dahin, lange Zeiten vom Vegetieren nach Pflanzenart dadurch vorwiegend unterschieden, daß der Ernährungsvorgang von Pflegern geregelt wird. Und doch ist zur gleichen Zeit ein Strahl psychischer Spontaneität wach: was immer bemalbar ist, Papier, Bücher, Zimmerwand, Mauer im Garten, reizt ihn anscheinend auch in den Tagen völliger Stumpfheit zu bildnerischer Betätigung. Wir sehen also an dem verschrobenen unzugänglichen Kranken eine Art des Gestaltungsdranges, die noch nahe an dem nicht determinierten Betätigungsdrang steht, da er sich fast wahllos auf alle Objekte stürzt, die zur Not verwendbar sind. Darin liegt, daß es ihm weniger auf die Erzeugung eines ihm vorschwebenden Bildwerkes ankommt, sondern daß vielmehr ein Erinnerungsschatz in ihm nicht zur Ruhe gelangt: die See in ihrem tausendfältigen Spiel von Farben und Formen, das Schiff, auf dem er fuhr, als er in ehrgeizigem Streben das Leben noch vor sich hatte.
Damit haben wir zwei Komponenten bezeichnet, die in der unmittelbaren Beobachtung gegeben sind: einseitig gerichteter Betätigungsdrang, bei großer allgemeiner Stumpfheit, und lebendiger anschaulicher Erinnerungsschatz. Aber es wurde schon vorher angedeutet, daß sein Zeichnen und Malen durchaus nicht als wahlloses Schmieren gewertet werden kann, sondern daß eine Vereinheitlichungstendenz nach der Seite der Form wie der Farbe unverkennbar ist. Der Skeptiker mag einwenden, Orth fahre eben, wie es in der Krankengeschichte heißt, in zehn Farben zumal und erzeuge so ein nasses Farbenspiel nach Art jener Vorsatzpapiere, bei denen man ähnlich gemischte Kleisterfarben zerreibt, quetscht und mit verschiedenen Pinseln, Kämmen usw. durcheinandertreibt. Daß spielerischer Betätigungsdrang, der sich gern von zufällig erscheinenden Formen leiten läßt, bei dieser Produktion eine größere Rolle spielt, wurde bereits gesagt. Hier kommt es darauf an, der eigentlichen Gestaltungsimpulse habhaft zu werden. Und da müssen wir zugeben: obwohl der gleiche Erinnerungskomplex sich immer vordrängt und die gleichen Motive immer wieder abgewandelt werden, so sind die entstehenden Produkte doch nicht eigentlich stereotyp, sondern in mehreren Richtungen recht mannigfaltig. Die Qualitäten aber, die in immer neuer, mannigfaltiger Abwandlung erscheinen, die sind es, in denen sich die Gestaltungskraft offenbart. Und das sind (nicht wertend gemeint!) die linear-dekorative Vereinheitlichung, die farbig-flächige Vereinheitlichung und der stetige Rhythmus der Strichführung, zumal bei den Buntstiftblättern.

Abb. 129. Dreimaster abends auf See (Aquarell). 29x21.
Diese Qualitäten lassen sich noch genauer charakterisieren: Orth hat immer die ganze Bildfläche im Blickpunkt des Bewußtseins, so scheint es. Was er etwa auf Abb. 129 von seinem »Motiv«, dem Dreimaster auf See, projiziert, ist nur ein schemenhaftes Gebilde, aus länglichem Rumpfe mit drei aufrechten Strichen als Repräsentanten der Maste oder Andeutungen der Segelflächen. Auf dies Schattengebilde bezieht er nun die Linienzüge. Bald führt er diese auf das Zentrum zu, bald rahmt er es ein und wiegt dabei rechts und links gegeneinander ab. Ebenso bei der Farbengebung auf Abb. 129. Oft ist der Gesamtakkord so eigenartig, daß man von raffiniert sprechen möchte. So wenn das grau-violette Schiff durch eine blaue Furche nach unten von einer stärker violetten Partie getrennt ist, während die Segel in hell Weinrot tauchen und die vier Bildecken mit Blaugrau, Gelbgrau, Olivgrün und Erdbeerrot gefüllt sind. Man sieht wie die Farben naß in naß mit eiligem Pinsel hingestrichen sind, ein paar Fingerabdrücke wurden nicht beseitigt. Die Gesamtwirkung des Farbakkords deutet auf die gewählte Paraphrase eines Sonnenunterganges auf See. Stellt man sich auf den Farbakkord und die Flächenteilung, also die beiden Einheitsqualitäten ein, so kann man sich zweifellos einen ästhetischen Genuß bereiten.
Andererseits ist es in diesem Falle nicht schwer, mit nüchtern-kritischem Blick die Unzulänglichkeit zu isolieren: die unsaubere, planlose Pinselführung weist auf große Gleichgültigkeit und Disziplinlosigkeit in technischer Hinsicht. Wenn auch die Flächenteilung ein gewisses freies System darstellt, so fehlt doch die Pointe, die der Schaffende seinem Werk aufzudrücken pflegt. Es fehlt vor allem eines: jener Charakter des Endgültigen, den ein Werk dadurch erhält, daß es mit einer gewissen Bewußtheit und Treffsicherheit durchorganisiert ist. An Stelle dieser Gestaltungssicherheit, die im einzelnen Strich und im Setzen der Akzente vorwiegend sich offenbart, erscheint uns hier ein ungefüges, triebhaftes, der Wirkung nicht bewußtes Anstreichen, ein Lallen mit dem Pinsel. Ein Vergleich der 10 vorhandenen Seestücke lehrt, daß die Charakteristik dieses einen auf alle in den Hauptzügen zutrifft. Andere Motive, wie Abb. 130, sind ganz ähnlich behandelt.
Auch bei den wenigen Figurenbildern überwiegen die Einheitstendenzen durchaus über die Darstellungstendenzen. Am deutlichsten bei der »Frau am gelben Tisch«. (Abb. 131.) Man kann einfach die kindliche Unfähigkeit des Zeichners darin sehen, daß er die Tischplatte nicht perspektivisch verkürzt darstellt, sondern in die Bildfläche klappt. Aber hier wie sonst ist darauf zu erwidern, der Charakter der »Unfähigkeit« könne nur dann entscheidend in Rechnung gestellt werden, wenn das Individuum sich bewußt ist, solche perspektivische Verkürzung sei »richtig« und zu erstreben, aber nicht imstande, dieser Absicht nachzukommen. Anders ausgedrückt: man muß sich hüten, von Unfähigkeit schlechthin zu sprechen, wenn jemand nicht tut, was der Betrachter will. Nur Diskrepanz zwischen Wollen und Können in einer Person ist Unfähigkeit in diesem wertenden Sinne. Hier kommt es vielmehr darauf an, welche Tendenzen den Zeichner geleitet haben mögen (psychologische Frage) und dann, inwieweit sein Werk künstlerische Qualitäten erreicht habe (ästhetische Frage). Bei dem »Kaffeehaus-Bild« können wir alle drei Arten von Einheitstendenzen wiederfinden: die lineardekorative, die farbig-dekorative und die des Striches. Ganz beherrschend steht das starkgelbe Oval des Tisches im Zentrum. Die Figur rechts ragt in einen leeren Raum und wird im Rücken von einer dunklen Senkrechten gestützt. Nach links ergießt sich ein Strom von Linienkurven um das Tischoval. Strenger ist die Farbverteilung abgewogen. Der Frau in Rot und Grün ist links oben ein Rechteck in den gleichen Farben entgegengesetzt; auch links vom Tisch kehren diese nochmals wieder. Aus dem Motiv: Frau am runden Tisch ist eine zentrierte Komposition geworden, ohne daß plakatartige Wirkung entstünde. Die ungefüge Derbheit des Striches entspricht völlig dem vorher bei dem Seestück Gesagten. – Was mit den strömenden Farbstreifen »gemeint« sei, läßt sich nicht erschließen. Jedenfalls bleibt die Tatsache unbestreitbar, daß hier eine Gestaltungstendenz am Werk war, die mit Form und Farbe und Fläche rechnete, nicht mit Abbildung der Umwelt.

Fall 50. Abb. 130. Landschaft (Aquarell). 29x21.

Fall 50. Abb. 131. Frau am Tisch (Buntstift). 21x16.

Fall 50. Abb. 132. Entführung (Buntstift). 21x17.
Dieselben Hauptzüge fallen auch bei den anderen Figurenbildern wie Abb. 132 auf: leicht kann man die kindlich-unbeholfenen Formen des Pferdes ironisieren. Man konzentriere sich aber einmal auf die Einordnung des Figurenbündels in die Bildgrenzen und auf die Umrißlinie, die Schwanzende, Füße, Schnauze und Reiterkopf verbindet, um mit dem blauen Kopftuch am oberen Rand hin zu entgleiten! Bei diesem Blatt muß ja das Primum movens überhaupt im Dynamischen gesucht werden. Die stürmische Bewegung des Reiters auf unruhigem Pferde, um die dreht sich das Ganze. Sein vorgeneigter Kopf mit dem wehenden Tuch zeigt ungestümes Vorwärtsdrängen, dem sich das Umgreifen der roten Gestalt ganz unterordnet. Wer gefühlt hat, wie diese dynamischen Faktoren lebendig weiter wirken, obwohl sie in eine strenge Kreiskomposition eingespannt sind, der wird alles das, was »schlecht«, »nicht gekonnt« ist, gebührend als sekundär erachten. Wobei ihm das Erlebnis erleichtert wird, wenn er das billige äußerliche Virtuosentum im Bereiche offizieller Kunst zu durchschauen vermag. Starke Spannung zwischen ausdrucksvollem Motiv und strenger Form – diese zweifellos künstlerische Qualität müssen wir Orth zuerkennen. Jedermann weiß, daß diese Qualität seltener ist, als realistisches Können, und oft durch solches Können vernichtet wird. Hier galt es zu zeigen, daß diese eminent künstlerische Qualität ohne Schulung und ohne Begabung im landläufigen Sinne schlicht überzeugend in dem Bilde verkörpert ist.

Fall 50. Abb. 133. Zwei Figuren (Bleistift). 33x41.
Ein anderes Blatt (Abb. 133) gelangt fast mit denselben Mitteln zu beinahe monumentaler Wirkung; die zwei großen Figuren mit Tintenstift, wie nach Steinbildern gezeichnet. Herrschend bleibt die Gebundenheit der Gestalten in die Konturen des präsumptiven Steinblocks. Nur die Hände lösen sich eben heraus. Sockel scheinen die Gestalten zu tragen, Baldachine schweben über ihnen. Die Quadrate an den Ecken des Blattes statuieren wieder die Geltung der ganzen Fläche als Einheit. Man denkt an mittelalterliche Grabplatten. In der Tat könnten die Beine der linken Figur gepanzert scheinen und Sporen sind unverkennbar. Rechts aber deutet das Gewand auf eine Frau. Soll man diese Gestalten mit Ahnenfiguren der Naturvölker in Beziehung setzen? Leider ist nichts Sicheres darüber bekannt, ob Orth etwa, wie so viele seiner Leidensgenossen, in magischen Vorstellungen gelebt hat. So können wir die Vergleichsmöglichkeiten nur anklingen lassen, nachdem die Monumentalität ans Licht gestellt worden ist, die hier aus den Einheitstendenzen herauswächst.
Daß Orth auch eine Anzahl »katatonischer« Zeichnungen gemacht hat, sei nur erwähnt. Auf diesen mischen sich, wie bei den früher besprochenen typischen Stücken, Menschenfiguren verschiedener Größe mit kleinen Schiffen, Tieren, besonders Pferden; jemand liegt im Bett, an diesem macht sich eine kleine geisterhafte Figur zu schaffen. Sonderbar maschinell aufgebaute Tische tragen Flaschen und wunderliche Gefäße. Aber auch hier fehlt nicht die ordnende Einheitstendenz, die wir für Orth charakteristisch fanden: Kurvenzüge fahren über das ganze Blatt, verschieden gerichtete Schraffierungen bedecken alles mit einem Schleier und machen aus dem Gewirr der Einzelheiten ein teppichartiges Gewebe.
Schließlich erweitert sich der Umkreis der Produktion noch durch eine Gruppe von »Geisterbildern« (Abb. 134). Ganze Hefte hat er mit diesen luftigen Schemen gefüllt, in denen sein Strich völlig verändert erscheint, obgleich sie nicht etwa an einem besonderen Zeitpunkt entstanden sind, wo die übrige Arbeit ruhte. Mehrere Gründe sprechen dafür, daß man hier halluzinatorische Anregung für wahrscheinlich erklären muß: vor allem die erwähnte Tatsache, daß diese Zeichnungen in jeder Beziehung völlig von seinem sonstigen Brauch abweichen. Hier ist es durchaus das Wesen als solches, das ihn fesselt. In immer neuen Versuchen müht er sich, es einzufangen, so möchten wir annehmen. Eine lockige Fratze, an der weit aufgerissene Augen überwiegen – daran ein luftiges Körperchen, bald mit fliegendem Gewand, meist mit Schleifenstrumpfbändern an den Beinchen, bald mit angedeuteten Brüsten, bald mit sichtbarem Nabel, bald armlos, bald mit schlangenartigem Arm – und doch offenbar immer dasselbe geisterhafte Wesen. Ganz besonders wird unsere Meinung von dem halluzinatorischen Charakter der Erlebnisgrundlage durch die Abwandlung der Gestaltungstendenzen gestützt: die Einheitstendenzen, in denen wir das Spezifikum für Orths Produktion erkannten, fehlen hier bis auf die eine: die stetige Verwendung eines leichten, etwas zittrigen Bogenstrichs, der nun so weit von seiner gewöhnlichen Zeichenweise abweicht, daß man auf einen ganz starken Abwandlungsimpuls schließen muß: diesen würden halluzinatorische Erlebnisse am befriedigendsten abgeben.

Fall 50 Abb. 134. Figuren-Kritzeleien (Bleistift). 48x32.
Der niedersächsische Landarbeiter Hermann Beil, geb. 1867, stammt aus belasteter Familie. Von dem Vater ist nichts bekannt; Anfang der 80er Jahre lebte er schon nicht mehr. Die Mutter wurde 1885 wegen Geistesstörung und Verwahrlosung in eine Heilanstalt überführt. Sie soll vorher stark getrunken haben. Ein Bruder des Patienten ist seit 1899 wiederholt anstaltsbedürftig geworden, weil er an manisch-depressivem Irresein leidet. Über die Jugend des Patienten ist nichts bekannt.
Beil wurde 1904 zum erstenmal in die Anstalt gebracht. Das einliefernde Krankenhaus hatte ihn, weil er tobte, nur in der Zelle halten können. Er war ein völlig verwahrloster Vagabund, der in redselig-heiterer gehobener Stimmung unablässig sprach, voll Selbstgefühl sich plump-vertraulich an Fremde drängte, dabei aber höchst reizbar war und unversehens in streitsüchtige Erregung geriet, kurzum, er bot – klinisch gesprochen – das typische Bild einer Hypomanie. Zeitweise nannte er sich den Sohn des Fürsten Waldemar, oder behauptete, er habe Medizin studiert. Dieser Erregungszustand klang im Laufe eines halben Jahres ab und Beil wurde ein freundlicher, ruhiger Arbeiter, der zwischen depressiven und hypomanischen Stimmungen schwankte, aber in einer ländlichen Kolonie gehalten werden konnte. Ende 1906 setzte ein zweiter schwerer Erregungszustand ein, in dem er Decken zerriß und nur im Dauerbad gehalten werden konnte, und 1908 folgte ein dritter, der noch heftiger verlief, aber nach einigen Monaten wieder einer arbeitsamen Periode Platz machte, in der er sehr fleißig und anstellig, voll brauchbarer praktischer Einfälle, überall mit zugriff. Dabei blieb er in leicht hypomanischer Stimmung und ging schließlich zu seinem Schwager, was die Anstaltsleitung genehmigte. Aber schon nach einem Monat kam er zurück, weil er nun in eine Depression geraten war. Mit starrem Gesicht, über das Tränen liefen, saß er da, gestand Selbstmordgedanken zu haben, und war ganz unfähig zum Arbeiten. 1910/1911 ist ein neuer Erregungszustand zu verzeichnen, nach dessen Ablauf er zwei Jahre bei seinem Schwager arbeitet. 1913 wird er in einem manisch-depressiven Mischzustand wieder aufgenommen, der rasch in eine Hypomanie übergeht und nur vier Monate dauert. 1916 liefert ihn das Amtsgefängnis in manischer Phase ein, nachdem er wegen Schafdiebstahls in Untersuchungshaft gesetzt worden war. Auch diesmal ging der Zustand in etwa vier Monaten vorüber. Dagegen dauerte die nächste Phase, 1920 – diesmal wieder ein Mischzustand – acht Monate mit kurzer Unterbrechung.
In den Symptomen treten im Laufe der Jahre psychopathologische Veränderungen ein. Der Größenwahn wird reichhaltiger: er kann die Ärzte absetzen oder ihr Gehalt erhöhen – er klebt sich den Gummiring einer Bierflasche an die Stirn, zum Zeichen, daß er Kaiser und König sei und das ganze Militär zu kommandieren habe, – oder er ist »Tierbändiger der ganzen Welt, Wahrsager der Liebe, von Gott über Kaiser und Könige gesetzt, größter Gauner und Spitzbube« – oder »ich bin der liebe Gott und bin dreimal gekreuzigt, aber die Mutter Gottes betet für mich; mein Vater Fürst Waldemar hat mir immer Anzüge gegeben« usw. Seit 1910 werden Halluzinationen erwähnt. Er bemerkt Zigeuner am Fenster, die ihn abholen wollen. Er hat den Wagen ganz genau gesehen, aber vielleicht war es ein Traum, meint er. »Ich bin über die Häuser hierhergeflogen – und dann spricht das Mädchen nur vom Heiraten – wegen meines Bruders muß ich in der Anstalt sein, dieser hier (er deutet auf sich) ist zu dumm.« An der Wand ist der liebe Gott, der hat ihm gesagt, er solle das Spanntuch zerreißen; nicht er, sondern Gottes Kraft habe das getan.
Man zweifelt natürlich, ob diese Symptome nicht doch zur Diagnose Schizophrenie zwingen. Aber dagegen spricht, daß Beil jedesmal als »flotte Manie« geschildert wird, daß er affektiv immer gleich wieder voll ansprechbar ist, an seinem Bruder fast zärtlich hängt, und überhaupt fast keine Verschrobenheiten in Sprache und Benehmen angenommen hat. Wenn auch das biographische Material etwas mager ist, so kann man doch einige Hauptzüge von Beils Persönlichkeit wohl herausholen. Er ist eine derb organisierte Landstreichernatur, in ruhigen Zeiten zu allen möglichen Arbeiten gut brauchbar, dagegen zum Bummeln und zu Spitzbübereien geneigt, wenn die Gelegenheit günstig und er nicht durch regelmäßige Arbeit gebunden ist. Wenn auch über seine Intelligenz nichts Sicheres bekannt ist, so scheint er doch jedenfalls nicht gerade imbezill zu sein. Die Spontaneität, die man an ihm rühmt, soll mit Anstelligkeit für verschiedene Aufgaben gepaart sein. So hat er zweckmäßige Methoden im Hausbetrieb und in der Landwirtschaft erfunden, wofür man ihn mit Nahrungszulagen belohnte. Auch hat er nebenbei das Malerhandwerk gelernt und alle vorkommenden Arbeiten selbständig ausgeführt.
Dieser Mann hat nun in seinen erregten Zeiten (mit Ausnahme der schlimmsten Tage, an denen er im Dauerbad sein mußte) fast jedesmal einen starken Drang zum Zeichnen gehabt, der noch kaum als Bedürfnis nach Gestaltung im vollen Sinne aufgefaßt werden kann, sondern viel näher mit einfachem Betätigungsdrang zusammenhing, wie er sich in seinem ideenflüchtigen Rededrang und in seiner Vielgeschäftigkeit gleichzeitig äußerte. Er bedeckte in diesen Zeiten unter großem Aufwand an Material alles Papier, dessen er habhaft werden konnte, vorwiegend mit menschlichen Figuren. Besonders Klosettpapier, das ihm wohl am leichtesten zur Verfügung stand, benutzte er zu diesen höheren Zwecken. Die einfachen Köpfe und Figuren sind plump hingeschmiert, zeigen aber überwiegend eine Neigung zu dekorativer Vereinfachung. So wird gern die Körperachse durch einen westenartigen farbigen Streifen betont, Brustwarzen und Nabel werden nachdrücklich hervorgehoben, bisweilen auch das Genitale. Die Augen sind durchweg groß und glotzend, die Zunge hängt öfters heraus. Etwas Götzenhaftes spricht aus diesen starren, maskenartigen Fratzen. Daneben gibt es ganz wirre, größere und kleine Blätter, auf denen Landschaftsteile, Köpfe, Figuren nur angedeutet sind, als habe der Stift nicht haltmachen können in der Unrast des Schmierens. Und endlich noch eine dritte Art: ganze Figuren, die rein zeichnerisch, ohne jede Schattierung, mit eigenartigem Zitterstrich behandelt sind.
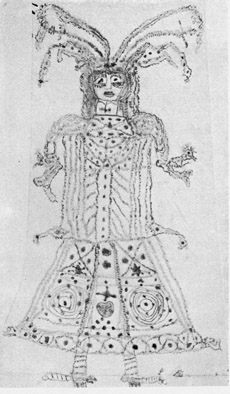
Fall 10. Abb. 135. Weibliche Figur (Bleistift). 9x15.
Diese letzte Gruppe ist für Beil besonders charakteristisch. Dazu kommt, daß wir aus ihr drei datierte Blätter von 1907, 1913 und 1920 besitzen, also auch auf eine Übungskomponente fahnden können. Die phantastische Figur Abb. 135 von 1907 ist fast vollständig in eine ornamentale Spielerei aufgelöst. Was als Vorbild dem Zeichner vorgeschwebt haben mag, ist wohl nur der Umriß einer Kleiderpuppe, nichts eigentlich Körperliches. Auffallend ist, wie konsequent er sich mit seinen Zierformen den Grundgesetzen des menschlichen Körperaufbaues anpaßt. Er scheidet genau Brustpartie (von der er noch eine Schulterpartie abtrennt), Bauch- und Beinpartie, obwohl er mit einigen Linienzügen wiederum den Zusammenhang betont. Und trotzdem der Rock eher wie eine Keramik aufgefaßt wird, hebt er wieder den Verlauf der Beine hervor, wobei er gleich ein Teilungsmotiv für die Rockfläche erhält. Die Kante des Rockes wie des jackenartigen Obergewandes laufen wie in einem Überschwange des Bewegungsdranges in schnurrige Zipfel aus. Ganz absonderlich aber wirken die Armstummel, die wie Pelzschwänze im Winde zu flattern scheinen, an ernstgemeinte Arme aber kaum denken lassen. Dazu paßt der phantastische Kopfputz, der wie Feuerwerk in langen, dünnen Bogenlinien auffährt, und doch sich noch der strengen Symmetrie fügt, die das ganze Zierwerk beherrscht. Wenn wir nun in der Mischung von ornamentaler Spielerei mit organischem Aufbau und Symmetrie und mit betonter Realitätsferne das Charakteristische des Blattes umschreiben, so fehlt noch ein Hauptkennzeichen: der wunderliche Zitterstrich, oder, wie man genauer sagen muß, Bogenstrich. Dieser unterscheidet sich nämlich von dem Strich bei organischem Tremor dadurch, daß nicht eigentlich Zickzacklinien entstehen, sondern das, was man in der Graphologie Arkaden nennt. Man kann sich durch Versuche leicht davon überzeugen, daß diese Strichart gar nicht aus unwillkürlichen Zitterbewegungen, sondern aus gerichteten Bewegungsimpulsen entsteht, die sogar recht langsam aufeinanderfolgen können, wenn man die Fortbewegung auf dem Blatt entsprechend verlangsamt. Immerhin werden wir dann, wie in den Anhängseln der Figur, jene Tendenz zu bombastischem Auftreten, zur Bereicherung ausgedrückt finden, die wir in hypomanischen Zuständen kennen.

Fall 10. Abb. 136. Damenbildnis (Bleistift). 12x14.
Dieselbe Art des Strichs herrscht vor in dem »Damenbildnis« von 1913, Abb. 136. Aber hier bleibt Beil nicht bei rein linearer Zeichenweise stehen, sondern legt Flächen an, die er mit Punkten, Kritzeln und verschieden gerichteten Strichlagen füllt. Das Blatt erhält dadurch trotz aller Unbestimmtheit im Sinne der Abbildung eine große Einheitlichkeit der Flächenstruktur. Dazu kommt hier allerdings deutlich eine traditionelle Geschlossenheit der Komposition, die uns nahelegt, eine Vorlage in Form irgendeiner Zeitschriften-Illustration anzunehmen. Die Krankengeschichte bestätigt, daß Beil gern solche Vorlagen in merkwürdig entstellter Weise abgezeichnet habe. Es lohnt sich, mit dem Wissen von dieser Vorbildbeziehung die Einzelheiten des Blattes durchzusehen und sich zu überzeugen, wie der Zeichner in seinem dunkeln Drange auf künstlerische Gestaltungsprinzipien gerät, in denen wir allzu leicht nur bewußte technische Kniffe zu sehen geneigt sind. Dahin ist außer der schon erwähnten Vereinheitlichung des Blattes durch die bröcklige Zeichentechnik etwa zu rechnen: die Art, den Kopf durch mäßige Verstärkung des Konturs hervorzuheben, vor allem aber dadurch, daß die einzige, ruhig durchgezogene Linie links am Kopf entlang geführt ist.
Mitten aus der flotten Manie von 1920 heraus stammt die Abb. 137, auf der nun die gleiche Technik weiter gelöst und vermannigfacht sich auswirkt. Der ursprüngliche »Zitterstrich« ist stark zurückgetreten, aber aus ihm haben sich zahlreiche Arten von unregelmäßigen Zickzack- und Kritzellinien, sowie girlandenartige Bildungen entwickelt, die in langen Zügen und Fragmenten den ganzen unruhigen Aufwand des Blattes bestreiten. Wahrscheinlich hat wiederum ein Vorbild zugrunde gelegen. Man könnte sich etwa eine Tänzerin oder eine Figur von Zuloaga als Ausgangspunkt denken. Der obere Aufbau wäre dann entweder frei dazu phantasiert, oder aber aus beliebigen Bildelementen gedeutet. Zahlreiche menschliche und tierische Köpfe und Figuren sind in das Gekritzel hineingedeutet. Dagegen ist der gorillaartige Kopf in der Genitalgegend wohl eigens hinzugezeichnet. Im Vergleich zu der Figur von 1907 fällt auf, daß der organische Aufbau des Körpers ganz vernachlässigt wird: diese Gestalt ist auf dem Wege zur Auflösung ins Abstrakte, zu einem reichen Spitzenmuster, das aber von einer wuchernden Lebendigkeit erfüllt ist, die jeder Ordnung widerstrebt. Wir können also auch hier eine Entwicklung feststellen, die vom Geschlossenen, mehr Organischen, zum Gelösten, mehr Vegetativen strebt. Die Bestätigung für unsere Annahme, Beil löse in seinen Zeichnungen Vorbilder auf, wurde schließlich durch eine Arbeit aus der letzten Zeit geliefert: Abb. 138a und b gibt Original und Neuschöpfung des Zeichners – denn von Nachbildung darf man wohl kaum reden. Es ist nur das Konturgerüst benutzt worden. Die aus den anderen Bildern bekannte Kritzelmanier füllt hemmungslos alle freien Räume aus. Ja, sie hat sich auch bereits an dem Original vergriffen, das in seiner Fadheit zu belebenden Zutaten herausfordert.

Fall 10. Abb. 137. Götzenfigur? (Bleistift). 25x33.

Fall 10. Abb. 139. Sakrale (Götzen-) Figur? (Aquarell). 20x32.
Die majestätische Gestalt in Blau–Gelb Abb. 139 stammt aus der frühen Zeit, wie man ohne weiteres sieht. Wer mit der Zahlenmystik, vor allem alter kirchlicher Kunst, vertraut ist, wird mit Überraschung bemerken, daß diese Figur tatsächlich aus den drei heiligen Urformen, Quadrat, Dreieck und Kreis, zusammengesetzt ist, die in der christlichen Kirche als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gedeutet werden. – Außer dieser geometrischen Konstruktion aber wird der organische Aufbau des Körpers zur Geltung gebracht, indem ein Brustteil wie mit keilförmiger Taille in den Hüftteil gesteckt erscheint. Und ferner wird eine Unterleibskurve betont durch einen Halbkranz tiefblauer Krakelformen. Die klären sich nach unten auf zu tanzenden Kobolden, die über dem dunklen Zentrum der Geschlechtsgegend einen spukhaften Reigen aufführen. Mitten in diesem Schattengebiet, das nur hier durch fast schwarze Flecken betont ist, eine dunkelrote Schlinge, unaufdringlich aber auch unverkennbar: die Vulva. Von hier aus sind mit Bleistift wie durchscheinend die Beine angedeutet, die nur als kurze Stumpen unter dem Gewand hervortreten. Der auf dünnem Hälschen aufsitzende dicke kugelrunde Kopf mit sonderbarem kohlblattartigem Putz ist, wie der Körper bei diskreter Kennzeichnung der Hauptorgane ganz entmaterialisiert durch krause Ornamentik, die jedoch wieder sinnvoll die Hauptformen berücksichtigt. Die Einteilung des Körpers in kleine Quadrate nach Art von Steingutplatten, gibt der Gestalt etwas Flächenhaftes, während ihre Farbigkeit und die angedeutete Schattierung, an Fayence erinnernd, zu plastischer Auffassung drängt. Noch mehr bringen den auf räumliche Klarheit erpichten Beschauer die rätselhaften Flügelarme in Verlegenheit, die mit ihrer drohend-feierlichen Gebärde die monumentale Wirkung der streng symmetrischen Gestalt noch ins Mystisch-Sakrale steigern.

Fall 10. Abb. 138a. Doppelbildnis (Bleistift). 21x31

Abb. 138b. Vorlage zu 138a.
Suchen wir nun, wie in den übrigen Fällen, nach dem symbolischen Gehalt, den der Zeichner in seine Blätter etwa hätte miteinfließen lassen, so sind wir in Verlegenheit – nichts dergleichen läßt sich auffinden. Weder wissen wir von irgendwelchen Äußerungen, die Beil über seine Bilder getan hätte, noch bieten diese selbst eine Handhabe zu symbolischer Ausdeutung. Mehrmals rechneten wir vielmehr mit Vorlagen, die spielerisch umgestaltet waren, wobei uns vor allem die Erkenntnis wichtig war, daß der Mann in Erregungszuständen, also in triebhaftem, unreflektiertem Zeichnen eine besondere Art von technischer Vereinheitlichung zustande brachte, die wie raffiniert wirkte. Darin liegt nun überhaupt eine wertvolle Erkenntnis: hier haben wir einmal den Beweis vor Augen, daß gerade dieser unreflektierte Zustand (denn nicht in der Erregung möchten wir das Wesentliche sehen, sondern in den triebhaft einheitlichen, durch keine Reflexion gebrochenen Impulsen) für die einheitliche Durchführung günstig ist. Die Gestaltung der Fläche wurde ja hauptsächlich schon von den Vorbildern geleistet, die nur etwas überwuchert wurden durch den manischen Bereicherungsdrang. In dieser Art zu zeichnen (gern nach Vorbild, sei es direkte Vorlage oder Vorstellung realer Gegenstände), bei der durch die gleichmäßige technische Ausführung eine merkwürdige Einheit bei oft exotischer Üppigkeit erzielt wird, möchten wir einen spezifischen Ausdruck des manischen Zustandes sehen, da uns mehrere andere Fälle mit nah verwandter Produktion vorliegen.
Schwieriger ist die Eigenart der blau-gelben Gestalt psychopathologisch unterzubringen. Es läßt sich gar nicht leugnen, daß man unter dem unmittelbaren Eindruck des Bildes geneigt sein wird, gerade jene Feierlichkeits- und Unheimlichkeitskomponente darin zu fühlen, die man am ehesten als typisch schizophren bezeichnen möchte. Wohl wird man dann einen Teil dieser Wirkung in der Gebärde an sich, in der räumlichen Ungeklärtheit, in der starren Götzenhaftigkeit usw. zu begründen suchen. Allein es bleibt ein Rest, den man am liebsten durch die Diagnose Schizophrenie gedeckt sähe. Daß gerade dieses Bild tief in die Psychologie des Dämonischen einzuführen geeignet ist, sei nur noch angemerkt. Die in dieser Richtung liegenden Probleme müssen ebenso wie die eigentliche Symboldeutung zurückgestellt werden.
Heinrich Welz, Baron, Dr. jur., ist 1883 geboren. In der Familie waren mehrere Mitglieder, besonders der Vater und dessen Bruder, exzentrisch und neurasthenisch. Er selbst war als Kind gesund, begabt, aber ebenfalls etwas auffällig; er galt als »Fex«. In der Pubertät zumal scheint er von großer Sensibilität gewesen zu sein. Ein verstiegener Idealist, der viel dichtete. Aus dem Beginn seiner 20er Jahre sind einige Liebesgeschichten bekannt, die in Dichtungen, sogar in einem Drama, Gestalt gewannen. Er soll damals zeitweise sehr übermütig gewesen sein und sich körperlich wie geistig überanstrengt haben. Darauf bekam er Depressionen und eine Herzschwäche und suchte Rat bei einem Psychiater. Ob es sich in jener Zeit um einen echten Erschöpfungszustand gehandelt hat, muß wohl bezweifelt werden. Der spätere Verlauf macht es wahrscheinlicher, daß die Ermüdbarkeit, die hypochondrischen Züge, wie die Depressionen und die Bizarrerien im Urteil schon Vorboten des schizophrenen Prozesses waren. Wie weit seine vom Üblichen abweichenden Meinungen, z. B. über Moral, auf die Eigenprägung eines begabten Menschen zurückzuführen sind, oder wie weit man auch darin Frühsymptome sehen kann, läßt sich nachträglich ohne Kenntnis der damaligen Persönlichkeit nicht sagen. – Er hatte dann ein Verhältnis mit einer Hysterika schwierigster Art, die er trotz fortwährender dramatischer Szenen mit Suiziddrohungen heiraten wollte und ins Ausland mitnahm. Zugleich arbeitete er an einem soziologischen Werk »Über Zentralisation«, das nach Meinung eines Bruders zwar unklar, aber ganz vernünftig und nicht krankhaft war. Plötzlich gab er den Verkehr mit Verwandten auf, die er bislang täglich besucht hatte, und blieb vier Wochen lang im Bett, bis der Arzt entschied, er müsse in eine Anstalt. Nun schickte er seine Dame fort und blieb noch 10 Tage allein in der Wohnung, bis sein Bruder ihn holte. In diesen Tagen halluzinierte er mehr und mehr, redete wirr, hatte hypochondrische Angstzustände, Vergiftungsfurcht und plötzliche Erregungsanfälle.
Aus den eben angeführten Komponenten in der Hauptsache baute sich das Krankheitsbild auch in der Anstalt auf. Dazu kam aber ein heftiger Drang zu stereotypen Bewegungen und Haltungen, die er rücksichtslos durchführte, besonders Purzelbäume. Und ferner der Drang, magische, zauberhafte Zusammenhänge für alles Geschehen draußen und zumal für seine eigenartigen triebhaften Erlebnisse zu finden. Seine körperlichen Sensationen führt er zunächst in üblicher Weise auf Magnetismus zurück, und zwar auf gestörte Polarisation in seinem Organismus. Diese Störung will er durch Purzelbäume in bestimmten Abständen korrigieren. Um diese Korrektur aber richtig wirksam zu machen, müssen die Purzelbäume nach Orten orientiert sein, die augenblicklich Bedeutung für sein Dasein haben: so schlägt er sie in der Richtung auf Schweinfurt, weil dort eben seine Geliebte sich aufhält. Von solchen magischen Beziehungen wimmelt es in seinen Wahnvorstellungen. Er muß z. B. einen Tag lang die Augen geschlossen halten. Wenn er sie öffnet, so beraubt er seine Geschwister ihrer Stärke. Oder er benennt die Bäume im Garten mit Namen seiner Angehörigen und mit soziologischen Begriffen und entdeckt, indem er diese mehrfach determinierten Bäume etwa in verschiedenen Richtungen visiert, überraschende Beziehungen, die er natürlich gleich als Erkenntnis mit Realitätscharakter verwendet. Oder er steht stundenlang am offenen Fenster, hält einen Löffel in der Hand und starrt zum Himmel hinauf: »ich werde die Stellung der Sterne verändern durch meinen Willen.« Daneben baut er ein höchst wunderliches, scheinbar streng systematisiertes Begriffsgebäude auf, in dessen sauber und übersichtlich angelegten Spalten nebeneinander etwa folgende Kategorien sich finden: Willologie, Ideologie, Gerechtologie, Schönologie, Artologie, Zoologie, Geschlechtologie, Witzologie, Naturologie, Zeitologie, Formologie. In den mit spitzem Stift ganz klein dazu gekritzelten Erläuterungen sind manche hübschen Einfälle enthalten, die jedoch die Absurdität des Ganzen nur um so grotesker erscheinen lassen.
Der erste Schub der Krankheit, in dessen Verlauf einige schwere Erregungszustände und auch Zeiten katatonischen Stupors auftraten, ging in etwa eineinhalb Jahren vorüber. Aber die Heilung war nur scheinbar. Wenige Monate später wurde Welz in viel schwererem Zustande wieder eingeliefert, und seither machte der Prozeß nicht mehr halt. Stärker waren jetzt die stereotypen Bewegungen geworden, besonders ein tolles Grimassieren, ungestümer die hemmungslosen triebhaften Handlungen, oft mitten aus dem Stupor heraus: er steht blitzschnell aus seiner starren Haltung auf, ohrfeigt einen Wärter oder Arzt und legt sich zurück, um wieder in Starre zu versinken. Oder er schneidet sich plötzlich mit einem stumpfen Messer energisch in die Stirn.
Anfangs traten diese schweren katatonischen Symptome noch zeitweise zurück. Er war dann wieder ganz umgänglich und rege, las die Zeitung, analysierte seine Träume, beschäftigte sich mit seinen soziologischen Systemen und zeichnete etwas. Aber er wurde dabei immer verschrobener und manierierter. Am wichtigsten waren ihm weiter Probleme wie Gedankenübertragung. Zu diesem Zweck blickte er seinem Gegenüber scharf auf die Nasenwurzel. Oder er betätigt sich als »Sozialarzt«, indem er Fernheilungen vornimmt. Auch ganz kindische Spielereien trägt er mit dem gleichen Ernst vor. So, wenn er einen grünen Zweig in die Hand nimmt, und seine darauf beruhenden mystischen Beziehungen zu einem Patienten namens Grünzweig erläutert. Seine gehemmten Gedanken fühlt er deutlich sich lösen und sich von einem bestimmten Punkte des Gehirns nach vorn projizieren. Seine früheren Polarisationsideen spinnt er weiter, indem er erwägt, wie man am besten durch Kreiselbewegungen die Anziehungskraft der Erde überwindet und senkrecht in die Höhe fahren könne.
Schließlich spricht er überhaupt kaum mehr, sondern ist scheinbar ständig mit seinen Halluzinationen beschäftigt. Einmal begründet er sein Schweigen ausdrücklich damit: er stehe ja mit der ganzen Welt in Verbindung durch Telepathie, deshalb sei alles Sprechen überflüssig. Plötzliche Gewalttätigkeiten, die er »Krämpfe« nennt und auf sexuelle Erregungen zurückführt, durchbrechen den Stupor nach wie vor.
Welz hat schon früher als Dilettant etwas gezeichnet und gemalt und kennt wahrscheinlich die Entwicklung der Kunst bis 1912. Während seines ersten Anstaltsaufenthaltes fertigte er eine Reihe von Bleistiftskizzen nach Enten und Hühnern, Kindern und Landschaftsausschnitten an, die eine durchschnittliche, etwas fade Geschicklichkeit verraten. Einige Aquarell-Landschaften sind etwas interessanter, räumlich bestimmt, in der Farbe lebhaft. Aber schon in der gleichen Zeit versuchte er, seine Wahnvorstellungen auf dem Papier zur Anschauung zu bringen. Aus dieser Zeit stammt z. B. die Zeichnung »Ideenkreis eines Mannes, auf die Außenwelt projiziert« Abb. 140. Da sehen wir einen mächtigen Kopf, wie aus Stein, der oben aufbricht und in ein Bukett von kleinen Szenen und Situationsbildern übergeht: ein Schloß, ein Turnier, ein Löwe, Frauen u. a. m. Ein Metallstreifen mit Nägeln scheint den Schädel zusammenzuhalten. Der ruhige Aufbau, die Präzision mancher Teile (Hand!) verrät den geübten Zeichner. Die beunruhigende Wirkung geht wohl von der ruhigen Sachlichkeit aus, mit der jener »projizierte Ideenkreis« dargestellt ist, als sei er ebenso dinglich real wie der Kopf des Mannes.

Fall 193. Abb. 140. »Ideenkreis eines Mannes« (Bleistift). 24x33.

Fall 193. Abb. 141. Frauenbildnis (Bleistift). 16x21.
Aus derselben Zeit scheint noch das »Frauenbild à la Liliefors« Abb. 141 zu sein, bei dem der Kontrast der Nackenkonstruktion mit dem zarten Gesichtsumriß auffällt. Offenbar sind wieder Gedankenströme und ähnliches, zumal mit den Wellenlinien, gemeint. Ob ein Bild des schwedischen Malers Liliefors als Vorlage gedient hat, ließ sich nicht mehr feststellen. Das Sonderproblem dieses Falles wird erst an Abb. 142 klar. Da hat der Zeichner ganz konsequent einen Profilkopf in geometrische Konstruktionen aufgelöst. Völlig entsprechend seinen Vorstellungen von der Projektion der Gedanken, der Polarisation des menschlichen Körpers in Beziehung auf Erde und umgebende Körper, sind zahlreiche Zentren angenommen, von denen die Kraftlinien ausstrahlen. Es ist unwahrscheinlich, daß irgendeine Kraftlinie für Welz ganz konstant verläuft, so daß er sie in jedem Falle genau so gestalten würde. Wiederum haben wir es mit der Gebärde der Gesetzlichkeit zu tun, und man fühlt sich nur zu der Frage gedrängt: was an der Zeichnung übt diese suggestive Wirkung aus, daß man »Gesetz« fühlt und »Willkür« denkt, ohne zu einem Ausgleich zu kommen?
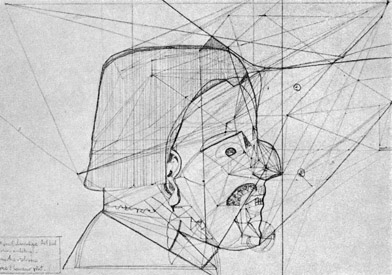
Fall 193. Abb. 142. Geometrisches Porträt (Bleistift). 26x18.

Fall 193. Abb. 143. Bildnis. (Bleistift) 26x18.

Fall 193. Abb. 144. »Willologie der Sonne« (Bleistift). 17x21.
In der »Lebensvollen Betrachtung des Pfarrers Obermaier« (Abb. 143) schließlich sind beide Tendenzen vereinigt und zu einer, wenn man will, endgültigen Formensprache entwickelt. Aufgehoben ist alle körperliche Wirkung, aufgehoben fast jedes realistische Detail. Man könnte das Ganze auf den ersten Blick für eine Landkartenskizze halten. Mit sichtlichem Behagen am ornamentalen Spiel sind diese Liniengräben, Ackerstreifen, Baumreihen eingetragen. Daß aber trotz dieser spielerischen Auflösung nicht nur irgendein Menschenschemen, sondern offenbar ein Individuum aus dem Liniengewirr spricht, das macht wieder stutzig. Also wäre die Absicht des Zeichners, ein abstraktes Porträt ohne realistisches Detail zu machen, gelungen? – Nach unserer Meinung läßt sich das allerdings nicht bestreiten. Welz hat seine bizarre Aufgabe überraschend gut gelöst. Man kann die Stellung der Aufgabe verwerfen, aber nicht die zeichnerische Leistung als solche ablehnen.
Und doch beweist Welz selbst, daß in der Idee des ganzen Verfahrens der Keim zur Absurdität steckt. Vielmehr, er beweist von neuem, daß jeder an sich durchaus diskutable Gedanke zum Unsinn wird, wenn man ihn einseitig konsequent zu Ende denkt. Er schreitet, dem blinden Systematisierungsdrang folgend, mit seinen Abstraktionstendenzen weiter vor und steckt sich das Ziel, Ideen graphisch zu versinnbildlichen, und zwar in einer Kurve oder in wenigen Linien. Offenbar glaubt er, durch Versenkung in eine Idee es so weit zu bringen, daß die aus solcher Konzentration entstandene Kurve auf magische Weise etwas von dem Extrakte jener Idee mitbekomme. Schaut man sich nun einen solchen Katalog von Ausdruckskurven an, etwa die »Willologie der Sonne«, Abb. 144, so wird auch der Gutwilligste über das klägliche Fiasko dieses an sich ausdruckspsychologisch richtig konzipierten, aber durch Kritiklosigkeit wörtlich ad absurdum geführten Gedanken nicht im Zweifel sein. Richtig nämlich ist bei diesem Gedankengang die Grundvorstellung, es müsse, was die Seele ganz erfüllt, in Bewegungsniederschlägen zum Ausdruck kommen. Falsch dagegen, dies könnten irgendwelche materiellen »Ideen« sein. Dazu bedürfte es allerdings der Magie und Zauberei, während allgemein gesagt nur die dynamischen Faktoren des seelischen Ablaufs, nicht ihre Vorstellungs-»Inhalte« sich verkörpern können. Reine Zauberei treibt Welz mit der »Napoleons-Kurve« Abb. 145. Da hat er diejenigen Orte Mitteleuropas, die auf Napoleons Kriegszügen von Bedeutung waren, durch eine propellerartige Kurve verbunden. Die wichtigsten aber ergeben, wenn man sie verbindet, das große N. Der Sinn dieser Kurve ist: fährt man ihr täglich mehrmals mit dem Kopfe nach, indem man eine ähnliche Kurve in die Luft beschreibt, so gewinnt man etwas von der äußeren und inneren Haltung Napoleons.
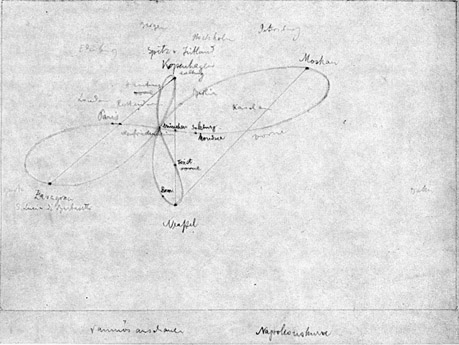
Fall 193. Abb. 145. »Napoleons-Kurve« (Bleistift). 15x11.
In den letzten Jahren hat Welz nicht mehr gezeichnet, wie er sich ja überhaupt ganz stumm in sich zurückgezogen hat. Durch unseren Besuch angeregt, sprach er seit langem zum erstenmal wieder und verriet, daß er auf das Zeichnen aus ähnlichem Grunde verzichte, wie auf das Sprechen: weil es für ihn nicht mehr nötig sei. Er werde künftig einfach das Papier mit Graphit bestreuen und, mit dem Blick darüberhinfahrend, die Körner zu Linien und Formen zwingen.
Der Bauzeichner Joseph Sell wurde 1878 geboren als Sohn eines staatlich angestellten bayrischen Oberbauführers. In der Familie sollen keine Geisteskrankheiten vorgekommen sein. Er selbst war ein schwächliches, empfindliches Kind, das Krampfanfälle bekam, als es den Nikolaus sah. Auch in der Schulzeit blieb er ein Muttersöhnchen, war gern für sich, immer weichmütig und oft etwas sonderbar. Ein Bruder betont, Sell habe elend gezittert, wenn Mitschüler gezüchtigt wurden. Als Schüler war er mäßig, lernte den Zimmermannsberuf und besuchte dann die Baugewerksschule, um bei der Eisenbahn als Bauzeichner angestellt zu werden. – Nachdem er schon einige Jahre an nervösen Beschwerden gelitten hatte, auch öfters deswegen behandelt worden war, steigerte sich sein Mißtrauen, zumal gegen Vorgesetzte, immer mehr bis zu echtem Verfolgungswahn. Er glaubte, man wolle ihn umbringen, die Leute sprächen so merkwürdig über ihn, man schieße ihm ins Fenster. Eines Tages legte er sich ins Bett, zündete eine Kerze an und benahm sich so fremdartig, daß er in eine Anstalt überführt wurde (1907).
Hier stellte sich alsbald heraus, daß er seit mindestens drei Jahren Stimmen hörte und sich mit Wahnvorstellungen beschäftigte: er spiele eine gewisse Rolle im Gleichgewicht zwischen Deutschland und Österreich, wovon hohe Persönlichkeiten mehr wüßten; das hinge mit dem Erdmagnetismus zusammen. Ferner erwog er, wie man auf chemischem Wege Menschen und Blumen herstellen könne. Den Stimmen hörte er ganz gern zu, manchmal waren es Bekannte, die sprachen, manchmal »das ganze Volk«. Auch Gesichtshalluzinationen hatte er, z. B. ein Herz mit einem Degen, oder einen Spruch am Himmel: »Die Natur bietet dem Menschen die Schlüssel zum Himmelreich.« Sein ganzes Benehmen war steif, etwas läppisch-heiter. Er war zwar wortkarg, aber zugänglich und freundlich, und sprach geziert, wobei er die Augen verdrehte. Körperlich ergab sich kein auffallender Befund.
Nachdem er kurze Zeit alle Wahnvorstellungen u. dgl. abgeleugnet hatte, um aus der Anstalt herauszukommen, setzte die Krankheit erneut ein. Er beschwerte sich, daß man ihm durch eigentümliche Präparation der Roßhaarkissen den Schlaf raube; die Stimmen, die er höre, würden von den Ärzten gemacht, um ihn zu verwirren; man habe hier die Kunst, einem die Gedanken und die Wissenschaft abzunehmen, was sehr peinlich sei. Auf Zetteln proklamierte er: »Ich bin beauftragt in Vertretung Gottes meine Lebensbeichte vor sämtlichen Gläubigen in Öffentlichkeit abzulegen und zugleich das Wort zu verkünden, welches Euch beten lehrt. In Verantwortung Jos. Sell, Niveau zu Wasser und zu Land.« Diesen Namen »Niveau« legt er sich nun dauernd bei. »Götter herrschen mit Elemente. Heilige regieren mit Frieden. Wer nicht glaubt, muß unterliegen.« – Oder verschrobener: »Ich sehe mich veranlaßt unter keine Umstände verpflichtet das Wort Gottes in einer Angelegenheit vertreten zu wollen.«
In den Mittelpunkt von Sells Wahnvorstellungen führen zwei kurze Briefe aus dem März 1908. Der erste ist an seine Geschwister gerichtet: »Wenn es Ihnen gelegen ist, Ihren Bruder Joseph am Leben zu erhalten, so wollen Sie so rasch als möglich ihn befreien lassen, nachdem derselbe von der Heil- und Pflege-Anstalt aus regieren soll, eine Menge von verheirateten Damen sich indirekt befriedigen lassen wollen, und nachdem er sich nicht hergibt dazu, belästigt man ihn fortwährend mit sog. Comprimiß-Aparat, indem man ihm mit Leichengeruch füttert bei Nacht und auf das Gemeinste foltert und mittels Electricität ihm früheres Herzleiden zugeteilt wird, sodaß er über Nacht weggeschafft sein kann, wenn er gezwungen ist, sich an einem Ort aufzuhalten und die Grenzen nicht überschreiten kann –.« Der zweite Brief richtet sich an die »Verwerfliche Staatliche Vernichtungsanstalt. – Unterfertigter erlaubt sich die Frage, wie lange er noch dazu da sein soll Verheiratete, Hysterische Spinat-Wachteln, welche er schon näher in einem an Herrn Dr. N. abgelieferten Verzeichnis aufgeführt hat zu befriedigen, nachdem er sich verehelichen will. Fürst Niveau.«
Die körperlichen Sensationen, die seinen Vorstellungen zugrunde liegen, schildert er in langen Schreiben an Behörden und Fürsten. Es sind vornehmlich folgende: seit kurzem wurde er gewahr, daß sein seit 7 Jahren bestehendes Leiden kein natürliches war. Jetzt besitzt er »die Eigenschaft, sich mit einer Menge Persönlichkeiten zu verständigen, welche sich mit seiner Person verbinden und ihre Leiden los werden wollen, indem dieselben ihm mittels Telepathie (Fernempfindung) übertragen werden – – sogar für die Leiden der Patienten, welche operiert werden, event. für Todesfälle einstehen soll. Entweder wirken die Leiden gleichmäßig, oder dieselben seien aufgespeichert in Telefunken, welche ihm zugeteilt werden und sich erst allmählich unter kolossalem Schmerzgefühl entwickeln, z. B. Intensives Kratzen an den Augennerven von innen heraus, Elektrisieren der verschiedenen Extremitäten, Knacken der Schädelknochen, sowie der Hals- und Rückgratswirbel, Kitzel an allen möglichen Stellen des Körpers, so an den Augendeckeln, den Ohr-, Nasenlöchern und Rachenhöhle, Genitalien usw. Sein Herz ist beständiges Spielzeug anderer und erlaubt man sich oft so viel damit, daß der ganze Körper an einer Versenkung leidet. In letzter Zeit begleiten heftige, wehende, intensive Brust-, Kreuz- und Rückenschmerzen sein Dasein und aus Rache, daß man darauf gekommen ist, daß das kein natürliches Leiden sei, mußte ich durch Verständigung gemeine Vorwürfe hören, Foltern genügten nicht, unangenehme Gerüche wurden übertragen, nächtelang Leichengeruch, Krankenhausluft, weiblicher Genitalgeruch, Aftergase, Geruch nach Gespieenem, Schnapsgeruch, und überträgt man meiner Person sogar die Katzenjammer auf elektrische Art. Auch der Geschmackssinn ist mir nicht vergönnt. Trinke ich meine Milch, so bringt man mir intensive Säuere, welche mittels Elektrizität durch die Zähne durchprickelt – An den unteren Füßen herrscht beständig elektrische Strömung, oft auch durch den ganzen Körper ... tägliche Abnahme des Appetits durch Auswechseln der Magensäure, außerdem Auswechseln der Rückenmarkssubstanz, Auswechseln des Ätherleibes (Puppensystem) mithin Seelenaustausch, alles mittels Elektrizität bezweckt. – In letzter Zeit bin ich mit ununterbrochenem Eintreiben von Afterwinden (Verepidemien) belästigt, so daß sich eine Krebsübertragung im Mastdarm, sowie im Rachen, woselbst ich das Brennen einer bejahrten Person fühle, sehr bewährt. – Unterfertigter bestätigt, daß er 3-4 Wochen kaum gehen kann, nachdem er beinahe ununterbrochen mit Leichen und Eis verbunden im elektrischen Stromkreis zappelt und Nächte circa 1000-10 000 m. W. tausend bis zehntausend Afterwinde in den Körper getrieben erhält« usw. Er unterschreibt meistens: »Niveau, Welt-Natur-Leiter«.
Zwei Hauptvorstellungen heben sich aus diesem tollen Gewirr von körperlichen Reizzuständen, Gefühlsreaktionen und Wahnvorstellungen heraus, die auch künftig stets den Mittelpunkt seines Weltgefühls bilden: ein elektrischer Stromkreis, von einem in seinem Geburtsort oder in der Anstalt aufgestellten Dynamo gespeist, verbindet ihn mit zahlreichen Personen und überträgt auf ihn alle die scheußlichen Erlebnisse, die er nicht müde wird zu schildern. Er ist durch das Dauerbad für die elektrischen Wellen empfänglich gemacht worden, die sich durch die Luft auf ihn zubewegen. Das wäre die mechanische Grundlage, die formale Seite seines Wahnsystems, die vorwiegend aus typischen Einzelheiten besteht. – Viel interessanter und reicher ausgebaut ist die andere, inhaltlich-psychologische Seite: was geschieht ihm durch den elektrischen Stromkreis, in den er eingespannt ist? Mit großer Konsequenz ordnet Seil körperliche Empfindungen, triebhafte Regungen (Wunsch-Phantasien) und die eigentlichen Wahnvorstellungen zu einem System, das sich völlig auf seine sadistisch-masochistischen Bedürfnisse zuspitzt. Die zentrale Vorstellung ist, daß er leiden muß, damit andere Lust erleben. In diesem Leiden aber findet er in Wahrheit seine Lust. Die Ergänzung dieser masochistischen Komponente seiner perversen Neigungen durch eine sadistische findet er dann in seiner zeichnerischen Tätigkeit und den Begleittexten zu seinen Bildern.
Was die realen Vorbedingungen zu seinen Wahnvorstellungen anbelangt, so ist in seinen Aufzeichnungen öfters die Rede davon, er habe sich in einem Bordell peitschen lassen, und das sei seinen Vorgesetzten zu Ohren gekommen. Wie weit das stimmt, läßt sich nicht mehr feststellen. In einem Schriftstück, das leider nicht datiert ist, aber nach der Schrift aus der Zeit um 1912 stammen mag, stellt Seil sich plötzlich ganz kritisch zu seiner Persönlichkeitsentwicklung und gibt so ausgezeichnete analytische Urteile zum besten, wie man es bei so weit zerfallenen paranoiden Demenzen nicht oft findet. Das ganze Schreiben ist mit fünf Farbstiften in verschiedener Kombination unterstrichen. Die Hauptstellen daraus lauten: »An die Psychiatrische Klinik. An das Ministerium für Verkehr. Ob ein Staat für unnormal in Betracht zu kommen hat, oder der Unterfertigte? War es doch des Unterfertigten verstorbener Vater Kaspar Sell, k. Oberbauführer, aus R. sein größter und täglicher Kummer, welchen er mit vielen seinen Kollegen und Freunden immer wieder in Gegenwart seiner Person besprach und vorhielt, daß er zu schüchtern sei. Unterschriebener sagte sich allerdings selbst, daß man besser im Narrenhaus aufgehoben wäre, solange man bei sich selbst und den intelligentesten Leuten merkt, den lebensüberdrüssigsten aller Fehler, ›die Furcht vor dem anderen Geschlechte‹. Mit 16 Jahren sagte ich mir allerdings selbst schon, daß man wohl mit keiner anderen Dame in intime Beziehung treten kann, wegen Körperschändung. Deshalb war man und ist man jetzt stets des Lebens überdrüssig, weil man für ein Weib nicht eine Nacht während 37 Jahre Gelegenheit hatte, und man ohne Weib, wenn die Eltern längst gestorben sind, überhaupt nie lebensfähig sein kann, als man deutlich fühlt, wie man unter dem Volke ohne Ruhe und Anhalt schwimmt, also nicht wurzelt und man ja doch auch nicht geboren sein könnte, wenn das weibliche Geschlecht gänzlich entbehrlich wäre. Wenn man sich durch 23 Jahre, also 23 mal 365 = 8395 mal nach Ehe sehnt, oder wenigstens einmal im Leben das Recht für eine Beischlafnacht zu haben wünscht, kann man doch nie Ruhe finden. In der Zeitung stand einmal von einem Künstler, welcher in einem Wahn lebte, daß er nie heiraten kann, weil er nicht im Stand wäre, eine Frau zu ernähren. Woher kommt es, als von der schrecklichsten aller Krankheiten, welche die Ärzte selbst haben und andern auch nicht helfen können, ›die Furcht vor dem anderen Geschlechte‹. Wie kann dann ein Beamter dienstlich tauglich sein, wenn er, wie jeder Tanzlehrer von seinem Kurs beweist, diejenige Dame, welche ihm gefällt, nicht einmal für Tanz, viel weniger für lebenslängliche Fütterungskosten heranziehen kann.«
In demselben Sinne äußerte sich Sell auch kürzlich noch mündlich. Interessanter als dieses Problem des Sexuallebens in der Anstalt, das viele Kranke und manche Ärzte sehr ernst nehmen, ist die Selbstschilderung seiner jugendlichen Schüchternheit, als Grundlage für die späteren Triebabweichungen, zumal da die objektive Schilderung von den Angehörigen völlig damit übereinstimmt. Das heißt also, daß die perverse Komponente nicht etwa in der Krankheit als ein Symptom unter anderen entstanden ist, sondern im Keime bereits vor der Krankheit psychologisch erfaßbar ist, selbst wenn die entsprechende Betätigung nicht glaubhaft wäre.
Ein anderes Dokument ist deshalb besonders wertvoll, weil es diesen von Perversionen geplagten Menschen von einer ganz anderen Seite zeigt: mit dem stillen Pathos eines Weltweisen sucht er seine Wahnerlebnisse als religiöse Erleuchtungen nachzuweisen. Herausgelöste Sätze könnten ohne weiteres in anderem Zusammenhange als Muster gläubiger Versenkung dienen. Gerade weil die Kritik des Laien sich gern an solche Sätze heftet, seien sie zitiert, da über die Krankheit des Mannes, der sie schrieb, wohl niemandem Zweifel kommen können: »Für jeden Besucher der Anstalt gilt die Frage: »Haben Sie Erscheinungen gehabt oder haben Sie Stimmen gehört?« Das will dem Arzt ein maßgebendes Symptom sein, eine Krankheit beurteilen zu können. Ich erlaube mir die Herrn Frager in Ihrem eigenen Interesse zu bitten, wenn Ihnen wirklich jeder Glaube an ein höheres Wesen entschwunden ist, oder von jeher gefehlt hat, mit den Erscheinungen in medizinischen kurzweg Halluzinationen (Irrtümer) sich entweder eingehend zu beschäftigen, oder jedes Befragen in dieser Hinsicht zu unterlassen, wenn Ihnen keine anderen Symptome zur Beurteilung des Geisteszustandes zu Grunde liegen – – Wer nicht glaubt an überirdische Mächte, der wird auch niemals gewünschte Erscheinungen haben oder gar keine, und wer keine Erscheinungen hatte, der besitzt auch keine Beweise zu seinem Glauben und wird nur zweifelhaft, ohne Fundament weiterbauen, und so lange Ihn das menschliche Dasein begleitet, wird er in die für Ihn tote Nacht schauen, ohne daß ein Geräusch eines in schwerer Seide gehüllten Engels sich über Seinem Bette beugend Ihm das Vorhandensein einer hohen himmlischen Macht beweisen kann, viel weniger, daß Sich Ihm die hohe Krone, welche Tag und Nacht über alle Menschen schwebt, sich für Ihm entfaltet. Ich glaube es recht gerne allseits das Verlangen zu haben, wissen zu wollen, wie Ihre unsichtbaren Schutzbegleiter und überirdischen Weltenherrscher aussehen. Ich bin aber der festen Überzeugung, daß event. Beneider bald den Wunsch fallen ließen, wenn sie wüßten mit was für enorme Leiden derartige Begegnungen zusammenhängen. Ohne große Leiden gibt es auf Erden keine große Freuden. Es läßt sich leicht begründen, warum nur Menschen, welche gewöhnt sind, zwischen Leben und Tod mit einem Lächeln zu ringen und ohne Furcht Ihrem Ziele entgegensehen können, hauptsächlich durch angenehme Erscheinungen, Anzeichen und Besuche beehrt werden – –
Nur derjenige, welcher sich Erscheinungen im krankhaften Zustande gewürdigt hat, wird auch Erscheinungen im gesunden Zustande entgegensehen können. – Aber bei dieser Wissenschaft, die höchste aller auf Erden, das Erwerben von Erscheinungen, das Wirken von Wunder und Einsicht in das Verborgene zu ergründen, das mag demjenigen Menschen, welcher nur für seinen irdischen Beruf tätig ist, stets ein unzugängliches Tor bleiben – – Ich bestätige nur, daß in Ungestörtheit überirdische Wesen nahbar sind und nicht als abstrakte Erscheinungen, sondern als solche, welche aus dem Abstrakten unter Geräusch sich in lebende konkrete Engel verwandeln. Ich würde mich schönstens bedanken, wenn ich im Glauben mich einer Verehrung hingebe und dabei auf jeden Beweis von Erscheinungen verzichten müßte – – Welch ein Trost war es mir einst als ich erkrankt aus dem Bette stieg, ein rot durchglühtes Herz, dem ewigen Lichte gleich mit einem goldgeschliffenen Degen durchzogen auf die Dauer von circa einer halben Minute langsam und gleichmäßig mir gegenüber entstieg. Nicht genügend war mir der Beweis. Daß es kein leerer Wahn, als drei Tage danach ein Schild mit grellen goldgelben Lichtgrenzen in Kirchenschrift mir eröffnete, »Die Natur bietet dem Menschen die Schlüssel zum Himmelreich.« Ich war erstaunt über diesen Satz, kann mich nicht erinnern, denselben schon gelesen zu haben. Der Grundstein zu meiner Religion war die Ankunft des durch Geräusch erschienenen Engels.
Das gleiche ist es mit dem sogenannten Stimmenhören, welches die Herrn Ärzte ebenfalls als krankhaft hinstellen wollen. Gibt es doch nichts interessanteres als die Sprache jeden Tieres zu verstehen, sowie aus allem, was Reibung verursacht, Worte zu entnehmen, so z. B. dem Rauschen der Baumblätter, der Quellen und Flüsse, dem Wehen des Windes und Sturmes, dem Donner bei einem Gewitter, dem Betreten des Kieses und Fußbodens, dem Klange der Kirchenglocken und den Melodien jedes Musikinstrumentes, sowie jeder Bewegung der Muskeln seines eigenen Körpers selbst, das heißt, es existiert ja kein toter Körper für mich, sondern jeder Körper, selbst der Stein als Aufbau von Atomorien spricht, weil ja der Stein nur eine Zusammensetzung, eine Vereinigung von Atome ehemaligen Lebens bildet, deshalb ist es durchaus nicht lächerlich, sondern für Gott höchst anerkennenswert, daß Heiden den Stein angebetet haben, weil der Stein nur für die meisten Menschen stumm ist, aber von Gott selbst als organischer Körper zu betrachten ist, der ja bekanntlich ein längeres Leben nachweisen kann, als jeder andere Körper, warum wird jeder Chemiker sich erklären können.
Abgesehen davon ist es traurig einem Menschen das Recht und die Ehre abstreitig machen zu wollen, wenn er beweisen kann, daß er schon viele Wunder gewirkt hat und ihm jeder Tag neue erscheinen läßt, was er schon von Jugend auf beweisen kann und auf Verlangen gerne Auskunft gibt, nachdem derselbe das Wichtigste schon im Voraus beweisen kann – – Wer seinen Schöpfer mehr liebt und sich selbst verachtet, dem gibt er in die Linke Amors Wage, in die Rechte Niveau's Peitsche in deren Besitz keine Nacht zu dunkel ist als daß sich ihm nicht jedes Weltgeheimnis enthüllen werde. Vom Jenseits bin ich anerkannt, Diesseits will man mich verachten.
Es wurde doch von jeher gelehrt, daß Gott überall ist, und an allen Orten und deshalb will man es doch nicht anerkennen, wenn Unterzeichneter doch nachweisen kann, daß er regieren muß für das Diesseits und Jenseits, denn wenn er alles hören und sehen kann, was vor sich geht, so unterliegt es doch keinem Zweifel mehr, daß er nicht für das Irrenhaus geboren ist, sondern man sich höchstens für seine Wissenschaft interessieren kann, und das ist diejenige Wissenschaft, welche auch Jesus Christus besaß, und ich glaube doch, daß sich das irdische Gesetz und die irdischen Richter sehr getäuscht haben, wenn sie glauben sie haben das Recht die Ceremonien Gottes lächerlich zu machen, nachdem sich doch alles begründen läßt. – Niveau, Freiherr von und zu Marmorkron.«
Aus der Fülle von Betrachtungen über seine Ausnahmeerlebnisse seien nur noch einige Sätze angeführt, die sich auf Gedankenübertragung, Beeinflussung u. dgl. beziehen:
»Erlaube mir hiermit einen kurzen Auszug in Bezug auf dem Gebiete der Übertragung von Gedanken, Worte, Bildern und Gefühl zu unterbreiten. Bemüht man sich doch schon lange Zeit auf welche Weise Traumvorstellungen zustande kommen und dürfte diese Wissenschaft als aufgeklärt gelten, nachdem man durch Elektricität in Gedanken- und Gefühls Verbindung treten kann, so daß man sich in der Weise auf gewisse Entfernungen so gut mit einander verständigen kann, als würde man sich gegenseitig laut aussprechen und ist man sogar im Stande das Gedankenbild aufzunehmen, was andere sich in ihrem Gedankengange vorstellen. So ist es mit den Träumen, die beruhen stets auf der Vorstellung und Übertragung einer nicht schlafenden Person, nachdem beim Schlafe die Gehirntätigkeit stets einer unwillkürlichen Funktion unterworfen ist; die meisten Menschen träumen ja während des Schlafes unaufhörlich, nur ist es der Fall, daß sie sich ihrer Träume nicht erinnern können oder wollen und der Gedankengang einer Person selbst ist immer mehr oder weniger nur eine Geistesbeeinflussung der Mitmenschen. Sobald der Mensch im Stande ist gar nichts mehr zu denken, was das Schwierigste ist, wird er beobachten daß er auch lenken kann und in dem Falle für einen, mehrere oder für seine ganze Umgebung regiert und kann sich der Betreffende Gott nennen, nachdem das Sprichwort heißt: »Der Mensch denkt und Gott lenkt.« Man kann sich auf diese Weise von einem Orte aus mit seinem ganzen Bekanntenkreis unterhalten oder dessen Gedankengang mit verfolgen und sogar in geschlechtliche Gefühlsverbindung treten, sodaß es vorkommt von Zeit zu Zeit in beständiger Wollust sich zu befinden (und erklärt sich auf diese Weise die indirekte Empfängnis einer Jungfrau) oder das Gegenteil, daß sobald eine Person leidend ist, eine andere dafür das Wohlgefühl erhält und sich die Gefühlskraft, welche für Leiden und Freuden in Betracht kommen kann, sich gegenseitig ausgleicht und das erklärt sich sobald eine Menge Menschen in Aufregung sich befindet und unter Leiden und Chikane sich abquält; andere, welche das Gebot einhalten: »Mensch, ärgere dich nicht« das gegenteilige, ein Bad der Wollust erhalten –«
Der Stromkreis, in den er eingespannt ist und der ihn mit der ganzen Welt verbindet, trägt also hauptsächlich folgende Erlebnisse: Gedanken werden ihm zugeführt und abgezogen. Er hört alles, was vorgeht in der Welt und vermag deshalb mehr zu durchschauen als andere. Auch kann er die Welt lenken, wenn er will. Aber andererseits ist er den Stromleitern und anderen Personen preisgegeben, indem diese sich seiner »Wissenschaft« bemächtigen und – was schlimmer ist – ihn ausnutzen. Alle körperlichen Qualen entstehen dadurch, daß andere von seiner Lebenskraft leben. Teils sind es Frauen, die ihn sexuell ausnutzen, teils Kranke, besonders aber hochstehende Personen: »Geisteskranke sind Medien und Opfer elektromotorischer Befriedigung bejahrter Hof-Personen« – diese Bekanntmachung schlägt er eines Tages im Krankensaal an, oder: »Seine Jugend mit dem Alter – sein Leben mit dem Tod – substanziel vertauschen – zu lassen, lautet das Amtsgeheimnis der Vorsteher«. Auf Grund dieser Erlebnisse fühlt er sich berechtigt, auf einige Throne, ja, auf den päpstlichen Stuhl, Anspruch zu machen, da er auch für Leo XIII. als Medium gedient habe, dieser daher, wie die Fürsten, auf seine Unterstützung angewiesen sei.
Man wird aus diesen schriftlichen Äußerungen Sells zur Genüge entnehmen, wie er durch sein Wahnsystem vollkommen ausgefüllt ist, so daß die Schilderung seiner Persönlichkeit mit gutem Grunde dahinter zurücktritt. Wir erfuhren von ihm selbst, wie von seinen Angehörigen, er sei von Jugend auf ein stiller, schüchterner Mensch gewesen. Aus seiner Beamtenzeit wissen wir gar nichts, als daß er mit seinen Vorgesetzten nicht gut stand, weil er sich von ihnen beeinträchtigt fühlte. Seine Intelligenz ragt entschieden über den Durchschnitt hinaus. Besonders seine psychologischen Fähigkeiten sind durchaus ungewöhnlich. Aber auch die Beurteilung von sozialen und staatlichen Einrichtungen verrät, wenn man die Verschrobenheiten berücksichtigt, eine gewisse Sicherheit im Herausholen des Wesentlichen. Den Schlüssel für sein affektives Verhältnis zu den Menschen und zum Leben überhaupt hat er in der zitierten Selbstanalyse gegeben. Für die Diskussion über die psychologisch einfühlbare Entstehung der Psychose, besonders auch über den Zusammenhang zwischen Analerotik und Paranoia (Freud), wird der Fall an anderer Stelle noch heranzuziehen sein. Die Furcht vor dem anderen Geschlecht ist danach die Grundlage seiner depressiven Konstitution. Aber nicht echte Triebinversion liegt vor, sondern – wie sich bald zeigt – sadistisch-masochistische Perversion, und diese beherrscht sein Gefühlsleben vollkommen. Wie weit seine Phantasie erst in der Psychose frei geworden ist, läßt sich nicht sicher sagen. Sein hervorstechendster Zug heute ist das paranoische Mißtrauen. Er traut der Persönlichkeit des Besuchers nicht, weil sie »wahrscheinlich mit diplomatischen und Polizei-Angelegenheiten verbunden« sei, woraus ihm Übles erwachsen könnte, wenn er offen redete. Der hellblonde, sehr blasse Mensch, der wegen seiner Reizbarkeit fast dauernd im Einzelzimmer im Bett gehalten wird, ist daher besonders unzugänglich. Wenn man ihn schließlich zum Reden gebracht hat, so schränkt er jeden Satz mit Bedenklichkeiten ein. Auch über seine Arbeiten spricht er sehr zurückhaltend und will sie am liebsten als gleichgültigen Zeitvertreib hinstellen, außer seinem »sadistischen Lebenswerk«.
Dies ist ein äußerst pedantisch angeordnetes dickes Faszikel in Quartformat, umständlich mit weißen und schwarzen Fäden in zwei Deckel eingeschnürt, die wiederum durch bewegliche Klappen und aufgeklebte Figuren geschmückt sind. Innen sind 20 Unterabteilungen von je 10-50 Blättern in Papiermappen gelegt, die feierliche Aufschriften in bizarrer Druckschrift tragen. Eine ganze Anzahl von Verzeichnissen der Einzelgruppen und des Ganzen liegt bei. Die Gruppen bestehen jeweils aus einer Serie Zeichnungen und sehr viel Text, der mit sehr gleichmäßiger, aber doch schwer leserlicher kleiner Schrift in Bleistift geschrieben ist und vorwiegend ermüdend langatmige Schilderungen von Prügeleien und wollüstigen »Reiz-Chikanen« enthält Diese geschehen ausschließlich zwischen weiblichen Personen, und zwar meist eingekleidet in das Milieu von Erziehungsinstituten oder auch Zuchthäusern, zu denen architektonische Pläne bis ins einzelne ausgearbeitet beiliegen. Eine Hauptrolle spielen dabei Bade-, Turn-, Klosetträume mit sehr komplizierten Einrichtungen und Apparaten. Das »Lebenswerk« ist in jahrelanger Arbeit, vorwiegend wohl in der Zeit 1910-1914 entstanden, und zwar, wie Seil ja wiederholt versichert hat, als eine Art Surrogat sexueller Betätigung. (Vgl. Lebensbeschreibung.)

Fall 180. Abb. 146. »Zuchthaus-Chikane« (Bleistift). 17x21.
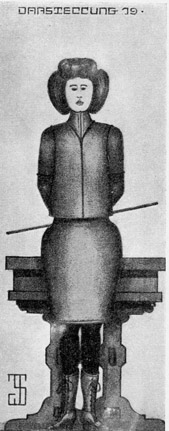
Fall 180. Abb. 147. Weibliche Figur (Bleistift). 7x17.

Fall 180. Abb. 148. Zwei Figuren (Bleistift). 13x19.
Die Zeichnung »Zucht-Haus-Chikane Luccas« Abb. 146 ist das Deckelblatt einer Gruppe des Lebenswerkes. Es repräsentiert gut jene Mischung von technisch-nüchterner Präzision, worin der Bauzeichner sich äußert, und der Schauerphantasie des Sadisten, vielleicht durch halluzinatorische Erlebnisse noch bereichert. Jene technische Nüchternheit läßt zunächst die wirklich grandiose Phantastik gar nicht zur Geltung kommen. Handelt es sich doch darum, daß ein Wandpfeiler zwischen zwei Spitzbogenfenstern oben in eine halbmenschliche Maschinerie übergeht und, während der Pfeiler sich krebsartig bäumt und die Fenster sich zueinander neigen, mit starren Metallarmen eine Frau am Gürtel packt. Die hängt halb verbogen über einer Urne, Peitschen in den Händen. Mit den Fenstern schaukeln Bogenlampen, die seltsamerweise daran haften, und an einer von ihnen ist ein ganzer Strauß von Prügelinstrumenten befestigt. Bei weniger lahmer Gestaltung hätte das ein Bild voll unheimlichen Grauens gegeben. Immerhin behält es auch so eine Spur davon.
Das Prügelmilieu zeigt Abb. 147 in einer besonders geschlossenen Weise, gerade weil nicht szenische Darstellung, sondern nur die eine Figur als Inbegriff gewählt ist. Derartiger kleiner Blätter, meist mit gespreizten Stellungen oder Andeutung von Quälhandlungen, gibt es einige Dutzend. Auf Abb. 148 ist für die Person rechts eine der nach bestimmten Riten verlaufenden Einschnürungen gemeint, die linke hockt auf einem der vielen Apparate, die Sell unermüdlich für alle möglichen greulichen Zwecke erfindet. Die gewaltsame, eckige Schrägstellung der beiden Gestalten ist wohl nicht nur auf eine gewisse Ungeschicklichkeit zurückzuführen, die ihn in der ersten Zeit gerade bei der Darstellung von Menschen im Räume behinderte, sondern diese exaltierte Gebärdensprache liegt gewiß in der Absicht des Zeichners.
Auch bei Sell müssen wir wieder eine Entwicklung seiner bildnerischen Fähigkeiten im Verlaufe seiner Erkrankung konstatieren, wenigstens für die ersten zehn Jahre. Dafür ist Abb. 149 ein Beweis. Das Blatt stammt aus den letzten Jahren, während die vorigen drei an den Beginn seines Aufenthaltes in der Anstalt gehören. Hier sehen wir ihn nun im vollen Besitze seiner Ausdrucksmittel fast dasselbe Thema zu sehr respektabler Lösung bringen. Es handelt sich wieder einfach um dies schwül-gespreizte Gebaren zweier Chikaneweiber, die etwa einem nonnenhaften Neuling gegenübergestellt werden. Die Farbenpracht des Hintergrundes hat etwas Branstiges, das abstoßend brutal wirkt und das feine grüne Gewand der Verschleierten fast erdrückt.
Der »Naturaltar« (Abb. 150) zeigt nüchternste Tektonik, ganz überwuchert von phantastischem, buntem Detail. Sell ist der Meinung, man solle wieder Menschenopfer einführen, wie in alten Zeiten, das könne der Menschheit nur dienlich sein. So läßt er vor dem Altar eine nackte Frau zur Opferung knien. Hinter ihr steht die Richterin oder Priesterin in kapriziösem Gewande mit riesigem blutrotem Kopfputz. Blutrot erglüht auch die Weihrauchschale und die Madonna. Die drei roten Stellen beherrschen das überaus bunte Vielerlei von Pflanzen, Gefäßen, grüngeflecktem Gestein. Unten links aber reitet auf großer grauer Schnecke ein tiefrotes Männchen – das »Blutmännchen zählt die Sekunden« sagt Sell lakonisch – ein Märchenmotiv, das trotz seiner Vieldeutigkeit von einer grauenhaften Drastik ist in dieser Sphäre der Opferung.

Fall 180. Abb. 149. Sadistisches Motiv (Buntstift). Originalgröße.
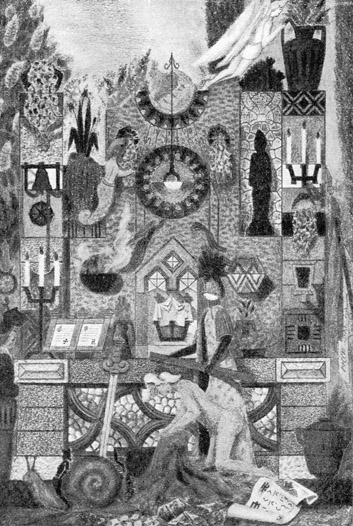
Fall 180. Abb. 150. »Naturaltar« (Buntstift). 15x22.
Abb. 151 hat besondere Bedeutung, weil sie die akute halluzinatorische Erregungsphase illustriert, die Sell in den ersten Monaten seiner Krankheit durchgemacht hat. Er erklärte das Bild 1920 so: »Das ist das Verbrechen, das an mir verübt worden ist – ein ganzes Volk vernimmt meine Stimme und weiß, daß ich seit 13 Jahren hier bin. Aber ich kann ja nicht vor Gericht und prozessieren über diese Angelegenheit, obgleich ich ein dutzendmal begründete Anträge gestellt habe. So was haben die Päpste auch anderen angetan, wenn sich jemand gegen sie vergangen hatte. Auch Hofrat Kraepelin hat etwas Ähnliches durchgemacht, wie ihm damals die Hautfetzen an der Backen heruntergehängt sind, das habe ich genau beobachtet. Links unten ist meine Person im Bad, das ist schrecklich, was man da durchmachen muß. Zum Erleben war's nicht und daß man nicht sterben könnte, wurde man mit einem Walfisch verbunden. – Das ganze Verbrechen ging vom Hof aus, das weiß ich genau.« (Walfische?) »Das ist schwer zu erklären, das ist halt eine Stützangelegenheit durch Tiere. – Es handelt sich um die Porenernähung des Universums, jede Pore ist das Arschloch einer anderen Person. Da liegt man fünf Tage im Bad und ein altes verdorbenes Essen schwimmt oben drauf, die Salatsäure dringt durch die Poren ein, dazu die Orangensäure, wenn man eine Orangenschale auf den Kopf kriegt – bespritzt man eine Stubenfliege damit, macht sie einige Umdrehungen und stirbt. Das Universum überstülpt sich, so daß die ganze Außenfläche eine Magenfläche wird. Wenn man das mitgemacht hat – der Universumstulp ist schlimmer als ein sterbender Christus. – Rechts unten liegt eine kleine Puppe in Hanf gewickelt. Das kam daher, man hat mich vorher beeinflußt, in eine Wasserschüssel zu urinieren, da haben die Damen die abgespulten Puppen hineingesteckt und dann in die Scheide. – Das ist damals viel vorgekommen.« (Die Kette?) »Die ist da, um zu beweisen, daß Stacheldrahtzeremonien wie ein Kalender im Dauerbad abgehalten worden sind; darüber der Eisbär ist mehr eine theologische Erscheinung. Der hat dortmals in E. in den Kleiderfalten gesessen mit Glacéhandschuhen. Es wird wohl eine Entfaltung der Kleider gewesen sein. In der Jugend hab ich schon mal eine solche Erscheinung gehabt. Da saß auf einmal eine Betschwester an meinem Bett, da hab ich mich vor Angst nicht zu rühren getraut.« (Der Ort?) »Da bin ich doch in der Klinik gewesen, wegen der Sittlichkeit, haben sie gesagt. – Die haben schön reden von Sittlichkeit, wo die Dachplanken sich gehoben haben durch die Verbrechen, – wo die Ätherleiber sich vom Experiment durchs Dach gehoben haben. – Die Partie links unten ist ein Schiff, darin eine Arena mit Zellen zum Sammeln der Ätherleiber – man kann das Ganze auch als Auge sehen – wodurch höhere Persönlichkeiten geschützt werden. – So wurden Tiere angewandt, um mich zu schützen, daß ich leben mußte. –

Fall 180. Abb. 151. »Universumstulp« (Buntstift). 15x22.
Oben in der Luft ist Papst Leo XIII. Der ist mir theologisch erschienen. Für den hab ich halt eintreten müssen, weil er dieselben Symptome hatte, den Universumstulp und diese Sachen. – Der fuhr durch die Wolken, daneben bin ich im Schatten, ihn theologisch schindend. Die blauen Figürchen sind sämtlich Monarchen, die hab ich nicht so genau treffen wollen, es ist nur eine Notiz und mir auch erschienen. Auch die Sonne ist nur eine Notiz, weil man dafür eintreten muß, denn sie ist der Fürst für geschlechtliche Angelegenheiten. Die kleinen Figuren zeigen die Affäre, daß man bald ins Wasser, bald ins Feuer muß und die elektrischen Radtouren spürt. – Die Kugel stellt die Welt dar, auch nur als Notiz.« –
Suchen wir uns nun die Komposition des Bildes zu vergegenwärtigen, so müssen wir wohl annehmen, daß Sell, als er zu zeichnen begann, im großen und ganzen wußte, was er etwa darstellen wollte. Wir möchten meinen, er habe mit dem Dauerbad in der Höhle begonnen, weil dieses im Mittelpunkt seiner Erinnerung an jene Zeit der Körperqualen steht, und habe von hier aus die anderen Szenen lose angereiht. Dabei mag, je mehr er sich dem oberen Teile des Bildes näherte, um so mehr der Fachzeichner in ihm sich geregt haben, der dann für einen guten Abschluß nach oben sorgte.

Fall 180. Abb. 152. »Sonnendrachen« (Buntstift). 14x22.
Bei dem »Sonnendrachen« Abb. 152 ist man sogleich geneigt, an eine Halluzination als Anregung zu denken – aber Sell weist das ganz ruhig ab. Ja, er sagt sogar selbst: »das könnte aussehen, wie wenn eine Halluzination gemalt wäre, das ist aber nicht der Fall, sondern die Frau ist rot gemalt so gut, wie ich sonst manchmal eine blau oder grün male.« Nun ist mit dieser Ablehnung ja gar nichts anzufangen, weil sie ebensogut wahr wie falsch sein kann. Zweifellos macht gerade dieses Blatt einen besonders stark schizophrenen Eindruck. Der Regenbogen, der aus einer Riesenbohne wie ein Blitz auf eine Frau niederfährt, die blutrot oder in Flammen aufleuchtet und dabei mit erschauerndem Gesicht zusammensinkt – der seltsame Adler zu ihren Füßen – die Spiegelung des Regenbogens in abgeschnittenen, perspektivisch rasch sich verjüngenden Streifen auf dem Rasen, die bieder und kleinlich durchgearbeitete winzige Fabrik im Hintergrunde – das alles hat jene pointenlosen, lockeren Beziehungen zueinander, die wir immer wieder als besonders charakteristisch für Schizophrene fanden. Aber es hat auch, zumal im starkfarbigen Original, jenen Reiz des in aller Fremdartigkeit irgendwie Ansprechenden, wenn nicht gar Überzeugenden, wenigstens in den Hauptmotiven. – Einfacher zugänglich ist das Stadtbild Abb. 153, das an manche Zeichnungen von Ensor und Kubin erinnert mit seinem hohen Einblick in enge Straßen, auf denen winzige Menschenschemen sich bewegen. An den Häusern sieht man den recht sterilen Kunstgewerbler wieder im Streit mit dem schizophrenen Spieltrieb.

Fall 180. Abb. 154. Motivierte Darstellung Gottes (Buntstift). Originalgröße.

Fall 180. Abb. 153. Stadtbild (Buntstift).16x21.
In neuerer Zeit hat Sell eine deutliche Tendenz, von der Darstellung realer Gegenstände zu lassen und sich mehr und mehr abstrakten Formen zuzuwenden, die teils auf ornamentale Reminiszenzen aus seinem Berufe hinauslaufen oder Abwandlungen davon sind, teils aber auch höchst originelle Neuschöpfungen werden. Am seltsamsten mutet Abb. 154 an. Er nennt das kleine Bild »motivierte Darstellung Gottes« und hat ganz das gleiche Motiv ein anderes Mal mit einem mehr realistischen Teufel kombiniert. Seine Erklärung dazu lautet so: »Das ist Gott, der aussieht wie ein Affe mit einer Purpurmütze; rechts ist sein Kristallauge, mit dem er in den Weltenraum schaut; unten sein Afterauge, mit dem er auf die Erde blickt.« Den erdbeerförmigen gelben Körper rechts unten nennt er eine Lampe, wie sie in seinem Zimmer an der Decke hinge. Phallische Bedeutung lehnt er gleichgültig ab. – Ein Beispiel für die abstrakten Phantasien, in denen Ornamentik, tektonische Körper wie Kandelaber, ferner Schmetterlinge und ähnliches wenigstens angedeutet sind, aber ganz ungerichtet durcheinander taumeln, gibt Abb. 155. Die meisten Formteile sind aufgeklebt. Das Blatt heißt: »Jenseits-Auferstehungs-Myriade«. In letzter Zeit hat Sell vorwiegend derartige grelle Farbspielereien angefertigt, von denen manche einen gewissen Reiz besitzen, während andere recht lahm und albern wirken.
Was uns an diesen Bildern fesselt, ist überwiegend das Stoffliche. Sells bildnerische Fähigkeiten sind so sehr durch seine bauzeichnerische Vergangenheit bestimmt, daß man diese fast nie vergessen kann. Und deshalb ist das Gestaltungsproblem bei ihm weniger ergiebig. Die psychotischen Erlebnisse treten allerdings unzweifelhaft auch bei ihm wieder als befruchtendes Moment auf. Nach zehn Jahren zeichnet er mit Buntstiften eine Reihe von starkfarbigen, vielleicht halluzinatorisch beeinflußten Bildern, die sogar auf gutem künstlerischen Niveau stehen. Und schließlich wendet er sich abstrakten Farbkompositionen zu, um auch darin bemerkenswerte Blätter zustande zu bringen. Gerade die Arbeiten dieser letzten Gattung verdienen wegen der krassen Mischung nüchterner traditioneller Formmotive mit entschiedener Tendenz zu völlig freier willkürlicher Scheinordnung eine aufmerksame Betrachtung und einen Vergleich mit entsprechenden Versuchen abstrakter Kunst. Man wird dann unschwer finden, wieviel näher die Verbindung selbst ganz konsequent gegenstandsloser Malerei mit der Tradition ist als Sells derb-buntes Spiel. Nur in solchen Vergleichen vermag man durch Hingabe an die innere Rhythmik im Linienverlauf und an den Farbzusammenklang Qualität im Sinne freier Tradition von mehr oder weniger barbarischer Willkür zu trennen, wenn auch äußere Ähnlichkeiten zunächst verwirren. Womit freilich noch nichts darüber ausgemacht ist, ob man etwa unter einem bestimmten Gesichtspunkt jenes unbefangene Willkürprodukt als unmittelbaren Ausdruck von Seelischem ernsthafter anschauen möchte als manches vielleicht nur virtuose Kulturprodukt.

Fall 180. Abb. 155. Jenseits-Auferstehungs-Myriaden (Buntstift). 11x27.
Der oberrheinische Kunstschlosser Franz Pohl, geboren 1864, stammt aus einer Familie, in der Geisteskrankheiten noch nicht vorgekommen sind. Der Großvater väterlicherseits wird als überreizter Mann geschildert; der Vater, ebenfalls Kunstschlosser, war dagegen eher ruhig, höflich und sehr zuverlässig, von einer für einen wenig gebildeten Mann ungewöhnlichen menschlichen Kultur. Die Mutter starb früh. Aus der Jugend des Pohl ist gar nichts bekannt. Er besuchte Volks- und Bürgerschule und lernte dann auf der Kunstgewerbeschule in München und Karlsruhe. 1893-1897 war er als Lehrer an einer Gewerbeschule angestellt und besuchte in dieser Zeit sechs Wochen die Weltausstellung in Chicago. Aus seiner Lehrerstelle soll er wegen seines höchst absonderlichen Verhaltens entlassen worden sein, Einzelheiten fehlen leider. Doch hat 1898 ein Verwandter angegeben, Pohl habe schon mit 16 Jahren Stimmen gehört. Er sei intelligent und gut veranlagt, von lebhaftem Temperament und energischem Willen gewesen, aber so überheblich und unverträglich, daß er sich mit jedermann verfeindete. In Chicago geriet er in Spiritistenkreise und schrieb seither in deren Manier vielerlei auf. Unter den Visionen, von denen andere erfuhren, waren z. B. zwei Köpfe, die ihm in die Augen schauten, oder ein Frauenkopf, der sich eng mit ihm verband und in ihm aufging.
1897-1898 lebte Pohl in Hamburg, arbeitete nicht, verbrauchte aber viel Geld, vor allem für Theater und Bordelle. Eine Lues hatte er 1894 durchgemacht, nach einer Angabe auch Gonorrhoe. Starke sexuelle Bedürfnisse werden in einigen Berichten betont. Im Winter 1897-1898 nahm der Verfolgungswahn rasch zu. Er bezog auf sich, was er im Theater hörte, verstand auf der Trambahn, wenn der Schaffner »fertig« rief: »er ist verrückt«. Schimpfworte erklangen von allen Seiten, die Leute bedrohten ihn, belauschten ihn durchs Schlüsselloch, so daß er die Wohnung wechseln mußte. In einem Angstraptus schwamm er (im Winter!) durch einen Kanal und wurde deshalb einige Tage in eine Anstalt aufgenommen. Dann fuhr er nach Hause, wobei er dem Zugführer die Zunge herausstreckte, weil dieser es ihm auch so gemacht habe. Zu Hause scheint er es nicht lange ausgehalten zu haben, denn im März 1898 wird er bereits aus einer Schweizer Anstalt einer heimischen Landesanstalt zugewiesen und im Mai dorthin übergeführt.
Im Vordergrund des Krankheitsbildes stand immer noch der Verfolgungswahn, in den er alsbald Ärzte, Wärter und Kranke der neuen Umgebung einbezog. Ferner halluzinierte er reichlich, angeblich jedoch nur auf dem Gebiete der Gehörs- und Geschmacksempfindung, nicht visuell. Aus Giftfurcht aß er zeitweise wenig. Obgleich er sich nicht für krank hielt und oft gereizt war, fügte er sich doch in den Aufenthalt und konnte auf der halbruhigen Abteilung ohne Schwierigkeit gehalten werden. Er benahm sich immer geordnet, beschäftigte sich mit Entwürfen für Schlosserarbeiten und schrieb Briefe, die jedoch schnell an Verständlichkeit abnahmen, so daß man nach kurzer Zeit kaum noch einen Sinn darin finden konnte. Auch seine Sprache wurde rasch verschrobener, sein ganzes Wesen matter, so daß man bald von Demenz reden mußte.
Schon 1900 scheint sein Verhalten dem entsprochen zu haben, was wir jetzt als schizophrenen Endzustand bezeichnen. Das kleine Männchen mit relativ großem Kopf, schwarzem Haar und Bart und dunklen leuchtenden Augen, bewegte sich ruhig, aber äußerst manieriert, sprach langsam, deutlich, geziert, mit freundlichem Lächeln und verbindlichen Gesten – ohne daß man viel verstehen konnte. Einige mystische Vorstellungen werden von damals noch berichtet: im Traum üben Personen einen Druck auf seinen Kopf aus, die Träume sind dann von solchen Personen abhängig – sie entstehen bei Personen, die im Gewissen belastet sind – im Traum befindet man sich in größerer Entfernung von Menschenansammlungen. Dies sind die einzigen Äußerungen, die wir von Pohl kennen. Im übrigen liegen nur kurze Notizen über sein äußeres Benehmen vor, und ferner das, was er selbst auf seine Zeichnungen, zumal auf die Rückseite, geschrieben hat. Wie nach der kurzen Schilderung seines Verhaltens um 1900 schon zu erwarten ist, bieten diese Schreibereien jedoch sehr wenig Aufklärendes über seinen psychischen Zustand. Anfangs kommen noch manchmal verständliche Sätze vor, die Wünsche, Mitteilungen, allgemeine Erwägungen enthalten. Aber schon 1903-1904 findet man selten mehr ein sinnvolles Satzstück. Dagegen greift ein hemmungsloser Systematisierungsdrang um sich. Das meiste, was er schreibt, ist in irgendein Schema gepreßt, z. B.:
I. Untergang v. Staates M
II. Stillstand s Dem.
III. Opfer h soz.
N IV. Index äußerlich versend P
III. wohl vereint geschichte
II. genuss bewegt geogr.
I. befried, bedarf sprache
Gott O. Ruhe Weltbürger +
Drei Beispiele scheinbar zusammenhängender Prosa mögen seine Ausdrucksweise zu verschiedenen Zeiten belegen:
Von 1900: »Während des Aufenthaltes der Anwesenden in Anforderung für Aufenthalt im Vorraum nach dem Frühstück vollzieht sich die geschlossene mit Zinkspänen fortgesetzt schädliche Bodenaufbereitung des Tagsaal etc.«
Etwa 1904: »Allgemeine Vortheile erhält die aufgelöste Ordnung. Frau erspart; hier bewachte der Meister die Kinder. Er schrieb: Es bilden Rückschritte sich aus der Familie heraus welcher Psychomanie = beschiss berechtigter erschuf. von beaufenthaltungen ist das Leben vorüber welches an mich erübrigt wurde, wenn verbesserlich, des Einsenders Reaktion vorüber geführt würde.«
Von 1919: »Das beste fortentlässig ver schauen vor ak kindliche Massenfriedens gelastige freie nach abschwirrenden Kopfenthauptender, Aufzucht dem 9ten bauchkehrlaute geboten.«
Aus früher Zeit, nach Papier und Schreibweise (mit Aquarellpinsel), wohl von 1901, stammen diese Verse, in denen das freie Schalten mit Vokalgleichklang unter Loslösung von der anschaulichen Vorstellung weit getrieben ist, ohne daß die dadurch entstehenden Plattheiten und Absurditäten den Klangreiz ganz entwerten könnten:
Feen, fegen
meiden neigen sich im Reigen
sehen drehen weiden neiden sich
gehen stehen reiten schreiten um Alles
wehenden Höhen entklommen
scheidenden Leiden herkommen
Weihgeschmückte irdische Leiber wähnen
tückische windige findige Weiberträhnen
tanzenden Reigen summend Geheul
zitternder Gräser schmachtender Düfte
steigen umschlossen den paarenden Trieben
In uns empor ein Odem des Lieben.
In den 22 Jahren seines Anstaltsaufenthaltes hat sich Pohl völlig in der Richtung weiterentwickelt, die er schon zuvor offenbar eingeschlagen hatte: sein Autismus resultierte nicht aus Kämpfen mit der Umgebung und mit Halluzinationen, sondern er glitt sozusagen immer tiefer hinein. Eigentliche Erregungszustände hat er kaum durchgemacht. Ganz selten wird im Krankenblatt vermerkt, er sei gereizt und momentan gewalttätig gegen Mitkranke, die ihn neckten. Während der ganzen Jahre hat er meist still für sich gezeichnet, geschrieben und musiziert. Die kargen Antworten, die er auf Fragen gab, wurden immer verschrobener und zerfahrener, wie seine Notizen.
Eine Unterhaltung ist heute natürlich längst nicht mehr möglich. Selbst der Reiz, daß ein Besuch aus der Fremde kam, wodurch manche Endzustände ein wenig in Bewegung geraten, wirkte hier nicht mehr. Er betrachtete den Besucher mit seinen lebhaften Mausaugen mißtrauisch und suchte die Besichtigung seiner Bilder auf ganz verschmitzte Weise zu hintertreiben, indem er fortwährend neue Anlässe fand, das Aufknüpfen der Schnüre von dem Zeitungsballen, der seine Schätze barg, hinauszuzögern. Bald murmelte er etwas von »unfertigen Sachen«, wendete den Ballen von einer Seite zur anderen, oder lief ans Fenster und machte Zeichen hinaus. Beim Anblick eines Arztes zog er sich mit warnendem Ruf an den Besucher in eine Ecke zurück und verfolgte den Arzt von dort aus mit gespannten Blicken und magisch-beschwörenden Handbewegungen unter ständigem Murmeln. Nachher prüfte er umständlich die Türen, horchte lange nach allen Richtungen – und begann von neuem den Ballen hin und her zu wenden, wobei er bedenklich die Achseln zuckte und scheue Seitenblicke warf, ohne auf die an ihn gerichteten Worte je einzugehen. Als er dann endlich die Schnur gelöst hatte und ein Blatt ergriff, faßte er sich plötzlich, wie in einer Erleuchtung an den Kopf, packte den Ballen sorgfältig nochmal zu und begann, alle Fragen mit kleinen Handbewegungen abwehrend, in den Westentaschen zu suchen. Aus dem kleinen Päckchen in Zeitungspapier, das er schließlich fand, entrollte er einen 3 cm langen Zigarrenstummel, den er liebevoll betrachtete und beroch und bedächtig anzündete. Immer mit kleinen Bewegungen und listig verschmitztem Blick dem Frager Ruhe bedeutend, ging er mit feierlichen kurzen Schritten auf und ab. Nachdem er etwa 1 cm von dem Stummel geraucht hatte, löschte er ihn sorgfältig aus, wickelte ihn umständlich wieder ein, versenkte ihn in seine Westentasche und kehrte mit freundlichem Lächeln zum Tisch zurück. In ständigem Kampf mit solchen Schrullen gelang es zwar noch, einige Blätter zu sehen, aber ohne daß ein Gespräch in Gang gekommen wäre. Nur wenn man ein Bildwerk in der Farbe oder eine Kurve schön fand, antwortete er darauf, wie Maler zu tun pflegen: »ja, das ist ganz gut« – »es sollte mehr rot hinein« u. dgl. Alle Bilder aus letzter Zeit waren auf Zeitungspapier mit hartem Pastell- und Ölfarbstift gezeichnet; Zeichenpapier dagegen hatte er seit kurzem nur noch mit seinen orakelhaften Satzstücken und Wortneubildungen beschrieben.
Pohl zeichnet sich von allen anderen geschilderten Fällen dadurch aus, daß er im bildnerischen Schaffen berufsmäßig vorgebildet war, als er sich von der Welt trennte – ja, er war zum mindesten im handwerklichen Sinne ein fertiger Kunstgewerbler, der bereits einige Jahre an einer Gewerbeschule gelehrt hatte. Diese Tatsache entschädigt ein wenig für den empfindlichen Mangel an Nachrichten über seine psychische Struktur und die Erlebnisinhalte, die in der Zeit der Krankheitsentwicklung das Material für das spätere, nur aus Bildern zu erschließende Weltbild abgegeben haben. Über die Persönlichkeit des Pohl, wie sie vor der Anstaltsaufnahme gewesen sein mag – die Krankheit hat sich wahrscheinlich schon seit dem 16. Lebensjahr in der Stille entwickelt – können wir nur so viel sagen: er war ein gut veranlagter, stiller, eigenwilliger Mensch, der, nach Schrift und Wortschatz zu urteilen, sich einen gewissen Bildungsgrad erworben hatte und anscheinend wenigstens in der Erotik eher expansiv war. Auch die Reise nach Chicago spricht für Unternehmungsgeist. Sein Verhältnis zum Vater (die Mutter starb bereits 1886) scheint ganz neutral gewesen zu sein, wie das ja bei Hebephrenen häufig ist. Im übrigen sind wir völlig auf die in großer Zahl vorliegenden bildnerischen Arbeiten angewiesen.
Zum Glück besitzt Pohl so viel Pedanterie, daß er auf den meisten Blättern ein Datum anbringt. Nicht, daß er sie förmlich signierte – aber in den Beischriften ergibt sich fast immer ein Anlaß zur Datierung, sei es, daß er eine Verordnung erläßt, oder eine Rechnung aufstellt und dergleichen mehr. Dadurch läßt sich nun sein ganzer Entwicklungsgang während der Krankheit über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren Schritt für Schritt verfolgen. Pohl steht also in einem doppelten Gegensatz zu sämtlichen anderen Fällen, die ausführlich besprochen wurden. Einmal erwarb er sich einen durchschnittlichen Grad von bildnerischem Können auf normale Weise. Daß er damals wahrscheinlich schon im Beginn der Krankheit stand, beeinträchtigt die Geltung unserer Untersuchungen nicht wesentlich. Denn immerhin finden wir in den Produktionen der ersten Anstaltsjahre eine bestimmte Art von Zeichnungen, in denen das schulmäßige Können vorherrscht. Und zweitens ist bei ihm, obgleich seine Zeichenweise feststand, eine Wandlung nachzuweisen, die sich keineswegs als Verfall im Verlaufe eines Verblödungsprozesses kennzeichnen läßt.
Für eine solche Wandlung kommen nun zwei Erklärungsprinzipien in Frage. Man muß zunächst bei einem ausgebildeten Zeichner daran denken, daß er in unablässiger Übung seiner Fähigkeiten im allgemeinen Fortschritte machen wird, sofern er überhaupt Begabung hat. Pohl war nun – wie wir wissen – einer schleichenden Psychose ausgesetzt, die ihn ohne sehr heftige Phasen langsam zu dem bizarren verschrobenen Menschen machte, der heute in vollkommenstem Autismus dahindämmert. Es wäre nun doch denkbar, daß seine zeichnerischen Fähigkeiten, die gerade beim Kunstgewerbler weniger mit dem Kern der Persönlichkeit zu tun haben müssen, sondern sich zur Not in der Sphäre handwerklicher Technik bewegen können, mehr oder weniger unabhängig von der psychotischen Änderung seines Weltbildes hätte halten können. Wie das ja in der Tat bei Handwerkern vorkommt, die auch als schizophrene Endzustände gelegentlich ihre Facharbeit ganz ordentlich verrichten. Wir würden dann – vielleicht mit einigem Staunen – bemerken, daß die Psychose dem Manne sein Können nicht zerstört, sondern vielleicht gar zuläßt, daß seine technischen Fertigkeiten sich noch festigen. Andererseits aber könnten wir jede Änderung seiner Zeichenweise von vornherein unter dem Gesichtspunkt der Krankheit betrachten, also theoretisch einer Einwirkung dieser Krankheit auf die bildnerische Tätigkeit sicher sein. Aber wir haben gar keine objektive Nachricht darüber, wie die Phasen der Krankheit, z. B. Erregungszustände, sich im Werke spiegelten und ähnliches. Auch läßt sich nicht vorher ausmachen, ob etwa die Psychose auflösend auf die Zeichenfähigkeit wirken muß, wie manche Psychiater bisher glaubten behaupten zu können, oder ob nicht in irgendeiner Richtung doch eine fördernde, lösende, vertiefende Wirkung von der Krankheit auf die Produktion ausgehen könnte. – Der Sinn dieser Erwägungen ist: wir können auch in diesem Falle, wo wir eine Wandlung der Zeichenweise im Verlauf der Krankheit vor uns haben, durchaus nicht ohne weiteres eindeutige Befunde erheben, sondern müssen in jedem Blatt mindestens zwei Komponenten zu erfühlen suchen. Nämlich das erlernte Können einerseits, das in Entwicklung oder Verfall begriffen sein kann, und andererseits jenes X der kranken Persönlichkeit, das nicht nur stofflich, sondern auch in der Gestaltung sich auswirken kann. Vielleicht wird uns die richtige Einschätzung dieser Komponenten dadurch erleichtert, daß wir die zweite bei einer Reihe von Fällen schon kennengelernt haben.
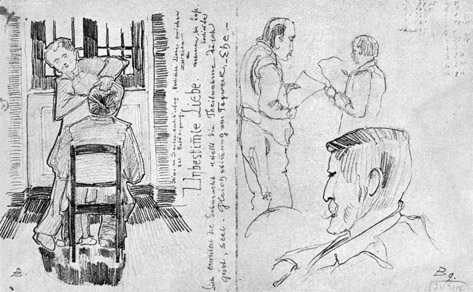
Fall 244. Abb. 156. Skizzen 1900 (Blei- und Buntstift). 34x21.
Aus den ersten Jahren des Anstaltsaufenthaltes liegen einige Dutzend datierte Zeichnungen vor, die durchweg realistisch gerichtet sind. Die Anstaltsumgebung bietet die Motive. Mitkranke werden porträtiert, kleine Szenen werden festgehalten, einzelne Patienten sind wohl besonders geduldig und dienen in zahlreichen verschiedenen Stellungen als Modell. Nichts außer manchen wunderlichen Beischriften verrät, daß in dem Manne seelisch Außerordentliches vorgeht. Die gewohnte Zeichentätigkeit wird verrichtet wie das Essen und Schlafen. Sie ist nicht Ausdrucksmittel für sein derzeitiges Leben, sondern für einen vergangenen Abschnitt. Das neue Weltbild geht nur in die sprachlichen Äußerungen ein, die schon durchaus autistisch verschroben sind. Es ist, wie wenn das Verhältnis zur Umwelt zwar innerlich schon gelöst wäre, an der Peripherie aber, in der anschaulichen Sphäre, in automatischer Perzeption und Reproduktion noch gewohnheitsmäßig fungiere, sozusagen nach Art eines überlebenden Organs. Abb. 156 von 1900 repräsentiert dieses Stadium recht vollständig: Kopfstudie, Haltungsstudien rein sachlich, mit lockerem, gleichgültigem Strich, die Rasierszene schematisiert, wie es im Buchschmuck jener Zeit vielfach üblich war, mit drahtiger Konturverdoppelung und nüchterner Flächigkeit der Strichlagen. Der gute Aufbau der Gruppe mag als Maßstab für die natürliche Begabung und die Stufe des Könnens dienen.

Fall 244. Abb. 157. Skizze 1904 (Blei- und Buntstift). 18x13.
Von 1904 gibt es datierte Blätter verschiedener Art. Noch kommen realistische Szenen vor, aber sie haben einen anderen Schwung im Strich und in der Komposition. Auch strömen sie wie Abb. 157 bei aller klaren Sachlichkeit eine gewisse Stimmung aus, die sich schwer auf Einzelheiten zurückführen läßt. Daneben aber gibt es schon Blätter, auf denen das reale Vorbild nur mehr Anlaß ist, während die Bildfläche als solche Farbe und Form zu einem neuartigen Organismus in sich sammelt. In solchen Bildern herrschen dann Stimmungsmomente weitaus vor. Pohl zeichnet in dieser Zeit mit harten Ölstiften, denen er aber auch rein malerische Wirkung abgewinnt. Bisweilen – wie auf dem Anstaltsinterieur, Abb. 157 – mischt er Bleistift, Farbstift und Tinte sehr wirkungsvoll. Auch technische Entwürfe aus diesen Jahren lassen eine ähnliche Wandlung von handwerklicher Nüchternheit zu schwungvollem rhythmisch drängendem Strich erkennen. Gewandt ist er gerade in diesen, mit Kunstschlosserarbeiten eng zusammenhängenden Entwürfen von Anfang an gewesen. Aber Blätter, wie Abb. 158, auf denen ein Strom von wilden Impulsen zu ganz gleichmäßigen Kurven mit äußerster Anspannung gebändigt erscheint, kommen früher nicht vor. Diese dynamische Komponente also müssen wir zum mindesten mit größter Wahrscheinlichkeit auf die schizophrene Veränderung zurückführen.
Etwa aus derselben Zeit mag auch die bewegte Bleistiftzeichnung Abb. 159 stammen, die nun auch bei Pohl die Sphäre der Ausnahmeerlebnisse erschließt. Objektive Bestätigungen für echt halluzinatorischen Ursprung des Blattes sind nicht beizubringen. Vergleichen wir es jedoch mit den übrigen Bildern, bei denen wir eine solche Entstehungsweise in Betracht zogen, so werden wir bei diesem eine besonders große Wahrscheinlichkeit annehmen müssen. Der Sinn der schwebenden Gestalt mit dem russischen Gesicht mag etwa sein: Der gerahmte Kopf, der als Porträt an der Wand hing, hat sich von seinem Nagel entfernt, ist durch einen herangezauberten Körper zu ganzer Figur ergänzt worden und fliegt nun durch den Raum – dabei trägt er ein Schwert in der Hand, um im gegebenen Augenblick Kopf und Körper wieder zu trennen. Die in rasender Flucht perspektivisch sich verjüngenden Gefäße und das seltsame Fabeltier – halb Tapir, halb Delphin – das ebenfalls in schwindlig machender Verkürzung sich schräg aus der Tiefe hervordrängt und mit gerümpfter Nase an dem vordersten Geschirr riecht – diese Motive erhöhen noch den taumelig-phantastischen Gesamteindruck, zu dem wir am ehesten über Traumgesichte Zugang haben.

Fall 244. Abb. 158. Dekorativer Entwurf (Bleistift). 25x39.

Fall 244. Abb. 159. Phantastische Zeichnung (Bleistift). 25x39.
Noch einmal hat Pohl ein Bild gemacht, das man sicher als Wiedergabe einer Halluzination auffassen muß: Abb. 160. Und in diesem Falle noch sicherer, weil der Hintergrund einen ganz realistisch gemeinten Ausgang in den Garten mit offener Tür darstellt, der den Anstaltsräumen stark ähnelt. In diesem vertrauten Zimmer steht das plumpe Ungeheuer, aus Hund, Eber, Mensch und Hirsch etwa kombiniert, bedrohlich in nächster Nähe, als dränge es den Kopf aus dem Bilde heraus. Neben ihm ein kleiner sonderbarer Hund mit trüben Augen in dem dicken Kopf. Von oben senkt sich ein riesiger Schmetterling ebenfalls peinlich nah herab, zwei kleinere erscheinen noch zu beiden Seiten des Ungeheuers. – Das Ungefüge, Klobige, Bedrückende, auch in der Farbe (mit grellem Rot) ungewöhnlich Brutale des Bildes wird wohl nur durch halluzinatorische Entstehung befriedigend erklärt.
Diese fünf Bilder sollen nur als Folie dienen, um die Werke aus den letzten Jahren des »völlig verblödeten Endzustandes« gebührend hervorzuheben. Die »Madonna mit den Krähen« (Abb. 161) mag zeigen, wie natürlich und frei er jetzt gestaltet, wie reich seine Ausdrucksmittel geworden sind. Das alte Motiv mutet zwar zunächst überraschend an in dieser etwas rauhen Umgebung eines kahlen Waldes, durch dessen Geäst eine Krähenschar flattert. Mancher wird geneigt sein, dann schon etwas gewaltsam Verschrobenes zu sehen. Darüber läßt sich streiten. Wir glauben mit einigen Künstlern, der Einfall sei beneidenswert originell, und, was mehr ist, ausgezeichnet gelöst. Denn das Bild überzeugt und gewinnt an Lebendigkeit, sooft man es anschaut. Auch die schlanke Madonna hat einen großen Reiz. Und was das formale Leben im Detail anlangt, so kann man ruhig beliebige Stellen der ganzen Bildfläche für sich betrachten: man stößt nirgends auf lahmes Strichgefüge. Ist denn aber überhaupt keine Spur von der Krankheit zu bemerken? Wir sind allerdings der Ansicht, daß dieses Bild, an neutralem Orte gezeigt, keinen Betrachter veranlassen würde, ärztliche Meinungen über seinen Urheber einzuholen. Man würde vielleicht über die Art, wie die Madonna in den Raum gesetzt ist, verwundert sein, in dem Maler einen Eigenbrötler vermuten, der sich an keine Tradition anschließt – aber dann würde jedermann, nach dem Grade seiner Empfänglichkeit, das Bild als Kunstwerk genießen.

Fall 244. Abb. 160. Fabeltiere (Buntstift). 29x40.

Fall 244. Abb. 161. Madonna mit Krähen (Buntstift). 29x40.
Dies kann man bei weitem nicht von allen späten Werken des Pohl sagen. Bei der großen farbigen Zeichnung Abb. 162 würde z. B. ebenso sicher jedermann aufs höchste befremdet sein über den unfaßbar gespaltenen Eindruck, den das Blatt macht. Da entzückt ein üppiges Tabernakelhäuschen von gotischer Art – aber es ist aus Rokokoformen gebildet. Daneben schleicht ein Mann gebückt nach vorn, als wenn er den putzigen rostbraunen kleinen Hund oder Teddybär wie einen Schmetterling fangen wollte. Und hinten blickt man ins Freie durch ein mächtiges unordentliches Geschiebe von klassischer Architektur, die links von Gruppen sich umschlingender Putten gekrönt ist. Das alles ist mit höchst beweglichem, lockerem, aber präzisem Strich, durchaus wie von der Hand eines reifen Meisters hingeworfen – aber dem Betrachter schwankt irgendwie der Boden unter den Füßen. Diese selbstverständliche Sachlichkeit, mit der das krause Konglomerat von völlig zusammenhanglosen Einzelheiten dargestellt ist, macht einen schwindeln, wie man es etwa bei E. T. A. Hoffmann öfters erlebt, wenn er einen absichtlich im Zweifel läßt, ob jetzt Realität oder Traumwelt gemeint sei. Ganz gleichgültig, ob hier Halluzination oder Traum zugrunde liegt, oder was immer: dies Blatt verkörpert auf höchstem Niveau die typisch schizophrene Seelenverfassung, deren Material man in einer »inkohärenten Wortreihe« zur Not ebenfalls wiedergeben könnte. Diese Wortreihe nach schizophrenem Muster würde etwa lauten: Tabernakel – Teddy – Schmetterling – Bückling – Rogotik – Puttenball – Hellastür usw. Wesentlich ist, daß bildnerische Gestaltungskraft aus solchem Material ebensowohl zu schöpfen vermag wie aus irgendeinem anderen – daß aber das Resultat deutlich beides zur Schau trägt: erstens das inkohärente Material oder die in selbständige Einzelpointen spaltende schizophrene Haltung, und zweitens die sichere Gestaltungskraft.
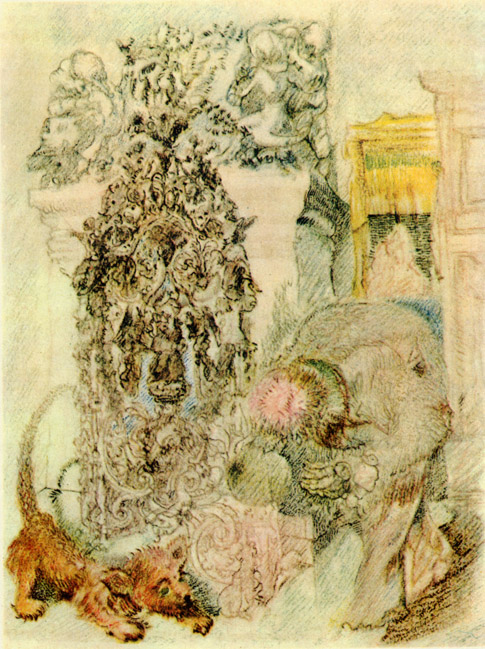
Fall 244. Abb. 162. Phantastische Szene (Buntstift). 29x40.
Das phantastische Zwischenreich, in das Pohl zu führen weiß, fließt aber gelegentlich auch zu völlig einheitlichen Werken zusammen, wie auf Abb. 163, wo drei gnomenhafte Gestalten mit ganz menschenunähnlichen Proportionen so selbstverständlich in einer ihnen angepaßten Umgebung dargestellt sind, wie das unseres Wissens kaum je so überzeugend gelungen ist. Die Unbestimmtheit der Umrisse darf ja nicht verwechselt werden mit der Verwaschenheit in spielerischen Kritzeleien, die dann gedeutet werden – in dieser Blaustiftzeichnung handelt es sich um meisterhafte Auflockerung der Form bei überaus klarer Vorstellung und treffsicherer Hand. Auch die technischen Entwürfe, die Pohl nie ganz vergißt, sind nun von der großzügigen malerischen Weichheit, die kein Detail mehr braucht und doch so suggestiv wirkt, daß man den tektonischen Organismus viel intimer auffaßt, als in exakter Werkzeichnung. Es erübrigt sich, zu dem Brunnenentwurf in Blaustift Abb. 164 mehr zu sagen.
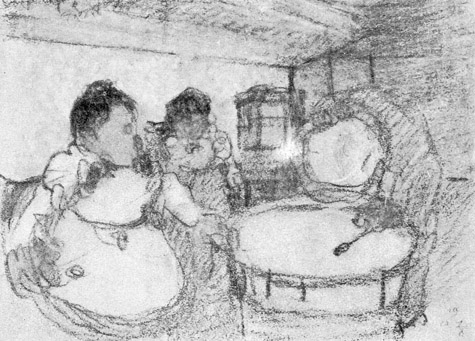
Fall 244. Abb. 163. Zwerge (Buntstift). 19x14.
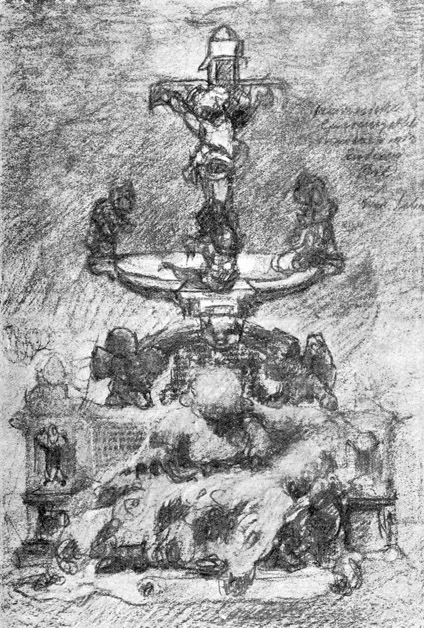
Fall 244. Abb. 164. Kreuzigungs-Brunnen (Blei- und Buntstift). 18x27.

Fall 244. Abb. 165. Selbstbildnis (Buntstift). 19x28.
Den Höhepunkt seines Schaffens erreicht Pohl in den letzten Bildern. Er hat eine große Reihe von Selbstbildnissen im Laufe der Jahre angefertigt. Meist stellt er nur den Kopf leicht vorgeneigt, mit runden, lebhaft herausschauenden Augen dar. Eine Zeitlang, als er wildbewegtes Gewimmel halb dekorativer, halb realistischer Motive liebte, erschien sein Kopf auch gelegentlich inmitten eines wolkigen Puttenkranzes u. dgl. Abb. 165 gehört zu den Bildern aus Pohls letzter starker, oder richtiger stärkster Schaffensperiode 1918. Der Strich ist ganz locker, aber prägnant; die Farbe derb, vorwiegend blau, im Gesicht ein stumpfes Hellbraun. Was einen packt, ist der Ausdruck in Haltung und Blick dieses Kopfes. Man muß an van Goghs spätes Selbstbildnis denken – nur dort treffen wir einen Menschen, der in so brennender Spannung hinausschaut und dabei so trostlos zerstört in seinem Weltgefühl zu sein scheint. Hier, wo wir es mit einem Könner zu tun haben, dürfen wir einmal ohne Skepsis von einem Bildnis im vollen Sinne des Wortes sprechen, von dem bildnerischen Selbstbekenntnis eines Künstlers, der seine Wortsprache längst nur noch zu verschrobenen Spielereien benutzt.
Die stumpfgrüne Parklandschaft mit Menschen Abb. 166, wohl etwas früher entstanden, entzückt den Kenner, ehe er überhaupt nach dem Stofflichen schaut, durch die matte vornehme Tonigkeit, den farbigen Schimmer, rein materiell genommen. Mögen darin auch alte Meister anklingen – man würde doch kaum einen bestimmten als Vorbild namhaft machen können. Dieser Eindruck vertieft sich aber noch ganz stark, wenn man nun den Einzelheiten nachzugehen trachtet. Da ragt mitten ein Kruzifixus unter den vereinzelt stehenden Bäumen – Menschen, der matten Wiesenfarbe angeglichen, in seltsam starrer, puppenhafter Haltung, gehen und sitzen verstreut umher – in veralteter Tracht. Unter ihnen reckt sich das Steindenkmal eines Ritters auf, der nicht lebloser dasteht, als die Menschen – von denen einer nun als französischer Kürassier mit weiten roten Hosen erkennbar wird. Durch das hohe dürre Geäst scheint ein milder Abendhimmel. Wir schauen in eine Welt, in der alles Vertraute uns unbegreiflich fern und fremd geworden ist. Psychopathologisch gesprochen, wir können, indem wir uns in dies Bild versenken, das Erlebnis der »Entfremdung der Wahrnehmungswelt« uns so eindringlich vermitteln, wie es nicht leicht auf andere Weise möglich ist. Ob Pohl selbst bewußt ein solches Erlebnis in seinem Bilde gestalten wollte, entzieht sich unserer Kenntnis. Neben der Tatsache, daß uns das Entfremdungsphänomen an diesem Werk einmal direkt zugänglich wird, bedeutet jener Mangel nicht viel.

Fall 244. Abb. 166. Seltsame Landschaft (Buntstift). 29x40.
Schließlich der Würgengel Abb. 167 (siehe Titelbild), in dem alles gipfelt, was an wertvollen steigernden Impulsen in der schizophrenen Seelenverfassung gefunden wurde. In seinem funkelnden Strahlenkranze bricht der Engel von oben herein, den linken Arm mit langem Griff vorstreckend, in der Rechten das Schwert fast bedächtig quer vor seinem Gesicht haltend. Zwischen den Händen steht sein linker Fuß auf der Kehle eines Menschen, der mit der Rechten sich zum Halse fährt, während die Linke den Herabdringenden abzuwehren trachtet. Die Beine des Überfallenen schlagen am rechten Bildrand in die Höhe, und zwar verdreht, von hinten gesehen. Das Gewirr der Glieder auf dem engen Bildraume ist bei aller grauenhaften Drastik auch kompositorisch gemeistert, ja die Art, wie die Dynamik aller Bewegungsimpulse eben so weit geordnet wird, daß man eine klare Übersicht gewinnt, ohne das Gefühl der gewaltigen Spannung zu verlieren, hat etwas schlechthin Grandioses. Und diesem hohen Niveau entspricht die Farbe: Wie die ganze Skala aufgeboten wird, um in schreiendem Rot, Grün, Blau dem Vorgang Genüge zu leisten – und diese grellen Kontraste doch gebunden werden durch gelbgrüne Halbtöne, die nach den Rändern zu dunkler werden – das zeigt dieselbe Tendenz, wie die Spannung der Formen und dieselbe souveräne Meisterschaft. Angesichts dieses Werkes von Grünewald und Dürer zu reden, ist gewiß keine Blasphemie. Alles, was wir im Verlaufe von Pohls Schaffen für ihn charakteristisch fanden, spiegelt sich in diesem Hauptwerk. In dem Strahlenkranze des Engels klingt die Kunstschlosserei an, wobei ein technischer Kunstgriff sich als sehr wirksam erweist: mit einer harten Spitze sind Wellenlinien in Strahlenrichtung in das Papier gepreßt. Die überzeugende Gewalt des Grauens aus den halluzinatorischen Bildern beherrscht den ganzen Eindruck. Eine gewisse natürliche Schlichtheit trotz aller übersteigerter Spannungen in Form und Farbe gibt einen Schimmer von Abgeklärtheit, der wiederum altmeisterlich anmutet.
Was ist hier schizophren? Wir vermögen es nicht sicher zu sagen. Aber wir stehen hier auch an dem Punkte, wo wir erklären müssen: wenn dieser Würgengel nur schizophrenem Weltgefühl entspringen konnte, so ist kein kultivierter Mensch mehr imstande, schizophrene Veränderungen lediglich als Entartung durch Krankheit aufzufassen. Man muß sich vielmehr endgültig entschließen, mit einer produktiven Komponente ein für allemal zu rechnen und allein in dem Niveau der Gestaltung einen Wertmaßstab für Leistungen zu suchen – auch bei Schizophrenen.