
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Religiöse Gebräuche der Mandaner. – Ihr Glaubensbekenntnis. – Drei Gegenstände der Zeremonien. – Das große Kanoe. – Eröffnung der Medizinhütte. – Opfer für das Wasser. – Fasten während vier Tage und Nächte. – Bel-lohk-nah-pick (Stiertanz). – Pohk-hong (die Schneide- oder Marter-Szene). – Eh-ke-nah-ka-nah-pick (die letzte Rasse). – Außerordentliche Beispiele von grausamer Selbstmarter. – Opfer für das Wasser. – Folgerungen aus diesen Grausamkeiten. – Überlieferungen. – O-kih-hih-de (der Böse Geist). – Die Mandaner können zivilisiert werden.
Die schon mehrmals erwähnte jährliche religiöse Zeremonie, die vier Tage währte, fand endlich statt und ich war glücklicherweise imstande, ihr beizuwohnen und ihre Bedeutung größtenteils zu verstehen; dies war mehr, als ich erwarten durfte, denn es ist wohl bis jetzt niemals einem weißen Manne gestattet worden, sich während dieser höchst merkwürdigen und schrecklichen Szenen in der Medizinhütte aufzuhalten.
Ich hatte den Medizinmann, der bei dieser Gelegenheit Hoherpriester oder Leiter der Zeremonien war und der mich zum Doktor oder weißen Medizinmaler (Te-ho-pih-nih-wasch-i-waska-puska) weihte, gemalt. An dem Morgen, als die großen Vorbereitungen zu den Mysterien begannen, führte er mich am Arme in die Medizinhütte, wohin mich Herr Kipp mit seinen beiden Schreibern begleitete. Während dieser vier Tage kehrten wir bei Sonnenuntergang in unseren Wigwam zurück und begaben uns am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang wieder in die Medizinhütte.
Während dieser Zeit habe ich viele getreue Zeichnungen in mein Skizzenbuch eingetragen und zahlreiche Bemerkungen nach der Erklärung des Dolmetschers niedergeschrieben. Nach der Beendigung dieser furchtbaren Szenen habe ich alles, was ich gesehen, auf Leinwand übertragen und auf diese Weise vier Gemälde angefertigt, deren jedes die Vorgänge eines Tages darstellt; die Genauigkeit derselben haben meine Begleiter auf der Rückseite der Gemälde bescheinigt.
Ich schaudere bei der bloßen Erinnerung an diese gräßlichen Szenen, und ich möchte es lieber unterlassen, sie hier zu beschreiben. Ich trat in die Medizinhütte, wie in eine Kirche, und erwartete zwar, etwas Außerordentliches und Auffallendes zu sehen, jedoch immer in der Form eines Gottesdienstes; allein ich erwartete keineswegs das Innere ihres Gotteshauses in ein Schlachthaus verwandelt und dessen Boden mit dem Blute der fanatischen Gläubigen bedeckt zu sehen und dort Szenen zu erleben, die, wenn möglich, die Gräuel der Inquisition noch übertreffen.
Die religiöse Zeremonie der Mandaner, wie man dies Fest mit Recht nennen muß, wird einmal jährlich in der Medizinhütte zu verschiedenen Zwecken gefeiert, wie wir sogleich sehen werden.
Die Mandaner glauben an einen Großen (guten) Geist und an einen Bösen Geist; der letztere soll lange vor dem ersteren gelebt haben und viel mächtiger sein Siehe Anmerkung 17.. Sie glauben auch an eine Fortdauer nach dem Tode, an einen künftigen Zustand der Belohnung der Tugend und der Bestrafung des Lasters und (wie alle anderen Stämme, die ich besuchte), daß die Strafen nicht ewig dauern, sondern nach Maßgabe ihrer Sünden eingerichtet seien.
Der Prinz von Neuwied hält dies für ein Mißverständnis, da die Indianer ihm niemals etwas ähnliches gesagt haben. (A. a. O. S. 659.)
Da diese Völker in einem Klima leben, in dem sie unter der Strenge des Winters leiden, so haben sie natürlich unsere Ideen von Himmel und Hölle umgekehrt. Die letztere beschreiben sie als ein Land, sehr weit gegen Norden gelegen, von ödem und schrecklichem Ansehen und mit ewigem Eise und Schnee bedeckt; dessen Qualen schildern sie als höchst martervoll, während sie den Himmel in ein wärmeres und schöneres Klima versetzen, wo man beständig die ausgesuchtesten Freuden genießt und Überfluß an Büffeln und anderen Annehmlichkeiten des Lebens findet. Sie glauben, der Große oder Gute Geist wohne in der Hölle Siehe Anmerkung 18., um die Qualen derjenigen, die ihn beleidigten, durch seine Gegenwart noch zu vermehren und zugleich darüber zu wachen, daß ihnen die gebührenden Strafen auferlegt werden. Den Bösen Geist dagegen versetzen sie in das Paradies, wo er fortfährt die Seligen in Versuchung zu führen. Die, welche in das Land der Strafe versetzt worden sind, werden dort eine der Größe ihrer Sünden angemessene Zeit gequält, dann aber in das Land der Seligen versetzt, wo sie wiederum den Versuchungen des Bösen Geistes ausgesetzt und für ihre neuen Sünden verantwortlich bleiben.
Catlin hat in bezug auf den Wohnplatz des Herrn des Lebens die Mandaner wohl mißverstanden, oder er ist falsch berichtet worden, wie dies auch Hr. Kipp, welcher der Mandanersprache ganz mächtig war, bekräftigte. Den Sitz des Herrn des Lebens glauben sie in der Sonne und nicht in der Hölle, weshalb sie auch besonders die Sonne verehren. Der Ausdruck »Hölle« sollte hier gar nicht gewählt werden, indem »das Land der Guten« und »das Land der Bösen« bessere Bezeichnungen für diese Begriffe zu sein scheinen. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 660 Anm.)
Dies ist das religiöse Glaubensbekenntnis der Mandaner, und um den Guten und den Bösen Geist zu versöhnen und sich den Eintritt in die himmlischen Gefilde oder die schönen Jagdgebiete zu sichern, unterwerfen sich die jungen Leute den fürchterlichen Martern, die weiter unten beschrieben werden sollen.
Es sind indes noch drei andere Zwecke, weshalb diese religiösen Zeremonien gefeiert werden, nämlich:
1. zur Erinnerung an die Befreiung von der großen Wasserflut, die sie Mih-nih-ro-ka-ha-scha (das Sinken der Gewässer) nennen;
2. um den Stiertanz (Bel-lohk-na-pic) zu tanzen, von dessen strenger Beobachtung, wie sie glauben, die Ankunft der Büffel abhängt, die ihnen Nahrung liefern;
3. um die jungen Leute des Stammes, die das Alter der Mannbarkeit erreicht haben, durch Fasten und Martern einer strengen Prüfung zu unterwerfen, damit sie ihre Muskeln stärken und sich zu den härtesten Entbehrungen vorbereiten; die Häuptlinge wohnen diesen Prüfungen bei, um zu entscheiden, wer von den jungen Leuten die größte körperliche Stärke besitzt und die größten Entbehrungen und Leiden, die so oft das Loos des indianischen Kriegers sind, zu ertragen vermag und daher am meisten dazu geeignet ist, eine Kriegspartei anzuführen.
Dieser letzte Teil ist so gräßlich und empörend, daß ich dessen Beschreibung ganz unterlassen würde, wenn er nicht so wesentlich und der zivilisierten Welt ganz unbekannt wäre.
Der Stiertanz und mehrere andere Teile dieser Zeremonien sind äußerst grotesk und belustigend, und derjenige Teil, der sich auf die große Flut bezieht, ist harmlos und sehr interessant.
Im Mittelpunkt des Dorfes der Mandaner befindet sich ein freier runder Platz von 150 Fuß im Durchmesser, der für alle öffentlichen Feste, Aufzüge usw. stets rein gehalten wird. Um diesen Platz stehen die Wigwams so nahe aneinander als möglich und sämtlich mit den Türen nach diesem Platz gerichtet. In der Mitte dieses Platzes, der so fest ist wie gepflastert, steht ein hölzerner Zylinder, ähnlich einem aufrechtstehenden Oxhoft, acht bis neun Fuß hoch, den sie von Jahr zu Jahr sorgfältig erhalten und »das große Kanoe« nennen Siehe Anmerkung 19. Es ist dies unstreitig eine symbolische Darstellung eines Teiles ihrer traditionellen Geschichte der großen Flut, die sie auf irgendeine Weise erhalten haben und nun in der Erinnerung der ganzen Nation zu bewahren suchen. Dies Kanoe ist, als der Mittelpunkt des Dorfes, der Versammlungsort des ganzen Stammes und sie beweisen ihm ihre Verehrung bei den verschiedenen Festen und religiösen Gebräuchen; auch bei dem Feste, das ich hier beschreiben werde, bildete es öfters den Mittelpunkt der Mysterien und Grausamkeiten, weshalb es nötig ist, seine Bedeutung zu kennen.
Es ist dies die Arche des ersten Menschen (Mah-Mönnih-Túchä), die Catlin »Kanoe« nennt. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 661 Anm.
Die religiöse Zeremonie der Mandaner beginnt nicht an einem bestimmten Tage im Jahre (denn sie kennen nicht die Einteilung in Tage oder Wochen Siehe Anmerkung 20., sondern dann, wenn die Weiden am Ufer des Flusses in vollem Laube stehen; denn nach ihren Überlieferungen »war der Zweig, den der Vogel mit nach Hause brachte, ein Weidenzweig mit vollständigen Blättern.« Der hier erwähnte Vogel ist die trauernde oder Turteltaube (Uárawit-kschukä), die sie mir oft zeigten, wenn sie sich bei den Hütten ihr Futter suchte; sie ist ein großer Medizinvogel und darf daher weder getötet noch überhaupt belästigt werden, und selbst die Hunde sind abgerichtet, sie nicht zu stören.
Nach Catlin kennen die Mandaner nicht die Einteilung in Tage oder Wochen; dagegen sagt der Prinz von Neuwied:
Die Einteilung der Zeit, besonders die Einteilung des Jahres in Monate (Minang-gä) ist bei den Mandanern ziemlich natürlich. Sie rechnen die Jahre nach Wintern, und sagen, so viele Winter sind seit jenem Ereignisse verflossen. Die Zahl der Winter können sie in Zahlen oder auch an den Fingern und Händen abzählen, denn ihre Zahlwörter sind sehr vollständig. Beginnt man mit dem Anfange des Jahres, so ist:
1. Der erste Monat, der Monat der sieben kalten Tage, Aschini-tächtä-minang-gä; er entspricht dem Januar.
2. Der Monat der Begattungszeit des Wolfes, Charatä-dúh-hämináhki-minang-gä; unser Februar.
3. Der Monat der kranken Augen; Istippa-minang-gä; März.
4. Der Monat des Wildprets; einige nennen ihn auch den Monat der wilden Gänse, Enten usw.; Pattohä-ku-minang-gä; April. Man nennt ihn auch öfters den Monat, welcher das Eis aufbricht, Chódä-uáppi-minang-gä.
5. Der Monat, in welchem man säet (den Mais), oder Monat der Blumen; Wakih-häddä-minang-gä; Mai.
6. Der Monat der reifen Service-Beeren; Manna-puschákä-ratak-minang-gä; Juni.
7. Der Monat der reifen Kirschen (Prunus); Katáckä-rátack-minang-gä; Juli.
8. Der Monat der reifen Pflaumen (Prunus); Wáhkta-rátack-minang-gä; August.
9. Der Monat des reifen Mais; Makiruchah-minang-gä; September.
10. Der Monat der abfallenden Blätter; Mánna-apä-haráh-minang-gä; Oktober.
11. Der Monat, wo die Flüsse zufrieren; Chódä-ahke-minang-gä; November.
12. Der Monat des kleinen Frostes (la lune du petit froid); Ischinin-takschú-kä-minang-gä; Dezember.
Hier und da werden auch noch andere Namen für die Monate gewählt, worin etwas Willkür herrscht; die hier angegebenen sind aber die gewöhnlichen. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 191.)
An dem Morgen, als diese sonderbaren Zeremonien begannen, und ich mit Herrn Kipp beim Frühstück saß, hörten wir bei Sonnenaufgang plötzlich das Geschrei der Frauen und das Bellen und Heulen der Hunde, als ob der Feind das Dorf stürmte. »Nun geht es los!« rief mein Wirt, indem er aufsprang, »die große Zeremonie hat begonnen. Legen Sie Messer und Gabel weg, nehmen Sie schnell Ihr Skizzenbuch, damit nichts verloren geht, denn der Anfang der Zeremonie ist eben so eigentümlich wie das Ganze.« Ich nahm sogleich mein Skizzenbuch und wir eilten nach der Medizinhütte. Gruppen von Frauen und Kindern standen auf den Dächern der Wigwams und alle schrien und schauten westwärts nach den Prärien, wo man in der Entfernung einer englischen Meile einen Menschen erblickte, der einen Hügel herabkam und gerade auf das Dorf zuging.
Die ganze Gemeinde nahm jetzt an dem Lärmen Teil; die Bogen wurden gespannt und die Elastizität geprüft – die Pferde auf der Prärie eingefangen und in das Dorf getrieben – die Krieger schwärzten das Gesicht, legten den Hunden Maulkörbe an und bereiteten alles wie zu einem Kampfe vor.
Während dieses betäubenden Lärms und allgemeiner Verwirrung nähert sich jener Mensch mit langsamen Schritt und in gerader Linie dem Dorfe. Aller Augen sind auf ihn gerichtet, bis er endlich das Dorf erreicht und sich nach dessen Mittelpunkt begibt, wo alle Häuptlinge und Tapferen zu seinem Empfange bereit stehen, ihm herzlich wie einem alten Bekannten die Hände reichen und seinen Namen »Numánk-Máchana« (der erste oder einzige Mensch) aussprechen. Dieser Mensch, dessen Körper mit weißem Ton bemalt ist, so daß er in der Entfernung einem weißen Manne gleicht, trägt einen Mantel von vier weißen Wolfsfellen, der ihm über die Schultern und den Rücken herabhängt, sowie einen prächtigen Kopfputz von zwei Rabenfellen und in der linken Hand mit großer Sorgfalt eine Pfeife von ungeheurer Größe. Nach der erwähnten Begrüßung der Häuptlinge und Krieger nähert er sich der Medizinhütte, die das ganze Jahr hindurch gewissenhaft verschlossen gehalten wird.
Nachdem er sie geöffnet und eingetreten ist, ruft er vier Männer und befiehlt ihnen, sie zu reinigen und zu der Feierlichkeit vorzubereiten. Man bedeckt nun den Boden und die Seitenwände mit grünen Weidenzweigen und mit wilder Salbei und anderen wohlriechenden Kräutern und bringt an mehreren Stellen Gruppen von Menschen- und Büffelschädeln an.
Während dieser Vorbereitungen wandert Numánk-Máchana durch das Dorf, bleibt vor jeder Hütte stehen und ruft, bis ihr Besitzer herauskommt und fragt, wer er sei und was es gebe? worauf jener das traurige Ereignis erzählt, das die Oberfläche der Erde durch das Überströmen der Gewässer betroffen habe; er sei der einzige Mensch, der aus dem allgemeinen Unglück gerettet worden, er sei mit seinem Kanoe auf einem hohen Berge im Westen gelandet, wo er jetzt wohne; er sei gekommen, die Medizinhütte zu öffnen, wozu er eines schneidenden Werkzeuges von jedem Hüttenbesitzer bedürfe, damit er es dem Wasser opfere; geschehe dies nicht, so werde eine neue Flut kommen und niemand werde gerettet werden, denn mit solchen Werkzeugen sei das große Kanoe gebaut worden.
Nachdem er am ganzen Tage jeden Wigwam des Dorfes besucht und überall ein Beil, ein Messer usw. erhalten hat, kehrt er in die Medizinhütte zurück und legt die Geschenke dort nieder, wo sie bleiben, bis sie am vierten Tage nachmittags in Gegenwart der ganzen Bevölkerung von einem dreißig Fuß hohen Ufer an einer sehr tiefen Stelle (unstreitig als ein dem Wassergeist gebrachtes Opfer) in den Fluß geworfen werden, wo sie niemals wieder herausgeholt werden können.
Niemand weiß, wo der erste Mensch in dieser Nacht schläft, und jedermann, jung und alt, Hunde und überhaupt alle lebenden Wesen bleiben in den Hütten und im ganzen Dorfe herrscht eine Totenstille. Am nächsten Morgen erscheint er indes wieder und begibt sich in die Medizinhütte; ihm folgen nach indianischer Weise einer hinter dem anderen, etwa fünfzig junge Leute, die sich den Martern unterwerfen wollen. Sie waren fast gänzlich nackt und ihre Körper mit verschieden gefärbtem Ton angestrichen: einige rot, andere gelb und noch andere weiß Siehe Anmerkung 21.. Jeder trug in der rechten Hand den Medizinbeutel, am linken Arm den Schild von Büffelhaut, in der linken Hand Bogen und Pfeile und auf dem Rücken den Köcher.
Eigentlich sollten sie alle weiß angestrichen sein, was die Farbe der Trauer oder Demut ist, doch kann zufällig die weiße Erde gefehlt haben. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 662 Anm. Catlin sagt übrigens selbst im 19. Kapitel S. 94, wo er von Regenmachern spricht: »die Medizinmänner sandten Gesänge und Gebete zu dem Großen Geiste empor, der in der Sonne lebt und den Wolken des Himmels gebietet.«.
Sobald alle in die Hütte eingetreten sind, hängen sie ihre Waffen und Medizinbeutel an der Wand auf und setzen sich dann, ein jeder unter den seinigen, auf den Boden.
Nachdem nun Numánk-Máchana in ihrer Mitte für den glücklichen Erfolg seine Pfeife geraucht und sie in einer kurzen Anrede ermahnt hatte, dem Großen Geiste zu vertrauen, der sie während der ihnen bevorstehenden harten Prüfung beschützen werde, rief er einen alten Medizinmann in die Hütte, dessen Körper gelb bemalt war und den er zum Leiter der Zeremonie – Kauih-Sächka Siehe Anmerkung 22. – ernannte, indem er ihm die große Medizinpfeife überreichte, von der die Macht abhängt, alle diese Gebräuche zu verrichten.
Catlin nennt den Leiter der Zeremonie Oh-ka-pa-kah-seh-ka; dies ist unrichtig, es muß heißen Kauch-Sächka. Es erklärt sich dies wohl dadurch, daß die Sprache der Mandaner für einen Engländer und Franzosen schwer, für einen Deutschen oder Holländer weit leichter auszusprechen ist, weil sie außerordentlich viele Kehltöne, wie ach, och, uch im Deutschen hat. Nasentöne kommen nur einzeln vor. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 662
Sobald Numánk-Máchana dem Medizinmann die Pfeife übergeben hatte, reichte er ihm die Hand, sagte Lebewohl und fügte hinzu, daß er nun wieder in die Gebirge im Westen zurückkehre, von wo er nach einem Jahre wiederkommen werde, um die Hütte zu öffnen. Er ging sodann aus der Hütte und durch das Dorf, nahm auf dieselbe Weise von den Häuptlingen Abschied und verschwand bald hinter den Hügeln, von denen er herabgekommen war Siehe Anmerkung 23..
Dies ist nicht richtig, indem der erste Mensch am Ende des Festes wieder erscheint, die acht Büffelstiere (Berócki-Häddisch) totschießen läßt und sie dem Volke preisgibt. Wenn nämlich alles vorüber ist, ladet Numánk-Máchana (der erste Mensch) die Bewohner ein, sich zu versammeln und Büffeljagd zu halten. Die Männer kommen nun zu Fuß und zu Pferde mit Bogen und Pfeilen herbei; letztere sind an der Holzspitze mit grünem Laub versehen, und indem die Stiere dem ersten Menschen tanzend sich genähert haben und von ihm zurückgestoßen werden, schießt man sie von allen Seiten nieder. Sie fallen, wälzen sich auf dem Boden und liegen dann als Tote still. Der erste Mensch ladet nun die Bewohner ein, sich das Fleisch der Büffel zu nehmen. Diese, denen die Roben schon abgefallen waren, stehen nun auf und ziehen sich in die Medizinhütte zurück, wo die Figuranten sich in zwei Haufen teilen, Arme und Beine ausstrecken, sich auf den Magen schlagen und dabei ausrufen, daß sie sich nun stark fühlen, die einen, daß sie Feinde töten, die anderen, daß sie viele Büffel erlegen würden usw., dann entfernt man sich, ißt, ruht, und das Fest ist beendigt. (Prinz von Neuwied, S. 662
Der von Numánk-Máchana ernannte Leiter der Zeremonien hat nun die Verpflichtung, mit der Medizinpfeife in der Hand bei einem kleinen Feuer zu liegen, von Zeit zu Zeit den Großen Geist anzurufen und die jungen Leute zu bewachen, damit sie nicht die Hütte verlassen, mit dem außerhalb derselben befindlichen Volke keinen Verkehr haben und während vier Tage und Nächte weder essen, trinken noch schlafen, um sich auf die Martern vorzubereiten, welche sie am vierten Tage zu erdulden haben.
Ich stand früh am Morgen mit meinen Begleitern vor der Medizinhütte und suchte wo möglich einen Blick in das Innere zu werfen, als der Zeremonienmeister heraustrat, mich beim Arme nahm und durch ein acht bis zehn Fuß langes Vorzimmer, das eine doppelte Tür hatte, vor der zwei Wachen mit Lanzen oder Kriegskeulen in der Hand standen, in das Allerheiligste einführte. Ich gab meinen beiden Gefährten einen Wink und meine Medizin war so mächtig, daß man sie ruhig mit eintreten ließ und uns sämtlich auf erhöhte Sitze führte, die der Medizinmann für uns errichtete. Von hier aus konnten wir bequem alles sehen, was in der Hütte vorging, und hier blieben wir an jedem der vier Tage vom Aufgang bis zum Untergang der Sonne.
Außer den bisher angegebenen Gegenständen befanden sich in der Hütte noch Menschen- und Büffelschädel in sonderbarer, aber regelmäßiger Weise in zwei Gruppen aufgestellt, und zwischen diesen stand ein kleines, zierliches, etwa fünf Fuß hohes Gerüst von vier gabelförmigen Weidenruten von der Stärke eines Ladestocks, die vier bis fünf Fuß voneinander in dem Boden steckten und vier gleich starke Ruten trugen, auf denen noch dünnere Ruten quer gelegt waren. Oben in der Mitte dieses Gerüstes lag ein kleiner Gegenstand, den ich von meinem etwa dreißig Schritt entfernten Sitze nicht genau erkennen konnte. Ich versuchte, mich demselben zu nähern, wurde aber sogleich durch ein allgemeines St! zurückgewiesen. Ich bezähmte daher meine Neugier und erfuhr später, daß dieser geheimnisvolle Gegenstand so heilig und seine Mysterien so wichtig seien, daß außer dem Medizinmann niemand, selbst nicht einmal die jungen Männer, die die Prüfung bestehen wollen, sich ihm nähern oder erfahren durften, was es sei.
Dieser kleine, geheimnisvolle Gegenstand hatte, von meinem Sitze aus, das Ansehen einer kleinen Schildkröte oder eines Frosches, der auf dem Rücken lag, Kopf und Beine von sich streckte, mit sehr feinen roten, blauen und gelben Bändern umwickelt und noch auf andere Weise verziert war. Aus der Ehrfurcht, welche alle diesem sonderbaren Dinge bezeigten, geht so viel hervor, daß es der eigentliche Mittelpunkt der Mysterien, das Allerheiligste war, das dem ganzen Feste die Weihe verlieh. Aber so viele Mühe ich mir auch später gab, um zu erfahren, was es eigentlich sei, so erhielt ich doch stets nur die Antwort, es sei »große Medizin« und »es könne nicht gesagt werden«. Ich suchte daher meine Neugier zu bezähmen, denn ich sah ein, daß ich erst noch einige höhere Grade würde erlangen müssen, bevor ich in alle indianischen Mysterien eingeweiht werden könne. Vielleicht ist dies so wunderbar erscheinende Ding nichts weiter als ein Bündel von Bändern und anderen Kleinigkeiten, das irgendeinen Geist oder Wesen vorstellt, dem sie große Verehrung bezeugen, und sie weisen vielleicht nur deshalb jede nähere Auskunft darüber mit den Worten: »es ist große Medizin« zurück, weil sie nichts zu sagen haben.

Tafel VIII. Kühnheit und Geistesgegenwart der Indianer auf der Büffeljagd.
Unter dem oben beschriebenen Gerüste lagen auf dem Fußboden der Hütte ein Messer und mehrere hölzerne Stäbchen, die bei den weiteren zu beschreibenden Martern benutzt werden. Von der Decke der Hütte hingen eine Anzahl Stricke von rohem Leder herab, woran die jungen Männer, die sich den Martern unterziehen, in die Höhe gezogen werden.
Außerdem lagen auf dem Boden noch vier hoch verehrte und sehr wichtige Gegenstände, nämlich Säcke (Ih-tih-ka), deren jeder zwölf bis fünfzehn Liter Wasser enthält. Sie sind von der Halshaut eines Büffels gemacht und haben die Gestalt einer großen Schildkröte, deren Schwanz durch Adlerfedern dargestellt wird. Auf jedem lag eine Art Trommelstock, womit während eines späteren Teiles der Zeremonien die Medizinmänner auf die Ledersäcke schlagen. Über diesen lagen noch zwei andere Gegenstände von gleicher Wichtigkeit, nämlich Rasseln (Ih-nä-dih) in der Form einer Kürbisschale, ebenfalls von Leder und gleich den vorigen zur Begleitung der Tänze usw. gebraucht.
Die oben erwähnten Säcke haben ein sehr altes Aussehen, und nachdem alles vorüber war, sagte mir mein Gönner, der Medizinmann, auf meine Frage, daß »diese vier Schildkröten Wasser aus den vier Weltgegenden enthielten und daß dies Wasser seit dem Sinken der großen Flut sich darin befinde!« Ich hielt es für angemessen, keinen Zweifel dagegen zu äußern und konnte daher auch nicht erfahren, wie oft und bei welchen Gelegenheiten das Wasser erneuert worden sei.
Ich ließ durch meinen Freund Kipp mehrmals einen bedeutenden Preis für einen dieser sonderbaren Gegenstände bieten, erhielt aber zur Antwort, daß diese und alle anderen bei den Zeremonien gebrauchten Dinge Gemeingut und Medizin, daher unter keiner Bedingung zu verkaufen seien. Ich war folglich auf meinen Pinsel beschränkt, und selbst dies betrachteten sie mit Mißtrauen und als eine Entweihung.
So war das Innere der Medizinhütte an den ersten drei Tagen und während eines Teiles des vierten.
Während der ersten drei Tage dieses feierlichen Konklave finden auf dem freien Platze in der Mitte des Dorfes vor der Medizinhütte noch andere merkwürdige Gebräuche statt, von denen der Stiertanz (Bel-lohk-näh-pick Es ist dies nicht der eigentliche Büffeltanz, der im 18. Kapitel beschrieben wurde.), wie oben bemerkt, einen Hauptteil dieses jährlichen Festes bildet und von dessen strenger Beobachtung die Ankunft der Büffel abhängt. Dieser Tanz wird am ersten Tage viermal, am zweiten achtmal, am dritten zwölfmal und am vierten sechszehnmal um »das große Kanoe« getanzt.
Die Hauptpersonen bei diesem Tanze waren acht ganz nackte Männer, die eine ganze Büffelhaut, mit Hörnern, Hufen und Schwanz, über den Rücken gehängt hatten und mit vorn übergebeugtem Körper alle Bewegungen der Büffel nachzuahmen suchten. Sie waren auf die wunderlichste und alle auf ähnliche Weise bemalt; Beine, Körper und Gesicht waren ganz mit roter, schwarzer oder weißer Farbe bedeckt, um die Knöchel trug jeder einen Kranz von Büffelhaaren, in der rechten Hand eine Rassel, in der linken einen dünnen weißen Stab von sechs Fuß Länge und auf dem Rücken einen Bündel grüner Weidenzweige von der Größe eines Bundes Stroh. Diese acht Männer stellten sich in vier Paaren um das große Kanoe, indem sie die vier Weltgegenden (Nord, Ost, West, Süd) darstellten, und zwischen jeder Gruppe stand mit dem Rücken gegen das Kanoe ein anderer Mann, der an demselben Tanze teilnahm, in der einen Hand einen ähnlichen weißen Stab und in der anderen eine Rassel trug. Die Körper dieser vier jungen Männer waren ganz nackt bis auf einen hübschen Gürtel (Kwarz-Kwad) und Kopfputz von Adlerfedern und Hermelin. Zwei von diesen Personen waren mit einer Mischung von pulverisierter Holzkohle und Fett ganz schwarz bemalt; sie wurden »das Firmament« oder »die Nacht«, und die zahlreichen weißen Flecke an ihrem Körper »die Sterne« genannt. Zwei andere, die sich ganz rot angestrichen hatten, stellten den Tag vor, und die roten Streifen, die vom Kopf bis zu den Füßen über den ganzen Körper hinliefen, waren »die Geister, die die Morgenstrahlen vertreiben«.
Diese zwölf Personen nehmen allein an dem Tanze wirklich teil, der stets genau auf dieselbe Weise ohne die mindeste Veränderung wiederholt wird. Außerdem treten jedoch bei diesem sonderbaren und lächerlichen Schauspiele noch eine Anzahl Gestalten auf, deren Verrichtungen ich zu erklären versuchen will, so gut ich es vermag.
Dies merkwürdige Schauspiel findet in Gegenwart sämtlicher Bewohner statt, die teils auf den Dächern der Wigwams, teils auf der Erde zuschauen, während die jungen Leute, wie oben beschrieben, in der Medizinhütte fasten. Am ersten Tage wird der Stiertanz einmal für jede Weltgegend getanzt und der Medizinmann raucht seine Pfeife nach diesen Richtungen hin; am zweiten Tage geschieht dies zweimal, am dritten dreimal und am vierten viermal für jeden der genannten Punkte. Die Tänzer und die übrigen Teilnehmer versammeln sich, wenn der Zeremonienmeister mit der Medizinpfeife in der Hand aus der Hütte hervortanzt, wobei er höchst kläglich singt oder vielmehr schreit, bis er das große Kanoe erreicht hat, an das er sich lehnt und zu schreien fortfährt. In diesem Augenblick gehen vier sehr alt und patriarchalisch aussehende Männer, die rot bemalt sind und die vier Seiten der Hütte bewachten, in diese hinein, holen die vier Wassersäcke und legen sie neben das große Kanoe, setzen sich auf die Erde und fangen an, die Säcke mit den Trommelstöcken zu schlagen; andere schwingen und schütteln die Ih-nä-dihs oder Rasseln, während alle ihre Stimmen so laut als möglich erheben, was die Musik zu dem Stiertanze bildet, der nun beginnt und fünfzehn Minuten, oder auch länger, ohne Unterbrechung fortwährt. Wenn die Musik und der Tanz aufhören, was stets ganz gleichzeitig geschieht, so erheben sämtliche Zuschauer ein betäubendes Beifallsgeschrei, der Zeremonienmeister tanzt in die Medizinhütte zurück, die alten Männer nehmen ihre frühere Stellung wieder ein, die Wassersäcke werden an ihren Ort zurückgebracht und alles bleibt wie vor dem Tanze, bis dieser von neuem beginnt.
Die Nebenfiguren, die an diesem großartigen Schauspiele teilnehmen, sind zahlreich und verdienen eine nähere Beschreibung Siehe Anmerkung 24.. Neben dem großen Kanoe sieht man zwei Männer, die die Haut eines greulichen Bären (Mato) als Maske übergeworfen haben, beständig brummen, alles vor sich zu verschlingen und die religiöse Handlung zu stören drohen. Um sie zu besänftigen, stellen die Frauen Schüsseln mit Fleisch vor sie hin, die aber sogleich von zwei anderen, die den Körper schwarz, den Kopf weiß bemalt haben und weißköpfige Adler (Pattáckä) vorstellen, ergriffen und in die Prärie getragen werden. Dort werden diese beiden Männer von mehr als hundert nackten Knaben verfolgt, die den Körper gelb und den Kopf weiß angestrichen haben und Cabris oder Antilopen vorstellen; sie entreißen zuletzt den Adlern die Speisen und verzehren sie, wodurch man vielleicht die schöne Moral ausdrücken will, daß die Gaben der Vorsehung zuletzt in die Hände der Unschuld kommen.
Max von Neuwied führt noch folgende Masken an, die am dritten Tage des Okippe an dem Tanze teilnehmen und von Catlin nicht erwähnt werden:
1. Zwei Männer, als Weiber verkleidet, welche in diesem Aufzuge mittanzen, indem sie sich zur Seite der acht Büffel halten. Sie tragen Kleider von Bighornleder, Weiberbeinkleider (Mitasses), die Robe mit den Haaren nach außen, bloß die Backen rot bemalt, das Kinn tätowiert, den Kopf nach Weiberart mit Glasperlen (Rassade) verziert.
2. Zwei andere Männer stellen ein Paar Schwäne vor. Sie sind nackt, tragen einen Schwanenschwanz in der Hand, sind über und über weiß angestrichen, bloß Nase, Mund (Schnabel) und der untere Teil der Beine mit den Füßen schwarz.
3. Ein paar Klapperschlangen. Ihr Rücken ist, wie bei diesen Tieren, schwarz quer gestreift, die Vorderseite gelblich, von jedem Auge läuft über die Backen hinab ein schwarzer Streifen und in jeder Hand halten sie einen Büschel Wermut.
4. Zwei Biber (Uárapä); sie tragen die Büffelhaut mit dem Pelze nach außen, hinten am Gürtel ein Stück Pergament, wie einen Biberschwanz, und sind braun bemalt.
5. Zwei Raubvögel; ihre Schultern sind blau, der Vorderteil gelblich und gefleckt, sie tragen Federn auf dem Kopfe und Raubvogelfüße in den Händen.
6. Zwei Männer stellen das getrocknete Fleisch vor, das in schmale Streifen geschnitten ist. Sie haben auf dem Kopfe eine Mütze von weißem Hasenfell, der Leib ist mit Zickzack-Streifen bemalt, um die Hüften haben sie einen Gürtel von grünen Zweigen und tanzen mit, wie die übrigen.
7. Ein oder zwei Wölfe (Cháratä). Sie sind weiß angestrichen, tragen eine Wolfshaut und laufen den Cabris, die sich vor ihnen flüchten, nach; fangen sie eine solche, so kommen die Bären, nehmen sie ihnen ab und fressen sie auf.
8. Zwei Prärie-Wölfe (Schähäcke). Sie sind oben auf dem Kopfe weiß, auf dem Gesichte gelbrot bemalt, tragen trockene Kräuter in den Haaren, in der Hand einen rotbraun gestreiften Stock und laufen in der Prärie vor den anderen Tieren her, wenn diese das Dorf verlassen.
Fast alle diese Tiere sollen verschiedene Gesänge mit Worten haben, die aber Uneingeweihte nicht verstehen. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 175, 177, 178.)
In der Zeit zwischen diesen Tänzen begeben sich alle Teilnehmer, mit Ausnahme derjenigen aus der Medizinhütte, in einen daneben befindlichen Wigwam, der bei dieser Gelegenheit auch als ein heiliger Ort betrachtet wird und nur für die genannten Personen bestimmt ist, um dort auszuruhen und sich zu schmücken.
Die alten Männer, die die Wassersäcke schlagen, fahren auch in der Zeit zwischen den Tänzen fort, den Großen Geist anzuflehen, daß er ihnen Büffel sende, damit sie während des Jahres zu leben hätten. Auch suchen sie den jungen Leuten in der Medizinhütte Mut einzuflößen, indem sie ihnen erzählen, daß »der große Geist sie erhört habe – daß ihre Frauen und Kinder den Mund des greulichen Bären halten können – daß sie täglich Ochkih-Häddäh (den bösen Geist, Teufel) angerufen – daß sie ihn noch jetzt aufforderten zu kommen, daß er aber noch nicht gewagt habe, zu erscheinen!«
Aber an dem vierten Tage um Mittag, bei dem letzten Tanze, als die Fröhlichkeit den höchsten Grad erreicht hatte, erscholl plötzlich von den Dächern der Hütten ein Schrei; Männer und Frauen schienen von Angst und Schrecken ergriffen und richteten ihre Blicke westwärts nach dem, eine englische Meile entfernten Präriehügel, von dem ein Mann herabstieg und mit schnellen Schritten, jedoch nicht in gerader Linie, sondern hin- und herlaufend, wie ein Knabe, der einen Schmetterling verfolgt, auf das Dorf zueilte. Als er die Palisaden erreicht hatte, konnte man erkennen, daß er ganz nackt und mit gestoßener Kohle und Bärenfett schwarz wie ein Neger angestrichen war; an verschiedenen Teilen des Körpers hatte er weiße Ringe von etwa einem Zoll Durchmesser und am Munde ein furchtbares Gebiß wie Hundezähne. Als er durch das Dorf eilte und in die, meist aus Frauen bestehende erschrockene Gruppe eindrang, stieß er ein furchtbares Geschrei aus.
In seinen beiden Händen trug er einen acht bis neun Fuß langen Stab, an dessen Ende sich eine rote Kugel befand, die er vor sich hin auf die Erde schleifte. Alle, mit Ausnahme der Tanzenden, blickten auf ihn; er stürzte auf die Frauen los, die laut um Hilfe riefen, und, indem sie zu entfliehen suchten, übereinander hinstürzten. In diesem Augenblick des allgemeinen Schreckens trat plötzlich eine allgemeine Totenstille ein. Der alte Zeremonienmeister verließ nämlich seine Stellung an dem großen Kanoe, hielt seine Medizinpfeife dem Bösen Geiste entgegen und zwang ihn dadurch, unbeweglich stehen zu bleiben. Dies gab den Frauen Gelegenheit, aus seinem Bereich zu kommen und als sie sich außer Gefahr sahen, verschwand ihre Furcht sehr bald und sie brachen in ein ungeheures Gelächter und Beifallsgeschrei aus über die plötzliche Besiegung des Teufels und die lächerliche Stellung, die er einnahm. Der alte Mann stand dicht neben ihm und schaute ihm fest ins Gesicht, während die Medizinpfeife Seine Satanische Majestät festgebannt hielt und alle Kräfte des Zauberstabes vernichtete.
Als die überlegenen Kräfte der Medizinpfeife, von der alle diese jährlichen Mysterien abhingen, hinreichend dargetan und anerkannt waren und die Frauen Zeit gehabt hatten, sich außerhalb des Bereiches dieses teuflischen Ungeheuers zu entfernen, wurde die Pfeife allmählich von dem bösen Geiste zurückgezogen, der froh zu sein schien, daß er den Gebrauch seiner Füße wieder erhielt und seine unbequeme und wirklich lächerliche Stellung verlassen konnte.
Nachdem er nun noch etwa eine halbe Stunde zur großen Belustigung der Zuschauer von Menschen und Tieren hin- und hergestoßen war, schien er äußerst erschöpft zu sein und sich ängstlich umzusehen, wie er wohl auf die beste Weise entwischen könne. In dieser unangenehmen Lage diente er den Frauen, die herbeieilten, um ihn zu quälen, zur Zielscheibe des Spottes. Eine dieser Frauen schlich sich hinter ihn und warf ihm mit beiden Händen gelbe Erde ins Gesicht und auf den Körper, wodurch er, da sein Körper mit Fett bedeckt war, plötzlich ein ganz anderes Ansehen erhielt. Diese Schmach schien ihm sehr zu Herzen zu gehen, denn er fing heftig an zu schreien, worauf die Frauen ihm seinen Stab entrissen, in kleine Stücke zerbrachen und diese nach ihm warfen. Nun war seine Macht dahin – seine Kraft erschöpft; er drängte sich durch die Menge und schlüpfte zwischen die Pfähle, die das Dorf auf der Hinterseite umgeben, hindurch, wo ihn mehr als hundert Frauen und Kinder erwarteten, die ihn über eine halbe englische Meile weit mit Stößen und Schlägen verfolgten, bis es ihm endlich gelang, seinen Peinigern zu entfliehen, worauf er hinter den Präriehügeln verschwand, von denen er herabgekommen war Siehe Anmerkung 25..
Die Rolle des Ochkih-Häddä oder Teufels kann niemand zugeteilt werden, sondern wer sich dazu hergeben will, muß sich selbst melden. (Prinz von Neuwied, a. a. O. S. 176.) Einst, so erzählen die Indianer, habe man dieses Medizinfest am Heart-(Herz-)Flusse gefeiert, wo die Mandaner damals noch wohnten, und den Mann, der diese Rolle übernommen hatte, in den Fluß geführt. Als man ihn ausgezogen hatte, um ihn zu bemalen und anzukleiden, gab er große Unruhe zu erkennen und verlangte, man solle ihn loslassen, und als dies geschah, was er wie vom bösen Geiste besessen, rannte pfeilschnell wie ein Pferd auf die Hügel und in der Ebene umher. Den beiden Begleitern wurde bange und sie liefen nach dem Dorfe; allein der neue Ochkih-Häddä kam pfeilschnell bei ihnen vorbei, sprang über die hohe Umzäunung des Dorfes oben in die Hütten hinein und wieder hinaus, lief alsdann nach dem Flusse und man sah nach ihrer Meinung deutlich, daß er besessen war. Es kostete den Bewohnern viel Mühe, seiner habhaft zu werden und ihn abzuwaschen, er aber zitterte am ganzen Leibe, verhüllte sich in seine Robe und blieb sein ganzes Leben hindurch in einem ähnlichen Zustande, ohne je wieder ein Wort zu sprechen.
Wenn die Mandaner drei bis vier Tage fasten, so träumen sie häufig vom Ochkih-Häddä und glauben dann, daß sie nicht lange mehr leben werden. Ein Indianer erzählte dem Prinzen von Neuwied (a. a. O. S. 176 Anm.), er habe auch einst bei diesem Feste lange gefastet und sich am Rücken aufhängen lassen. Während der Nacht träumte er vom Ochkih-Häddä und sah ihn weit schrecklicher und größer, als er je dargestellt werden konnte. Sein Federbusch reichte bis in die Wolken und er lief pfeilschnell umher. Noch mehrmals träumte er von diesem Teufel; er will aber jetzt, um nicht zu früh zu sterben, nie mehr fasten. Er setzte noch hinzu, er habe den als Maske vorgestellten Ochkih-Häddä oft mit Freude und ohne Scheu betrachtet; er sehe jetzt diese Sache aus einem anderen Gesichtspunkte an, denn je mehr er an ihn gedacht habe, desto größer und gräßlicher sei er ihm vorgekommen und unter diesen Umständen sei ihm der Geist auch sehr nahe gewesen, und wenn er ihn nur einmal berührt hätte, so würde er ohne Zweifel gestorben sein.
Anmerkung des deutschen Übersetzers zu
Kapitel Banden oder Vereine bei den Mandanern.
(Siehe Max von Neuwied, Reise in das Innere von Nord-Amerika. Bd. II, S. 138.)
Wie unter den meisten nordamerikanischen Indianerstämmen, so bestehen unter den Mandanern und allen Nationen des oberen Missouri gewisse Banden oder Vereine, Gesellschaften, die sich durch äußere Kennzeichen und Gesetze von den übrigen unterscheiden und zusammenhalten. Bei ihnen kommen drei Arten von Kriegs- oder Signalpfeifen (Ihkaschka) vor, die sie um den Hals gehängt tragen; sie gehören mit zu den Kennzeichen der Vereine, welch letztere die Männer nach ihrem Alter in sechs Klassen teilen.
1. Die erste Bande oder den ersten Verein bilden die Meniss-Ochka-Ochatä, die törichten Hunde, oder die Hunde, deren Namen man nicht kennt. Sie bestehen aus jungen Leuten von 10–15 Jahren und tragen eine Ihkaschka aus dem Flügelknochen der wilden Gans (Outarde der Kanadier), der nur klein ist. Wenn sie tanzen, so haben drei von ihnen ein langes, breites Stück rotes Tuch vom Halse hinten bis auf den Boden hinab hängen. Wie eine jede Klasse haben sie einen besonderen Gesang zu ihrem Tanz. Ehemals konnten auch alte Leute in dieser Bande sein; dann durften sie aber nie vor dem Feinde weichen; man hat

Tafel XXIV. Die Rückkehr von Washington.
dies seitdem zu der jetzt bestehenden Regel abgeändert. Wollen Knaben in die erste Bande eintreten, um Männer zu werden, so gehen sie zu ihren Mitgliedern, reden sie mit der Benennung Vater an und suchen sowohl den Grad, als den Tanz, den Gesang und die damit verbundene Kriegspfeife für gewisse Gegenstände von Wert, als wollene Decken, Tuch, Pferde, Pulver, Blei u. dgl. anzukaufen, die der Vater für sie zahlt. Verkauft man ihnen die Stelle, so haben sie das Recht an die Auszeichnungen dieser Bande, und der, welcher sie verkaufte, begibt sich dadurch aller Ansprüche an diese; er sucht sich dagegen in eine höhere Bande einzukaufen. Die Tänze der verschiedenen Klassen sind in der Hauptsache dieselben; allein es ist mit einem jeden ein besonderer Gesang verbunden, auch selbst zuweilen eine verschiedene Fußbewegung. Trommel und Schischikué werden ebenfalls mitgekauft. Die erstere nennen die Mandaner Mánna-Bärächä und das Schischikué Ináhdä. Das letztere ist bei dieser Bande kugelförmig, mit einem Stiel oder Handgriff, und wird von Leder gemacht. Wenn man die Art der Instrumente näher bezeichnen will, so setzt man zu dem Worte Ihnádä noch den Namen der Bande hinzu.
2. Die zweite Klasse oder Bande sind die Hähderucha-Ochatä, die Krähen- oder Rabenbande, junge Leute von 20–25 Jahren. Oft sind junge Leute ein halbes Jahr oder länger in keiner der Banden; sie gehen dann zu denen der Krähenbande und reden sie an: »Vater, ich bin arm, wünsche aber von Dir zu kaufen.« Willigt der bisherige Besitzer ein, so erhalten sie die Rabenfedern, welche die Krähenbande auf dem Kopfe trägt, eine doppelte Ihkoschka, aus zwei nebeneinander befestigten Gänseflügelknochen bestehend, Trommel, Schischikué, Gesang und Tanz. Eine jede dieser Banden hat einen Anführer (Headman der Amerikaner), der über den Verkauf ihrer Rechte und Attribute verfügt. An diesen wendet man sich vorzüglich bei vorkommenden Gelegenheiten. Es wird sodann in der Medizinhütte ein Fest veranstaltet, das man 40 Nächte hintereinander fortsetzt. Man tanzt, ißt und raucht daselbst, die Käufer tragen die Unkosten und überlassen noch obendrein den Verkäufern während dieser ganzen Zeit alle Nächte ihre Weiber, bis die sogenannten Väter befriedigt sind und ihre Gerechtsame den Käufern abtreten, wodurch die Festlichkeit endigt.
3. Die dritte Klasse oder Bande sind die Chárak-Ochätä oder die Káua-Karakachka, die sogenannten Soldaten, die ausgezeichnetsten und angesehensten Krieger. Sie bemalen das Gesicht bei ihrem Tanze oben rot und unten schwarz, ihre Kriegspfeife ist groß und aus dem Flügelknochen eines Kranichs gemacht. Die Insignien, die sie bewahren, sind zwei lange, gerade, mit Otterfell umwickelte Stangen, Mánna (das Holz) genannt, von denen Uhufedern herabhängen Diese Art von Stangen wird auch Ihskopka-Schóhdäh und von den Mönnitarriern Biddá-Parachpá genannt.. Gehen sie in den Krieg, so pflanzen sie diese Stangen vor dem Feinde in die Erde und dürfen sie dann nicht verlassen, etwa wie die Fahne bei den europäischen Truppen. Sie haben auch eine solche Stange mit Rabenfedern, die, wenn sie eingepflanzt worden ist, ebenfalls nicht verlassen werden darf und die sie Káhka-Pampi nennen. (Eine Abbildung siehe a. a. O. Bd. I, S. 578.) Sie besitzen Gesang und Tanz und müssen sich in höhere Klassen einkaufen. Ihr Schischikué oder Rasselinstrument ist aus Blech gemacht, in der Gestalt eines kleinen Kessels mit einem Handgriff oder Stiel daran; auch besitzen sie zwei Tabakspfeifen, aus denen bei besonderen Gelegenheiten geraucht wird. Zwei Männer verwahren und tragen diese Pfeifen. Alle höheren Klassen können zugleich in die Bande der Kaúa-Karakáchka gehören, da dieser Verein zur Handhabung der Polizei bestimmt ist; es versteht sich aber, daß alle Mitglieder mit dem Kauf einverstanden sein müssen. Stimmt ein einziger Mann gegen den Verkauf, so kann aus dem Handel nichts werden, Oft geben einzelne ihre Einwilligung nicht sogleich, um den Kaufschilling höher zu treiben und später desto höher zu verkaufen. Die sogenannten Soldaten bilden einen Ausschuß, der alle Hauptangelegenheiten leitet, besonders allgemeine Unternehmungen, als: Veränderungen des Wohnplatzes, Büffeljagden, Umzug der Dorfschaften u. dgl. Sind die Büffelherden in der Nähe, so bewachen sie diese und gestatten nicht, daß sie von einzelnen beunruhigt werden, bis eine allgemeine Jagd angestellt werden kann.
Schießt jemand in dieser Zeit nach einem Wolfe oder anderen Tieren, so nehmen ihm die Soldaten die Flinte ab und mißhandeln und schlagen ihn zuweilen, was er sich gefallen lassen muß; selbst die Häuptlinge würden in solchen Fällen nicht verschont werden. Die in der Nähe lebenden Weißen (Uaschi oder Waschi) sind während einer solchen Zeit denselben Gesetzen unterworfen und öfters haben die Soldaten den Holzhauern des Forts die Äxte weggenommen, oder ihnen das Holzhauen untersagt, damit sie nicht durch ihr Getöse die Büffelherden beunruhigen.
4. Die vierte Klasse oder Bande, Meniss-Ochatä, die Hunde, trägt beim Tanze eine große Mütze von buntem Tuche, auf welcher eine große Menge von Elster-, Raben- und Uhufedern befestigt ist, mit bunten Pferdehaaren und Hermelinschnüren verziert, dabei eine große Kriegspfeife aus dem Flügelknochen des Schwans. Drei von ihnen haben alsdann dieselben roten Tuchstreifen den Rücken herabhängen, deren bei der ersten Bande erwähnt wurde. Gewöhnlich ist ihr Kopf mit einem hinten herabhängenden dichten Busch von Uhu-, Raben- oder Elsterfedern geziert und oft sind diese drei Federarten gemischt. Den drei vorerwähnten, mit den langen roten Tuchstreifen gezierten Männern, oder den eigentlichen Hunden, kann man ein Stück Fleisch in die Asche des Feuers oder auf den Boden werfen und dabei sagen: »Da, Hund, friß!« und sie müssen darüber herfallen und es roh verzehren wie Hunde und andere Raubtiere. Das Schischikué dieser Bande besteht in einem Stock von 1–1½ Fuß Länge, an welchem viele Tierhufe aufgehängt sind.
5. Die fünfte Bande bilden die Beróck-Ochatä, die Büffelstiere. Sie tragen beim Tanze die obere Kopfhaut und die langen Nackenhaare des Büffelstiers mit den Hörnern auf dem Kopfe; zwei Auserwählte unter ihnen aber, die Tapfersten unter allen, die alsdann nie mehr vor dem Feinde fliehen dürfen, tragen einen ganzen, völlig nachgebildeten Büffelkopf mit den Hörnern, den sie über ihren Kopf setzen, durch dessen künstliche, mit einem eisernen oder blechernen Ringe umlegte Augen sie hindurchblicken. Diese Bande allein trägt unter allen übrigen eine hölzerne Thkoschka und in ihrem Verein befindet sich eine Frau, die bei dem Tanze mit einer Schüssel voll Wasser herumgeht, um die Tänzer zu erfrischen; allein sie darf dies Wasser nur den Tapfersten bringen, die den ganzen Büffelkopf tragen. Sie ist bei diesen Gelegenheiten in einem schönen neuen Anzuge von Bighornleder gekleidet und streicht ihr Gesicht mit Zinnober an. Die Männer haben hinten ein Stück rotes Tuch befestigt und eine Figur, die den Büffelschwanz vorstellt; dabei tragen sie die Waffen in der Hand. Die Männer mit den Büffelköpfen halten sich beim Tanze immer nach der Außenseite der Gruppe, ahmen alle Bewegungen und Stimmen dieses Tieres nach, wie es schüchtern und scheu auf die Seite fährt, sich nach allen Richtungen umsieht usw.
6. Die sechste Bande bilden die Schúmsi-Ochatä, die schwarzschwänzigen Hirsche. Sie besteht aus allen alten Männern über 50 Jahren, die aber ebenfalls noch tanzen. Zwei Weiber gehören zu der Bande, die bei dem Tanze aufwarten, kochen, zur Erfrischung frisches Wasser herumtragen usw. Die Männer dieser Bande tragen sämtlich einen Kranz von den Klauen des gräulichen Bären ( (Grizzly Bear) um den Kopf, sowie sie alle Auszeichnungen für ihre Heldentaten am Leibe zur Schau bringen, als Kopffedern, Haarzöpfe an den Armen und Beinen, Skalpe, Malerei usw.
Alle diese Banden, sowie die nachfolgenden Tänze werden gekauft und verkauft, und bei diesen Gelegenheiten muß, wie weiter oben gesagt wurde, der Käufer seine Frau dem Verkäufer während der Festzeit überlassen. Ist aber ein solcher junger Mann noch unverheiratet, so muß er zuweilen weit über Land nach einem anderen Dorfe gehen, um einen Freund oder Kameraden um seine Frau anzusprechen. Dieser geht alsdann mit ihm und gibt an den Abenden des Tanzes für ihn seine Weiber preis. Oft bringt ein solcher Mann drei, vier und mehrere Weiber mit auf den Schauplatz und gibt sie seinem sogenannten Vater, d. h. sobald der Tanz, das Essen, Tabakrauchen und das Aufzählen der Heldentaten vorüber ist. Alsdann kommt eine Frau nach der anderen, streicht dem Manne, den sie begünstigen will, mit der Hand über den Arm hinab und geht in den Eingang der Hütte, wo sie wartet, bis er ihr folgt. Oft bleibt der Herausgeforderte sitzen und senkt den Kopf; dann geht die Frau nach Hause, bringt Dinge von Wert herbei, wie Flinten, Roben, wollene Decken u. dgl., die sie Stück für Stück vor ihm niederlegt, bis er befriedigt ist, aufsteht und ihr in den Wald folgt.
Es gibt auch noch andere Tänze, die sich kaufen und verkaufen lassen; dahin gehört der Káua-Karakáchka, ferner der Tanz des halbgeschorenen Kopfes, Ischohä-Kakoschóchatä, den die untere Klasse kaufen kann, bevor sie noch das Alter hat, Káua-Karakáchkä zu werden. Ein anderer Tanz ist der der alten Hunde, Meniss-Chäh-Ochatä. Die Bande der Hunde kann ihn von der Bande der Stiere kaufen, bevor sie selbst Stiere werden oder sich in die Bande Bérock-Ochatä einkaufen darf. Bei dem Tanze der alten Hunde malt man sich weiß, die Hände und rot schwarz, und trägt um den Leib eine Binde von Bärenfell ( Grizzly Bear) und vom Hinterkopfe herabhängende Federn.
Der sogenannte heiße Tanz, Wadádähschóchatä, wird in Ruhptare und bei den Mönnitarriern getanzt, welch letztere ihn von den Arikkarern kauften. Die kleinen Hunde, deren Namen man nicht kennt, führen ihn auf. Man zündet dabei ein großes Feuer an und wirft eine Menge glühender Kohlen auf dem Boden auseinander, zwischen denen die jungen Leute völlig nackt, also mit bloßen Füßen, umhertanzen. Die Hände mit den Vorderarmen, so wie die Füße bis über die Knöchel, werden dabei rot angestrichen. Aus dem Feuer kocht ein Kessel mit zerschnittenem Fleisch und wenn dies recht gar ist, greifen sie mit der Hand in die kochende Flüssigkeit, nehmen das Fleisch heraus und verzehren es, mit der Gefahr, sich zu verbrennen. Die Zuletztkommenden haben dabei das übelste Geschäft: sie müssen am tiefsten in das kochende Wasser greifen. Während des Tanzes trägt man die Waffen und das Schischikué in den Händen.
As-Chóh-Ochatä ist ein anderer Tanz, der wie gewöhnlich im Kreise aufgeführt und mit Schischikué und Trommel begleitet wird. In der Hand tragen sie dabei mit Federn und Bärendärmen verzierte Bogenlanzen Die Bogenlanze (Erúhpa-Hichtä) ist ein großer Bogen, an dessen einem Ende das Eisen einer Lanze befestigt ist. Sie dient nur als Zierwaffe und wird im Ernste nie gebraucht. Sie ist schön mit Adlerfedern verziert, oft auch mit rotem Tuch und hat, vollständig dekoriert, einen Wert von 100-250 Gulden. Sie erbt vom Vater auf den Sohn fort und man kann sie nicht wohlfeil erhalten, zuweilen muß man ein Pferd und mehr dafür geben..
Auf ganz ähnliche Art wie bei den Männern ist auch das weibliche Geschlecht bei den Mandanern dem Alter nach in vier Klassen geteilt.
Die jüngste Bande führt den Namen Erúhpa-Mih-Ochatä, die Flinten-Bande. Sie tragen hinten am Kopfe ein Paar Kriegs-Adler-Daunfedern, malen sich und haben ihren Tanz.
Die nächste Klasse, in welche sie sich einkaufen, ist die der Fluß-Bande, Passan-Mih-Ochatä. Wenn diese tanzen, so tragen sie eine Adlerfeder, vor dem Kopfe mit einem weißen Band befestigt, die nach der linken Seite hinaussteht und einen mit Gras umwickelten Kiel hat.
Die dritte Klasse bilden die Heu-Weiber, Chan-Mih-Ochatä, die, wenn sie tanzen, ihre besten Kleider anlegen und nur den Skalptanz singen.
Die vierte Klasse sind die Weiber von der Bande der weißen Bisonkuh, Ptihn-Tack-Ochatä. Sie bemalen das eine Auge mit einer Farbe nach ihrem Geschmack, meist himmelblau. Am Kinn vom Munde herab sind diese größtenteils alten Weiber zum Teil mit schwarzen Linien tätowiert Ganz ähnliche Tätowierung als diese senkrechten schwarzen Linien am Kinn der mandanischen Weiber sah Kapt. Beechey bei den Eskimos und den Kaliforniern. – Die Eskimos hatten drei Linien.. Am den Kopf tragen sie ein breites Stück von weißer Bisonkuhhaut, wie eine Husarenmütze, und einen Federbusch darauf.
Banden oder Vereine der Mönnitarrier.
Die Mönnitarrier haben ähnliche Banden oder Vereine, wie die Mandaner, die sich ebenfalls durch Gesang, Tanz und gewisse Zeichen unterscheiden, nämlich:
1. Die Stein-Bande, Wiwa-Ohpage, besteht aus Knaben von zehn bis elf Jahren, die Federn auf dem Kopfe tragen.
2. Die Bande der großen Säbel, Wirriachischi. Sie sind vierzehn bis fünfzehn Jahre alt und tragen bei ihrem Tanze Säbel in der Hand Da Säbel eine seltene Erscheinung unter den Indianern sind und nur von den Kaufleuten bezogen werden können, so scheint diese Bande neueren Ursprungs zu sein..
3. Die Raben-Bande, Haideróhka-Ächke; junge Leute von siebenzehn bis achtzehn Jahren.
4. Die Bande der kleinen Prärie-Füchse, Ehchoch-Kaïchke. Bei ihrem Aufzuge tragen sie Felle von Ottern und Wölfen am Leibe.
5. Die Bande der kleinen Hunde, Waskúkka-Karischta. Auf dem Kopfe tragen sie Federn und quer über die Schultern herab breite Binden von rotem oder blauem Tuche.
6. Die Bande der alten Hunde, Waschukke-Ächke. Sie tragen Federn auf dem Kopfe, die vorerwähnten Tuchbinden über die Schulter, ein Wolfsfell um den Leib, in der Hand ein Schischikué, das aus einem kurzen Stocke besteht, an welchem Hufe des Büffelkalbes ausgehängt sind, und an ihrem Halse hängt eine Kriegspfeife, Ih-Akóhschi.
7. Die Bande der Bogenlanzen, Sóhta-Girakschóhge oder Suhta-Wirakschóhke. Sie tragen Federn auf dem Kopfe und Bogenlanzen (Bidúcha-Haski) in der Hand. Dies ist dieselbe Bande, welche die Mandaner Ischohä-Kakoschóchatä nennen.
8. Die Bande der Feinde, Mah-Iháh-Ächke. Sie tragen Gewehre in der Hand und sind dasselbe, was die Mandaner Kaúa-Karakáchka nennen, die sogenannten Soldaten.
9. Die Bande der Stiere, Kädap-Ächke. Sie tragen die Kopfhaut des Büffels mit den Hörnern auf dem Kopf, Tuchbinden um den Leib, Schellen an ihm und an den Beinen, Lanzen, Flinten und Schilde als ihre Waffen.
10. Die Raben-Bande, Pehriskäike. Sie sind die ältesten Männer. Ein jeder von ihnen trägt eine lange Lanze, mit rotem Tuch überzogen, Biddá-Paráchpa genannt, von der Rabenfedern herabhängen. Sie haben schön verzierte Kleidungsstücke, Federn auf dem Kopfe, Hauben von Kriegsadlerfedern (Wah-Aschú-Lakúkárahä) und borgen selbst schöne Kleider von anderen Banden.
11. Die Bande des heißen Wassers, Máhsawähs. Sie ist einerlei mit Nr. 1. – Sie tanzen, wie bei den Mandanern, nackt zwischen glühenden Kohlen umher und nehmen Fleisch aus einem Topfe mit kochendem Wasser. Hände, ein Teil der Vorderarme und Füße sind rot angestrichen.
Vereine der Frauen:
1. Die Bande der wilden Gänse, Bihda-Ächke. Wenn sie tanzen, so tragen sie Wermut und einen Maiskolben im Arm, vor dem Kopf ist quer eine Feder befestigt. Diese Bande besteht aus den ältesten Frauen.
2. Die Bande der Feinde, Máh-Iháh-Ächke. Sie tragen lange Gehänge von Muscheln und Glasperlen wie die Männer neben der Stirn befestigt und eine Feder quer vor dem Kopfe.
3. Die Stinktier-Bande, Chochkäiwi. Hinten aus dem Kopf steht ein Federbusch, das Gesicht ist schwarz bemalt, mit einem weißen Streifen über die Nase herunter wie am Stinktier.
Außer diesen Banden haben die Mönnitarrier ein Paar für sich bestehende Tänze:
1. Táiruchpahga, der Tanz der Alten. Die Männer erscheinen bei diesem Tanze nackt und nicht aufgeputzt. Nur alte Leute führen ihn aus, die alles mitgemacht haben und nicht mehr zu Felde ziehen.
2. Zúhdi-Arischi, der Skalptanz. Die Weiber tanzen ihn und tragen dabei den Skalp an Stangen. In ihren Händen haben sie Flinten, Äxte, Streitkolben, Stangen u. dgl. Einige Männer schlagen die Trommel und rasseln mit dem Schischikué. Die Kriegspartei der Männer steht währenddessen in einer Linie und bewegt die Füße im Takte mit.
Die Spiele der Mönnitarrier sind dieselben wie bei den Mandanern; denn wenn sie auch eines oder das andere ursprünglich nicht kannten, so haben sie es angenommen.
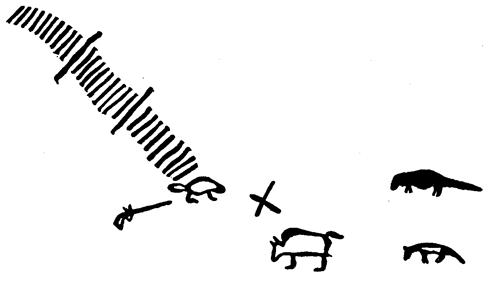
Brief eines Mandaners an einen Pelzhändler.
Das Kreuz bedeutet: »Ich will tauschen oder handeln.« Drei Tiere, ein Büffel, ein Fischer (Mustela canadensis) und eine Fischotter sind zur Rechten des Kreuzes abgebildet. Der Schreiber will die Felle dieser Tiere und zwar wahrscheinlich eines weißen Büffels, gegen die von ihm auf der linken Seite des Kreuzes abgebildeten Gegenstände eintauschen.
An der linken Seite hat er zuerst einen Biber sehr deutlich angebracht, hinter dem eine Flinte steht. Zur Linken des Bibers befinden sich 30 Striche, immer zehn durch eine längere Linie abgeteilt. Dies bedeutet: »ich will 30 Biberfelle und eine Flinte gegen die Felle der zur Rechten des Kreuzes abgebildeten drei Tiere geben.
In diesem Augenblick erhob das ganze Dorf ein Freudengeschrei, der Stiertanz hörte auf und man traf Vorkehrungen zu den Martern, die in der Medizinhütte stattfinden sollten. Der Sinn des Vorhergehenden ist offenbar, daß der Böse Geist (Ochkih-Hädä) bei ihren religiösen Gebräuchen erscheint, um diese zu stören, daß er durch die höhere Macht der Medizinpfeife daran verhindert und zuletzt von denen, welchen er Schaden zufügen wollte, mit Schande aus dem Dorfe vertrieben wird.
Der Zeremonienmeister und die Musiker kehrten nunmehr in die Medizinhütte zurück, in die auch mehrere Männer eingelassen wurden, die bei den daselbst stattfindenden Martern tätig sein sollten; auch die Häuptlinge und die Doktoren begaben sich in die Hütte, um Zeuge der Martern zu sein und zu entscheiden, wer von den jungen Leuten diese mit dem größten Mute ertrage. Die Häuptlinge nahmen auf der einen, die Musiker auf der anderen Seite der Hütte Platz und der alte Zeremonienmeister setzte sich zu dem kleinen Feuer in der Mitte der Hütte, wo er so stark rauchte, als er nur immer konnte, damit der Große Geist den jungen Leuten gnädig sei. Nachdem nunmehr das kleine Gerüst – das Allerheiligste –, von dem oben die Rede war, hinweggeschafft, die neben ihm auf dem Boden liegenden Menschen- und Büffelschädel an den Pfosten der Hütte aufgehängt waren und zwei Männer, von denen der eine das Skalpiermesser, der andere die hölzernen Stäbchen in der Hand hielt, sich nahe dem Mittelpunkte der Hütte aufgestellt hatten, trat einer von den jungen Leuten, die durch anhaltendes Fasten und Wachen während beinahe vier Tagen und Nächten schon ganz erschöpft waren, hervor, um sich den Martern zu unterziehen, die in folgender Weise stattfanden: Der Mann, der das Messer hatte, zog auf jeder Schulter oder auf jeder Seite der Brust ein Stück Fleisch zwischen Daumen und Zeigefinger in die Höhe, nahm das Messer (das zuerst auf beiden Seiten geschärft und dann mit einem anderen schartig gemacht worden war, damit es um so mehr Schmerzen verursache) und stieß es unter seinen Fingern durch das heraufgezogene Fleisch hindurch, worauf der Zweite mit den kleinen Holzstäben herzutrat und einen derselben durch jede Wunde steckte. Es wurden nun von Leuten, die sich auf der Außenseite der Hütte befanden, zwei Stricke in diese hinabgelassen, an die Stäbchen befestigt und der Gemarterte daran so weit in die Höhe gezogen, daß er über dem Boden schwebte, worauf noch an den Armen unterhalb der Schulter und dem Ellenbogen, an den Schenkeln und unter dem Knie ähnliche Einschnitte gemacht und Stäbchen hindurchgesteckt wurden, an die man Schild, Bogen, Köcher und zuweilen noch Büffelschädel mit den Hörnern hing. Oft blieben sie jedoch am Boden liegen, bis die ganze Operation, welche etwa fünf bis sechs Minuten währte, vorüber war.
Nun wurden sie, während das Blut von ihrem Körper herabströmte, so weit hinaufgezogen, daß die angehängten Gegenstände den Boden nicht mehr berührten, so daß sie oft sechs Fuß über dem Boden schwebten. In diesem Zustande boten sie einen furchtbaren Anblick dar; die Stäbchen, woran die Stricke befestigt waren, wurden sechs bis acht Zoll herabgezogen, und der Kopf des Gemarterten sank entweder auf die Brust hinab oder hinten über, je nachdem sie an der Brust oder dem Rücken aufgehängt waren.
Die Standhaftigkeit, womit alle diese Martern ertrugen, grenzt ans Unglaubliche. Keiner von ihnen verzog auch nur eine Miene, als das Messer durch das Fleisch gestoßen wurde und mehrere, die bemerkten, daß ich zeichnete, gaben mir zu verstehen, ich möchte ihr Gesicht betrachten; ich tat dies auch während der ganzen Operation, ohne daß ich etwas anderes wahrgenommen hätte, als ein freundliches Lächeln, wenn sie mich anblickten, während ich hörte, wie das Messer das Fleisch zerriß und mir unwillkürlich die Tränen in die Augen traten.
Wenn der Gemarterte auf die oben beschriebene Weise an den Stricken schwebt, tritt ein anderer hinzu und bringt ihn mittelst einer langen Stange in eine drehende Bewegung, die allmählich immer schneller wird, wodurch die Schmerzen so vermehrt werden, daß der Unglückliche sie nicht mehr überwinden kann und in den rührendsten Klagetönen den Großen Geist anfleht, ihm in dieser Prüfung Kraft zu verleihen, während er zugleich wiederholt, daß das Vertrauen in seinen Schutz unerschütterlich sei. Das Drehen wird nun solange fortgesetzt, bis seine Klagen verstummen und er still und anscheinend leblos dahängt, was gewöhnlich in zehn oder fünfzehn Minuten geschieht. Nun wird er von seinen Quälern genau beobachtet, die einander zurückhalten, solange sich noch ein Zucken bemerklich macht, damit er nicht eher herabgenommen werde, als bis er, wie sie sagen »ganz tot ist«.
Wenn er sich endlich in diesem Zustande befindet, die Zunge aus dem Munde heraustritt und sein Medizinbeutel, den er in der linken Hand hält, ihm entfallen ist, so wird den auf dem Dache befindlichen Personen durch Anschlagen des Stabes gegen den Strick das Zeichen gegeben, worauf sie ihn langsam und vorsichtig auf den Boden herablassen, wo er nun gleich einer Leiche liegt, jedoch nach ihrem Ausdrucke unter dem Schutze des Großen Geistes, der, wie man hofft, ihn beschützen und in den Stand setzen wird, aufzustehen und davonzugehen. Sobald er auf den Boden herabgelassen ist, zieht ihm einer von den Umstehenden die beiden Holzstäbchen aus den Schultern oder der Brust und macht ihn dadurch von den Stricken los, an denen er gehangen hatte; die übrigen Stäbchen, mit allem, was daran hängt, bleiben jedoch in dem Fleische stecken.
In diesem Zustande liegt er sechs oder acht Minuten, bis er sich stark genug fühlt, allein aufzustehen und hinwegzugehen, denn niemand darf ihm Hilfe leisten, da er hier das Vorrecht genießt, worauf die Mandaner den höchsten Wert legen, nämlich in dieser Zeit der größten Gefahr »sein Leben dem Schutze des Großen Geistes anzuvertrauen«.
Sobald er so viel Kraft wiedererlangt hat, daß er sich auf Händen und Füßen zu erheben vermag, kriecht er mit der ganzen, an seinem Körper hängenden Last nach einem anderen Teile der Hütte, wo ein anderer Indianer sitzt, der ein Beil in der Hand und einen getrockneten Büffelschädel vor sich liegen hat. Hier erklärt er mit wenigen Worten, daß er den kleinen Finger der linken Hand dem Großen Geiste zum Opfer bringen wolle, worauf er ihn auf den Büffelschädel legt und der erwähnte Indianer ihn mit einem Hiebe des Beils von der Hand trennt!
Fast alle jungen Leute, die ich diesen Martern sich unterziehen sah, brachten auf diese Weise den kleinen Finger der linken Hand zum Opfer; ja einige ließen sich unmittelbar darauf, ohne besonders merkliche Bewegung und nachdem sie wieder einige Worte an den Großen Geist gerichtet, auch noch den Zeigefinger derselben Hand abhauen, so daß sie an der linken Hand nur zwei Finger und den Daumen behielten, die hinreichend sind, um den Bogen, die einzige Waffe der linken Hand, zu führen.
Man sollte meinen, hiermit sei die Verstümmelung weit genug getrieben; allein ich habe mehrere Häuptlinge und bedeutende Männer des Stammes gesehen, die sich bei solchen Gelegenheiten auch den kleinen Finger der rechten Hand hatten abhauen lassen, was sie für ein weit größeres Opfer halten, als die beiden Finger der linken Hand. Ich sah auch mehrere ihrer berühmtesten Männer, die durch fünf bis sechs korrespondierende Narben an der Brust, den Armen und Beinen unwiderleglich bewiesen, daß sie sich ebenso oft den beschriebenen Martern unterworfen hatten. Es scheint dies von ihrem freien Willen abzuhängen und je öfter sie sich dieser Prüfung unterziehen, um so höher werden sie von ihrem Stamme geachtet.
An der verstümmelten Hand wird kein Verband angelegt, noch werden die Adern unterbunden; auch wird den übrigen Wunden nicht die mindeste Sorgfalt gewidmet, sondern man überläßt es »dem Großen Geiste sie zu heilen, der sicherlich Sorge dafür trägt.« Es ist ein merkwürdiger Umstand, daß diese Wunden, die ich täglich genau untersuchte, nur kurze Zeit und nur sehr wenig bluten. Vielleicht ist dies eine Folge der durch langes Fasten und Wachen erzeugten Schwäche und Erschöpfung, wodurch die Zirkulation des Blutes gehemmt und der Körper weniger empfindlich wird gegen die Martern, die unter anderen Umständen Entzündung und Tod herbeiführen würden.
Während der ganzen Dauer dieser Martern geben die Häuptlinge und Würdenträger genau acht, wer der Stärkste und Standhafteste ist – wer am längsten hängen kann, bevor er ohnmächtig wird und wer, nachdem er herabgelassen worden, sich am schnellsten wieder erholt, um danach zu entscheiden, wer sich am meisten dazu eignet, eine Kriegspartei anzuführen, oder auf einen gefährlichen Posten gestellt zu werden. Die vier alten Männer schlagen während der ganzen Dauer der Zeremonie auf die ledernen Wassersäcke und besingen mit lauter Stimme, um die jungen Leute zu ermutigen, die Macht und Wirksamkeit der Medizinpfeife, die den Bösen Geist aus dem Dorfe vertrieben habe und sie während der harten Prüfung, die sie zu bestehen haben, gewiß beschützen werde.
Sobald sechs oder acht junge Leute die oben beschriebenen Martern überstanden haben, werden sie mit allem, was an ihrem Körper hängt und zum Teil auf dem Boden nachschleppt, aus der Hütte geführt, um sich in der Mitte des Dorfes und in Gegenwart der ganzen Bevölkerung noch folgender Prüfung zu unterziehen.
Der alte Zeremonienmeister verläßt abermals, wie bei dem Stiertanze, mit der Medizinpfeife in der Hand die Hütte, lehnt sich an das große Kanoe und beginnt den Großen Geist anzuflehen. Um das Kanoe herum standen etwa zwanzig junge Männer von gleicher Größe und gleichem Alter, die fast ganz nackt waren, auf dem Kopfe einen Schmuck von Adlerfedern trugen und einen Kranz von Weidenzweigen in der Hand hielten, den je zwei so anfaßten, daß sie einen Kreis um das Kanoe bildeten, das sie mit der größten Schnelligkeit umtanzten, wobei sie beständig schrien so laut sie es nur vermochten.
Ein jeder von den jungen Leuten, die die Martern in der Medizinhütte überstanden haben, wird nun von zwei kräftigen jungen Männern in Empfang genommen, die ihn zwischen sich nehmen, einen breiten Lederriemen um seine Handgelenke schlingen, jedoch ohne ihn festzubinden, und nun bereit sind, das letzte Rennen (Eh-ke-nah-ka-nah-pick) zu beginnen; und wahrlich, der Zuschauer sollte meinen, es sei dies für die Gequälten wirklich das letzte Rennen.
Sobald das Zeichen gegeben ist, fangen die beiden jungen Männer mit der größten Schnelligkeit an zu laufen und der von ihnen Festgehaltene muß mit der ganzen an seinem Körper hängenden Last ihnen folgen, bis er vor Schwäche niederstürzt; aber auch dann wird er noch nicht losgelassen, sondern an den um seine Handgelenke geschlungenen Riemen so lange, oft mit dem Gesichte im Schmutz, im Kreise herumgeschleift, bis alle an seinem Körper hängenden Gegenstände ausgerissen sind, was oft nur dadurch geschehen kann, daß die Umstehenden mit dem ganzen Gewichte des Körpers darauf treten; denn es würde den Großen Geist beleidigen, wenn man die Stäbchen, woran die Gegenstände hängen, herausziehen wollte, sie müssen vielmehr mit dem Fleische herausgerissen werden. Nur die beiden Stäbchen auf der Brust oder den Schultern, welche, um die Last des Körpers tragen zu können, unter den Muskeln hindurchgehen, dürfen, wie oben gesagt, herausgezogen werden. Sind endlich alle angehängten Gegenstände auf diese Weise von dem Körper getrennt, so lassen ihn die beiden Männer, die ihn herumschleiften, augenblicklich los und laufen mit der größten Geschwindigkeit nach der Prärie, als ob sie ein großes Verbrechen begangen hätten und sich der allgemeinen Rache entziehen wollten.
Der Unglückliche, welcher alle Entbehrungen und Martern mit männlicher Standhaftigkeit ertragen hat, liegt nun zum zweiten Male als eine Leiche da, aber, wie sie sagen, »unter dem Schutze des Großen Geistes«, der ihn, wie er zuverlässig hofft, beschützen und am Leben erhalten wird. Hierauf legen sie einen so hohen Wert, daß niemand, weder ein Verwandter, noch ein Häuptling, es wagen wird, den Gemarterten Beistand zu leisten und wenn es gälte, das Leben desselben zu retten; denn nicht nur, daß die Gebräuche selbst dies verbieten und der Stolz desjenigen, der sein Leben dem Großen Geiste anvertraut hat, jede Hilfe zurückweisen würde; auch der Aberglaube, das stärkste Argument bei den Indianern, würde sie abhalten, sich eines Menschen anzunehmen, dessen Leben der Große Geist in seine besondere Obhut genommen.
Haben die Gemarterten sich so weit erholt, daß sie aufstehen können, was in der Regel in wenigen Minuten der Fall ist, so erheben sie sich und gehen, schwankend gleich Betrunkenen, durch die ihnen Platz machende Menge hindurch in ihre Wigwams, wo sie von ihren Freunden und Verwandten empfangen und sorgfältig gepflegt werden.
Unter den jungen Leuten, die sich den Martern unterzogen, befand sich einer, an dessen einem Schenkel ein Elenschädel hing, der, obgleich mehrere der Umstehenden bereits darauf gesprungen waren, nicht von dem Körper zu trennen war, da das Holzstäbchen, woran er hing, unter der Sehne hindurch ging, die sich nicht zerreißen ließ. Das Herumschleifen im Kreise geschah nun immer schneller und die Besorgnisse für das Leben des armen Burschen gaben sich deutlich durch ein klägliches Geheul der Umstehenden zu erkennen. Endlich sprang der Medizinmann mit seiner Pfeife hinzu und gebot Halt, worauf man den jungen Mann liegen ließ, der sich indes bald wieder erholte, seine zerrissenen und blutenden Schenkel betrachtete und dann, seinem Mißgeschicke Trotz bietend, mit einem freundlichen Lächeln durch die Zuschauer und über die Prärie nach einem einsamen, etwa eine halbe englische Meile entfernten Orte kroch (gehen dürfen sie nicht eher, als bis alle Stäbchen mit den daran hängenden Gegenständen ausgerissen sind). Hier lag er noch drei Tage und drei Nächte ohne Nahrung, bis endlich die Wunde in Eiterung überging und das Stäbchen, das er nicht herauszuziehen gewagt hatte, mit dem Fleische und dem anhängenden Schädel abfiel. Nun kroch er auf Händen und Füßen, da er zu matt war um gehen zu können, in das Dorf zurück und bat, ihm etwas zu essen zu geben, was auch sofort geschah. Er war bald gänzlich wieder hergestellt.
Fälle dieser Art kommen oft vor und es hängt dann von dem jungen Manne ab, auf welche Weise er sich von den angehängten Gegenständen befreien will. Einige Pelzhändler, welche mehrere Jahre den letzten Teil der Zeremonien mit angesehen hatten, erzählten mir, daß vor zwei Jahren ein junger Mann, dessen Fleisch so stark war, daß es nicht zerreißen wollte, bis an das Flußufer kroch, dort einen Pfahl in die Erde stieß, an diesem und an seinem Arm einen Strick befestigte und nun sich an dem steilen, zwanzig bis dreißig Fuß hohen Ufer hinabließ, so daß das ganze Gewicht seines Körpers von dem Fleische seines Armes getragen wurde. Hier hing er einige Tage gleich weit von dem hohen Uferrande und dem tiefen Wasser entfernt, bis endlich das Fleisch zerriß, er in den Fluß stürzte und sich durch Schwimmen rettete.
Aus dem bisher Gesagten ergibt sich wohl zur Genüge, daß im standhaften Ertragen von Schmerzen und Entbehrungen dem Indianer der Vorrang vor allen anderen Völkern gebührt, obgleich einige neuere Schriftsteller, aus Neid, Unwissenheit, oder aus irgendeinem anderen Grunde bemüht gewesen sind, ihm auch diesen Vorzug streitig zu machen. Und obgleich mir bei dem Anblicke dieser grausamen Gebräuche das Herz weh tat, so bin ich doch gern bereit, sie zu entschuldigen, daß sie so streng an einer Feier festhalten, deren Ursprung sie nicht kennen und die einen Teil ihrer religiösen Gebräuche bildet.
Als die jungen Leute sämtliche Martern überstanden hatten, ging der alte Medizinmann und Zeremonienmeister in die Medizinhütte und holte die »schneidenden Werkzeuge«, die, wie oben erwähnt, an der Tür jedes Wigwams gesammelt worden waren. Nachdem er die Hütte fest verschlossen hatte, begab er sich in Begleitung aller Medizinmänner und aller Bewohner ans Ufer und warf sämtliche Messer usw., als ein dem Wasser dargebrachtes Opfer, an einer sehr tiefen Stelle in den Fluß, von wo sie niemals wieder hervorgeholt werden können. Dies fand bei Sonnenuntergang statt und bildete den Schluß der religiösen Zeremonie der Mandaner Herr Catlin hat sich von den drei Personen, die während der ganzen Dauer des Okippe seine Begleiter waren, ein Zeugnis ausstellen lassen, daß er in der hier mitgeteilten Schilderung dieses Festes nichts übertrieben, sondern alles der Wahrheit gemäß berichtet hat. Die genannten drei Personen sind: J. Kipp, Agent der Amerikanischen Pelz-Compagnie aus New-York, L. Crawford, sein Sekretär, und Abraham Bogard. Anm. d. Übers..
Das sonderbare Land, in dem ich mich befand und die eigentümlichen Vorfälle und Ereignisse, die mir dort fast in jedem Augenblicke vor Augen traten, machten es mir damals unmöglich, eine genaue Untersuchung über das Erlebte anzustellen; aber selbst wenn ich Zeit dazu gehabt hätte und mit allen Nachrichten, die ich mir später noch verschafft habe, müßte ich doch befürchten, bei der Erklärung dieser rätselhaften Mysterien auf dieselbe Schwierigkeit zu stoßen, die mit der Erklärung der meisten Gebräuche und Überlieferungen dieses einfachen Volkes verbunden ist, das keine Geschichte besitzt, um Tatsachen und Systeme aufzubewahren und vor der Ausartung in abgeschmackte und unzusammenhängende Fabeln und Erdichtungen zu sichern.
Die wenigen wahrscheinlichen Folgerungen, die ich aus den oben erzählten wunderlichen Gebräuchen habe ableiten können, will ich, wenn auch mit einigem Mißtrauen, hier mitteilen.
Daß dies Volk eine Überlieferung von der großen Flut besitzt, ist keineswegs auffallend, da jeder Stamm, den ich besuchte, in seiner Nähe einen großen Berg als denjenigen bezeichnet, auf dem das große Kanoe landete; aber daß dies Volk dieses Ereignis jährlich feiert, daß diese Feier immer dann stattfindet, wenn die Weiden ihr volles Laub haben, daß die Medizinhütte durch eine Person wie Numánk-Máchana (der ein weißer Mann zu sein scheint) eröffnet wird und daß dieser Mann »von den hohen Bergen im Westen kommt«, sowie einige andere Umstände, dies alles ist gewiß sehr merkwürdig und verdient besondere Aufmerksamkeit.
Der erwähnte Numánk-Máchana (der erste oder einzige Mensch) ist unstreitig ein Medizinmann des Stammes, der am Abend zuvor in die Prärie hinausgegangen ist und, nachdem er sich für das Fest angekleidet und bemalt hat, am Morgen in das Dorf zurückkehrt, wo er den Anschein der Wirklichkeit zu erhalten sucht; denn ihre Überlieferung sagt, daß in sehr alter Zeit ein solcher Mann wirklich von Westen her kam – daß sein Körper von weißer Farbe war, wie jener seinen Körper bemalt –, daß er einen Anzug von vier weißen Wolfsfellen, einen Kopfputz von zwei Rabenbälgen und in der linken Hand eine große Pfeife trug. Er sagte, »daß er einstmals der einzige Mensch gewesen – er erzählte ihnen, daß alles auf der Oberfläche der Erde vom Wasser zerstört worden sei –, daß er mit seinem großen Kanoe an einen hohen Berg im Westen gekommen sei, wo er gelandet und sich gerettet habe – daß die Mandaner und alle anderen Menschen jährlich dem Wasser einige schneidende Werkzeuge opfern müßten, denn mit solchen Dingen sei das große Kanoe gemacht worden. Er unterrichtete die Mandaner, wie sie die Medizinhütte erbauen und die jährlichen Zeremonien feiern sollten. Auch sagte er ihnen, daß, solange sie diese Opfer brächten und jene Gebräuche streng beobachteten, sie stets das Lieblingsvolk des Allmächtigen bleiben und immer vollauf zu essen und zu trinken haben würden; sobald sie dagegen die vorgeschriebenen Formen auch nur in einer Beziehung vernachlässigten, so könnten sie versichert sein, daß ihr Stamm sich vermindern und endlich ganz verschwinden würde.«
Diese sonderbaren und unerklärlichen Gebräuche sind ohne Zweifel den Mandanern eigentümlich, obgleich die Mönnitarrier und einige andere benachbarte Stämme ebenfalls zu bestimmten Zeiten fasten und sich gewissen Martern unterziehen, die indes nur eine schwache Nachahmung der Zeremonien der Mandaner sind.
Aus ihrer Sage von dem Weidenzweige und der Taube scheint hervorzugehen, daß sie mit irgendeinem Teile der zivilisierten Welt in Verbindung gewesen sind, oder daß Missionare oder andere Personen früher unter ihnen gelebt haben, die sie mit der christlichen Religion und der mosaischen Lehre von der großen Flut bekannt machten, die von den Ansichten über dieses Ereignis, wie sie sich bei den meisten Naturvölkern finden, ganz verschieden ist.
Noch andere und fast entscheidende Beweise für die obige Behauptung einer Verbindung mit der zivilisierten Welt lassen sich aus der verschiedenen Färbung des Haares und der Haut, sowie aus der Sage von dem »ersten oder einzigen Menschen« ableiten, dessen Körper weiß war, der von Westen herkam, ihnen von der Zerstörung der Erde durch Wasser erzählte und sie in den Mysterien unterrichtete. Zu dem obigen will ich noch zwei Erzählungen hinzufügen, die mir von mehreren alten und würdigen Häuptlingen mitgeteilt wurden.
Die Mandaner (Volk der Fasanen) waren das erste Volk, das in der Welt erschaffen wurde und lebten ursprünglich im Innern der Erde. Sie pflanzten viele Weinreben, von denen eine durch ein Loch in der Erde nach oben gewachsen war; an dieser kletterte einer ihrer jungen Leute hinauf, bis er oben anlangte an dem Ufer des Flusses, wo das Dorf der Mandaner steht. Er blickte um sich und bewunderte das schöne Land und die Prärien – er sah viele Büffel, tötete einen mit seinem Bogen und seinen Pfeilen und fand dessen Fleisch wohlschmeckend. Er kehrte zurück und erzählte, was er gesehen hatte, worauf mehrere mit ihm an der Rebe hinaufkletterten und dieselben Dinge sahen. Unter denen, die hinaufkletterten, befanden sich auch zwei sehr schöne junge Frauenzimmer, welche Jungfrauen und daher Lieblinge der Häuptlinge waren. Als eine sehr große und beleibte Frau auch hinaufklettern wollte, wurde ihr dies von den Häuptlingen untersagt, weil sie zu schwer sei. Als sie sich jedoch einst allein sah, konnte sie ihre Neugier nicht länger bezwingen, sie fing an zu klettern, allein die Rebe brach unter dem Gewicht ihres Körpers und sie fiel herab, wodurch sie sich sehr verletzte, obgleich sie nicht starb. Die Mandaner waren hierüber sehr betrübt, und sie wurde von allen verachtet, weil sie die Veranlassung eines großen Unglücks war, das sich nicht wieder gut machen ließ; denn es konnte nun niemand mehr hinauf- und von den oben befindlichen keiner mehr herabsteigen. Letztere bauten das Mandanerdorf da, wo es früher stand, eine große Strecke den Fluß weiter abwärts; der übrige Teil des Volkes lebt noch jetzt in der Erde.
Diese Sage wird von den Häuptlingen und Doktoren oder Medizinmännern mit dem größten Ernste erzählt und die letzteren behaupten, daß sie zu gewissen Zeiten und an bestimmten Orten ihre Freunde durch die Erde hindurch könnten sprechen hören und daß sie diese in wichtigen Fällen um ihre Meinung und ihren Rat fragten.
Eine zweite Sage lautet folgendermaßen:
Vor sehr langer Zeit kam Ochkih-Häddäh (der Böse Geist, von dem oben bei der Beschreibung des Festes Okippe die Rede war) in Begleitung des Numánk-Máchana von Westen her in das Dorf der Mandaner und setzte sich neben eine Frau, die nur ein Auge hatte und Getreide behäufelte. Ihre Tochter, die sehr schön war, kam zu ihr und der Böse Geist bat sie, ihm Wasser zu bringen, doch wünschte er, daß sie vorher noch zu ihm komme und etwas Büffelfleisch esse; sie möge, sagte er, nur ein Stück aus seiner Seite nehmen. Sie tat dies, aß und fand, daß es wie Büffelfett schmeckte. Dann holte sie Wasser, von dem beide, die unterdes nach dem Dorfe gegangen waren, tranken – und weiter geschah nichts.
Die Freunde des Mädchens suchten sie bald darauf in Unehre zu bringen, indem sie erzählten, daß sie schwanger sei, was sie zwar nicht leugnete, zugleich aber ihre Unschuld beteuerte und kühn jeden Mann im Dorfe aufforderte, sie anzuklagen. Dies verursachte eine große Aufregung im Dorfe und da niemand auftrat, um sie zu beschuldigen, so wurde sie als »große Medizin« betrachtet. Bald nachdem dies geschehen, ging sie heimlich nach dem oberen Mandanerdorfe, wo das Kind geboren wurde.
Es wurden große Nachforschungen angestellt, ehe man sie fand, denn man erwartete, daß das Kind ebenfalls große Medizin und für das Bestehen und die Wohlfahrt des Stammes von großer Wichtigkeit sein werde. Zu diesem Glauben bewog sie die sonderbare Weise der Empfängnis und der Geburt des Kindes, auch bestätigten die Wunder, die es verrichtete, diesen Glauben. Außer anderen Wundern gab es den Mandanern, als sie nahe daran waren vor Hunger zu sterben, vier Büffel und sagte, daß diese sie für immer mit Nahrung versorgen würden, auch war, nachdem sie sich gesättigt, noch eben so viel Fleisch vorhanden, als vorher, ehe sie gegessen hatten. Der erste Mensch war jedoch entschlossen, das Kind zu töten und nachdem er es lange vergebens gesucht, fand er es einst an einem dunklen Orte, worauf er es ergriff und in den Fluß warf.
Als Ochkih-Häddäh den Tod dieses Kindes erfuhr, suchte er Numánk-Máchana auf, um ihn zu töten. Er verfehlte lange seine Spur und fand ihn endlich am Heart-(Herz-) Flusse, etwa fünfzehn Meilen unterhalb des Dorfes, mit der großen Medizinpfeife in der Hand, deren Zauber ihn gegen jeden Feind schützt. Sie versöhnten sich bald wieder, rauchten beide aus der großen Pfeife und kehrten in das Dorf der Mandaner zurück. Der Böse Geist war zufriedengestellt und Numánk-Máchana sagte den Mandanern, sie möchten niemals über den Heartfluß gehen, denn er sei die Mitte der Welt und wenn sie jenseits desselben lebten, so würden sie untergehen. Er gab dem Flusse den Namen Nátka pássahäh (Herz oder Mitte der Welt).
Ich habe hier einige der hauptsächlichsten Sagen dieses Volkes ganz so mitgeteilt, wie sie mir von den Indianern erzählt wurden und überlasse es jedem zu entscheiden, in wiefern sich daraus der Beweis herleiten läßt, daß dieses Volk seit langer Zeit eine unvollkommene Kenntnis von der Sündflut, von dem Erscheinen und dem Tode des Erlösers und dem Sündenfalle Evas besitzt.
Ob sie eine bestimmte Ansicht über die Schöpfung haben, konnte ich nicht erfahren, indes scheinen sie über ihre eigene Existenz als Volk nicht hinauszudatieren. Sie halten sich, wie bereits erwähnt, für das zuerst erschaffene Volk. Ein mandanischer Doktor erzählte mir, daß die Erde eine große Schildkröte sei, die das Land auf ihrem Rücken trage, daß ein weißer Volksstamm, der jetzt ausgestorben sei, sehr tief in diesem Boden zu graben pflegte, um Dachse zu fangen. Eines Tages stießen sie ein Messer durch die Schale der Schildkröte, worauf diese sank, das Wasser das Land überschwemmte und alle Menschen bis aus einen ertranken. Als ich später das Bildnis dieses Doktors malte, sagte er mir, daß vier Schildkröten, eine im Norden, eine im Osten, eine im Süden, eine im Westen, vorhanden seien, von denen jede zehn Tage lang Regen gemacht habe und daraus endlich die Erde mit Wasser bedeckt worden sei.
Diese sich widersprechenden Erzählungen von einem und demselben Manne geben wohl den besten Beweis von der mangelhaften Beschaffenheit der indianischen Überlieferungen. Vielleicht waren es aber in diesem Falle Sagen verschiedener Sekten oder verschiedener Priester, die häufig ganz entgegengesetzte Theorien und Überlieferungen in bezug auf Geschichte und Mythologie aufstellen.
Wie roh und lächerlich indes alle diese Sagen auch erscheinen mögen, so sind doch einige Umstände darin, die mit den eben mitgeteilten unerklärlichen religiösen Zeremonien in Verbindung stehen und wohl eine nähere Berücksichtigung verdienen.
Bei allen Festlichkeiten, wobei die Pfeife angezündet und im Kreise herumgereicht wird, suchen die mandanischen Häuptlinge und Doktoren die Gunst des Großen Geistes dadurch zu gewinnen, daß sie, bevor sie selbst rauchen, die Pfeife mit der Spitze aufwärts nach den vier Weltgegenden richten. Die jährliche religiöse Zeremonie währt stets vier Tage und mehrere andere Umstände bei dieser Feierlichkeit scheinen mit den vier Weltgegenden oder den »vier Schildkröten« in Verbindung zu stehen. Vier Männer werden stets von Numánk-Máchana ausgewählt, um die Medizinhütte zu dem Feste vorzubereiten und zu reinigen, und zwar beruft er dazu aus jeder der vier Weltgegenden einen. Die vier Wassersäcke in Form von Schildkröten, die nebst den vier Büffel- und vier Menschenschädeln auf dem Fußboden der Hütte liegen, sowie die vier Paar Tänzer und die vier sich einmischenden Tänzer beziehen sich offenbar auf denselben Gegenstand.
Der Stiertanz, den man an den vier Tagen des Festes tanzt, wird am ersten Tage viermal, am zweiten achtmal, am dritten zwölfmal und am vierten sechzehnmal, im ganzen also vierzigmal wiederholt, was genau die Dauer der Sündflut nach der mosaischen Urkunde ist. Vier Opfer von schwarzem und blauem Tuch sind vor der Tür der Medizinhütte errichtet; der Böse Geist stattet den vier Büffeln im Stiertanze Besuche ab, und die jungen Leute, die sich den oben beschriebenen Martern unterzogen, hatten vier Stäbchen in den Beinen, vier in den Armen und vier am Körper.
Hiermit will ich meine Nachrichten über die Mandaner und ihre sonderbaren Gebräuche schließen. Ich könnte mit ihren Erzählungen und Überlieferungen leicht noch einen ganzen Band füllen; allein dies wäre nur ein Band voll Fabeln, die nicht des Erwähnens wert sind; denn ein Indianerstamm im Urzustande, der keine Geschichtsschreiber besitzt, hat nur eine temporäre historische Existenz und was man über seine Geschichte mit Sicherheit erfahren kann, läßt sich auf wenigen Seiten zusammenfassen.
Wenn ich bei den Mandanern länger verweilte, als es bei irgendeinem anderen Stamme der Fall sein wird, so geschah dies, weil ich aus ihrer Persönlichkeit, ihren Gebräuchen, ihren Überlieferungen und ihrer Sprache die Überzeugung gewonnen habe, daß sie einen von den übrigen Stämmen dieser Gegenden ganz verschiedenen Ursprung haben und als ein wenig zahlreicher und schwacher Stamm in dem beständigen Kampfe mit den mächtigen Sioux bald unterliegen müssen.
Aus den oben geschilderten barbarischen Gebräuchen wird man natürlich schließen, daß dies Volk zu den grausamsten und unmenschlichsten in der Welt gehöre. Dies ist jedoch nicht der Fall, und ich halte es für meine Pflicht, zu erklären, daß es im ganzen genommen kein besseres, ehrenwerteres, freieres Volk auf der Erde gibt, daß man den Weißen nirgends schneller und herzlicher willkommen heißt, und daß niemand mehr auf sein gegebenes Wort und auf seine Ehre hält.
Man wird unstreitig die Frage aufwerfen, ob es nicht möglich sei, diese grausamen Gebräuche unter den Mandanern auszurotten, sie zur christlichen Religion zu bekehren und an den Ackerbau zu gewöhnen. Dies alles muß ich mit »ja« beantworten; denn obgleich diese Gebräuche seit undenklichen Zeiten bei ihnen einheimisch sind und einen Teil ihrer Religion bilden, und unwissende und abergläubische Völker hartnäckig an ihren religiösen Meinungen festzuhalten pflegen, so glaube ich dennoch, daß die Bestrebungen der Missionare nirgends mit glücklicherem Erfolge gekrönt werden dürften, als unter den freundlichen und gastfreien Mandanern.