
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Eine der artenreichsten Familien umfaßt die Sänger ( Sylviidae), kleine, gestreckt gebaute Sperlingsvögel, mit schlankem, dünnem, pfriemenförmigem, auf der Firste bis zur leicht ausgerundeten Spitze gekrümmtem Schnabel, kurzen oder höchstens mittelhohen Füßen, deren Läufe vorn mit getheilten Schildern bekleidet sind, mittellangen, meist gerundeten Flügeln, deren Handtheil stets zehn Schwingen trägt, verschiedenartig gebildetem, kürzerem oder längerem Schwanze und seidenweichem Gefieder.
Nicht weniger als etwa vierhundertundfunfzig Arten von Sperlingsvögeln gehören der Sängerfamilie an. Sie verbreitet sich über alle Theile der Osthälfte der Erde und fehlt nur in Amerika. Sänger bewohnen alle Gebiete und alle Gürtel der Höhe und Breite und werden, wo das Gelände mit Pflanzen bestanden ist, nirgends vermißt; sie herbergen im Walde wie in einzelnen Gebüschen, in der hochstämmigen Heide, wie im Röhrichte, Schilfe oder Riede; sie beleben daher die verschiedensten Oertlichkeiten, und zwar, ihrer hohen Begabung entsprechend, meist in höchst anmuthiger Weise. Munter und thätig, bewegungslustig und unruhig, durchschlüpfen und durchkriechen sie die dichtesten Bestände der verschiedenartigsten Pflanzen mit unübertrefflicher Gewandtheit. Sie beherrschen das Gezweige der Bäume ebenso wie das verfilzte Buschdickicht und das dichteste Ried; sie laufen zum Theile ebensogut, als sie schlüpfen, und fliegen, wenn auch nicht gerade ausgezeichnet, so doch meist recht leidlich, gefallen sich sogar in Flugkünsten mancherlei Art. Weitaus die meisten verdienen ihren Namen; denn alle Mitglieder ganzer Unterfamilien zählen zu den trefflichsten Sängern, welche wir kennen; einzelne sind wahre Meister in dieser Kunst. Auch ihre höheren Fähigkeiten müssen als wohl entwickelte bezeichnet werden. Die Sinne scheinen ziemlich gleichmäßig ausgebildet zu sein, und der Verstand wird von niemand unterschätzt werden, welcher sie kennen lernt. Sie sind klug, wissen sich den Umständen gemäß einzurichten, unterscheiden ihre Freunde und Feinde, zeigen sich zutraulich, wo dies gerechtfertigt ist, und scheu, wo sie Nachstellungen erfahren haben, bekunden List wie Ehrlichkeit, Geradheit, Zuthunlichkeit wie Mißtrauen, leben mit anderen Vögeln in bester Eintracht, so lange sie es können, und mit ihresgleichen in Frieden, so lange mit der Liebe nicht auch die Eifersucht in ihnen sich regt, bethätigen sich als treue Gatten und hingebende Eltern, opfern ihrer Brut zu Liebe in wunderbar rührender Weise sich auf, vereinigen mit einem Worte die vielseitigsten und trefflichsten Eigenschaften in sich.
Alle bei uns im Norden wohnenden Arten sind Zugvögel; die meisten erscheinen auch erst, wenn der Frühling wirklich eingezogen ist, in der Heimat. Dann grenzt sich jedes Paar sein Brutgebiet, sei dasselbe groß oder klein, gegen andere derselben Art ab und duldet nur ausnahmsweise innerhalb desselben ein zweites. Unmittelbar nach der Wahl des Gebietes beginnt der Bau des Nestes, welches je nach der Art ebenso verschieden gestellt als ausgeführt sein kann. Beide Eltern pflegen das aus vier bis sechs, höchstens acht Eiern bestehende Gelege abwechselnd zu bebrüten, und beide widmen sich der Brutpflege mit gleichem Eifer. Die Jungen werden ausschließlich mit Kerbthieren aufgefüttert, und diese bleiben auch die hauptsächlichste Nahrung der alten Vögel, obgleich sie im Herbste allerlei Beeren und andere Früchte nicht gänzlich verschmähen. Merkbar schädlich wird uns kein einziger Sänger, nützlich wohl jeder, so schwierig es auch sein mag, dies immer zu erkennen. Alle verdienen daher in demselben Maße unseren Schutz und die Liebe, welche sie, Dank ihres vortrefflichen Gesanges, glücklicherweise fast ausnahmslos bei alt und jung sich erworben haben; alle eignen sich auch zu Käfigvögeln und werden als solche, trotz mancher Irrwege, auf welche die Liebhaberei in der Neuzeit gerathen, stets hohen Rang behaupten.
Unter allen Sängern stehen wohl die Grasmücken ( Sylviinae) obenan. Ihre Merkmale liegen in dem schlanken Baue, dem kegelpfriemenförmigen, an der Wurzel noch ziemlich starken, auf der Firste sanft gebogenen, an der Spitze übergekrümmten, vor derselben mit kleinem Ausschnitte versehenen Schnabel, den starken, ziemlich kurzen Füßen, den mittellangen, leicht zugerundeten Flügeln, unter deren Schwingen die dritte und vierte die anderen überragen, den kurzen oder mittellangen, stets aus zwölf Federn gebildeten Schwanz, sowie endlich dem reichen, seidigweichen, in der Regel nicht besonders lebhaft gefärbten Federkleide.
Die Grasmücken, kaum fünfundzwanzig Arten umfassend, bewohnen die Osthälfte der Erde, in größter Anzahl den nördlichen altweltlichen Gürtel, nehmen in Laub- und Nadelwäldern, Gebüschen und Gärten ihren Stand, halten sich in der Höhe wie in der Tiefe auf, vereinigen fast alle Begabungen ihrer Familiengenossen in sich, singen vorzüglich, fressen Kerbthiere, Spinnen, Früchte und Beeren und bauen niedrig im Gebüsche unkünstliche Nester.

Südeuropäische Grasmücken
1 Provencesänger. 2, 3 Masken-, 4 Sarden-, 5 Brillengrasmücke. 6 Sammetköpfchen. 7 Bartgrasmücke.
Die größte aller in Deutschland lebenden Arten der Sippe ist die Sperbergrasmücke auch Spanier genannt ( Sylvia nisoria, Curruca und Philacantha nisoria, Adophoneus nisorius, undatus und undulatus, Nisoria undata und undulata). Ihre Länge beträgt achtzehn, ihre Breite neunundzwanzig, ihre Fittiglänge neun, ihre Schwanzlänge acht Centimeter. Die Oberseite des Gefieders ist olivenbraungrau, der Oberkopf etwas dunkler, der Bürzel und das Oberschwanzdeckgefieder mit schmalen weißen, innen schwärzlich gerandeten Endsäumen, das der Stirn und Augenbrauen mit äußerst schmalen weißlichen Spitzen geziert, das des Zügels grau, der Unterseite weiß, an den Kopf- und übrigen Körperseiten, an Kinn und Kehle mit schmalen dunklen Endsäumen, auf den Unterflügeln und Unterschwanzdecken mit dunklen Keilflecken gezeichnet; Schwingen und Schwanzfedern sind dunkelbraun, außen schmal fahlweiß, innen breiter weißlich gerandet, die Enden der Armschwingen und deren Deckfedern sowie der größten oberen Flügeldeckfedern, weißlich gesäumt, die äußersten drei Schwanzfedern innen am Ende breitweiß gefärbt. Die Iris ist citrongelb, der Schnabel hornbraun, unterseits horngelb, der Fuß lichtgelb. Das Weibchen unterscheidet sich durch mattere Färbung.
Vom südlichen Schweden an bewohnt oder besucht die Sperbergrasmücke Mittel- und Südeuropa, mit Ausschluß Großbritanniens, ebenso das westliche Asien und Nordchina, und wandert im Winter bis ins Innere Afrikas. In einzelnen Theilen unseres Vaterlandes, namentlich in den Auen und an buschigen Ufern größerer Flüsse, ist sie häufig, an anderen Orten fehlt sie gänzlich oder gehört wenigstens zu den größten Seltenheiten. Bei uns zu Lande erscheint sie nie vor dem letzten Tage des April, meist erst im Anfange des Mai und verweilt höchstens bis zum August in der Heimat. Zu ihrem Sommeraufenthalte wählt sie niederes Gebüsch, dabei mit Vorliebe Dickichte, verläßt dieselben aber, wenn sie zum Stangenholze heranwuchsen, um sich anderen, aus jungem Nachwuchse gebildeten zuzuwenden. Höhere Bäume besucht sie bloß während ihres Zuges.
Auf dem Boden bewegt sie sich schwerfällig, kommt daher auch selten zu ihm herab, fliegt dagegen, obschon ungern, recht gut und durchschlüpft das Gezweige mit überraschender Fertigkeit. Ihre Lockstimme ist ein schnalzendes »Tschek«, der Warnungslaut ein schnarchendes »Err«, der Gesang, gleichsam eine Zusammensetzung des Liedes der Garten- und der Dorngrasmücke, nach Oertlichkeit und Vogel verschieden, im allgemeinen wohllautend und reichhaltig, mit dem einer dem Gebirge entstammten Mönchsgrasmücke jedoch kaum zu vergleichen, auch dem unserer Gartengrasmücke nachstehend, so sehr er diesem im ganzen ähneln mag. Der Pfiff des Pirols, der Schlag des Finken, der sogenannte Ueberschlag des Mönchs und andere, den umwohnenden Singvögeln abgeborgte Töne werden häufig eingewoben; das Schnarren oder Trommeln aber, welches der Sperbergrasmücke eigenthümlich ist und dem Gesange vorauszugehen pflegt, fällt unangenehm in das Ohr. Wie die meisten Verwandten ist auch die Sperbergrasmücke ein sehr fleißiger Sänger und deshalb ein wahrer Schatz für den Wald.
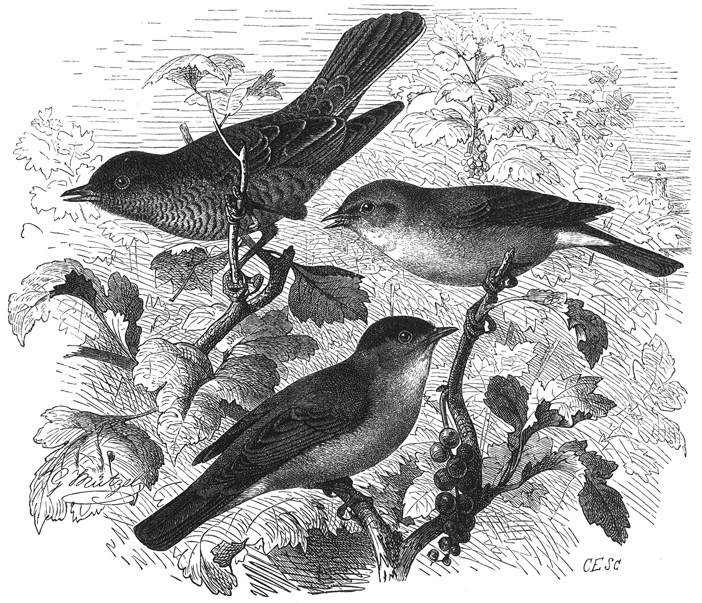
Sperber-, Garten- und Mönchsgrasmücke ( Sylvia nisoria, hortensis und atricapilla). 1/2 natürl. Größe.
Sofort nach der Ankunft im Frühjahre wählt sich jedes Paar ein Gebiet und vertreibt aus ihm alle anderen, welche etwa eindringen. »Das Männchen«, sagt Naumann, »ruht, wenn ein anderes in seinen Bezirk kommt, nicht eher, bis es dasselbe mit grimmigen Bissen daraus vertrieben hat, und beide raufen sich oft tüchtig. Während das Weibchen das niedere Gebüsch durchkriecht, am Neste baut oder auf demselben sitzt, treibt sich das Männchen über ihm in den höheren Bäumen unruhig umher, singt, schreit und achtet darauf, daß kein Nebenbuhler kommt. Erscheint einer, so wird er sogleich angefallen und so lange verfolgt, bis er die Flucht ergreift.«
Das Nest steht im Dickichte oder in großen, natürlichen Dornhecken, meist ziemlich gut versteckt, in einer Höhe von einem Meter und mehr über dem Boden. Es unterscheidet sich in der Bauart nicht von dem allgemeinen Gepräge. Ende Mai oder Anfang Juni findet man in ihm vier bis sechs gestreckte, zwanzig Millimeter lange, vierzehn Millimeter dicke, zartschalige, wenig glänzende Eier, welche gewöhnlich auf grauweißem Grunde mit hell aschgrauen und blaß olivenbraunen Flecken gezeichnet sind. Die Eltern bekunden am Neste das tiefste Mißtrauen und versuchen regelmäßig, sich zu entfernen, wenn sie ein Geschöpf bemerken, welches sie fürchten. Das Weibchen gebraucht im Nothfalle die bekannte List, sich lahm und krank zu stellen. Nähert man sich einem Neste, bevor es vollendet ist, so verlassen es die Alten gewöhnlich sofort und erbauen dann ein neues; sie verlassen selbst die bereits angebrüteten Eier, wenn sie merken, daß diese von Menschenhänden berührt wurden. Die Jungen bringen die Gewandtheit ihrer Eltern im Durchschlüpfen des Gebüsches, so zu sagen, mit auf die Welt, treten daher sehr bald selbständig auf und entfernen sich vom Neste, noch ehe sie ordentlich fliegen können. Ungestört brütet das Paar nur einmal im Jahre; es hat bei der Kürze seines Aufenthaltes in der Heimat zu mehreren Bruten kaum Zeit.
Die Nahrung besteht, wie bei allen Grasmücken, in Kerbthieren, welche auf Blättern und in Blüten leben, zumal Räupchen und Larven verschiedener, meist schädlicher Schmetterlinge und Käfer, Spinnen und allerlei Gewürm, im Herbste aber vorzugsweise in genießbaren Beeren aller Art, im Sommer wohl auch in Kirschen.
Bei geeigneter Pflege gewöhnt sich die Sperbergrasmücke im Gebauer ebenso gut und rasch ein wie ihre übrigen deutschen Verwandten, ist auch nicht anspruchsvoller als diese, singt bald fleißig und wird zuletzt sehr zahm.
Die zweitgrößte Grasmücke Europas ist der Meistersänger ( Sylvia orphea, grisea, crassirostris und caniceps, Curruca orphea, musica, Helenae und Jerdoni, Philomela orphea, Bild S. 165). Ihre Länge beträgt siebzehn, die des Weibchens sechzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sieben Centimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite aschgrau, auf dem Rücken bräunlich überflogen, auf dem Scheitel und dem Nacken bräunlich oder mattschwarz, auf der Unterseite weiß, seitlich der Brust licht rostfarbig; die Schwingen und die Steuerfedern sind matt schwarzbraun; die schmale Außenfahne der äußersten Schwanzfeder ist weiß; die breite Innenfahne zeigt an der Spitze einen weißen keilförmigen Fleck von derselben Färbung, die zweite einen weißen Spitzenfleck. Das Auge ist hellgelb, der Oberschnabel schwarz, der Unterschnabel bläulichschwarz, der Fuß röthlichgrau, ein nackter Ring ums Auge blaugrau. Das Weibchen ist blasser gefärbt als das Männchen und namentlich die Kopfplatte lichter.
Der Meistersänger gehört dem Süden Europas an; seine Heimat beginnt im nördlichen Küstengebiete des Mittelmeeres, uns zunächst in Istrien oder der südlichen Schweiz. Da, wo in Spanien die Pinie ihre schirmförmige Krone ausbreitet, da, wo in den Fruchtebenen Johannisbrod-, Feigen- und Oelbäume zusammenstehen, wird man selten vergeblich nach ihm suchen. Unter gleichen Umständen lebt er in Griechenland oder auf der Balkanhalbinsel überhaupt, in Italien und Südfrankreich wie in Südrußland, hier wie dort als Sommergast, welcher hier zu Ende des März oder im Anfange des April erscheint und im September wieder verschwindet, in Spanien dagegen nicht vor Ende April, zuweilen erst Anfang Mai eintrifft und kaum länger als bis zum August im Lande verweilt. In Westasien ist er ebenfalls heimisch, in Kleinasien, Persien wie in Turkestan gemein, und auch in Gebirgslagen von zweitausend Meter Höhe noch Brutvogel. Deutschland und England soll er wiederholt besucht haben. Seine Winterreise dehnt er bis Mittelafrika und Indien aus: ich erlegte ihn in den Wäldern des Blauen Flusses; Jerdon beobachtete ihn als häufigen Wintergast in ganz Südindien.
Abweichend von anderen Grasmücken bevorzugt der Meistersänger höhere Bäume; in dem eigentlichen Niederwalde ist er von uns niemals beobachtet worden. Die Ebenen beherbergen ihn weit häufiger als die Gebirge; denn das bebaute üppige Land, welches regelmäßig bewässert wird, scheint ihm alle Erfordernisse zum Leben zu bieten. Sehr gern besiedelt er auch Kieferwälder. An derartigen Oertlichkeiten vernimmt man überall seinen Gesang, und hier sieht man, wenn man den Klängen vorsichtig nachgeht, das Paar in den höheren Baumkronen sein Wesen treiben. Auch der Meistersänger ist mißtrauisch und vorsichtig, läßt sich ungern beobachten, sucht beim Herannahen des Jägers immer die dichtesten Zweige der Bäume auf und weiß sich hier so vortrefflich zu verstecken, daß er auf lange Zeit vollkommen unsichtbar ist.
Der Meistersänger verdient seinen Namen. Man hat den Werth seines Liedes beeinträchtigen wollen; soviel aber ist zweifellos, daß er selbst in seiner Familie einen hohen Rang einnimmt. Das Lied erinnert einigermaßen an den Schlag unserer Amsel, ist jedoch nicht so laut und wird auch nicht ganz so getragen gesungen. Alexander von Homeyer, welcher einen Meistersänger längere Zeit im Käfige hielt, sagt, daß er vorzüglicher sänge als irgend eine Grasmücke. »Der Gesang ist höchst eigenthümlich. Man wird ihn freilich nur für einen Grasmückengesang halten können, durch den ruhigen Vortrag melodisch zusammengefügter Strophen aber doch auch an einen Spöttergesang erinnert werden, indem er trotz seiner, nur den Grasmücken eigenen Rundung zeitweise das abgesetzte und schnalzende des Gartensängers hat. Besonders in der Fülle des Tons, sowie im allgemeinen in der Art des Vortrags gleicht dieser Gesang am meisten dem der Gartengrasmücke, ist aber lauter, mannigfaltiger, und großartiger. Bald ist der Ton gurgelnd, bald schmatzend, bald schäckernd, bald frei heraus von einer solchen Kraft und Fülle, daß er wahrhaft überrascht, während gerade die Gartengrasmücke immer einen und denselben Vortrag behält und aus ihren ruhigen Gurgel- und schnarrenden Tönen nicht herauskommt. Dabei werden die Töne und Strophen des Liedes so deutlich gegeben, daß man sie während des Singens nachschreiben kann, ohne sich übereilen zu müssen. Der Warnungslaut klingt schnalzend wie ›Jett, tscherr‹ und ›Truii rarara‹, der Angstruf, welcher schnell hinter einander wiederholt wird, wie ›Wieck wieck‹.« Einzelne Meistersänger nehmen auch Töne aus vieler anderer Vögel Liedern auf.
Die Nahrung besteht in entsprechendem Kleingethier, Früchten und Beeren seiner Heimat.
Die Brutzeit beginnt in der Mitte des Mai und währt bis zur Mitte des Juli; dann tritt die Mauser ein. Während der Paarungszeit sind die Männchen im höchsten Grade streitlustig, und wenn ihre Eifersucht rege wird, verfolgen sie sich wüthend. Das Nest steht hoch oben in der Krone der Bäume, ist gewöhnlich nicht versteckt, sondern leicht sichtbar, zwischen die Astspitzen gesetzt. In der Bauart unterscheidet es sich nur dadurch von anderen Grasmückennestern, daß es dickwandiger und nicht so lose gebaut ist. Inwendig sind manche Nester mit Rindenstreifen von Weinreben ausgelegt; Thienemann erwähnt eines, welches sogar mit Fischschuppen ausgekleidet war. Das Gelege besteht aus fünf feinschaligen, feinporigen und glänzenden Eiern, welche auf weißem oder grünlichweißem Grunde violettgraue Unter- und gelbbraune Oberflecken zeigen. Letztere können auch gänzlich fehlen. Das Weibchen scheint, nach Krüper, das Brutgeschäft allein zu übernehmen; das Männchen sitzt währenddem nicht in der Nähe, sondern in bedeutender Entfernung vom Neste und singt hier seine Lieblingslieder. Die Jungen werden noch einige Zeit nach dem Ausfliegen geführt und zwar von beiden Eltern; sobald aber die Mauser eintritt, lösen sich die Familien auf, und jedes einzelne Mitglied treibt sich nun allein umher.
»Der Vogel, welcher von allen anderen der Kanarischen Inseln den schönsten Gesang hat, der Capriote, ist in Europa unbekannt. Er liebt so sehr die Freiheit, daß er sich niemals zähmen läßt. Ich bewunderte seinen weichen, melodischen Schlag in einem Garten bei Orotava, konnte ihn aber nicht nahe genug zu Gesicht bekommen, um zu bestimmen, welcher Gattung er angehörte.« So sagt Alexander von Humboldt, und es sind nach des großen Forschers Besuch auf den Inseln noch Jahre vergangen, bevor wir erfuhren, welchen Vogel er meinte. Jetzt wissen wir, daß der hochgefeierte Capriote, welchen der Kanarier mit Stolz seine Nachtigall nennt, kein anderer ist, als die Mönchsgrasmücke, Mönch, Schwarzplättchen, Schwarzkappe, Schwarz-, Mohren- oder Mauskopf, Kardinälchen, Kloster- oder Mönchswenzel ( Sylvia atricapilla, nigricapilla, ruficapilla, rubricapilla, pileata und Naumanni, Motacilla, Curruca, Philomela und Epilais atricapilla, Monachus atricapillus, Bild S. 182), einer der begabtesten, liebenswürdigsten und gefeiertesten Sänger unserer Wälder und Gärten. Das Gefieder der Oberseite ist grauschwarz, das der Unterseite lichtgrau, das der Kehle weißlichgrau, das des Scheitels beim alten Männchen tiefschwarz, beim Weibchen und jungen Männchen rothbraun gefärbt. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarz, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt fünfzehn, die Breite einundzwanzig Centimeter, die Fittiglänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Das Weibchen ist ebenso groß wie das Männchen.
Der Mönch bewohnt ganz Europa, einschließlich Madeiras, nach Norden hin bis Lappland, Westasien, die Kanarischen Inseln und Azoren, während er in Griechenland wie in Spanien nur auf dem Zuge erscheint, überwintert schon hier, dehnt aber seine Wanderung bis Mittelafrika aus. Er trifft bei uns gegen die Mitte des April ein, nimmt in Waldungen, Gärten und Gebüschen seinen Wohnsitz und verläßt uns im September wieder. So viel mir bekannt, fehlt er keinem Gau unseres Vaterlandes, ist aber in einzelnen Gegenden, beispielsweise in Ostthüringen, seit einem Menschenalter merklich seltener geworden, als er früher war.
»Der Mönch«, sagt mein Vater, welcher die erste eingehende Schilderung seines Lebens gegeben hat, »ist ein munterer, gewandter und vorsichtiger Vogel. Er ist in steter Bewegung, hüpft unaufhörlich und mit großer Geschicklichkeit in den dichtesten Büschen herum, trägt dabei seinen Leib gewöhnlich wagerecht und die Füße etwas angezogen, legt die Federn fast immer glatt an und hält sich sehr schmuck und schön. Auf die Erde kommt er selten. Sitzt er frei, und nähert man sich ihm, so sucht er sich sogleich in dichten Zweigen zu verbergen oder rettet sich durch die Flucht. Er weiß dies so geschickt einzurichten, daß man den alten Vögeln oft lange vergeblich mit der Flinte nachgehen muß. Die Jungen sind, auch im Herbste noch, weniger vorsichtig. Sein Flug ist geschwind, fast geradeaus mit starker Schwingenbewegung, geht aber selten weit in einem Zuge fort. Nur nach langer Verfolgung steigt er hoch in die Luft und verläßt den Ort ganz. Zur Brutzeit hat er einen ziemlich großen Bezirk und hält sich zuweilen nicht einmal in diesem. Bei kalter und regnerischer Witterung habe ich die Mönche, welche unsere Wälder bewohnen, manchmal nahe bei den Häusern in den Gärten gehört. Sein Lockton ist ein angenehmes ›Tack, tack, tack‹, worauf ein äußerst sanfter Ton folgt, welcher sich mit Buchstaben nicht bezeichnen läßt. Dieses ›Tack‹ hat mit dem der Nachtigall und der Klappergrasmücke so große Aehnlichkeit, daß es nur der Kenner gehörig zu unterscheiden vermag. Es drückt, verschieden betont, verschiedene Gemüthszustände aus und wird deswegen am meisten von den Alten, welche ihre Jungen führen, ausgestoßen. Das Männchen hat einen vortrefflichen Gesang, welcher mit Recht gleich nach dem Schlage der Nachtigall gesetzt wird. Manche schätzen ihn geringer, manche höher als den Gesang der Gartengrasmücke. Die Reinheit, Stärke und das Flötenartige der Töne entschädigen den Liebhaber hinlänglich für die Kürze der Strophen. Dieser schöne Gesang, welcher bei einem Vogel herrlicher ist als bei dem anderen, fängt mit Anbruch des Morgens an und ertönt fast den ganzen Tag.« Hinsichtlich seiner Nahrung unterscheidet er sich nur insofern von anderen Grasmücken, als er leidenschaftlich gern Früchte und Beeren frißt und sie auch schon seinen Jungen füttert.
Der Mönch brütet zweimal des Jahres, das erstemal im Mai, das zweitemal im Juli. Das Nest steht stets im dichten Gebüsche, da wo der Schwarzwald vorherrscht, am häufigsten in dichten Fichtenbüschen, da wo es Laubhölzer gibt, hauptsächlich in Dornbüschen verschiedener Art. Es ist verhältnismäßig gut, aber durchaus nach Art anderer Grasmückennester erbaut. Das Gelege besteht aus vier bis sechs länglichrunden, glattschaligen, glänzenden Eiern, von achtzehn Millimeter Länge und vierzehn Millimeter Dicke, welche auf fleischfarbenem Grunde mit dunkleren und braunrothen Flecken, Schmitzen und Punkten gezeichnet sind. Beide Geschlechter brüten, beide lieben ihre Brut mit gleicher Liebe, und beide betragen sich bei Gefahr wie ihre Verwandten. Kommt durch Zufall die Mutter ums Leben, so übernimmt das Männchen ausschließlich die Aufzucht der Jungen.
Des ausgezeichneten Gesanges wegen wird der Mönch häufiger als alle übrigen Grasmücken im Käfige gehalten. Die vorzüglichsten Sänger sind diejenigen, welche aus Fichtenwäldern des Gebirges stammen, aber auch die, welche im Laubholze groß wurden, Meister in ihrer Kunst. »Der Mönch«, rühmt Graf Gourcy mit vollstem Rechte, »ist einer der allerbesten Sänger und verdient, meinem Geschmacke nach, in der Stube den Rang vor jeder Nachtigall. Sein langer, in einem fortgehender Gesang ist flötender und mannigfaltiger, dabei nicht so durchdringend als jener der beiden Nachtigallarten, von deren Schlägen der Mönch ohnehin sehr viel dem seinigen einmischt. Viele unter ihnen singen fast das ganze Jahr, andere acht bis neun Monate. Die aufgezogenen taugen nichts, lernen aber zuweilen ein Liedchen pfeifen. Ein solcher Vogel trug das Blasen der Postknechte prächtig vor.« Alle Mönche, selbst die Wildfänge, werden außerordentlich zahm und sind dann ihrem Herrn so zugethan, daß sie ihn oft schon von weitem mit Gesang begrüßen und sich darin, selbst wenn er ihren Käfig umherträgt, nicht stören lassen. »Die Hauptstadt Kanarias«, erzählt Bolle, »erinnert sich noch des Capriote einer früheren Nonne, die täglich, wenn sie dem noch jungen Vögelchen Futter reichte, wiederholt: » mi niño chicheritito« (mein allerliebstes Kindchen) zu ihm sagte, welche Worte dasselbe bald ohne alle Mühe, laut und tönend, nachsprechen lernte. Das Volk war außer sich ob der wundersamen Erscheinung eines sprechenden Singvogels. Jahrelang machte er das Entzücken der Bevölkerung aus, und große Summen wurden der Besitzerin für ihn geboten. Umsonst! Sie vermochte nicht, sich von ihrem Lieblinge zu trennen, in dem sie die ganze Freude, das einzige Glück ihres Lebens fand. Aber was glänzende Versprechungen außer Stande gewesen waren, ihr zu entreißen, das raubte der Armen die, selbst unter den sanften, freundlichen Sitten der Kanarier nicht ganz schlummernde Bosheit: der Vogel ward von neidischer Hand vergiftet. Sein Ruf aber hat ihn überlebt, und noch lange wird man von ihm in der Ciudad de las Palmas sprechen.«
Dem Meistersänger und Mönch als Sängerin fast ebenbürtig ist die Gartengrasmücke, Grasmücke oder Grashexe ( Sylvia hortensis, aedonia und salicaria, Motacilla, Curruca, Epilais und Adornis hortensis, Motacilla salicaria, Curruca grisea und brachyrhynchos, Bild S. 182). Ihre Länge beträgt sechzehn, die Breite fünfundzwanzig, die Fittiglänge acht, die Schwanzlänge sechs Centimeter. Das Weibchen ist bedeutend kleiner, dem Männchen aber durchaus ähnlich gefärbt. Das Gefieder der Oberseite ist olivengrau, das der Unterseite hellgrau, an der Kehle und am Bauche weißlich; Schwingen und Schwanz sind olivenbraun, außen schmal fahlgrau, erstere innen breiter fahlweißlich gesäumt. Ein das Auge umgebender, sehr schmaler Federkranz ist weiß, das Auge selbst licht graubraun, der Schnabel wie der Fuß schmutzig bleigrau.
Als die Heimat der Gartengrasmücke darf Mitteleuropa angesehen werden. Nach Norden hin verbreitet sie sich bis zum neunundsechzigsten Grade nördlicher Breite; nach Süden hin nimmt sie rasch an Anzahl ab; nach Osten hin überschreitet sie den Ural nicht. In Südfrankreich und in Italien tritt sie häufig auf; in Spanien und Portugal ist sie ebenfalls Brutvogel; Griechenland und Kleinasien dagegen berührt sie nur während ihres Zuges, welcher sie bis Westafrika führt. Sie trifft bei uns frühestens zu Ende des April oder im Anfange des Mai ein und verläßt uns im September wieder. Auch sie lebt im Walde, und zwar im Laub- wie im Nadelwalde, bewahrheitet jedoch auch ihren Namen; denn jeder buschreiche Garten, namentlich jeder Obstgarten, weiß sie zu fesseln. Sie treibt sich ebensoviel in niederen Gebüschen wie in den Kronen mittelhoher Bäume umher, wählt aber, wenn sie singen will, gern eine mäßige Höhe.
»Sie ist«, wie Naumann sagt, »ein einsamer, harmloser Vogel, welcher sich durch stilles, jedoch thätiges Leben auszeichnet, dabei aber keinen der ihn umgebenden Vögel stört oder anfeindet und selbst gegen die Menschen einiges Zutrauen verräth; denn sie ist vorsichtig, aber nicht scheu und treibt ihr Wesen oft unbekümmert in den Zweigen der Obstbäume, während gerade unter ihr Menschen arbeiten. Sie hüpft wie die anderen Grasmücken in sehr gebückter Stellung leicht und schnell durch die Aeste hin, aber ebenso schwerfällig, schief und selten auf der Erde wie jene. Da sie mehr auf Bäumen als im Gebüsche lebt, so sieht man sie auch öfter als andere Arten von Baum zu Baum selbst über größere freie Flächen fliegen; sie schnurrt dann schußweise fort, während sie im Wanderfluge eine regelmäßigere Schlangenlinie beschreibt.« Die Lockstimme ist ein schnalzendes »Täck täck«, der Warnungsruf ein schnarchendes »Rhahr«, der Angstruf ein schwer zu beschreibendes Gequak, der Ausdruck des Wohlbehagens ein sanftes, nur in der Nähe vernehmliches »Biwäwäwü«. Der Gesang gehört zu den besten, welche in unseren Wäldern oder Gärten laut werden. »Sobald das Männchen«, fährt Naumann fort, »im Frühlinge bei uns ankommt, hört man seinen vortrefflichen, aus lauter flötenartigen, sanften, dabei aber doch lauten und sehr abwechselnden Tönen zusammengesetzten Gesang, dessen lange Melodie im mäßigen Tempo und meistens ohne Unterbrechung vorgetragen wird, aus dem Grün der Bäume erschallen, und zwar vom frühen Morgen bis nach Sonnenuntergang, den ganzen Tag über, bis nach Johannistag. Nur in der Zeit, wenn das Männchen brüten hilft, singt es in den Mittagsstunden nicht, sonst zu jeder Tageszeit fast ununterbrochen, bis es Junge hat; dann macht die Sorge für diese öftere Unterbrechungen nothwendig. Während des Singens sitzt es bloß am frühen Morgen, wenn eben die Dämmerung anbricht, sonst selten und nur auf Augenblicke still in seiner Hecke oder Baumkrone, ist vielmehr immer in Bewegung, hüpft singend von Zweig zu Zweig und sucht nebenbei seine Nahrung. Der Gesang hat die längste Melodie von allen mir bekannten Grasmückengesängen und einige Ähnlichkeit mit dem der Mönchsgrasmücke, noch viel mehr aber mit dem der Sperbergrasmücke, dem er, bis auf einen durchgehends reineren Flötenton, vollkommen gleichen würde, wenn in jenem nicht einige weniger melodische oder unsanftere Stellen vorkämen.« Nach meinen Beobachtungen ist der Gesang je nach Oertlichkeit und Fähigkeit wesentlich verschieden. Am besten von allen Gartengrasmücken, welche ich kennen gelernt habe, singen die Ostthüringens. Eine Sperbergrasmücke, welche ihnen gleich gekommen wäre, habe ich nie gehört, wohl aber mehr als eine Gartengrasmücke, welche mit dem Mönche wetteifern durfte. Eine, welche meinem Vater in ergreifender Weise das Grablied sang und länger als zehn Jahre unseren Garten bewohnte, war die ausgezeichnetste Sängerin, der ich je gelauscht, und hat eine Nachkommenschaft hinterlassen, deren Lieder mich noch allsommerlich erquicken und entzücken, obgleich sie das unvergleichliche Vorbild nicht erreichen.
Hinsichtlich der Nahrung stimmt die Gartengrasmücke mit dem Mönche am meisten überein.
Das Nest steht bald tief, bald hoch über dem Boden, zuweilen in niederen Büschen, zuweilen auch auf kleinen Bäumchen, bei großer Wohnungsnoth sogar, wie Eugen von Homeyer auf Hiddensöe erfuhr und zweifellos feststellte, in Erdlöchern mit engem Eingange. Es ist unter allen Grasmückennestern am leichtfertigsten gebaut und namentlich der Boden zuweilen so dünn, daß man kaum begreift, wie er die Eier festhält. Zudem wird es sorglos zwischen die dünnen Aeste hingestellt, so daß es, wie Naumann versichert, kaum das oftmalige Aus- und Einsteigen des Vogels aushält oder vom Winde umgestürzt wird. »In der Wahl des Platzes sind die Gartengrasmücken so unbeständig, daß sie bald hier, bald da einen neuen Bau anfangen, ohne einen zu vollenden, und zuletzt häufig den ausführen, welcher, nach menschlichem Dafürhalten, gerade am unpassendsten Orte steht. Nicht allemal ist hieran ihre Vorsicht schuld. Wenn sie einen Menschen in der Nähe, wo sie eben ihr Nest zu bauen anfangen, gewahr werden, lassen sie den Bau gleich liegen; allein, ich habe auch an solchen Orten, wo lange kein Mensch hingekommen war, eine Menge unvollendeter Nester gesunden, welche öfters erst aus ein paar Dutzend kreuzweise hingelegten Hälmchen bestanden, und wo das eine nur wenige Schritte vom anderen entfernt war, und so in einem sehr kleinen Bezirke viele gesehen, ehe ich an das fertige mit den Eiern etc. kam. Die vielen, mit wenigen Hälmchen umlegten Stellen zur Grundlage eines Nestes, welche man beim Suchen nach Nestern in den Büschen findet, rühren oft von einem einzigen Pärchen her.« Das Gelege ist erst zu Ende des Mai vollzählig. Die fünf bis sechs neunzehn Millimeter langen, vierzehn Millimeter dicken Eier, welche es bilden, ändern in Farbe und Zeichnung außerordentlich ab, sind aber gewöhnlich auf trüb röthlichweißem Grunde mattbraun und aschgrau gefleckt und gemarmelt. Beide Geschlechter brüten, das Männchen aber nur in den Mittagsstunden. Nach vierzehntägiger Bebrütung schlüpfen die Jungen aus, nach weiteren vierzehn Tagen sind sie bereits so weit entwickelt, daß sie das Nest augenblicklich verlassen, wenn ein Feind ihnen sich nähert. Allerdings können sie dann noch nicht fliegen, huschen und klettern aber mit so viel Behendigkeit durchs Gezweige, daß sie dem Auge des Menschen bald entschwinden. Die Eltern benehmen sich angesichts drohender Gefahr wie andere Mitglieder ihrer Familie, am ängstlichsten dann, wenn die Jungen in ihrem kindischen Eifer sich selbst zu retten suchen. Ungestört brütet das Pärchen nur einmal im Jahre.
Des ausgezeichneten Gesanges wegen wird die Gartengrasmücke häufig im Käfige gehalten, eignet sich hierzu ebenso gut wie irgend eine andere Art ihres Geschlechtes, wird leicht sehr zahm, singt fleißig und dauert bei guter Pflege zehn bis funfzehn Jahre in Gefangenschaft aus.
Die allbekannte Zaun- oder Klappergrasmücke, das Müllerchen, Müllerlein, der Liedler und Spötter ( Sylvia garulla, Motacilla sylvia, curruca und garrula, Curruca garrula, superciliaris und septentrionalis) ist der Gartengrasmücke nicht unähnlich gefärbt, aber bedeutend kleiner: ihre Länge beträgt nur vierzehn, die Breite höchstens einundzwanzig Centimeter; der Fittig mißt fünfundsechzig, der Schwanz achtundfunfzig Millimeter. Das Gefieder ist auf dem Oberkopfe aschgrau, auf dem Rücken bräunlichgrau, auf dem Zügel grauschwärzlich, auf der Unterseite weiß, an den Brustseiten gelbröthlich überflogen; die olivenbraunen Flügel- und Schwanzfedern sind außen schmal fahlbraun, erstere auch innen und zwar weißlich gesäumt; die äußerste Schwanzfeder jederseits ist außen, ihre Endhälfte auch innen weiß. Das Auge ist braun, der Schnabel dunkel-, der Fuß blaugrau.
Das Verbreitungsgebiet des Müllerchens erstreckt sich über das ganze gemäßigte Europa und Asien, nach Norden hin bis Lappland, nach Osten hin bis China, nach Süden hin bis Griechenland, das Wandergebiet bis Mittelafrika und Indien. Die Zaungrasmücke trifft bei uns erst im Anfange des Mai ein und verläßt uns schon im September wieder. Während ihres kurzen Sommerlebens in der Heimat siedelt sie sich vorzugsweise in Gärten, Gebüschen und Hecken an, neben den Ortschaften wie zwischen den Wohnungen derselben, selbst sogar inmitten größerer Städte. Doch fehlt sie auch dem Walde nicht gänzlich, bewohnt mindestens dessen Ränder und Blößen.
»Sie ist«, wie Naumann schildert, »ein außerordentlich munterer und anmuthiger Vogel, welcher fast niemals lange an einer Stelle verweilt, sondern immer in Bewegung ist, sich gern mit anderen Vögeln neckt und mit seinesgleichen herumjagt, dabei die Gegenwart des Menschen nicht achtet und ungescheut vor ihm sein Wesen treibt. Nur bei rauher oder nasser Witterung sträubt sie zuweilen ihr Gefieder; sonst sieht sie immer glatt und schlank aus, schlüpft und hüpft behend von Zweig zu Zweig und entschwindet so schnell dem sie verfolgenden Auge des Beobachters. So leicht und schnell sie durchs Gebüsch hüpft, so schwerfällig geschieht dies auf dem Erdboden, und sie kommt deshalb auch nur selten zu ihm herab.« Ihr Flug ist leicht und schnell, wenn es gilt, größere Strecken zu durchmessen, sonst jedoch flatternd und unsicher. Die Lockstimme ist ein schnalzender oder schmatzender, der Angstruf ein quakender Ton. Der Gesang, welchen das Männchen sehr fleißig hören läßt, »besteht aus einem langen Piano aus allerlei abwechselnd zwitschernden und leise pfeifenden, mitunter schirkenden Tönen, denen als Schluß ein kürzeres Forte angehängt wird«: ein klingendes oder klapperndes Trillern, welches das Lied vor dem aller anderen Grasmücken kennzeichnet.
Die Nahrung ist im wesentlichen dieselbe, welche die Verwandten genießen.
Das Nest steht in dichtem Gebüsche, niedrig über dem Boden, im Walde vorzugsweise in Schwarz- und Weißdorngebüschen, auf Feldern in Dornhecken, im Garten hauptsächlich in Stachelbeerbüschen, ist überaus leicht gebaut, einfach auf die Zweige gestellt, ohne mit ihnen verbunden zu sein, und ähnelt im übrigen den Nestern der Verwandten. Das Gelege besteht aus vier bis sechs, sechzehn Millimeter langen, zwölf Millimeter dicken, zartschaligen Eiern, welche besonders am dickeren Ende auf reinweißem oder bläulichgrünem Grunde mit asch- oder violettgrauen, gelbbraunen Flecken und Punkten bestreut sind. Beide Eltern brüten wechselsweise, zeitigen die Eier innerhalb dreizehn Tagen, lieben ihre Brut mit derselben Zärtlichkeit wie andere Grasmücken, brauchen auch dieselben Künste der Verstellung, wenn ihnen Gefahr droht, und verfolgen noch außerdem den sich nähernden Feind mit ängstlichem Geschrei. Im allgemeinen sind die Zaungrasmücken während ihrer Fortpflanzungszeit äußerst mißtrauisch, lassen ein bereits angefangenes Nest oft liegen, wenn sie erfahren haben, daß es von einem Menschen auch nur gesehen, und verlassen das Gelege, sobald sie bemerken, daß dasselbe berührt wurde; diejenigen aber, welche von dem Wohlwollen ihrer Gastfreunde sich überzeugt haben, verlieren nach und nach ihr Mißtrauen und gestatten, daß man sie, wenn man vorsichtig dem Neste naht, während ihres Brutgeschäftes beobachtet. Die Jungen lassen sie nie im Stiche; auch die ihnen untergeschobenen jungen Kukuke, bei denen sie sehr häufig Pflegeelternstelle vertreten müssen, ziehen sie mit Aufopferung groß.
Wie die meisten Grasmücken läßt sich das Müllerchen leicht berücken, ohne sonderliche Mühe an ein Ersatzfutter gewöhnen und dann lange Zeit im Käfige halten. Bei guter Behandlung wird es sehr zahm und erwirbt sich dadurch ebenfalls die Gunst des Liebhabers.
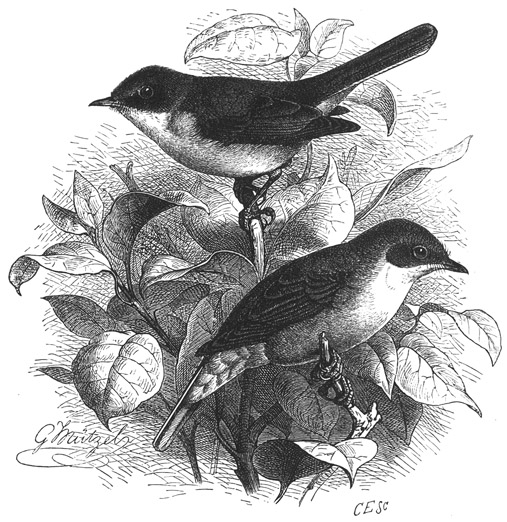
Zaun- und Dorngrasmücke (Sylvia garrula und cinerea). ½ natürl. Größe.
Die Dorngrasmücke, der Hagschlüpfer, Hecken- und Staudenschwätzer, Wald- oder Nachtsänger und Dornreich, das Weißkehlchen ect. ( Sylvia cinerea, rufa, cineraria, fruticeti und affinis, Motacilla rufa und fruticeti, Ficedula curruca und cinerea, Curruca sylvia, cinerea, fruticeti, cineracea und caniceps), die letzte Art ihrer Sippe, welche in Deutschland brütet, zeichnet sich durch Schlankheit aus. Ihre Länge beträgt funfzehn, die Breite zweiundzwanzig, die Fittig- wie die Schwanzlänge sieben Centimeter. Die Obertheile sind röthlich erdbraun, Oberkopf, Hinterhals und Ohrgegend braungrau, Zügel, Schläfenstrich und Halsseiten deutlich grau, Kinn, Kehle und Unterbacken weiß, die übrigen Untertheile zart fleischröthlich, an den Seiten rostbräunlich, die Schwingen olivenbraun, außen schmal rostfahl, die Armschwingen und deren Decken breit rostbraun gesäumt, die Schwanzfedern dunkelbraun, die beiden äußersten außen weiß, innen in der Endhälfte weißgrau, die zweite von außen her am Ende weiß gesäumt. Die Iris ist braun, der Schnabel hornbräunlich, unterseits horngelblich, der Fuß gelb. Beim Weibchen sind Oberkopf und Hinterhals erdfahl, die Untertheile weiß und die braunen Außensäume der Armschwingen schmaler und blasser.
Unter allen Verwandten dringt die Dorngrasmücke am weitesten nach Norden vor, da sie noch im nördlichen Skandinavien gefunden wird; nach Osten hin dehnt sich ihr Verbreitungsgebiet bis Westasien; im Winter wandert sie bis Mittelafrika, besucht auch um diese Zeit die Kanarischen Inseln. Bei uns zu Lande bevorzugt sie niedere Dorngebüsche jedem anderen Bestande; in Spanien lebt sie mit den kleinen Arten der Familie in dem eigenthümlichen Niederwalde, von welchem ich weiter unten zu reden haben werde. Den Wald meidet sie hier wie dort; auch in Gärten nimmt sie ihren Aufenthalt nicht, obwohl sie einzelne höhere Bäume in ihrem Gebiete wohl leiden mag, um in den niederen Aesten der Krone zu singen oder während der Paarungszeit aus der Höhe, zu welcher sie fliegend sich erhob, auf jene sich herabzulassen. Auf dem Zuge besucht sie die Fruchtfelder, in Deutschland Roggen- oder Weizenfelder, im Süden Europas Maispflanzungen. Sie trifft spät, selten vor Ende des April, meist erst im Anfange des Mai bei uns ein, bezieht sofort ihr Brutgebiet und verweilt auf ihm bis zum August, beginnt dann zu streichen und verläßt uns im September, spätestens im Oktober wieder.
»Sie ist«, sagt mein Vater, »ein äußerst lebhafter, rascher und gewandter Vogel, ruht keinen Augenblick, sondern hüpft unaufhörlich in den Gebüschen herum und durchkriecht vermöge ihres schlanken Leibes mit ungemeiner Geschicklichkeit auch die dichtesten, durchsucht alles und kommt sehr oft lange Zeit nicht zum Vorscheine. Dann aber hüpft sie wieder herauf, setzt sich auf die Spitze eines vorstehenden Zweiges, sieht sich um und verbirgt sich von neuem. Dies geht den ganzen Tag ununterbrochen so fort. Ihr Flug ist geschwind, mit starkem Schwingenschlage, geht aber gewöhnlich tief über dem Boden dahin und nur kurze Strecken in einem fort. Ihr Lockton lautet ›Gät gät scheh scheh‹ und drückt verschiedene Gemüthszustände aus. Das Männchen hat einen zwar mannigfachen, aber wenig klangvollen Gesang, welcher aus vielen abgebrochenen Tönen zusammengesetzt ist und an Anmuth und Schönheit dem der meisten deutschen Sänger sehr nachsteht; er dient aber doch dazu, eine Gegend zu beleben und bringt in die flötenden Gesänge der Gartengrasmücke, des Weidenlaubsängers und anderer eine angenehme Mannigfaltigkeit.« Naumann nennt den Gesang angenehm und sagt, daß man ihn für kurz halten könnte, weil man in der Entfernung nur die hellpfeifende, flötenartige, wohltönende Schlußstrophe höre, während er in der That aus einem langen Piano und jenem kurzen Schlußforte bestehe. »Das Piano ist zusammengesetzt aus vielerlei abwechselnden, pfeifenden und zirpenden Tönen, welche sehr schnell auf einander folgen und leise hergeleiert werden; aber das beschließende Forte wird mit schöner Flötenstimme und mit voller Kehle gesungen.« »Die Dorngrasmücke«, fährt mein Vater fort, »läßt ihren Gesang nicht bloß im Sitzen und Hüpfen, sondern auch im Fluge hören. Sie kommt nämlich singend auf die höchste Spitze eines Busches herauf, steigt flatternd funfzehn bis dreißig Meter in die Höhe und stürzt sich, immer singend, entweder flatternd in schiefer, oder mit angezogenen Schwingen fast in senkrechter Richtung wieder herab.« Hierdurch macht sie sich dem kundigen Beobachter schon von weitem kenntlich. Vor dem Menschen nimmt sie sich wohl in Acht. Bei uns ist sie zwar nicht gerade scheu, aber doch vorsichtig genug. »Merkt sie, daß man sie verfolgt, dann verbirgt sie sich so sorgfältig in dichtem Gesträuche oder hohem Grase, daß man ihr oft lange vergeblich nachjagen muß«; sie sucht sich, wie Naumann bemerkt, »durch das Gebüsch fortzuschleichen«. In Spanien habe ich sie so scheu gefunden, daß ich ihr wochenlang vergeblich nachstellte. Aeußerst angenehm ist die Heiterkeit dieses Vogels. »Ich erinnere mich nicht«, sagt Naumann, »sie im Freien jemals traurig gesehen zu haben; vielmehr läßt sie an den ihr nahe wohnenden Vögeln beständig ihren Muthwillen durch Necken und Jagen aus, beißt sich auch wohl mit ihnen herum, verfliegt sich aber dabei niemals sorglos ins Freie, sondern bleibt klüglich immer dem Gebüsche so nahe wie möglich.« Dasselbe Betragen behält sie nach meinen Beobachtungen auch im Süden oder auf ihrer Wanderung bei. Sie ist überall dieselbe, überall gleich aufmerksam, überall gleich mißtrauisch und überall gleich listig.
Bald nach ihrer Ankunft in Deutschland macht die Dorngrasmücke Anstalt zu ihrer Brut. Sie baut in dichte Büsche, Ried und langes Gras, selten mehr als einen Meter über dem Boden, oft so niedrig, daß der Unterbau des Nestes die Erde berührt. Die wie gewöhnlich aus Halmen zusammengesetzte dünne Wandung wird oft mit Schafwolle gemischt, die innere Ausfütterung aus den Spitzen der Grashalme hergestellt. Schon in der zweiten Hälfte des April enthält das Nest das volle Gelege, vier bis sechs, in Größe, Gestalt und Färbung außerordentlich abändernde Eier, welche durchschnittlich siebzehn Millimeter lang, dreizehn Millimeter dick, auf elfenbeinweißem, gelbem, grauem odergrünlich gelbgrauem, auch Wohl grünlichweißem und bläulichweißem Grunde deutlicher oder undeutlicher mit aschgrauen, schiefer-farbigen, ölbraunen, gelbgrünen etc. Punkten und Flecken gewässert, gemarmelt, gepunktet und sonstwie gezeichnet sind. Die Eltern betragen sich beim Neste wie andere Grasmücken auch. Die zweite Brut folgt unmittelbar auf die erste.
Im Käfige wird die Dorngrasmücke seltener gehalten als ihre Verwandten. Ihr Gesang gefällt nicht jedem Liebhaber, verdient aber die allgemeine Mißachtung der Pfleger nicht, der Vogel daher mehr Beachtung, als ihm bisher zu theil geworden ist.
Ein verschönertes Abbild der Dorngrasmücke im kleinen ist die Brillengrasmücke ( Sylvia conspicillata und icterops, Curuca und Stoparola conspicillata). Ihre Länge beträgt einhundertsiebenundzwanzig, die Breite einhundertfünfundsiebzig, die Fittiglänge sechsundfunfzig, die Schwanzlänge zweiundfunfzig Millimeter. Der Kopf ist dunkel-, die Ohrgegend hellaschgrau, der Zügel schwarz, die Oberseite hellbraun, roströthlich überflogen, der Bürzel roströthlichgrau, die Kehle wie das untere Schwanzdeckgefieder weiß, die übrige Unterseite zart fleischröthlich, auf der Bauchmitte Heller; die Schwingen sind grau, die Armschwingen und oberen Flügeldeckfedern auf der Außenfahne breit rostroth gesäumt; die äußerste Schwanzfeder ist auf der Außenfahne bis gegen die Wurzel hin weiß, auf der Jnnenfahne mit einem bis zur Mitte reichenden Keilfleck gezeichnet, welcher auf den übrigen Steuerfedern immer kleiner und kürzer wird. Ein weißer Ring umgibt das Auge; dieses ist licht röthlichbraun, der Schnabel fleischröthlich an der Wurzel, schwarz an der Spitze, der Fuß gelblich fleischfarben oder röthlichgrau. Die Jungen unterscheiden sich von den Alten hauptsächlich durch die einfach graue, d. h. nicht röthlich überflogene Brust. Von der Dorngrasmücke, als deren Abart einzelne Forscher sie betrachtet wissen wollen, unterscheidet sich die Brillengrasmücke außer ihrer geringeren Größe und schöneren Färbung auch dadurch, daß bei ihr die vierte, nicht aber die dritte Fittigfeder die längste ist.
Man darf die Brillengrasmücke als einen Charaktervogel der südlichen Mittelmeerländer bezeichnen. Sie bewohnt Südfrankreich, Spanien, Portugal, Nordwestafrika, Palästina bis Persien, Kleinasien, Griechenland und Süditalien, ebenso die Inseln des Grünen Vorgebirges, und bevölkert in Spanien wie in Griechenland oder auf Sardinien und Malta die mit dem niedersten Gestrüppe, namentlich mit Rosmarin oder mit Disteln, bestandenen dürren Berggehänge. Hier scheint sie Stand- oder höchstens Strichvogel zu sein. Graf von der Mühle traf sie in Griechenland im Winter in kleinen Gesellschaften an; mein Bruder beobachtete sie während derselben Jahreszeit in den Gärten, welche an die Fruchtebene von Murcia grenzen; Wright nennt sie den einzigen Standvogel Maltas; Cara versichert, daß sie Sardinien nicht verlasse, während Salvatori glaubt, daß nur einzelne Brillensänger auf der letztgenannten Insel überwintern, und hinzufügt, daß mit Beginn des April viele in der Nachbarschaft von Cagliari erschienen. Die ersten, welche ich beobachtete, trieben sich an einer Bergwand herum, welche nur hier und da mit Wein bepflanzt, im übrigen aber im höchsten Grade öde war; später fanden wir mehrmals kleine Gesellschaften in Distelwäldern auf. Hansmann traf sie auf Sardinien in Strauchwäldern in der Nähe der Küste, nicht aber im Gebirge.
Ich meinestheils hatte wenig Gelegenheit, das niedliche Geschöpf zu beobachten. Die ersten, welche ich bemerkte, fand ich nicht scheu, sondern verhältnismäßig zutraulich. Sie verkrochen sich auch nicht in dem Gestrüppe nach Art ihrer Verwandten, sondern zeigten sich gern frei, und namentlich die Männchen setzten sich oft auf die höheren Spitzen, um von ihnen herab zu singen. Ganz anders benahm sich derselbe Vogel nach beendeter Mauser im Herbste. Jetzt verbarg er sich zwischen den Disteln und Rosmarin, schlüpfte wie die Dorngrasmücke von einem Busche zum anderen und wußte sich förmlich unsichtbar zu machen. Aufgescheucht, flog er gewandt und schnell weit dahin, von einem Berge zum anderen und zwar in ziemlicher Höhe über dem Boden; doch schien es mir, als ob dieses Betragen weniger eine Folge der Furcht vor dem Menschen, als vielmehr auf seine Lebendigkeit und Regsamkeit begründet wäre. Wright berichtet, daß der Brillensänger auf Malta bei einigermaßen günstiger Witterung schon im Januar zu singen beginnt und im Frühjahre sein anmuthiges Lied sehr fleißig vernehmen läßt, und daß er fast immer von einem hohen Sitze, entweder von der Spitze eines Zweiges oder wohl auch von der Kuppe eines größeren Steines herab, zu singen pflegt.
»Der Brillensänger«, sagt Hansmann, »hat hinsichtlich seiner Sitten viel Aehnlichkeit mit der Dorngrasmücke. Wenig scheu, erscheint er oft singend auf der Spitze der Dornen und Cistensträucher, mitunter dabei wie eine Rakete in die Luft steigend, um mit aufgeblähtem Gefieder, noch bevor die letzte Strophe geendet, wieder auf die nächsten Zweige herabzufallen. Der Gesang hat ebenfalls viel Aehnlichkeit mit dem der Dorngrasmücke, nur daß er rauher klingt. Das lang anhaltende und klangreiche Zwitschern, welches diese oft, besonders in der ersten Zeit des Frühlings nach ihrer Ankunft hören läßt, fehlt der Brillengrasmücke gänzlich; sie besitzt nur den kurzen Ruf ihrer nördlichen Verwandten, den sie mitunter mehr oder weniger durch beliebige Hinzufügungen noch einige Silben in die Länge zieht. Ebenso ist der Lockton des Brillensängers nicht der schnalzende der Dorngrasmücke, sondern der harte würgerähnliche, welcher allen Strauchsängern mehr oder weniger gemein ist. Zum Ueberflusse finden sich beide an denselben Stellen, wo man dann sofort den Unterschied in ihrem, trotz aller Aehnlichkeit verschiedenen Benehmen bemerken kann, indem die eine eine Grasmücke, der andere ein Strauchsänger ist.« Mein Bruder bezeichnet Hansmanns Angabe als unrichtig und hebt hervor, daß auch diese Art einen länger währenden, leisen, aber sehr lieblichen Vorgesang zu hören gibt.
Die Brutzeit scheint früh im Jahre, wahrscheinlich bereits im Februar, zu beginnen und bis zum Juni zu währen, da Wright vom März an bis zum Juni Junge fand und deshalb annimmt, daß ein Pärchen zweimal im Jahre brütet. »Das Nest« bemerkt Hansmann noch, »welches ich bereits zu Ende des April fertig, aber noch ohne Eier fand, hat ebenfalls die tiefnapfige, dünnwandige Bauart, wie sie allen Strauchsängern eigen ist. Außen sah ich einige Lammwollflocken mit eingewebt, wie dieses wohl ebenfalls die fahle Grasmücke zu thun pflegt. Die Vögel waren indeß so empfindlich, daß sie das Nest, welches ich nur nach Wegbiegen der Zweige erblicken konnte, sofort verließen.« Die Eier sind etwa siebzehn Millimeter lang, elf Millimeter dick und auf blaß graugrünem Grunde mit äußerst feinen bräunlichen Punkten gezeichnet.
Ungefähr dieselben Länder, welche ich vorstehend nannte, genauer gesagt, Istrien, Dalmatien und Griechenland, ganz Italien, Südfrankreich, Spanien, Portugal, die Kanarischen Inseln und Atlasländer, überhaupt alle südlichen Küstengebiete des Mittel- und Schwarzen Meeres, nach Osten hin bis Transkaukasien, beherbergen während der Brutzeit, Mittel- und Westafrika im Winter die Bartgrasmücke, Röthel- oder Sperlingsgrasmücke, das Weißbärtchen etc. ( Sylvia subalpina, passerina, leucopogon, mystacea und Bonellii, Curruca subalpina, passerina, leucopogon und albostriata, Alsaecus und Erythroleuca leucopogon), ein wirklich allerliebstes Geschöpf. Die Oberseite ist schön aschgrau, die Unterseite graulichweiß, die Kehle aber lebhaft rostbraunroth, durch ein schmales weißes Band, welches von der Schnabelwurzel an gegen die Schultern verläuft, von der dunkleren Färbung der Oberseite getrennt; ein Kreis von röthlichen Federn umgibt das Auge; die Ohrenfedern sind bräunlich, die Schwingen und Schwanzfedern dunkelbraun, die äußersten Steuerfedern auf der Außenfahne zu dreiviertel ihrer Länge weiß, auf der Innenfahne durch einen lichten Keilfleck gezeichnet, die übrigen weiß gesäumt. Die Weibchen und Jungen sind einfacher, unserem Müllerchen nicht unähnlich, gefärbt und namentlich durch den Mangel des braunrothen Kehlfleckes unterschieden. Das Auge ist röthlichgrau, das Augenlid blaß ziegelroth, der Schnabel matt hornschwarz, an der Spitze des Unterschnabels matt röthlichhornfarben, der Fuß röthlichgrau. Die Länge beträgt einhundertfünfundzwanzig bis einhundertunddreißig, die Breite einhundertundachtzig, die Fittiglänge siebenundfunfzig, die Schwanzlänge vierundfunfzig Millimeter; das Weibchen ist um einige Millimeter schmäler als das Männchen.
Alle Mittel- und Niedergebirge des nördlichen Spanien deckt ein wunderbarer Wald, welchen die Landeseingeborenen bezeichnend Nieder- oder Strauchwald nennen: ein Zwergwald im eigentlichen Sinne des Wortes. Prachtvolle Heidearten, Cisten-, Oleander-, immergrüne Eichen- und Ulmengebüsche setzen ihn zusammen und einigen sich zum fast undurchdringlichen Dickichte. Einzelne Bäumchen erheben sich über dieses Wirrsal von Pflanzen und erscheinen nur deshalb höher, als sie sind, weil der Zwergwald unter ihnen den Maßstab gibt für ihre Höhe. Dieser Wald nun, welcher auch im übrigen Südeuropa und in Nordwestafrika vorherrschend geworden ist, darf als die eigentliche Heimat der vorstehend beschriebenen zwerghaften Grasmücke bezeichnet werden. Sie ist ein prächtiger Vogel. Zutraulicher, als alle anderen ihres Geschlechtes, läßt sie sich in größter Nähe beobachten, und ohne Sorgen vor dem zu ihr heranschleichenden Menschen trägt sie ihr anmuthiges Liedchen vor. So lange sie nicht verfolgt wird, scheint sie den Erzfeind der Thiere unter allen Umständen und überall für ein in jeder Hinsicht ungefährliches Geschöpf zu halten. In ihrem Betragen hat sie viel mit unserem Müllerchen, aber noch mehr mit dem Schwarzköpfchen, welches dieselben Oertlichkeiten bewohnt, gemein. Sie beherrscht ihr Buschdickicht in der allervollkommensten Weise, bewegt sich jedoch mehr auf als in den Gebüschen. An geeigneten Orten wohnt Paar an Paar, und hier sieht man denn fast auf jeder hervorragenden Strauchspitze ein Männchen sitzen, entweder von der Höhe aus die Gegend überschauend oder singend. Gibt man dem Thierchen keine Veranlassung zur Furcht, so bleibt es sorglos in Sicht, hüpft munter von einem Zweige zum anderen, streicht mit gewandtem, aber selten weit ausgedehntem Fluge von einem Buschwipfel zum nächsten, nimmt sich hier und da eine kleine Raupe, ein Käferchen weg, fängt auch wohl ein vorüberfliegendes Kerbthier geschickt aus der Luft und schwingt sich zeitweilig zu den höchsten Bäumen seines Gebietes oder singend in die Luft empor, sechs bis zehn Meter über das Dickicht, von hieraus sodann in schiefer Richtung wieder nach unten schwebend. Verfolgt man es ernstlich, so senkt es sich in das Buschdickicht hinab und schlüpft hier mit unbeschreiblicher Fertigkeit von Zweig zu Zweig, ohne sich sehen zu lassen. Dann vernimmt man nur den Warnungsruf noch, ein lang gedehntes, leises »Zerr«, welches seine Anwesenheit verräth und kundgibt, wie schnell es das Buschdickicht durcheilt. Der Lockton ist ein wohllautendes »Zäh« oder »Teck teck«, der Gesang ein klangvolles Liedchen, welches aber leider ziemlich leise vorgetragen wird. Dem ziemlich langen, vielfach abwechselnden, theilweise hübsch verschlungenen Vorgesange folgt die frische, laut vorgetragene Schlußstrophe, welche mehr an eine unserer Gartengrasmücken als an den Schlußsatz der Dorngrasmücke erinnert.
Das Nest wird im dichtesten Gebüsche niedrig über dem Boden angelegt, nach unseren Beobachtungen erst gegen Ende des Mai; doch kann es sein, daß dasjenige, welches wir fanden, schon das zweite des Paares war. Es zeichnet sich vor dem der Verwandten aus durch zierliche Bauart und verhältnismäßig dichte Ausfütterung. Die vier bis fünf etwa sechzehn Millimeter langen und dreizehn Millimeter dicken Eier des Geleges sind auf schmutzigweißem Grunde mit ölbraunen und olivengrünen Flecken und Punkten, welche zuweilen am dicken Ende zu einem Kranze zusammenlaufen, gezeichnet. Am Neste geberden sich beide Eltern überaus ängstlich, und das Weibchen braucht regelmäßig alle Verstellungskünste, wie sie in seiner Familie üblich sind.
Im Norden Spaniens scheint die Bartgrasmücke Zugvogel zu sein. Wir bemerkten sie im April in Gegenden, in denen sie sonst nicht gefunden wird, und trafen ebenso Mitte September kleine Gesellschaften an, welche offenbar auf der Reise begriffen waren. Nach Lindermayers und Krüpers Beobachtungen erscheint sie in Griechenland gegen Ende des März, treibt sich zunächst in den ausgetrockneten Betten der Gebirgswässer umher und steigt dann höher an den Bergen hinauf, um dort zu brüten; nach Salvatori's Angabe verläßt sie Sardinien gegen den Herbst hin, dieser Forscher bemerkte sie wenigstens während des Winters nicht mehr. Diejenigen Bartgrasmücken welche in Egypten beobachtet worden sind, scheinen von Südosteuropa herübergewandert zu sein; ich wenigstens habe das Vögelchen dort niemals im Sommer beobachtet. Mein Bruder sagt ausdrücklich, daß er es im Winter in der Umgegend von Murcia habe singen hören, und somit dürfte erwiesen sein, daß wenigstens einige, wenn auch nicht in unmittelbarer Nähe ihrer Brutplätze, so doch in ihrem heimatlichen Lande bleiben.
Im Südosten Europas tritt zu den genannten noch eine andere kleine Grasmücke, die zu Ehren Rüpells benannte Masken- oder Stelzengrasmücke ( Sylvia Rüpellii, capistrata und melandiros, Curruca und Corytholaea Rüpellii). Sie erinnert in ihrer Gesammtfärbung so sehr an unsere Bachstelze, daß man beide fast mit denselben Worten beschreiben könnte. Kopf, Zügel, Kinn und Kehle bis zur Brust sind schwarz, die Obertheile dunkelgrau, ein von der Unterkinnlade beginnender, bis unters Ohr verlaufender Streifen und die Untertheile weiß, letztere röthlich überflogen, in der Weichengegend graulich, die Schwingen und die kleinen Flügeldeckfedern bräunlichschwarz, letztere weiß gesäumt, die mittleren Schwanzfedern schwarz, die äußersten ganz weiß, die zweiten, dritten und vierten jederseits an der Spitze und an der Innenfahne mehr oder weniger weiß. Das Weibchen ist kleiner und blasser gezeichnet. Das Auge ist hellbraun, der Schnabel hornfarben, der Fuß röthlich. Die Länge des Männchens beträgt 13, die Breite 21, die Fittiglänge 7, die Schwanzlänge 6,5 Centimeter.
Das Vaterland der Maskengrasmücke ist Griechenland, Kleinasien, Syrien, Palästina; auf ihren Zügen besucht sie Arabien, Egypten und Nubien. Ueber ihre Lebensweise fehlen noch ausführliche Mittheilungen; nur Heuglin und Krüper geben dürftige Berichte. Wir wissen, daß sie ein Bewohner der buschigen Thäler wüstenähnlicher Gegenden oder spärlich bewachsener Inseln ist. In Griechenland gehört sie zu den Seltenheiten; in Palästina, Kleinasien und auf den Inseln des Rothen Meeres ist sie häufiger, in der Umgegend von Smyrna die gemeinste Art ihres Geschlechtes. In Ionien erscheint sie, laut Krüper, gegen Ende des März, beginnt bereits um die Mitte des April zu brüten und verläßt das Land im August wieder. Ich habe sie ein einziges Mal in der Nähe des Mensalehsees bemerkt und erlegt, nicht aber beobachten können, und vermag daher nur die Mittheilungen der genannten Forscher wiederzugeben. Auf dem Zuge begegnet man ihr, wie auch ich erfuhr, meist in niedrigem Gesträuche oder Schilfe, emsig nach Kerbthieren suchend; in der Heimat findet man sie bald nach ihrer Ankunft auf allen mit geeignetem Gestrüppe bedeckten Anhöhen und Berggehängen, bis ins Gebirge hinauf. Man sieht fast nur die Männchen, nicht aber die versteckt lebenden Weibchen. Erstere lassen ihr Lied von der Spitze eines Strauches herab ertönen, verschwinden darauf behende in dem Busche oder fliegen einer anderen Spitze zu, um dort dasselbe zu wiederholen. Während der Paarungszeit singen sie sehr eifrig, erheben sich dabei gleichsam tanzend in die Luft und lassen sich mit ausgebreiteten Flügeln und gefächertem Schwanze schwebend herab. An ihrem Gesange kann man sie von allen anwohnenden Vögeln unterscheiden: wie, ist nicht gesagt. Am siebenten April fand Krüper ein nur aus feinen, dürren Grashalmen bestehendes, nicht ausgepolstertes, etwa funfzehn Centimeter über dem Boden stehendes Nest mit fünf, deren der gemarmelten Spielart der Dorngrasmücke ähnelnden Eiern; gegen Ende des Mai erhielt er drei andere. Eines von den gesammelten, welches er an Dresser sandte, ist neunzehn Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick und auf graulichweißem Grunde mit kleinen graubraunen, ineinander laufenden Punkten gezeichnet.
Während die bisher genannten Grasmücken sich so ähneln, daß jede Trennung der Sippe unnöthig erscheint, zeigen andere ein etwas abweichendes Gepräge, indem in dem sehr kurzen und stark abgerundeten Flügel die dritte, vierte und fünfte Schwinge gleich lang und die längsten sind, der lange Schwanz deutlich abgestuft und das reiche Gefieder haarartig zerschlissen ist. Leach hat auf diese geringfügigen Unterschiede eine besondere Sippe ( Melizophilus) begründet.
Eine der bekanntesten Arten der Gruppe, welche wir als Untersippe auffassen mögen, ist das Sammetköpfchen ( Sylvia melanocephala, ruscicola, ochrogenion und Baumani, Motacilla melanocephala und leucogastra, Curruca melanocephala, momus und luctuosa, Melizophilus melanocephalus und nigricapillus, Pyrophthalma melanocephala, Dumeticola melanocephala). Die Länge beträgt 14, die Breite 18, die Fittiglänge 5,5, die Schwanzlänge 6 Centimeter. Das Gefieder der Oberseite ist grauschwarz, das der Unterseite weiß, röthlich angeflogen, das des Kopfes sammetschwarz, der Kehle reinweiß; Flügel und Schwanzfedern sind schwarz, die drei äußersten Steuerfedern jederseits und die Außenfahnen der ersten weiß. Das Auge ist braungelb, das nackte, stark aufgetriebene Augenlid ziegelroth, der Schnabel blau-, der Fuß röthlichgrau.
Von Südfrankreich und Süditalien an ist das Schwarzköpfchen über ganz Südeuropa, Nordafrika und Westasien verbreitet und auch auf den kleinsten Inseln noch zu finden, vorausgesetzt, daß es hier wenigstens einige dichte Hecken gibt. Im Niederwalde und in allen Gärten Griechenlands, Italiens und Spaniens ist es gemein. Es wandert nicht, sondern bleibt, wie alle seine Verwandten, jahraus jahrein in der Heimat. Ich habe es über ein Jahr lang fast tagtäglich beobachtet, ziehe es aber doch vor, Hansmann für mich reden zu lassen, weil ich es für unmöglich halte, eine so ausgezeichnete Schilderung zu erreichen, ganz abgesehen von billiger Wahrung des Erstlingsrechtes, wie ich sie stets geübt habe. Nur in einer Hinsicht kann ich Hansmann nicht beistimmen. Er sagt sehr richtig, daß das Schwarzköpfchen seinen Aufenthalt mit dem Brillen- und manchmal auch mit dem Sardensänger gemein habe, sich indessen an Orten finde, wo diese beiden niemals hinkommen, bezweifelt aber die Angabe von der Mühle's, daß es besonders die Hecken der Stachelfeigen liebe und in denselben auch sein Nest aufstelle. Ich muß von der Mühle beipflichten: das Sammetköpfchen scheint sich mit ersichtlichem Behagen gerade in diesen Kaktushecken anzusiedeln und sie namentlich auch zur Winterherberge zu wählen. In allem übrigen entspricht Hansmanns Schilderung durchaus meinen Beobachtungen.
»Nähert man sich dem Orte, wo das Nest oder die Jungen eines Sammetköpfchens versteckt sind, so hört man seinen hellen Warnungsruf ›Trret trret trett‹, welcher mitunter im höchsten Zorne oder in der höchsten Angst so schnell hinter einander wiederholt wird, daß er als ein zusammenhängendes Schnarren erscheint. Dabei spreizt dasselbe seine dunkelschwarzen Kopffedern, welche um ein geringes bis in den Nacken hinein verlängert sind, in die Höhe, und der nackte Augenring flammt feuerroth. Der Lockton ist ein weniger scharfes ›Treck, treck, treck‹, und mit ihm beginnt gewöhnlich auch der Gesang, ein sehr mannigfaltiges, ziemlich langes, aus schnarrenden und pfeifenden Tönen zusammengesetztes Lied, welches gegen das Ende hin manche ganz artig klingende Strophen hat. Diesen Gesang läßt es auch öfter, von einem Orte zum anderen fliegend oder, wie die Brillengrasmücke, aufsteigend und wieder auf einen Zweig zurückfallend, vernehmen.« Ich will hinzufügen, daß das singende Männchen fast immer oder wenigstens sehr gern hochsitzt, während des Singens den Schwanz stelzt, die Halsfedern sträubt und zierliche Verbeugungen macht. »Das Weibchen ist ein nicht halb so munterer und so kecker Vogel als das Männchen, und man bekommt ersteres nur selten zu sehen. Auch um die Jungen ist es wohl ebenso besorgt als der andere Gatte; indessen geschieht die Vertheidigung derselben lange nicht mit der lärmenden Tapferkeit, welche man an diesem erblickt. Das Männchen ist denn auch Hans in allen Gassen, welcher sich um alles bekümmert, überall mitredet und überall theil nimmt. Läßt sich ein Raubvogel von fern erblicken, sogleich macht es Lärm, auf einen freien Zweig hinaustretend; klagt ein anderer Vogel ängstlich um seine Brut, sogleich ist es bei ihm und hilft kräftig den Feind mit vertreiben. Daß ihm dabei vom Jäger manches unangenehme geschieht, scheint für die anderen durchaus keine Warnung zu sein.
»Die Nester des Schwarzköpfchens, welche ich gefunden, standen entweder in niedrigen, dichten Cratejus- oder Lyciumbüschen oder ganz frei zwischen den Zweigen eines Brombeerstrauches, von der überhängenden Krone desselben freilich vollkommen vor allen feindlichen Blicken geschützt. Dieser Vogel muß seine erste Brut schon ziemlich früh beginnen, indem ich bereits zu Anfange des April flügge Junge von ihm vorfand. Sogar im August noch entdeckte ich ein Nest desselben mit vier vollständig frischen Eiern. Diese, vier bis fünf an der Zahl, sind etwa zwanzig Millimeter lang, funfzehn Millimeter dick, auf schmutzigweißem, olivengraugrünlichem Grunde mit sehr vielen äußerst feinen dunkleren Flecken, fast nach Art der Holzhehereier gezeichnet. Außerdem finden sich auch noch bläuliche Pünktchen und am dicken Ende öfter ein kleiner Kranz olivenbrauner Flecken. Das Nest selbst ist dickwandiger als diejenigen seiner Familienverwandten, etwa demjenigen des Plattmönchs ähnelnd, jedoch bei weitem kleiner und auch zierlicher angelegt.« Nach der Brutzeit streicht alt und jung noch längere Zeit zusammen im Lande umher. Wir haben in den Wintermonaten noch solche Familien beobachtet.
Auf Sicilien, Sardinien, Corsica, Malta, den Balearen, in Portugal, Griechenland und auf seinen Inseln lebt eine zweite Art der Gruppe, die Sardengrasmücke oder der Sardensänger ( Sylvia sarda, Melizophilus sardus, Curruca, Parophthalma und Dumeticola sarda). Die Länge beträgt ungefähr einhundertunddreißig, die Fittiglänge fünfundfunfzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Das Gefieder der Oberseite ist schwärzlich aschgrau, leicht rostfarben angeflogen, das der Unterseite rostisabellbräunlich, das der Kehle weißlich, das des Bauches schmutzigweiß; die Schwung- und Steuerfedern sind schwarzbraun, rostbräunlich gesäumt; das äußerste Paar der Steuerfedern ist außen schmal rostweißlich gesäumt. Das Auge ist nußbraun, der nackte Augenlidrand gelblichfleischfarben, der Schnabel schwarz, am Grunde des Unterkiefers gelblich, der Fuß licht hornfarben. Das Weibchen unterscheidet sich durch etwas hellere Färbung vom Männchen.
»Diese Grasmücke«, sagt Salvatori, »ist vielleicht der gemeinste Vogel, welchen es auf Sardinien gibt. Er bewohnt Berg und Ebene, aber immer nur da, wo der Boden mit Cisten und Heide bekleidet ist. Besonders auf den von diesen Pflanzen bedeckten Hügeln lebt eine außerordentlich große Anzahl.« Ganz dasselbe scheint, laut Alexander von Homeyer, für die Balearen zu gelten, und deshalb ist es um so auffallender, daß der Vogel in Spanien nicht oder doch nur höchst selten gefunden wird. In seinem Strauchwalde bewegt er sich fast mehr nach Art einer Maus als nach Art eines Vogels. »Er verläßt«, sagt Homeyer, »einen Strauch, eilt flatternd, hüpfend dicht über dem Boden dahin, einem anderen zu, verschwindet in diesem, verläßt ihn jedoch oft sofort wieder, fliegt auf einen Stein oder Felsen, läuft über ihn oder um ihn herum, verschwindet wieder im Strauche, läuft auf der Erde fort zu den nächsten Deckungen, und das alles mit einer Gewandtheit, welche die unseres Zaunkönigs weit übertrifft. Er hat, was das Schlüpfen anbetrifft, mit dem Sammetköpfchen Ähnlichkeit; seine Eilfertigkeit und Gewandtheit ist aber viel bedeutender. Auch läuft er stolz wie eine Bachstelze oder hurtig wie ein Blaukehlchen auf dem Boden dahin, den Schwanz in der Regel fast senkrecht in die Höhe gestelzt. Drollig sieht der Vogel aus, wenn er in dieser Stellung auf die Höhe eines Steines kommt und hier Umschau hält.« Aehnlich schildert ihn Hansmann. »Rastlos in Bewegung von einem Cistenstrauche zum anderen gehend, bald Käferchen aus der Blütenkrone hervorpickend, bald einen flatternden Spanner über der Erde im Laufe verfolgend, läßt er von Zeit zu Zeit sein klingendes Liedchen erschallen, welches große Aehnlichkeit mit dem Gezwitscher eines jungen Kanarienvogelmännchens hat, mit dem Unterschiede jedoch, daß jenes, wie der Gesang des Rothkehlchens, in Moll schließt. So wenig laut das Lied des sardischen Sängers auch an und für sich ist, so weit kann man es doch vernehmen, besonders einzelne hellere Töne, die fast ganz dem Schellen einer kleinen Klingel gleichen. Der Lockruf ähnelt vollkommen demjenigen des rothrückigen Würgers, nur daß er um ein bedeutendes leiser ist. Schärfer und schneller ausgestoßen, wird er zum Warnungsrufe.
»Der sardische Sänger ist der allerletzte, welcher sich noch in der Dämmerung hören läßt, nachdem schon die ersten Zwergohreulen angefangen haben zu rufen. Dann aber ist sein Gesang nur ein helles Aufflackern, welches sich in langen und unregelmäßigen Pausen wiederholt, jedenfalls eine Folge der Unruhe dieses Vogels, dem die herabsinkende Nacht noch nicht sogleich auf die Augenlider fällt.
»Es ist ziemlich schwierig, den Sardensänger an seinen dicht bebuschten Aufenthaltsorten zu erlegen. Sobald er sich verfolgt sieht, taucht er unter die Cistenzweige, sein Wesen dicht über der Erde forttreibend. Dies wird um so leichter, als erstere, oben wohl eng mit den Kronen sich berührend, eine weite und zusammenhängende Decke bilden, unten jedoch, wo die Zwischenräume der Stämme nicht mit Moos oder Gras ausgefüllt werden, einen genügenden Raum zu freier Bewegung darbieten. Zuweilen taucht er dann zwischen den oberen Zweigen jener Pflanzen auf, geschickt durch die Blätter sich deckend, so daß man höchstens einen Theil des Schwanzes oder eines anderen Gliedes, nie jedoch den ganzen Vogel gewahr wird. Verhält man sich ruhig, so erscheint er auch wohl singend auf dem Gipfel des nächsten Busches, von dem man ihn dann, schnell feuernd, herab schießen kann. Jede verdächtige Bewegung vorher macht, daß er mit einem kurzen ›Täck‹ unter der Laubdecke verschwindet. Flügellahm geschossen, läuft er hurtig an der Erde fort, und man muß flink hinterher sein, will man ihn noch zu rechter Zeit ergreifen.
»Sein Nest legt er am liebsten in einem dichten Dornen- oder Mirtenbusche an, da ihm die Cisten im ganzen doch zu durchsichtig sind. Es besteht aus dürren Halmen und ist inwendig mit einzelnen Pferdehaaren, hin und wieder auch mit einer Feder ausgelegt, verhältnismäßig tief, jedoch nicht sehr fest gebaut und mehr dünnwandig, nach Art etwa des der fahlen Grasmücke, mit welcher überhaupt alle Strauchsänger im Nestbaue Aehnlichkeit haben. Die vier bis fünf Eier sind auf grünlich schmutzigweißem Grunde mit ölgrünen Wolken, welche hin und wieder das Gepräge von Flecken annehmen, sowie mit einzelnen wirklichen ins Aschbläuliche spielenden Flecken, schwarzen Pünktchen und ab und zu einer schwarzen Schnörkellinie gezeichnet.
»Die Jungen gleichen vollkommen den Alten, nur daß der dunkle Anflug auf den Scheitel und an den Zügeln bei dem jungen Männchen bei weitem nicht so stark ist als bei dem erwachsenen, und daß der Augenlidrand des Jugendkleides einen nur geringen rothen Anflug zeigt. Sonst aber ist das Wesen, wie wir es an den alten Vögeln sehen, schon gänzlich bei den kaum flüggen Jungen ausgeprägt, und es hält ziemlich schwer, die aus dem Neste noch vor ihrer vollkommenen Flugbarkeit herausgehüpften Vögel zu ergreifen, da sie mit ungemeiner Behendigkeit zwischen den Cistenzweigen hindurchzuklimmen und so zu entfliehen wissen.
»Der sardische Sänger ist Standvogel für Sardinien und verläßt auch im Winter seinen einmal gewählten Aufenthaltsort nicht. Da er schon mit dem Anfange des April zu nisten beginnt, bringt er gewiß den Sommer über drei Bruten zu Stande.«
Aus vorstehender Schilderung ist mir deutlich hervorgegangen, daß die Schlüpfgrasmücke oder der Provencesänger ( Sylvia provincialis, undata, ferruginea und dartfordiensis, Motacilla provincialis und undata, Melizophilus provincialis und dartfordiensis, Ficedula ulicicola, Curruca, Thamnodus und Malurus provincialis), welche ich in Spanien sehr häufig beobachtet habe, als der nächste Verwandte des sardischen Sängers angesehen werden muß. Das Gefieder der Oberseite ist dunkel aschgrau, das der Unterseite dunkel weinroth, das der Kehle gilblichweiß gestreift; die Schwingen und Steuerfedern sind bräunlichgrau, die vier äußersten Schwanzfedern jederseits an der Spitze weiß gesäumt. Das Auge ist hell rothbraun, der Augenring ziegelroth der Schnabel schwarz, an der Wurzel des Unterschnabels röthlich, der Fuß röthlichgrau. Die Länge beträgt dreizehn, die Breite sechzehn, die Fittiglänge fünf, die Schwanzlänge sechs Centimeter.
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Sänger der Provence keineswegs bloß diese, Westfrankreich und das übrige Südeuropa oder Kleinasien und Nordafrika, sondern auch das südliche Großbritannien ständig bewohnt. Hier haust er in dem öde Triften deckenden Stachelginster; in Spanien dagegen geben ihm die niederen Kieferdickichte, die mit der stattlichen Buschheide, den Cistenrosen bedeckten Nordabhänge der Gebirge Kataloniens, die mit dürftigem Gestrüpp kaum begrünten Einöden Valencias, die steppenartigen Ackerstücke Kastiliens, die Eichenwälder, Hecken, niederen Gebüsche, kurzum, der Buschwald im weitesten Sinne, Herberge. Kaum betritt man einen dieser Urwälder der kleinen Sängerschaft, so vernimmt man sein einfaches, aber gemüthliches Liedchen, welches nach Hansmanns Versicherung dem des Sardensängers aufs täuschendste ähnelt, und erblickt, wenn man glücklich ist, das rothgebrüstete Vögelchen auf der Astspitze eines Busches. Hier dreht und wendet es sich nach allen Seiten, spielt mit seinem Schwanze, den es bald stelzt, bald wieder niederlegt, sträubt die Kehle und singt dazwischen. Beim Herannahen des Jägers huscht es überschnell wieder in das Dickicht, und ist dann auch dem schärfsten Auge zeitweilig verschwunden. Aber das währt nicht lange; denn immer und immer wieder erscheint es auf der Spitze des Kronentriebes einer Kiefer, auf dem höchsten Zweige eines Busches, sieht sich einen Augenblick um, stürzt wieder auf den Boden herab und huscht und läuft hier wie eine Maus dahin. Ist das Dickicht weniger filzig, so sieht man es ab und zu, doch nur einem Schatten vergleichbar; denn man gewährt bloß einen eilig sich bewegenden Gegenstand. Nach einem Schusse oder einem anderen Geräusche erscheint es regelmäßig auf der Spitze eines Busches, doch nur um sich umzusehen: im nächsten Augenblicke ist es verschwunden. In seinem Betragen hat es mich oft an unsere Braunelle erinnert; es ist aber weit gewandter und behender als diese.
Besonders anmuthig erscheint der Sänger der Provence, wenn er seine Familie führt. Auch er beginnt schon in den ersten Monaten des Jahres mit seinem Brutgeschäfte, nistet aber zwei-, sogar dreimal im Laufe des Sommers und zieht jedesmal eine Gesellschaft von vier bis fünf Jungen heran. Sobald diese nur einigermaßen flugfähig sind, verlassen sie das Nest, auf ihre, vom ersten Kindesalter an bewegungsfähigen Füße sich verlassend. Den kleinen unbehülflichen Jungen wird es schwer, sich in die Höhe zu schwingen, und sie laufen deshalb ganz wie Mäuse auf dem Boden dahin. Aber die Alten fürchten, wie es scheint, gerade wegen ihres Aufenthaltes da unten in allem und jedem Gefahr und sind deshalb überaus besorgt. Abwechselnd steigt eines um das andere von den beiden Eltern nach oben empor, und unablässig tönt der Warnungs- und Lockruf des Männchens, dem die schwere Pflicht obliegt, die Familie zusammenzuhalten. Sind die Jungen etwas weiter entwickelt, so folgen sie den Alten auch in die Höhe, und es sieht dann köstlich aus, wenn erst das Männchen und hierauf eins der Jungen nach dem anderen auf den Buschspitzen erscheint und dann beim ersten Warnungsrufe die ganze Gesellschaft mit einem Male wieder in die Tiefe sich hinabstürzt. Man gewahrt nur noch eilfertiges Rennen, Laufen und Huschen, hört ab und zu das warnende »Zerr zerr« und endlich nichts mehr, bis das Männchen wieder nach oben kommt.
Das Nest ähnelt dem der Verwandten; die Eier sind etwa achtzehn Millimeter lang, vierzehn Millimeter breit und auf grünlichweißem Grunde verschiedenartig lichter oder dunkler braun gefleckt.
Die Laubsänger ( Phylloscopinae) bilden eine zweite, etwa hundertundfunfzig Arten zählende, fast über die ganze Erde verbreitete Unterfamilie und kennzeichnen sich durch schlanken Bau, pfriemenförmigen, an der Wurzel abgeplatteten Schnabel, schwachen Fuß, mittellangen Flügel, meist etwas ausgeschnittenen Schwanz und blattfarbiges Gefieder.
Innerhalb ihrer Familie dürfen die Laubsänger als die Baumvögel bezeichnet werden. Die Wipfel der Bäume sind ihr Wohn- und Jagdgebiet. Hinsichtlich ihrer Begabungen stehen sie den Grasmücken wenig nach. Auch sie sind rege, lebhaft, gewandt und sangeskundig, aber doch nicht so vorzügliche Sänger wie jene. Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Gruppen ist im Nestbaue zu finden; denn die Laubsänger errichten stets mehr oder weniger künstliche Gebäude.
Obenan stellen wir die Gartensänger oder Bastardnachtigallen ( Hypolais), über das nördlich altweltliche, indische und äthiopische Gebiet verbreitete, verhältnismäßig große Laubsänger, mit großem, starkem und breitem, an den Schneiden scharfem, jedoch kaum eingezogenem Schnabel, kräftigen Füßen, mäßig langen Flügeln, in denen die dritte oder vierte Schwinge die anderen überragen, und mittellangem oder kurzem, seicht ausgeschnittenem Schwanze.
Der Gartensänger, auch Gartenlaubvogel, Spötterling, Hagspatz, Bastardnachtigall, Mehlbrust, Titeritchen und Schakerutchen genannt ( Hypolais icterina, hortensis, vulgaris, und salicaria, Motacilla und Fidecula hippolais, Sylvia hipolais, hippolais, icterina, obscura und xanthrogastra, Salicaria vulgaris), ist auf der Oberseite olivengrüngrau, auf dem Zügel und der unteren Seite blaß schwefelgelb, in der Ohrgegend, auf den Hals- und Körperseiten schwach ölgrau verwaschen; die Schwingen sind olivenbraun, auf der Außenfahne grünlich, innen breit fahlweiß gesäumt, die Schwanzfedern lichter als die Schwingen, außen wie diese gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel graubraun, an der Wurzel der Unterkinnlade röthlichgelb, der Fuß lichtblau. Die Länge beträgt einhundertfünfundvierzig, die Breite zweihundertfunfzig, die Fittiglänge neunzig, die Schwanzlänge dreiundfunfzig Millimeter.
Als Vaterland des Gartensängers müssen wir Mitteleuropa ansehen. Von hier aus verbreitet er sich nördlich bis Skandinavien, wahrend er im Süden des Erdtheiles durch Verwandte vertreten wird. In Großbritannien kommt er nicht vor; in Spanien haben wir ihn ebensowenig beobachtet; Griechenland besucht er nur zur Zugzeit.
In Südeuropa, von Portugal an bis Dalmatien, wie in Nordwestafrika wird der Gartensänger durch den etwas kleineren und lebhafter gefärbten Sprachmeister ( Hypolais polyglotta, Sylvia und Ficedula polyglotta) vertreten, welcher sich außer den angegebenen Merkmalen noch dadurch von ihm unterscheidet, daß die dritte und vierte Schwinge, nicht die dritte allein, die längste ist. Die Länge beträgt einhundertsiebenunddreißig, die Breite zweihundert, die Fittiglänge achtundsechzig, die Schwanzlänge fünfundfunfzig Millimeter.
Unter seinen Verwandten ist der Gartensänger der weichlichste und zärtlichste. Er erscheint bei uns zu Lande erst, wenn alle Bäume sich belaubt haben, niemals vor Ende des April, und verweilt in Deutschland höchstens bis zu Ende des August. Den Winter verbringt er in Afrika. Er wohnt gern in unmittelbarer Nähe des Menschen, bevorzugt Gärten und Obstpflanzungen dem Walde, bevölkert mehr die Ränder als die Mitte desselben, fehlt im Nadelwalde gänzlich und steigt auch im Gebirge nicht hoch empor. Gärten mit Hecken und Gebüschen, in denen Hollunder-, Flieder-, Hartriegel- und ähnliche Gesträuche dichte und nicht allzuniedrige Bestände bilden, oder Obstpflanzungen, welche von Hecken eingefaßt werden, beherbergen ihn regelmäßig.
Sein Gebiet wählt er mit Sorgfalt aus; hat er aber einmal von ihm Besitz genommen, so hält er mit Hartnäckigkeit an ihm fest und kehrt alle Sommer zu ihm zurück, so lange er lebt. Wir haben einen, welchen wir wegen seines wenig ausgezeichneten Gesanges halber »den Stümper« nannten, sieben Jahre nach einander in einem und demselben Garten beobachtet. Im Laufe des Tages ist er bald hier bald dort, so lange ihn nicht die Sorge um das brütende Weibchen oder um die Brut selbst an eine bestimmte Stelle fesselt. Gewöhnlich hüpft er in dichten Bäumen umher, immer möglichst verborgen, und es kann geschehen, daß man viele Minuten lang ihn vergeblich mit dem Auge sucht, trotzdem er sich beständig hören läßt. Gewisse Bäume, gewöhnlich die höchsten und belaubtesten seines Wohnraumes, werden zu Lieblingsplätzen; sie besucht er täglich mehrere Male, und auf ihnen verweilt er am längsten. Im Sitzen trägt er die Brust aufgerichtet; wenn er etwas auffälliges bemerkt, sträubt er die Scheitelfedern; im Hüpfen hält er sich wagerecht und streckt dabei den Hals vor. Der Flug ist rasch, gewandt und jäher Wendungen fähig. Auf den Boden herab kommt der Gartensänger selten. Nur während des Singens verweilt er längere Zeit an einer und derselben Stelle; sonst ist er, sozusagen, beständig auf der Wanderung begriffen. Die Lockstimme ist ein sanftes »Teck teck«, welchem ein wohllautendes »Terüt« angehängt wird, wenn besonderes Verlangen, Eifersucht oder Zorn, auch wohl drohende Gefahr ausgedrückt werden sollen; seinen Aerger oder vielleicht auch seine Kampfeslust pflegt er durch die Silben »Hettettett« kundzugeben. Der Gesang spricht nicht jedermann an und wird deshalb verschieden beurtheilt; auch singt keineswegs ein Gartensänger wie der andere: dieser ist vielleicht ein ausgezeichneter Spötter, welcher die verschiedensten Laute der umwohnenden Vögel in seine Weise mischt, jener nur ein erbärmlicher Stümper, welcher bloß wenige wohllautende Töne vorträgt und die minder angenehmen gewissermaßen zur Hauptsache macht. Ich muß sagen, daß ich den Gesang ansprechend finde und die abgebrochenen und schwatzenden Laute über die herrlich flötenden vergesse. Er singt von der Morgendämmerung an bis gegen Mittag hin und abends bis zu Sonnenuntergange, am eifrigsten selbstverständlich, während das Weibchen brütet oder wenn ein Nebenbuhler zum Kampfe auffordert, läßt sich auch so leicht nicht beirren, nicht einmal durch einen Fehlschuß zum Schweigen bringen, als wolle er, wie Naumann meint, »den mißlungenen Anschlag auf sein Leben aller Welt verkündigen oder den ungeschickten Schützen verhöhnen«. Zwei Männchen, welche neben einander wohnen, eifern sich gegenseitig nicht bloß zum Gesange an, sondern raufen sich auch sehr häufig. »Es darf sich«, sagt Naumann, »kein anderer seiner Art blicken lassen; er wird sogleich mit grimmigen Bissen verfolgt und sofort wieder aus dem Gebiete gejagt. Der Eindringling widersetzt sich aber meistens, und dann gibt es heftige Schlägereien, so daß man nicht selten ein Paar solcher Zänker, welche sich gepackt haben, im Streite zur Erde herabpurzeln, hierüber dann aber gewöhnlich erschreckt, plötzlich aus einander fahren, und nun einen jeden seinem Standorte zueilen sieht. Auch andere Vögel, welche um sie wohnen, necken und jagen sie gern.«
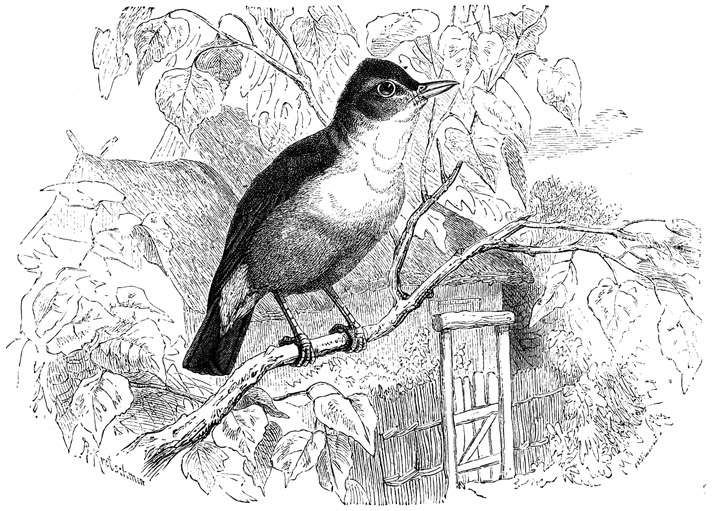
Gartensänger ( Hypolais icterina). 2/3 natürl. Größe.
Die Hauptnahrung besteht aus Käferchen und anderen kleinen fliegenden Kerbthieren, welche von den Blättern abgelesen oder aus der Luft weggefangen werden. Deshalb sieht man ihn auch häufig in den Baumkronen umherflattern oder selbst über die schützenden Zweige hinausflattern. Wenn die Kirschen reif werden, besucht er die fruchtbeladenen Bäume und erlabt sich an dem weichen Fleische der süßen Früchte; wenn es Johannisbeeren gibt, erhebt er sich von ihnen seinen Zoll: irgendwie nennenswerthen Schaden richtet er hierdurch aber nicht an.
Ungestört brütet er nur einmal im Jahre und zwar zu Ende des Mai oder zu Anfang des Juni. Das Nest steht regelmäßig in dem dichtesten Busche seines Gebietes, am liebsten in Flieder-, Hasel-, Hartriegel-, Faulbaum-, selten oder nie in Dornen tragenden Büschen, nicht gerade verborgen, aber doch immer durch das Laub verdeckt und geschützt. Es ist ein sehr zierlicher, beutelförmiger Bau, dessen Außenwandung aus dürrem Grase und Queggenblättern, Bastfasern, Pflanzen- und Thierwolle, Birkenschalen, Raupengespinst, Papier und ähnlichen Stoffen äußerst kunstreich und dauerhaft zusammengefilzt, und dessen Inneres mit einigen Federn ausgepolstert und mit zarten Grashalmen und Pferdehaaren ausgelegt wird. Die vier bis sechs länglichen, siebzehn Millimeter langen, dreizehn Millimeter dicken Eier sind auf rosenrothem oder rosenroth-ölgrauem Grunde mit schwärzlichen oder rothbraunen Punkten und Aederchen gezeichnet. Männchen und Weibchen bebrüten sie wechselweise, zeitigen sie innerhalb dreizehn Tagen und füttern die ausgeschlüpften Jungen mit allerlei kleinen Kerbthieren auf.
Der Gartensänger zählt zu den hinfälligsten Stubenvögeln, verlangt die sorgsamste Pflege und ausgewählteste Nahrung, hält aber trotzdem, zum Kummer aller Liebhaber, selten längere Zeit im Käfige aus; doch kenne ich Beispiele, daß einzelne mehrere Jahre ausdauerten, fleißig sangen und leicht mauserten. Solche werden ungemein zahm und zu einer wahren Zierde des Gebauers.
Bei uns zu Lande verfolgt man den ebenso munteren als nützlichen Vogel nicht, schützt ihn eher, in einzelnen Gegenden unbedingt, und hat dadurch wesentlich beigetragen, daß er sich stetig vermehrt. Hauskatzen dürften seiner Brut gefährlich werden; ihn selbst sichert sein verstecktes Leben vor den meisten Nachstellungen der gewöhnlichen Feinde des Kleingeflügels, nicht aber vor den Netzen der auch ihm auflauernden Wälschen.
Es war in einem der blumenreichen Gärten Valencias, wo ich zum erstenmale das Lied eines bis dahin mir noch unbekannten Gartensängers vernahm. Der Gesang fiel mir auf, weil er mir vollständig fremd war. Ich erkannte aus ihm wohl die Sippe, welcher der Vogel angehören mußte, nicht aber eine schon früher beobachtete Art. Einmal aufmerksam gemacht, wurde es mir und meinen Begleitern nicht schwer, den fraglichen Sänger auch außerhalb der Ringmauern der Stadt Valencia aufzufinden, und so erfuhren wir denn, daß derselbe sich über den ganzen Südosten Spaniens verbreitet und da, wo er einmal vorkommt, viel häufiger ist als jeder andere Verwandte von ihm an seinen bezüglichen Aufenthaltsorten. Der Grauspötter ( Hypolais opaca, cinerascens, fuscescens und Arigonis, Phyllopneuste opaca, Chloropeta pallida) ist oberseits olivenbräunlich, unterseits schmutzigweiß; Zügel und ein schmaler Augenring sind weißlich, Ohrgegend, Hals- und Körperseiten bräunlich verwaschen, die unteren Flügel- und Schwanzdecken gilblichweiß, die Schwingen und Schwanzfedern braun mit schmalen fahlbräunlichen Außensäumen, die äußersten drei Schwanzfedern jederseits schmal fahlweiß gerandet. Die Iris ist dunkelbraun, der Oberschnabel horngrau, der untere gilblichgrau, der Fuß bleigrau. Die Länge beträgt einhundertundfunfzig, die Breite zweihundert, die Fittiglänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge dreißig Millimeter.
In Griechenland vertreten unseren Vogel zwei nahe verwandte Arten: der merklich kleinere, genau gleich gefärbte, durch seinen erheblich schmäleren Schnabel jedoch hinlänglich unterschiedene Blaßspötter ( Hypolais pallida, elaeica, megarhyncha und Verdoti, Sylvia pallida, Salicaria elaeica, Acrocephalus pallidus, Ficedula ambigua), welcher wahrscheinlich dem Ramaspötter ( Hypolais caligata oder Rama) gleichartig ist, und der größere, dunklere Olivenspötter ( Hypolais olivetorum, Sylvia, Salicaria und Ficedula olivetorum), welcher sich durch die olivenbräunlichgraue Oberseite, die weiße, schwach rostfahl überflogene, auf Hals und Körperseiten bräunlich verwaschene Unterseite sowie die bräunlichweiß gesäumten unteren Flügeldecken und die außen und innen fahlweiß gerandeten Schwungfedern unterscheidet.
Wie es scheint, meidet der Grauspötter das Gebirge oder überhaupt bergige Gegenden und wählt ausschließlich baumreiche Stellen der Ebenen zu Wohnsitzen. Besondere Lieblingsorte von ihm sind die Huertas, jene paradiesischen Gefilde Spaniens, welche noch heutzutage durch die von den Mauren angelegten Wasserwerke regelmäßig bewässert werden und in Fruchtbarkeit schwelgen. Hier in den Obst- oder Blumengärten, welche innerhalb dieses einen großen Gartens sich finden, neben und über den Spaziergängen der Städte und Dörfer und selbst noch in den an die Ebene stoßenden Weinbergen und Oelpflanzungen ist unser Vogel so häufig, daß wir von ungefähr zwanzig neben einander stehenden Silberpappeln zwölf singende Männchen herabschießen konnten.
So sehr der Grauspötter unserem Gartensänger hinsichtlich seines Aufenthaltes und seines Betragens ähnelt, so bestimmt unterscheidet er sich von ihm durch seine Verträglichkeit, anderen derselben Art gegenüber, und durch seinen Gesang. Ich habe nie gesehen, daß zwei Männchen eifersüchtig sich verfolgt hätten, vielmehr wiederholt beobachtet, daß zwei Paare auf einem und demselben Baume lebten; ich habe sogar zwei Nester mit Eiern auf einem Baume gefunden. An ein feindseliges Verhältnis zwischen den betreffenden Paaren ist also gar nicht zu denken, und diese Verträglichkeit fällt dem, welcher das zänkische Wesen anderer Gartensänger kennt, augenblicklich auf. Aber auch der Gesang unterscheidet den Grauspötter leicht und sicher von seinen Verwandten. Der Lockton, welchen man von beiden Geschlechtern vernimmt, ist das so vielen Singvögeln gemeinsame »Tack tack«, der Gesang ein zwar nicht unangenehmes, aber doch höchst einfaches Lied, welches in mancher Hinsicht an den Gesang gewisser Schilfsänger erinnert und von der Nachahmungsgabe oder Spottlust unserer Gartensänger nichts bekundet. In seinen Bewegungen, wie überhaupt in allen wesentlichen Eigenschaften, ähnelt der Grauspötter unserem Gartensänger; doch darf er vielleicht als ein minder lebhafter Vogel bezeichnet werden. An das Treiben des Menschen hat er sich so gewöhnt, daß er durchaus keine Scheu zeigt, sich vielmehr in nächster Nähe beobachten läßt und noch das kleinste Gärtchen inmitten der Häusermassen großer Städte wohnlich und behaglich findet. Sein Vertrautsein mit dem Menschen geht so weit, daß er sich auf den belebtesten Spaziergängen ansiedelt, selbst wenn diese bis nach Mitternacht von Laternen glänzend beleuchtet sein sollten.
Die Brutzeit beginnt erst zu Anfang des Juni und währt bis Ende des Juli. Zum Nisten wählt sich das Paar stets einen hohen, dichtwipfeligen Baum und eine blätterreiche Stelle des Gezweiges. Hier, immer in beträchtlicher Höhe über dem Boden, steht oder hängt das Nest zwischen zwei senkrecht auf- oder ablaufenden Zweigen, welche in dasselbe verflochten werden, erinnert also in dieser Hinsicht an die Nester der Schilfsänger. Die Wandungen sind sehr dicht, aber aus verschiedenen Stoffen zusammengefilzt. Einzelne Nester bestehen aus Grashalmen, dickeren und feineren durcheinander, und werden innen kaum mit Distelwolle ausgekleidet; andere sind fast ganz aus letzterer oder aus Baumwolle und aus Schalenstückchen verschiedener Bäume zusammengesetzt. Die Nestmulde hat einen Durchmesser von fünf und eine Tiefe von vier Centimeter. Das Gelege besteht aus drei bis fünf rein eiförmigen Eiern, welche auf blaßgrauem oder blaßröthlichem Grunde mit unregelmäßigen, d. h. größeren und kleineren Flecken und Punkten von dunkelbrauner bis schwarzer Farbe gezeichnet sind. Beide Eltern brüten abwechselnd, beide füttern die Brut heran, und beide lieben sie äußerst zärtlich. Ob das Paar mehr als einmal im Sommer nistet oder nur eine Brut erzieht, lasse ich dahin gestellt sein; ich kann blos sagen, daß wir zu Ende des Juli die ersten flüggen Jungen beobachteten, zugleich aber bemerkten, daß die Alten um diese Zeit noch nicht mauserten. Höchst wahrscheinlich ist der Grauspötter in Spanien nur Sommergast; ich vermag jedoch hierüber, und also auch über die Zeit seiner Ankunft und seines Wegzuges, bestimmtes nicht anzugeben.
Die nächsten Verwandten der Bastardnachtigallen sind die Laubsänger ( Phyllopneuste), kleine Arten der Unterfamilie, mit schwachem, an der Wurzel etwas verbreitetem, übrigens pfriemenförmigem, vorn zusammengedrücktem Schnabel, mittellangen, schwachen, kurzzehigen Füßen, ziemlich langen Flügeln, unter deren Schwingen die dritte und vierte die längsten, mäßig langem, gerade abgeschnittenem oder schwach ausgekerbtem Schwanze und lockerem, bei beiden Geschlechtern fast im ganzen sehr übereinstimmend gefärbtem Kleide.
Innerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes wohnen vier Arten, deren Lebensweise in allen Hauptzügen so übereinstimmt, daß ich sie gemeinschaftlich abhandeln darf.
Die schönste und größte Art ist der Waldlaubsänger, Schwirrlaubvogel, Seiden- und Spaliervögelchen ( Phyllopneuste sibilatrix und sylvicola, Sylvia sibilatrix, flaveola und sylvicola, Sibilatrix sylvicola, Motacilla und Fidecula sibilatrix). Die Länge beträgt einhundertsiebenunddreißig, die Breite zweihundertfünfundzwanzig, die Fittiglänge siebenundsiebzig, die Schwanzlänge sechsundfunfzig Millimeter. Die Obertheile sind hell olivengrün, ein bis auf die Schläfen reichender Augenstreifen, Kopfseiten, Kinn und Kehle, Kropf und untere Flügeldecken blaßgelb, die übrigen Untertheile weiß, die Seiten olivenfarb verwaschen, die Schwingen und Schwanzfedern olivenbraun, außen schmal grün, innen breiter weißlich gerandet, die Schwanzfedern am Ende licht, die Schwingen außen grüngelb gesäumt. Der Augenring ist dunkelbraun, der Oberschnabel braun, unterseits fleischbräunlich, der Fuß braun, an den Schilderrändern gelblich.
Das Verbreitungsgebiet umfaßt vom mittleren Schweden an ganz Mitteleuropa und ebenso Westasien; auf dem Winterzuge besucht der Vogel Nordafrika bis Habesch.
Die fast aller Orten in Deutschland häufigere und gemeinste Art der Sippe ist der Fitislaubsänger, auch Fitting, Schmidtl, Wisperlein, Backöfelchen und Sommerkönig oder, wie die nächst verwandten Arten, Weidenzeisig, Weidenblättchen und Weidenmücke genannt ( Phyllopneuste trochilus, Motacilla trochilus und fitis, Sylvia trochilus, flaviventris, tamaricis, angusticauda und Eversmanni, Ficedula trochilus und fitis). Die Länge beträgt einhunderteinundzwanzig, die Breite einhundertfünfundachtzig, die Fittiglänge zweiundsechzig, die Schwanzlänge funfzig Millimeter. Die Obertheile sind olivenbraungrün, welche Färbung auf dem Bürzel in das Grüne übergeht, die Untertheile blaßgelb, auf Kehle und Kropf am lebhaftesten, Ohrgegend, Hals- und Körperseiten olivengelbbräunlich, Unterbrust und Bauch weiß, die Federn hier mit schmalen, verwaschenen, blaßgelben Säumen, ein Augenstreif blaßgelb, ein Zügelstreif bräunlich, die Schwingen und Schwanzfedern olivenbraun, außen schmal bräunlichgrün, erstere innen breiter weißlich gesäumt. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel schwarzbraun, an der Wurzel des Unterschnabels gelb, der Fuß gelbbräunlich.
Vom mittleren Schweden und Schottland an verbreitet sich der Fitis über ganz Europa und den größten Theil Asiens und wird im Winter ebenso in Indien, wie in fast ganz Afrika angetroffen.
In einzelnen Theilen unseres Vaterlandes tritt der Weidenlaubsänger, Weidensänger, Erdzeisig, Mitwaldlein ( Phyllopneuste rufa, Curruca rufa, Sylvia rufa, abietina, nemorosa, brevirostris, sylvestris und collybita, Ficedula, rufa, Motacilla acredula) häufiger auf als der Fitis. Seine Länge beträgt einhundertundzehn, seine Breite etwa einhundertundachtzig, die Fittiglänge sechzig, die Schwanzlänge sechsundvierzig Millimeter. Die Obertheile sind lebhaft olivengrünlichbraun, Kopf, Hals- und Körperseiten olivengelblichbraun, Kehle und Kropf blasser, die Federn hier einzeln seitlich verwaschen, blaßgelb gesäumt, Unterbrust und Bauch weiß, ein schmaler Augenstreif blaßgelb, ein undeutlicher Zügelstrich braun, die unteren Flügeldecken gelb, die Schwingen und Schwanzfedern olivenbraun, außen schmal grünbräunlich, erstere auch innen breiter fahlweißlich gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornbraun, an der Wurzel des Unterschnabels gelblich, der Fuß graulichbraun.
Auch der Weidenlaubvogel dringt bis nach Nordschweden und Westasien vor, ebenso, wie er im Winter seine Reise bis Mittelafrika ausdehnt.
Im Nordosten Europas, insbesondere im nördlichen Ural, vertritt ihn der Trauerlaubsänger ( Phyllopneuste tristis und fulvescens, Phylloscopos und Abrornis tristis) welcher sich durch matt olivenbraune Oberseite und roströthlichfahle Augenstreifen, Kopf- und Körperseiten, Kehle und Kropf unterscheidet.
Der Berglaubsänger endlich ( Phyllopneuste Bonellii und montana, Sylvia Bonellii, Nattereri, albicans und prasinopyga, Ficedula Bonellii) ist ebenso groß wie der Fitis, oberseits düster olivenbraun, schwach grünlichgelb angeflogen, auf dem Bürzel lebhaft olivengelb, ein Augenstrich und der Zügel weißlich, ein kürzerer Strich hinter den Augen dunkel, die Ohrgegend fahlrostbräunlich, die Unterseite weißlich, seitlich schwach rostfahl verwaschen, das untere Flügeldeckgefieder schwefelgelb; die Schwingen und Schwanzfedern sind olivenbraun, außen schmal olivengrün, innen weißlich, die Armschwingen breiter olivengelb gesäumt, die oberen braunen Flügeldecken am Ende olivengrünlich gerandet. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel hornbraun, an den Schneiden und an der Wurzel des Unterschnabels horngelb, der Fuß braun.
Das Vaterland dieser Art ist der Süden Europas, das westliche Asien und Nordafrika. Auf dem Winterzuge besucht der Vogel Südnubien und den Senegal.
Außer den genannten wurde auf Helgoland auch noch eine asiatische Art der Sippe, der Wanderlaubvogel ( Phyllopneuste magnirostris, indica, javanica, borealis, sylvicultrix und Kenicotti, Phylloscopus magnirostris und javanicus, Sylvia flavescens) erbeutet. Das Gefieder dieser Art ist oberseits düster olivengrün, der Augenstreif wie Backen und Ohrgegend gelblichweiß, letztere undeutlich dunkler gestrichelt, unterseits weiß, schwachgelblich angeflogen, auf den Hals- und Körperseiten bräunlichgrau verwaschen, das untere Flügeldeckgefieder gelblichweiß; die dunkelbraunen Schwingen und Schwanzfedern zeigen schmale, olivengrünliche Außen-, die ersteren breitere fahlweiße Innensäume, die ersten Decken der Armschwingen fahlgrüne Endränder, wodurch ein undeutlicher Spiegel entsteht.
Unter unseren deutschen Laubvögeln trifft zuerst, meist schon um die Mitte des März, der Weidenlaubsänger, später, gegen Ende des März, der Fitislaubsänger und in der letzten Hälfte des April endlich der Waldlaubsänger ein, dieser, um bis zum August in unseren Wäldern zu verweilen, wogegen der Fitislaubsänger nicht vor Ende des September und der Weidenlaubsänger erst im Oktober von uns weg zieht. Der Berglaubsänger, ein Alpenvogel, welcher innerhalb der Grenzen unseres Vaterlandes nur Schwaben und Bayern bewohnt, erscheint noch später als seine Verwandten und verläßt sein Brutgebiet bereits im August wieder. In Deutschland lebt der Waldlaubsänger wohl in jeder Provinz, nicht aber in jeder Gegend; denn sein Wohnbaum ist die Buche, und er findet sich ausschließlich da, wo sie vorkommt, da, wo sie zusammenhängende Bestände bildet, ungemein häufig, da, wo sie im Nadelwalde eingesprengt ist, seltener, unter Umständen auf eine einzige Buche sich beschränkend. Nur in Südungarn habe ich ihn auch in Weiden- und Pappelwaldungen, wahrscheinlich aber als Zugvogel, angetroffen, da er in den herrlichen Wäldern der Fruschkagora, wie der Herrschaft Belye als einzige Art seines Geschlechts wiederum durch die Buche sich fesseln ließ. Diesem Baume zu Gefallen steigt er bis zur oberen Waldgrenze empor, wie er überhaupt im Gebirge lieber zu wohnen scheint als in der Ebene. Der Fitis beschränkt seinen Aufenthalt nicht in dieser Weise, tritt vielmehr buchstäblich aller Orten auf, wo er Unterkunft und Unterhalt zu finden glaubt, obwohl er gewisse Waldungen, namentlich gemischte mit viel Unterholz, anderen bevorzugt. In ähnlicher Weise verbreitet sich auch der Weidenlaubsänger, obschon er seinen Namen nicht umsonst trägt. In manchen Gegenden wohnen beide Arten friedfertig neben einander, hier tritt der eine, dort der andere häufiger auf. Der Berglaubvogel endlich wählt am liebsten südlich oder östlich gelegene, mit Lärchen und dichtem Unterholze bewachsene, hier und da durch Blößen unterbrochene Gehänge des Gebirges zu seinen Wohnsitzen, ohne deshalb Laubwaldungen mit Unterholz und dichter Pflanzendecke zu meiden. Für den Waldlaubvogel bilden die unteren Aeste hoher Buchen die beliebtesten Sitz- und Ruheorte, wogegen der Weidenlaubsänger die äußerste Wipfelspitze aufzusuchen pflegt und der Fitis zwischen hoch und niedrig kaum einen Unterschied macht. Jedes Pärchen grenzt sich auf der erwählten Oertlichkeit sein Brutgebiet ab, duldet innerhalb desselben kein anderes der gleichen Art, neckt und verfolgt auch alle übrigen kleinen Vögel, welche sich ihm allzunah aufdrängen, und trägt dadurch, wie durch die ihm eigene Unruhe und den zwar einfachen, aber doch nicht unangenehmen Gesang wesentlich zur Belebung der Wälder bei.
Bewegungen und Handlungen der Laubsänger verrathen, wie Naumann mit Recht sagt, immerwährenden Frohsinn. Ruhig auf einer und derselben Stelle zu sitzen, kommt ihnen schwer an. Wie die Grasmücken, sind sie fast ununterbrochen in Bewegung, bald geschickt durch Zweige schlüpfend, bald einer Zweigspitze zufliegend und flatternd vor derselben sich erhaltend, um ein Kerbthier wegzunehmen, bald singend einem anderen Baume zustrebend. Selbst wenn sie wirklich einmal auf einer Stelle sitzen, wippen sie wenigstens noch mit dem Schwanze. Ihr Flug ist flatternd und etwas unsicher, wie Naumann sich ausdrückt, hüpfend; auch beim Durchmessen weiterer Strecken beschreiben sie eine unregelmäßige, aus längeren und kürzeren Bogen zusammengesetzte Schlangenlinie. Nicht umsonst heißt der Waldlaubvogel auch der schwirrende; denn die Hauptstrophe seines Liedes ist in der That kaum mehr als ein Schwirren, welches man durch die Laute »Sisisisisirrrrrirrirr« ungefähr versinnlichen kann. Bei Beginn der Strophe, welche anscheinend mit größter Anstrengung hervorgestoßen wird, pflegt sich der Vogel von seinem Sitze herabzuwerfen und, mit den Flügeln zitternd oder schwebend, einem anderen Aste zuzuwenden, immer aber einem solchen, welchen er mit Beendigung der Strophe zu erreichen vermag, worauf er dann noch zwei oder dreimal die äußerst zartklingende Silbe »Hoid« verlauten läßt. Der Gesang des Fitis besteht nur aus einer Reihe sanfter Töne, welche wie »Hüid, hüid, hoid, hoid, hoid, hoid« klingen; aber das schmelzende und flötenartige, das Steigen und die Weichheit der Laute gibt ihm, wie mein Vater sagt, etwas eigenes und ansprechendes, daß er dem Schlage vieler Vögel vorzuziehen ist. Das Lied des Weidenlaubvogels dagegen beginnt mit den Silben, »Trip, trip, trip, het«, worauf die lauteren »Dillr, dellr, dillr, dellr« folgen; der Gesang des Berglaubsängers endlich klingt, laut Landbeck, wie »Se-e-e-e-trrre-e-e, da, da da, uit, uit, uit«. Alle Arten singen so lange die Brutzeit währt, außerordentlich eifrig, blähen daher die Kehle auf, sträuben die Scheitelfedern, lassen die Flügel hängen, zittern vielleicht auch mit ihnen, beginnen schon am frühesten Morgen und enden erst nach Sonnenuntergange.
Alle Laubsänger bauen mehr oder weniger künstliche, backofenförmige Nester auf oder unmittelbar über dem Boden. Die Nester des Waldlaubsängers, Fitis und Berglaubvogels stehen stets auf letzterem, die des Weidenlaubsängers in der Regel ebenfalls, zuweilen aber auch einen halben bis auf einen Meter hoch in Sträuchern, da, wo das Unterholz aus Wacholder besteht, fast stets in diesem. Der Waldlaubsänger wählt zu seinem Nistplatze den unteren Theil eines alten Stockes, den Fuß eines großen oder kleinen Baumstammes, welcher von Heidekraut, Heidel- oder Preißelbeeren, Moos und Gras dicht umgeben ist, errichtet hier aus starken Grashalmen, feinen Holzspänen, Moosstengeln, Kieferschalen, Splittern und ähnlichen Stoffen den äußerlich ungefähr dreizehn Centimeter im Durchmesser haltenden Kuppelbau mit vier Centimeter weitem Eingangsloche und kleidet das Innere mit feineren Grashalmen äußerst sauber aus, wogegen Fitis und Weidenlaubsänger den Bau aus Gras, Blättern und Halmen herstellen, mit Moos und Laub umkleiden, innen aber mit Federn, namentlich Rebhuhnfedern, ausfüttern, und der Berglaubvogel endlich, welcher das größte Nest unter allen Verwandten zu bauen scheint, Wurzeln, Gras, dürre Aestchen zum Außenbau, feiner gewählte Stoffe derselben Art zum Innenbau und zuweilen noch Thierhaare zur Auskleidung der Mulde verwendet. Um den großen Bau zu Stande zu bringen, beginnen die weiblichen Laubsänger, wie mein Vater vom Fitis beobachtete, damit, die Vertiefung auszuhöhlen, in welcher das Nest steht, ziehen, oft mit großer Anstrengung, die Gras- und Moosstengel aus und bearbeiten die Stelle mit dem Schnabel so lange, bis sie den Grund halbkugelförmig ausgegraben haben. Nunmehr erst gehen sie zum Herbeitragen und Ordnen der Niststoffe über, bethätigen hierbei aber, obgleich sie nur in den Morgenstunden daran arbeiten, so viel Fleiß und Eifer, daß das ganze binnen wenigen Tagen vollendet ist. Während der Arbeit suchen sie sich und das Nest sorgfältig zu verbergen, rupfen fern von jenem Moos und Gras aus, fliegen damit auf hohe, nahe beim Neste stehende Bäume und kommen erst von letzteren zur Niststelle herab. Der Waldlaubsänger brütet nur einmal im Jahre und zwar zu Ende des Mai oder im Anfange des Juni, der Fitis früher, meist schon in der ersten Hälfte des März, der Weidenlaubsänger ungefähr um dieselbe Zeit, der Berglaubsänger dagegen, der Lage seiner Wohnsitze entsprechend, kaum vor den letzten Tagen der ersten Hälfte des Juni. Das Gelege zählt bei den erstgenannten fünf bis sechs, beim Fitis fünf bis sieben, beim Weidenlaubsänger fünf bis acht, beim Berglaubsänger endlich vier bis fünf Eier, welche durchgängig funfzehn bis siebzehn Millimeter lang und elf bis dreizehn Millimeter dick, verschiedengestaltig, aber stets dünn- und glattschalig, glänzend und gefleckt sind. Die des Waldlaubsängers zeigen auf weißem Grunde viele rothbraune und verwaschen aschbläuliche, mehr oder minder dicht über die ganze Oberfläche vertheilte oder gegen das Ende hin gehäufte, die des Fitislaubsängers in ähnlicher Anordnung auf milchweißem Grunde hellrothe oder hell lehmröthliche, auch wohl hell röthlichbraune und verwaschen blauröthliche, die des Weidenlaubsängers auf kreideweißem Grunde rothbraune und braunrothe, auch wohl dunkel rothbraune und aschgraue, die des Berglaubsängers endlich auf weißem Grunde bläuliche oder bräunliche, entweder über das ganze Ei vertheilte, oder gegen das dicke Ende hin gehäufte, hier auch wohl kranzartig zusammenfließende Punkte und Flecke. Beide Geschlechter brüten abwechselnd, das Männchen jedoch nur während der Mittagstunden, auch nicht so hingebend wie das Weibchen, welches sich fast mit Händen greifen oder thatsächlich ertreten läßt, bevor es wegfliegt und, wenn endlich entschlüpft, in kriechender Weise dicht über dem Boden dahinfliegt, falls aber bereits Junge im Neste liegen, unter allerlei mit kläglichem Schreien begleiteten Listen und Verstellungskünsten flüchtet. Nach höchstens dreizehntägiger Brutzeit entschlüpfen die Jungen; ebenso viele Tage später sind sie erwachsen, noch einige Tage darauf selbständig geworden, und nun entschließen sich Fitis und Weidenlaubsänger auch wohl, zum zweitenmal zu brüten.
Den behaarten und befiederten Räubern, welche kleinen Vögeln insgemein nachstellen, gesellen sich als Feinde der Laubsängerbrut Mäuse, Waldspitzmäuse, vielleicht auch Schlangen und Eidechsen; mehr aber als durch alles dieses Gezücht ist sie durch länger anhaltende Platzregen gefährdet. Der Mensch verfolgt die munteren und liebenswürdigen Vögel nur in Welschland, Südfrankreich und Spanien, um auch sie für die Küche zu verwerthen. Im Käfige sieht man Laubfänger selten, obwohl sie sich recht gut für die Gefangenschaft eignen, zwar nicht in allen Fällen und ohne ihnen gewidmete Aufmerksamkeit, aber doch unter sorgsamer Pflege an ein Ersatzfutter sich gewöhnen, bald zahm und zutraulich werden und dann alle auf ihre Pflege verwendete Mühe reichlich vergelten.
Unbemerkt oder unerkannt durchwandert alljährlich ein dem fernen Ostasien angehöriger Laubsänger unser Vaterland, um viele tausend Kilometer von seiner Heimat, in Westafrika, Herberge für den Winter zu nehmen: der Goldhähnchenlaubsänger, wie ich ihn nennen will, ( Phyllopneuste superciliosa und modesta, Motacilla superciliosa, Regulus modestus, proregulus und inornatus, Reguloides superciliosus, modestus und proregulus, Phylloscopus superciliosus und modestus, Sylvia proregulus und bifasciata, Phyllobasileus superciliosus). Er wird, weil er durch verhältnismäßig kürzeren Schnabel und Fuß, aber etwas längeren und mehr zugespitzten Flügel von den übrigen Arten der Sippe sich unterscheidet, auch wohl als Vertreter einer eigenen Untersippe, der Laubkönige ( Phyllobasileus), angesehen. Die Oberseite ist matt olivengrün, ein vom Nasenloche über den Augen hinweg zum Hinterkopfe verlaufender, ziemlich breiter, ober- und unterseits matt schwarz gesäumter Streifen blaßgelblich, ein über die Scheitelmitte ziehender zweiter, undeutlicher, heller als das ihn umgebende Gefieder, die ganze Körperseite vom Kropf an bis zu den Schenkeln zart grünlichgelb, die übrige Unterseite weißgelblich überflogen; die Schwingen und Schwanzfedern sind schwarzbraun, außen schmal olivengrün, erstere auch innen weiß gesäumt, die Armschwingen- und größten Oberflügeldeckfedern am Ende blaßgelb gerundet, zwei helle Flügelquerbinden zeichnend. Das Auge ist gelbbraun, der Schnabel dunkel hornfarben, unterseits von der Wurzel orangegelblich, der Fuß hell rothbraun. Die Länge beträgt neunzig bis hundert, die Breite einhundertundsechzig, die Fittiglänge zweiundfunfzig, die Schwanzlänge neunundreißig Millimeter.
Die Ausdehnung des Brutgebietes unseres Goldhähnchenlaubsängers ist zur Zeit noch unbekannt; wir wissen nur, daß er Turkestan vom Tianschan an, Ostsibirien vom Baikalsee an, China und den Himalaya bewohnt, in einem Höhengürtel zwischen ein- und dritthalbtausend Meter haust und brütet und allwinterlich nach Südindien hinabwandert. Kaum minder regelmäßig, stets aber in ungleich geringerer Anzahl, zieht er auch die westliche Straße, welche ihn durch Nord- und Westeuropa führt. Nach mündlicher Mittheilung Gätke's sieht man ihn fast alljährlich auf der kleinen Insel Helgoland, und die Annahme dieses scharfen Beobachters, daß der Vogel unzweifelhaft in jedem Jahre durch Deutschland wandern muß, erscheint vollkommen gerechtfertigt. In der That hat man unseren Laubsänger in den verschiedensten Theilen Europas erbeutet, so mehrmals in der Nähe Berlins und in Anhalt, außerdem in England, Holland, bei Wien, Mailand, auch in Palästina beobachtet. Ueber seine Lebensweise fehlen noch immer inhaltsvolle Mittheilungen, obgleich seitenlange Berichte englischer Eierkundigen vorliegen. Gätke, dessen eigenartige Forschungen bisher leider nur bruchstückweise erschienen, hebt zuerst hervor, daß Wesen und Betragen mit dem Auftreten und Gebaren anderer Laubsänger übereinstimmen; Radde bemerkt, daß der Vogel in Südostsibirien um die Mitte des Mai erscheint und bis gegen Ende des September verweilt, gelegentlich seines Herbstzuges lange an einem und demselben Orte sich aufhält oder wenigstens sehr langsam reist und deshalb im Gebüsche der Uferweiden monatelang beobachtet wird; Swinhoe berichtet, daß man ihn in China selten in Gesellschaft anderer Vögel sehe, daß er lebendig und stets in Bewegung sei und durch seinen lauten eintönigen Lockruf »Swiht« seine Anwesenheit bekunde. Das beste gibt Dybowski, wenn auch nur mit wenigen Worten. Nach seinen Beobachtungen ist der Goldhähnchenlaubsänger in Ostsibirien seltener als andere seiner Verwandtschaft, erscheint in der ersten Hälfte des Juni und nistet in der Höhe des Gebirges nahe der Waldgrenze oder über derselben an solchen Stellen, welche reichlich mit verkrüppelten gelben Alpenrosen bewachsen sind. Hier verweilt er bis zur Mitte des September. Das Nest befindet sich in der Regel in einem dicht mit im Moose wachsendem Grase durchwucherten Alpenrosenstrauche, ist meisterhaft gebaut, mit einer schwachen, aus trockenem Grase bestehenden Decke überwölbt und hat ganz das Ansehen einer Hütte mit einer Oeffnung von der Seite. Als Niststoffe dienen trockene Gräser, als Auskleidung Reh- und Renthierhaare. Nur wenn die Eltern ihre Jungen füttern, ist man im Stande, es zu entdecken. Dybowski hat im August ein Nest mit sechs Jungen gefunden, welche, als er sie in die Hand nehmen wollte, obwohl noch nicht flügge, behend in das Moos schlüpften, hat ferner Ende August schon gänzlich ausgewachsene Junge gesehen, die Eier aber nicht kennen gelernt. In Kaschmir, und zwar in einem Höhengürtel von anderthalb bis zweitausend Meter, lebt der Vogel so häufig, daß sich jedes Pärchen auf ein Wohngebiet von wenigen Metern Durchmesser beschränken muß. Die Männchen sind sehr lebendig und geben ununterbrochen ihren lauten, doppelten, kaum Gesang zu nennenden Ruf zum besten. In den letzten Tagen des Mai und in den ersten des Juni fand Brook mehrere Nester mit vier bis fünf frischen oder kaum bebrüteten Eiern. Der Längsdurchmesser der letzteren beträgt vierzehn, der Querdurchmesser elf Millimeter; die Grundfärbung ist ein reines Weiß; die Zeichnung besteht aus braunrothen oder tiefpurpurbraunen, meist über das ganze Ei vertheilten, am dicken Ende zu einem ringförmigen Gürtel verschmelzenden Punkten und Flecken.

Goldhähnchenlaubsänger ( Phyllopneuste superciliosa), Sommer- und Wintergoldhähnchen ( Regulus cristatus und ignicapillus). ½ natürl. Größe.
Vielfach hin- und hergeworfen, haben die Goldhähnchen oder Kronsänger ( Regulus) endlich in der Unterfamilie der Laubsänger unbestrittene Stellung gefunden. Ihre Merkmale sind: gerader, dünner, nadelspitziger, an der Wurzel etwas breiterer, hochrückiger Schnabel, dessen Oberkiefer vor der abwärts gebogenen Spitze eine seichte Kerbe zeigt, schlanke, hochläufige Füße, deren Zehen mittellange, sehr gekrümmte Nägel bewaffnen, kurze, stark gerundete, breite Flügel, in denen die vierte und fünfte Schwinge die längsten sind, mittellanger, etwas ausgeschnittener Schwanz und reiches, aus langen, weitstrahligen Federn bestehendes Gefieder. Kammartige Federchen bedecken die Nasenlöcher, einige schwarze Barthaare stehen am Schnabelwinkel; die Schwung- und Steuerfedern sind sehr schwach und biegsam, die Federn der Scheitelmitte verlängert und durch lebhafte Färbung ausgezeichnet. Die Sippe verbreitet sich über Europa, Asien und Nordamerika. Mein Vater unterschied zuerst die beiden Arten, welche in Europa leben.
Das Wintergoldhähnchen oder Safrangoldhähnchen, welches auch Goldköpfchen, Kron- und Goldvögelchen, Goldemmerchen, Hauben- und Sommerkönig genannt wird ( Regulus cristatus, flavicapillus, crococephalus und vulgaris, Motacilla und Sylvia regulus), ist oberseits olivenfahlgrün, auf Schläfen und Halsseiten olivenfahlbräunlich; der Stirnrand und ein Streif über den Augen sind heller, Zügel und Augenkreis weißlich, die Federn des Oberkopfes gelb, die verlängerten des Scheitels lebhaft orange, seitlich durch einen schwarzen Längsstrich begrenzt, die Untertheile rostgelblichweiß, an den Seiten rostbräunlich, die Schwingen und Schwanzfedern olivenbraun, außen schmal hell olivengrün, die Armschwingen innen weiß gerandet und hinter der gelblichweißen Wurzel der Außenfahne durch eine schwarze Querbinde, die hinteren auch durch einen weißen Endfleck, die Decken der Armschwingen und die vorderen der größten oberen Deckfedern durch einen breiten, gelblichweißen Endrand geziert, wodurch zwei Querbinden entstehen. Das Auge ist tiefbraun, der Schnabel hornschwarz, der Fuß bräunlich. Das Weibchen unterscheidet sich vom Männchen dadurch, daß die Mitte des Oberkopfes gelb, nicht aber auf dem Scheitel orange ist. Die Länge beträgt sechsundneunzig, die Breite einhundertvierundfunfzig, die Fittiglänge achtundvierzig, die Schwanzlänge achtunddreißig Millimeter.
Fast über ganz Europa bis zum höchsten Norden und über das nördliche Asien bis in die Amurländer verbreitet, zählt das Goldhähnchen auch in Deutschland zu den in allen Nadelwaldungen, namentlich in Kieferbeständen, vorkommenden Brutvögeln, lebt während des Sommers ebenso in den höheren Gebirgen Südeuropas und besucht während seines Zuges im Herbste auch die dortigen Ebenen, mit Beginn des Frühlings wieder verschwindend.
Das gleich große Sommergoldhähnchen, Goldkronhähnchen oder Feuerköpfchen, der Feuerkronsänger etc. ( Regulus ignicapillus, pyrocephalus und mystaceus) ist oberseits lebhaft olivengrün, seitlich am Halse orangegelb, der Stirnrand rostbräunlich, ein schmales Querband über dem Vorderkopf wie ein breites Längsband über dem weißen Augenstreifen schwarz, ein breites von beiden eingeschlossenes, den Scheitel und Hinterkopf deckendes Feld dunkel orangefarben, ein Strich durchs Auge wie der schmale Rand desselben schwärzlichgrau, ein schmaler, unterseits durch einen dunkleren Bartstreifen begrenzter Strich unter dem Auge weiß, die Ohrgegend olivengrau, die Unterseite gräulichweiß, an Kinn und Kehle rostfahlbräunlich; die olivenbraunen Schwingen und Steuerfedern sind außen schmal hell olivengelbgrün, erstere innen breiter weiß gesäumt, die des Armes außen, hinter der hellen Wurzel mit einer breiten schwarzen Querbinde, die Armschwingendecken und größten oberen Deckfedern mit weißem Endrande geziert, wodurch zwei undeutliche helle Querlinien über dem Flügel entstehen. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel schwarz, der Fuß bräunlich; das Weibchen unterscheidet sich durch orangegelben Scheitel.
Außer in Deutschland ist der niedliche Vogel in Frankreich, Italien, Griechenland und Spanien, hier namentlich als Wintergast, aufgefunden worden.
Beide Arten haben in ihrem Wesen und Treiben die größte Aehnlichkeit. Sie bewohnen sehr oft dieselben Oertlichkeiten gemeinschaftlich, nähren sich von denselben Stoffen und nisten in derselben Weise. Die erste ausführliche Beschreibung von ihnen und von ihrem Leben rührt von meinem Vater her, und sie ist es, welche ich dem nachfolgenden zu Grunde legen darf, da sie wesentliche Berichtigungen oder Bereicherungen nicht erfahren hat.
In Deutschland ist das Wintergoldhähnchen Stand- und Strichvogel. Oft hält es sich das ganze Jahr in dem kleinen Gebiete einer ganzen oder halben Geviertstunde; doch kommen im Oktober viele Vögel dieser Art aus dem Norden an, welche in Gärten, Nadel- und Laubhölzern oder in buschreichen Gegenden gesehen werden, zum Theile bei uns überwintern, zum Theile aber auch südlich ziehen, im März und April wieder bei uns durchstreichen und dieselben Orte wie im Herbste besuchen. Das Sommergoldhähnchen dagegen bringt den Winter nicht in Deutschland, sondern in wärmeren Ländern zu, und erscheint bei uns in den letzten Tagen des März oder in den ersten des April und verweilt bis zu den letzten Tagen des September oder den ersten des Oktober. Bei der Ankunft streicht es in den Hecken und Büschen umher, eilt aber bald in die Nadelwälder, wo es sich in Fichtenbeständen vereinzelt. Viele ziehen weiter nördlich, viele bleiben bei uns. Sie wandern des Nachts und suchen am Tage ihre Nahrung. Im Sommer leben sie fast immer auf hohen Bäumen, und kommen nur selten in Dickichte oder in niederes Stangenholz; im September streichen sie. Beide Goldhähnchen halten sich vorzugsweise in den Nadelwaldungen auf, meist auf den Bäumen, aber auch in niederen Gebüschen, kommen nicht selten selbst zum Boden herab. Jenes bevorzugt die Kiefer, dieses die Fichte jedem anderen Baume; beide aber lieben kleinere Bestände von fünfzig bis hundert Hektar mehr als ausgedehnte Waldungen. »Die Zuneigung zu den Nadelbäumen«, bemerkt Naumann, »ist auffallend. Wenn man im Spätherbste und Winter eine Gesellschaft in einem Garten ankommen sieht, wo nur eine einzelne Fichte oder Tanne steht, so besuchen sie diese gleich, treiben sich auch in solchen Gärten länger als in anderen und meistens bei jenen Bäumen herum. Allein sie durchstreifen auf ihren Wanderungen auch alle reinen Laubholzwaldungen.« Ihr Aufenthalt und ihr Streichen im Herbste und Winter richten sich nach den Umständen. Ist im Winter das Wetter schön, heiter und nicht zu kalt, dann sind sie hoch auf den Nadelbäumen, bei Regen, Wind und Sturm oder sehr strenger Kälte aber kommen sie auf niedrige Gebüsche und auf den Boden herab. Im Winter halten sie sich immer auf denjenigen Stellen des Waldes auf, welche von der Sonne beschienen werden.
Auffallend ist die außerordentliche Unruhe der Goldhähnchen. Das Feuerköpfchen hüpft unaufhörlich von einem Zweige zum anderen und verhält sich nur selten kurze Zeit ruhig, hängt sich, nach Meisenart, unten an die Zweige, erhält sich flatternd auf einer Stelle, um nach Laubsängerart ein Kerbthier von einer Zweigspitze wegzunehmen, und fliegt leicht und geräuschlos von einem Baume zum anderen. Die Brutzeit ausgenommen, findet man es selten allein, gewöhnlich in Gesellschaft seinesgleichen und anderer Vögel. Wir haben beide Arten besonders unter den Hauben- und Tannenmeisen, weniger oft in Gesellschaft von Baumläufern und Kleibern, Sumpf-, Blau- und Kohlmeisen gesehen.
Der Lockton klingt schwach »Si si«, auch »Zit«, und wird von beiden Geschlechtern im Sitzen ausgestoßen. Den Gesang, welchen man von den Alten im Frühjahre und im Sommer, von den Jungen im August, September und Oktober, selbst von denen, welche mitten in der Mauser stehen, vernimmt, fängt mit »Si si« an, wechselt aber dann hauptsächlich in zwei Tönen von ungleicher Höhe ab und hat einen ordentlichen Schluß. An warmen Wintertagen singen die Goldköpfchen herrlich, während der Paarungszeit ungemein eifrig und überraschend laut; während der Nistzeit dagegen sind sie sehr still. Ein eigenes Betragen zeigen sie oft im Herbste, vom Anfange des September bis zum Ende des November. Eines von ihnen beginnt »Si si« zu schreien, dreht sich herum und flattert mit den Flügeln. Auf dieses Geschrei kommen mehrere herbei, betragen sich ebenso und jagen einander, so daß zwei bis sechs solch außergewöhnliches Spiel treiben. Sie sträuben dabei die Kopffedern ebenso wie bei der Paarung, bei welcher das Männchen sein Weibchen so lange verfolgt, bis es sich seinem Willen fügt. Streben zwei Männchen nach einem Weibchen, dann gibt es heftige Kämpfe. Das Feuerköpfchen ist viel gewandter und unruhiger und in allen seinen Bewegungen rascher, auch ungeselliger als sein Verwandter. Während man letzteren, die Brutzeit ausgenommen, immer in Gesellschaft und in Flügen sieht, lebt dieses einsam oder paarweise. Im Herbste trifft man öfters zwei Stück zusammen, welche immer ein Pärchen sind. Schießt man eines davon, dann geberdet sich das andere sehr kläglich, schreit unaufhörlich und kann sich lange Zeit nicht zum Weiterfliegen entschließen. Auch der Lockton unseres Vogels ist ganz anders als der seines Sippenverwandten: denn das »Si si si« ist viel stärker und wird anders betont, so daß man beide Arten sogar am Locktone unterscheiden kann, obgleich man nicht im Stande ist, die Verschiedenheit so anzugeben, daß auch ein Unkundiger sie richtig auffassen würde. Viel leichter ist dies beim Gesange möglich. Beim Wintergoldhähnchen wechseln in der Mitte des Gesanges zwei Töne mit einander ab, und am Ende hört man die Schlußstrophe; beim Sommergoldhähnchen dagegen geht das »Si« in einem Tone fort und hat keinen Schluß, so daß der ganze Gesang weit kürzer, einfacher und nichts als ein schnell nach einander herausgestoßenes »Si si si« ist. Zuweilen hört man von dem Männchen auch einige Töne, welche an den Gesang der Haubenmeise erinnern. Im Frühjahre und Hochsommer singt dieses Goldhähnchen oft, selbst auf dem Zuge, im Herbste aber, und auch darin weicht es vom gewöhnlichen ab, äußerst selten. Der Gesang der beiden verwandten Arten ist so verschieden, daß man bei stillem Wetter den einer jeden Art auf weithin unterscheiden kann.
Bei der Paarung sträubt das Männchen des Feuerköpfchens die Kopffedern, so daß eine prächtig schimmernde Krone aus ihnen wird, umhüpft sodann unter beständigem Geschreie, mit etwas vom Körper und Schwanze abstehenden Flügeln und in den sonderbarsten Stellungen sein Weibchen, welches ein ähnliches Betragen annimmt, und neckt es so lange, bis die Begattung geschieht.
Beide Goldhähnchen brüten zweimal im Jahre, das erste Mal im Mai, das zweite Mal im Juli. Die ballförmigen, sehr dickwandigen, außen neun bis elf, innen nur sechs Centimeter im Durchmesser haltenden, etwa vier Centimeter tiefen, bei beiden Arten gleichen Nester stehen sehr verborgen auf der Spitze langer Fichten- und Tannenäste, zwischen dichten Zweigen und Nadeln und auf herabhängenden Zweigen, welche von der ersten Lage der Neststoffe ganz oder zum Theil umschlossen sind und bis an den Boden oder über ihn hinausreichen. Das Weibchen, welches beim Herbeischaffen der Baustoffe zuweilen vom Männchen begleitet, aber hierbei ebenso selten wie beim Verarbeiten unterstützt wird, bedarf mindestens zwölf, zuweilen auch zwanzig Tage, bis es den Bau vollendet hat, umwickelt zunächst, zum Theil fliegend, mit großer Geschicklichkeit die Zweige, füllt sodann die Zwischenräume aus und beginnt nunmehr erst mit Herstellung der Wandungen. Die erste, fest zusammengewirkte Lage besteht aus Fichtenflechten und Baummoos, welche zuweilen mit etwas Erdmoos und Rehhaaren untermischt werden und durch Raupengespinst, welches besonders um die das Nest tragenden Zweige gewickelt ist, gehörige Festigkeit bekommen, die Ausfütterung aus vielen Federn kleiner Vögel, welche oben alle nach innen gerichtet sind und am Rande so weit vorstehen, daß sie einen Theil der Oeffnung bedecken. Bei zwei Nestern des Feuerköpfchens, welche mein Vater fand, ragten aus der äußeren Wand Reh- und Eichhornhaare hervor. Die Ausfütterung bestand zu unterst zum größten Theil aus Rehhaaren, welche bei dem einen über wenige Federn weggelegt waren, oben aber aus lauter Federn, welche so künstlich in den eingebogenen Rand des Nestes eingebaut waren, daß sie die oben sehr enge Oeffnung fast oder ganz bedeckten. Das erste Gelege enthält acht bis zehn, das zweite sechs bis neun sehr kleine, nur dreizehn Millimeter lange, zehn Millimeter dicke, auf weißlichgrauem oder blaß fleischfarbenem Grunde mit lehmgrauen, am dickeren Ende gewöhnlich dichter zusammenstehenden Punkten gezeichnete auch wohl geaderte oder gewässerte Eier. Sie sind so zerbrechlich, daß man sie mit der größten Vorsicht behandeln muß, will man sie nicht mit den Fingern zerdrücken. Die Jungen werden von beiden Eltern mit vieler Mühe, weil mit den kleinsten Kerfen und Kerbthiereiern, aufgefüttert, sitzen im Neste dicht auf- und nebeneinander und müssen, um Platz zu finden, ihre Wohnung nach und nach mehr und mehr erweitern. Eine Goldhähnchenfamilie bleibt nur kurze Zeit zusammen; denn die Alten trennen sich wegen der zweiten Brut entweder bald von den Jungen des ersten Genistes, oder schlagen sich nach der zweiten Brut mit anderen Familien zu Flügen zusammen.
Verschiedene Kerbthiere und deren Larven, aber auch seine Sämereien, bilden die Nahrung der Goldhähnchen. Im Sommer fressen sie kleine Käferchen und Räupchen, im Winter fast ausschließlich Kerbthiereier und Larven. Sie lesen gewöhnlich von den Zweigen ab, zwischen den Nadeln oder dem Laube hervor, erhalten sich vor einer erspähten Beute flatternd und jagen einer fliegenden nach.
In der Gefangenschaft sieht man Goldhähnchen selten, weil es schwierig ist, sie an Stubenfutter zu gewöhnen und sie sehr hinfällig sind, oft sogar bereits beim Fange sterben. Haben sie sich einmal eingewöhnt, so können sie, geeignete Pflege vorausgesetzt, jahrelang im Käfige ausdauern und sind dann allerliebste Stubengenossen. Frei im Zimmer gehalten, erwerben sie sich durch Wegfangen von Fliegen nicht geringere Verdienste, als draußen im freien Walde durch Aufzehren von forstschädlichen Kerbthieren.
Die Unterfamilie der Schilfsänger ( Calamoherpinae), welche in etwa fünfundsiebzig Arten vorzugsweise das nördlich altweltliche Gebiet bevölkert, außerdem aber auch im indischen, äthiopischen und australischen vertreten ist, kennzeichnet sich durch schlanken Leib, gestreckten, flachstirnigen Kopf, verhältnismäßig starken, schlank kegel- oder pfriemenförmigen Schnabel, hochläufige kräftige Füße mit dicken Zehen und großen, scharf gekrümmten Nägeln, kurze und abgerundete Flügel, in denen die zweite oder zweite und dritte Schwinge die längsten, mittellangen, zugerundeten, stufigen oder keilförmigen Schwanz und glattes, etwas hartes Gefieder, von grüner oder graugilblicher, Ried und Röhricht entsprechender Färbung.
Wesen und Gebaren dieser sehr eigenartigen Sänger entsprechen deren Aufenthaltsorten. Sie, die Rohr-, Schilf-, Ried- und Grassänger, hausen stets am Boden und bethätigen hier alle Eigenschaften, welche solche Lebensweise bedingt. Hochbegabt nach jeder Richtung hin, zeichnen sie sich auch durch ihre Gesänge aus: es sind Sumpf- und Wasserlieder, welche sie zum besten geben. Ihre Nahrung suchen und finden sie am Boden, und hart über dem Wasser, an den Pflanzen, zwischen deren Dickicht sie wohnen; ihr meist künstliches Nest legen sie ebenfalls hier an.
Rohrsänger ( Acrocephalus) heißen die Arten mit geradem, wenig gebogenem und kaum übergekrümmtem Schnabel, kräftigen Füßen, mittellangen Flügeln, unter deren Schwingen die dritte und vierte die längsten, mittellangem, stufigem Schwanze und ungeflecktem Gefieder.
Die größte und bekannteste Art der Sippe ist der Drosselrohrsänger, auch Wassernachtigall, Schlotengatzer, Rohrsprosser, Rohrvogel, Rohrschliefer, Rohrsperling, Rohr-, Bruch- und Weidendrossel genannt ( Acrocephalus turdiodes, turdides und lacustris, Turdus arundinaceus und junco, Salicaria turdiodes und turdina, Calamoherpe turdina, Calamodyta arundinacea, Muscipeta lacustris, Sylvia und Arundinaceus turdoides). Seine Länge beträgt 21, die Breite 29, die Fittiglänge 9, die Schwanzlänge 8,5 Centimeter. Das Gefieder ist oberseits dunkelbraun, unterseits rostgelblichweiß, auf der Kehle und Brustmitte lichter; die dunkelbraunen Schwingen sind innen rostfahl, die Steuerfedern am Ende verwaschen fahlweißlich gesäumt. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel dunkel hornbraun, unterseits horngelb, der Fuß hornbräunlich.

Drosselrohrsänger ( Acrocephalus turdoides). ½ natürl. Größe.
Mit Ausnahme Großbritanniens bewohnt der Drosselrohrsänger vom südlichen Schweden an abwärts alle ebenen Gegenden des gemäßigten und südlichen Europa sowie Westasien und besucht im Winter den größten Theil Afrikas, bis in die Kapländer vordringend. Niemals verläßt er das Röhricht, fliegt selbst auf der Reise stets von Gewässer zu Gewässer. Am Brutorte erscheint er frühestens gegen Ende des April und verweilt höchstens bis Ende des September in der Heimat. Sofort nach seiner Ankunft im Frühjahre vernimmt man ununterbrochen, vom frühesten Morgen bis zum späten Abende, während der ersten Zeit seines Hierseins sogar zu allen Stunden der Nacht, den lauten weit schallenden, aus vollen, starken Tönen zusammengesetzten, in mehrere mannigfach abwechselnde Strophen gegliederten Gesang der Männchen. Ihm meint man es anzumerken, daß die Frösche beachtet worden sind; denn er erinnert ebenso sehr an das Knarren und Quaken derselben wie an das Lied irgend eines anderen Vogels. Sanft flötende Töne sind unserem Sänger fremd: das ganze Lied ist nichts anderes als ein Geknarr oder ein Quiken. »Dorre, dorre, dorre, karre karre karre, kerr kerr kerr, kei kei kei kei, karre karre karre, kitt« sind die wichtigsten und wesentlichsten Theile dieses Liedes. Und dennoch spricht es an. Es liegt etwas gemüthliches in jenen Lauten, etwas lustiges in der Art und Weise, wie sie vorgetragen werden. Da man dort, wo sie erklingen, auf anderen Vogelgesang kaum rechnen darf, vielmehr gewöhnlich nur die Stimmen der Wasservögel, das Schnattern der Gänse und Enten, das Quaken der Reiher, das Knarren der Rothhühner vernimmt, stellt man freilich auch bescheidene Anforderungen und wird zu mildem Urtheile geneigt. Ich muß gestehen, daß der Gesang der Rohrdrossel mich von jeher außerordentlich angezogen hat. Er vermochte mich nicht zu entzücken, hat mich aber immer weidlich ergötzt. Dem Männchen ist es Ernst mit seinem Singen: es geberdet sich, als ob es mit einer Nachtigall wetteifern wolle. Hochaufgerichtet, mit hängenden Flügeln und ausgebreitetem Schwanze, dick aufgeblasener Kehle, den Schnabel nach oben gewendet, sitzt es auf seinem schwankenden Halme, sträubt und glättet abwechselnd die Scheitelfedern, auch wohl das übrige Gefieder, so daß es viel größer erscheint als übrigens, und schmettert sein Gequak fröhlich in die Welt hinaus.
Die Rohrdrossel brütet, wie alle ihre Verwandten, erst wenn das neu aufschießende Röhricht geeignete Höhe erlangt hat, also frühestens zu Ende des Mai, meist erst um die Mitte des Juni, gewöhnlich gesellig auf einem Brutplatze, auch wenn derselbe nur ein kleiner Teich ist. Das Nest steht durchgehends auf der Wasserseite des Röhrichts und nie tief im Rohre, im Gegentheile oft sehr frei, fast immer über dem Wasser und an oder richtiger zwischen vier, seltener fünf, höchstens sechs Rohrstengeln, welche in seine Wandungen eingewoben sind oder diese durchbohren, regelmäßig in einer Höhe, bis zu welcher das Wasser nicht emporsteigt, auch wenn es ungewöhnlich anschwellen sollte, selten einen vollen Meter über dem Wasserspiegel. Wahrheitsliebende Forscher haben beobachtet, daß die Rohrsänger ihrer Umgegend in gewissen Jahren, scheinbar ohne alle Veranlassung, ihre Nester viel höher anlegten als sonst, und anfangs darüber die Köpfe geschüttelt; da mit einem Male, lange nachdem das Nest fertig war, trat andauerndes Regenwetter ein, und der Stand der Teiche oder Flüsse erhob sich hoch über das gewöhnliche Maß: die Nester aber blieben verschont, während sie überflutet worden wären, hätten die Vögel sie ebenso niedrig aufgehängt wie sonst! Ausnahmsweise, und nicht immer durch Wohnungsnoth veranlaßt, brütet der Drosselrohrsänger auch außerhalb des Röhrichts, in Gebüschen oder hohen Teichbinsen sein Nest anlegend, ebenso wie er an verschiedene Verhältnisse, beispielsweise hart an seinen Brutplätzen vorüberrasselnde Eisenbahnzüge, leicht sich gewöhnt. Das Nest selbst ist viel höher als breit, dickwandig und der Rand seiner Mulde einwärts gebogen. Die Wandungen bestehen aus dürren Grasblättern und Halmen, welche nach innen feiner werden und mit einigen Würzelchen die Ausfütterung bilden. Je nach dem Standorte werden die Blätter verschieden gewählt, auch wohl mit Bastfaden von Nesseln, mit Weiderich, Samenwolle und selbst mit Raupengespinst, Hanf- und Wollfaden untermischt, oder trockene Grasrispen, Rosmarinkronen, Pferdehaare und dergleichen zur inneren Ausfütterung benutzt. Das Gelege, welches gewöhnlich aus vier bis fünf Eiern besteht, ist selten vor Mitte des Juni vollzählig; die Eier, welche zweiundzwanzig Millimeter lang, fünfzehn Millimeter dick, auf bläulichem oder graugrünlichweißem Grunde mit sehr dunkel olivenbraunen, aschgrauen und schieferfarbigen Flecken, Punkten und Schmitzen fast gleichmäßig bedeckt sind, werden vierzehn bis fünfzehn Tage eifrig bebrütet. Beide Eltern nahen sich dem Störenfriede am Neste bis auf wenige Schritte, verstecken sich und erscheinen abwechselnd vor ihm, umfliegen ihn auch wohl mit kläglichem Geschreie, sind aber so empfindlich gegen derartige Störungen, daß sie, wenn auch nicht in allen Fällen, noch wenig bebrütete Eier verlassen, wenn man das Nest wiederholt besucht. Die Jungen werden mit Kerbthieren groß gefüttert, von den Alten zärtlich geliebt und vor Gefahr gewarnt, auch nach dem Ausfliegen noch lange geleitet. Dieser Fürsorge bedürfen sie um so mehr, als sie, ehe sie ordentlich fliegen können, das Nest zu verlassen pflegen und nun die ersten Tage ihres Lebens kletternd sich forthelfen. Ende Juli sind sie selbständig geworden, und nunmehr denken sie schon an die Winterreise.
Gefangene Rohrdrosseln sind angenehme, obschon ziemlich hinfällige Zimmergenossen, halten sich, wenn sie sich einmal an das Stubenfutter gewöhnt haben, glatt und nett, erfreuen durch ihre außerordentliche Behendigkeit und Gewandtheit, durch ihr geschicktes Klettern, singen auch recht eifrig, und können mit der Zeit sehr zahm werden. Um sich ihrer zu bemächtigen, stellt man meterhohe Stöcke mit Quersprossen und Schlingen in das Röhricht.
Ein Abbild des Drosselrohrsängers im kleinen ist der Teichrohrsänger, Teich-, Schilf- oder Rohrsänger, Rohr- und Schilfschmätzer, Schilf- und Wasserdornreich, Wasser- und Rohrzeisig, kleiner Rohrsperling etc. ( Acrocephalus arundinaceus und streperus, Sylvia arundinacea, strepera, affinis, boeticula, baeticata, horticola und isabellina, Calamoherpe arundinacea, obscurocapilla, rufescens, arbustorum und pinetorum, Calamodyta strepera, boeticula und rufescens, Salicaria arundinacea und rufescens, Cettia boeticula, Motacilla, Curruca und Muscipeta arundinacea). Seine Länge beträgt hundertundvierzig, die Breite zweihundert, die Fittiglänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge achtundfunfzig Millimeter. Die Obertheile und Außensäume der olivenbraunen Schwingen und Schwanzfedern sind olivenrostbraun, Bürzel und Oberschwanzdecken lebhafter, die Untertheile rostgelblichweiß, Kinn und Kehle lichter, deutlich ins Weiße ziehend, Zügelstreifen, Rückengegend, Hals- und Körperseiten nebst unteren Flügel- und Schwanzdecken lebhaft rostgelb. Der Augenring ist dunkelbraun, der Schnabel hornbraun, am Mundrande orangeroth, unterseits horngelb, der Fuß hornbräunlich.
Vom südlichen Schweden und dem Weißen Meere an verbreitet sich der Teichrohrsänger über ganz Europa und Westasien, ist noch in den Atlasländern Brutvogel und durchwandert im Winter ganz Afrika, bis zum Vorgebirge der Guten Hoffnung vordringend. In Deutschland bewohnt er ähnliche Gegenden wie sein größerer Verwandter, ist aber weiter verbreitet als dieser, dehnt sein Wohngebiet mehr und mehr aus, nimmt auch an Menge merklich zu. Aus seiner Winterherberge kommend, erscheint er um die Mitte des April und zieht nun langsam nordwärts, so daß man ihm noch zu Ende des Mai, selbst im Juni, auf dem Zuge begegnen kann. Auch er wohnt stets in der Nähe des Wassers und regelmäßig im Rohre, siedelt sich jedoch häufiger als der Drosselrohrsänger ebenso in benachbarten Gebüschen an, besucht überhaupt diese und selbst Bäume nicht selten. In Wesen und Eigenschaften erinnert er in jeder Beziehung an seinen größeren Verwandten; selbst sein Lied hat mit dessen Gesange die größte Aehnlichkeit, nur daß es sich in höherer Tonlage bewegt als letzteres. Ein schnalzender Laut, welcher wie »Tschädsche« klingt, ist der Lockton; ein schnarchendes »Schnarr« zeigt Unwillen und Besorgnis an. Der Gesang, welcher am lautesten im Juni erklingt und während des ganzen Tages, vom frühesten Morgen bis zum späten Abend, fast ununterbrochen vorgetragen wird, kann durch die Silben »Tiri, tiri, tiri, tir, tir, tir, zeck, zeck, zeck, zeck, zerr, zerr, zerr, tiri, tiri, dscherk, dscherk, dscherk, heid, heid, heid, trett, trett, trett« ausgedrückt werden. Das Nest steht in der Regel ganz ebenso wie das seines größeren Verwandten im Rohre, ähnelt diesem auch in der Form und wird mehr oder minder aus denselben Stoffen errichtet, jedoch etwas leichter gewebt und innen häufiger mit Pflanzenwolle, auch wohl mit etwas grünem Moose oder Raupengespinst, ausgekleidet. Die drei bis fünf Eier, welche man um die Mitte des Juni findet, haben durchschnittlich einen Längsdurchmesser von neunzehn und einen Querdurchmesser von vierzehn Millimeter und sind auf grünlich- oder graulichweißem Grunde mit olivengrauen oder olivenbraunen, auch aschgrauen Flecken mehr oder weniger dicht gezeichnet. Beide Eltern brüten abwechselnd mit Eifer und Hingebung, zeitigen die Eier innerhalb dreizehn bis vierzehn Tagen und füttern gemeinschaftlich auch die Jungen auf. Letztere verlassen erst, wenn sie vollkommen befiedert sind, das Nest, treiben es nunmehr vom ersten Tage an ganz wie die Alten, beginnen Ende Juli oder im August mit diesen umherzustreichen und treten hierauf ihre Winterreise an.
Dem Teichrohrsänger täuschend ähnlich, in der Lebensweise jedoch durchaus verschieden, ist der Sumpfrohrsänger, Sumpf- oder Sumpfschilfsänger ( Acrocephalus palustris, Sylvia palustris, nigrifrons und fruticola, Calamoherpe palustris, pratensis und fruticola, Curruca fusca, Calamodyta und Salicaria palustris). Er ist unbedeutend größer als der vorstehend beschriebene Verwandte und läßt sich mit Sicherheit namentlich an den längeren Flügeln erkennen. Seine Länge beträgt ebenfalls hundertundvierzig, die Breite aber mindestens zweihundertundzehn, die Fittiglänge siebenundsechzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter. Hinsichtlich der Färbung besteht der einzige Unterschied zwischen ihm und jenem darin, daß die Oberseite olivengrüngrau, nicht aber rostbräunlich überhaucht, und der Bürzel stets der übrigen Oberseite gleichgefärbt ist. Auch der etwas kürzere und kräftigere, an der Schneide schwach eingezogene Schnabel und die um vier Millimeter kürzere Fußwurzel unterscheiden ihn von jenem.
Das Verbreitungsgebiet des Sumpfschilfsängers reicht nicht so weit nach Norden hinauf, sein Wandergebiet nicht soweit nach Süden hinab als das des Verwandten.
Im Nordosten Rußlands und von hier an in verschiedenen Ländern Asiens bis Indien, Nepal und Assam vertritt ihn der Podenarohrsänger, Podena der Inder ( Acrocephalus dumetorum und montanus, Sylvia montana, Salicaria arundinacea), welcher sich durch düstere, olivenfahlbraune Färbung der Oberseite, etwas längeren Schnabel und anderen Bau des Flügels von ihm unterscheidet. Auch der in Osteuropa und Sibirien bis Nordchina lebende, einmal auf Helgoland erlegte Zwergrohrsänger ( Acrocephalus salicarius, Motacilla salicaria, Sylvia caligata und scita, Lusciola caligata, Calamoherpe scita) dürfte als ihm nahestehender Verwandter angesehen werden können. Die Länge dieses noch wenig bekannten Vogels, eines ausgezeichneten Sängers, beträgt hundertvierundzwanzig, die Fittiglänge fünfundsechzig, die Schwanzlänge dreiundfunfzig Millimeter. Das Gefieder ist oberseits gelblich rostgrau, auf dem Scheitel etwas dunkler, auf dem Bürzel etwas heller, unterseits ebenso wie ein deutlicher heller Strich über den Augen rostgelblichweiß, an Kinn und Kehle weißlich, an den Halsseiten braun, an den Leibesseiten rostgelblich; die Schwingen sind graubraun, außen rostgelblich gesäumt, die Schwanzfedern rostigbraun, am Ende schmal hell rostbraun gerandet.
Als selbständige Art gibt sich der Sumpfrohrsänger nicht allein durch die hervorgehobenen Merkmale, sondern auch durch seinen Aufenthaltsort und wundervollen Gesang zu erkennen. Abweichend von den bisher genannten Arten der Unterfamilie, bezieht er sofort nach seiner Ankunft, welche frühestens im Anfange des Mai stattfindet, niedriges, sumpfiges Gebüsch an Fluß- und Bachufern, Wassergräben, Seen und Teichen, in dessen Nähe Schilf und andere Wasserpflanzen oder Brennnesseln wachsen oder Viehweiden, Wiesen und Getreidefelder sich ausdehnen. In solchen Gebüschen verbringt er die vier Monate seines Sommeraufenthalts, ohne sich um das Röhricht viel zu kümmern. Seine Wohnpflanze ist die Weide, vorausgesetzt, daß sie als Schnittweide gehalten und mit allerlei kletternden und rankenden oder hoch aufschießenden Pflanzen und Kräutern durchwachsen wird. Von hier aus begibt er sich oft auf die Bäume und in die benachbarten Felder, namentlich in solche, welche mit Hanf und Raps bestanden sind, äußerst selten dagegen in das Rohr oder Schilf, und wenn dies der Fall, bloß in solches, welches sein Gebüsch begrenzt. Aeußerst gesellig, wie die meisten Rohrsänger überhaupt, wohnt auch er gern in unmittelbarer Nähe anderer seiner Art, so daß man, laut Altum, auf einer Fläche von vierhundert Schritt Durchmesser sieben bis acht Nester finden kann. Naumann bezeichnet ihn als einen sehr netten, lustigen, unsteten Vogel, hurtig in allen Bewegungen, im Hüpfen und Durchschlüpfen der Gebüsche und des dichtesten Gestrüppes wie im Fluge, gleicherweise kühn und muthig im Streite mit seinesgleichen, und bemerkt übereinstimmend mit anderen Beobachtern, daß seine Sitten und Gewohnheiten eine Mischung derer des Gartensängers und der Schilfsänger seien. »Im Klettern und Anklammern«, sagt er, »ist er ebenso geschickt wie die letzteren, im Fluge aber noch gewandter. Oft stürzt er sich, durch die Luft fortschießend, aus den Zweigen eines ziemlich hohen Baumes schief herab ins niedrige Gesträuch; ein anderes Mal schwingt er sich ebenso aus der Tiefe zur Höhe auf oder fliegt gerade fort und ungezwungen eine gute Strecke über das Freie von Baum zu Baum oder von einem Gebüsche zum anderen und nicht etwa ängstlich am Boden hin, sondern meist keck in ungemessener Höhe durch die Luft.« Er ist ununterbrochen in Bewegung, hüpft beständig hin und her, klettert nicht selten zur höchsten Spitze des Gebüsches empor, und verkriecht sich aber ebenso in den dichtesten Zweigen. Dem Menschen gegenüber zeigt er sich vorsichtig, verstummt bei dessen Ankunft, auch wenn er eben aus voller Kehle singt, schweigt lange Zeit und stiehlt sich währenddem kriechend so geschickt fort, daß man ihn oft trotz aller Mühe nicht zu sehen bekommt. Sein Lied ähnelt am meisten dem des Gartensängers, ist aber durchaus lieblich und zart, obschon klangvoll und kräftig. Trotz dieser Eigenschaften erkennt man jedoch, laut Altum, sofort den Rohrsänger: das »Terr, zerr, zirr, tiri, tirr« wird bald so, bald anders eingewoben. Der Hauptsache nach besteht der Gesang aus einer Mengung von einem Dutzend und mehr Vogelgesängen und Stimmen. »Kraus und bunt durcheinander folgen die Bruchstücke der Gesänge und die Rufe von Singdrossel, Gartengrasmücke, Rauchschwalbe, Wachtel, Schaf- und Bachstelze, Kohlmeise, Haus- und Feldsperling, Buchfink und Stieglitz, Feldlerche, Plattmönch, Kleiber; ja sogar das Gequake des Wasserfrosches darf zuweilen nicht fehlen. Aber alle diese Stimmen reiht er nicht schlechthin und steif aneinander, sondern macht sie ganz zu seinem Eigenthume. Sie kommen wie aus einem Gusse hervor; seine Silberkehle veredelt sie alle. Er singt eben nur sein Lied, geläufig, ohne sich zu besinnen, ohne Pause, in voller, anderweitiger Beschäftigung, im Klettern, Durchschlüpfen, Kerbthierfangen, im Verfolgen eines Nebenbuhlers. Einen größeren Singmeister kenne ich unter unseren einheimischen Singvögeln nicht. Freilich beherrscht und erhebt sein Lied nicht, wie das der Feldlerche, die ganze Umgegend; freilich bleiben Sprosser und Nachtigall unerreichbare Künstler: aber die Meisterschaft in der Nachahmung, verbunden zugleich mit entsprechender Tonfarbe, mit lieblicher, klangvoller Stärke, erreicht kein anderer. An mondscheinlosen Abenden beginnt er, sobald die Tagessänger verstummen; darauf tritt etwa von zehn bis elf Uhr eine Pause ein, und nun bleibt er Nachtsänger. Jedoch folgen seine Strophen weniger rasch, sind weniger lang und werden weniger feurig vorgetragen als am Morgen. Am Tage verstummt er nur um die Mittagszeit.«
Das Nest steht innerhalb des von ihm gewählten Wohnplatzes, jedoch nicht immer im dichtesten Gestrüppe, sondern meist am Rande der Pflanzungen, oft in einzelnen dicht am Fußwege stehenden kleinen Büschen, niemals über Wasser, aber ebenfalls niedrig über dem Boden. In seiner Bauart ähnelt es denen anderer Rohrsänger, wird auch in ähnlicher Weise zwischen aufrecht stehenden Baumschossen oder tragfähigen Pflanzenstengeln, seltener an einem einzigen Zweige angehängt. Trockene Blätter und Halme von feinen Gräsern mit Rispen, Nesselbastfasern, auch wohl mit Raupen- und Thiergespinst vermengt, alles gut durcheinander verflochten und verfilzt, bilden die Außenwandungen und den sehr dicken Boden, feine Hälmchen und Pferdehaare die innere Auskleidung. Die vier bis fünf, höchstens sechs, achtzehn Millimeter langen und vierzehn Millimeter dicken Eier sind zart und glattschalig und auf graubläulichem oder bläulichweißem Grunde mit größeren, zuweilen etwas verwaschenen, aschgrauen, oliven- oder dunkelbraunen Flecken, vielleicht auch braunschwarzen Punkten oder Strichelchen spärlich, unregelmäßig und verschiedenartig gezeichnet. Das Brutgeschäft verläuft in der beim Teichrohrsänger geschilderten Weise, vielleicht mit dem Unterschiede, daß die Jungen frühzeitig das Nest verlassen und anfänglich nur kriechend und schlüpfend im Gebüsche sich bewegen. Ihnen wie den Alten stellen verschiedene Feinde nach, und auch der Mensch wird, indem er die Brutplätze zerstört, zuweilen gefährlich.
Gefangene lassen sich leicht eingewöhnen und entzücken durch ihren unvergleichlichen Gesang jeden Liebhaber, welcher mehr erstrebt, als den langweiligen kleinen ausländischen Finken eine noch nicht beschriebene Bewegung abzusehen oder einen noch nicht bekannten Quäklaut abzuhören.
Weit verbreitet in Deutschland und anderswo ist auch der Uferschilfsänger oder Seggenschilfsänger ( Acrocephalus phragmitis und schoenibanus, Sylvia phragmitis und schoenibanus, Motacilla schoenibanus, Calamodus phragmitis und schoenibanus, Muscipeta, Calamodyta, Salicaria und Caricicola phragmitis), welcher auch wohl als Vertreter einer besonderen Untersippe, der Seggenschilfsänger ( Calamodus), angesehen wird. Seine Länge beträgt einhundertundvierzig, die Breite zweihundert, die Fittiglänge dreiundsechzig, die Schwanzlänge funfzig Millimeter. Die Obertheile und die schmalen Außensäume der dunkelbraunen Schwingen, Flügeldecken und Steuerfedern sind fahlbräunlich, Bürzel und Oberschwanzdecken rostbräunlich, Mantel und Schultern mit verwaschenen dunklen Schaftstrichen gezeichnet, Scheitel und Oberkopf auf schwarzbraunem Grunde mit einem fahlbräunlichen, dunkel gestrichelten Mittellängsstreifen, an jeder Seite mit einem breiten Augenbrauenstreifen, die Zügel mit einem durchs Auge verlaufenden schmalen Striche geziert, die Kopfseiten und die Unterteile zart rostgelblich, Kehle, Bauch und Unterschwanzdecken heller, mehr weißlich gefärbt. Der Augenring ist hellbraun, der Schnabel oberseits hornschwarz, unterseits, wie der Fuß, grau.
Vom achtundsechzigsten Grade nördlicher Breite an verbreitet sich der Uferschilfsänger über ganz Europa und ungefähr von derselben Breite an auch über Westsibirien und Westasien.
Im Süden Europas und ebenso in Südwestasien vertritt ihn der einzeln schon in Südungarn und Nordfrankreich, häufig aber in Italien auftretende gleich große Tamariskenrohrsänger ( Acrocephalus melanopogon, Sylvia melanopogon und melamopogon, Calamodyta, Salicaria, Lusciniola, Cettia und Amnicola melanopogon). Er ist oberseits röthlichbraun, auf Mantel und Schultern mit verwaschenen dunklen Schaftflecken, auf dem braunschwarzen Oberkopfe längs der Mitte durch die verwaschenen helleren Seitensäume der Federn gezeichnet, vom Nasenloche bis zur Schläfe durch einen breiten rostgelblichen, in der Zügelgegend durch einen braunschwarzen Streifen geziert, unter den Augen dunkelbräunlich, auf Kinn, Kehle und den unteren Flügeldecken weiß, auf dem übrigen Untertheile rostgelblich, seitlich dunkler gefärbt. Die Schwingen und Schwanzfedern sind dunkelbraun mit schmalen rostfahlen Außensäumen, welche an den hinteren Armschwingen sich verbreitern und ins Röthlichbraune übergehen.

Uferschilfsänger ( Acrocephalus phragmitis), Seidenrohrsänger ( Bradypterus Cettii) und Cistensänger ( Cisticola cursitans). ½ natürl. Größe.
Unser Uferschilfsänger bewohnt vorzugsweise die Sümpfe oder die Ufer des Gewässers, am liebsten diejenigen Stellen, welche mit hohem Seggengrase, Teichbinsen und anderen schmalblätterigen Sumpfpflanzen bestanden sind, sonst aber auch Felder in den Marschen, zwischen denen schilfbestandene Wassergräben sich dahin ziehen, mit einem Worte, das Ried und nicht das Röhricht. Rohrteiche und Gebüsche oder in Afrika die mit Halfa bestandenen dürren Ebenen besucht er nur während seiner Winterreise. Er erscheint bei uns im letzten Drittel des April und verläßt uns erst im Oktober wieder; einzelne sieht man sogar noch im November. Den Winter verbringt er in Mittelafrika; doch ist zur Zeit noch nicht bekannt, wie weit er in das Innere vordringt. Versprengte sind auf hohem Meere beobachtet worden: so erhielt Burmeister einen, welcher auf der Höhe von Buena Vista auf das Schiff geflogen kam.
Der Uferschilfsänger übertrifft als Schlüpfer alle bisher genannten Arten und kommt hierin den Heuschreckensängern vollständig gleich. Mit mäuseähnlicher Gewandtheit bewegt er sich in dem Pflanzendickichte oder auf dem Boden; weniger behend zeigt er sich im Fluge, da er bald schnurrend, bald flatternd, förmlich hüpfend, in Schlangenlinien dahinzieht, selten weitere Strecken durchfliegend und meist plötzlich in gerader Linie in das Ried herabstürzend. Letzteres gewährt ihm das Bewußtsein so vollständiger Sicherheit, daß er durchaus nicht scheu ist, einen sich nahenden Menschen gar nicht beachtet, in zehn Schritt Entfernung von demselben auch wohl die Spitze eines Busches erklettert und von dort aus unbesorgt sein Lied zum besten gibt, und ebenso plötzlich wieder erscheint, als er aus irgend welchem Grunde in der Tiefe verschwand. Die Lockstimme ist ein schnalzender Laut, der Ausdruck des Unwillens ein schnarchendes »Scharr«, der Angstruf ein kreischendes Quaken, der Gesang sehr angenehm, durch einen langen, flötenartigen, lauten Triller, welcher oft wiederholt wird, ausgezeichnet, dem Liede anderer Rohrsänger zwar ähnlich, aber auch wieder an das der Bachstelze oder der Rauchschwalbe erinnernd, seine Abwechselung überhaupt so groß, daß man ihn dem Gesange einzelner Grasmücken gleichstellen darf.
In der Regel hält sich der Uferschilfsänger so viel wie möglich verborgen; während der Begattungszeit aber kommt er auf die Spitzen hoher Pflanzen oder auf freie Zweige empor, um zu singen oder einen Nebenbuhler zu erspähen, dessen Lied seine Eifersucht reizte. Neugier veranlaßt ihn zu gleichem Thun. Wenn man den Hühnerhund das Gestrüpp durchsuchen läßt, und dieser sich ihm nähert, sieht man ihn oft an einem Binsen- oder Rohrhalme in die Höhe kommen, sich umschauen und dann blitzschnell wieder in die Tiefe verbergen. Erschreckt erhebt er sich, fliegt aber, so lange er in der Heimat weilt, nie weit und immer sehr niedrig über den Boden oder über dem Wasser dahin. Ununterbrochen in Bewegung, hält er sich nur, so lange er singt, minutenlang ruhig auf einer und derselben Stelle, und wählt hierzu bestimmte Halme oder Zweige, zu denen er oft zurückkehrt. Andere Vögel, welche sich auf denselben Sitzplätzen niederlassen wollen, werden mit Heftigkeit angegriffen und vertrieben. Wenn das Weibchen brütet, singt das Männchen zu allen Tageszeiten sehr eifrig, am meisten in der Morgendämmerung, aber auch in hellen Nächten, und belebt dann in anmuthender Weise Gegenden, in denen man sonst kaum Klang und Sang vernimmt. Je eifriger er wird, um so mehr ändert er sein Betragen. Wenn er recht im Feuer ist, geberdet er sich so, daß ihn der Ungeübte kaum für einen Rohrsänger halten kann; denn er fliegt jetzt, zumal bei schönem Wetter und um die Mittagszeit, sehr häufig mit langsamen Flügelschlägen von seinem Sitzpunkte aus in schiefer Richtung singend in die Höhe und schwebt, die Schwingen so hoch gehalten, daß die Spitzen sich oben berühren, langsam wieder herab oder stürzt sich gerade von oben hernieder, dabei aber immer aus voller Kehle singend und sich noch außerdem ballartig aufblähend.
Ungefähr dieselben Kerbthiere, welche anderen Rohrsängern zur Speise dienen, bilden auch die Nahrung dieses Schilfsängers; Beeren frißt er ebenfalls. Das Nest steht an sehr verschiedenen, in der Regel wohl schwer zugänglichen Orten, im Seggengrase und ziemlich tief im Sumpfe, oft aber auch auf ganz trockenem Gelände in der Nähe und ebenso hundert bis zweihundert Schritte entfernt vom Wasser, sogar auf sandigem, aber mit Buschwerk und Gräsern bewachsenem Grunde, entweder auf dem Boden selbst oder in niedrigen, kleinen Weidenköpfchen, zwischen Weidenruthen, Nesselstielen und anderen derben Stengeln verwoben. Erst in der zweiten Woche des Mai beginnt der Bau, welcher aus dürren Gräsern, Stoppeln, Hälmchen, feinen Wurzeln, grünem Laube, Moos und dergleichen hergestellt, innen aber mit Pferdehaaren und anderen weichen Stoffen ausgepolstert und ausgelegt wird. Die fünf, bis sechs, siebzehn Millimeter langen, zwölf Millimeter dicken, an dem einen Ende stark abgerundeten, an dem anderen auffallend spitzigen Eier, welche man Anfang Juni findet, sind auf schmutzigem oder graulichweißem Grunde mit matten und undeutlichen Flecken, kritzeligen Punkten von braungrauer und grauer Färbung gezeichnet und gemarmelt. Beide Eltern brüten in der unseren Schilfsängern überhaupt üblichen Weise mit großer Hingebung, sind während der Brutzeit noch weniger scheu als sonst und fliegen, wenn sie ihre Jungen füttern, unbekümmert um einen dicht neben dem Neste stehenden Beobachter, mit Schmetterlingen und Wasserjungfern im Schnabel ab und zu, verlassen das Nest bei Störung überhaupt nur in den ersten Tagen der Brutzeit. Nähert man sich dem brütenden Weibchen mit Vorsicht, so kann man bis unmittelbar zum Neste gelangen, bevor es letzteres verläßt. Hat es Junge, so geberdet es sich meist sehr ängstlich; das Männchen dagegen singt, laut Naumann, »sein Lied und treibt seine Gaukeleien im Fluge ununterbrochen fort, auch wenn dem Neste Gefahr droht oder dieses gar sammt dem Weibchen vor seinen Augen zu Grunde geht«, wogegen es, wenn die Jungen ausgeschlüpft sind, ängstlich in einem engen Umkreise von einem Halme zum anderen fliegt, einzelne Strophen seines Gesanges vernehmen läßt und dazwischen sein laut warnendes »Err« unabläßig ausstößt. Die Jungen verlassen das Nest, wenn sie vollkommen flügge sind, gebrauchen aber ihre Schwingen in der ersten Zeit gar nicht, sondern kriechen wie Mäuse durch die dichtesten Wasserpflanzen dahin.
Gefangene Uferschilfsänger gehören zu den Seltenheiten, nicht weil sie sich schwer halten, sondern weil sie schwer zu erlangen sind. Auch sie gewöhnen sich bald an ihre neue Lage, sind nicht so zärtlich und weichlich wie andere Familienverwandte und wegen ihrer Munterkeit, Gewandtheit, schlanken Haltung und lieblichen Gesanges sehr geschätzt.
Der nächste Verwandte des vorstehend beschriebenen Vogels ist der Binsenrohrsänger ( Acrocephalus aquaticus und salicarius, Sylvia aquatica, salicaria, striata, paludicola und cariceti, Motacilla aquatica, Salicaria aquatica und cariceti, Muscipeta salicaria, Calamodus aquaticus und salicarius, Caricicola aquatica und cariceti, Calamodyta aquatica). Seine Länge beträgt einhundertdreiunddreißig, die Breite einhundertundneunzig, die Fittiglänge achtundfunfzig, die Schwanzlänge siebenundvierzig Millimeter. Die allgemeine Färbung ist die des Uferschilfsängers, und die Unterschiede beschränken sich darauf, daß Mantel und Schultern mit scharf ausgeprägten dunklen Schaftstrichen geziert sind, der braune Oberkopf einen ungestrichelten, deutlichen, fahlbraunen Mittelstreifen zeigt, die Untertheile lebhafter rostgelblich, und Kropf und Seiten mit sehr feinen dunklen Schaftstrichen gezeichnet sind.
Mittel- und Südeuropa, Westasien und Nordwestafrika, einschließlich der Kanaren, bilden das Brutgebiet des Vogels. In Deutschland tritt er überall weit seltener als der Uferschilfsänger, mit diesem aber meist gemeinschaftlich auf, namentlich an geeigneten Orten der ganzen Norddeutschen Ebene, so beispielsweise im Spreewalde und im Braunschweigischen. Weite, etwas sumpfige, von Wasserarmen durchschnittene Wiesenflächen mit einzelnen dazwischen stehenden Büschen, nasse Moore, Sümpfe und Brüche sind es, welche er während der Brutzeit bewohnt. Er erscheint und verschwindet mit dem Uferschilfsänger, welchem er in seinem Wesen und Betragen überhaupt außerordentlich ähnelt. Er lebt ebenso versteckt, schlüpft mit derselben Gewandtheit durch das dichteste Pflanzengewirre, läuft, klettert, fliegt, stürzt sich am Ende seiner kurzen Flüge ebenso senkrecht aus der Luft herab; in seinem Halmwald läßt auch er einen ähnlichen Lockton vernehmen wie jener und unterscheidet sich nur durch den Gesang einigermaßen von ihm, so schwierig es auch ist, diese Unterschiede mit Worten hervorzuheben. Laut Päßler findet man gegen Ende des Mai sein mit fünf bis sechs Eiern belegtes Nest tief unten in einem Seggenbusche, im Grase, hinter etwas Wust oder am Ufer eines Grabens nahe am Wasser, an Pflanzenstengeln hängend. Es ist merklich kleiner als das des Verwandten, aber aus denselben Stoffen gebaut, zuweilen mit zarten schwarzbraunen Wurzeln, meist mit Rohrrispen und Halmen, unter denen auch einige Pferdehaare sein können, ausgeführt. Die Eier sind etwas kleiner, heller, glatter und glänzender als die des Uferschilfsängers, oft mit vielen braunen Haarstrichen, oft aber so matt gezeichnet, daß sie einfarbig erscheinen. Das Männchen unterstützt sein Weibchen wenig beim Brüten; mit um so größerem Eifer aber gibt sich dieses seinen Mutterpflichten hin, sitzt so fest, daß es erst dicht vor dem sich nahenden Feinde auffliegt und geberdet sich hierbei in ähnlicher Weise wie der Uferschilfsänger. Nach dreizehntägiger Bebrütung sind die Eier gezeitigt, kaum drei Wochen später die erwachsenen Jungen dem Neste entflogen. Die Familie bleibt nunmehr noch geraume Zeit zusammen, einen lockeren Verband bildend, beginnt sodann hin- und herzustreifen und tritt endlich im Anfange des August die Winterreise an. Pfarrer Bolsmann hat, laut Altum, in der Umgegend von Münster viele Jahre hindurch genau am neunten August und nur ausnahmsweise manchmal am achten oder zehnten dieses Monats durchziehende Binsenschilfsänger an bestimmten Stellen angetroffen.
Die Heuschreckenschilfsänger ( Locustella) unterscheiden sich in Gestalt und Wesen hinlänglich von ihren Familiengenossen, um ihnen den Rang einer Sippe zuzugestehen. Der Leib ist schlank, der Schnabel breit, gegen die Spitze hin pfriemenförmig, der Fuß ziemlich hoch und langzehig, der Fittig kurz und abgerundet, in ihm die zweite und dritte Schwungfeder die längsten, der Schwanz mittellang, breit und abgestuft, sein Unterdeckgefieder sehr lang, das übrige Gefieder weich und fein, seine Färbung ein düsteres Bräunlichgrün, mit dunklerer Fleckenzeichnung auf dem Rücken und auf der Oberbrust.
Als Urbild der Gruppe darf der Feldschwirl, Schwirl, Busch- und Heuschreckenrohrsänger, Heuschreckensänger, Buschgrille etc. ( Locustella naevia und Rayi, Acrocephalus locustella, Sylvia, Salicaria und Threnetria locustella, Muscipeta locustella und olivacea, Calamoherpe locustella, und tenuirostris) gelten. Seine Länge beträgt einhundertfünfunddreißig, die Breite einhundertundneunzig, die Fittiglänge dreiundsechzig, die Schwanzlänge achtundvierzig Millimeter. Das Gefieder ist auf der Oberseite olivenbraun, auf dem Kopfe durch kleine rundliche, auf Mantel und Schultern durch breite pfeilförmige braunschwarze Flecke gezeichnet; die Unterteile sind rostfahlgelb, Kinn, Kehle, Unterbrust und Bauchmitte lichter, ins Weißliche ziehend, auf dem Kropfe mit feinen dunklen Schaftstrichen, auf den Unterschwanzdecken mit breiten verwaschenen Schaftflecken geziert, die Schwingen schwärzlichbraun mit schmalen ölgrauen Seitenkanten, welche nach hinten zu breiter werden, die Steuerfedern dunkel grünlichbraungrau, lichter gesäumt und gewöhnlich dunkler in die Quere gebändert. Das Auge ist graubraun, der Schnabel hornfarben, der Fuß lichtröthlich. Im Herbstkleide ist die Unterseite gilblicher, im Jugendkleide die Brust gefleckt.
Im mittleren Sibirien, angeblich auch in Südrußland, vertritt ihn der Striemenschwirl ( Locustella lanceolata und minuta, Acrocephalus lanceolatus, Sylvia, Cisticola und Calamodyta lanceolata). Er ist ihm sehr ähnlich, unterscheidet sich aber durch erheblich geringere Größe, zart rostgelbliche Unterseite und stärkere, dichtere, auch Kinn und Kehle einnehmende Fleckung. Dem Osten Mittelasiens entstammt der einmal auf Helgoland erbeutete Streifenschwirl ( Locustella certhiola und rubescens, Motacilla, Sylvia, Turdus und Acrocephalus certhiloa). Seine Länge beträgt einhundertundsechzig, die Fittiglänge fünfundsiebzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter; sein Gefieder ist oberseits olivengraubraun, mit breiten, dunklen Schaftstrichen gezeichnet, welche auf dem Oberkopfe sechs, auf dem Rücken acht unregelmäßige Längsreihen bilden, unterseits rostgelblich, an der Kehle und auf der Bauchmitte weißlich, an den Unterschwanzdecken rostfahlbraun, weißlich gerandet, über dem Auge, einen schmalen Streifen bildend, weißlich; die Schwingen und Schwanzfedern sind dunkelbraun, erstere außen schmal fahlbraun gesäumt, letztere mit sieben dunklen, verloschenen Querbinden und breitem lichten Endrande geziert.
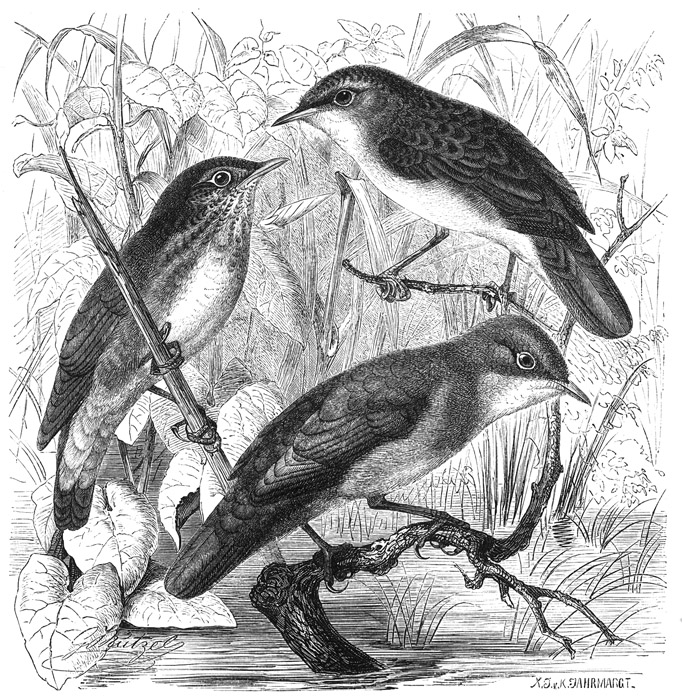
Feld-, Schlag- und Rohrschwirl ( Locustella naevia, fluviatilis und luscinioides). 2/3 natürl Größe.
Von Schweden oder Rußland an verbreitet sich der Schwirl über ganz Mitteleuropa; gelegentlich seines Zuges erscheint er im Süden unseres Erdtheiles oder in Nordostafrika. Er bewohnt die Ebenen, findet sich aber keineswegs überall, sondern nur stellenweise, hier und da sehr häufig, an anderen Orten, zumal im Gebirge, gar nicht. In Deutschland erscheint er um die Mitte des April und verweilt hier bis zu Ende des September, ebensowohl in großen Sümpfen wie auf kleineren, mit Weidengebüsch bewachsenen Wiesen, im Walde nicht minder als auf Feldern seinen Aufenthalt nehmend. Hier entfernt er sich nicht vom Wasser, dort lebt er auf trockenem Boden; hier bevorzugt er Seggengräser, dort niederes, dichtes Buschholz und Dornengestrüppe, Eine Oertlichkeit, welche ihm hundert- und tausendfach Gelegenheit bietet, sich jeder Zeit zu verbergen, scheint allen Anforderungen zu entsprechen. Auf dem Zuge verbringt er den Tag allerorten, wo niedere Pflanzen dicht den Boden bedecken.
»Der zusammengedrückte Leib, die bewunderungswürdige Schnelligkeit im Laufen und das gefleckte Gefieder«, sagt Wodzicki, »stempeln den Schwirl zu einem Vertreter der Rallen in der Sängerfamilie. Hat man je Gelegenheit gehabt, diese Vögel beim Neste zu beobachten, wie sie emsig hin- und herlaufen auf nassem Boden, selbst kleine, mit seichtem Wasser bedeckte Strecken überschreiten, wie sie im Wasser, ohne sich aufzuhalten, die auf ihrem Wege sich vorfindenden Kerbthiere erhaschen, dieselben in größter Eile den Jungen zutragen und wieder fortrennen, wie sie auf die Graskaupen springen, ein paarmal schwirren und dann wieder eifrig suchen; hat man sie endlich mit ausgestrecktem Halse und aufgeblasener Kehle beim Singen gesehen, so wird man gewiß an die Wasserralle denken.« Mit dieser Schilderung des Gebarens stimmen alle Beobachter überein. »Es mag«, bemerkt Naumann, »nicht leicht einen unruhigeren und dabei versteckter lebenden Vogel geben als diesen. Sein Betragen ist ein Gemisch des Wesens der Rohrsänger, Schlüpfer und Pieper. Unablässig kriecht er im dichtesten Gestrüppe von Buschholz und von Sumpfpflanzen dicht über dem Boden oder auf diesem herum und treibt hier sein Wesen fast ganz im verborgenen. Nur ein plötzlicher Ueberfall kann ihn einmal aus seinen Verstecken hervorscheuchen; aber er fliegt auch dann gewiß nie weit über das Freie und bloß niedrig und dicht über dem Boden dahin. Er ist ein ungemein hurtiger, lebhafter Vogel und dabei scheu und listig. Aus dem Erdboden läuft er schrittweise mit einer Leichtigkeit und Anmuth wie ein Pieper, wenn er sich verfolgt glaubt aber mit einer Schnelligkeit, wie man eine Maus laufen zu sehen gewohnt ist. Wenn er Gefahr ahnt, schlüpft er so schnell durch das dichte Gezweige, daß man ihn im Nu aus dem Auge verliert. Beim Gehen trägt er den Leib wagerecht und streckt dabei den Hals etwas vor; er läuft ruckweise und bewegt dazu den Schwanz und den ganzen Hinterleib mehrmals nach einander auf und nieder. Wenn er durch die Zweige hüpft, beugt er die Brust tief; wenn er etwas verdächtiges bemerkt, zuckt er mit den Flügeln und dem Schwanze; bei großer Augst schnellt er den letzteren ausgebreitet hoch aufwärts und bewegt dabei die hängenden Flügel oft nach einander. Im ruhigen Forthüpfen, und namentlich dann, wenn er an senkrechten Zweigen und Pflanzenstengeln auf- und absteigt, ist er wieder ganz Rohrsänger.« Seinen Familiengenossen ähnelt er auch im Fluge, erhebt sich selten zu nennenswerther Höhe über den Boden, flattert vielmehr meist in gerader Linie, anscheinend unsicher und unregelmäßig, dahin und wirft sich nach Art seiner Verwandtschaft plötzlich senkrecht in das dichte Pflanzengewirr unter ihm herab. Demungeachtet durchmißt der anscheinend wenig flugfähige Vogel zuweilen doch auch Strecken von mehreren tausend Schritten im Fluge, um mit Hansmann zu reden, »abwechselnd auf die eine oder andere Seite gelegt wie ein Schwimmer, welcher mit einer Hand rudert. Der Flug ist dann demjenigen seiner Nachbarin, der Dorngrasmücke, ähnlich, nur flüchtiger, und die Schwingen werden nach jedem Stoße fast an den Schwanz gelegt.«
Mehr als jede andere Begabung zeichnet den Schwirl und seine Verwandten ein absonderlicher Gesang aus. Derselbe besteht nämlich nur in einem einzigen wechsellosen, langgezogenen, zischenden Triller, dem Schwirren vergleichbar, welches die großen Heuschrecken mit den Flügeln hervorbringen. Versucht man, den Laut durch Buchstaben auszudrücken, so kann man sagen, daß er wie »Sirrrrr« oder »Sirrlrlrlrl« klinge. »Ganz sonderbar ist es mir vorgekommen«, sagt Naumann, »daß man dieses feine Geschwirre, welches in der Nähe gar nicht stark klingt, so weit hören kann. Ein gutes Ohr vernimmt es an stillen Abenden auf tausend Schritt und noch weiter ganz deutlich. Ich habe diese Vögel zu allen Stunden des Tages und der Nacht zu belauschen versucht, deshalb ganze Nächte im Walde zugebracht, und kann versichern, daß der merkwürdige Gesang stets einen höchst eigenthümlichen Eindruck auf mein Gemüth machte, so daß ich stundenlang, nachdem ich den Wald längst im Rücken hatte, immer noch dieses Schwirren zu hören glaubte. Es schien mir aus jedem rauschenden Zweige, an dem ich vorüberging, aus jedem säuselnden Lüftchen entgegen zu kommen. Gewöhnlich schwirrt der merkwürdige Sänger seine Triller gegen eine Minute lang in einem Athem weg, ohne einmal abzusetzen; wenn er aber recht eifrig singt, so hält er ohne Unterbrechung oft zwei und eine halbe Minute aus, wie ichs mit der Uhr in der Hand öfters beobachtet habe. Nach einer Unterbrechung von wenigen Sekunden fängt er dann wieder an zu schwirren, und so hört man ihn seine einförmige Musik nicht selten stundenlang fortsetzen. Am Brutplatze schwirrt der Vogel selten am Tage und noch seltener anhaltend. Er fängt hier erst nach Sonnenuntergang ordentlich an, singt immer eifriger, je mehr die Mitternacht naht, bis nach zwölf Uhr, setzt nun eine gute Stunde aus, beginnt wieder und treibt es ebenso eifrig als vor Mitternacht bis zum Aufgang der Sonne. Hat das Weibchen erst Nest und Eier, so singt das Männchen am Tage gar nicht mehr, sondern bloß bei mitternächtlicher Stille oder früh, wenn der Morgen kaum zu grauen anfängt. So lange der Schwirl noch keinen festen Wohnsitz erwählt hat, singt er, während er durch die Zweige schlüpft, so daß er sich beim Schlusse seines Trillers oft fünfzig Schritt von dem Orte, wo er anfing, entfernt hat; am Brutplatze hingegen sitzt er häufig stundenlang an einer Stelle oder klettert höchstens an einem Halme in die Höhe oder auf einem Zweige hinaus und wieder zurück«. Dieser Gesang, welchen ich zufälligerweise bis jetzt noch niemals selbst gehört habe, verräth den Schwirl jedem aufmerksamen Beobachter. In der Zeit, in welcher er am eifrigsten schwirrt, läßt sich noch keine Heuschrecke vernehmen, und man braucht daher nur dem absonderlichen Laute zu folgen, um den Vogel aufzufinden. »Bei seiner versteckten Lebensweise«, meint Hansmann, »ist derselbe für uns nicht eher da, als seine Stimme vernommen wird. Das Weibchen, welches am Boden, vom hohen Grase bedeckt, sein Wesen treibt, bekommt man überhaupt nicht zu sehen, falls nicht ein günstiger Zufall es vor das Auge bringt; das Männchen dagegen zeigt sich beim Singen regelmäßig frei und kommt dabei früher oder später zu Gesichte.« Ungestört sitzt es, nach langjährigen Beobachtungen des letztgenannten, während es singt, stundenlang mit senkrecht herabhängendem Schwanze, etwas nach oben gerichtetem Schnabel, zitterndem Unterschnabel und aufgeblasener Kehle regungslos auf einer und derselben Stelle. »Der wunderliche Sänger hat die größere oder geringere Stärke des Tones ganz in seiner Gewalt. Nähert man sich einem solchen, welcher auf einem vereinzelten Wiesenbusche sitzt, so schweigt er plötzlich. Man steht still, fünf, zehn Minuten lang wartend, da beginnt das Schwirren wieder, scheint aber aus einer ganz anderen Richtung herzukommen oder aber ist so leise und gedämpft, daß man über die Entfernung des singenden Vogels vollständig irre werden möchte, Zuweilen schweigt der Schwirl viele Tage, fast wochenlang, hartnäckig; dann wieder läßt er sich nur des Vormittags oder des Mittags oder des Abends, am regelmäßigsten aber immer in den Nachtstunden hören. Er schweigt bei Sonnenscheine und schwirrt bei Regen und heftigen Stürmen: so wenig begabt, und doch so launisch wie der gefeiertste Künstler!«
Die Nahrung entspricht der anderer Familienverwandten und ändert höchstens infolge der verschiedenen Oertlichkeit, welche der Schwirl bewohnt, einigermaßen ab.
Das Nest ähnelt mehr dem einer Grasmücke als irgend einem aller bisher genannten Rohrsänger, steht aber ausnahmslos auf dem Boden, gleichviel ob derselbe trocken oder so naß ist, daß man selbst unmittelbar unter den Eiern die Feuchtigkeit spüren kann, entweder unter einem kleinen Strauche oder, und häufiger, im Grase in der Nähe eines Strauches oder Baumstammes zwischen herabhängenden trockenen Grasblättern außerordentlich verborgen. Der einfache, flache Bau wird ausschließlich aus trockenen Grasblättern errichtet, und der hauptsächlichste Unterschied zwischen ihm und einem Gartengrasmückenneste besteht darin, daß der Schwirl breitere Blätter zur Herstellung der Außenwände wie der inneren Auskleidung verwendet. Ausnahmsweise findet man wohl auch etwas Moos als Unterlage. Das Gelege besteht aus fünf bis sieben, siebzehn Millimeter langen, dreizehn Millimeter dicken, ungleichhälftigen, zartschaligen, mäßig glänzenden Eiern, welche auf gelb-, oder matt-, oder bräunlichröthlichem Grunde mehr oder minder gleichmäßig am dicken wie am spitzigen Ende kranzartig mit matt veilchenblauen Schalenflecken und kleinen bläulichröthlichen Punkten gezeichnet sind. Nach etwa vierzehntägiger Brutzeit entschlüpfen die Jungen, wachsen, rasch heran, verlassen, wenigstens bei Störung, das Nest ehe sie vollständig flügge sind, und verschwinden dann, mäuseartig rennend, in dem benachbarten Pflanzendickichte. Hansmann behauptet, daß der Schwirl ungestört nur einmal im Jahre nistet; Baldamus und Päßler dagegen geben an, daß man das erste Gelege gegen die Mitte des Mai, das zweite gegen Mitte oder Ende des Juli findet. Für die Richtigkeit letzterer Angabe spricht der um diese Zeit noch hörbare Gesang des Männchens. In der ersten Hälfte des August verläßt alt und jung die Niststätte, wendet sich zunächst dichter bestandenen Brüchen zu und tritt nun allmählich die Winterreise an.
Mehr den Südosten Europas und außerdem Westasien und Ostafrika bewohnt der in Deutschland seltene Schlagschwirl oder Flußrohrsänger ( Locustella fluviatilis und strepitans, Sylvia, Acrocephalus, Salicaria, Lusciniopis und Threnetria fluviatilis, Bild S. 222). Seine Länge beträgt einhundertsiebenundvierzig, die Breite zweihundertfünfunddreißig, die Fittiglänge dreiundsiebzig, die Schwanzlänge zweiundsechzig Millimeter. Die Oberseite und die Außenfahnen der olivenbraunen Schwingen und Schwanzfedern sind olivenfahlbraun, die Untertheile heller, Kehle und Bauchmitte fast weiß, die breiten Endsäume der rostbräunlichen unteren Schwanzdecken verwaschen weiß, Kehle und Kopf mit sehr verwischten olivenbräunlichen Längsstreifen gezeichnet. Der Augenring hat braune, der obere Schnabel hornbraune, der untere wie der Fuß horngelbliche Färbung.
Wahrscheinlich kommt der Schlagschwirl in Deutschland öfter vor, als man bis jetzt annimmt; denn er mag sehr oft mit seinen Verwandten verwechselt werden. Mit Sicherheit ist er an der Elbe, Oder und dem Memel sowie neuerdings von Freund Liebe an der Göltsch, einem Nebenflusse der Elster, beobachtet worden. Häufiger tritt er an der mittleren und unteren Donau, in Galizien, Polen und ganz Rußland auf. Wir verdanken die eingehendsten Berichte über sein Freileben Wodzicki und Schauer, welche ihn in Galizien beobachtet haben. Hier bewohnt er zwar ebenfalls niedrige Lagen, mit Weidengebüsch bestandene Waldwiesen ausgedehnter Föhrenwaldungen, von Wiesen und Viehweiden umgebene Erlenbrüche oder ähnliche Oertlichkeiten, am häufigsten aber doch die Buchenholzschläge des Mittelgebirges, in denen über starken Wurzelstöcken und alten, faulenden Stämmen der üppigste, aus hohen Gräsern, Halbgräsern, Doldengewächsen, Brombeer- und Himbeersträuchern bestehende Unterwuchs wuchert. In seinem Brutgebiete erscheint er erst um die Mitte des Mai, wenn der Pflanzenwuchs schon so weit vorgerückt ist, daß er sich verstecken kann, nimmt auch nicht sogleich nach seiner Ankunft seine Brutstätte ein, sondern schweift erst an Orten umher, wo man ihn nicht vermuthen oder suchen möchte: in kleinen Gärtchen mit Stachelbeerbüschen, sogar in trockenen, aus Ruthen geflochtenen Zäunen zum Beispiel. Aber auch an solchen so wenig deckenden Orten weiß er sich auf das geschickteste zu verbergen; denn sein ganzes Wesen ist versteckt und geheimnisvoll. Selbst am Brutplatze, vielleicht einer Wiese, auf welcher unzusammenhängende Weidenbüsche stehen, gewahrt man das Männchen bloß, wenn es sich ganz sicher glaubt, und auch dann voraussichtlich nur auf bestimmten Zweigen, seinen Singplätzen, zu denen es regelmäßig zurückkehrt; übrigens hält es sich stets versteckt, fliegt so selten wie möglich und, wenn es dasselbe dennoch thut, bloß über kurze Strecken, unter gleichartigem, schnurrendem Flügelschlage, einer großen Sphinx vergleichbar, hält dabei stets eine schnurgerade Linie ein, hat nur sein Ziel vor Augen und läßt sich durch nichts beirren. Beunruhigt, sucht es sich nur durch Flucht zu retten; nähert man sich ihm, wenn es, wie gewöhnlich, auf einem hervorragenden trockenen Zweige des Weidenbaumes sitzt, so stürzt es wie todtgeschossen, ohne einen Flügel zu rühren, fallrecht herab, verkriecht sich im Grase, weiß binnen wenigen Augenblicken die dichtesten und verworrensten Stellen zu gewinnen und läßt sich durch kein Mittel, nicht einmal durch einen Hund, zum Auffliegen zwingen. Einzig und allein im Eifer des Gesanges vergißt es zuweilen die ihm eigene Vorsicht und gestattet unter Umständen, daß ein versteckter Beobachter es und sein Treiben belauscht. Beim Singen geberdet es sich ganz wie seine Verwandten, erklettert einen überragenden Zweig oder hebt den Kopf in die Höhe, so daß der Schnabel fast senkrecht emporgerichtet wird, öffnet ihn sehr weit, sträubt gleichzeitig die Kehlfedern und schwirrt nun unter eigenthümlichen Zungenbewegungen seinen Triller ab. Dieser besteht aus zwei nebeneinander liegenden gezogenen Tönen, von denen der eine tiefer und stärker, der andere höher und schwächer ist, und wird, nach Schauers Meinung, ebensowohl beim Einathmen wie beim Ausstoßen von Luft hervorgebracht. Verglichen mit dem Triller des Feldschwirls ist er stark und kräftig, weniger zischelnd, sondern mehr wetzend, der vielleicht funfzig- bis sechzigmal aneinander gereihten Silbe »Zerr« etwa ähnlich, stets merklich kürzer, auch im Gange langsamer und dem Schwirren der grünen Heuschrecken ähnlicher. Er wird von Zeit zu Zeit durch den abgerissenen, schnarrenden Lockton unterbrochen und erinnert in gewisser Beziehung an den Anfang des Goldammergesanges. Während des Singens wendet der Schlagschwirl den Kopf mehr oder weniger bald nach rechts, bald nach links, und bewirkt dadurch, daß das Schwirren bald etwas stärker, bald etwas schwächer erklingt. Niemals schwirrt er, wenn er sich von einem Orte zum anderen bewegt; will er seinen Platz wechseln oder auch nur einen Sprung ausführen, so unterbricht er sich. Fühlt er sich sicher, und ist gutes Wetter, so sitzt er stets auf einem hervorragenden trockenen Zweige eines Busches, seltener auf den unteren oder mittleren Aesten, niemals im Wipfel eines Baumes. Wurde er gestört, so beginnt er aus der Mitte eines Busches ganz ungesehen und versteckt kurze, durch Pausen unterbrochene Strophen zu trillern, springt aber gewöhnlich nach jedem Triller, nach jeder Pause auf einen höheren Ast, bis er endlich sein Lieblingsplätzchen wieder eingenommen hat. Erst wenn er hier sich vollkommen sicher glaubt, fängt er aus voller Brust nach Herzenslust zu singen an. Bei starkem Winde und leichtem Regenwetter hört man ihn ebenfalls; dann aber sitzt er tief unten im Busche und kommt nicht zum Vorscheine. Dem Schwirren läßt er, wie seine Verwandten auch, ein eigentümliches Gurgeln, Glucksen, Murksen vorausgehen, namentlich, wenn er gestört wurde. Oft aber will auch sein Gesang nicht recht in Gang kommen: er räuspert und gurgelt, hält aber plötzlich inne und schwirrt gar nicht oder läßt nur einen einzigen Triller vernehmen. Das Weibchen antwortet jedesmal, sobald das Männchen zu singen aufhört, mit einem »Tschick, tschick«, welches offenbar Wohlgefallen bekundet, da der Ausdruck der Angst ein knarrendes »Kr, kr« ist.
Das Nest steht immer auf dem Boden, aber auf sehr verschiedenen Oertlichkeiten, entweder in Büschen oder auf Graskufen, zwischen Wurzeln eines Baumes etc., ist auch sehr ungleichmäßig gebaut, bald aus groben Schilfblättern unordentlich zusammengefügt und innen mit Moos und feinen Wurzeln ausgelegt, bald etwas besser geflochten und innen auch zierlicher ausgekleidet, bald wiederum aus kleinen, feinen Gräsern und Moos hergestellt, von außen regelmäßig mit einem großen zusammengetragenen Haufen derselben Stoffe, welche die Wandungen bilden, so locker umgeben, daß man das Nest aus dieser Ringmauer herausheben kann. Um die Mitte des Mai, oft aber erst zu Ende des Monats, beginnt das Weibchen seine vier bis fünf Eier zu legen und vom ersten an zu brüten. Die Eier haben einen Längsdurchmesser von vierundzwanzig, einen Querdurchmesser von achtzehn Millimeter, ändern in der Form vielfach ab und sind auf weißem, schwach glänzendem Grunde mit äußerst kleinen schmutziggelblichen und braunen, gegen das dicke Ende zu einem undeutlichen Kranze zusammentretenden Punkten gezeichnet. Das Weibchen hängt an seiner Brut mit solcher Liebe, daß Wodzicki drei Fehlschüsse auf ein solches thun und beobachten konnte, wie dasselbe trotzdem zum Neste zurückgelaufen kam und weiter brütete. Gleichwohl sind die Vögel gegen Gefahr nicht unempfindlich; denn schon beim leisesten Geräusche hört man das Männchen wie das Weibchen warnend »Kr, kr, tschick« ausrufen und erst dann wieder schweigen, wenn beide von ihrer Sicherheit sich überzeugt haben. Die Jungen verlassen das Nest, wenn sie kaum mit Federn bedeckt und ihre Schwanzfedern eben im Hervorsprossen begriffen sind, laufen wie Mäuse im Grase umher, locken eintönig »Zipp, zipp«, selbst wenn die Alten sie durch ihren Warnungslaut zum Schweigen bringen wollen, und würden sich leichter verrathen, als dies der Fall, täuschte nicht auch bei ihnen der Ton in auffallender Weise selbst den kundigen Beobachter.
Die dritte Art der merkwürdigen Gruppe ist der Rohrschwirl oder Nachtigallrohrsänger ( Locustella luscinioides, Sylvia, Salicaria, Acrocephalus, Cettia und Lusciniopsis luscinioides, Lusciniola, Pseudoluscinia und Lusciniopsis Savii, Bild S. 222). Seine Länge beträgt einhundertundvierzig, die Breite zweihundertundzehn, die Fittiglänge siebenundsechzig, die Schwanzlänge neunundfunfzig Millimeter. Die Obertheile sind olivenrostbraun, Schwingen und Steuerfedern etwas dunkler, die Untertheile und ein schmaler Augenstreifen viel heller, olivenroströthlich, Kinn, Bauchmitte und die verloschenen Endsäume der unteren Schwanzdecken rostweißlich; auf der Unterkehle bemerkt man einige verwaschene rostbraune Schaftflecke. Der Augenring ist tiefbraun, der Oberschnabel braunschwarz, der Unterschnabel gelblich, die Wachshaut fleischfarbig.
Vorzugsweise dem Süden Europas angehörend, findet sich der Rohrschwirl auch in Galizien, an der Donau, in Südrußland, in Holland und ebenso im westlichen Asien und Nordafrika; immer und überall aber beschränkt sich sein Vorkommen auf einzelne Gegenden, und außerdem tritt er, in Galizien wenigstens, in manchen Jahren äußerst selten, in anderen dagegen ungemein häufig am Brutorte auf. Er ist, laut Wodzicki, ein wahrer Rohrvogel, welcher das Röhricht nie verläßt, nach Art seines Geschlechtes aber immer sich bewegt und bald auf dem Boden, bald im Rohre dahinläuft. Niemals wird man ihn ruhig sitzen sehen. Im Frühjahre belustigt er sich sogar durch Balzflüge, indem er flatternd in die Luft aufsteigt und sich nach Art der Grasmücken und Pieper, jedoch ohne zu singen, mit zurückgelegten Flügeln wieder ins Röhricht wirft. Viel zutraulicher und neugieriger als der Schlagschwirl, pflegt er, sobald er ein Geräusch hört, vom Boden aufzufliegen und sich aufs Rohr zu setzen, um den Hund oder Jäger erstaunt anzusehen. Bezeichnend für ihn ist seine außerordentliche Kampflust: während der Brutzeit verfolgen sich die Gatten oder Nebenbuhler bis zu den Füßen des Beobachters, gleichviel ob auf sie geschossen wurde oder nicht; denn sie schwirren selbst bei Gefahr. Ihr Gesang ist noch schwerer zu beschreiben als der der Verwandten, um so mehr, als man denselben im bewegten Rohre nur undeutlich vernehmen kann, und er außerdem unter den drei Schwirlen zwar die angenehmste, aber auch die schwächste Stimme hat, so daß man, etwas entfernt von ihm, glauben kann, Ohrensausen zu empfinden. »Wer auf fetten Morästen das Geräusch der schnell auf die Wasserfläche kommenden Blasen gehört hat«, sagt Wodzicki, »wird sich den Gesang des Rohrschwirls gut versinnlichen können. Oft ist der Ton höher oder tiefer, ohne das sonst vorherrschende R, als ob man schnell die Buchstaben ›gl gl gl gl gl‹ wiederholte.« Beim Singen sitzt der Vogel hoch oder niedrig, ausnahmsweise auch ganz ruhig, den Kopf zurückgelegt, den Hals langgezogen, den Kropf stark aufgeblasen. Während der Brutzeit singt er fleißig den ganzen Tag über bis zum Sonnenuntergange, nach Schauers Beobachtungen auch lebhaft während der ganzen Nacht. Sein Gesang täuscht ebenso wie der der übrigen Verwandten.
Zum Baue des Nestes, an welchem sich beide Gatten des Paares betheiligen, schleppen sie mühselig die Niststoffe herbei. Anfangs thun sie dies gemeinschaftlich, später theilen sie die Arbeit, indem das Männchen zuträgt und das Weibchen die Stoffe aus dem Schnabel nimmt und sie sodann verbaut. Das Männchen ist lustig und emsig bei der Arbeit und läßt sein eintöniges »Kr, kr« fast ohne Aufhören ertönen. Zur Niststätte wird eine geeignete Stelle im alten, hohen Schilfe oder im dichten, jedoch nur ausnahmsweise im hohen Grase gewählt, und hier steht der große Bau zumeist auf eingeknickten Schilfstengeln zuweilen funfzehn, manchmal auch bis sechzig und neunzig Centimeter über dem Wasser. Das Nest besteht nur aus breiten Schilfblättern, ist aber so sorgsam geflochten und inwendig so glatt, daß die Eier in der Mulde rollen. Jeder Unbefangene würde es eher für das Nest des Zwergrohrhuhns als für das eines Schilfsängers halten, so ähnlich ist es jenem, nur kleiner. Die größere Anzahl der Nester, welche Wodzicki untersuchte, war spitzig, oben breit und nach unten hin kegelförmig abfallend, zehn Centimeter hoch, neun Centimeter breit und etwa sechs bis neun Centimeter tief. Das Gelege besteht aus fünf, seltener vier Eiern, welche entweder zu Ende des Mai oder im Anfange des Juni vollzählig sind, in Form und Farbe außerordentlich abändern, einen Längsdurchmesser von einundzwanzig bis fünfundzwanzig, einen Querdurchmesser von funfzehn bis neunzehn Millimeter haben und auf weißlichem oder kalkweißem Grunde mit äußerst feinen, das dicke Ende ganz bedeckenden oder mit größeren gelben und braunschwarz violetten Punkten nur sparsam bespritzt und dann denen der Klappergrasmücke sehr ähnlich sind, ebenso wie andere wiederum an Pieper- und Heidelercheneier erinnern. Beide Gatten des Paares brüten abwechselnd und mit solcher Hingebung, daß man sie währenddem ganz gut beobachten kann; beide kommen auch, verscheucht, ohne Bedenken sofort zurück und zwar entweder im Fluge oder von Ast zu Ast hüpfend. Ist die Brut groß gezogen, so verläßt alt und jung das Rohr, übersiedelt ins Schilf und höhere Gras und verbleibt hier bis spät in den September, fortan auf dem nassen Boden sich umhertreibend.
Zur Vervollständigung mag noch der Seidenrohrsänger ( Bradypterus Cettii, Sylvia Cettii, sericea und platyura, Cettia sericea, altinisonans und Cettii, Calamodyta Cettii und sericea, Acrocephalus, Calamoherpe, Potamodus und Salicaria Cettii, Bild S. 218) hier eine Stelle finden. Er kennzeichnet sich durch seinen kurzen, schmalen Schnabel, die sehr abgerundeten Flügel, unter deren Schwingen die dritte und vierte die längsten sind, und die sehr breiten, langen und vollen Unterschwanzfedern, gilt daher als Vertreter einer besonderen Sippe, der Bruchrohrsänger ( Bradypterus). Die Obertheile sind röthlichbraun, Bürzel und Oberschwanzdecken etwas lebhafter, Steuerfedern und die Außenränder der dunkelbraunen Schwingen dunkler, ein Augenstrich verloschen, ein Augenring deutlicher weiß, die Untertheile und Unterflügeldecken weißlich, Kopf- und Halsseiten grau, die übrigen Körperseiten nebst den Unterschwanzdecken rostbräunlich, die längsten der letztgenannten Federn mit verwaschenem weißen Endrande. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel rostbraun, die Wurzel des unteren horngelb, der Fuß röthlichgelb. Die Länge beträgt ungefähr einhundertunddreißig, die Fittiglänge sechzig, die Schwanzlänge fünfundsechzig Millimeter. Das Weibchen ist merklich kleiner, das außerordentlich lockere Gefieder der Jungen nicht ganz so röthlich wie bei dem Männchen und der weiße Augenstreif im Jugendkleide kaum angedeutet.
Der Seidenrohrsänger bewohnt den Süden Europas von Spanien an bis zum Kaspischen Meere, das westliche Asien und Nordafrika und ist, wo er vorkommt, Standvogel. Beliebte Aufenthaltsorte von ihm sind stehende, mehr aber noch fließende Gewässer, namentlich Bäche, Wasser- und Abzugsgräben, deren Ufer Binsen, Brombeerhecken und Gebüsche möglichst dicht besäumen. Hier führt er ein sehr verborgenes Dasein. Laut Alexander von Homeyer ist er außerordentlich lebhaft und fast immer in Bewegung, kommt nicht häufig zum Vorscheine, verräth sich aber sofort durch seinen lauten, aufflackernden Gesang. Sein Wohngebiet, welches einige hundert Schritte Durchmesser haben mag, durchstreift er fortwährend und überrascht durch seine Eilfertigkeit. Bald singt er zur Linken, bald wieder zur Rechten des Beobachters, welcher sich im Anfange die Möglichkeit solcher Schnelligkeit gar nicht erklären kann, um so mehr, als ein Fliegen des nicht zu Gesichte kommenden Vogels nicht wahrscheinlich erscheint. Gleichwohl bemerkt man doch, daß er das Gebüsch nicht allein behend durchschlüpft, sondern auch ganz niedrig über den Boden weg, in der Regel durch ein Gesträuch gedeckt, weitere Strecken durchfliegt. Aeußerst vorsichtig entflieht er bei der geringsten Gefahr, ist daher noch schwerer zu erlegen als zu sehen. Lockton wie Gesang sind so bezeichnend, daß man den Seidensänger, wenn man ihn einmal gehört, niemals mit einem anderen Vogel verwechseln kann. Der Lockton klingt wie »Tscheck, tscheck, tscheck«; der Gesang ähnelt dem Beginne des Nachtigallschlages oft in so hohem Grade, daß man getäuscht werden könnte, würde das ganze Lied mit der einzigen Strophe nicht auch beendet sein. Hansmann übersetzt die Laute mit »Zick, ziwitt, ziwoid«, von der Mühle mit »Tschifut, tschifut, tschifut«, einem Worte, welches von den Türken als Schimpfnamen der Juden gebraucht wird und unserem Vogel bei den griechischen Hirten Haß eingetragen hat, weil sie glauben, daß der Seidensänger sie als Juden bezeichnen und schmähen wolle.
Das Nest steht ziemlich niedrig über dem Boden in undurchdringlichem Gesträuche, ist tief tassenförmig, wird aus Pflanzenresten, Stengeln und Blättern in halbmoderigem Zustande hergestellt, inwendig mit feinem Grase und Ziegenhaaren oder Schaf- und Baumwolle ausgekleidet und enthält schon zu Ende des April das volle, aus vier bis fünf, zwanzig Millimeter langen, funfzehn Millimeter dicken, eintönig rothen Eiern bestehende Gelege. Auf die erste Brut folgt im Laufe des Sommers regelmäßig eine zweite. Ueber die Erziehung der Jungen finde ich keine Angabe; wohl aber erwähnt Krüper, daß strenge Winter unter den Seidenrohrsängern oft arge Verheerungen anrichten.
An die Rohrsänger schließen sich die Buschsänger ( Drymoicinae) an. Wir vereinigen unter diesen Namen eine gegen zweihundert Arten zählende, auf die Alte Welt und Australien beschränkte, im heißen Gürtel besonders zahlreich auftretende Sängergruppe, deren Merkmale in dem mäßig langen, seitlich zusammengedrückten, gewöhnlich sanft gebogenen Schnabel, den verhältnismäßig sehr kräftigen Füßen, aber kurzen, abgerundeten Flügeln und verschieden langem, meist gesteigertem Schwanze sowie endlich dem einfarbigen, ausnahmsweise auch prachtvollen Gefieder zu suchen sind.
Hinsichtlich des Aufenthaltsortes im allgemeinen mit den Rohrsängern übereinstimmend, unterscheiden sich die Buschsänger von ihnen vielleicht dadurch, daß sie noch mehr als jene niedriges Gestrüpp, Binsen und langes Gras zum Aufenthaltsorte wählen. Sie vereinigen die Gewandtheit der Strauch- und Schilfsänger in sich, klettern, laufen, schlüpfen gleich ausgezeichnet, fliegen dagegen schlecht, unsicher und wankend, erheben sich, liebebegeistert, aber doch über die Spitzen ihrer Wohnpflanzen, um hüpfend und flatternd aufzusteigen, ihre einfache Strophe vernehmen zu lassen und dann wieder in das Dickicht unter ihnen hinabzustürzen. Hier, meist dicht über dem Boden, stehen ihre künstlichen, in gewissem Sinne unvergleichlichen, von ihnen zwischen zusammengenähten Blättern gebauten Nester; hier erziehen sie ihre Brut, hier finden sie ihre Nahrung, hier verbringen sie den größten Theil ihres Lebens.
Ein kurzer, zarter, leicht gebogener Schnabel, langläufige und großzehige Füße, kurze, gerundete Flügel, in denen die vierte Schwinge die längste, und ein nur wenig gerundeter, kurzer Schwanz sind die Kennzeichen der Cistensänger ( Cisticola), welche das gleichnamige Urbild der Sippe ( Cisticola cursitans, schoenicola, arquata, terrestris, europaea, tintinnabulans, munipurensis und Ayresii, Sylvia cisticola, Prinia cursitans, cisticola und subhimalachana, Salicaria cisticola und brunniceps, Calamanthella tintinnambulum, Bild S. 218) vertritt. Das Gefieder ist oberseits, die bräunliche Nackengegend und den rostbraunen Bürzel ausgenommen, ölbraun und dunkelbraun gefleckt, die Mitte der Federn schwarzbraun, der Rand aber rostgelbbraun; auf dem Kopfe bilden sich drei schwärzliche und zwei lichtgelbe Längsstreifen; die Nackengegend, Kehle und Unterleib sind reinweiß, die Brust, die Seiten und unteren Deckfedern des Schwanzes rostgelb, die Schwingen grauschwarz, außen rostgelb gesäumt, die mittleren Schwanzfedern rostbraun, die übrigen graubräunlich, am Ende weiß gerandet, vor letzterem mit einem schwärzlichen herzförmigen Fleck gezeichnet. Das Auge ist bräunlich hellgrau, der Schnabel hornfarben, der Fuß röthlich. Die Jungen unterscheiden sich von den Alten bloß durch etwas lichtere Färbung der Oberseite. Die Länge beträgt elf, die Breite sechzehn, die Fittiglänge fünf, die Schwanzlänge vier Centimeter. Das Weibchen ist etwas kleiner.
Mittel- und Südspanien, Süditalien, Sardinien und Griechenland, Nordafrika, Mittel-, Ost- und Südasien, sind die Länder und Landstriche, in denen der Cistensänger gefunden wird. Wo er vorkommt, ist er häufig, an vielen Stellen gemein. Er ist Standvogel, »bis auf die Orte, an denen er geboren wurde und an denen er später brütet«. In Spanien lebt er in allen Tiefebenen, welche nur einigermaßen seinen Anforderungen genügen: auf den mit hohem Schilfe bestandenen Dämmen der Reisfelder, im Riede, in Mais-, Luzern-, Hanffeldern und an ähnlichen Orten; auf Sardinien haust er, nach Hansmann, am Rande des Meeres, wo das Ufer flach und sumpfig ausläuft und nur mit Gräsern, besonders mit der Stachelbinse, bewachsen ist, besucht aber auch dort die Getreidefelder und brütet selbst in ihnen; auf den Balearen beobachtete ihn Alexander von Homeyer ebenfalls in fruchtbarem Getreidelande, jedoch nicht bloß in der Ebene, sondern auch auf den Bergen, wo es nur hier und da eine feuchte Stelle gab, so daß Hansmanns Angabe, »daß ein kleiner, sickernder Quell und ein Streifen Wiese, ein Ar groß, ihm mitunter schon genüge«, sich auch hier bewahrheitet. In Nordostafrika, woselbst er von der Küste des Mittelmeeres an bis Habesch, hier noch in zweitausend Meter Höhe, vorkommt, siedelt er sich außer in Feldern und Rohrbeständen auch in Akazien- und Dattelgebüschen, in Nordwestafrika hauptsächlich auf Wiesen an; in Indien bewohnt er jede Oertlichkeit, falls es nur langes Gras, Korn- oder Reisfelder gibt. Unbegreiflich war es mir, zu erfahren, daß die spanischen Vogelkundigen den Cistensänger bisher übersehen hatten; denn gerade er scheint sich förmlich zu bemühen, die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich zu ziehen. Namentlich während der Brutzeit macht sich das Männchen sehr bemerklich. Es steigt in kurzen Flugabsätzen mit lautem »Zit tit tit« in die Höhe, fliegt dann gewöhnlich lange, fortwährend schreiend, im Bogen hin und her, umschwärmt insbesondere einen Menschen, welcher in seine Nähe kommt, in dieser Weise minutenlang. Im Grase läuft er ungemein behend umher, so daß man ihn eben nur mit einer Maus vergleichen kann; angeschossene Alte wissen sich in wenigen Augenblicken so zu verstecken, daß man nicht im Stande ist, sie aufzufinden. Hansmann hat sehr recht, wenn er sagt, daß der Cistensänger etwas von dem Wesen des Zaunkönigs habe, stets tief in die Gras- oder Binsenbüsche sich verkrieche und in ihnen so beharrlich verweile, daß ihn erst ein Fußstoß gegen den betreffenden Büschel zu vertreiben vermöge. Ganz gegen die Art der Schilf- oder Riedsänger, mit denen er um die Wette an den Halmen auf- und niederklettert, bewegt er sich nur in einem kleinen Umkreise und fliegt auch, wenn er aufgescheucht wurde, niemals weit, sondern höchstens über Strecken von wenigen Metern hinweg. Der erwähnte Ton, welcher dem Cistensänger in Murcia den Namen »Tintin« und in Algerien den Namen »Pinkpink« verschafft hat, ist der Gesang des Männchens; außerdem vernimmt man nur noch ein schwaches, kurzes Schwirren, welches Aengstlichkeit ausdrückt, oder ein leises Gekicher, welches der Laut der Zärtlichkeit ist. Das zornig erregte Männchen läßt auch ein weiches »Wüit« oder ein kürzeres »Witt Witt« hören, wenn es sich mit anderen seiner Art herumstreitet.
Allerlei kleine Käfer, Zweiflügler, Räupchen, kleine Schnecken und ähnliche Thiere bilden die Nahrung unseres Vögelchens. Die Hauptmenge liest er von den Blättern des Grases oder Getreides ab, einzelne nimmt er wohl auch vom Grunde auf.
Das Nest, welches wir mehrmals gefunden haben, wurde zuerst von Savi richtig beschrieben. »Eigentümlich«, sagt dieser Forscher, »ist die Art und Weise, in welcher der Vogel die das Nest umgebenden Blätter zusammenfügt und die Wände seines Gebäudes fest und stark macht. In dem Rande jedes Blattes nämlich sticht er kleine Oeffnungen, welche durch einen oder durch mehrere Fädchen zusammengehalten werden. Diese Fäden sind aus dem Gewebe der Spinnen oder aus Pflanzenwolle gefertigt, ungleich dick und nicht sehr lang (denn sie reichen höchstens zwei oder dreimal von einem Blatte zum anderen), hin und wieder aufgezasert, an anderen Stellen auch in zwei oder drei Abzweigungen getheilt. Beim inneren Theil des Nestes herrscht die Pflanzenwolle vor, und die wenigen Spinnwebfäden, welche sich darunter befinden, dienen lediglich dazu, die anderen Stoffe zusammenzuhalten. An den seitlichen und oberen Theilen des Nestes stoßen die äußere und die innere Wand unmittelbar an einander; aber an dem unteren findet sich zwischen ihnen eine mehr oder weniger dichte Schicht, aus kleinen dürren Blättern oder Blütenkronen bestehend, welche den Boden des Nestes, auf dem die Eier ruhen sollen, dichtet. Im oberen Drittel der Wand ist das runde Eingangsloch angebracht. Der ganze Bau hat die Gestalt eines länglichrunden oder eiförmigen Beutels. Er steht in der Mitte eines Gras-, Seggen- oder Binsenbusches, der Boden höchstens fünfzehn Centimeter über der Erde, und ist an die tragenden Blätter genäht und auf andere, welche untergeschoben werden und so gleichsam Federn bilden, gestellt. So gewähren die wankenden Halme dem Neste hinlängliche Festigkeit und ausreichenden Widerstand gegen die heftigsten Stürme. Alle Nester, welche wir fanden, entsprachen vorstehender Beschreibung; Heuglin dagegen lernte in Egypten auch sehr abweichende, im Dattel- oder Dornengestrüppe stehende, in Blattscheiden, zwischen Dornen, Aestchen und Grashalme verflochtene, undichte, innen mit Wolle, Haaren und Federn ausgekleidete Bauten kennen.
Bisher haben wir geglaubt, daß das Weibchen der eigentliche Baumeister wäre; durch Tristrams Beobachtungen, welche von Jerdon bestätigt werden, erfahren wir aber, daß das Männchen den Haupttheil der Arbeit übernimmt. Sobald der Grund gelegt oder der Boden des Nestes fertig ist, beginnt das Weibchen zu legen, und wenn das Gelege vollzählig ist, zu brüten. Während es nun auf den Eiern sitzt, beschäftigt sich das Männchen noch tagelang damit, die Wandungen aufzurichten und die Grasblätter zusammenzunähen. »Ich hatte«, sagt Tristram, »das Glück, ein Nest zu entdecken, als es eben begonnen war, mußte an ihm täglich vorübergehen und konnte so einen Monat lang die Vögel beobachten. Als das erste Ei im Neste lag, war der ganze Bau noch überall durchsichtig und seine filzigen Wandungen nicht über zwei Centimeter hoch; während der ganzen Zeit der Bebrütung aber setzte das Männchen seine Arbeit an dem Neste fort, so daß dasselbe, als die Jungen ausgeschlüpft waren, schon das dreifache an Höhe erreicht und hinlängliche Festigkeit gewonnen hatte.«
Die Eier scheinen außerordentlich abzuändern. Wir haben in Spanien ein Gelege von fünf Stück gefunden, welche einfarbig lichtblau waren; andere Forscher aber erhielten solche, welche auf lebhaft röthlichweißem Grunde zahlreiche, zart rostfarbene Flecke und Punkte, andere solche, welche auf bläulichgrünem Grunde überall oder spärlich größere oder kleinere, braune oder ziegelrothe, schwarzbraune und schwarze Flecke und Punkte oder auf grünlichweißem Grunde schmutzig fleischfarbene und braunrothe, theilweise verwaschene oder auf reinweißem Grunde hellrothe Flecke zeigten. Die Jungen werden von beiden Eltern zärtlich geliebt. Das Männchen scheut, wenn ein Mensch dem Neste sich nahet, keine Gefahr und umfliegt ihn Viertelstunden lang in sehr engen Kreisen unter ängstlichem Geschreie. Wenn die Jungen glücklich ausgeflogen sind, gewährt die Familie ein überaus anziehendes Schauspiel. Die ganze Gesellschaft hüpft und kriecht, flattert und läuft um, auf und über dem Grase oder Getreide umher, und wenn eines der Eltern ein Kerbthier bringt, stürzt die gesammte Kinderschar, das Schwänzchen hoch gehoben, in wahrhaft lächerlicher Weise auf den Nahrungsspender los, da jedes das erste und jedes bevorzugt sein will. Naht sich Gefahr, so verschwindet die Mutter mit ihren Kindern, während das Männchen sofort in die Luft sich erhebt und hier in gewohnter Weise umherfliegt. Aus Savi's Beobachtungen geht hervor, daß der Cistensänger dreimal im Jahre brütet, das erste Mal im April, das zweite Mal im Juni, das dritte Mal im August. Wir fanden Nester im Mai, Juni und Juli; dann trat die Mauser und damit das Ende der Fortpflanzungszeit ein.
Wir haben uns viel Mühe gegeben, einen Cistensänger lebend zu fangen. Das Nachtigallgärnchen erwies sich als unbrauchbar; aber auch Schlingen, welche wir mit größter Sorgfalt um das Eingangsloch des Nestes legten, wurden von den geschickten Vögeln weggenommen, ohne sie zu gefährden.
Die Schneidervögel ( Orthotomus) sind gestreckt gebaut; der Schnabel ist lang, schwach, gerade, an der Wurzel breit, nach vorn zugespitzt, der Fuß kräftig, hochläufig, aber kurzzehig, der Flügel kurz, schwach, sehr gerundet und in ihm die fünfte oder sechste Schwinge die längste, der schmalfederige, meist kurze Schwanz stark abgerundet oder abgestuft, das glatt anliegende am Schnabelgrunde theilweise in Borsten umgewandelte Gefieder ziemlich lebhaft, auf der Oberseite gewöhnlich grün, auf dem Scheitel meist roströthlich gefärbt.

Schneidervogel ( Orthotomus Bennettii). 2/3 natürl. Größe.
Der Schneidervogel ( Orthotomus Bennettii, Lingoo, sphenurus, sutorius, ruficapillus, longicaudus, Sylvia ruficapilla und guzurata, Malurus longicaudus, Sutoria agilis) ist auf dem Mantel gelblich olivengrün, auf dem Scheitel rostroth, im Nacken grauröthlich, auf der Unterseite weiß, seitlich graulich verwaschen; die Schwingen sind olivenbraun, grünbräunlich gesäumt, die Steuerfedern braun, grünlich überflogen, die äußersten an der Spitze weiß. Bei dem Männchen verlängern sich die beiden Mittelfedern des Schwanzes über die anderen; beim Weibchen ist der Schwanz nur zugerundet. Die Länge beträgt siebzehn, beim Weibchen dreizehn, die Fittiglänge fünf, die Schwanzlänge neun, beim Weibchen fünf Centimeter.
Vom Himalaya an bis zum Kap Comorin, auf Ceylon, Java, in Burma etc., fehlt der Schneidervogel nirgends, vorausgesetzt, daß die Gegend nicht gänzlich des Baumwuchses entbehrt. Er bewohnt Gärten, Obstpflanzungen, Hecken, Rohrdickichte und Waldungen mit mittelhohen Bäumen, lebt gewöhnlich paarweise, zuweilen aber auch in kleinen Familien zusammen, hüpft ohne Unterlaß auf den Zweigen der Bäume und Gebüsche herum, läßt häufig einen lauten Ruf ertönen, welcher wie »Tuwi« oder »Pretti pretti« klingt, ist zutraulich und hält sich gern dicht bei den Häusern auf, wird aber vorsichtig, wenn er sich beobachtet, und scheu, wenn er sich verfolgt sieht. Seine Nahrung besteht aus verschiedenen Kerbthieren, vorzugsweise aus Ameisen, Cicaden, Raupen und anderen Larven, welche er von der Rinde und von den Blättern, nicht selten aber auch vom Boden aufnimmt. Beim Hüpfen oder beim Fressen pflegt er den Schwanz zu stelzen und das Gefieder seines Kopfes zu sträuben.
Nester, welche Hutton fand, waren sehr zierlich gebaut und bestanden aus Rohr- und Baumwolle, auch Bruchstücken von Wollenfäden, alle Stoffe fest in einander verwoben, mit Pferdehaaren dicht ausgefüttert, und wurden zwischen zwei Blättern eines Zweiges des Amaltusbaumes in der Schwebe gehalten. Diese beiden Blätter waren zuerst der Länge nach auf einander gelegt und in dieser Lage von den Spitzen aus bis etwas über die Hälfte an den Seiten hinaus mit einem vom Vogel selbst aus roher Baumwolle gesponnenen starken Faden zusammengenäht, so daß der Eingang zum Neste am oberen Ende zwischen den Blattstielen frei blieb, gerade da, wo diese am Baumzweige hafteten Ein anderes Nest hing an der Spitze eines Zweiges, etwa sechzig Centimeter über dem Boden, und war aus denselben Stoffen wie das vorige gearbeitet. Die Blätter waren hier und da mit Fäden, welche der Vogel selbst gesponnen, hier und da mit dünnen Bindfaden, welchen er aufgelesen hatte, zusammengenäht. Alle übrigen Nester, welche Hutton untersuchte, glichen den beschriebenen, bestanden aus Baum- und Schafwolle, Roßhaaren und Pflanzenfasern verschiedener Art, hatten die Gestalt eines Beutels und füllten stets das Innere zusammen genähter Blätter aus. Nicholson, welcher in bewässerten Gärten zu allen Zeiten des Jahres belegte Nester fand, glaubt, daß die Blätter der Bringal ( Solanum esculentum) oder die einer Kürbisart ( Cucurbita octangularis) bevorzugt werden. Mit Hülfe des Schnabels und der Füße schiebt der Vogel die Blattränder gegen- oder übereinander, durchsticht sie dann mit dem Schnabel, in welchem er einen selbstgedrehten oder aufgefundenen Faden hält, bis sie in ihrer Lage verbleiben, und baut endlich das Innere aus. Das Gelege besteht aus drei bis vier Eiern, welche auf weißem Grunde, namentlich am dünneren Ende, braunröthlich gefleckt sind.

Emuschlüpfer ( Stipiturus malachurus). ¾ natürl. Größe.
Der Emuschlüpfer ( Stipiturus malachurus, Muscicapa malachura, Malurus malachurus und palustris), Vertreter einer gleichnamigen Sippe, zeichnet sich namentlich durch die Bildung des Schwanzes aus, welcher nur aus sechs, mit zerschlissenen Fahnen besetzten Federn besteht und besonders bei den Männchen sehr entwickelt ist. Die Oberseite ist braun, schwarz in die Länge gestreift, der Oberkopf rostroth, die Gurgelgegend blaßgrau, die übrige Unterseite lebhaft roth; die Schwingen sind dunkelbraun, rothbraun gesäumt, die Steuerfedern dunkelbraun. Das Auge ist röthlichbraun; der Schnabel und die Füße sind braun. Beim Weibchen ist auch der Scheitel schwarz gestrichelt, die Gurgelgegend aber roth, anstatt grau. Die Länge beträgt siebzehn, die Fittiglänge sechs, die Schwanzlänge neun Centimeter.
Ueber das Leben des allen Ansiedlern Australiens wohlbekannten Vogels haben Gould und Ramsay ziemlich ausführlich berichtet. Der Emuschlüpfer bewohnt sumpfige Gegenden des südlichen Australien, von der Moritonbay an der Ostküste bis zum Schwanenflusse an der Westküste, ebenso Tasmanien, und ist, wo er vorkommt, häufig. Gewöhnlich findet man ihn paarweise oder in kleinen Familien, immer nächst dem Boden, in der Mitte der dichtesten Grasdickichte, so verborgen, daß man ihn selten zu sehen bekommt. Seine sehr kurzen, runden Flügel sind nicht zum Fluge geeignet, wenn die Gräser vom Thau und Regen naß sind, sogar vollkommen unbrauchbar; er fliegt daher so wenig als möglich und verläßt sich auf seine Füße. Ueberaus schnell und beweglich, behend und gewandt läuft er dahin, auf dem Boden ebenso rasch als, halb flatternd, halb hüpfend, zwischen den Grashalmen dahin, wendet und schwenkt sich mit unglaublicher Leichtigkeit und vereitelt deshalb die meisten Nachstellungen. Wenn ein Verfolger ihm plötzlich hart auf den Leib kommt, verschwindet er, Dank seiner Kunst im Verstecken, vor dessen Augen. Zum Fliegen entschließt er sich nur, wenn er unbedingt fliegen muß, und wenn er wirklich aufgescheucht wurde, fliegt er dicht über den Grasspitzen dahin und wirft sich plötzlich von der Höhe wieder zur Tiefe hernieder. Zuweilen erscheint er auf der Spitze eines Halmes, um von hieraus seine Welt zu überschauen. Bei ruhigem Sitzen trägt er den Schwanz aufrecht, gelegentlich auch wohl über den Rücken nach vorn gerichtet; bei schnellem Laufe aber hält er ihn wagerecht nach hinten. Das Männchen läßt während der Zeit seiner Liebe ein kurzes, aber niedliches Gezwitscher vernehmen; der Lockton ist ein leises Zirpen.
Ramsay entdeckte ein Nest zu Ende des September, aber erst, nachdem er tagelang die sehr häufigen Vögel beobachtet hatte, und nur durch Zufall. Es stand, äußerst geschickt verborgen, unter einem Grasbusche, war eiförmig, das Eingangsloch sehr groß, seine Mulde so seicht, daß die Eier, wenn das Ganze stark bewegt worden wäre, herausgerollt sein würden, bestand äußerlich aus Würzelchen, innerlich aus feinen Halmen und war mit einer Lage von Moos ausgekleidet; das Gefüge war überaus locker, geradezu lose. Die drei Eier waren auf reinweißem Grunde über und über mit feinen lichtrothen Punkten bestreut, am dicken Ende am dichtesten. Das Weibchen saß sehr fest und kehrte, eben vertrieben, sogleich wieder zum Standorte des Nestes zurück.
Die Kennzeichen der Flüevögel ( Accentorinae), welche gewöhnlich der Sängerfamilie eingereiht werden und dann hier ihre Stelle finden mögen, sind kräftiger Leib, kegelpfriemenförmiger, gerader, mittellanger, an den scharfen Schneiden stark eingezogener Schnabel, dessen ritzenförmige Nasenlöcher oben von einer Haut bedeckt werden, mittelhohe, etwas starke Füße, mit kurzen, aber kräftigen Zehen und stark gekrümmten Nägeln, mittel- oder ziemlich lange Flügel, in denen die dritte oder vierte Schwinge die längste zu sein pflegt, kurzer, mäßig breiter Schwanz und lockeres, Gefieder. Die Geschlechter unterscheiden sich wenig, die Jungen merklich von den Alten.
Je nachdem man die Gruppe auffaßt, weist man ihr ein Dutzend oder höchstens zwanzig Arten zu. Im ersteren Falle beschränkt sich der Verbreitungskreis auf das nördlich altweltliche und indische Gebiet. Europa gehören nur zwei Arten an. Die meisten leben im Gebirge und halten sich vorzugsweise am Boden auf, hüpfen in sonderbar gebückter Stellung langsamer oder schneller einher, fliegen fast immer niedrig über der Erde dahin und suchen auf dem Boden oder in niederem Gestrüppe ihre Nahrung, welche aus Kerbthieren, Beeren und feinen Sämereien besteht. Mit Anbruch des Winters verlassen einige den Norden und wandern südlicheren Gegenden zu; andere rücken von der Höhe ihrer Gebirge in tiefere Gegenden herab oder wenden sich südlichen Abhängen der Berge zu. Schon frühzeitig im Jahre schreiten sie zur Fortpflanzung, bauen ziemlich künstliche Nester und legen drei bis sechs grünliche Eier.

Wald- und Alpenflüevogel ( Accentor modularis und alpinus). ½ natürl. Größe.
Der Waldflüevogel, auch Braunelle, Heckenbraunelle, Isserling und Bleikehlchen genannt ( Accentor modularis und pinetorum, Motacilla, Sylvia, Prunella und Tharraleus modularis, Curruca sepiaria), Vertreter der Untersippe der Heckenbraunellen ( Tharraleus), ist schlank gebaut, der Schnabel schwach, die Flügel, in welchen die vierte Schwinge die längste, mäßig, der Schwanz ziemlich lang, auf Kopf, Hals, Kehle und Kropf aschgrau, am Kinne graulichweiß, auf dem Oberkopfe mit verwaschenen braunen Schaftstrichen gezeichnet, in der Ohrgegend bräunlich, heller gestrichelt, auf Brust und Bauch weißlich, an den Seiten bräunlich mit dunklen Schaftstrichen, auf den unteren Schwanzdecken braun, jede Feder hier weißlich gerandet; die Schwingen und Steuerfedern sind braunschwarz, letztere etwas matter als die erstere, außen rostbraun gesäumt. Das Auge ist lichtbraun, der Schnabel braun, der Fuß röthlich. Die Jungen sind auf der Oberseite auf rostgelbem Grunde schwarzbraun, auf der Unterseite auf rostgelblichem, in der Mitte weißlichem Grunde grauschwarz gefleckt. Die Länge beträgt hundertundfunfzig, die Breite zweihundertundvierzehn, die Fittiglänge einundsiebzig, die Schwanzlänge sechzig Millimeter.
Im östlichen Sibirien vertritt vorstehend beschriebene Art der annähernd gleichgroße Bergflüevogel ( Accentor montanellus, Motacilla, Sylvia und Prunella montanella, Spermolegus montanellus). Oberkopf und ein breiter Streifen über die Zügel, welcher bis auf die Ohrgegend reicht, sind schwarzbraun, ein breiter bis auf die Schläfe reichender Augenstreifen und die unteren Theile licht rostgelb, Bauchmitte und untere Schwanzdeckfedern heller, die Seiten mit rothbraunen Schaftstrichen, Bauch und Brust infolge der dunklen Federwurzeln etwas fleckig, Nacken, Mantel und Schultern rothbraun, durch dunkle Schaftflecke und verwaschene, hellere Seitensäume gezeichnet, die Halsseiten aschgrau, Bürzel und obere Schwanzdeckfedern fahlbraun, die Schwingen und deren Deckfedern braunschwarz, mit verwaschenen rothbraunen Außensäumen, Armschwingen und größte obere Flügeldeckfedern am Ende weiß, zwei Querbinden über den Flügel zeichnend, die Schwanzfedern erdbraun mit fahleren Außensäumen, die drei äußeren auch mit schmalen Endsäumen. Das Auge ist braun, der Schnabel schwarzbraun, der Fuß bräunlichroth. Das Weibchen unterscheidet sich durch minder lebhafte Färbung.
Vom vierundsechzigsten Grade nördlicher Breite an bis zu den Pyrenäen, den Alpen und dem Balkan scheint der Waldflüevogel überall Brutvogel zu sein, kommt aber auch noch weiter nach Norden hin vor und erscheint im Winter sehr regelmäßig im Süden Europas, streift selbst nach Nordafrika und nach Westasien hinüber. In Mitteldeutschland trifft er im März ein, hält sich eine Zeitlang in Hecken und Gebüschen auf und begibt sich dann an seinen Brutort, in den Wald, Fichten- und Kieferbestände Laubhölzern und ebenso das Gebirge der Ebene bevorzugend.
»In ihrem ganzen Wesen«, sagt mein Vater, »zeichnet sich die Braunelle so sehr aus, daß sie der Kenner schon von weitem an dem Betragen von anderen Vögeln unterscheiden kann. Sie hüpft nicht nur im dichtesten Gebüsche, sondern auch auf der Erde mit größter Geschicklichkeit herum, durchkriecht alle Schlupfwinkel, drängt sich durch dürres hohes Gras, durchsucht das abgefallene Laub und zeigt in allem eine große Gewandtheit. Auf dem Boden hüpft sie so schnell fort, daß man eine Maus laufen zu sehen glaubt. Ihren Leib trägt sie auf die verschiedenste Weise, gewöhnlich wagerecht, den Schwanz etwas aufgerichtet, die Fußwurzeln angezogen, oft aber auch vorn erhoben, den Hals ausgestreckt, den Schwanz gesenkt. Wenn man sie vom Boden aufjagt, fliegt sie auf einen Zweig, sieht sich um und verläßt den Ort erst, wenn ihr die Gefahr sehr nahe kommt. Ihr Flug ist geschwind, geschieht mit schneller Flügelbewegung und geht ziemlich geradeaus. Von einem Busche zum anderen streicht sie niedrig über der Erde dahin; wenn sie aber den Platz ganz verläßt, steigt sie hoch in die Luft empor und entfernt sich nun erst. So gern sie sich beim Aufsuchen ihrer Nahrung verbirgt, ebenso gern sitzt sie frei beim Singen. Man sieht sie dann stets auf den Wipfeln der Fichten, doch selten höher als zwanzig Meter über dem Boden, oder auf freistehenden Zweigen, besonders auf denen, welche den Wipfeln am nächsten stehen. Ihr Gesang besteht aus wenigen Tönen, welche durch einander gewirbelt werden und nicht viel anmuthiges haben.« Der Lockton klingt wie »Di dui dii« oder »Sri sri«; der Ausdruck der Angst hell wie »Didü«, ein Ruf, welchen sie im Fluge vernehmen läßt, wie »Bibibil«; das Lied besteht hauptsächlich aus den Lauten »Dididehideh«. Ein Vogel singt fast wie der andere; doch sind auch geringe Abweichungen bemerkt worden. Im Sitzen lockt die Braunelle selten, am häufigsten, wenn sie hoch durch die Luft fliegt. Sie scheint dann die sitzenden Vögel zum Mitwandern ermuntern zu wollen. Oft sind die lockenden Vögel so hoch, daß sie das menschliche Auge nicht erblicken kann. »Bei Annäherung einer Gefahr stürzt sie sich von der Spitze des Baumes fast senkrecht ins Gebüsche herab und verbirgt sich gänzlich. Sie ist jedoch keineswegs scheu, vielmehr sehr zutraulich und kirre und läßt den Beobachter nahe an sich kommen.« Im Sommer nährt sie sich hauptsächlich von Kerbthieren, zumal kleinen Käferchen und deren Larven; auf dem Zuge verzehrt sie fast nur feine Sämereien, nimmt auch, um die Verdauung zu erleichtern, Kieskörner auf.
Ende April schreiten die Paare zum Nestbaue. Das Männchen singt jetzt unaufhörlich, streitet sich heftig mit Nebenbuhlern und hilft später am Baue des künstlichen Nestes. Dieses steht stets in dichtem Gezweige, gewöhnlich in Fichtenbüschen, durchschnittlich einen Meter über dem Boden. »Es hat eine Unterlage von wenigen dürren Zweigen und besteht ausschließlich aus feinen, grünen Erdmoosstengeln, welche bisweilen auch die Ausfütterung bilden und seine Schönheit vollenden. Gewöhnlich ist es inwendig mit den rothen Staubträgern des Erdmooses ausgelegt und erhält dadurch das Ansehen, als wäre es mit Eichhornhaaren ausgefüttert. Unter den Moosstengeln finden sich oft auch Fichtenbartflechten und einzelne Heidekrautstengel, und die innere Lage besteht zuweilen aus schlanken, dürren Grasblättern, etwas Schafwolle und einzelnen Federn. Im Mai findet man das erste, im Juli das zweite Gelege in ihm. Ersteres besteht aus vier bis sechs, letzteres gewöhnlich aus vier, zwanzig Millimeter langen, vierzehn Millimeter dicken, blaugrünen Eiern. Sie werden wahrscheinlich von beiden Geschlechtern in dreizehn bis vierzehn Tagen ausgebrütet und wie die Brut sehr geliebt. Bei Gefahr verstellt sich das Weibchen nach Art der Grasmücken.« Auf die erste Brut folgt im Juni eine zweite.
Die Braunellen gewöhnen sich rasch an die Gefangenschaft und werden bald sehr zahm. Ihre Zutraulichkeit macht sie dem Liebhaber werth, trotz des unbedeutenden Gesanges.
Hoch oben in dem Alpengürtel der Schneegebirge Südspaniens begegnete ich zu meiner Freude zum ersten Male einer mir bisher nur durch Beschreibungen bekannt gewordenen Art der Familie, dem auf allen Hochgebirgen Europas häufigen Alpenflüevogel, auch Stein-, Flüe- oder Blümtlerche, Bergspatz, Blütling, Berg-, Spitz- oder Gadenvogel genannt ( Accentor alpinus, major und subalpinus, Motacilla alpina, Sturnus moritanus und collaris, Bild S. 235). Bald rasch über die zerstreut liegenden Felsblöcke hinweg gleitend, bald zwischen den duftigen Rosmarin- und Thymianbüschen sich verbergend, bald auf einen größeren Block fliegend, sang er hier sein leises, klangreiches Liedchen, trotz Sturmgebrause und Schneegestöber, wie es dort oben uns oft umtobte in den Tagen des November. Auch jetzt noch war er lebendig, behend und munter, wenig scheu, eher zutraulich, gewandt in seinen Bewegungen, anmuthig in seinem Wesen. Einzeln oder in kleinen Gesellschaften trafen wir ihn bis zu den Schneefeldern hinauf, in weit größerer Anzahl aber auf den sonnigen Gehängen der Südseite des mächtigen Gebirges. Hier ging er zuweilen auch tiefer hinab in die Thäler; sein eigentliches Gebiet aber schien die Höhe zu sein, und namentlich gegen Abend flogen auch die zerstreut da unten lebenden immer wieder nach oben empor. Es versammelten sich dann die einzelnen Gesellschaften auf gemeinschaftlichen Schlafplätzen, auf oder an steilen Felsenwänden mit Löchern und Spalten oder einzelnen Büschen und Grasbüscheln, auf denen auch Alpenkrähen und Felsentauben sich einfanden, um dort die Nacht zu verbringen. Am frühen Morgen verließ der Schwarm den Schlafplatz, zertheilte sich in Trupps und jeder von diesen ging nun seinem Tagewerke nach. Später habe ich den anmuthigen Vogel oft wiedergesehen, in den Alpen sowohl wie auf dem Riesengebirge, außer dem Bayerischen Hochgebirge seinem einzigen Brutorte in Deutschland.
Der Alpenflüevogel, welcher die Untersippe der Flüelerchen ( Accentor) vertritt, hat mit einer Lerche Aehnlichkeit. Der Schnabel ist verhältnismäßig stark, von oben und unten etwas gekrümmt, zugespitzt, an den Seiten sehr eingezogen, vorn schmal, an der Wurzel aber breiter als hoch, der Fuß stämmig, dickzehig, mit stark gekrümmten, jedoch stumpfen Krallen bewehrt, der Flügel lang, in ihm die dritte Schwinge die längste, der Schwanz kurz, in der Mitte merklich ausgeschnitten, das Gefieder reich. Die Obertheile sind graubraun, Nacken und Halsseiten deutlicher grau, Mantel und Schultern durch breite, dunkelbraune Schaftflecke gezeichnet, Kinn und Kehlfedern weiß mit schwarzen Endsäumen, die übrigen Untertheile bräunlichgrau, seitlich rostroth, durch die verwaschenen weißlichen Seitensäume der Federn geziert, untere Schwanzdecken braunschwarz, am Ende breit weiß, Schwingen und deren Deckfedern braunschwarz, außen rostbräunlich gerandet und an der Spitze weiß, die größten oberen Schwanzdeckfedern am Ende ebenfalls weiß, die Schwanzfedern schwarzbraun, außen fahlbraun gesäumt, am Ende der Innenfahne rostweißlich. Das Auge ist braun, der Schnabel hornschwarz, der Unterschnabel horngelb, der Fuß gelbbräunlich. Das Weibchen unterscheidet sich durch etwas mattere Färbung; die Jungen sind auf dem grauen Grunde oben rostgelb und schwärzlich, unten rostgelb, grau und grauschwarz gefleckt, die braunschwarzen Schwungfedern rostfarben gekantet, die Flügel durch zwei rostgelbe Binden, die braunen Schwanzsteuerfedern durch rostgelbe Spitzen geziert. Das Auge ist hellbraun, der Schnabel an der Wurzel gelb, an der Spitze schwarz, der Fuß bräunlich. Die Länge beträgt achtzehn, die Breite dreißig, die Fittiglänge zehn, die Schwanzlänge sieben Centimeter.
Alle höheren Gebirge Süd- und Mitteleuropas beherbergen die Flüelerche. Auf den Alpen ist sie überall häufig, auf dem Riesengebirge eine zwar seltenere, aber doch regelmäßige Erscheinung. In der Schweiz scheint sie ziemlich alle Gebirgsketten zu bewohnen; wenigstens traf sie Girtanner überall im Gebirge an, wo die Bedingungen, welche sie an das Leben stellt, erfüllt sind. Im Riesengebirge beschränkt sich ihr Aufenthaltsort auf wenige Stellen, namentlich die Riesenkoppe und das Hohe Rad, woselbst man sie, wenn man sie einmal erkundet hat, wenigstens im Sommer jederzeit annähernd auf derselben Stelle bemerken kann, da ihr ein Gebiet von wenigen Hektar vollkommen zu genügen scheint. In der Schweiz sieht man sie, laut Girtanner, fast immer in kleinen Trupps, welche die Nähe der Sennhütten und Viehställe der Gebirgseinsamkeit vorzuziehen scheinen, mindestens sofort hier sich zeigen, wenn das Wetter stürmisch ist oder höher oben im Gebirge Schnee fällt. So hoch wie der Schneefink steigt sie nicht empor, treibt sich vielmehr am liebsten an Steinhalden umher, welche an Felsenwände sich anlehnen und nicht alles Pflanzenlebens ermangeln. An regengeschützten Stellen der Absätze jener Wände steht auch gewöhnlich das Nest des Paares. Zum Singen wählt sich das Männchen entweder einen hervorstehenden Felsbrocken oder einen einzelnen hohen Stein. Der Gesang ist nicht eben bedeutend, doch auch nicht langweilig und entspricht ganz dem im allgemeinen sanften, freundlichen Wesen des Sängers selbst.
Unbeobachtet oder wenigstens vollster Sicherheit sich bewußt, hüpft der zusammengehörende Haufe unablässig über und zwischen bemoosten Felsstücken umher, dabei beständig freundliche Locktöne ausstoßend und allmählich vorwärts rückend. Währenddem ergreift der Schnabel bald ein Kerbthier, bald ein Samenkörnchen, bald ein Würmchen, bald eine Beere; denn der Flüelerche ist fast alles recht, was nicht zu hart oder zu wehrfähig erscheint. So lange sie in den höheren Gebirgen auszuhalten vermag, d. h. so lange nicht Schneemassen den Boden allzudick überschütten, verläßt sie ihren Stand nicht, weicht aber natürlich der Tiefe zu, sobald jene die kalte Hand auf ihre Futterquelle legen. Im Winter kommt sie bis in die Bergdörfer herunter, geht dann mit der Steinkrähe und den Schneefinken den Spuren der Pferde auf den Landstraßen nach oder erscheint selbst zwischen den stillen Hütten der Aelpler.
In günstigen Sommern brütet auch der Alpenflüevogel zweimal; denn man findet sehr frühzeitig und noch zu Ende des Juli Eier im Neste. Letzteres wird in Steinritzen und Löchern unter Felsblöcken oder in dichten Alpenrosenbüschen, immer aber auf gedeckten und versteckten Plätzen, aus Erdmoos und Grashalmen erbaut und innen mit dem feinsten Moose oder mit Wolle, Pferde- und Kuhhaaren zierlich ausgelegt. Die vier bis sechs länglichen, glattschaligen, blaugrünen Eier unterscheiden sich von denen der Heckenbraunelle nur durch die Größe: ihr Längsdurchmesser beträgt vierunddreißig, ihr Querdurchmesser siebzehn Millimeter.
Gefangene Alpenflüevögel gewöhnen sich leicht ein, werden außerordentlich zahm, dauern bei geeigneter Pflege einige Jahre im Käfige aus und erfreuen durch ihren angenehmen, sanften Gesang und die Unermüdlichkeit, mit welcher sie ihr einfaches Lied vortragen.