
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Von Walther Kopp
Nach dem Plan Alfred Wegeners sollte die Oststation im Innern des auf 71 Grad Nord gelegenen Scoresby-Sunds aufgebaut werden. Sie war von den übrigen Teilen der Expedition vollkommen getrennt Wir konnten erst Anfang Juli abreisen, da des Eises wegen mit Scoresby-Sund nur einmal im Jahr, im Hochsommer, eine Schiffsverbindung möglich ist.

Aufnahme Oststation. Dr. Walther Kopp, Leiter der Oststation.
Unsere Aufgabe war rein meteorologisch und aerologisch. Es galt, die klimatologischen Verhältnisse am Ostrand des Inlandeises in Meereshöhe ein Jahr lang zu beobachten und durch Instrumente aufzeichnen zu lassen, sowie die Eigenschaften des Luftmeers über Grönland mit Hilfe von Drachen und Ballonen zu untersuchen.
Die Station sollte aus drei Mann bestehen. Alfred Wegener hatte mich mit der Leitung betraut, da ich aus meiner langjährigen Tätigkeit am Aeronautischen Observatorium Lindenberg und an seiner wissenschaftlichen Höhenflugstelle mit solchen Arbeiten vertraut war.
Bei der Auswahl der beiden andern Mitglieder verfuhr ich nach dem Gesichtspunkt, noch einen Mann zu bekommen, der in technischen Dingen, wie Motorenbehandlung, zu Hause war, und einen, der sich um die vielen kleinen Ausgaben kümmern konnte, die eine Expedition mit sich bringt, die in ihrer Gesamtheit aber eine recht wesentliche Rolle spielen. Es handelt sich hier um medizinische, photographische, küchentechnische und sonstige Dinge.
Meine Wahl fiel auf cand. ing. Ernsting aus Darmstadt und den Kieler Zoologen Dr. Peters. Die Notgemeinschaft schickte beide vor Antritt der Expedition noch einige Zeit nach Lindenberg, damit sie sich die Grundbegriffe für unsere meteorologische Arbeit erwerben konnten. Keiner von uns dreien hatte bisher arktische Erfahrung, wir waren auf die Literatur, vor allen Dingen aber auch auf die Ratschläge Alfred Wegeners angewiesen. In diesem Punkte aber beruhigte er uns und betonte, die Hauptsache für eine solche Fahrt sei viel Geduld, gesunder Menschenverstand und eine ordentliche Portion Glück. Lebensmittel und Kleidung besorgte uns Wegener vor seiner Abreise im April noch selbst, so daß für mich nur der größte Teil der wissenschaftlichen Ausrüstung blieb.

Kartographische Anstalt von F. A. Brockhaus. Die Umgebung der Oststation im Scoresby-Sund.
Vom 1. bis 10. Juli trafen wir in Kopenhagen die letzten Vorbereitungen, machten die letzten Einkäufe und durften die Erinnerung an einige schöne Stunden im gastfreundlichen Haus des deutschen Gesandten, des Freiherrn Richthofen, mit auf die Reise in die Arktis nehmen.
Am Morgen des 10. Juli verlassen wir an Bord des kleinen Grönlandfahrers »Gertrud Rask« Kopenhagen. Zum erstenmal können wir aufatmen nach all dem Trubel der Besprechungen, Sitzungen, Vorbereitungen, Berechnungen und können uns so ganz den bekannten Genüssen einer Seereise hingeben, bis der Sturm im Kattegat das 400-Tonnen-Schiffchen zu so lebhaften Kundgebungen veranlaßt, daß wir uns sehnlichst von ihm herunterwünschen. Wie oft schleichen wir in diesen Tagen zwischen unsern Benzindunken, dem Motorboot und Lastprahm, die auf dem Vorderdeck verstaut sind, herum, im Anblick dieser Gegenstände immer wieder die Unterhaltung mit den Worten beginnend: »Ja, wenn wir erst –«
Das Wetter bessert sich, und am 18. Juli kommen in der Ferne die blauen Berge Grönlands in Sicht. Schon am Tage vorher war es merklich kälter geworden. Alken, Lummen und Eissturmvögel waren aufgetaucht. Am Abend sind wir mitten im Packeisgürtel. Eis und Mitternachtsonne üben zum erstenmal ihren Zauber auf uns aus. Mühsam ist jetzt die Fahrt. Jede Scholle auf dem Weg muß von dem Schiff entweder sachte beiseitegeschoben oder zertrümmert werden. An Schlaf ist dabei nicht zu denken, und alles ist auch voller Erwartung, ob wir bald durchkommen werden, denn es kommt an der Ostküste Grönlands vor, daß die Schiffe monatelang im Eis festliegen.
Wir haben Glück, am 19. schon ist das Fahrwasser besser. Lange Strecken freien Wassers liegen vor uns, und rasch nähern wir uns einer großartigen Szenerie von hohen Bergen mit tiefen Einschnitten und weißen Gletschern. Auf »Gertrud Rask« fährt der dänische Kriegskapitän Bistrup mit. Viel erzählt er uns über die Tücken des Eises. Wir sind ihm dankbar für die Mitteilung seiner Erfahrungen, denn auf den langen Motorbootsreisen, die wir vorhaben, werden wir sie brauchen. Da kommen wir jetzt in den Sund; langsam fährt das Schiff um Kap Tobin, die vorher so einsam daliegende Landschaft belebt sich. Kleine braune Männer tauchen hinter den Eisschollen mit ihren Kajaks auf, hastig paddeln sie auf das Schiff los, jeder will der erste sein. Ihre Kenntnisse über die augenblicklichen Eisverhältnisse sind gut zu verwerten. Auch an Land wird's lebendig. Hunde rennen den Steilhang herab, hinterdrein eine lärmende Kinderschar und zuletzt Frauen in bunter Tracht. Ganz oben auf dem Berg um den Danebrog geschart liegen kleine, unscheinbare Hüttchen, die Wohnungen der Grönländer. Kap Tobin ist eine Außenstelle der Kolonie, die selbst in der ersten größeren Bucht des Sundes liegt. Es ist großer Festtag für die Grönländer, nur einmal im Jahr kommt ja das Schiff.
Wir aber müssen Geduld haben, denn, wie die Grönländer schon mitgeteilt haben, in der Bucht liegt noch festes Wintereis. Wir müssen am Eisrand zwölf Kilometer vor der Kolonie ankern, nachdem mit viel Lärm und Getöse versucht worden war, mit dem Schiff eine Gasse zu stampfen. Wann wird das Eis weggehen? Vielleicht heute nacht schon, vielleicht morgen, vielleicht in vier Wochen, vielleicht überhaupt nicht. Vielleicht, dies ist das Wort von allgemeinster Gültigkeit, »imera« sagt der Grönländer, und er sagt's als Antwort auf fast jede Frage, darum kennt er auch keine Überraschungen und bleibt in den tollsten Lagen ruhig. Wenn man in der Arktis reist, tut man gut daran, es ebenso zu machen.
Sonntag, den 20. Juli. Das Eis rührt sich nicht. Aber es herrscht Festfreude, schließlich sind wir ja fast am Ziel. Festessen und Festkleidung erhöhen die Stimmung. Der Kapitän erlaubt einen Ausflug an Land. Vor zehn Tagen noch in hochsommerlicher Hitze, stapfen wir jetzt durch Eis, Schnee und Geröll nach Kap Tobin, das dem Schiff am nächsten liegt. Der äußerliche Eindruck kann bei einem südländischen Bild nicht bunter sein. Klarer, heller Himmel, tiefdunkles Meer mit glitzernden Eisschollen, steile, hochragende Felsengebirge im Hintergrund. In der Nähe schwarze Grönländerhäuschen, zwischen rötlichem Gestein hier und da Polarblumen im grünen Heidekraut, dazwischen weiße Hunde, braune, lachende Menschen, die Männer im weißen Anorak, die Frauen und Kinder in buntesten Farben, reich gestickten Fellhosen und bunten Jacken, über dem Ganzen strahlende arktische Sonne. Wir sind wieder auf dem Schiff. Der Kapitän brummt, weil wir keine Waffen mitgenommen hatten. Mein Gott, wer denkt am ersten Tag schon an Eisbären? Aber tatsächlich, wo wir eben noch waren, läuft so ein Tier, hinter ihm her ein Hund und ganz weit hinten zwei Mann. Am nächsten Tag schon trocknet sein Fell ausgespannt an der Sonne.
21. Juli. Das Eis liegt fest, aber der Tag bringt eine wichtige Entscheidung für den weiteren Verlauf der Expedition. Der Kolonievorsteher, wir nennen ihn mit der dänischen Amtsbezeichnung Bestyrer, kommt übers Eis aufs Schiff. Er bringt Nachrichten aus dem Innern des Sundes. Die Eisverhältnisse sind dort trostlos. Nach Wegeners Plan sollte uns das Schiff nach Hekla Havn bringen und dort unser Gut zur Weiterbeförderung mit Motorboot und Lastprahm ausladen. Diesen Plan müssen wir fallenlassen. Eine feste Eisbarriere zieht sich von Kap Stewart quer über den Scoresby-Sund bis zu den Bergen im Süden. Schweren Herzens fassen wir den Entschluß, alles Gepäck an der Kolonie auszuladen.

Aufnahme Oststation. Zeltlager bei der Kolonie 1930. Von links nach rechts: Peters, Kopp, Ernsting.
1 Uhr nachts, es sieht nach Wind aus. Der Steuermann glaubt's nicht, aber wozu sind wir schließlich Meteorologen! Der Wind kommt, und dann geht alles sehr schnell. Die ganze Eisfläche treibt in einem Stück aus der Bucht. Um 6 Uhr liegen wir vertäut im Hafen. Mit Motorboot und Prahm werden unsere Kisten ans Ufer geschafft und auf Hundeschlitten den Steilhang hinauf befördert, ein Gaudium für alle. Am Packhaus der Kolonie entsteht ein wirrer Haufen, dem wir unter dem Schlachtruf: Hie Kolonie, hie Expedition! zu Leibe gehen, damit wir einen Überblick bekommen, was alles uns gehört, was wir alles auf dem kleinen Motorboot und Lastkahn in den Fjord befördern sollen. Es ist ungeheuer viel, vier Fahrten gibt's mindestens.
Bei strömendem Regen bauen wir am 24. Juli drei Zelte auf, die uns beherbergen sollen, bis das Eis im Fjord aufbricht. Jeden Tag will die »Gertrud Rask« abfahren, immer wieder ist zuviel Eis. Die Tage, und es ist immer Tag, vergehen mit Auspacken, Ordnen, Motorennachsehen. Man arbeitet, bis man müde ist, schläft, arbeitet wieder, ob es nun Mitternacht, Morgen oder Abend ist.
Am 28. Juli sticht die »Gertrud Rask« in See, und nun sitzen wir drei Mann da mit einem Riesengepäck. Ein paar Dutzend große Petroleumfässer und Benzindunken, zwei Häuser, sechs Motoren, eine elend schwere Drachenwinde, Funkeinrichtung, Batterien, Instrumente, ganze Stapel Lebensmittelkisten, schwere Kisten mit 60 Kilometer Stahldraht, 50 Wasserstoffgasflaschen, von denen jede einzelne schon von zwei Mann bewegt werden will, dazu noch hunderterlei Kleinkram. Wir sitzen da und warten auf Besserung der Eisverhältnisse, und das ist ein ziemlich trostloses Warten.
Wenn nur das Eis erst aufginge, der Transport macht uns jetzt weniger Sorgen, denn Kapitän Petersen hat leihweise das Schiffsmotorboot zurückgelassen. Einen weiteren Lastkahn können wir in der Kolonie leihen. In ein bis zwei Fahrten können wir das Notwendigste zum Arbeiten und Leben schon wegbringen. Die Kenner der Verhältnisse raten uns, in der Kolonie zu bleiben. Das ist ja zweifellos verlockend. Hier sind hilfsbereite Menschen. Wir hätten keine Transportschwierigkeiten, könnten gleich anfangen zu arbeiten und, warum soll man's leugnen, uns auch manchmal an einen gedeckten Tisch setzen. An und für sich hätte man das Hierbleiben schon verantworten können. Ader nur nicht weich werden, unsere Aufgabe liegt im Innern des Fjords. Wir werden's noch nicht aufgeben, sondern warten und mal einen vorläufigen Plan aufstellen. Zunächst bauen wir die Aerologische Station provisorisch auf und fangen mit der Arbeit an. Für den späteren Abtransport werden die nötigen Instrumente und das Allernotwendigste an Betriebs- und Heizstoffen sowie Lebensmitteln (wir hoffen auf Jagd) bereitgestellt.
Möglichst oft werden Motorbootfahrten zur Erkundung der Eisverhältnisse ausgeführt, um ja die erste Reisemöglichkeit auszunutzen. Diese Fahrten dienen auch dazu, den 5-PS-Glühkopfpetroleummotoren der Motorboote »Johann« und »Klaus« auf den Zahn zu fühlen, denn sie sind in einem erbärmlichen Zustand. Die erste Erkundungsfahrt ist ein Mißerfolg. Eben noch in einem offenen Kanal, sind wir in den nächsten Minuten schon fest vom Eis eingekeilt, das als große Fläche langsam aber sicher der Fjordmündung zutreibt. Zwei volle Stunden müssen wir angestrengt arbeiten, denn das Schicksal mit einem kleinen Boot mit unzuverlässigem Motor auf dem offenen Meer ist ziemlich eindeutig.
Die nächsten Fahrten machen wir in dem offenen Prahm mit Außenbordbenzinmotor. Wir verlieren nicht soviel Zeit damit, der Motor braucht nicht angeheizt zu werden, er springt sofort an und läuft vorzüglich. Man wagt es kaum zu glauben, aber die Eisverhältnisse scheinen wirklich etwas besser zu werden, man kann schon recht weit hinausfahren.
Auch der Bau des kleinen Maschinenhauses für die Motorwinde schreitet fort. Auf einem kleinen Berg soll es stehen, denn beim Drachenbetrieb kann es zu leicht zu Zusammenstößen mit Menschen, Tieren und Gebäuden kommen, drum weg von den Häusern. Der Weg vom Lagerplatz dort hinauf führt über eine Geröllhalde, Schnee und wieder Geröll. Das ist mühsam, die schwersten Stücke unserer Ausrüstung müssen hinauf. Für die Bauarbeiten haben wir zwei junge Grönländer als Hilfe gemietet, die älteren Männer arbeiten in der Kolonie oder sind auf Fang. Unsere beiden haben wohl erst knapp die Flegeljahre hinter sich, das gibt's in Grönland auch. Solange die Arbeit leicht ist und es Zigarren gibt und viel Neues zu sehen ist, geht's gut. Die schweren Stücke, Windentrommel und Opelmotor, guckten sie aber nur an, dann ist erst mal Feierabend. Solange wir kein Grönländisch können und es immer Tag ist, kann man schlecht etwas gegen diese Zeiteinteilung sagen, aber der Fall liegt bald klar, um die saftigen Arbeitsstücke machten die Jünglinge grundsätzlich einen großen Bogen. Da müssen wir denn allein dran, eine Tragbahre, vorn Ernsting, hinten ich, der Opel drauf festgeschnürt und los. Sind Sie schon einmal mit einem ausgewachsenen Automotor auf weglosem, steilem, alpinem Untergrund spaziert? In Bayern nennt man so was eine Viecherei, aber sie bringt uns vorwärts, das ist die Hauptsache.
Am nächsten Tag gibt's eine kleine Aufregung. Ein kleines norwegisches Motorschiff liegt im Hafen, und in Gestalt eines Rumänen, Professor Dumbrave, und eines Amerikaners betritt die zweite rumänische Grönlandexpedition das Land. Es ist etwas faul bei der Sache, ich glaube, es besteht ein Verbot für die Leute, im Scoresby-Sund zu bleiben. Nun, es geht uns ja nichts an, aber wir fühlen uns doch schon etwas als eingesessene Scoresbysunder, und beim Mittagessen vorm Zelt wird der Fall leicht lokalpatriotisch gefärbt diskutiert. Das erwähnte Verbot brachte uns im September noch einen Schiffsbesuch: das dänische Inspektionsschiff »Godthaab«, das von uns Post und die zweite rumänische Expedition mit nach Hause nahm, sie so vor den Schrecken des Polarwinters bewahrend.
Die nächsten Tage vergehen in gleichförmiger Arbeit. Mit Ernsting arbeite ich an der Montage des Motors und der Drachenwinde, Peters besorgt die Küche, später fahren Peters und ich dann meistens noch mit dem Prahm auf Erkundung, während Ernsting sich liebevoll mit dem Bootsmotor abgibt. Immerhin bietet Grönland auch in diesen Tagen uns Laien mancherlei Neues. Unter anderm auch ein Schlachtfest. Ein dicker alter Walroßbulle liegt, durchbohrt von einer Grönländerharpune, die mächtigen Hauer kläglich in die Luft gestreckt, am Strand der Walroß-Bucht. Gleich sind die Frauen mit einem großen Topf da, und über dem offenen Feuer aus Heidekraut geht das Kochen los. Viel Volk steht drum herum, und kaum gar, wird das Fleisch verschlungen, dazwischen sausen schreiend und beißend, den Vorderkörper ganz mit Blut beschmiert, die Köter herum. Immer gehören zu einem solchen Bild noch die gierig und aufgeregt herabschießenden Möwen.
Die Vorbereitungen für die aerologische Arbeit sind jetzt so weit vorgeschritten, daß wir die ersten Aufstiege beginnen können. Die Maschinerie arbeitet einwandfrei, und jetzt sind wir dran, den Grönländern etwas Neues zu bieten. Ein Motor, bei dem man nur auf den Knopf drückt, und da läuft er, so was haben sie noch nicht gesehen. Und die Ballone erst! Solche Szenen mögen sich unter den Zuschauern zu Anfang der Luftfahrt abgespielt haben.
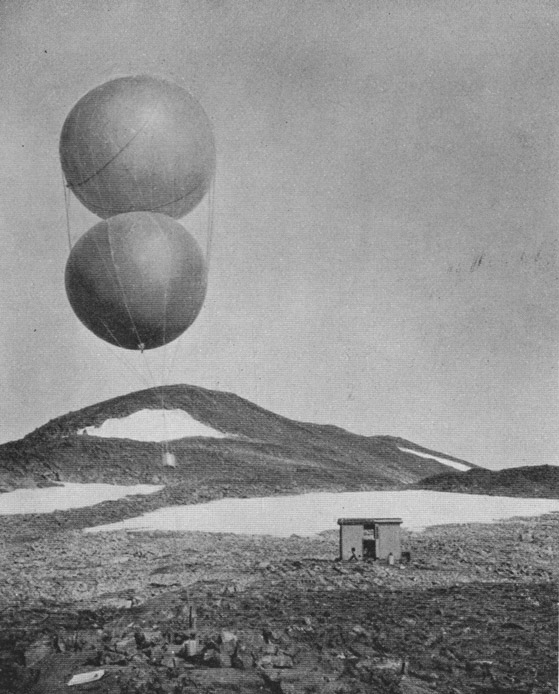
Aufnahme Oststation. Ballonaufstieg bei der Kolonie.
Es ist fast nie Wind, und wir benutzen nur Ballone. Zwei kleine Gummiballone in einem Netz an 0,4-Millimeter-Draht steigen auf und werden mit Motor und Winde wieder heruntergeholt. So gelingt es, bis 4000 Meter Höhe Temperatur, Luftdruck und Feuchtigkeit Luft über Grönland im Hochsommer zu bestimmen. Es kommen aber auch wieder Tage, an denen alles schief geht. So der 13. August; beim Aufstieg Nummer l3 reißt in 1300 Meter Höhe das Netz – in dieser Höhe begann viel Wind –, beide Ballone machen sich selbständig, das Instrument fällt mit zwei Kilometer Draht ins Meer. Natürlich fahren wir gleich mit dem Prahm am Draht entlang hinterher, aber dieser verschwindet unter einem kleinen Eisberg, und alle Mühe ist vergebens. Kleinere Ereignisse an diesem Tag, daß der Theodolit kaputt geht, ebenso ein Psychrometer und schließlich auch der vielgelobte Prahmmotor bei einem Zusammenstoß mit dem Eis, können uns schon gar nicht mehr aufregen. Wir bessern aus und lernen dabei. Hoffentlich, hoffentlich können wir die jetzt gemachten Erfahrungen noch im Innern des Sundes verwerten. Ist eigentlich überhaupt noch Hoffnung? Nachts friert es schon ganz ordentlich, und leichtes Neueis ist jeden Morgen auf dem Wasser, wenn alles still war. Vielleicht sollten wir doch hierbleiben.

Aufnahme Oststation. Erkundungsfahrten.
Der Versucher naht auch wieder in Gestalt des Kolonievorstehers. Wir bewohnen jetzt in seinem Haus eine Stube, die Zelte waren uns nämlich vor kurzem durch den Föhn zusammengerissen worden. Manchen interessanten und nahrhaften Abend verleben wir bei ihm und seiner Frau. Um wieviel besser lernen wir Land und Leute aus den Erzählungen Bestyrer Hoeghs kennen! Bald können wir uns mit ihm dänisch unterhalten und mit seiner Frau, einer Grönländerin, grönländisch. Ich finde überhaupt, unsere Erfahrung wächst so, daß es ein Jammer wäre, wenn wir nicht weiter kämen. Hoegh schüttelt lachend den Kopf, als ich ihm erkläre, daß wir noch nicht aufgeben. Wenn auch überall Eis liegt, so weit die Außenstellen der Kolonie reichen, so wollen wir doch auch noch feststellen, was dahinter liegt. Wir rüsten also zu einer mehrtägigen Reise mit dem größten Motorboot »Johann«. Am 14. August geht's los, zum Gruß wehen die Flaggen der Kolonie. Der Motor spuckt und faucht, aber er läuft. Verhältnismäßig schnell erreichen wir trotz Eis Kap Hope, dort wohnen drei Grönländerfamilien, die sich über die Abwechslung freuen. Zwischen Kap Hope und der nächsten Ansiedlung Kap Stewart liegt wieder eine sehr dichte Eisbarriere. Aber wir haben schon Übung und wissen, um diese Scholle fährt man besser herum, jene kann man ruhig anrempeln oder diese beiden mit Vollgas auseinanderdrücken. Nach acht Stunden haben wir 25 Kilometer zurückgelegt, und in Kap Stewart gibt's Seehundbraten und eine unruhige, kühle Nacht ohne Schlaf aus einer Sandbank, auf die wir aufgelaufen sind.

Aufnahme Oststation. Zwischen Kolonie und Kap Hooker.
Von Kap Hope bis Kap Stewart ändert sich das Landschaftsbild entscheidend. Von der Kolonie bis Kap Hope steigen fast unmittelbar vom Ufer die Berge auf 500 bis 1000 Meter an, und das Innere des Landes ist von tiefen Schluchten und steilen Höhenrücken durchzogen. Westlich von Kap Hope, zwischen diesem und Kap Stewart, liegt der Hurry Inlet, und bei Kap Stewart beginnt das Jameson-Land. In seinem östlichen Teil steigt es unmittelbar von der Küste bis zu 150 Meter an, dann senkt sich das von vielen kleinen Flüssen durchzogene Plateau nach Westen hin bis auf 50 Meter herab. Hier gibt es keine Felsmassive und Geröllfelder mehr. Eine weite, blühende und grüne Fläche hat man vor sich. Polarweiden, Heidekraut, Anemonen und eine Menge anderer arktischer Pflanzen bedecken den Boden. Viele Insekten, selbst Schmetterlinge und Bienen, tummeln sich in der durch den Boden erwärmten Luft. Infolge der starken Sonnenstrahlung beträgt die Bodentemperatur 30 bis 40 Grad. Ganz wunderschön ist das Land, man muß sich einmal hinlegen auf den grünen Teppich, und dann duftet es und summt und ist so warm wie zu Hause im Frühling. Eins steht fest: Wenn wir nicht ins Innere des Scoresby-Sundes kommen, so müssen wir wenigstens aufs Jameson-Land gehen, die Arbeitsmöglichkeiten sind sicher besser als in dem gebirgigen Gelände der Kolonie.

Aufnahme Oststation. Flußmündung im Jameson-Land bei Kap Stewart.
Zunächst fahren wir weiter, an der immer flacher werdenden Küste des Jameson-Landes entlang. Von der Höhe Kap Stewarts aus haben wir schon eine weite Eisbarriere im Westen gesehen. Diese erreichen wir bald. Wir können sie, wenn auch mühsam, durchbrechen. Mit schwerbeladenem Boot und Anhänger wäre es vielleicht kaum möglich gewesen. Jetzt wird das Fahrwasser besser, schnell besser sogar, bald kommen wir nur noch an einzelnen Schollen vorbei, die Zahl der großen Eisberge nimmt dafür immer zu. Allerdings liegen diese so weit auseinander, daß sie keine Gefahr für unsern Schiffsverkehr bilden werden. Der Weg ins Innere ist frei!
Jetzt nach Hause zur Kolonie und die Transporte vorbereitet. Bisher waren wir auf der Fahrt noch nicht zum Schlafen gekommen. Der Motor geht aber jetzt so gleichmäßig, und die Fahrt ist so glatt, daß ich Ernsting und Peters in die Koje schicke; in vier Stunden soll mich dann Ernsting an Steuer und Motor ablösen. Ich freue mich auf die einsame Fahrt, es ist prachtvolles Wetter. In tiefschwarzen niedrigen Wellen zieht das Jameson-Land vorbei, durch einen schmalen hellen Streifen Sand vom Meer getrennt. Einmal belebt sich der Strand, große dunkle Schatten huschen vorüber, Moschusochsen. Fast ohne Bewegung liegt das Meer im Widerschein des durch die Dämmerung bläulichgrün gefärbten Nachthimmels. Klar zeichnen sich gegen diesen fahlen Himmel die Umrisse der hohen, zackigen Berge im Süden. Die großen Eisschollen, die Gott sei Dank nur selten auf dem Weg liegen, tauchen plötzlich und gespenstisch auf dem gleichfarbigen Wasser auf und verschwinden ebenso schnell wieder. Man merkt sie eigentlich immer erst, wenn die Bahn des Mondlichts auf dem Wasser sich verbreitert und verzerrt. Manchmal kann man auch nicht mehr schnell genug wenden, und mit lautem Krach streift die Eiskante das Boot, was meist einen dumpfen Kraftausdruck aus Ernstings Koje zur Folge hat. Da fällt mir wieder ein Abenteuer von heute mittag ein, das leicht hätte schief ausgehen können. Mit einem Klepperfaltboot, das wir immer aufgebaut, sozusagen als Rettungsboot auf dem »Johann« haben, war ich losgefahren, um nach Enten zu jagen. Ich war an einem kleinen Eisberg vorbeigekommen, als ich mich ohne ersichtlichen Grund in einer eigentümlich sanften, aber eindringlichen Weise über die Landschaft hinausgehoben fühlte. Eine Riesenwoge rollte unter dem Boot her, ließ es knallend zurückfallen, und dann brach ein tolles Getöse hinter mir los. Der Eisberg hatte sich umgedreht und war in kleine Teile zerborsten. In Zukunft werden wir große Bogen um die harmlos aussehenden Gebilde machen.
Als wir uns der Eisbarriere nähern, ist's wieder heller Tag, wir sind bald wieder am Kap Stewart. Ernsting kommt, mich abzulösen. Der Motor war in der letzten Stunde schon unregelmäßig, nun setzt er öfters aus, und jetzt ein lauter Knall! Die Dichtung des Kühlwassermantels fliegt an einer Stelle heraus, gerade als wir wieder mal auf einer Sandbank sitzen. Na, da sitzen wir gut, morgens um ½6. Ein Versuch, das Loch mit Holz zu verkeilen, schlägt fehl und endet damit, daß mir eine ordentliche Ladung Dreck und Dampf ins Gesicht fliegt. Klingerit zur Herstellung einer neuen Dichtung fehlt. Die Verlegenheit ist doch recht groß, und wie das bei Verlegenheiten so geht, wird jetzt erst mal gefrühstückt mit heißem Tee. Das belebt die Geister und führt zu der Idee, aus meinem Wethmann-Aquarellpapier in vielfachen Lagen Dichtungen zu schneiden. Es glückt, nach drei Stunden läuft der Motor besser als je zuvor. Nur einmal werden wir noch aufgehalten. Eine riesige Fläche Schollen hatte sich vom Außenmeer bis Kap Hope vorgeschoben und versperrte den Weg zur Kolonie. Eine Strecke, zu der mir vor ein paar Tagen eine halbe Stunde brauchten, fahren wir heute in sieben Stunden. Manchmal geht's in dem Irrgarten eine Stunde ganz gut vorwärts, nur um festzustellen, daß es keinen Durchgang gibt. Dazu ist es trübe geworden, der Abend naht, vor uns das offene Meer, der Motor unsicher, nein, der Abschluß der Fahrt schön, um so schöner schließlich die glückliche Landung und die Gewißheit, was jetzt zu tun ist. Vor dem Innern des Fjords brauchen wir keine Angst zu haben, müssen uns nur beeilen wegen des Neueises. Erfassen wir günstige Eisverhältnisse in der Nähe der Kolonie, und die wechseln Gott sei Dank schnell, so muß der Transport glücken. Die Boote sind vertäut, die drei acht- bis zwölfjährigen Bengels des Bestyrers, die in praktischen Dingen weit über europäische Verhältnisse hinaus fix sind wie alle Grönländerkinder, halfen dabei.
Wir haben keine Zeit zu verlieren, wenn wir die Vorbereitungen und Transportfahrten noch vor ernstlichem Neueis beendet haben wollen. Drei Grönländer mieten wir durch Vermittlung des Bestyrers als Hilfskräfte. Diesmal keine Jungens, sondern die tüchtigsten Fänger der Kolonie, Josua, Manasse und Hans, sie sind getauft, daher die Namen.

Aufnahme Oststation. Manasse Arkit mit einem Teil seiner Familie.
Josua ist ein ernster Mann, auf den man absolut rechnen kann, eine durchaus vornehme Natur, interessiert für alles, was seine Heimat angeht, er hat etwas von einem Forscher und war auch schon bei früheren Expeditionen als Begleiter beliebt.
Manasse hat ebensoviel technische Fertigkeiten wie Mutterwitz. Kleine Schäden weiß er immer auszubessern, und auf jeden Spaß geht er ein. Aber alles kann er auch brauchen und deutet mit einem fragenden Blick auf einen Gegenstand, von dem er glaubt, daß wir ihn nicht benötigen, und dann auf sich.
Hans ist noch jung, er singt seine Kirchenlieder zur Unterhaltung und kann lachen, daß ihm die Tränen nur so über die Backen laufen. Sich die schwersten Gepäckstücke zu suchen, gehört aber auch zu seinem Vergnügen. Sehr schätzbar ist eine Eigenschaft von ihm, daß er schnell Sprachen lernt und seine eigene lehren kann. Kostbar ist es, als er schon nach kurzer Zeit die trockene Bemerkung »sehr gut« macht, wenn wir etwas tun, was ihm gefällt.
Am 22. August ist die ganze aerologische Einrichtung wieder abgebaut und auf den »Johann« verladen. Sein Laderaum faßt die schwere Winde, den Opelmotor, sechs Benzindunken zu 100 Liter, ein Faß Öl, sechs Proviantkisten, den gesamten Drachendraht. Er liegt aber auch bis zum oberen Blechrand im Wasser. Übrigens bin ich gezwungen, von heute ab eine gewisse Küchendiktatur einzuführen, die Lebensmittel sind nicht so reichlich, daß wir weiterhin aus dem Vollen schöpfen können.
Am 23. können wir nicht weiter arbeiten. Es herrscht verheerendes Regenwetter, auch ein unangenehm bockiger Wind macht sich auf, und die Dünung ist beängstigend. Die Motorboote liegen etwa 30 Meter vom Ufer ab. Sie sind verankert und außerdem einzeln mit einem neuen, dicken Manilahanftau am Ufer befestigt. In der Nähe des Ufers wären sie bei ihrer schweren Ladung vielleicht zerschellt. Denn der Prahm, der am Ufer seiner Ladung harrt, wird von der Dünung bei jedem Gang krachend gegen den Fels geworfen und splittert schon. Die Windgeschwindigkeit klettert auf 35 Metersekunden. Unsere Aufmerksamkeit wird jetzt vom Meer abgelenkt, die Zeltstangen knicken unter dem Winddruck einfach zusammen, ein Hausteil fliegt vom Stapel in hohem Bogen ins Meer, auch die Zelte drohen einfach wegzufliegen. Alles muß mit Steinen beschwert werden. Der Sturm hat sich jetzt so gesteigert, daß das Wasser von der Meeresoberfläche aufgejagt und fein zerstäubt wird und dann wie Nebel davonjagt. Eben freuen wir uns noch, daß das Eis mit rasender Schnelligkeit aus dem Sund triftet, als wir auch schon mit starrem Entsetzen sehen, wie das kleine Motorboot »Klaus« sich mehr und mehr vom Ufer entfernt. Das Tau ist durchgerissen. Anfangs findet der Anker noch zeitweise Widerstand, dann wird das Wasser zu tief. Das Boot verschwindet schaukelnd hinter dem aufgewirbelten Wasserstaub. Wir müssen es verloren geben; wenn es auch nicht gleich voll Wasser läuft oder vom Eis zerbrochen wird, so ist doch die Wahrscheinlichkeit, daß es vom Sturm aufs offene Meer getrieben wird, sehr groß. Das ist um 3.30 Uhr mittags. Alle Aufmerksamkeit wendet sich jetzt dem »Johann« zu.
Eine halbe Stunde später: Die Hoffnung, daß sich der Sturm nach der besonders schweren Bö etwas legt, um zum »Johann« fahren zu können erfüllt sich nicht. Trotzdem machen wir ein zweites Tau bereit, wir müssen alles einsetzen, die wichtigste Habe ist auf diesem Boot. Zu spät! Von einer riesigen Welle hochgehoben, fällt das Boot zurück. Ungeheuer muß die Wucht der schweren Masse sein, da kann kein Tau standhalten. Lähmende, ratlose Stille. Langsam, mit sich neigendem Mast, entschwindet das zweite Boot. Jetzt nachfahren, wäre gröbster Leichtsinn. Und doch hätten wir's bei der herrschenden Stimmung getan, wenn wir uns auf den Motor hätten verlassen können. Sturm und Brandung sind jetzt fürchterlich. Tiefhängende, dunkle Wolken und Regenschauer nehmen jede Sicht. Wäre das Boot vor unsern Augen geborsten und gesunken, es wäre nicht so schlimm gewesen, wir hätten schon Mittel und Wege gefunden, das Notwendigste wieder heraufzuholen. Aber wie es so langsam abtrieb, ohne daß wir etwas tun konnten, das war zum Verrücktwerden. Unter eifrigster Mithilfe des Kolonievorstehers, seiner Grönländer und des Pastors ist jetzt das restliche Material gesichert. Es vergehen zwei Stunden. Alles ist natürlich sehr niedergeschlagen, der Bestyrer gibt die Hoffnung noch nicht auf. Denn früher war der »Johann« mit Lauge Koch schon einmal im Scoresby-Sund und riß auch ab im Sturm und wurde nachher wiedergefunden. Wirklich ist gegen 6 Uhr wieder Hoffnung. Josua, der treue Kerl, hat die ganze Zeit mit dem Fernglas die Wasserfläche abgesucht und, als es etwas lichter wurde, den Mast des »Johann« weit draußen im Eis entdeckt. Freudestrahlend kommt er an, und da es jetzt etwas ruhiger ist (meteorologisch gesprochen aber immer noch voller Orkan), wollen wir noch einen Versuch machen, mit Prahm und Außenbordmotor hinauszufahren. Hendrik Hoegh will mit. Wir haben schon Gasflaschen in dem Prahm. Ich versuche, sie herauszuschmeißen, vier Grönländer halten das Tau des Prahms, um die Brandungsstöße auszugleichen. Drei Flaschen habe ich schon draußen, da kommt wieder ein furchtbarer Stoß, der mich samt der eineinhalb Zentner schweren Eisenflasche an die Bordwand schleudert. Und schon reißt wieder das Tau. Ein neues, es reißt. Wieder eins, es reißt. Fünfmal dasselbe Theater, wir geben's auf. Das Meer ist wieder zu, der Sturm heult stärker, der Aufenthalt im Boot wird ungemütlich. Ich springe hinaus, falle ins Wasser, kriege die Landungsbrücke zu fassen, die mit dem Vorderteil abgesunken ist. Es ist sinnlos, solange der Sturm währt, etwas zu unternehmen.
An Schlaf ist heute nicht zu denken. Was sollen wir tun? Mit einem vereinfachten Programm arbeiten? Für drei Mann gibt's immer noch genug zu tun! Aber die aerologische Arbeit! Die fällt aus. Die Winde ist weg samt dem Motor. Das wäre zu verschmerzen. Aber kein Meter Draht haben wir. Gas ist zwar da, aber alle Ballone sind weg. Gewiß, wir hätten die Ladung auf verschiedene Transporte verteilen können, aber ich hatte so eingeteilt, daß wir im äußersten Notfall auch mit einer Fahrt ausgekommen wären.
Es wird uns kaum jemand verübeln, wenn uns manchmal der Gedanke kam, wenn die »Godthaab« kommt, fahren wir nach Haus. Nun, die »Godthaab« ist weit, und der Sturm läßt nach.
Um 7 Uhr morgens kommt der Pastor, er hat den Mast des »Johann« gesehen, draußen im Eis bei Kap Tobin. Es ist jetzt still, die Sonne scheint durch die Wolken. Raus zum Prahm, den Motor angeworfen und los, denn jetzt kann nur größte Eile helfen. Jetzt kommt das Eis mit dem Boot, das an der äußersten Grenze zum offenen Meer von den Schollen festgehalten wird, zurück, wer weiß, wie es in ein paar Stunden aussieht. Nach fünf Kilometer kommen wir in einen Eistrümmerbrei, ein Krach, der Schraubenwellenzapfen ist gebrochen. Ernsting und Josua fahren mit dem Kajak weiter, ich laufe mit dem Grönländer Julius am Land entlang, vor uns ist der Bestyrer, mit seinem kleinen Boot hat er sich noch ein Stück weiter durchs Eis gewagt. Gerade sitzt er endgültig fest, da liegt ein paar Meter vor ihm, dicht am Ufer vom Eis gepreßt und geschoben, dreiviertel voll Wasser, das kleine Motorboot. Ein Mann bleibt dabei, die andern eilen weiter. Endlich, gegenüber von Kap Tobin, 200 Meter vom Ufer, liegt der »Johann«, auch im Eis, aber anscheinend unversehrt. Zwei Grönländer vom Kap Tobin arbeiten sich mit Kajaks durchs Eis und gelangen schließlich aufs Boot. Es ist gerettet. Mit Rudern und Eishaken suchen wir an Land zu kommen, was uns auch allmählich gelingt. Der Motor kommt in Gang, und in sehr mühsamer, aber glücklicher Fahrt kommen wir gegen Mittag mit allen Booten zurück. Unsern Dank dem Bestyrer und seinen Grönländern! Es fehlen eine Proviantkiste, drei Benzindunken und leider auch ein wertvoller Kompaß. Aber dies ist nichts gegen das, was drohte. Hoffen wir, daß es das Schwerste war von allem, was uns begegnet.
Mit größtem Eifer wird weiter geladen. Ernsting bemüht sich noch um den Motor des kleinen Bootes. Was zurückbleibt, wird verstaut. Der erste Schnee fällt schon, dann wieder Regen und undurchdringlicher Nebel.
Vier Boote und sechs Mann, ein Mann an jeder Maschine, ein Mann an jedem Steuer. So durchqueren wir ziemlich ungefährdet die starke Eiszone bei der Kolonie und nähern uns gegen Mittag des 30. August Kap Hope. Doch schon ereilt uns ein neues Mißgeschick. Mit einem letzten lauten Knall versagt der Motor des »Johann« endgültig den Dienst. Heiliger Bimbam, jetzt haben wir's aber satt. Darüber sind wir uns klar, bei einem so ausgeklapperten Motor hilft es nichts, einzelne neue Teile einzusetzen, mit denen die andern nicht Schritt halten können. Jetzt kommt nur eine vollständige Überholung in Frage. So wird der Sonntag und letzte Tag im August, vielleicht auch der letzte Sommertag, zu einem Arbeitstag erster Ordnung. Unter lebhafter Anteilnahme der ganzen Einwohnerschaft von Kap Hope wird der Motor von Ernsting und mir zerlegt, in Ordnung gebracht, wieder zusammengesetzt und, was die Hauptsache ist, zum Schluß auch einwandfrei zum Laufen gebracht. Darüber wird's 1. September. Die Septembergedanken drehen sich ums Neueis, jeden Morgen liegt es dichter auf dem Fjord. Und immer wieder verzögern neue Schwierigkeiten die Reise. Am nächsten Tag holt sich der Prahm vor Kap Stewart an einer Eisscholle ein Loch und sinkt mit der ganzen Hausladung. Doch er trägt nur schwimmende Ware, die unter einem großen Zeitplan verstaut ist, so daß nichts verlorengehen kann.
Während Hans und Manasse mit Speck und Seehundfell das Boot ausbessern, steige ich hinauf aufs Jameson-Land, um mir von dort aus die Eisverhältnisse für die nächste Strecke anzusehen. Besonders freudige Gedanken sind es nicht, die mir durch den Kopf gehen. Wenn die Reise so langsam weitergeht, werden wir kaum fertig mit allem, bis die Winternacht beginnt. Schon sieht man die Vorboten, das erste Nordlicht zuckt über den sternklaren Himmel. Die bedrückende Einsamkeit hier oben wird manchmal durch ein fernes Schnauben und Trampeln der Moschusochsen unterbrochen. Im fahlen Licht des scheidenden Tages liegt die Wasserfläche da. Verschwunden ist die große Eisbarriere, die wir vor 14 Tagen noch hier trafen. Wir werden morgen freie Fahrt haben, das gibt neue Hoffnung. Es geht dann auch alles gut, und wir ankern abends schon am Kap Hooker. Kurz vor dem Ankerplatz hatten wir auf dem Grat eines Hügels die riesigen Silhouetten mehrerer Moschusochsen gesehen, vielleicht konnten wir die Ochsen nun einmal näher zu Gesicht bekommen. Wir ziehen also los, Dr. Peters, der Zoologe, mit seiner Prachtkamera mit allen Schikanen, Hans, Manasse und ich. Josua, der zurückbleibt, warnt uns noch, ohne Hunde – aber wir hatten noch keine – zu nahe an die Ochsen zu gehen. Es fällt mir auf, daß unsere beiden grönländischen Begleiter, bevor sie aufbrechen, ihre Kamikker aus- und leichte Segeltuchschuhe dafür anziehen. Von der ersten Bodenwelle aus sehen wir nun jenseits eines kleinen Tales eine Herde von etwa 30 Ochsen und Kühen, der Leitstier etwas abseits nach uns zu. Wenn die Grönländer Wild sehen, werden sie toll, schon sausen sie den Abhang hinunter, durchqueren das Tal und drüben hinauf. Wir langsam hinterher, so daß wir sie bald nicht mehr sehen. Peters marschiert noch im Tal, die Prachtkamera vorm Bauch, und ich klettere gerade auf der andern Seite hinauf, als die beiden Genossen mit Johlen und Schreien zurückkommen, und zwar so schnell, daß ich gar nicht erst zum Fragen komme, was eigentlich los ist. Das zeigt sich aber umgehend von selbst, über mir auf dem Gipfel erscheint der wütende Leitstier, ordentliche Dampfwolken stößt er in die kalte Luft und stampft mit den Vorderbeinen, das ungeheure Gehörn gesenkt. Mit Steinwürfen hatten ihn die beiden bis zur Vollglut gereizt. Schießen von vorn ist sinnlos und verschlimmert sicher die Lage. Laufen und Deckung suchen war das einzig mögliche. Ich kann mich nicht entsinnen, in meinem Leben schon einmal so ein Tempo angeschlagen zu haben. Auch die Prachtkamera wendet sich in elegantem Bogen zurück, da ihr Herr den Rückweg vorzieht. Wir haben das schützende Tal wieder zwischen uns und sehen den Ochsen würdevoll zu seiner Herde zurücktraben, die sich bald im dämmernden Abend verliert. Josua schimpft seine Kollegen wegen ihrer Unvernunft, aber dann klingt der Abend noch bei einer Tasse Tee und Zigarren unter den spannenden Erzählungen grönländischer Jagdabenteuer aus. Die Grönländer sind ebenso gute Erzähler wie Schauspieler. Wir dringen weiter in das Verständnis für ihr eigenartiges Land und Leben ein, und manche mitgeteilte Erfahrung hat uns später genützt.
Bei der Weiterfahrt geht alles gut. Die Motoren laufen den ganzen Tag wie ein Uhrwerk. Schnell kommen wir vorwärts. Die Landschaft hat sich schon recht verändert. Das Jameson-Land ist flach geworden, kaum fünf Meter noch ragt es über das Meer. Der Hauptarm des Fjords nähert sich seinem Ende. Links ragt steil und blau Kap Stevenson, tiefe Einschnitte in den Gebirgen gegenüber dem Jameson-Land kennzeichnen den Gänse-Fjord und Föhn-Fjord. Schroff und unzugänglich erhebt sich vor uns das Milnes-Land mit seiner ewigen Eiskappe, dort, wo es im Süden etwas flacher wird, liegen die Danmarks Oer und Hekla Havn, unser ursprüngliches Ziel. Die Entscheidung fällt uns nicht schwer, wir fahren weiter, das Jameson-Land reizt. Aus dem Hauptarm des Fjords kommen wir jetzt heraus und in den Hall Inlet. Viele hohe Eisberge waren uns schon begegnet, aber der Blick, der sich jetzt vor unsern Augen öffnet, ist überraschend. Nicht Hunderte, sondern Tausende von riesigen Eisbergen liegen im Hall Inlet. Fast alle 50 bis 100 Meter über Wasser, also viele hundert Meter unter Wasser. Ihr Tiefgang ist unser Glück, da Jameson-Land die ersten paar hundert Meter flach in das Meer abfällt, kommen die Eisberge nur bis auf diese Entfernung an das Ufer heran, und es bleibt uns genügend Fahrwasser zwischen ihnen und dem versandeten Strand. Wie weit wir aber sicher sind, wenn ein solcher Koloß kippt, das hoffen wir nicht erfahren zu müssen, wenn wir auch damit rechnen müssen. Wundervolle Sonnentage erleben wir jetzt noch. Einmal, am 5. September, gehen wir an Land, um ein Depot für den Rückmarsch auszulegen. Der arktische Sommer zeigt noch einmal seine ganze Glut. Die weiten Tundren strömen einen herben Duft nach Kräutern und Blumen aus, Schmetterlinge und Mücken fliegen durch die Luft, als ob der Winter noch weit wäre.
In der Nacht müssen wir weit draußen, ein Kilometer vom Ufer, ankern, das hier besonders flach ist. Die Boote sind mit einem Tau verbunden und kuscheln sich in der Dunkelheit aneinander wie eine Herde Schafe. Um 2 Uhr schrilles Pfeifen von Ernstings Boot her. Der Lärm von einem umstürzenden Eisberg hat ihn aus dem Schlaf geweckt. Es muß ganz in der Nähe gewesen sein, mächtige Wellenzüge durchfurchen plötzlich das vorher spiegelglatte Wasser, und brausend tönt die Brandung vom Ufer zurück. Mit den Rudern suchen wir die Boote, so gut es geht, auseinanderzuhalten, und doch trifft sie mancher harte Stoß. In solcher Lage hilft nur abwarten und hoffen, daß es nochmal gut geht. Das tut es auch, aber mit der Ruhe ist es vorbei, und bald fahren wir weiter. Auch heute geht alles gut bis gegen Mittag. Ich war mit dem Boot »Johann« etwa zwei Kilometer voraus, als Hans zurückdeutet: »Mikikaju umiak ajopok«, »Kleines Boot kaputt.« Am Ufer steigt eine dunkle Benzinwolke auf, das verabredete Notzeichen. Wir fahren zurück und sehen die Bescherung. Das Anwerfritzel von Ernstings Motor ist zum Teufel. Das können wir so schnell nicht ausbessern, und Zeit können wir erst recht nicht verlieren. Das entscheidet. Hier wird gebaut.
Ganz in der Nähe findet sich auch eine Stelle, wo wir bis auf 20 Meter an das Ufer heranfahren können. Alles freut sich, daß das Ziel erreicht ist, die Fahrt ein Ende hat. Der Strand liegt voll schönster Versteinerungen, das Ufer steigt ziemlich steil an, aber nur bis etwa zehn Meter Höhe, dann ist das Land eben und dicht mit Heidekraut und Polarweide bewachsen. Nach etwa 300 Meter dem Innern zu senkt sich der Boden wieder zu einem scharf in die Ebene eingeschnittenen Flußtal hinunter. Klares, herrliches Süßwasser fließt dort, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Es ist fast angenehm, gar keine andere Möglichkeit mehr zu haben, als hier die Station zu gründen. Zur Feststimmung gehört ein Festessen, und das haben wir in Gestalt von einigen Gänsen, die wir unterwegs geschossen haben. Der gute Braten und einige Stunden Schlaf in der Sonne bringen alles wieder auf den Damm. Das Ausladen beginnt. Da wir bei Flut eingefahren waren, liegt der »Johann« jetzt in dem niedrigen Wasser ganz schief. Das vereinfacht die Sache. Die Benzindunke werfen wir einfach hinunter. Sie schwimmen, ein Grönländer im Kajak bindet sie alle an eine Schnur und zieht die ganze Geschichte ans Ufer. Am nächsten Tag gelingt es, fast alles auszuladen, mit den flacheren Lastkähnen können wir bis ans Ufer, so daß wir mit Wasserstiefeln alles heraustragen können. Das Schleppen haben wir jetzt so allmählich gelernt. Eineinhalb bis zwei Zentner schwere Kisten kommen einfach auf den Rücken, und los geht's. Die Lebensmittelkisten sind so merkwürdig schwer geworden. Es zeigt sich bald, warum. Beim Abladen gluckert's darin, und als wir sie anbohren, strömt das Meerwasser nur so heraus. Die Blechkisten waren unzureichend verlötet. Donner ja, das war eine schöne Bescherung. Das ausfließende Wasser schmeckt schon nach Meer, Zucker, Schokolade, Tabak, Zitronenbonbons, und später stellt sich heraus, daß der größte Teil des Inhalts ungenießbar ist, vor allem Brot, Nudeln, Schokolade und Dörrgemüse. Der bisherige Gesamtverlust beträgt Lebensmittel für rund 70 Tage. Da sind wir unbedingt auf Jagd angewiesen. Gleich am ersten Abend machen wir daher noch einen Ausflug in das Innere, um über die Möglichkeit unterrichtet zu sein. Das Ergebnis ist: Moschusochsen sind in der Nähe. Einen alten Ochsen bekommen wir auch zu Gesicht. Im Mondschein geht es wieder zurück über die weiten Heideflächen und durch steile Flußbetten. Auf Schritt und Tritt findet man Renntiergeweihe. Heute gibt es keine Renntiere mehr im Scoresby-Sund, man weiß auch nicht, wohin sie ausgewandert sind.

Aufnahme Oststation. Ein gefährlicher Geselle. Im Hintergrund das Jameson-Land.
Am 7. September wird fertig ausgeladen und wegen der Kalbungswellen alles oben auf dem Land verstaut. Es ist blendendes, wolkenloses Wetter, das müssen wir ausnützen und sofort an die Kolonie zurückfahren. Der Motor läuft langsam zwar, aber unentwegt. Es herrscht Mondschein, und wir beschließen durchzufahren. Staunend fährt man durch die ganz unwirklich geisterhafte Landschaft. Die hohen Eisberge steigen silbrig glänzend aus dem tiefdunklen Wasser, und darüber ergießt sich immer wieder der gelbgrüne Schein des Nordlichtes. Ich verstehe, daß der Grönländer sein Land und die Natur innig liebt, mehr als er wohl für gewöhnlich zeigt. Es fällt mir auf, wie andachtsvoll der junge Hans die aufgehende Sonne mit aufgehobenen Händen grüßt.
Nach einem aufregenden Kampf mit Walrossen erreichen wir schließlich unbeschadet die Kolonie mit einem kaum zu bändigenden Bedürfnis nach Ruhe. Am andern Tag finden wir Schiffsbesuch im Hafen, Kapitän Riis Cartensen mit dem Expeditionsschiff »Godthaab«. Wir bringen Post an Bord und verleben noch eine gemütliche Stunde beim Kapitän. Es bleibt uns eine freundliche Erinnerung für die Winternacht an den letzten Tag unter Menschen.
Vom 10. bis 16. September gibt es wieder neue Reisevorbereitungen, neue Schwierigkeiten. Trotzdem wir den Kolonieprahm noch einmal brauchen, also zwei Prahmkähne am »Johann« hängen, geht nur ein Drittel von dem hinein, was wir noch mitnehmen wollten. Freundlicherweise erklärt sich der Kolonievorsteher bereit, mit dem zweiten Kolonieprahm und unserm Außenbordmotor, den wir nicht mitnehmen, noch Gasflaschen, Benzin und Petroleum nach Kap Stewart zu bringen, die wir dann auf einer dritten Reise nur mit dem »Johann« abholen, im Notfall aber dort lassen. Alles in allem müssen wir mit dem, was wir jetzt haben, sparsam umgehen. Für Heizung, Kochen, Motor usw. bleiben nur 4,7 Liter Petroleum je Tag.
Die Grönländer Josua, Manasse und Hans werden die Reise nicht mehr mitmachen. Sie müssen auf Fang gehen, schon hungern ihre Hunde. In letzter Stunde gelingt es noch, zwei andere Grönländer mitzubekommen, auch ältere Männer, Frederic aus Westgrönland, der beste Fänger, und Nils, ein großer Bärenjäger und origineller Kerl. Er ist der Neffe des letzten Zauberers Angakok, und er zeigt uns noch manches aus seinen heidnischen Tagen. Außerdem führen wir diesmal noch drei Hunde mit für den Notfall, es sind gelernte Schlittenhunde.
Am 16. September können wir abfahren. Es ist ein feierlicher Augenblick, die ganze Kolonie ist auf den Beinen, nehmen wir doch für eine lange Zeit Abschied, und dazwischen liegt der grönländische Winter. Es ist wenig Eis, und wir kommen gut vorwärts; um 5 Uhr laufen wir Kap Stewart an. Die Grönländer dort hatten gerade einen Narwal harpuniert, und so bekommen wir noch Hundeproviant. Auch hier in Kap Stewart feierlicher Abschied. Drei Gewehrsalven donnern und hallen wider an den Eisbergen und Felswänden. Dreimal senken sich der Danebrog und die deutsche Flagge, und dann geht es in die Nacht hinaus. Wieder fahren wir Tag und Nacht und erreichen am 18. früh die Station. Stellenweise bereitete das Neueis schon merkliche Schwierigkeiten.

Aufnahme Oststation. Nils verläßt uns als Letzter.
An unserm Lager ist alles in Ordnung. Schnell laden wir aus, morgen kann Ernsting mit Frederic nach Kap Stewart fahren und das Depot holen. Als er fährt, grüßt ihn schon die deutsche Flagge vom Fahnenmast der Wegenerschen Oststation. Mit Peters und dem Grönländer Nils bleibe ich zurück. Wir müssen uns sofort an den Hausbau machen. Der Boden ist schon gefroren und taut tagsüber nicht mehr auf. In beschleunigtem Tempo müssen also die Planierungsarbeiten durchgeführt werden, solange es überhaupt noch geht. Es kommt eine neue Sorge, Nils hat nichts mehr zu essen, und von unserm knappen Proviant können wir nicht viel abgeben. Wir müssen also bald auf Jagd gehen. Die Arbeiten drängen, Sonntagsruhe fällt aus.
21. September 1930. Sonntag. Der Boden ist fast nicht horizontal zu kriegen, neues Erdbewegen. Ab 4 Uhr Moschusochsenjagd. Morgens wird Peters von einem Ochsen verfolgt, er schießt, aber der Ochse läuft weg. Wir finden ihn mittags eineinhalb Kilometer entfernt, 500 Meter weiter steht eine Herde von 15 Stück. Als ich in Schußweite komme, gehen die Ochsen in Angriffsstellung. Ich schieße auf ein einzelnes großes Tier aus 150 Meter Entfernung. Durch einen Schuß ins Rückenmark ist das Tier sofort tot, die Stelle müssen wir uns merken. Inzwischen hat Nils einen Seehund geschossen: Frischfleisch für viele Tage. Prachtvolles Nordlicht. Im Augenblick haben wir aber nur Sinn für Ochsenbraten und Bier.
Am 23. September. Warten auf Ernsting. Es kommt viel Neueis. Die Hausgrundlage ist fertig und mit 100-Liter-Benzindunken glattgewalzt.
24. September. Ernsting noch nicht da. Nils hat jetzt Angst und will nach Hause, wir können ihn nicht mehr halten, es ist ihm selbst auch nicht wohl zumute, jetzt allein die 150 Kilometer mit dem Kajak zurückzufahren. Mühsam krebst er durchs Neueis. Nils kommt zurück. Hurra, am Horizont taucht der »Johann« auf und kommt mit Benzin, Petroleum und Gasflaschen. Aber was hat Ernsting alles erlebt! Am Kap Stewart war ungeheure Dünung, er wurde seekrank, mußte schließlich zur Kolonie fahren und dort laden. Eine gute Leistung in der kurzen Zeit.
Nils und Frederic verlieren keine Zeit mehr, beladen die Kajaks mit Proviant und ziehen ab.
Wieder sitzen drei Mann, wie am Anfang, bei einem auch jetzt noch ansehnlichen Haufen Gepäck, aber diesmal hilft uns keiner. Es ist uns kaum zum Bewußtsein gekommen, wie schnell und immer schneller in den letzten Wochen der Sommer verging, wie mehr und mehr das Leben um uns erstarrte. Wir stehen an der Schwelle des Winters. –
Da geht's mit Feuereifer an den so lebenswichtigen Hausbau. Der Boden wird gelegt, die ersten Seitenplatten werden aufgestellt. In der Halle der Fabrik mag das alles glänzend gegangen sein. Jetzt nach der abenteuerlichen Reise sind die Einzelteile so verquollen und verbogen, daß es eine Schinderei für uns und auch für das Haus ist. Jedes Stück muß mit Hobel und Axt bearbeitet werden. –
Peters hat Rheuma im Arm, das Zeltleben ist jetzt nichts mehr, zumal wir nur Sommerschlafsäcke und keinerlei Decken mithaben. Die Ochsenfelle aber sind noch nicht trocken. Ich muß jetzt zu Tag- und Nachtarbeit zwingen, wenn auch die Kameraden von Nachtarbeit nicht viel halten. Am 30. September haben wir ein Haus und den ersten Schnee.
Es vergeht jetzt noch eine betriebsame Woche, in der die Inneneinrichtungen gebaut werden, Kojen, Öfen, Dunkelkammer, Werkstätte und Küche, außerdem stellen wir die ersten meteorologischen Registrierinstrumente auf. Draußen im Windenhaus stehen jetzt auch die Motoren, der Mast des »Johann« wird als zweiter Mast für die Antenne aufgestellt. Das Ende der Erdleitung aus Stahldraht wird, mit einem Stein beschwert, ins Meer geworfen.
Nun ist es so ziemlich fertig, unser »meteorologisches Observatorium«. Das gibt Veranlassung, endlich einmal Sonntag zu feiern, es ist ungefähr der erste, seit wir in diesem Lande sind. So wird der 5. «Oktober zum Ruhetag, der vor allem zum langen Schlafen ausgenutzt wird. Genießerisch schlendert man dann zwischen den Baulichkeiten umher, im Osten vom Wohnhaus auf einer kleinen Bodenwelle neben dem Radiomast steht die meteorologische Hütte mit dem Strahlungsschreiber und den Temperatur- und Feuchtigkeitsmeßgeräten. Von dort führt ein kleiner Pfad zum Fahnenmast, dicht am Windenhaus, von diesem 50 Meter nach Nordost liegt fest im Boden verankert die Azimutrolle für die Drachendrahtführung. Das Windenhaus liegt etwa ein Meter höher als das Wohnhaus und von diesem nur einige Meter entfernt. Man steigt ein paar Stufen hinab und kommt erst in das unmittelbar ans Haus angebaute Vorratszelt. Dieses steht etwa ein Meter tief im Boden zum Schutz gegen Sturm und Kälte. Rings im Vorratszelt liegen die Lebensmittelkisten. Durch das Vorratszelt gelangen wir ins Haus wieder über eine 50 Zentimeter tiefe Stufe und stehen zunächst im Vorraum. Links ist Werkstatt, rechts hat sich Peters eine kleine, wirklich interessante Küche eingerichtet, sie erinnert an eine Alchimistenbude bei der trüben Petroleumbeleuchtung. Durch eine zweite Tür geht's dann in den eigentlichen Wohnraum. Gleich links an der Innenwand ein dickes, unterstütztes Brett, die Funkbank mit Sender und Empfänger. An der Gegenseite dann die Kojen und sonst noch die üblichen Einrichtungsgegenstände, in der Mitte der Ofen. Dieser war eine Neukonstruktion, er hatte bis jetzt nicht recht funktioniert und sollte uns noch manchen Ärger geben, ja das Haus mit allem in Gefahr bringen. An des Hauses Rückseite, die nach dem Meer zu liegt, ist noch ein großes Zelt angebaut; es enthält Ersatzstücke und soll zum Aufbewahren gefüllter Ballone dienen; ein drittes, an Benzindunken verankertes Zelt Ersatzlebensmittel. Vom Haus führt der Weg etwa 50 Meter hinab bis zum Meer an einem Lager Benzindunken und Gasflaschen vorbei, und am Strand selbst steht eine Reihe Petroleumfässer. Nun können wir also den Winter abwarten. Mit Heizung und Lebensmitteln sind wir zwar knapp, aber wenn nicht allzuviel Unvorhergesehenes dazwischenkommt, wird's wohl reichen.

Aufnahme Oststation. Der tote Riese.
Die mittlere Temperatur ist jetzt schon 11 bis 15 Grad Kälte. Wenn wir noch eine Erkundungsfahrt ins Innere des Landes machen wollen, müssen wir uns beeilen. Da schiebt eine unangenehme Entdeckung die Ausführung dieses Vorhabens wieder hinaus. Der Inhalt der Seewasserkisten ist noch mehr verdorben, als anzunehmen war, merkwürdigerweise ist auch Preßsülze in zugelöteten Dosen so verdorben, daß sie beim Öffnen einen grauenhaften Duft ausströmt. Wollen wir unsere Hunde durchbringen, müssen wir noch Fleisch herbeischaffen, und das bald, mit dem ersten Schnee beginnen die Moschusochsenherden schon ins Innere zu wandern, und es wird umständlich, vielleicht kaum möglich sein, das Fleisch aus großer Entfernung herbeizuschleifen. Aber alles geht nach Wunsch, am nächsten Morgen stehen vier kapitale Ochsen dicht vor der Station. Doch schon mißfällt ihnen das erwachende fremde Leben, auch sind die Hunde gleich hinterher, und die Tiere ziehen sich nach Osten zurück. Die Hunde stellen sie aber immer wieder, da stehen sie dann auf einem Klumpen, unser stärkster Hund Magdalene dicht davor. Die Schlacht beginnt, wir müssen viele Kugeln hinüberschicken und dabei scharf aufpassen, den Köter nicht zu treffen, der immer dreister wird; endlich wird's still. Aber als wir hinkommen, reißt sich ein uralter, riesiger Ochse noch einmal hoch, bis ein Fangschuß ihn endgültig erlöst. Es freut uns, daß wir bei der Fleischversorgung keine Kühe zu schießen brauchten, also kaum den Fortbestand der Moschusochsen gefährdet haben. An Ort und Stelle werden die Tiere in saubere Stücke zerlegt und alles zur Station gebracht. Das Dach des Windenhauses, der einzige Ort, an den die Hunde nicht herankönnen, wird Fleischkeller. Es friert ja immer, so daß alles frisch bleibt. Viele Zentner Fleisch haben wir jetzt zu Hause und zunächst keine Nahrungssorgen mehr. Die Hunde sind in glänzendem Zustand, der »Professor« geradezu unanständig fett.
Jeden Tag ist jetzt prachtvolles Wetter. Wir beschließen, den Erkundungsmarsch doch noch auszuführen. Nur mit Gewehr, Rucksack und Kamera marschieren Ernsting und ich ins Innere des Landes 17 Stunden ununterbrochen. Auf dem Heimweg schleppen wir uns mühsam genug die letzten Kilometer, auch der »Professor« ist vollständig erledigt und wird's wohl bedauern, daß er auf unsere freundliche Aufforderung hin mitkam. Am meisten hat uns der Nachtmarsch mitgenommen, bei dem wir dauernd großen Ochsenherden ausweichen mußten. Manchmal ist es sogar geraten, recht hastig seitlich in eine Talsenkung zu verschwinden und dort in Sicherheit den nächtlichen Spuk zu erleben. Der Vollmond steht über der glitzernd hellen Schneefläche, unruhiges Nordlicht tanzt über den ganzen Himmel und strahlt über den fahlen Eisbergen zu den dunklen Gebirgen im Süden hin, sich dort mit den letzten grünen Streifen der Dämmerung mischend. Durch diese phantastische Welt braust ein wilder Zug, schattenhaft undeutlich mit eiligem Stampfen und lautem Schnauben.
Unser Ausflug, der uns zu der höchsten Erhebung des eigentlichen Jameson-Landes geführt hatte, läßt uns vermuten, daß die Randzone des Inlandeises nördlich der Nordostbucht für den Abstieg einer Überquerungspartie nicht ungünstig ist. Die steilen, unzugänglichen Berge hören im Norden auf, und hier scheint das Inlandeis bis zu den flachen Bergen vorzustoßen, die sich langsam zum Jameson-Land hinabsenken. Schwierig aber würde es für uns wegen des langen Anmarsches sein, ein Depot dort auszulegen. Nun – es sollte alles anders kommen.
Wie schnell sich doch ein Heimatgefühl auch für die dürftigste Bude bildet, wenn man sonst nichts hat. Sie ist der Inbegriff der Sicherheit und des Geborgenseins. Man freut sich unbändig, wenn man sie endlich in der Ferne auftauchen sieht. Übrigens ist vor uns ein Bär hergelaufen, und wir hoffen im stillen, daß Peters, der inzwischen das Haus besorgt hat, ihn erlegt hat, was aber nicht der Fall war. Die letzte größere Unternehmung ist vorbei. Prompt setzt am nächsten Tag ein Schneesturm ein, der uns nicht auf dem Marsche hätte überraschen dürfen, da wir ohne Zelt waren und wenig Lebensmittel mit hatten. Und diesmal gibt es viel Schnee. Die Temperaturen sinken auf -20 bis -30 Grad. Draußen ist jetzt alles erstarrt, nur vereinzelt donnert noch ein Eisberg oder Gletscher. Für uns beginnt der »Stellungskrieg«, wie wir diese Zeit nennen.
Fragt einen jemand nach dem Polarwinter, so will er meist wissen, wie man die lange dunkle Zeit dort oben totschlägt. Bei mancher Expedition mag dies schon ein schwieriges Problem gewesen sein. Bei uns nicht. Von vornherein war uns klar, daß, auch wenn keine besonders schwierigen Verhältnisse eintreten sollten, der Aufbau und Betrieb einer meteorologisch-aerologischen Station für nur drei Mann kaum Zeit zu all den psychischen Schwierigkeiten des Polarwinters lassen würden.
Da ist zunächst die Arbeit mit der Sende- und Empfangsstation und die regelmäßigen Versuche mit diesen Geräten. Die Apparate waren zu einem ganz niedrigen Preis von dem Funkmeister Jansen der Flughafenfunkstelle Lindenberg selbst entworfen und hergestellt. In zwei Koffer mittlerer Größe war alles eingebaut. Wenn auch durchaus mit der Möglichkeit zu rechnen war, daß der drahtlose Verkehr über die hohen Randgebirge und das Inlandeis hinweg mit den Kameraden an der Weststation seine Schwierigkeiten haben würde, so hofften wir doch im stillen, wenigstens ab und zu Verbindung zu bekommen. Schwer war die Enttäuschung, als die mit der West- und Zentralstation ausgemachten Versuchstage vom 18. bis 20. Oktober verliefen, ohne daß wir das geringste von West hörten. Tag und Nacht haben wir gesendet und auf Empfang gestanden. Später stellte sich dann heraus, daß die Weststation noch nicht ausgebaut war.
Mit der Station Scoresby-Sund kamen wir bald in Verbindung. Da wir nicht im geringsten als Funker ausgebildet waren, haben im Anfang immer zwei Mann die heißersehnten Punkte und Striche, die über Scoresby-Sund aus der Heimat kamen, nachgeschrieben, oft war es eine wüste Hetze, und nachher erst das Herausbuchstabieren! Nun, alles übt sich, und schließlich konnten wir gleich aus dem Hören aufnehmen, worauf wir nicht wenig stolz waren. Den kleinen Zweitaktmotor, der die Strom- und Spannungserzeuger (Generator) für die Senderei antrieb, hatten wir anfangs im Freien stehen. Das gab viel Schererei. Er sprang schlecht an, lief unregelmäßig, bekam Nebenschluß und was derlei Dinge noch mehr sind. In tagelangem Umbau schlossen wir schließlich den Generator an den Opelmotor der Drachenwinde an, doch das Baumaterial war zu schlecht und die Mühe vergebens. Jetzt griffen wir zu einem radikalen Hilfsmittel und setzten den Motor samt Generator in den Wohnraum. Es ging. Damit der Motor nicht zu heiß wurde, durfte nur bei offener Haustür gesendet werden, außerdem wurden Schneebrocken um den Zylinder gebaut und schließlich aus Blech und der Handbohrmaschine noch ein Ventilator hergestellt. Das Auspuffrohr des Motors ging ins Freie, und eine Klappe in der Wand sorgte für Durchzug. Ein Sendetermin war jedesmal ein schönes Theater. Ein Mann wedelte mit der Haustür, der andere drehte wie rasend die Bohrmaschine, und der dritte schlug auf die Tasten, was das Zeug hielt – ein Höllenlärm in der Bude! Der Erfolg war aber, daß wir meist einen auf die Sekunde regelmäßigen Funkdienst einhalten konnten, und Telegramme von 100 Worten ohne Unterbrechung waren unser ganzer Stolz. Auch mit Wegeners Weststation waren wir schließlich in Verbindung gekommen. Am 28. November hörte ich um die Mittagszeit zufällig auf Kurzwellen deutlich eine Station mit dem Kennzeichen OZA. Es war tatsächlich West. Wir hatten die Hoffnung schon aufgegeben, mit ihr in Verbindung zu kommen. Durch ein Telegramm über die dänische Station schlugen wir sofort ein Programm an West vor, und am 16. Dezember war auch die Verbindung hergestellt. Zweimal wöchentlich verkehrten wir mit West, die Verständigung war immer gut. So erfuhren wir auch, daß die Station »Eismitte« errichtet, daß aber kein Funkgerät dorthin gekommen sei. Weiter hörten wir, daß unser Führer, Professor Alfred Wegener, noch im Herbst eine Reise nach »Eismitte« ausgeführt hatte, seitdem aber nicht zurückgekehrt sei. Viel Sturm, ungewöhnlich starke Schneefälle und Kälte mußten nach unsern Beobachtungen zu der Zeit auf dem Inlandeis geherrscht haben.
Nach der Heimkehr hatten wir die Genugtuung, vom Funkmeister Jansen am Observatorium Lindenberg bei Berlin zu erfahren, daß wir auch die Strecke bis nach Deutschland mit unserm Sender überbrückt hatten, er hatte uns fast ständig gehört. Außer dem regelmäßigen Nachrichtenverkehr betrieben wir nach der meteorologischen Tagesarbeit ausgedehnte Empfangsversuche auf kurzen, mittleren und langen Wellen. Das war recht interessant. Nie hatte ich so gute Empfangsverhältnisse angetroffen wie gerade in Grönland. Wenn wir gar eine 200 bis 500 Meter lange Antenne senkrecht am Ballon in der Luft stehen hatten, hörten wir ohne Störungen die Sender der ganzen Welt. Das ist ein Unterschied gegen frühere arktische Expeditionen. Fern von den Menschen und fern von der Heimat ist man mit ihrem geistigen Leben verbunden; man hört von den politischen Kämpfen, von den lebenswichtigen Tagesfragen so laut und so deutlich, als ob man dort wäre. Und doch ist es so ganz anders. Hier in der Einsamkeit des grönländischen Winters fehlt das Verständnis für die Kompliziertheit des europäischen Lebens. Man empfindet höchstens seine Überspanntheit, und es dämmert einem, daß sie früher oder später zum Bankerott führen muß. Hier herrscht die Natur in ihrer ganzen Schönheit und in ihrer ganzen Grausamkeit. Was gelten hier die politischen Phrasen und all das philosophische Geschwätz, es gilt die Tat und der Tod. –
Für unsere Hauptaufgabe, die meteorologischen Untersuchungen, war der Funkempfang dadurch wichtig, daß er uns die genauen Zeitangaben ermöglichte. Dreimal täglich wurden nach vorher vereinbarten Terminen Luftdruck, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Wind abgelesen und die Bewölkung vermerkt. Außerdem mußten die Registrieruhren täglich kontrolliert und ihr Stand mit der Normalzeit verglichen werden. Die Uhren der im Freien aufgestellten Instrumente bereiten in der Arktis viel Ärger. Sobald die Temperatur sehr tief sinkt, bleiben sie stehen, erst im Frühjahr gelang es durch einen Kniff, diesen Übelstand zu beseitigen. Die Arbeitsteilung war meist so, daß Ernsting die Frühbeobachtung machte, dann die Registrierinstrumente bediente und die Stube heizte. Peters machte eine der beiden andern Beobachtungen, während ich mich mit der Auswertung beschäftigte und oft Nächte hindurch Uhren ausbessern mußte. So war einer einmal mit dem Taschenchronometer hingefallen, und Achse und Lager waren zerstört. Da wurde dem Präzisionsinstrument ein Weißblechlager mit Kolophonium eingeklebt, und wir konnten uns die ganze Zeit nachher auf diese Uhr verlassen. Der Uhrmacher, der sie später einmal in die Hände bekommt, wird sich allerdings wundern!
Zu diesen Arbeiten kamen noch die Messungen der Ein- und Ausstrahlung und der Sonnenstrahlung. Daß uns aber an manchen Tagen kaum Zeit zum Essen blieb, brachte unsere weitere Aufgabe, die Erforschung der Atmosphäre über Grönland, mit sich.

Aufnahme Oststation. Drachen im Schnee.
Die Bestimmung der Luftströmungen vom Boden bis in die höheren Schichten über der Station war noch eine verhältnismäßig angenehme Arbeit. Vor allem hatte man hierbei in den meisten Fällen die Gewißheit, daß die aufgewandte Mühe durch gute Ergebnisse belohnt würde. Die Methode ist einfach. Gefüllt wurden die Ballone wegen der Gefährlichkeit des Wasserstoffgases im Freien. Viele Gasflaschen, die im Meerwasser gelegen hatten, waren fest eingefroren, und mitunter mußten wir die zwei Zentner schweren Dinger erst mit dem Oberteil in einen Eimer heißes Wasser halten, ehe sie sich öffnen ließen. Dann wurde der vorher in der Hosentasche oder auf dem Bauch schön durchgewärmte Ballon gefüllt. Zeigte sich ein kleines Loch im Gummi, durch das das Gas entwich, so hatte Ernsting ein probates Mittel, er spuckte drauf, sofort war das Loch zugefroren, und er hatte schön Zeit, in der warmen Stube ein Pflaster mit Gummilösung zu bestreichen und es dann noch warm draufzudrücken.
Mehr als 50 Höhenwindmessungen konnten selbst in den dunklen Wintermonaten gemacht werden. Auch als die Sonne schon tagsüber nicht mehr über den Horizont kam, gelang es, in der Dämmerung der Mittagsstunde den Ballon noch auf mehrere tausend Meter Höhe zu verfolgen.
Bei den ein bis eineinhalb Stunden langen Ballonverfolgungen bei 30 bis 40 Grad Kälte half keine Pelzbekleidung mehr, zum Schluß war man steif gefroren und eifriges Auftauen der weiß gewordenen Gliedmaßen eine gewohnte Beschäftigung. In den meisten Fällen, wenn nicht gerade Föhnsturm herrschte, flogen unsere Ballone zunächst schnell in westlicher Richtung davon, aber nur bis etwa 50 Meter Höhe. Dann stiegen sie steil durch die Windstille hoch, kehrten mit einer starken Westströmung über die Station zurück und flogen nach Osten weiter. Diese Windverteilung hatte für uns zwei große Nachteile. Erstens mußten wir am Boden meist im Wind arbeiten und beobachten, und Wind bei 30 bis 40 Grad Kälte ist eine teuflische Erfindung. Zweitens war die Ausführung von Registrieraufstiegen mit Drachen nur unter den allergrößten Anstrengungen und Vorbereitungen möglich, mit Fesselballonen überhaupt fast unmöglich. Um den Drachen in die obere, oft erst bei 600 bis 1000 Meter beginnende Windschicht zu bringen, mußte er ein bis zwei Kilometer ausgetragen werden. Unten war aber Gegenwind, der Drache mit 25 Meter Fläche konnte dabei kaum gehalten werden. Ungeheure Schneewehen und steile Talsenken ließen dann wieder einmal die Drachenmannschaft tief einsinken oder gar einige Meter hinunterstürzen. In der dunklen Zeit oder bei Nebel war das oft nicht zu vermeiden, da die Landschaft keinerlei Konturen mehr erkennen ließ. Ging dann ein Drachen schon während des Austragens entzwei, war die Stimmung denkbar schlecht. Das Drachenkabel mußte von zwei Mann ausgezogen werden. So vergingen oft zwei bis drei Stunden, bis der Drachen weit draußen aufstiegbereit stand, vom Windenhaus war er oft nur ganz undeutlich als gelblicher Punkt in der eintönig weißen Landschaft zu erkennen. Manchmal stand er auch so, daß er durch Schneewehen ganz verdeckt war. Gleich anfangs erkannten wir, daß der Mann, der im Windenhaus die Maschine bediente, wegen der widrigen Windverhältnisse den Drachen gleich beim Starten mußte verfolgen können. Kam der Drachen beim Anziehen nicht vom Boden weg, weil der Rückenwind zu stark war, mußte sofort die Maschine gestoppt werden, da sonst beim Einholen mit einer Geschwindigkeit von zehn Meter in der Sekunde der Drachen zerstört wurde; oder das Kabel riß, und ein bis zwei Kilometer Draht war unbrauchbar. Das brauchte nur dreißigmal vorzukommen, und der gesamte Draht wäre weg gewesen.
Zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bauten wir also eine kleine Kommandobrücke auf das Maschinenhaus und verlängerten alle Maschinenhebel mit Bambusstangen, die durchs Dach hindurch führten. Diese Einrichtung hat sich dann sehr bewährt. Ein besonderes Kapitel war auch das Anwerfen des auf 30 bis 40 Grad Kälte abgekühlten Automotors. Nach anfänglicher begreiflicher Scheu griffen wir zu Gewaltmitteln, um bald zum Ziel zu kommen, zu Hause hätte man uns für verrückt erklärt. Unter das Motorgehäuse kam eine mit höchster Kraft brennende Lötlampe, dicht neben dem Motor wurde aus dem mit offener Flamme brennenden Dapolinofen in einer Konservenbüchse Benzin gekocht, jawohl richtiggehend Benzin gekocht, und dieses dem kalten Zylinder einverleibt. Dann kamen schnell die glühend heißen Kerzen darauf, nötigenfalls noch warmes Wasser in den Kühler, und schon fünf Minuten später lief meist der brave Opel. Daß nichts passierte, ist unser Glück. Nur einmal wäre um ein Haar das ganze Maschinenhaus abgebrannt. Peters sollte während einer Betriebspause den Motor zudecken, hängte aber die Decke so, daß sie dem Ofen zu nahe kam, kurz darauf quoll aus allen Ritzen des Häuschens dicker Qualm, und als wir hinkamen, zuckten schon blaue Flämmchen am Benzintank; hätte Ernsting nicht in seiner Umsicht einen Feuerlöscher aufgehängt, wäre uns alles abgebrannt. Die Geschichte ereignete sich am 28. November, also ein bißchen früh, um die Drachen schon zu pensionieren.
War der Motor nun in Gang und stand der Drachen startfertig draußen, so gab es immer noch genug Möglichkeiten, um uns um den Erfolg unserer Arbeit zu bringen. Gelang es, den Drachen glücklich aus dem gefährlichen Unterwind zu holen, so stieg er gut an, aber häufig kam es auch vor, daß er blitzschnell wieder zum Boden zurückkehrte und zerschmettert liegenblieb. Es war unmöglich, den Draht in einer schnurgeraden Linie auszulegen, der starke Zug von fast 100 Kilogramm drückte ihn dann seitwärts tief unter den verharschten Schnee, der Drachen vermochte sich den Draht nicht herauszureißen und mußte selbst zu Boden. Waren schließlich doch alle Klippen überwunden und die obere Windschicht erreicht, herrschte große Freude, wie oft kam es aber auch vor, daß nach Überwindung aller Schwierigkeiten in Bodennähe der noch nicht aufgerollte Draht so kurz war, daß die Erreichung der Windschicht illusorisch wurde, dann leierten wir langsam und tiefbetrübt den Drachen durch die Luft bis in Stationsnähe, ergeben auf den unvermeidlichen Bruch wartend, der fast immer eintrat, da der Drachen aus der Windstille heraus mit Rückenwind und Kopf zuerst in den Boden ging, wobei ich mich häufig genug durch tiefes Ducken auf dem Maschinenhaus in Sicherheit bringen mußte. Sofort wurde dann wieder aufgebaut, mit klammen Fingern bei beißendem Wind, eine ganz elende Schinderei. Das Ergebnis von acht bis zehn Stunden Arbeit: 200 bis 300 Meter Höhe.
Hätten wir die glänzenden Start- und Landegelegenheiten im Scoresby-Sund gekannt, hätten wir durch Benutzung eines Flugzeuges zu Registrieraufstiegen viel Zeit und Mühe sparen können. Unsere Tagebücher müssen immer wieder herhalten zu harten Worten über all die nun zu bestehenden Schwierigkeiten. Ich greife irgendeinen Tag heraus: »Samstag, den 29. November 1930. Wollten Drachenaufstieg machen, natürlich der Wind weht aus der andern Ecke, es ist tatsächlich zum Verzweifeln, Luftdruck fällt stark, aber nicht die Spur Wind.« –
Überraschte uns günstiger Wind während des Schlafens in der Nacht und hielt er wirklich beim Aufwachen noch an, so war der Aufstieg auch noch nicht gesichert. Erst galt es, die Drachen in mehrstündiger Arbeit aus den tiefen Schneewehen auszugraben, und da kann es in Grönland vorkommen, daß bei der letzten Schippe Schnee der Drachenwind den letzten Seufzer hören läßt und dem Gegenwind Platz macht. Nur dadurch, daß wir dauernd auf dem Posten waren, ob der Wind nun morgens früh oder spät in der Nacht, Sonntags oder werktags kam, und trotz der mühseligen Arbeit dauernd versuchten, die obere Windschicht zu erreichen, gelangen uns doch viele schöne Aufstiege mit guten Ergebnissen. Ich muß an dieser Stelle den Kameraden, besonders Ernsting, für ihre Mühe danken. Es fiel einem manchmal wirklich schwer, abends um 9 oder 10 aus der warmen Stube hinauszugehen, um bei völliger Dunkelheit, Sturm und schneidender Kälte eine mehrstündige Arbeit zu beginnen. Kein Mensch wird es Ernsting verübeln, wenn er manchmal brummte, aber ich konnte sicher sein, ehe ich mich noch recht nach dem Registrierinstrument umgesehen hatte, war er schon draußen und machte den Drachen fertig.
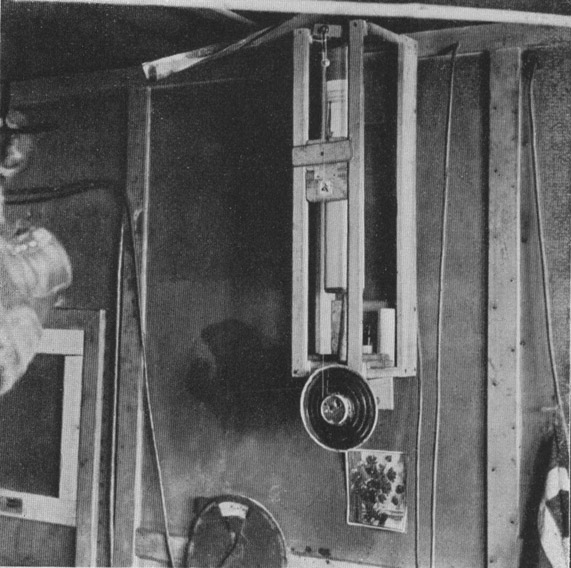
Aufnahme Oststation. Die selbstgebaute Windregistriereinrichtung.
Im Rahmen dieses Buches kann ich nicht näher auf unsere Arbeit und die Ergebnisse eingehen. Nur will ich kurz darauf verweisen, daß die Luft über Grönland von etwa 1000 Meter Höhe ab im Winter kaum kälter ist als im Sommer, und auch kaum kälter als in Nordeuropa. Nur dicht am Boden liegt die ungeheuer kalte Schicht. Es kam vor, daß es bei 40 Grad Kälte am Boden in 100 Meter Höhe nur noch 22 Grad kalt war, in 500 Meter Höhe vielleicht -12 Grad, oder im Februar am Boden -25 Grad, in 1000 Meter Höhe nur noch 0 Grad. Es ist zu hoffen, daß die Auswertung der mehr als tausend aus der Höhe und am Boden an der Oststation gewonnenen Registrierstreifen ein gut Teil zur Klärung der Witterungsverhältnisse in Grönland und ihrer Einflüsse auf unser Wetter beiträgt.
Der Leser wird auf Grund des kurzen Berichts über unsere Arbeiten verstehen, daß sich, trotzdem wir drei Mann waren, kein Skatklub an der Oststation bildete und auch die Zahl der Schachpartien in acht Monaten sicher nicht zehn überschritt. Ließ uns das Wetter wirklich einmal Ruhe, so ging jeder irgendeiner Liebhaberei nach, es wurde auch viel gebaut. Ich habe vergessen zu erwähnen, daß unsere Windmeßeinrichtung verlorengegangen war. Wir stellten selbst aus Kondensmilchdosen, Konservenbüchsen, Bambusstangen und andern Dingen eine Einrichtung her, die mit aller Genauigkeit arbeitete.
Heute, am 20. November, kommt die Sonne zum letztenmal über den Horizont. Ihr oberer Rand wird gerade noch in einem tiefen Einschnitt der südlichen Gebirgsgruppe sichtbar. Die schon so oft beschriebene und vielgefürchtete Winternacht beginnt. Auf uns aber macht das Ganze zunächst recht wenig Eindruck, das Verschwinden der Sonne wird eben zur Kenntnis genommen wie jeder Punkt des Programms, und weiter geht die Verfolgung unseres Ballons bis auf 5000 Meter hinauf. Auf Expeditionen aber, die im wesentlichen geographische Reisen ausführen und meteorologische Beobachtungen nur nebenbei machen, ist der Winter zweifellos mit Recht gefürchtet und von einschneidender Bedeutung für das ganze seelische und körperliche Leben.
Bei uns fällt das alles nicht so ins Gewicht. Einmal haben wir eine Fülle von Arbeit an einer festen Station, zum andern verschwindet die Sonne auf 71 Grad Nord nur auf etwa zwei Monate. Weiter bewirkt die außerordentliche Temperaturzunahme mit der Höhe in der untersten Luftschicht eine starke Brechung der Lichtstrahlen, so daß auch bei dem tiefsten Sonnenstand mittags noch sehr helle Dämmerung herrscht. Ein ganz prachtvolles Schauspiel bietet dann der in allen Farben getönte Himmel und die von einem magischen Licht übergossene Eiswelt. Gewiß, es gibt auch ganz dunkle Tage, aber die sind vereinzelt. Dann fegt bei 20 Grad Kälte der Schneesturm ums Haus, es ächzt und braust im Blechschornstein des Ofens, die Ofenflammen zucken unruhig und verlöschen immer wieder. Die Stube ist nicht warm zu kriegen. Von Zeit zu Zeit jault ein Köter draußen, der vom andern von einem schützenden Platz vertrieben ist. Sichtlich wachsende, riesige Schneewehen begraben jeden Gegenstand. Dieser Spuk dauert aber immer nur höchstens zwei Tage, dann ist wieder prachtvolles Wetter. Schlimmer als die Sturmtage sind eigentlich die allerdings ebenso seltenen Nebeltage, an denen meist auch Schnee fällt, manchmal 60 bis 80 Zentimeter an einem Tag. Eine unheimliche Stille umgibt dann das Haus, kein Luftzug weht, die Fahne hängt völlig still herab, nicht der geringste Laut in der Umgebung, und man wartet doch sehnsüchtig darauf, daß man etwas hört oder sieht – aber es geschieht nichts. Wenige Meter vom Hause weg, und man kommt sich vor wie aus der Welt entrückt, in einem Meer von Schnee. Mit unglaublicher Geschäftigkeit fallen die Schneeflocken, als ob sie sich gar nicht genug beeilen könnten, alles, aber auch alles zuzudecken. Man sieht die Schneefläche wachsen und hat das Gefühl, daß sie in den nächsten Stunden über einem zusammenschlagen muß.
Die Hunde liegen bei solchem Wetter meist draußen herum und schlafen. Geht man zur Instrumentenhütte, um eine Beobachtung zu machen, dann bewegt sich wohl in der Nähe des Hauses ein kleiner Schneehügel, zerfällt, und heraus steigt ein Hund, schwimmt durch die weiße Masse zu einem her, schüttelt sich den Schnee aus dem prachtvollen schwarzen Winterpelz, macht seine Reverenz, einmal vorwärts und einmal rückwärts, und kriegt möglichst einen kleinen Leckerbissen; bald darauf ist er wieder zugeschneit, alles ist still, das ganze Leben beschränkt sich wieder auf das kleine verlorene Expeditionshaus.
Ballone können wir an solchen Sturm- und Nebeltagen nicht verfolgen, man sieht nichts. Drachenaufstiege werden an den Sturmtagen meist gemacht, doch wie oft reißt ein wertvoller Drachen ab und muß geborgen werden. Das ist mühsam und oft nicht ganz gefahrlos. Es ist häufig schwer, sich wieder zum Haus zurückzufinden, aber das sind schließlich Gefahren, mit denen man bei Hochgebirgstouren in der Heimat auch rechnen muß. Unangenehm, wenn auch nicht gefährlich, ist es bei diesen Bergungstouren, oft haushoch in die Tiefe zu sausen und bis zum Kopf in einer Schneewehe zu versinken. Da Unebenheiten nicht zu erkennen sind, haben wir uns schon angewöhnt, dauernd Speerwerfen mit dem Skistock zu machen, bleibt er im Schnee stecken, so ist es gut, versinkt er, so heißt es Vorsicht. An den Hunden hat man in diesen Lagen keine Hilfe. Sie laufen bei viel Schnee nie vorn, sondern im Gänsemarsch hinter einem her. Ist der Mann heruntergeplumpst, so gehen sie vorsichtig weiter, bis sie sich die Bescherung von oben angucken können. Beim Rückmarsch laufen sie auch nicht etwa freudig bellend Heim und Herd entgegen, sondern macht man halt, weil man die Orientierung verloren hat, legen sie sich sofort hin und machen sich zum Schlafen zurecht, so sind sie's von den großen Schlittenreisen gewöhnt.
An Nebeltagen machen wir wohl auch mitunter einen Drachenversuch, doch fast nie wird eine Windschicht erreicht, und es bleibt an diesen Tagen Zeit für Innenarbeiten. Es wird gewaschen, geflickt und ausgebessert, manchmal auch Haar geschnitten und rasiert, dabei werden zum hundertstenmal die schon zum Auswachsen gehörten Grammophonplatten geleiert. Dem Reinigungsbedürfnis können wir allerdings nicht allzusehr frönen. Die Wasserverhältnisse sind schlecht geworden. Nachdem das Meer zugefroren war, wurde das Flußwasser immer salziger und zuletzt unbrauchbar. So muß Schnee geschmolzen werden, und das dauert auf unsern Öfen furchtbar lange. Ein Vollbad ist daher ein freudiges Ereignis, und wer gerade an der Reihe ist, fängt schon früh morgens mit den Vorbereitungen an. Dieselbe Wäsche tragen wir allerdings den Verhältnissen entsprechend viele Wochen auf dem Leib. Aber sonst muß man, wenn es irgend die Verhältnisse zulassen, zusehen, daß alles vermieden wird, was nach Verschlampung aussieht; das hilft am besten über das Außergewöhnliche der Lage. So entsteht denn auch jedesmal Palastrevolution, wenn einer im Schneeholen und Wassermachen sparsam wird und diese Sparsamkeit sich in zunehmender Zähigkeit des Spülwassers oder Konservenbüchsen mit gebrauchtem Waschwasser ausdrückt, die zum Aufwärmen auf dem Ofen stehen. Anderseits herrscht wieder helle Begeisterung, und es hebt die Stimmung, wenn wieder mal alles blitzt und sauber ist.
So war es besonders Weihnachten. Die Zeit bis dahin verlief ohne nennenswerte Ereignisse. Der Weihnachtstag bricht mit wundervoll klarem, aber auch kaltem Wetter an, nachdem es vorher trüb und ungewöhnlich warm gewesen war; auf 0 Grad war die Temperatur gestiegen, und es hatte sogar ein wenig geregnet. Heute, am Festtag, ist es aber so hell, daß wir in der Mittagsstunde mal kurz das Licht ausmachen können, es geschieht in der Hauptsache aus Vergnügen daran, daß es überhaupt geht. Peters entfaltet eine fieberhafte und geheimnisvolle Tätigkeit in der Küche. Wenn dann auch in allen Ecken des Hauses ein leichter Moschusochsenduft schwebt, so mindert das nicht die Überraschung und Freude an dem lukullischen Festmahl, das er auf den Tisch bringt. Hier die Speisenfolge:
»Bouillon in Tassen,
Hors d'Oeuvre,
Omelette mit Aal,
Moschusochsenschmorbraten mit Rotkraut und Sauce, Kartoffelpüree,
Plumpudding,
Mokka,
Zigarren.«
Und dies alles seit Monaten wieder mal auf einem Tischtuch, das uns meine Frau mitgegeben hatte. Dann packt jeder aus, zieht sich zurück und ist für ein paar Stunden mit den Gedanken zu Haus, von wo auch Weihnachtstelegramme gekommen waren.
Später muß man sich erst wieder ein bissel aneinander gewöhnen, es liegt halt doch etwas in der Luft, aber Gott sei Dank, für Sentimentalität ist sie nicht reif, das schwächt nur, und es gibt genug anderes, was uns mürbe zu machen droht. Aber auch daran wollen wir heute nicht denken. Draußen hat der Himmel zur Feier des Tages besonders strahlende Nordlichter aufgesetzt, und drinnen brennen jetzt die papiernen Tannenbäumchen, es duftet nach Kaffee und Zigarren, mit Musik und Lesen verbringen wir den Abend. Meine Frau hatte mir Timmermanns Pallieter ins Paket gelegt. Es war schon lange Jahre her, daß ich dieses Buch gelesen und schätzen gelernt hatte. Wieviel Freude machte mir gerade heute wieder die derbe, aber auch unendlich tiefe Schilderung des Lebenskünstlers Pallieter. Die glutvollen und farbigen Bilder eines gesegneten Landstrichs wecken zwar keine schmerzhafte Sehnsucht, aber eine unbändige Freude darüber, daß es noch etwas anderes gibt als Eis und Schnee. Und so hat jeder etwas bekommen zum Vergnügen und zur Freude, was er mit den andern teilen kann.
Am nächsten Tag tauschen wir noch Weihnachtsgrüße mit den Kameraden im Westen aus, und dann beginnt wieder die meteorologische Arbeit. Das Jahr 1930 geht kalt und klar zu Ende. Die Lufttemperaturen am Boden liegen dauernd an 40 Grad Kälte, nehmen aber bis 100 Meter Höhe schon um 20 Grad zu. Dies bewirkt so starke Luftspiegelungen, daß die Berge im Süden, wenn man sie in gebückter Stellung betrachtet, vollkommen anders aussehen, als wenn man sie aufrecht stehend ansieht. Da außerdem die unterste kalte Luftschicht dauernd rhythmische Bewegungen, ähnlich der Dünung des Meeres, ausführt, so bietet der Horizont ein eigenartig bewegtes Bild. Hochplateaus zerfallen, steigen wieder als spitze Berge auf, die wieder zu einer geschlossenen Masse zerfließen.
Neben Ballonaufstiegen und Drachenversuchen werden die klaren Nächte zu ausgiebigen Messungen der Ausstrahlung mit einem Aktinometer benutzt.
So kommt Silvester heran, der letzte Tag im alten Jahr, mit seinem Rückblick und seinen Hoffnungen. Auch dieser Abend bekommt seine festliche Note: ein Ballon mit einer von Ernsting verfertigten Bombe steigt. Ich hatte noch einen Schalltrichter für den Radioapparat hergestellt. Draußen in der stillen, kalten Luft 200 Meter hoch steht der Ballon mit der Antenne, und wir hören Neujahrsfeiern aus aller Welt und zu allen gangbaren Zeiten. Alle deutschen Sender sind da, Rußland, Skandinavien, Island, Frankreich, England, Italien, Japan, Amerika, und alles laut, und was uns am meisten freut, auch Wegener West. Ich kann eigentlich nicht sagen, daß einem die glänzende Verbindung mit der Außenwelt das Gefühl der Einsamkeit nimmt; im Gegenteil, verstärkt bleibt das Bewußtsein, daß zwischen dem Tausende von Kilometern entfernten Festtrubel eine breite Zone der vollständigen Erstarrung allen Lebens und des drohenden Todes liegt. Doch was macht uns dies heute aus, wo es uns noch gut geht.
Ein paar Tage später schon ist's anders. Ernstings Neujahrsbombe brachte uns auf die Idee, eine Auslösevorrichtung für Instrumente zu bauen. Nach bestimmter Zeit soll von einem frei aufsteigenden Ballon das Instrument abgelöst werden und mit einem Fallschirm herunterfallen. Diese Einrichtung soll uns die Möglichkeit geben, bei schwachem Wind in den oberen Schichten Aufstiege nur so hoch durchzuführen, daß das Instrument noch in der Nähe der Station niederfällt. Ernsting will einen Zeitzünder im Vorratszelt erproben; das ist mir zu gefährlich, und ich gehe damit ins Freie und probiere ihn selbst. Ein Funke schlägt infolge des leichten Windes in eine Blechbüchse mit 50 Gramm Pulver 25 Zentimeter von meinem Kopf. Ein dumpfer Schlag, eine ungeheure Helle, und dann ist es Nacht, unerbittliche Nacht. Die Sterne sind nicht mehr zu sehen und der Mond nicht. Jetzt heißt es vor allem, die Nerven bewahren, auch wenn mit allem zu rechnen ist. Ich spüre keinerlei Schmerz, reiße die Augen weit auf, betaste die Augäpfel und spüre nichts. Ernsting kommt herangestürzt, ich sehe ihn nicht. Er erfaßt die Lage, seine Stimme ist ganz verändert vor Angst und Schreck. Das gibt mir völlig das Gleichgewicht wieder, und ich bitte zunächst, eine Taschenlampe zu holen und mir direkt in die Augen zu leuchten. Wie freuen wir uns über den ganz schwachen Schimmer, den ich wenigstens auf einem Auge wahrnehmen kann. Dann führt er mich zum Hause, Magdalene kommt an, leckt mir die Hand und wundert sich wohl, daß ich heute keinerlei Sinn habe, mich mit ihr zu necken. Ich mag schön aussehen, ich merk's an den Ausrufen der beiden im Haus. Das Blut läuft mir übers schwarz verbrannte Gesicht, die Hand ist aufgerissen, und jetzt beginnen fürchterliche, wahnsinnige Schmerzen, am schlimmsten in den Augen. Zwei Tage lang tanzen mir Feuerkugeln vor den geschlossenen Augen in irrsinniger Drehung, und die gesunde Hand krampft sich um irgendeinen Gegenstand, um den Schmerz abzulenken. Jetzt weiß man, was es bedeutet, keinen Arzt holen zu können und ganz auf sich selbst gestellt zu sein. Nach zwei Tagen lassen die Schmerzen ein wenig nach, ich kann, wenn auch mit größter Schwierigkeit, die Augen öffnen und stelle fest, daß ich sehe, wenn auch vollkommen unscharf und verschleiert. Das allgemeine körperliche Befinden ist aber wieder gut, den Radioempfangsdienst kann ich versehen und tags darauf die alte Arbeit aufnehmen, wenn auch schwer zerschunden, verbunden und entstellt, ich habe keinerlei Haar mehr an den Augen, und die Haut hängt herunter.
Es war noch großes Glück bei der Sache, die Metallstücke der Dose waren tief in das Holz des drei Meter entfernten Fahnenmastes eingedrungen. Merkwürdig, daß ich noch wochenlang an der stärksten Kurzsichtigkeit leide. Auf Ernsting ruhte in den schlimmsten Tagen eine große Arbeitslast, aber er ist ein ganzer Kamerad, auf den man sich immer verlassen kann. Es ist gut, daß ich so schnell wieder auf dem Damm bin, wir müssen jetzt viel an den Uhren herumbasteln, auch Drachenstücke flicken, die Ersatzteile sind zu Ende. Oft ist das Aufbauen der vom Seewasser angefressenen Drachen eine ziemliche Tüftelei, und manche Arbeit kann man nicht in Handschuhen ausführen, so daß einem der Kälteschmerz das Wasser in die Augen treibt.
Am 17. Januar sinkt die Temperatur unter 40 Grad. Peters wird so krank, daß er ganz in der Koje bleiben muß. Ernsting übernimmt die Küche mit vereinfachtem Programm, und da er das Wasserbereiten und Ordnunghalten glänzend versteht, blitzt der Laden in einer für arktische Verhältnisse geradezu erstaunlichen Sauberkeit. Doch das hindert nicht, daß jetzt Nahrungssorgen leise anklopfen. Für die Hunde sind nur noch zwei Ochsenkeulen da, und jeden Morgen werden die Portionen kleiner, die sie von den steinharten Fleischklötzen heruntergesägt bekommen. Das ist aber nicht die einzige Sorge, auch unsere Kleidung zerfällt langsam.
Da gute Kleidung für den Verlauf eines arktischen Unternehmens von größter Wichtigkeit ist, müssen diesem Umstand ein paar Worte gewidmet werden. Für eine reine Reiseexpedition, die ohne dauernden großen, technischen Apparat arbeitet, wäre unsere Kleidung zweifellos glänzend gewesen, wenn sie richtig gepaßt hätte. Das tat sie aber nicht, vor allem der 1,90 Meter große Ernsting stand in seiner Hose und Weste wie ein Abiturient im Konfirmandenanzug und fror dementsprechend. Ich will nicht auf die vielen romantisch aussehenden Kleidungsstücke eingehen, die von uns zur Abhilfe geschaffen wurden. Oft müssen wir trotz der durchaus nicht rosigen Lage herzlich lachen. Durch den dauernden Betrieb mit Maschinen und Drachen zerriß auch manches Kleidungsstück vor der Zeit. Das gilt vor allem von Schuhen und Handschuhen. Eine Kiste mit Lappenkomagern aus Norwegen war nicht mehr rechtzeitig zum Schiff gekommen, und die grönländischen Seehundkamikker bieten hierfür keinen ausreichenden Ersatz. Mit weißgefrorenen, bloßen Füßen wird dann nach Schluß eines langen Drachenaufstiegs im 30 Grad kalten Schnee ein Indianertanz aufgeführt, um das Blut wieder in Fluß zu bringen. Diese Pferdekur half dann auch immer, am meisten Spaß aber hatten dabei die mittollenden Hunde. Fast jeden Abend gibt es Handschuhflicken, man kann ja auch von keinem Stoff verlangen, daß er stundenlanges Drahtspulen, Drahtspleißen, Maschinenbedienen und Schneeschaufeln aushält. Nun, es hat jetzt keinen Zweck, die Sache tragisch zu nehmen, und ein mit mancher lustigen Szene verbundener Wettstreit setzt ein, aus Unterhosen Handschuhe zu nähen, mit Nägeln oder Grammophonnadeln Sperrholzsohlen auf die Schuhe zu schlagen, und manches andere noch.
Wenn auch alle Mängel noch keine ernstliche Besorgnis verursachen, so helfen sie doch mit, daß wir sehnlichst auf die Wiederkehr der Sonne warten, was wir nie gedacht hätten. Besteht doch die Hoffnung, daß wir dann bald wenigstens zu Hundefutter und Frischfleisch kommen. Und die Sonne kommt.
Am 23. Januar findet die Kälteperiode mit einem ungewöhnlich heftigen Föhnsturm ihr Ende. Der Sturm ist so stark, daß zwei Drachen mit großem Gepolter aufs Dach fliegen, samt den Benzindunken, an denen sie angebunden sind. Aber am nächsten Tag ist's noch sehr warm, noch nicht unter -20 Grad, bei vollständiger Klarheit und Windstille scheint von 12 bis 12.04 Uhr wieder die Sonne. Und dann geht es sichtlich aufwärts mit der Helligkeit und der Stimmung. Als ob auch die Tierwelt auf die Sonne gewartet hätte, kreist am 28. Januar seit langer Zeit wieder ein Rabe mit lautem Krächzen über der Station. Später zeigt sich ein Bär in der Ferne, die Fuchsspuren in der Nähe der Station nehmen zu. Nur die sehnlichst erwarteten Moschusochsen bleiben aus, und der neu als Hundefutter eingeführte Hafer- und Reisbrei ist für Polarhunde noch weniger angebracht als für Polarfahrer. Lieber die Füchse als unsere Hunde, heißt jetzt die Losung, und so beschließen wir, gelegentlich die Fuchsjagd auszuüben.
Und während noch ein Physiker und ein angehender Diplomingenieur eine raffinierte Falle konstruieren, hat der Zoologe schon einen weißen Fuchs erwischt, allerdings mit einer an der Station vorhandenen mächtigen Eisenfalle und Revolverschüssen. Nun müssen die Laien ihr Ziel höher stecken, ein lebendiger Fuchs muß herbei. Auf dem Schlitten wird die Holzkastenfalle, ein Wunderwerk der Behelfstechnik, hinunter ins Flußtal in die Nähe eines alten Moschusochsenkadavers gefahren, wo die Füchse ihr Stelldichein haben. Ein Fuchs ist kein Nagetier, belehrt uns der Zoologe, aber ein Polarfuchs ist mit allen Hunden gehetzt, das zeigt unser Reinfall. Voller Spannung sausen wir in einer mondhellen, glitzernden Nacht auf Schneeschuhen ins Tal. Ha, Magdalene knurrt und schnüffelt am Kasten, ganz vorsichtig machen wir den Deckel auf. Der Köder ist verschwunden, dafür ein Häufchen Losung und ein reizendes rundes Loch im Boden, mit weißen Haaren verbrämt, dazu ein beißender Gestank.
Nun nageln wir Blech um den Kasten. Und wieder verschwendet die Polarnacht ihre Pracht an zwei dafür ganz unempfängliche Jagdgesellen und wieder knurrt Magdalene die Falle an, und welch liebliche Musik: sie kriegt Antwort. Eine Stunde später hält ein reizendes Blaufüchslein seinen Einzug in unsere Villa und frißt schon am ersten Abend zum Erstaunen aller Fachgelehrten Kondensmilch vom Löffel. Ungeheuer hart muß der Lebenskampf für die Tierwelt im arktischen Winter sein, keine Spur von Fett zeigt der entsetzlich abgemagerte Fuchskörper, der Magen ist völlig leer. Hunde mit Fuchsfleisch füttern zu wollen, ist ein aussichtsloses Beginnen.
Die Sonne scheint jetzt im Februar schon mit merklicher Kraft. An den schwarzblauen Petroleumfässern taut's am Mittag ein bissel, und die kleinen Rinnsale sind unser ganzes Entzücken; tief unterm Schnee sind die Pflanzen schon recht weit, ein kleiner Zweig, den Peters in der Stube ins Wasser stellt, entwickelt rasch zarte grüne Blättchen. Aber kaum ist die Sonne wieder weg, fällt eisige Erstarrung über alles. Zwischen 40 und 50 Grad Kälte liegen die Temperaturen Ende Februar. Der März beginnt mit lautem Donnern. Ein Eisberg ist zusammengefallen, hat das Eis auf weite Strecken aufgerissen, und in mächtigen Nebelwolken verdampft das wärmere Meerwasser in die kalte Luft. Wir stehen draußen auf dem Eis, unter ihm braust das aufgeregte Meer, und die weiße Fläche wellt sich wie ein Tuch. Wie freuen wir uns über jeden Aufruhr in der Natur, aber wieder erstarrt auf Wochen hinaus alles Leben.
Was soll uns noch euer Glanz, ihr oft bewunderten weißen Polarnächte und strahlenden Nordlichter! Kommt einer von der Beobachtung und ruft uns zu einer besonders auffallenden Erscheinung, so kann er froh sein, wenn ihm nur ein »Scher dich zum Teufel mit deinem Nordlicht« zur Antwort wird. Die strahlende Sonne ist jetzt unser Fall und lockt uns zu immer weiteren Ausflügen. Sie gelten vor allem der Moschusochsensuche. Fünf bis sechs Kilometer nordöstlich der Station ist eine spitze Erhebung, wir nennen sie Fuchsberg, denn ein riesiger Fuchsbau befindet sich auf dem Gipfel. Von dort aus kann man einen großen Teil des Jameson-Landes überblicken, aber nichts ist von Ochsen zu sehen, wir geben es auf. Die Sorge um die Nahrungsmittel wird ernst.
Das einzige, woran wir Überfluß haben, ist Benzin. Der Aufstiegbetrieb kostet weniger Betriebsstoff, als wir annahmen. Die Petroleum- und Wasserstoffvorräte sind aufgebraucht. So beginnen wir in den sonnigen Mittagsstunden in mühsamer Kleinarbeit das Eis aus dem Laderaum des »Johann« zu Pickeln. Der Erfolg ist betrüblich. Die Holzfässer haben im günstigsten Fall nur noch 140 bis 150 Liter Petroleum statt 200. Wenn das Wetter nicht erheblich besser wird, sind wir Mitte April fertig mit dem Petroleumheizen. Am 7. März läßt uns der Kolonievorsteher telegraphieren, daß er uns rät, bis spätestens Ende Mai zurückzukehren, da bald danach die Flüsse aufbrechen und das Meereis unsicher wird. Nun, wir denken noch nicht an Abreise, aber wichtig ist dieser Ratschlag für die Kameraden von »Eismitte«; demnach besteht keine Aussicht für eine Überquerungsabteilung, das Schiff im Juli zu erreichen. Wir melden diese Ansicht nach West. Es ist auch für uns jetzt ganz unmöglich, Depots für ein solches Unternehmen auszulegen. Erstens sind unsere Lebensmittel knapp, zweitens haben wir keine ausreichenden Transportmittel, drittens können wir den wissenschaftlichen Betrieb nicht auf Wochen stillegen, und schließlich können wir Peters, dem es immer schlechter geht, nicht auf längere Zeit allein lassen. Er selbst will uns natürlich durchaus nicht hinderlich sein und gibt sich auch alle Mühe, uns zu helfen, soweit es sein körperlicher Zustand erlaubt, vom 9. März ab aber muß sich seine Hilfe ganz auf gelegentliche leichtere Arbeiten beschränken. An diesem Tage erkrankt er schwer unter starken Schmerzerscheinungen, örtliche Schmerzen in der rechten Bauchseite: Blinddarm. Peters versteht als Zoologe eine ganze Menge von Medizin und hat uns oft erklärt, daß bei der Unmöglichkeit einer Operation nichts weiter hilft, als abwarten und Eis auf die schmerzende Stelle legen. Dies Mittel wenden wir nun bei ihm selbst an, Eis gibt's genug und wasserdichte Beutel aus Ballongummi auch. Auch die nächste Nacht verbringt er unter starken Schmerzen und bittet dringend, an die Kolonie gebracht zu werden.
Sofort stellt der immer hilfsbereite Kolonievorsteher Hoegh auf den von uns drahtlos übermittelten Notruf Peters' eine Hilfsexpedition aus vier Schlitten mit drei Grönländern und ihm selbst zusammen. Eine harte und beschwerliche Reise nehmen die Männer auf sich, noch herrscht der arktische Winter uneingeschränkt. Auch über die Schneeverhältnisse können wir nichts Gutes melden, an manchen Stellen liegt er so tief, daß ein Durchkommen kaum möglich erscheint. Trotz allem reisen am 14. März die vier Schlitten ab. Täglich stehen wir jetzt zwei- bis dreimal drahtlos mit Scoresby-Sund in Verbindung. Es ist gut, daß diese Verbindung wenigstens tadellos klappt. Weiter ist es gut, daß wir noch soviel Benzin haben. So zünden wir nach der mit Hoegh getroffenen Verabredung jeden Tag um 2 und 6 Uhr ein großes Rauchfeuer an. Nachts steht ein Ballon mit roter Laterne in der Luft, tagsüber ein Ballon mit roten Fahnen. Dann wieder schleifen wir eine Dunke Benzin auf den Fuchsberg und machen dort ein Feuer an, sausen zurück in wahnsinniger Hast, daß einem bei 35 Grad Kälte das Wasser vom Körper läuft, um wieder zum Senden zurechtzukommen. Aber immer wieder müssen wir melden: Nichts gesehen. Und dann fällt der Luftdruck, am vierten Tag tobt der Schneesturm über das Land, Nebel und Schnee folgen. Von Scoresby-Sund meldet der Telegraphist, die Frauen seien sehr besorgt. Wir können nur melden, daß wir nichts gesehen haben, aber hoffen, daß die Schlitten nicht weiter vordringen, sondern umkehren.

Aufnahme Oststation. Der Registriereisberg (Höhe 75 Meter).
Am 21. März Frühlingsanfang mit 32 Grad Kälte und Schneefall, sonst nichts Neues. Am 22. werde ich 30 Jahre alt, den Umständen entsprechend sang- und klanglos. Am 23. kommt endlich die Meldung, die Schlitten sind zurück, sie waren schon so weit vorgedrungen, daß sie unser Feuer sahen, aber es war unmöglich durchzukommen, zu gewaltig lagen die Schneemassen. Schlechte Aussichten für unsern Rückmarsch, und doch muß Ende April etwas geschehen, bis dahin reichen die Lebensmittel noch. Immer neue Schneemassen fallen; ein Vielfaches der gewöhnlichen Menge für diese Gegend ist in wenigen Tagen schon heruntergekommen. Am Gründonnerstag klart's wieder auf. Es ist frühlingshaft draußen, nur noch 13 Grad kalt, und die arktische Sonne strahlt so stark, daß das Wasser von den Dächern läuft. Heute ist prachtvolles Flugwetter. Das ist für uns arme flugzeuglose Flugzeugführer Ernsting und mich wieder ein Anlaß, uns auszumalen, wie schön wir in diesem Idealgelände hätten fliegen können. Ganz sicher hätte auch die Angelegenheit mit Peters' Krankheit besser gelöst werden können. Es geht ihm jetzt übrigens wieder ganz gut.
Auch das warme Wetter, nur -12 Grad, hält an, und am Ostersonntag sitzen wir alle vor dem Haus in der Sonne oder üben mit nacktem Oberkörper Skilauf. Fällt man allerdings mal in den etwa 20 Grad kalten Schnee, so bleibt einem im ersten Augenblick die Luft weg. Mitte des Monats wird es dann wieder kälter, die Temperaturen gehen auf fast -30 Grad herunter. Doch lang und stark strahlt jetzt schon die Sonne. Wir benutzen die schönen Tage, um auf einem drei Kilometer von der Station entfernten riesigen Eisberg eine Registrierstation einzurichten. Der Eisturm an der steilen Westwand dieses Berges teilt sich in zwei Spitzen. Von Ballonen lassen wir ein Stahlkabel zwischen diese Spitzen hinauftragen, das an beiden Seiten verankert wird, und nun wird auf der Schattenseite das Instrument hochgeleiert, das die Temperatur und Feuchtigkeit in etwa 70 Meter Höhe aufschreibt. An der Spitze des Eisberges ist es fast immer 15 Grad wärmer als am Fuß.
Auf diesen »frühjahrlichen« Ausflügen lernen wir wieder neue arktische Landschaftsbilder von unerhörter Pracht und Farbenfreudigkeit kennen. Die Wanderungen zwischen den steil aufragenden, opalisierenden, bläulichgrünen Wänden der Eisberge hinterlassen einen unvergeßlichen Eindruck. Einmal finden wir bei der Rückkehr von einem Ausflug unser Haus in dickem Qualm. Der letzte hatte vergessen, die Ofen klein zu schrauben, und diese Prachtexemplare waren wieder einmal explodiert. Als wir die Tür öffneten, schlug uns eine große Stichflamme entgegen, und alles war rauchgeschwärzt. Abwechselnd, solange die Luft anhielt, mußten Ernsting und ich drinnen den Feuerlöscher in Tätigkeit setzen. Es fehlte nicht viel, und wir hätten ins Zelt gemußt, und alle Aufzeichnungen wären verbrannt.

Aufnahme Oststation. Gesamtansicht der Station im Frühling. Rechts Windenhaus und Funkmast.
In diesen Tagen hacken wir auch ein Loch ins Eis und messen die Dicke zu 1,10 Meter. In andern Jahren mag das Eis stärker sein, der hohe Schnee hat den Zuwachs verhindert. Später wird das Loch noch weiter aufgesprengt, Peters will versuchen zu fischen, aber nur eine einzige Qualle kommt zum Vorschein. Unsere Hunde sind übrigens jetzt auch wieder bedeutend unternehmungslustiger und machen dauernd kleinere oder größere Ausflüge. In der Hauptsache mag sie der Hunger nach Frischfleisch treiben. Bei dem schlechten Futterstand haben sie doch jetzt mehr Bedürfnis nach Wärme, während sie früher bei -40 Grad auf dem blanken Boden übernachteten, suchen sie jetzt gern das Zelt oder die Stube auf. Magdalene legt sich abends wie selbstverständlich neben meine Koje, aber nie verunreinigt sie die Stube, schlafe ich, so trommelt sie mir so lange auf den Bauch, bis ich sie hinauslasse.
Dort, wo an der Küste der Schnee verweht ist, taut es jetzt stark, und eine Kette von schwarzen Flecken bildet sich. Aber was das Schönste an diesen Flecken ist, sie werden Anziehungspunkte für ganze Scharen von Schneehühnern. Diese schmecken prachtvoll, der Rest zieht aber bald aus der gefährlichen Nähe der Station fort. Was bedeutet schließlich auch eine Schar Schneehühner für drei Mann und drei Hunde? Das Großwild aber ist und bleibt verschwunden. Nur ein riesiger Polarwolf streift eine Zeitlang um die Station, wir erwischen ihn aber nicht. Das Petroleum zum Heizen und Kochen ist auch bis auf einen kleinen Rest verbraucht. Wenn wir auch nachts in unsern Ochsenfellen warm genug schlafen, so ist doch beim Arbeiten am Tag die Kälte empfindlich. Bis auf Herzbeschwerden geht es Peters jetzt wieder ganz gut, er kann kleine Jagdausflüge unternehmen und sieht blühend aus.
Da ist es am besten, wir ordnen alles in der Station, nehmen das Notwendigste mit und brechen nach der Kolonie auf. Kaum haben wir den ernstlichen Entschluß gefaßt, fällt wieder Schnee, in zwei Tagen 60 Zentimeter. Da müssen wir zunächst warten, bis der gewöhnlich nach größeren Schneefällen wehende Sturm die Schlittenbahn auf dem Eis gefestigt hat, aber wie zum Hohn bleibt dieser Sturm diesmal aus. An den letzten Tagen im April liegt bei Windstille die Temperatur fast 1 Grad über Null, in der Sonne ist es heiß, und der Schnee pappt fürchterlich.
Die Ernährung ist jetzt hundsmiserabel, der Aufbruch kann nicht mehr hinausgeschoben werden, mag kommen was will. Alles, was wir nicht mitnehmen können, wird sorgfältig verpackt und ins Wohn- oder Windenhaus gestellt. Befördert werden müssen einige Instrumente, um wenigstens etwas an der Kolonie arbeiten zu können, und vor allem sämtliche Beobachtungen. Dann muß jeder sein Schlafzeug mitführen, ein kleines Zweimannzelt wird noch vorgesehen und Lebensmittel. Außerdem für jeden fünf Kilogramm Privatgepäck, was er will. Damit ist aber der Schlitten dickvoll, Ein großer Schlittenbau beginnt. Ich verzichte auf mehr als das zugelassene Privatgepäck, nehme dafür aber 65 Kilogramm Dienstgepäck, für das ich mir den Stationsschlitten ausbitte. Ernsting baut aus dreizölligen Brettern ein grundsolides Möbel mit blechbeschlagenen Holzkufen, schön, aber schwer. Peters ist für Leichtbau. Ein zierlicher, schmalkufiger Rodelschlitten wird mit Bambusstäben zu einem weitausladenden Lastschlitten umgebaut. Zunächst ist das Gefährt bestechend, leicht, mit zierlichen Stoßstangen an der Rückseite; vorn soll der wegen seiner Originalität bei Peters beliebte Professor ziehen. Und nun wächst das Gepäck auf den Schlitten zu wilden Bergen, so daß ich unbarmherzig mit der Zugwaage in der Hand kürzen muß, denn so kommen wir bestimmt nicht weiter. – Wir müssen weg, Peters hat jetzt wieder Fieber und Herzschmerzen; wenn's noch lange dauert, sind wir wegen schlechter Ernährung ganz schlapp.
Nun sind wir wieder soweit wie am Anfang. Keine Verbindung mehr mit der Außenwelt. Gern hätten wir von West noch etwas über »Eismitte« gehört, die Sorge um das Ergehen dieser Mannschaft bedrückt uns doch sehr, aber immer noch besteht keine Verbindung. Auch mit Scoresby-Sund ist sie schon seit acht Tagen aus unbekannten Gründen unterbrochen.

Aufnahme Oststation. Magdalene.
Am Sonntag, dem 10. Mai, verlassen wir nachmittags um 6 Uhr nach einer zweiten Verminderung der Schlittenlasten die Station. Ich komme mit meinem Schlitten und Magdalene ganz gut vorwärts, auch Ernsting mit seinem starken Hund, doch sinkt sein Schlitten bei der Schwere zu tief ein. Peters hat Last mit seinem Hund, dem Professor (jetzt Professorchen), er will nicht ziehen und sucht immer möglichst hinter den Schlitten zu kommen. Dieser spurt sehr schlecht und fällt dann, das beste für uns alle, nach 500 Meter um. Die große Reise ist vorläufig zu Ende, aber sie hat einen wichtigen Erfolg. Jetzt finde ich keinen Widerstand mehr bei der Verminderung der Gewichte. Ernstings 100 und Peters' 116 Kilogramm geben jetzt zusammen auf Ernstings Schlitten 90 Kilogramm! Nach einer ungemütlichen Nacht in der kalten Oststation beginnt am 11. Mai gegen 9 Uhr die zweite Ausreise. Peters fiebert, er will allein zurückbleiben, und die Grönländer sollen ihn später abholen; ich glaube es nicht verantworten zu können. Ernsting und Peters haben zwei Hunde für ihren Schlitten, während ich vor meinen Schlitten Magdalene spanne. Dies Tier ist fabelhaft. Läuft der Schlitten in der Spur der andern, zieht es ihn fast allein. Wir wechseln uns im Spuren ab, aber es geht furchtbar schwer. Der Schnee ist zu tief und zu weich. Sechs Kilometer machen wir am ersten Tag, und 150 so sind es. Für zwei Tage haben wir Lebensmittel, dann müssen wir das Depot erreichen. Peters ist recht herunter, wir müssen heute Rast halten von 11.30 bis 12, von 1 bis 4 und von 5 bis 6 Uhr.
Das Wetter ist gut, aber für das wundervolle Landschaftsbild haben wir keinen Sinn, von 10 bis 4 Uhr nachts liegen wir zu dritt in einem Zweimannzelt in einem Schneeloch auf dem Meereis. Es sind -6 Grad, und an Schlafen ist nicht zu denken. Um 4 Uhr morgens kriegen die Hunde halbe Ration für den ganzen Tag und wir etwas warme Kondensmilch mit Butterkeks. Wo sind die schönen Zeiten der Moschusochsenbraten? Wenn nur das Wetter klar bleibt, denn jetzt trägt der Schnee ganz gut. Aber nein, es wird zusehends wärmer, -2 Grad und neblig. Dieser verfluchte Nebel! Man stapft ganz ins Ungewisse, und wir müssen nahe am Ufer laufen, um ab und zu einen schwarzen Fleck zu sehen. Das ist sehr schlimm; während wir vorher große Buchten queren konnten, müssen wir sie jetzt auslaufen, um nicht auf dem Eis ins Uferlose zu marschieren. Wenn wir auch heute oft unterbrechen mußten, so denke ich doch, daß wir 15 Kilometer gemacht haben. Leider geht es Peters jetzt sehr schlecht, er hat hohes Fieber. Außerdem ist er vollkommen schneeblind und muß die Augen zubinden.
Es folgt eine erbärmliche Nacht in einem Schneeloch am Ufer. Seit der Abreise habe ich noch keine Stunde geschlafen. Das ist noch nicht so schlimm, aber die Lust nach etwas Richtigem zu essen wird langsam zur Qual. Wenn jetzt Neuschnee kommt, wird die Lage kritisch. Man weiß nicht mehr, wo man ist, guckt die Depotstange überhaupt noch aus dem Schnee heraus? Mit vielen, vielen Unterbrechungen gehen wir an der Küste entlang, aber dann geht es nicht mehr. Die Hunde bekommen nichts mehr zu fressen, und es tut einem leid, wie die Köter einem jeden Bissen bis in den Mund verfolgen. Es herrscht allgemeine Schlappheit, wir rasten von morgens 8 bis abends 7 Uhr. In der Zeit führe ich die dritte und letzte Verminderung des Gepäcks durch. Manch wertvolles Stück muß liegenbleiben in dem Zelt, das am Abhang fest verankert wird, daneben weht die Stationsfahne, und rote Fähnchen auf dem Meer sollen das Auffinden erleichtern. Mitgenommen werden nur zwei Gewehre mit Munition, Lichtbilder, Beobachtungen, Schlafzeug (ohne Zelt) und der Rest des Brennstoffs. Das Holz von Ernstings Schlitten wärmt die letzte Milchsuppe. Ich dränge zum Aufbruch. Fast scheint es mir selbst zwecklos, denn bei -10 Grad beginnt es jetzt zu schneien, und die Gicht hört ganz auf. Peters wird beim Weitermarsch an Ernsting angebunden, ich suche den Weg, d. h. ich passe auf, daß wir am Ufer bleiben. Das ist ein aufreibendes Geschäft. Manchmal kann ich das Ufer nur dadurch feststellen, daß ich von Zeit zu Zeit nach links abweiche, geht es gleich bergauf, sind wir richtig. Nur selten hilft ein schwarzes Fleckchen zur Orientierung mit, taucht es auf in dem ungewissen Nebelmeer, so sagt zwar keiner etwas, aber jeder denkt an die Depotstange. Gegen 10 Uhr kommt ein etwas länglicher Stein in Sicht, ich versuche Ernsting auszureden, daß es eine Stange ist, Enttäuschungen wiegen jetzt doppelt schwer. Und doch, das Ding bleibt lang, ist eine Stange, kommt näher, es ist unsere Stange. Der Schnee spritzt weg, die Steine fliegen beiseite, die Kiste ist da. Für zehn Tage Lebensmittel!
Was kümmert's uns, daß es schneit, wir bauen uns ein Schneehaus, laden uns den Magen mit halbgefrorenen Fleischklößen, Bücklingen, Würstchen voll, schneiden den Hunden die Gulaschbüchsen einfach mitten auseinander, daß es nur schnell geht, denn dann kommt eine lange, wohltuende Rast. Der Himmelfahrtstag zieht herauf mit blauem Himmel und hellem Sonnenschein. Um 11 Uhr erst wachen wir auf. Ach, was ist das ein Genuß, gleich können wir uns wieder satt essen, die Hunde sind munter und drängen zur Arbeit, die ganze Welt hat ein anderes Gesicht. Endlich können wir auch wieder mal unsere Kleider trocknen; die Kleidung ist überhaupt ein böses Kapitel. Die Stiefel sind so hart, daß wir fast alle aufgelaufene Füße haben. Meine Schuhe sind sogar mitten durchgebrochen, und oft muß ich den Schnee herausmachen. Leinenfetzen haben wir um die Beine gewickelt, um nicht auch von oben noch soviel Schnee in die Stiefel zu bekommen. Ich denke zuerst daran, von den wertvollen Sachen aus dem Instrumentendepot noch etwas zu holen, und fahre ein Stück hinaus, um die Schlittenbahn anzusehen. Die Spur eines kapitalen Bären führt an unserm Haus vorbei, er hat uns nicht gestört, das ist anständig. Als ich zum Lager zurückkomme, herrscht wenig Stimmung zum Zurückfahren. Ernstings Ferse ist ein großes, schmerzendes, schmieriges Loch, und unter dem Fußballen hat er eine schwarze, stechende Stelle, Frost. Peters, der arme Kerl, ist vollkommen hilflos, er wird von Ernsting rührend versorgt. Er hilft ihm essen, an- und ausziehen.

Aufnahme Oststation. Wieder unter Menschen.
Es kommt jetzt also nur noch in Frage: möglichst schnell vorwärts. Doch schwer ist der neue Anfang, und es geht wieder verzweifelt langsam, aber die Hunde ziehen wieder besser. Magdalene geht beim Anrucken immer ein Stück zurück und wirft sich dann mit aller Gewalt ins Geschirr. In der Nacht vom 14. auf 15. wird die Schneebahn endlich glänzend. Ganze Strecken ziehen die Hunde allein, allerdings rennen sie manchmal querab einer Fuchsspur nach; Peters kann sich zum Teil auf den Schlitten setzen, während er vorher daran angebunden war. Ganz bewußt erzeuge ich eine gewisse Hast und verschließe mich gegen Zurufe von hinten, haltzumachen; nur zum Essen halten wir. Meine Aufgabe ist es dann immer, einen Windschutz aus Schnee zu bauen, während Ernsting kocht und Peters versorgt. Morgen können wir zum letztenmal auf Petroleum kochen. Doch die Landschaft zeigt wieder schneefreie Stellen, und vielleicht läßt sich genug dürres Heidekraut finden. Am 15. schlafen wir in der warmen Mittagssonne, brechen um 19 Uhr auf und erreichen in schneller Fahrt den Steinmann bei Kap Hooker. Schon seit einiger Zeit sind die beiden Hunde – der Professor tut, als ob er lahm sei, und macht was er will – sehr unruhig und ziehen so toll, daß wir kaum mit können.
Um 22 Uhr finden wir die Erklärung. Sieben schwarze Punkte tauchen am Horizont auf und kommen in jagender Eile näher. Sind das Moschusochsen, jetzt, wo uns Sinn und Zeit für eine Jagd fehlen? Wenige Minuten später sind wir Mittelpunkt einer lebendigen Szene: sieben Grönländer mit ihren Hundeschlitten, darunter unsere Freunde vom letzten Jahr, Josua, Manasse und Hans, aber jetzt fast unkenntlich im dicken Pelz. Was gibt es doch merkwürdig viele und merkwürdig kleine Menschen und Hunde!
Die Begrüßung ist herzlich. Sofort haben wir wieder den besten Eindruck von den Leuten. Sie haben kaum Peters' Zustand erkannt, als wie der Wind ein Zelt aufgebaut und er möglichst warm und weich dort untergebracht wird. Ich bekomme Briefe. Hoegh ist besorgt um uns. Auch in der Kolonie war die Not im Winter groß. Es gab wenig Frischfleisch. Deshalb sehen die Hunde so kümmerlich aus wie Füchse. Jetzt sind die Grönländer unterwegs, um unsere Kurzwellenstation zu holen, die dänische Station ist gestört und die Kolonie seit Anfang Mai von der Welt abgeschnitten. Der Telegraphist hofft auf Ernsting, der als Maschinist noch in guter Erinnerung steht. Vom Telegraphisten erhalte ich einen Brief mit schwerwiegendem Inhalt. Alfred Wegener, unser Führer, ist seit November auf dem Inlandeis mit seinem grönländischen Begleiter Rasmus verschollen, das bedeutet den Tod der beiden. Schwer lastet diese Nachricht auf uns und den Grönländern. Stumm stehen die harten, abenteuererprobten Männer im Kreise um uns. Trauer senkt sich über das Lager, nur die Hunde krakeelen an den Schlitten. Die Mitternachtsonne übergießt mit ungeheurer Farbenpracht die weiten Schneeflächen, riesigen Eisberge und steilen Bergmassive im Hintergrund, das ist die ergreifendste Feier für die Toten. Und dann kommst du, treuer Josua, drückst mir stumm die Hand und nestelst eine verkommene Zigarre aus dem Anorak als Trost.
Jetzt auf zur Weiterreise. Wir haben keine Zeit zu verlieren, um noch möglichst viele von den wissenschaftlichen Aufgaben im Sinn unseres großen Führers zu lösen. Hei, das ist ein anderes Fahren, wie die wilde Jagd braust der Schlittenzug dahin. Nach kurzem Aufenthalt in Kap Stewart und Kap Hope erreichen wir am 17. Mai wohlbehalten die Kolonie.
Herzlicher Empfang, knatternde Fahnen in der blauen Luft, und bald sitzen wir beim dampfenden Kaffee unter unsern Freunden. Wie man sich freut, daß wir wieder da sind, geht am besten aus den Worten des Telegraphisten hervor, worin er sagt: »So, Hoegh, nun sind wir wieder alle beieinander.«
Kurze Tage der Ruhe, die wir bitter nötig haben, und Ernsting und ich reisen wieder zurück mit dem Bestyrer, neun Grönländern, zehn Schlitten und 80 Hunden. Peters hat sich schnell erholt und hofft, an der Kolonie jetzt endlich etwas zoologisch arbeiten zu können. Als wir Ende Mai wieder reisen, kommen schon die ersten Blumen an warmen Stellen zum Vorschein, und vereinzelte Mücken summen durch die Luft. Doch nachts liegen die Temperaturen noch weit unter 10 Grad. Es ist ein anstrengendes, aber vergnügliches Reisen, wir werden zu Grönländern. Gemeinsam sind Zelt und Kochtopf, gemeinsam alles, was geschossen wird, und die harmlosen Vergnügungen. Bald lernen wir die Hundepeitsche zu gebrauchen und den Seehund zu beschleichen. Hinter einem weißen Segel wird das vorsichtige Tier an seinem Atemloch auf dem Eis überlistet und ihm die Kugel in Kopf oder Hals gejagt. Stolz schleife ich meinen ersten Seehund ins Lager, denn wir brauchen gerade Fleisch. Täglich gibt's rohe oder gebratene Seehundleber und Unmengen Fleisch. 30 Seehunde wurden in sieben Tagen von Hunden und Menschen verbraucht. An der Station und am Instrumentendepot ist das Gepäck in bester Ordnung, aber sonst hat das Tauen in der Sonne bös gewirkt. 50 Zentimeter hoch steht das Eis im Haus, die Tür müssen wir aufbrechen. Lustige Szenen spielen sich ab. Die Grönländer können alles brauchen und sind mit kindlichem Eifer hinter dem Müllhaufen her. Nach einer abenteuerlichen Rückfahrt – die Flüsse sind inzwischen aufgebrochen und machen das Eis in der Nähe des Landes unsicher – gelangen wir mit den wertvollsten Materialien wieder zur Kolonie. Selbst die schweren Stücke, wie Motor und Winde, können auf den Hundeschlitten zurückgebracht werden.
Die Rückkehr erfolgt gerade zur rechten Zeit. Nun beginnen die Wochen in denen das Eis zwar noch unweigerlich fest liegt, aber für große Transporte zu mürbe ist. Strahlungsmessungen, Ballonverfolgungen, Drachenaufstiege bilden wieder die Hauptarbeit. Um wieviel leichter geht es jetzt, wo es nicht mehr so kalt und immer Tag ist. Die Windverhältnisse sind zwar immer noch schlecht, aber mit zwei Schlitten und zehn Hunden fahren wir oft den großen 35-Quadratmeter-Drachen drei bis vier Kilometer aufs Meer hinaus, der Motor reißt ihn mit Vollgas durch die 800 bis 1000 Meter hohe Windstille hindurch, dort faßt er Wind und steigt mehrere tausend Meter hoch. Viel Schlaf gibt's jetzt nicht, manchmal dauern die Aufstiege ununterbrochen mehrere Tage. Doch gibt es in Notlagen, wenn der Föhnsturm droht, viel freiwillige Helfer, allen voran der Kolonievorsteher.
Mit Macht setzt jetzt der kurze, aber glutvolle arktische Sommer ein. Unvergeßlich bleiben die Eindrücke von den gelegentlichen Jagdausflügen in die Umgebung der Kolonie. Steilauf steigen gleich hinter den Häusern die in der Mittagssonne liegenden Berghänge. Jenseits trifft man wieder auf ewigen Schnee, der in breiter Bahn hinunter zur Walroß-Bucht führt. Still liegt der Mittag auf diesem wundervollen Stück Erde, selten kommt ein Mensch dorthin. Hohe Berge, von blendend weißen Gletschern unterbrochen, rahmen ein grünes, mit bunten Blumen reich übersätes Tal ein, mitten darin ein fischreicher See. Oder man wandert auf Schneeschuhen über das Eis nach Kap Tobin, wo dicht am Meer in felsiger Umgebung eine fast 70 Grad heiße Quelle entspringt. Sehr häufig kommen wir auch in die Behausungen der Grönländer. Am eigenen Leib haben wir die harten Bedingungen verspürt, unter denen sie leben. Manche Lebensgewohnheit, die uns anfangs abschreckte, verstehen wir heute und wissen, daß diese Menschen so leben müssen. Und wenn es das einfache Leben ist, was ihnen den Stempel des Frohsinns aufdrückt und sie ohne europäische Sitten und äußere Lebensform die schönsten menschlichen Tugenden üben läßt, so sind sie darum zu beneiden.

Aufnahme Oststation. Das Schiff ist da.
Kurz nach Sonnenwende gerät die Kolonie in eifrige Tätigkeit, in vier Wochen soll das Schiff kommen, obwohl die Eisdecke jetzt noch geschlossen ist. Tagelang waschen Frauen Eisbärfelle und trocknen sie an der Sonne für den Transport. Kostbare Fuchsfelle werden geordnet, Riesentonnen mit Seehundspeck fertiggemacht, Seehundfelle aufgestapelt und schließlich die Ladebrücke errichtet. Die ersten Kajaks schwimmen wieder in den Wasserrinnen zwischen den Eisschollen, und überall ist Erwartung. Wann wird das Eis gehen, wird es überhaupt gehen? Zwei dänische Expeditionsschiffe liegen seit Wochen im Eise fest. Und dann ertönt doch eines Tages der freudige, langgezogene Ruf von einem Posten auf dem Berg: »Umiarssuit, umiarssuit«, »das große Schiff«. In majestätischer Ruhe tauchen die vier Maste der »Gertrud Rask« hinter Kap Tobin auf, eine halbe Stunde später donnert der Böller, das Schiff liegt im Hafen.
Gleich fahren wir hinüber, mit uns zwei Männer von der dänischen Fangkompanie, Bruhn und van Havn, die ebenfalls nach abenteuerlichem Winter hierher zur Heimfahrt kamen. Herzliche Begrüßung drüben, viel Leute sind diesmal an Bord. Das gibt eine enge Heimreise. Doch jetzt ist erst mal der Postsack Trumpf, und schnell stehle ich mich mit ihm aus der Zivilisation, die mir sowieso noch schwerfällt. Alle haben von zu Hause gute Nachrichten. Dann kommt der Tag, wo wir das gastliche Haus des Bestyrers verlassen und auf das Schiff gehen. Jaulend rennt Magdalene am Ufer hin und her, leb auch du wohl, treues Tier. Wenn es uns auch sehr nach Hause zieht, der Abschied fällt schwer.
Es drängt mich, zugleich im Namen meiner beiden Kameraden den Bericht über unsern Aufenthalt in Grönland mit dem Dank an alle zu beschließen, die uns bei der Erfüllung unserer Aufgaben geholfen haben: Professor Alfred Wegener für die geistige Führung und Sorge für das Zustandekommen der Expedition, der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft, ihrem Präsidenten Staatsminister Schmidt-Ott und seinen Mitarbeitern, für die Aufbringung der Mittel und für die viele Mühe bei der schwierigen Vorbereitung der aerologischen und meteorologischen Sonderausrüstung, auch allen wissenschaftlichen Instituten in Deutschland und ihren Mitgliedern, die uns mit Rat und Tat zur Seite standen, ich nenne vor allem das Observatorium Lindenberg, seinen Direktor Hergesell und den Spitzbergenmeteorologen Professor Robitzsch. Nicht zuletzt danken wir den dänischen Behörden für ihr Entgegenkommen, in Grönland Bestyrer Hoegh, Telegraphist Kaldahl, ihren Familien und allen Grönländern.
Grönlands Küsten verschwinden am Horizont, Island und die Färöer tauchen ins Meer, schließlich umbraust uns wieder der Trubel der Großstadt Kopenhagen. Vor drei Wochen noch führte mich der Hundeschlitten über das Eis Grönlands, heute brütet hochsommerliche Glut über der einsamen, sandigen Kiefernlandschaft der Mark, und vor mir steht ein kleiner, nackter Junge, unbeschwert von Rührseligkeit. Kaum drei Monate war er alt, als sein Vater abreiste, und nun erklärt er in kindlichem Kauderwelsch dem fremden Mann den Gebrauch eines Badeschwamms. Eine wahrhaft vergnügliche Einführung in das geregelte Leben der mitteleuropäischen Zivilisation.