
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
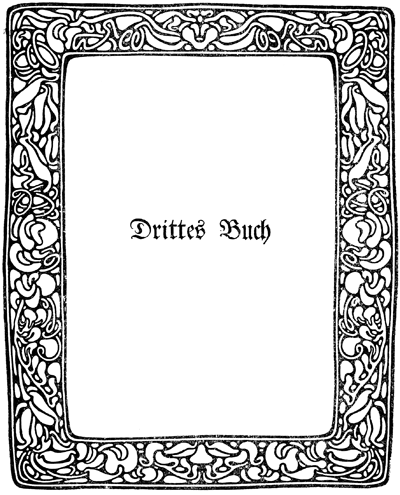

 Die Uhren im Haus gingen schreckhaft laut. Man hörte sie durch die Stille der Nacht wie mahnende Stimmen.
Die Uhren im Haus gingen schreckhaft laut. Man hörte sie durch die Stille der Nacht wie mahnende Stimmen.
O, wie rasend schnell jagte die Zeit hin! Eben war es noch Abend gewesen – eben Mitternacht – und nun schlug die Pendüle auf dem Kaminsims schon ein kurzes, helles, hartes Eins!
Mit einem Zusammenschaudern hob die einsame Frau die Hände an die Schläfen und preßte sie fest dagegen. Ah, wie es dadrinnen hämmerte, und wie sich Gedanken – quälende Gedanken – jagten, rasend schnell und rastlos wie das hastige Ticken der Uhren!
Alle schliefen im Haus. Der Diener, die Mädchen; auch ihr Mann – längst! Nur sie, sie allein hatte noch keinen Schlaf gefunden.
Und draußen schlief auch alles. Die Kiefern standen ums Haus, regungslos, und ihre dunklen Silhouetten, steif wie aus Pappe geschnitten, hoben sich scharf ab vom silbrigen Nachthimmel.
Kein Ruf, kein Fußtritt, kein Räderrollen, kein Singen, kein Lachen, nicht einmal ein Hundegekläff stieg auf aus der schlafenden Grunewaldkolonie. Nur wie ein leises Seufzen ging's um die weiße Villa mit dem roten Dach und den grünen Läden.
Die Mutter, die auf ihren Sohn wartete, horchte auf: war da jemand?! Nein, es war das Nachtlüftchen, das dort die Äste der alten verknorrten Kiefer zu bewegen versuchte.
Käte Schlieben stand jetzt am Fenster – vorhin hatte sie es ungeduldig aufgerissen – nun beugte sie sich hinaus. Soweit ihr Auge reichte, war niemand zu sehen – gar niemand. Er kam noch immer nicht!
Zwei schlug die Uhr. Mit einem fast verzweifelten Blick sah sich die Frau nach dem Kamin um: o, diese quälende, diese unerträgliche Uhr! Es konnte nicht sein, sie mußte falsch gehen, es konnte nicht sein, daß es schon so spät war!
Käte hatte schon manchen Abend aufgesessen und auf Wolfgang gewartet, aber so lange wie heute war er noch nie ausgeblieben. Paul hatte nichts dagegen, wenn der Junge seine eignen Wege ging. ›Liebes Kind,‹ hatte er ja gesprochen, ›das kannst du nicht ändern. Lege dich hin und schlafe, das ist viel vernünftiger. Der Junge hat den Schlüssel, er wird schon wohlbehalten ins Haus kommen. Einen jungen Menschen in seinem Alter kannst du nicht mehr gängeln. Laß ihn – du verleidest ihm ja sonst unser Haus – laß ihn doch ruhig gehen!‹
Was Paul sich dachte! Freilich, er hatte ganz recht, gängeln durfte sie ihn nicht mehr! Das konnte sie auch gar nicht mehr – hatte sie nie gekonnt. Aber wie konnte sie sich ruhig zu Bett legen?! Schlafen würde sie ja doch nicht. Wo blieb er?! –
Käte war grau geworden. In den drei Jahren, die verstrichen waren seit des Sohnes Einsegnung, hatte sie sich äußerlich sehr verändert. Während Wolfgang in die Höhe wuchs, stark und sich breitete wie ein junger Baum, hatte ihre Gestalt sich geneigt wie eine Blume, die regenbeschwert ist oder welken will. Ihre feinen Züge waren dieselben geblieben, aber die Haut, die so lange eine fast mädchenhaftzarte Glätte bewahrt hatte, war schlaffer geworden; ihre Augen sahen aus, als hätten sie viel geweint. Die Bekannten fanden Frau Schlieben recht gealtert.
Wenn sich Käte jetzt in dem Spiegel sah, hatte sie nicht mehr das freudige Erröten über die eigne wohlkonservierte Erscheinung; sie sah sich nicht gern mehr an. Es hatte ihr irgend etwas innerlich und äußerlich einen Ruck gegeben. Was das gewesen war, ahnte niemand. Schlieben freilich wußte es, aber er sprach mit seiner Frau nicht darüber: warum sie von neuem aufregen, alte Wunden wieder aufreißen?!
Er hütete sich wohl, noch einmal wieder auf jenen Konfirmationstag zurückzukommen. Es war auch bequemer so. Den Jungen hatte er sich freilich damals noch ordentlich vorgenommen, ihm in strengen Worten sein undankbares Verhalten klar gemacht und ein rücksichtsvolleres und besonders gegen die Mutter liebevolleres Benehmen von ihm verlangt. Und der junge Mensch, den sein Betragen wohl längst reuen mochte, hatte dagestanden wie ein armer Sünder, nichts hatte er gesagt, den gesenkten Blick nicht gehoben. Und als der Vater ihn zuletzt zur Mutter geführt hatte, hatte er sich führen lassen und sich von der Mutter, die ihn mit beiden Armen umschlang, umschlingen lassen. Sie hatte über ihm geweint und ihn dann geküßt.
Und dann war nie, nie mehr darüber geredet worden. –
Das weiße Haus mit seinem heiteren Grün und Rot, an dem und in dem immer wieder neue Verschönerungen und Verbesserungen vorgenommen wurden, fiel allen, die vorübergingen, als besonders anheimelnd auf. Die Sonntagsausflügler blieben am schmiedeeisernen Gitter stehen und bewunderten die Blumenfülle; im Sommer die hängenden Geranien der Balkons und die Pracht der edlen Rosenstöcke, im Winter die Azaleen und Kamelien hinterm dicken Glas des Wintergartens und die farbigen Primelreihen zwischen den Doppelfenstern und die frühen Hyazinthen und Tulpen. Die Dame in dem weichen Tuchkleid mit dem welligen grauen Scheitel und dem sanften Gesicht, auf dem es wie ein leicht-wehmütiges Lächeln lag, paßte gut zu dem Haus und zu den Blumen, zu dem ganzen Frieden. ›Entzückend‹, sagten die Leute.
Wenn Wolfgang früher, als Junge, so etwas gehört hatte, hatte er den Bewunderern eine Fratze geschnitten: was gingen die Haus und Garten an, da war doch nichts daran zu bewundern?! Nun schmeichelte es ihm, wenn sie stehen blieben, wenn sie's gar beneidenswert fanden. O ja, es war recht nett hier! Er fühlte sich.
Schlieben und Käte hatten nie einen besonderen Wert auf Geld gelegt, sie hatten ja immer genug gehabt, das gute Auskommen war ihnen einfach selbstverständlich; sie ahnten es gar nicht, daß der Sohn Wert auf den Reichtum legte. Wenn Wolfgang jetzt daran dachte, daß er einst in knabenhaftem Ungestüm das alles nicht geachtet hatte, fortgelaufen war in die Irre, ohne Geld, ohne Brot, mußte er lächeln: wie kindisch! Und wenn er bedachte, daß er einmal, als er doch schon älter geworden war und überlegen konnte, mit Ungestüm etwas verlangt hatte, das gleichbedeutend gewesen wäre mit Aufgabe all dessen, was sein Leben so bequem gestaltete, dann schüttelte er jetzt den Kopf: zu einfältig!
Es gewährte ihm eine gewisse Genugtuung, sich mit andern zu vergleichen. Kesselborn schwitzte noch in Prima – der sollte durchaus studieren, Theologie, womöglich wegen seines Adels Hofprediger werden – Lehmann mußte seinem Vater bei der Spedition helfen, trotz des Einjährigen, mit dem er abgegangen war, Möbelwagen karren! Und Kullrich – ach, Kullrich erst, der hatte die Schwindsucht! Wie seine Mutter. Trauriges Erbe das!
Ein halb geringschätziges, halb mitleidiges Lächeln zog Wolfgangs Mundwinkel herab, wenn er der Schulkameraden gedachte. Hieß das leben?! Ah, und leben, leben war so wunderschön!
Wolfgang hatte das Bewußtsein seiner Kraft: er konnte Bäume entwurzeln, Mauern, die sich ihm entgegenstellten, umpusten, als seien es Kartenblätter.
Es war nicht länger mehr mit ihm auf der Schule gegangen, seine Glieder und seine Neigungen hatten nicht mehr in die Schulbank hineingepaßt. Er bekam ja auch schon einen Schnurrbart! Wie ein schwarzer Schatten war der schon lange auf der Oberlippe zu ahnen gewesen; nun war er da, er war da! So ein fertiger Mensch konnte doch nicht mehr in Sekunda sitzen? Wozu auch, er sollte ja auch kein Gelehrter werden?! Mit der Reife für Prima war Wolfgang abgegangen.
Schlieben hatte die Absicht, ihn gleich nach Absolvierung der Schule ins Ausland zu schicken, noch für ein Jahr aufgegeben; erst wollte er ihn doch noch etwas unter Augen behalten. Nicht, daß er ihn etwa so ängstlich wie Käte zu hüten bestrebt war, aber der alte Sanitätsrat, der gute Freund, auf den er so viel gab, hatte ihn in einer vertraulichen Stunde, in der sie ganz allein, von niemandem gehört, beim Glase Wein saßen, gemahnt: »Hören Sie, Schlieben, nehmen Sie den Jungen doch lieber in acht! Ich würde ihn noch nicht so weit weggeben – er ist so jung. Und er ist ein Unband und – wissen Sie, bei dem, was er als Kind durchgemacht hat – hm, man kann doch nicht sagen, ob das Herz so mit standhält!«
»Warum nicht?« hatte Schlieben da betroffen gefragt, »Sie halten ihn also für krank?!«
»Nein, durchaus nicht!« Der Arzt war ordentlich ärgerlich geworden: gleich diese Übertreibung! »Wer sagt denn was von ›krank‹?! Aber drauf losgehen darf der Bursche doch nicht so. Na, und Jugend hat doch keine Tugend! Das wissen wir doch auch noch von unsrer Zeit her!«
Und beide Männer hatten sich zugenickt, waren heiter geworden und hatten gelacht.
Wolfgang bekam ein Reitpferd, ritt erst in der Bahn und dann täglich seine paar Stunden draußen. Der Vater hielt darauf, daß er nicht zu viel im Kontor saß: was ihm zum kaufmännischen Beruf not tat, würde er schon lernen, rechnen konnte er ja!
Die beiden Sozien, alte Junggesellen, waren entzückt von dem frischen Jungen, der mit der Reitgerte ins Bureau kam und auf dem Kontorbock hockte, als säße er auf einem Gaul.
Schlieben hörte keine Klagen über den Sohn; das ganze Personal, Leute, die ihre zehn, zwanzig Jahre in der Firma waren, alle gut eingeölte, tadellos funktionierende Maschinen, schnurrten um den jungen Menschen herum: das war doch der künftige Chef! Es ging alles glatt.
Beide Eheleute bekamen Komplimente über den Sohn zu hören: Mn famoser Mensch! Welche Frische! »Er soll ja erst werden,« sagte Schlieben dann wohl, aber man merkte ihm doch eine gewisse innere Befriedigung an. Er hatte nicht diese peinliche Seelenunruhe wie seine Frau. Käte zog nur die Augenbrauen ein wenig höher und lächelte ein leicht zustimmendes, etwas wehmütiges Lächeln.
Sie konnte sich nicht mehr über den großen Menschen freuen, wie sie sich einst über das kleine Jungchen auf ihrem Schoß gefreut hatte. Ihr war, als sei ihr überhaupt die Fähigkeit zur Freude abhanden gekommen, langsam zwar, ganz allmählich, aber doch stetig, bis der letzte Rest dieser Fähigkeit auf einmal ausgerissen ward, mit der Wurzel, an einem Tag, in einer Stunde, in jenem unglückseligen Augenblick – ›ich will gehen, ich will an meine Mutter denken, wo ist sie?!' – seitdem! Sie wünschte ihm noch alles Beste auf Erden, aber sie war gleichgiltiger geworden; müde. Er hatte sie zu schwer aufs Herz getreten, schwerer, als einst seine kleinen urkräftigen Füße auf ihren Schoß gestampft hatten. –
Mit einem tiefen Seufzer lehnte sich die einsam Wartende weiter zum Fenster hinaus. War das nicht unerhört, unverzeihlich von ihm, so spät nach Hause zu kommen?! Wußte er denn nicht, daß sie auf ihn wartete?!
In der Anwandlung eines Zornes, der ihr sonst selten kam, ballte sich ihre Hand, die sich auf den Fenstersims stützte, zur Faust. Sie war eine Närrin, auf ihn zu warten! War er nicht alt genug – achtzehn Jahre – brauchte er noch erwartet zu werden wie ein Knabe, der zum ersten Mal allein von einer Kindergesellschaft heimkommt?! Er hatte sich mit andern jungen Leuten in Berlin verabredet – weiß Gott, in welchem Nachtcafé sie jetzt herumbummelten!
Sie stieß mit dem Fuß auf. Ihr heißer Atem stieg wie ein Rauch in die kalte klare Frühlingsnacht, es fröstelte sie vor Überwachtheit und Unbehagen. Und Stunden fielen ihr ein, alle Stunden, die sie schon um ihn verwacht hatte, und eine große Bitterkeit quoll in ihr auf. Selbst ihre Zunge kostete Bitternis – das war Galle. Nein, sie fühlte jetzt nicht mehr die Liebe früherer Jahre! Damals, ja damals war – selbst wenn sie um ihn litt – noch Wonne dabei gewesen; jetzt fühlte sie nur dumpfen Groll. Warum hatte er sich in ihr Leben gedrängt?! O, wie war das früher so glatt, so sorgenlos, so – ja, so viel glücklicher gewesen?! Wie hatte er sie zerbrochen – würde sie sich je wieder aufrichten können?!
Nein! Ein hartes kurzes Nein. Und dann dachte sie an ihren Mann. Auch den hatte er ihr geraubt. Waren sie zwei nicht früher eins gewesen, ganz eins? Nun hatte sich dieser dritte dazwischen gedrängt, sie beide immer weiter und weiter voneinander geschoben – bis daß er hier ging, und da sie!
Ein jäher Schmerz stieg in der Grübelnden aus, ein erbarmungsvolles Mitleid mit sich selber trieb ihr die Tränen in die Augen; heiß tropften sie nieder auf die Hände, die sich auf dem kalten Steinsims ballten. Wenn er, wenn er doch nie in ihr Leben –
Da schreckte sie eine Hand, die ihre Schulter berührte, auf. Blitzschnell wendete sie sich: »Bist du endlich da?!«
»Ich bin's,« sagte Schlieben. Er war aufgewacht, hatte sie nicht neben sich atmen hören und sich dann geärgert: wahrhaftig, da saß sie nun wieder unten und wartete auf den Jungen! Solch ein Unverstand! Und als er noch ein Weilchen gelegen und auf sie gewartet und sich geärgert hatte, warf er notdürftige Kleidung über, schlüpfte in die Morgenschuhe und tappte durchs nächtliche Haus. Ihn fröstelte, und er war schlechter Laune. Nicht genug, daß er aus dem besten Schlaf gestört war und daß sie morgen Migräne haben würde, nein, was noch schlimmer war, Wolfgang mußte es ja geradezu unleidlich finden, so beobachtet zu werden!
Es war natürlich, daß er mit ihr schalt. »Was ist denn Schlimmes dabei, wenn er einmal ein bißchen länger ausbleibt, ich bitte dich, Käte! Das ist ja rein lächerlich von dir! Ein bißchen bummeln, das hab' ich auch als junger Mensch getan, und meine Mutter war, Gott sei's gedankt, verständig genug, sich nicht darum zu kümmern. Komm, Käte, komm jetzt zu Bett!«
Sie wich zurück. »Ja – du!« sagte sie langsam, und er wußte nicht, wie sie's meinte. Sie drehte ihm den Rücken und lehnte sich wieder zum Fenster hinaus.
Er stand noch einige wenige Augenblicke und wartete, aber als sie nicht mitkam, sich nicht einmal umwandte nach ihm, schüttelte er den Kopf: man mußte sie lassen, sie wurde eben geradezu wunderlich!
Schlaftrunken stieg er wieder allein die Treppe hinauf; er taumelte fast vor Müdigkeit, und die Glieder waren ihm schwer, und trotzdem war sein Denken klarer, unerbittlicher als am Tage, an dem so vieles rund umher ablenkt und zerstreut. Eine Sehnsucht stieg in dieser Stunde in ihm auf nach einer Frau, die seine alten Tage in sanftem Geleise ruhig und freundlich führen würde, deren Lächeln nicht nur Schein war wie das Lächeln auf Kätes Gesicht. Eine Frau, die mit dem Herzen lächelt, ach, leider, so eine war seine Käte nicht!
Mit einem Seufzen der Enttäuschung legte sich Schlieben wieder nieder und zog stierend die Decke hoch hinauf. Aber es dauerte lange, bis er einschlafen konnte. Wenn der Junge doch nur endlich käme! Heute dauerte es wirklich etwas lange! Solche Bummelei ging denn doch zu weit! –
Der Morgen graute, als eine Droschke langsam die Straße herunter zockelte. Vor der weißen Villa hielt sie an, und zwei Herren halfen einem dritten heraus. Die beiden, die den dritten unter den Armen gefaßt hielten, lachten, und der Kutscher auf dem Bock, der interessiert herunterguckte, lachte auch verschmitzt: »Soll ick helfen, meine Herren? Na, jeht's?!«
Sie lehnten ihn gegen das Gitter, das den Vorgarten verschloß, tippten auf die Klingel, sprangen dann eilig wieder in den Wagen und schlugen den Schlag zu: »Los Kutscher, zurück!«
Die Klingel hatte nur einen leisen vibrierenden Ton von sich gegeben – wie einen bangen Hauch – Käte hatte ihn gehört, obgleich sie im Sessel eingeschlafen war; nicht fest, es war mehr ein hindämmerndes Versinken gewesen. Nun sprang sie erschrocken auf, es gellte ihr in den Ohren. Rasch ans Fenster! Draußen am Gitter lehnte jemand. Wolfgang –?! Ja, ja, er war's! Aber warum schloß er denn nicht auf und kam herein?!
Was war ihm denn passiert?! Es war ihr auf einmal, als müßte sie um Hilfe rufen: Friedrich! Paul! Paul! Nach den Mädchen klingeln. Es war ihm etwas geschehen, es mußte ihm etwas geschehen sein, – warum kam er denn nicht herein?!
Er lehnte da so schwer gegen das Gitter. Ganz seltsam! Der Kopf hing ihm auf die Brust, der Hut saß ihm im Nacken. War er krank?!
Oder hatten ihn Strolche angefallen?! Die abenteuerlichsten Ideen schossen ihr plötzlich durch den Kopf. War er verletzt? Herrgott, was war ihm denn widerfahren?!
Befürchtungen, über die sie sonst gelächelt haben würde, kamen ihr jetzt zu dieser Stunde, in der es nicht Nacht mehr war, und doch auch noch nicht Tag. Ihre Füße waren kalt und steif, wie erfroren, kaum kam sie bis zur Haustür; den Schlüssel konnte sie erst nicht finden, und als ihre zitternden Hände ihn ins Schloß stießen, brachten sie ihn nicht herum. Sie war so ungeschickt in ihrer Hast, so sinnlos in ihrer Angst: etwas Furchtbares mußte geschehen sein! Ein Unglück! Sie fühlte das.
Endlich, endlich! Der Schlüssel ließ sich endlich drehen. Und nun stürzte sie durch den Vorgarten ans Gittertürchen; eine eisige Morgenluft schlug ihr entgegen wie Winterhauch. Sie drückte das Gitter auf: »Wolfgang!«
Er gab keine Antwort. Sein Gesicht konnte sie so nicht recht sehen; er stand unbeweglich.
Sie faßte seine Hand: »Um Gottes willen, was ist dir denn?!«
Er rührte sich nicht.
»Wolfgang! Wolfgang!« Sie rüttelte ihn in höchster Angst; da fiel er so schwer gegen sie, daß er sie beinahe umgestoßen hätte und stammelte, lallte wie ein Blöder, dessen schwerer Zunge man etwas eingelernt hat: »Par–don!«
Sie mußte ihn führen. Sein Atem, ganz voll Alkoholdunst wehte sie an. Ein ungeheurer Ekel, schrecklicher noch als die Angst vorher, packte sie. Das war das Furchtbare, das sie erwartet hatte –, nein, das war noch furchtbarer, noch unerträglicher! Er war ja betrunken, betrunken! So mußte ›betrunken‹ sein!
In ihre Nähe war noch nie ein Betrunkener gekommen; nun hatte sie einen dicht bei sich. Ein Entsetzen schüttelte sie, daß ihr die Zähne aufeinander schlugen. O pfui, pfui, wie ekelhaft, wie gemein! Wie niedrig erschien er ihr, und sie selber wie miterniedrigt. Das war ihr Wolfgang nicht mehr, ihr Kind, das sie an Sohnes Statt angenommen hatte! Dies hier war ein ganz gewöhnlicher, ein ganz gemeiner Mensch von der Straße, mit dem sie nichts, aber auch gar nichts mehr zu schaffen hatte!
Hastig wollte sie ihn von sich schieben, ins Haus eilen, die Tür hinter sich schließen – mochte er sehen, was er machte! Aber er hielt sie fest. Seinen Arm hatte er schwer um ihren Nacken gelegt, er drückte sie fast nieder; so zwang er sie, ihn zu führen.
Und widerwillig, mit innerem verzweifeltem Aufbäumen und doch bezwungen, führte sie ihn. Sie konnte ihn doch nicht aufgeben, dem Gespött der Dienstboten preisgeben, dem Gelächter der Straße! Wenn ihn jemand so sähe?! Wie lange noch, und die ersten Menschen kamen vorüber, die Milchjungen, die Bäckermädchen, die Straßenarbeiter und die frühen Karlsbadtrinker. Um Gottes willen, wenn jemand eine Ahnung davon bekäme, wie tief gesunken er war!
»Stütze dich, stütze dich fest,« sagte sie mit zitternder Stimme. »Nimm dich zusammen – so!« Sie brach fast unter ihm zusammen, aber sie erhielt ihn auf den Füßen. Er war so betrunken, er wußte nicht, was er tat, er wollte sich durchaus vor der Schwelle niederlegen, platt auf die Steinstufen. Aber sie riß ihn auf.
»Du mußt – du mußt,« sagte sie, und er folgte ihr wie ein Kind. ›Wie ein Hund‹ dachte sie.
Nun hatte sie ihn in der Vorhalle – die Haustür war wieder verschlossen – aber nun kam die Angst vor der Dienerschaft. Noch war diese nicht auf, aber nicht lange mehr, und Friedrich tappte auf Lederpantoffeln von der Gärtnerwohnung herüber, und die Mädchen kamen aus ihren Mansarden herunter, das Fegen und Aufräumen fing an, das Öffnen der Fenster, das Hochziehen der Jalousieen, daß Helle – grausame Helle – in jeden Winkel drang. Sie mußte ihn die Treppe herauf bekommen, in sein Zimmer, ohne daß jemand etwas ahnte, ohne daß sie einen Menschen zu Hilfe rief!
Einen Augenblick hatte sie an ihren Mann gedacht –, aber nein, auch den nicht, kein Mensch durfte ihn so sehen! Mit einer Kraft, die sie sich selber nie zugetraut hätte, half sie ihm hinauf; sie lud ihn sich förmlich auf. Und sie flehte ihn an dabei, immer flüsternd, aber mit hartnäckiger Eindringlichkeit: »Leise, leise!« Sie mußte ihm schmeicheln, sonst ging er nicht weiter: »Leise, Wölfchen! Geh, geh, Wölfchen – so ist's schön, Wölfchen!«
Es war eine Höllenqual. Er stolperte und polterte; bei jedem Anstoßen seines Fußes an die Treppenstufen, bei jedem Knarren des Geländers unter seiner dagegensinkenden Hilflosigkeit, fuhr sie zusammen, und ein banger Schreck lähmte sie fast. Wenn jemand das hörte, wenn jemand das hörte! Aber weiter, voran!
»Leise, Wölfchen, ganz leise!« Es klang wie eine Bitte und war doch ein Befehl. Wie er sie vordem bezwungen hatte, mit seinem schweren Arm, so zwang sie ihn jetzt mit ihrem Willen.
Alle im Hause mußten taub sein, daß sie diesen Lärm nicht hörten! Der Frau klang jeder Tritt wie ein Donnergepolter, das sich im weiten Raum mit Rollen fortsetzt und bis in den fernsten Winkel hallt. Paul mußte auch taub sein! Sie kamen an seiner Tür vorüber; gerade am Schlafzimmer der Eltern blieb der Trunkene stehen, er wollte durchaus nicht weiter – da hinein – nicht einen Schritt mehr weiter! Sie mußte ihn locken, wie sie einst das Kindchen gelockt hatte, das süße Kindchen mit den blanken Beerenaugen, das vom Stühlchen aus noch weiter bis zum nächsten Halt laufen sollte. »Komm, Wölfchen, komm!« Und sie brachte ihn glücklich vorüber.
Nun waren sie endlich in seinem Zimmer. »Gott sei Dank, Gott sei Dank,« stammelte sie, als sie ihn auf dem Bette hatte. Sie war so blaß wie er, dessen blödes Gesicht immer fahler und fahler wurde im sich hellenden Morgengrau. Hier – hier – ach, das war derselbe Raum, in dem sie einst vor vielen Jahren – unendlich lange war's her! – um des Kindes teures, geliebtes Leben mit Angst und Zittern gerungen hatte, vor der Allmacht Gottes gekrochen war wie ein Wurm: nur leben, Gott, laß ihn nur leben! Ach, wäre er damals lieber gestorben!
Wie ein Pfeil, aus allzu straffem Bogen geschnellt, blitzschnell dahinschwirrt, so durchschwirrte das ihren Sinn. Der Gedanke war ihr schrecklich, sie verzieh ihn sich nicht, aber sie konnte sich seiner nicht erwehren. Mit bebenden Knieen stand sie, entsetzt ob der eignen Herzlosigkeit, und dachte doch: wäre er damals lieber gestorben, besser wär's gewesen! Hier – hier, das war dasselbe Zimmer noch, in dem sie dem Heranwachsenden die Einsegnungskleider anprobiert hatte! Nun zog sie dem Erwachsenen die Kleider aus; zerrte ihm den Smoking ab, die eleganten Beinkleider – so gut es eben ging bei seiner nun völligen Bewußtlosigkeit – und schnürte ihm die Lackschuhe auf.
Wo war er gewesen?! Ein Geruch von Zigaretten und Parfüm und Weinneigendunst strömte von ihm aus; es benahm ihr fast den Atem. Da hing derselbe Spiegel noch, in dem sie neben ihrem hellen weichen Frauengesicht das bräunliche Knabengesicht gesehen hatte, frisch und rundwangig, ein wenig derb, ein wenig trotzig, aber doch so hübsch in seiner Kernigkeit, so lieb in seiner Unschuld. Und jetzt –?!
Ihr Blick streifte das fahle Gesicht, aus dessen offenem Munde der dunstige Atem mit Schnarchen und Röcheln ging, und sah dann im Spiegel ihr eignes verängstetes, überwachtes Antlitz, in dem alle Weichheit sich verschärft hatte zu harten, vergrämten Linien. Ein Schauer durchrieselte sie; mit ihrer kalten Hand strich sie sich die grauen, verwirrten Strähnen aus der Stirn, ihre Augen zwinkerten, als wollten sie weinen. Aber sie zwang die Tränen nieder: nun durfte sie nicht mehr weinen, die Zeit war vorbei!
Sie stand noch eine Weile mitten im Zimmer, regungslos mit angehaltenem Atem, die überangestrengten Arme schlaff herunterhängen lassend; dann schlich sie auf Zehen zur Tür. Er schlief ganz fest. Von außen verschloß sie die Tür und steckte den Schlüssel in ihre Tasche – niemand durfte hinein!
Sollte sie sich nun noch zu Bette legen? Schlafen konnte sie ja doch nicht – o Gott, die innere Unrast war so groß, – aber sie mußte sich niederlegen, ja, sie mußte das, was sollten sonst die Mädchen denken und Paul?! Mußte dann aufstehen wie alle Tage, sich waschen, ankleiden, am Frühstückstisch sitzen, essen, sprechen, lächeln, wie alle Tage, als sei nichts, gar nichts geschehen. Und doch war ihr so viel geschehen!
Sie fühlte eine trostlose Vereinsamung, als sie neben ihrem Mann im Bette lag. Da war ja niemand, dem sie klagen konnte. Hatte Paul sie schon früher nicht verstanden, jetzt würde er sie erst recht nicht verstehen; er war ja so ganz anders geworden mit der Zeit. Und war er nicht jetzt noch dazu blind vernarrt in den Jungen? Merkwürdig, früher, als sie den Knaben so geliebt hatte, war's immer zu viel der Liebe gewesen – wie oft hatte er ihr deswegen Vorwürfe gemacht – und jetzt, jetzt – nein, sie verstanden sich eben nicht mehr! Sie mußte allein durch, ganz allein!
Als Käte die ersten Geräusche im Hause hörte, wäre sie gerne aufgestanden, aber sie zwang sich noch, liegen zu bleiben: es würde den Leuten auffallen, sie so früh zu sehen. Aber eine furchtbare Angst quälte sie: wenn der Mensch – jener – dort drüben in seinem Rausch nun aufwachte, Lärm schlug, an die verschlossene Tür polterte?! Was sollte sie dann sagen, um ihn zu entschuldigen, was machen?! Fiebernd vor Unruhe lag sie im Bett. Endlich war es ihre gewohnte Aufstehenszeit.
»Der Junge ist wohl schrecklich spät nach Hause gekommen,« fragte Paul beim Frühstück. »Wohl vielmehr früh? Was?«
»O nein! Gleich nachdem du heraufgegangen warst!« »So? Ich habe aber noch eine ganze Weile wach gelegen!« Er hatte es leichthin gesagt, ohne jeden Argwohn, aber sie bekam doch einen Schrecken. »Wir – wir – er hat mir noch eine ganze Weile erzählt,« brachte sie stockend heraus.
»Töricht,« sagte er, weiter nichts und schüttelte den Kopf.
O, es war doch schwer, zu lügen! In welche Lage brachte Wolfgang sie!
Als Schlieben zur Stadt gefahren war, die Köchin unten im Souterrain wirtschaftete und Friedrich im Garten, belauerte Käte das Hausmädchen: wie lange brauchte das denn heute im Schlafzimmer? Scharf sagte sie: »Sie müssen rascher hier oben aufräumen, Sie sind ja über die Maßen langsam!«
Ganz verwundert über den ungewohnten Ton sah die Dienerin die Herrin an und sagte nachher unten zur Köchin: »Hu, ist die Gnäd'ge heute schlechter Laune, hat die mich gehetzt!«
Käte hatte dabei gestanden, bis das Aufräumen des Schlafzimmers beendet war, sie hatte das Mädchen förmlich gejagt. Nun war sie allein, ganz allein mit ihm hier oben, nun konnte sie sehen, was mit ihm war!
Würde er noch betrunken sein?! Als sie vor seiner Türe stand, hielt sie den Atem an; das Ohr geneigt, lauschte sie. Drinnen war nichts zu hören, nicht einmal ein Atemzug. Wie ein Dieb, sich scheu umblickend, schloß sie auf und schlich hinein, hinter sich wieder zuschließend. Vorsichtig, leise trat sie auf das Bett zu; doch so hastig fuhr sie zurück, daß der hochlehnige Stuhl, an den sie stieß, mit Gepolter umstürzte. Was war das – da – was?!
Ein ekler Dunst, der die geschlossene Stube erfüllte, reizte sie zur Übelkeit; zum Fenster taumelnd, riß sie es auf, stieß den Laden zurück – da sah sie. Da lag er wie ein Tier – er, der sorgsam Gewöhnte, er, der als Kind seine kleinen Hände ausgestreckt hatte, klebte nur ein Krümchen daran: ›Sauber putzen!‹ und geweint hatte dabei. Jetzt lag er da, als merkte er nichts, als ginge ihn das um ihn her nichts an, als ruhte er in lauter Reinheit; hielt die Augen, deren kohlschwarze Wimpern wie Schatten auf die bleichen Wangen fielen, fest geschlossen und schlief den Schlaf bleischwerer Müdigkeit.
Sie wußte nicht, was sie tat. Sie hob die Hand, um ihn ins Gesicht zu schlagen, ihm ein Wort zuzurufen, ein heftiges Wort des Ekels und Abscheus; sie fühlte, wie ihr der Speichel im Munde zusammenlief, wie es sie drängte, auszuspeien. Das war zu schrecklich, zu schmutzig, zu entsetzlich!
Durchs offene Fenster drang ein Strom von Licht herein, von Licht und Sonne; eine Amsel sang, voll und rein. Da war Sonne, da war Schönheit, aber hier, hier –?! Wimmernd hätte sie ihr Antlitz verhüllen mögen, davonlaufen und sich verbergen. Aber wer sollte dann hier tun, was zu tun nötig war, wer Ordnung schaffen und Reinlichkeit?! Der umgestürzte Stuhl, die hastig abgezogene Kleidung, der widrige Dunst – ach, all das mahnte nur zu deutlich an eine wüste Nacht. Das durfte nicht so bleiben. Und wenn sie ihn auch nicht mehr liebte – nein, nein, keine Stimme in ihrem Herzen sprach von Liebe mehr! – der Stolz gebot ihr, sich nicht vor den Dienstboten zu demütigen. Beiseite schaffen, niemanden etwas davon merken lassen, rasch, rasch!
Die Zähne zusammenbeißend, den Ekel zurückdrängend, der ihr immer wieder und wieder würgend aufstieg, fing Käte an, zu waschen, zu reiben, zu putzen, holte sich immer wieder Wasser, den Krug voll, einen ganzen Eimer voll. Heimlich mußte sie es tun, auf Zehen über den Gang schleichen. O weh, wie das plätscherte, mit welchem Geräusch das Wasser aus dem aufgedrehten Hahn in den untergehaltenen Eimer schoß! Daß nur niemand, niemand etwas merkte!
Sie hatte ein Scheuertuch gefunden, und, was sie in ihrem Leben noch nie getan hatte, nun tat sie's: sie lag wie eine Magd auf den Knieen und wischte den Boden ab und rutschte vor dem Bett herum, bis unters Bett, und reckte die Arme lang und streckte und dehnte sich, um nur ja jeden Winkel zu erreichen. Nichts durfte vergessen werden, alles mußte überschwemmt werden mit frischem, reinem, erlösendem Wasser. Es kam ihr alles im Raum beschmutzt vor – wie beleidigt und erniedrigt – die Dielen, die Möbel, die Wände; am liebsten hätte sie auch die Tapeten abgewaschen oder sie ganz heruntergerissen, diese schönen, tieffarbenen Tapeten.
So hatte sie noch nie in ihrem Leben gearbeitet; der Schweiß der Anstrengung und der Angst klebte ihr das elegante Morgenkleid mit dem Seideneinsatz und den Spitzen an den Körper. An den Knieen zeigte der Rock dunkle Flecke vom Rutschen im Naß, der Saum der Schleppe war tief ins Wasser getunkt; unordentlich hingen ihr die Haare, sie hatten sich gelöst und zausten um das erhitzte Gesicht. Kein Mensch hätte so Frau Schlieben erkannt.
Gott sei Dank, endlich! Mit einem Seufzer der Erleichterung sah Käte sich um; eine andre Luft herrschte nun im Zimmer. Der frische Wind, der hereinwehte, hatte alles geklärt. Nur er, er paßte noch nicht in die Reinheit! Seine Stirn war voll klebrigen Schweißes, seine Wangen erdfahl, seine Lippen geschwollen, geborsten, sein Haar borstig, sich sträubend in Büscheln. Da wusch sie auch ihn, kühlte seine Stirn und trocknete sie, rieb seine Wangen mit Seife und Schwamm, holte Bürste und Kamm, kämmte und glättete sein Haupt, lief hurtig hinüber in ihr Zimmer, brachte das Toilettenwasser von ihrem Tisch und ließ es über ihn hinsprühen. Nun noch die Decke frisch bezogen! Mehr konnte sie nicht tun, es ward ihr zu schwer, ihn zu heben. Denn er erwachte nicht. Wie ein gefällter Baum – tot, starr, unbeweglich – lag er da und merkte nichts von den zitternden Händen, die über ihn hinhuschten, zupften und glätteten, bald hier, bald da.
Wie lange sie um ihn geschafft hatte, wußte sie nicht; ein Klopfen an der Tür brachte sie in die Zeit zurück.
»Ich, der Friedrich!«
»Was wollen Sie?«
»Gnädige Frau, der Herr läßt zu Tisch bitten!«
»Zu Tisch – der Herr –?!« Sie faßte sich an den Kopf: war's möglich, Paul schon zurück – Mittagszeit? Das konnte nicht sein! »Wieviel Uhr?« schrie sie schrill. Selbst nach der Uhr zu sehen, die auf dem Nachttisch lag, fiel ihr nicht ein; sie hätte es ja auch nicht gekonnt, die kostbare goldene Uhr, das Geschenk zur Konfirmation, stand still, nicht aufgezogen zur Zeit.
»Gnädige Frau, es ist halb drei,« sagte Friedrich draußen. Und dann wagte es der langjährige Diener respektvoll zu fragen: »Ist der junge Herr nicht wohl, daß er noch nicht aufgestanden ist? Kann ich vielleicht was helfen, gnädige Frau?«
Einen Augenblick zauderte sie: sollte sie Friedrich einweihen? Es wäre dann leichter für sie! Aber die Scham schrie aus ihr: »Es ist nichts zu helfen, gehen Sie nur! Der junge Herr hat Migräne, er wird noch eine Stunde liegen bleiben. Ich komme gleich!«
Und sie stürzte hinüber in ihr Zimmer; das Kleid zu wechseln war keine Zeit mehr, aber wenigstens das heruntergefallene Haar mußte sie sich aufstecken, den Scheitel glattstreichen und ein Häubchen darauf stülpen mit zartem Band.
»Noch in Morgentoilette?« fragte verwundert Schlieben, als sie ins Eßzimmer trat. Etwas von Vorwurf war auch in der Frage; er mochte es nicht leiden, wenn man nicht korrekt zum Mittagstisch kam.
»Du kamst heute ausnahmsweise früh,« entschuldigte sie sich. Sie wagte nicht, frei aufzusehen, unendlich gedemütigt; essen konnte sie auch nicht, eine unleidliche Erinnerung verekelte ihr jeden Schluck und jeden Bissen.
»Wo ist denn Wolfgang?«
Da war die Frage, auf die sie eigentlich hätte vorbereitet sein müssen und die sie dennoch traf, gänzlich vernichtend. Sie hatte keine Abwehr. Was sollte sie antworten? Sollte sie sagen: er ist krank?! Dann ging der Vater hinauf und sah nach ihm. Sollte sie sagen: er ist betrunken und schläft?! O Gott, nein, es war nicht zu verheimlichen! Sie wurde blaß und rot, ihre Lippen zuckten und sagten nichts.
»Aha!« Schlieben lachte plötzlich auf – ein wenig gutmütig, ein wenig spöttisch – und dann streckte er ihr die Hand über den Tisch hin und sah sie ruhig an: »Du mußt dich nicht so aufregen, Käte, wenn der Junge mal einen kleinen Kater hat. So was kommt vor, das macht jede Mutter durch!«
»Aber nicht so schrecklich – nicht so schrecklich!« Sie schrie laut heraus, von Schmerz und Zorn überwältigt. Und dann packte sie die Hand ihres Mannes und klemmte sie zwischen ihre beiden feuchtkalten Hände und raunte ihm zu, halb erstickt: »Er war betrunken – ganz betrunken – sinnlos betrunken!«
»So – ?!« Schlieben runzelte die Stirn, aber das Lächeln erstarb nicht ganz auf seinen Lippen. »Nun, ich werde mal mit dem Jungen, wenn er ausgeschlafen hat, ein Wörtchen reden. Sinnlos betrunken, sagst du?«
Sie nickte.
»Es wird wohl nur halb so schlimm gewesen sein! Aber überhaupt, betrunken, das darf nicht vorkommen! Angeheitert, du lieber Gott!« Er zuckte die Achseln, und wie eine sonnige Erinnerung glitt's über sein Gesicht. »Angeheitert – wer wäre jung gewesen und nicht einmal angeheitert?! Ah, ich erinnere mich noch ganz deutlich an meinen ersten Schwips, der Kater nachher war fürchterlich, aber der Schwips selber schön, wunderbar schön! Ich möchte ihn nicht missen!«
»Du – du bist auch einmal angetrunken gewesen?!« Sie sah ihn starr an mit weiten Augen.
»Angetrunken – das nennt man doch nicht gleich angetrunken! Angeheitert,« verbesserte er. »Du mußt nicht so übertreiben, Käte!« Und dann aß er weiter, als wäre nichts geschehen, als hätte ihm diese Unterhaltung gar nicht den Appetit rauben können.
Sie fieberte: wann würde Wolfgang erwachen, und was würde dann sein?!
Gegen Abend hörte sie oben seinen Tritt, hörte ihn sein Fenster schließen und wieder öffnen und sein leises Pfeifen wie Vogelgezwitscher. Paul ging, seine Zigarre rauchend, im Garten auf und ab. Sie saß zum ersten Mal in diesem Frühjahr auf der Veranda und sah zu ihrem Mann hinunter in den Garten. Es war lind und warm. Jetzt fühlte sie, daß Wolfgang nahte; sie wollte den Kopf nicht wenden, so schämte sie sich, aber sie wendete ihn doch.
Da stand er in der Tür, die vom Eßzimmer hinaus in die Veranda führte; hinter ihm war das Dämmerlicht des Parterreraumes, vor ihm die flutende Helle der Abendsonne. Er blinzelte und kniff die Augen zusammen, rot war sein Gesicht bestrahlt – oder schämte er sich so? Was würde er nun sagen, wie beginnen?! Ihr Herz klopfte; sie hätte kein Wort sprechen können, ihre Kehle war wie zugeschnürt.
»'n Abend,« sagte er laut und vergnügt. Und dann räusperte er sich, wie eine leichte Verlegenheit herunterschluckend, und sagte leise, der Mutter einen Schritt näher tretend: »Pardon, Mama, ich habe verschlafen, ich hatte keine Ahnung, wie spät es war – ich war todmüde!«
Sie sagte noch immer nichts.
Er wußte nicht, wie er mit ihr daran war. Sie war so still, das beirrte ihn ein wenig. »Ich bin gestern abend nämlich sehr spät nach Hause gekommen!«
»So – bist du?« Sie wendete den Kopf von ihm weg und sah wieder angelegentlich hinaus in den Garten, wo Paul jetzt gerade mit Friedrich sprach und mit dem Finger zu einem schon blühenden Zierkirschenbaum hinaufwies.
»Ich glaube wenigstens,« sagte er. Was sollte er sagen? War sie böse?! In der Tat, er mußte wohl sehr spät nach Hause gekommen sein, um wieviel Uhr konnte er sich nicht erinnern, er konnte sich überhaupt an nichts klar erinnern, es war ihm alles etwas dunkel. Er hatte auch einen bösen Traum gehabt, sich scheußlich gefühlt, aber jetzt war ihm wohl, so wohl! Nun, wenn sie was gegen ihn hatte, konnte er ihr auch nicht helfen!
Die Lippen wieder zu einem leisen Pfeifen, wie Vogelzwitschern spitzend, wollte er, die Hände in den Taschen seiner gutsitzenden modischen Hose, von der Veranda herab in den Garten schreiten, als sie ihn zurückrief.
»Du wünschest, Mama?«
»Du warst betrunken,« sagte sie leise und heftig.
»Ich – ?! O!« Eine plötzliche Verlegenheit überkam ihn: war er wirklich betrunken gewesen? Er hatte keine Ahnung davon. Aber freilich, es konnte am Ende sein, er hatte ja auch gar keine Ahnung, wie er nach Hause gekommen war!
»Du hast wohl wieder aufgesessen und auf mich gewartet?!« Mißtrauisch sah er sie von der Seite an, seine breite Stirn zog sich über der Nasenwurzel in eine so tiefe Falte, daß die dunklen Brauen ganz zusammenstießen. »Du mußt nicht immer auf mich warten,« sagte er dann mit heimlicher Ungeduld, aber äußerlich im Ton der Besorgnis. »Das nimmt mir ja jede Lust, etwas mitzumachen, wenn ich denke, du opferst deine Nachtruhe. Bitte, Mama, tu das nicht mehr!«
»Ich werde es nicht mehr tun,« sagte sie und sah in ihren Schoß. Sie hätte ihn nicht ansehen können, so verachtete sie ihn. Wie hatte er dagestanden, so breit und groß und dreist und ganz vergnügt ›'n Abend‹ gesagt! Tat so, als ob er von nichts wüßte, nicht, daß er vor ein paar Stunden noch hatte kriechen wollen auf allen vieren, sich strecken auf die Schwelle, als wäre da sein Bett oder er ein Hund! War so unbefangen, als hätte er nicht heute mittag noch da oben in seinem Zimmer gelegen, so – so – schmutzig! Als wenn sie ihn nicht gesehen hätte in seiner tiefsten Erniedrigung. Nein, nie, nie mehr würde sie ihn küssen können, ihn streicheln, die Arme um seinen Hals legen, wie sie's dem Knaben so gern getan hatte! Er war ihr auf einmal ein ganz fremder Mensch geworden.
Sie sagte kein Wort mehr, machte ihm keinen Vorwurf. Teilnahmslos hörte sie das, was jetzt ihr Mann unten im Garten zu ihm sprach.
So milde wie Schlieben diesen Mittag seiner Frau gegenüber geschienen hatte, jetzt, dem Sohne gegenüber, war er es denn doch nicht. Ernsthaft sagte er: »Ich höre, du bist angetrunken nach Hause gekommen – was soll das heißen?! Schämst du dich nicht?«
»Wer hat das gesagt?«
»Das ist ja ganz gleichgiltig, ich weiß es, und das genügt!«
» Sie natürlich,« sagte der Sohn bitter. »Mama übertreibt gleich alles so. Betrunken bin ich sicher nicht gewesen, nur ein bißchen im Schwum – das waren wir alle – Gott, Papa, man kann sich doch nicht ausschließen! Was soll man denn auch sonst machen an so 'nem langen Abend?! Aber schlimm war's jedenfalls nicht. Ich bin ja jetzt so frisch!« Und er packte den Zierkirschenbaum, unter dem sie gerade standen, mit beiden Händen, als wolle er ihn ausreißen, und ein ganzer Schauer von weißen Blüten ging nieder über ihn und den Weg.
»Laß meinen Baum nur stehen,« sprach der Vater lächelnd.
Käte sah: Paul konnte lachen?! Also so ernst war's ihm doch nicht! Aber sie erregte sich nicht mehr, wie sie sich wohl früher hierüber erregt haben würde, es war ihr, als sei alles in ihr kalt und tot. Sie hörte die beiden sprechen wie aus weiter, weiter Ferne, ganz schwach nur war der Stimmen Klang, und doch sprachen sie beide laut und auch lebhaft.
Die Unterhaltung war nicht so ganz freundschaftlich; wenn Schlieben dem Jungen auch nicht ernstlich zürnte, so hielt er es doch für Pflicht, ihm Vorhaltungen zu machen. Er schloß: »Ekelhaft sind solche Saufereien!« Im stillen dachte er freilich: ›so schlimm, wie Käte es macht, kann es unmöglich gewesen sein, man müßte doch sonst dem Jungen etwas anmerken? Seine bräunlichen Wangen waren glatt und fest, so blank, so frisch gewaschen, seine nicht großen, aber durch ihre dunkle Tiefe auffallenden Augen hatten heute sogar einen besonderen Glanz.
Schlieben legte dem Sohne die Hand auf die Schulter: »Also, wenn wir gute Freunde bleiben sollen, nie mehr so etwas, Wolfgang!«
Sorglos zuckte dieser die Achseln: »Ich weiß wirklich nicht, Papa, was ich verbrochen habe. Es ist mir alles etwas schleierhaft. Aber es soll nicht mehr vorkommen, gewiß nicht!«
Und sie schüttelten sich die Hände.
Nun rührte sich doch etwas in Käte; sie hätte aufspringen mögen, schreien: ›Glaub' ihm nicht, Paul, glaub' ihm nicht! Er wird sich doch wieder betrinken, ich traue ihm nicht! Ich kann ihm ja nicht trauen! Hättest du ihn gesehen, wie ich ihn gesehen habe – o, er war ja so gemein!‹ Und wie eine Vision tauchte plötzlich eine Bauernschenke vor ihr auf, eine Schenke, die sie nie gesehen hatte – rohe Kerle saßen um den Holztisch, die Ellbogen aufgestemmt, pafften stinkenden Tabak von sich, tranken wüst, gröhlten wüst – – ah, saßen da nicht sein Vater, sein Großvater auch darunter, alle die, von denen er abstammte?! Eine furchtbare Angst fiel über sie her: das konnte ja nie, nie gut enden!
»Du bist so bleich, Käte,« sagte Schlieben beim Abendbrot. »Du hast zu lange stillgesessen; es ist doch noch zu kalt draußen!«
»Ist dir nicht wohl, Mama?« fragte Wolfgang höflich-besorgt.
Käte antwortete dem Sohn nicht, sie sah nur zu ihrem Manne hin und schüttelte verneinend-abwehrend den Kopf: »Mir ist ganz wohl!«
Da gaben sie sich zufrieden.
Wolfgang aß mit gutem Appetit, mit besonders großem sogar; er war völlig ausgehungert. Es gab auch lauter gute Sachen, die er gern aß: warmes Hühnerfrikassee mit Kalbsmilch, Klößchen und Krebsschwänzen, und dann noch feinen Aufschnitt, Butter und Käse und junge Radieschen.
»Junge, trink nicht so viel,« sagte Schlieben, als Wolfgang schon wieder nach der Weinflasche griff.
»Ich habe Durst,« sagte der Sohn mit einem gewissen Trotz, schenkte sein Glas aufs neue voll bis an den Rand und goß es hinunter auf einen Zug.
»Das kommt vom Schwärmen!« Der Vater hob leicht drohend den Finger, lächelte aber dabei.
›Vom Saufen kommt's,‹ dachte Käte, und der Ekel schüttelte sie wieder; sie hatte sonst, selbst in Gedanken, nie einen solchen Ausdruck gebraucht, nun dünkte ihr keiner stark, schroff, verächtlich genug.
Es kam keine gemütliche Unterhaltung zustande, trotzdem das Zimmer so wohnlich war, der Tisch so reich besetzt, Blumen auf dem weißen Tuch, zierlich eingesteckt in eine kristallene Schale, und über dem allen mildes, gedämpftes Licht unter einem grünseidenen Schirm. Käte war so einsilbig, daß Paul bald nach der Zeitung griff, der Sohn verstohlen durch die Nase gähnte und endlich aufstand. Das war denn doch zu gräßlich öde, hierzusitzen! Ob er noch einmal nach Berlin hineinfuhr oder zu Bette ging?! Er wußte selbst nicht recht, was tun.
»Du gehst jetzt zu Bett?!« Es sollte wie eine Frage klingen, aber Käte hörte selber, daß es nicht wie eine Frage klang.
»Natürlich geht er jetzt zu Bett,« sagte der Vater, einen Augenblick den Kopf hinter seiner Zeitung hervorhebend. »Er ist müde. Gute Nacht, mein Junge!«
»Ich bin nicht müde!« Wolfgang wurde rot und heiß: was fiel ihnen denn ein, ihm einreden zu wollen, er sei müde?! Er war doch kein Kind mehr, das man zu Bette schickt! Besonders der Mutter Ton reizte ihn – ›du gehst jetzt zu Bett‹ – das war ja ein Befehl!
In seinen dunklen Augen wurde der Glanz zum Flackern; ein Zug von Trotz und Widersetzlichkeit machte sein Gesicht nicht angenehm. Man hätte wohl sehen können, wie es in ihm aufbrauste, aber der Vater sagte: »Gute Nacht,« und hielt ihm, mit seiner Zeitung vorm Gesicht, ohne aufzublicken, die Hand hin.
Die Mutter sagte auch: »Gute Nacht!«
Und der Sohn ergriff eine Hand nach der andern – auf der Mutter Hand drückte er den gewohnten Kuß – und sagte: »Gute Nacht!«
