
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wir ließen zwei Abteilungen in der Umgegend zurück, um am nächsten und übernächsten Tag die Strecke noch weiter zu zerstören, und ritten am 1. April nach Abdullas Lager zurück. Schakir, großartig, wie stets, hielt beim Einzug eine glänzende Parade ab, und Tausende von Freudenschüssen wurden zu Ehren seines Teilsieges abgefeuert. Das ganze Lager feierte fröhlich den Tag.
Abends wanderte ich in dem Dornbaumgehölz hinter den Zelten umher und sah dann plötzlich zwischen dem dichten Gezweig hindurch einen flackernden Lichtschein, der von einer hochaufschlagenden Flamme herrührte; und durch Flammen und Rauch drang das Schlagen von Trommeln herüber, begleitet von rhythmischem Händeklatschen und dem tief dröhnenden Chorgesang von Eingeborenen. Ich schlich mich leise näher und erblickte ein riesiges Feuer, um das herum in weitem Kreise Hunderte von Ateiba dicht nebeneinander auf dem Boden hockten. Sie blickten gespannt auf Schakir, der, aufrecht und ganz allein in ihrer Mitte, den Gesang mit einem Tanz begleitete. Er hatte seinen Mantel abgeworfen und trug nur das weiße Kopftuch und das lange weiße Gewand, über das, wie über sein bleiches, leidenschaftliches Gesicht der gewaltige Feuerschein rötliche Lichter warf. Während er sang, warf er den Kopf zurück; und am Ende jeder Phrase hob er seine Hände, ließ die weiten Ärmel bis auf die Schultern zurückgleiten und schwenkte wie beschwörend die nackten Arme. Die Ateiba rings um ihn schlugen mit den Händen den Takt oder sangen auf seinen Wink die Schlußwendung aus tiefer Kehle mit. Das Gehölz, in dem ich stand, war außerhalb des Lichtkreises dichtgedrängt voll Araber anderer Stämme, die flüsternd miteinander sprachen und die Ateiba beobachteten.
Am Morgen beschlossen wir, der Bahnlinie erneut einen Besuch abzustatten, um nochmals einen Versuch mit den selbsttätigen Minen zu machen, die bei Aba el Naam halb und halb versagt hatten. Der alte Dakhil-Allah erklärte, daß er diesmal persönlich mitkommen wolle; die Aussicht auf Plünderung eines Zuges verlockte ihn. Wir nahmen etwa vierzig Dschuheina mit, die mir kräftiger zu sein schienen, als die etwas zu hoch gezüchteten Ateiba. Nur einer der Häuptlinge der Ateiba, Sultan el Abbud, ein Kumpan Abdullas und Schakirs, weigerte sich, zurückzubleiben. Er war der Scheik eines ziemlich ärmlichen Clans des Stammes, ein gutmütiger und etwas unbesonnener Mensch, dem im Kampfe schon mehr Pferde unterm Sattel getötet worden waren als irgendeinem andern Krieger der Ateiba. Er zählte etwa sechsundzwanzig Jahre, war ein großer Reitersmann, steckte voller Spaße, stellte gern irgendwelchen Ulk an, war immer laut und lebhaft, hatte eine hochgewachsene, kräftige Gestalt, großen viereckigen Kopf, faltige Stirn und tiefliegende, glänzende Augen. Ein noch jugendlicher Backen- und Schnurrbart verbarg sein hartes, eckiges Kinn und den vollen geraden Mund, in dem weiße aufeinandergepreßte Zähne wie ein Wolfsgebiß glänzten.
Wir nahmen ein Maschinengewehr und dreizehn Mann zur Bedienung mit, um den Eisenbahnzug, falls wir ihn abfingen, unter Feuer zu nehmen. Schakir gab uns mit der feierlichen Höflichkeit, die er den Gästen des Emirs entgegenbrachte, eine halbe Stunde Wegs das Geleit. Diesmal folgten wir dem Wadi Ajis fast bis zu seiner Vereinigung mit dem Hamdh; es war von frischem Grün bedeckt und voll guter Weideplätze, da es in diesem Winter bereits zweimal überflutet worden war. Dann bogen wir nach rechts ab, kamen über einen Graben zu einer Niederung und schliefen dort im Sande; um Mitternacht wurden wir von einem Regenschauer aufgestört, der in kleinen Bächen über den Boden dahinströmte. Aber der nächste Morgen war hell und warm, und wir gelangten auf die weit gebreitete Ebene, wo die drei Täler von Tubja, Ajis und Dschisi zusammenflossen und sich mit dem Tal des Hamdh vereinigten. Das Bett des Hauptstroms war dicht mit Asla-Gesträuch bewachsen, gerade wie bei Abu Serebat, und hatte auch den gleichen, von unregelmäßigen Sandhöckern durchsetzten Untergrund. Doch der Buschgürtel war nur zweihundert Yard breit, und jenseits davon erstreckte sich meilenweit die Ebene mit ihrem wirren Geäder von flachen Flutrinnen. Zu Mittag hielten wir an einer Stelle, die wie ein verwilderter Garten aussah: Blumen und hüfthohes saftiges Gras, an dem unsere beglückten Kamele sich eine Stunde gütlich taten, um sich dann satt und zufrieden niederzulegen.
Der Tag schien immer heißer und heißer zu werden. Die Sonne stach brennend hernieder, und kein Lüftchen regte sich. Der klare sandige Boden war so glühend heiß, daß ich es mit meinen bloßen Füßen nicht mehr aushielt und Sandalen überzog, zur Belustigung der Dschuheina, deren dicke Fußsohlen selbst gegen ein mäßiges Feuer unempfindlich waren. Im Lauf des Nachmittags trübte sich das Licht, aber die Hitze nahm noch immer zu, und es wurde so drückend und schwül, wie ich es kaum je erlebt hatte. Ich wandte fortwährend den Kopf, um zu sehen, ob nicht irgend etwas Massiges sich unmittelbar hinter uns auftürmte, das uns die Luft abschnitt.
Den ganzen Tag schon hatte man von den Bergen her langhingezogenes Donnergrollen gehört, und die beiden Kuppen, der Serd und der Dschasim, waren von dichten Schwaden bläulichen und gelblichen Dunstes verhüllt, der völlig regungslos schien. Zuletzt aber sah ich, daß die um den Serd stehende gelbe Wolke sich loslöste und gegen den Wind langsam auf uns zukam, dabei eine Menge kleiner Staubteufel vor sich aufwirbelnd.
Die Wolke war fast so hoch wie der Berg selbst. Indes sie sich näherte, schoben sich zwei Staubsäulen, gerade und ebenmäßig wie Schornsteine, die eine rechts, die andere links vor ihr heran. Dakhil-Allah, der verantwortliche Führer, blickte sich besorgt nach allen Seiten nach einem Unterschlupf um, konnte aber keinen entdecken. Er sagte mir, daß der Sturm sehr schwer werden würde.
Als die Wolke heran war, schlug der Wind, der uns bisher heiß und atembeklemmend ins Gesicht gepeitscht hatte, plötzlich um und kam, nach einem Augenblick der Stille, bitter kalt und feucht uns in den Rücken gefegt. Dabei nahm er heftig an Gewalt zu, und zugleich verschwand die Sonne, ausgelöscht von dichten Schwaden gelblichen Dunstes. Ein seltsam gespenstisches Licht, ockerfarben und flackerig, war um uns. Die braune Wolkenwand von den Bergen war nun ganz nahe und kam mit brüllendem, knirschendem Ton gegen uns herangebraust. Drei Minuten später brach sie über uns her, überschüttete uns mit einer Flut von Staub und prasselnden Sandkörnern, fegte in heftigen Stößen und Wirbeln um uns her und jagte dabei doch mit großer Geschwindigkeit ostwärts weiter.
Wir hatten unsere Kamele mit dem Hinterteil gegen den Sturm gedreht, um uns vor ihm hertreiben zu lassen; aber die ihn begleitenden heftigen Wirbel rissen uns die mühsam festgehaltenen Mäntel aus den Händen, trieben uns Sand in die Augen und nahmen uns jedes Gefühl für die Richtung, da die Kamele links und rechts abgetrieben wurden. Manchmal wurden sie völlig um sich selbst gedreht, einmal prallten wir in einem Strudel hilflos aufeinander, während Sträucher, große Grasbüschel und sogar ein kleiner Baum samt Wurzeln und Erdreich ausgerissen wurden und gegen uns antrieben oder mit bedenklicher Heftigkeit über unsere Köpfe hinwegfegten. Dabei war uns aber nie ganz die Sicht genommen – man konnte stets sieben bis acht Fuß nach jeder Richtung sehen. Nur war es gefährlich, sich umzublicken, da man nie sicher sein konnte, ob man nicht, abgesehen von dem unfehlbaren Sandschwall, einen entwurzelten Baum, eine Ladung Kiesel oder ein paar herumwirbelnde Grasstücke ins Gesicht bekam.
Der Sturm dauerte etwa achtzehn Minuten; dann jagte er weiter und verschwand ebenso rasch, wie er gekommen war. Unsere Leute waren auf mehr als eine Quadratmeile und noch weiter verstreut, und bevor wir uns sammeln konnten, während wir noch in Staub gehüllt waren, der unsere Kleider und Kamele von oben bis unten mit einer dichten gelblichen Schicht bedeckte, brach ein strömender Regen los, der uns völlig mit einer Lehmkruste überzog. Das Tal begann sich mit Wasserbächen zu füllen, und Dakhil-Allah trieb zur Eile, um noch rasch hindurchzukommen. Der Wind drehte sich nochmals, diesmal nach Norden, und trieb uns den Regen in heftigen Schauern entgegen. Im Augenblick hatte er unsere Mäntel durchdrungen, durchnäßte uns bis auf die Haut und durchkältete uns bis auf die Knochen.
Gegen vier Uhr nachmittags erreichten wir die Bergschranke, aber das Tal, in das wir nun einbogen, erwies sich als völlig kahl und schutzlos, und es war kälter als zuvor. Wir ritten drei bis vier Meilen das Tal hinan, hielten dann und begannen einen hohen Felsgrat hinaufzuklettern, um einen Blick auf die Bahn werfen zu können, die unmittelbar dahinter liegen sollte. Nach oben zu blies der Wind so heftig, daß wir uns beim Schlappen und Aufbauschen unserer Mäntel und Kleider kaum noch an den nassen, schlüpfrigen Steinen festhalten konnten. Ich zog meinen Mantel aus und kletterte halbnackt weiter; es ging leichter, und mir war kaum kälter als vorher. Aber die Mühe erwies sich als vergebens, denn die Luft war zu dunstig, um irgend etwas beobachten zu können. So kletterte ich zerschlagen und zerschunden wieder zu den anderen hinunter und kleidete mich halb erstarrt wieder an. Auf dem Rückweg erlitten wir den einzigen Verlust bei diesem Unternehmen. Sultan hatte darauf bestanden, mit uns zu kommen, und sein Ateibi-Diener mußte ihm folgen, obwohl er nicht schwindelfrei war; an einer bösen Stelle glitt er aus und stürzte kopfüber vierzig Fuß auf steinigen Boden hinunter.
Als wir zurückkamen, waren meine Hände und Füße so zerschunden, daß ich sie nicht mehr bewegen konnte; ich legte mich für eine Stunde nieder, zitternd vor Kälte, während die anderen den Toten in einem Seitental begruben. Bei ihrer Rückkehr begegneten sie plötzlich einem unbekannten Kamelreiter, der ihren Weg kreuzte. Er feuerte auf sie. Sie schossen zurück, es gab ein kurzes Geknalle im Regen, dann verschluckte der Abend den Fremden. Das war beunruhigend, denn Überraschung war unser bester Verbündeter, und wir konnten nur hoffen, daß der Fremde nicht umkehren und die Türken benachrichtigen würde, daß ein Überfall im Gange war.
Nachdem uns die Lastkamele mit dem Dynamit eingeholt hatten, saßen wir wieder auf, um näher an die Bahnlinie zu reiten. Aber kaum waren wir aufgebrochen, als uns der Wind durch das neblige Tal den Klang von türkischen Signalhörnern herübertrug, die zum Essen bliesen. Dakhil-Allah lauschte in der Richtung, aus welcher der Ton kam, und meinte dann, daß dort drüben Madahrij liegen müsse, die kleine Station, unterhalb der wir die Mine zu legen gedachten. So hielten wir denn auf diesen verhaßten Lärm zu – verhaßt, weil er von Essen und Zelten kündete, während wir kein Obdach und in einer solchen Nacht nicht die Aussicht hatten, Feuer machen und Brot aus dem durchweichten Mehl in unsern Satteltaschen backen zu können, so daß wir hungrig weiterziehen mußten.
Wir erreichten die Bahn erst nach zehn Uhr nachts; es war so dunkel, daß es zwecklos schien, nach einer Stellung für das Maschinengewehr zu suchen. Durch Zufall traf ich auf Kilometerstein 1121, gezählt von Damaskus aus, wo wir die Mine legen wollten. Es war eine zusammengesetzte Mine mit einem Hauptschalter, der gleichzeitig zwei andere, dreißig Yard entfernte Ladungen zur Explosion bringen sollte; wir hoffen, auf diese Weise die Lokomotive zu treffen, ob sie nun nach Norden oder Süden fuhr. Das Vergraben der Mine nahm vier Stunden in Anspruch, denn der Regen hatte die Bettung klumpig und zäh gemacht. Unsere Füße hinterließen eine Menge Spuren auf dem Damm und an der Böschung; es sah aus, als hätte dort eine Elefantenschar einen Tanz vollführt. Die Spuren zu verwischen, war unmöglich; so halfen wir uns auf andere Weise und zertrampelten den Boden auf Hunderte von Yards hin, dabei auch unsere Kamele zur Hilfe nehmend, bis es aussah, als hätte eine halbe Armee das Tal durchquert, und die Stelle mit der Mine von der Umgebung nicht mehr zu unterscheiden war. Dann zogen wir uns in sichere Entfernung hinter ein paar elende Hügel zurück, kauerten uns auf freiem Felde nieder, um den Tagesanbruch abzuwarten. Unsere Zähne klapperten, und wir wurden von Frostschauern geschüttelt, während sich unsere Hände wie Klauen zusammenkrampften.
Als es dämmerte, waren die Wolken verschwunden, und eine rötliche Sonne stieg verheißungsvoll über den feingezackten Höhenrand jenseits der Bahn auf. Der alte Dakhil-Allah, unser Führer und Weggeleiter während der Nacht, übernahm nun den Oberbefehl und stellte uns einzeln oder zu zweit an allen Ausgängen unseres Schlupfwinkels auf. Er selber kletterte den Bergrücken vor uns hinauf, um alles, was auf der Strecke geschah, durch sein Glas zu beobachten. Ich betete zum Himmel, daß nichts geschehen möge, bis die Sonne kräftiger geworden war und mich durchwärmt hatte, denn der Schüttelfrost beutelte mich noch immer. Aber bald stieg die Sonne hoch am wolkenlosen Himmel, und mir wurde wohler. Meine Kleider trockneten. Gegen Mittag war es fast so heiß wie am Tage zuvor, und nun sehnten wir uns wieder nach Schatten und dickeren Kleidern zum Schutz gegen die brennende Sonne.
Zuerst meldete Dakhil-Allah schon um sechs Uhr morgens eine Draisine, die von Süden kam und über unsere Mine fuhr, ohne daß sich etwas ereignete – zu unserer Befriedigung, denn wir hatten nicht die schönen Ladungen just für vier Mann und einen Sergeanten gelegt. Dann kamen sechzig Mann aus Madahrij heraus. Das beunruhigte uns, bis wir sahen, daß sie fünf Telegraphenstangen wieder aufzurichten begannen, die der Sturm am Nachmittag zuvor umgerissen hatte. Um sieben Uhr dreißig kam dann eine Patrouille von elf Mann die Strecke entlang gegangen; je zwei untersuchten sorgfältig die Schienen, drei auf jeder Seite gingen den Damm entlang, um nach kreuzenden Spuren zu suchen, und einer, offenbar der Unteroffizier, stolzierte zwischen den Schienen, ohne etwas zu tun.
Diesmal jedoch fanden sie etwas, als sie zu unseren Fußtapfen am Kilometerstein 1121 gelangten. Sie sammelten sich dort, starrten auf die Spuren, trampelten herum, suchten auf dem Damm umher, kratzten an der Bettung und dachten angestrengt nach. Die Zeit, die sie suchten, wurde uns lang; aber die Mine war gut versteckt, so daß sie am Ende beruhigt nach Süden weitergingen, wo sie auf die von Hedia kommende Patrouille trafen; beide Abteilungen lagerten sich gemeinsam im kühlen Schatten eines Brückenbogens und ruhten sich von ihrer Tätigkeit aus. Dann kam von Süden her ein langer Zug angefahren. Neun von den Waggons waren mit Frauen und Kindern besetzt, Flüchtlingen, die mit ihrem Hausrat von Medina nach Syrien abtransportiert wurden. Der Zug fuhr über die Mine hinweg, ohne daß sie explodierte. Als Techniker war ich wütend, als Befehlshaber jedoch sehr erleichtert: Frauen und Kinder waren kein geeignetes Zielobjekt.
Als die Dschuheina den Zug kommen hörten, kamen sie auf die Höhe, wo Dakhil-Allah und ich versteckt lagen, hinaufgelaufen, um zu sehen, wie der Zug in die Luft flog. Das bißchen Deckung, das wir uns aus Steinen aufgebaut hatten, reichte gerade für zwei, so daß sich nun die Höhe, eine kahle Kuppe, gerade gegenüber dem feindlichen Arbeitstrupp, plötzlich weithin sichtbar bevölkerte. Das war zuviel für die Nerven der Türken. Sie flüchteten nach Madahrij und eröffneten von dort aus einer Entfernung von ungefähr fünftausend Yards ein lebhaftes Gewehrfeuer. Anscheinend hatten sie auch nach Hedia telephoniert, denn dort begann es sich ebenfalls zu regen; aber da der nächste vorgeschobene Posten nach dieser Seite hin über sechs Meilen entfernt war, enthielt sich die Besatzung des Schießens und begnügte sich damit, eine Auswahl ihrer täglichen Hornsignale zu blasen. Aus der Ferne klang das sehr schön und feierlich.
Auch die Schießerei tat uns keinen Schaden; unangenehm nur war, daß man uns entdeckt hatte. In Madahrij lagen zweihundert Mann und in Hedia elfhundert, und unsere Rückzugstraße führte über die Ebene von Hamdh, an der Hedia lag. Die türkischen berittenen Truppen konnten einen Ausfall machen und uns den Rückzug abschneiden. Die Dschuheina besaßen gute Kamele und hatten daher nichts zu befürchten; aber das Maschinengewehr war ein erbeutetes deutsches Schlitten-Maxim, eine schwere Last für das kleine Maultier. Die Bedienungsmannschaften gingen zu Fuß oder ritten auf Mulis: sie konnten höchstens sechs Meilen in der Stunde zurücklegen, und ihr Gefechtswert war mit dem einzigen Maschinengewehr nicht sehr groß. Nach einem Kriegsrat ritten wir daher mit ihnen den halben Weg durch die Berge zurück und schickten sie von dort mit fünfzehn Dschuheina nach dem Wadi Ajis.
Auf diese Weise waren wir beweglicher, und Dakhil-Allah, Sultan, Mohammed und ich ritten mit dem Rest unserer Leute nach der Bahnlinie zurück. Die Sonne brannte jetzt fürchterlich, und leichte Wellen glühendheißer Luft wehten uns von Süden her entgegen. Gegen zehn Uhr suchten wir unter ein paar breitästigen Bäumen Zuflucht, wo wir uns Brot buken und frühstückten; wir hatten von dort gute Sicht auf die Bahnstrecke und waren dabei doch einigermaßen gegen die Sonne geschützt. Auf dem kiesigen Boden rings um uns huschten, wenn sich die dünnen Zweige lässig im Wind bewegten, die fahlen Schatten der krausen Blätter hin und her, gleich grauen, seltsamen Käfern. Unser Festmahl schien die Türken zu ärgern; sie schössen und bliesen unaufhörlich den ganzen Nachmittag über, während wir abwechselnd schliefen.
Gegen fünf Uhr wurde es bei ihnen still; wir saßen auf und ritten vorsichtig durch das offene Tal zur Bahnlinie. Madahrij lebte sofort wieder auf und begann eine wilde Schießerei, sämtliche Trompeten in Hedia lärmten wieder los. Nun aber konnten wir uns die Freude nicht versagen, wie Artisten nach gelungenem Kunststück eine schöne und eindrucksvolle Reverenz zu machen. Als wir daher die Bahnlinie erreichten, ließen wir die Kamele neben dem Damm niedergehen, traten hinauf und begannen mitten zwischen den Schienen unter Leitung Dakhil-Allahs als Imam in aller Ruhe das Abendgebet zu verrichten. Für die Dschuheina mochte es wohl das erste Gebet seit einem Jahr oder mehr sein, und ich war ein gänzlicher Neuling; aber aus der Ferne machte es sich ganz gut, und verblüfft stellten die Türken das Feuern ein. Es war dies das erste und letzte Mal, daß ich je in Arabien wie ein Moslem betete.
Nach dem Gebet war es noch zu hell, als daß wir uns hätten unbemerkt bewegen können; so ließen wir uns rauchend rings um den Bahndamm nieder, bis ich bei Dunkelwerden versuchte, mich ganz allein frei zu machen, um die Mine auszugraben und für spätere Fälle festzustellen, aus welchem Grunde sie versagt hatte. Doch die Dschuheina interessierten sich ebensosehr dafür wie ich; sie kamen in hellen Haufen mit und drängten sich dicht um die Schienen, während ich suchte. Das verursachte mir einiges Herzklopfen, denn ich brauchte allein eine Stunde, nur um die Stelle zu finden, wo die Mine vergraben war. Eine Mine nach Garlands Muster zu legen, war an sich schon eine heikle Sache, aber in der pechschwarzen Finsternis hundert Yards weit die Strecke auf und ab zu kriechen und nach dem haardünnen Auslöser zu tasten, der in dem Schotter vergraben war, schien mir allmählich eine Beschäftigung zu sein, für die es keine Lebensversicherung geben würde. Die beiden verbundenen Ladungen waren stark genug, um siebzig Yard der Strecke auseinander zu sprengen. Ich sah mich schon jeden Augenblick nicht nur selbst, sondern mitsamt der ganzen Truppe in die Luft fliegen. Sicherlich wäre durch solch ein Kunststück die Verblüffung der Türken vollkommen geworden!
Schließlich fand ich den Auslöser und stellte fest, daß der Haken sich um ein sechzehntel Zoll gesenkt hatte; entweder hatte ich ihn schlecht angebracht, oder der Untergrund hatte durch den Regen nachgegeben. Ich befestigte ihn wieder an seinem Platz. Dann, um dem Feind eine plausible Erklärung für unsere Anwesenheit zu geben, begannen wir nördlich der Mine Sprengungen vorzunehmen. Wir entdeckten eine kleine vierbogige Brücke und ließen sie in die Luft gehen. Danach machten wir uns an die Gleise und unterbrachen sie auf eine Strecke von über zweihundert Yard. Während die Leute die Ladungen legten und entzündeten, unterwies ich Mohammed, wie man eine splittrige Telegraphenstange hinaufklettert; wir schnitten zusammen die Drähte durch und rissen mit ihrer Hilfe die Stangen um. Alles geschah in größter Eile, denn wir fürchteten, daß uns die Türken auf den Hals kommen könnten; und als wir mit den Sprengungen fertig waren, rannten wir wie die Hasen zu unseren Kamelen, saßen auf und ritten ohne Aufenthalt nochmals durch das windige Tal zur Ebene des Hamdh.
Dort waren wir in Sicherheit. Aber der alte Dakhil-Allah war noch zu vergnügt über die Bescherung, die wir an der Bahn angerichtet hatten, um ruhig zu reiten. So trieb er, kaum daß wir die sandige Niederung erreicht hatten, sein Kamel zu einem scharfen Galopp an, und wir jagten wie der Teufel hinterdrein in dem farblosen Mondlicht. Der Weg war vorzüglich, und wir verhielten nicht ein einziges Mal, bis wir auf unser Maschinengewehr und die Bedienungsmannschaft stießen, die sich auf dem Heimweg gelagert hatte. Die Mannschaften hörten unsere wilde Jagd durch das nächtliche Dunkel, hielten uns für Feinde und feuerten mit ihrem Maschinengewehr auf uns; aber nach ein paar Schüssen trat eine Ladehemmung ein, und die Soldaten, im Zivilberuf Schneider aus Mekka, verstanden sich nicht auf den Mechanismus. So wurde niemand verletzt, und wir nahmen sie vergnügt gefangen.
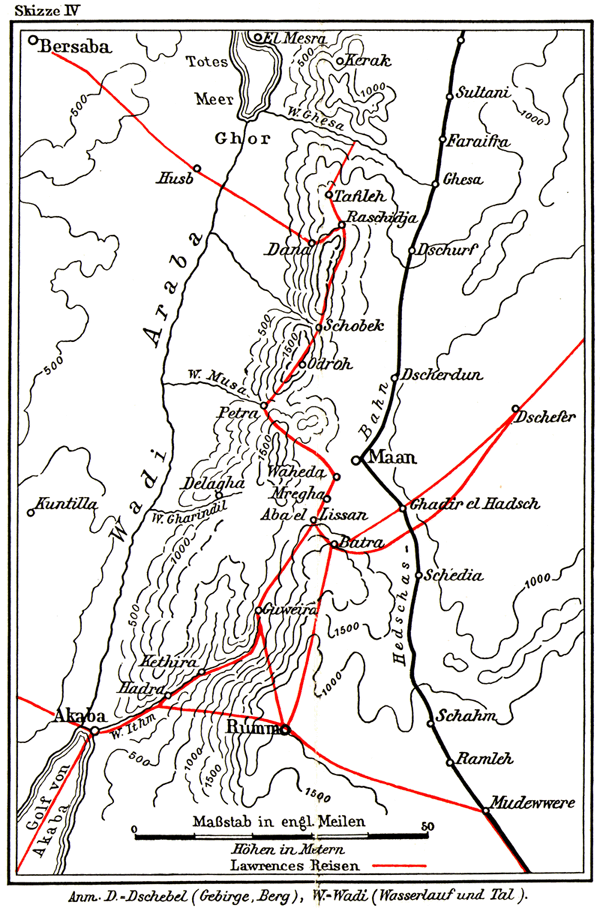
Karte 4
Wir schliefen lange in den Morgen hinein und frühstückten in Rubiaan, dem ersten Brunnen im Wadi Ajis. Dann saßen wir rauchend beisammen und unterhielten uns gerade darüber, wie man Kamele einfängt, als wir plötzlich den dumpfen Widerhall einer schweren Explosion hinter uns an der Bahn hörten. Wir überlegten, ob die Mine entdeckt worden war oder ob sie ihre Pflicht getan hatte. Wir hatten zwei Späher zurückgelassen, die uns Bericht erstatten sollten; so ritten wir jetzt langsam weiter: ihretwegen und weil der Regen zwei Tage vorher wieder einmal das Wadi Ajis unter Wasser gesetzt hatte; sein Bett war über und über mit seichten Tümpeln taubengrauen Wassers bedeckt, zwischen denen sich silbrige Lehmbänke erhoben, die von der Strömung schuppenartig geriffelt waren. Die Sonnenwärme verwandelte die Oberfläche in eine klebrige Masse, in der unsere Kamele in komischer Hilflosigkeit herumrutschten oder sich mit einem so kräftigen Plumps auf den Allerwertesten setzten, wie man es diesen würdevollen Tieren gar nicht zugetraut hätte. Ihre schlechte Laune wurde durch unsere Lachanfälle entschieden noch vermehrt.
Das Sonnenlicht, der bequeme Ritt und das Warten auf Nachricht von unsern Spähern stimmte alles freudig, und wir entwickelten sogar gesellige Tugenden; aber unsere von den Anstrengungen des vorhergehenden Tages noch steifen Glieder und unser reichliches Essen bestimmten uns, bei Abu Markha für die Nacht haltzumachen. So wählten wir bei Sonnenuntergang eine trockene Terrasse im Tal aus, um dort zu lagern. Ich ritt zuerst hinauf und blickte zurück auf die Leute, die unter mir in einer Gruppe hielten, auf ihren bräunlichen Kamelen wie Bronzestatuen in dem vollen roten Licht der untergehenden Sonne, und es schien mir, als wären sie wie von einer inneren Flamme durchleuchtet.
Ehe noch das Brot gebacken war, kamen die Späher zurück und berichteten uns, die Türken hätten sich in der Dämmerung eifrig an unseren Sprengungen zu schaffen gemacht; etwas später sei eine Lokomotive mit Gerätewagen und einem großen Arbeitertrupp darauf von Hedia gekommen, und die Mine sei vor und zwischen den Rädern der Maschine explodiert. Das war alles, was wir erhofft hatten, und wir ritten an einem wunderbaren Frühlingsmorgen singend zu Abdullas Lager zurück. Wir hatten bewiesen, daß eine gut gelegte Mine auch losging, und daß sie selbst für die, die sie gelegt hatten, schwer zu entdecken war. Das war beides wichtig, denn Newcombe, Garland und Hornby waren jetzt draußen an der Bahn mit Zerstörungen tätig, und die Minen waren immer noch die beste Waffe, die es gab, um den regelmäßigen Zugverkehr für die Türken kostspielig und unsicher zu machen.