
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Die Stellung des Scherifs von Mekka war lange Zeit eine Anomalie gewesen. Der Titel Scherif bedeutete Abstammung vom Propheten Muhammed über seine Tochter Fatima und ihren älteren Sohn Hassan. Die Namen der echten Scherifs waren in den Familienstammbaum eingetragen, eine unendlich lange Liste, die in Mekka aufbewahrt wurde unter der Obhut des Emirs von Mekka, des erwählten Scherifs der Scherifs, der als der oberste und vornehmste von allen galt. Die Familie des Propheten hatte die letzten neunhundert Jahre die weltliche Herrschaft in Mekka inne gehabt und zählte über zweitausend Mitglieder.
Die alte türkische Regierung betrachtete diese Sippe mantikratischer Fürsten mit gemischten Gefühlen, halb mit Ehrfurcht, halb mit Mißtrauen. Da sie zu mächtig waren, um beseitigt werden zu können, wahrte der Sultan dadurch seine Würde, daß er ihren Emir feierlich in seiner Stellung bestätigte. Dieser formelle Akt gewann mit der Zeit tatsächlichen Inhalt, bis zuletzt der neue Träger des Titels gewahr wurde, daß erst dadurch seiner Wahl das endgültige Siegel aufgedrückt wurde. Schließlich fanden die Türken, daß sie zur wirksameren Kostümierung ihrer neuen panislamischen Idee den Hedschas unter ihren unbestrittenen Einfluß bringen mußten. Die Eröffnung des Suezkanals gab ihnen Anlaß, eine Garnison in die Heiligen Städte zu legen. Sie begannen den Bau der Hedschasbahn und stärkten ihren Einfluß unter den arabischen Stämmen durch Geld, Intrigen und militärische Streifzüge.
Nachdem so der Sultan seine Macht in jenen Gegenden gefestigt hatte, ging er daran, sich mehr und mehr neben dem Scherif und auch in Mekka zur Geltung zu bringen. Er unternahm es sogar, gelegentlich einen Scherif abzusetzen, der ihm zu groß geworden schien, und einen Nachfolger aus einem rivalisierenden Zweig der Sippe einzusetzen in der Hoffnung, durch Förderung der Uneinigkeit die üblichen Vorteile zu gewinnen. Schließlich holte Abdul Hamid einige Mitglieder der Sippe nach Konstantinopel und hielt sie dort in ehrenvoller Gefangenschaft. Unter ihnen war Hussein ibn Ali, der zukünftige Herrscher, der fast achtzehn Jahre in Konstantinopel festgehalten wurde. Hussein benutzte die Gelegenheit, um seinen Söhnen – Ali, Abdulla, Faisal und Seid – eine neuzeitliche Erziehung und Ausbildung zuteil werden zu lassen, was sie später befähigte, die arabischen Truppen zum Erfolg zu führen.
Nach dem Sturz Abdul Hamids wurde dessen Politik von den weniger klugen Jungtürken umgestoßen und der Scherif Hussein als Emir nach Mekka zurückgesandt. Er machte sich sogleich ans Werk, die Macht des Emirats unauffällig wiederherzustellen, unterhielt aber zugleich enge und freundschaftliche Beziehungen zu Konstantinopel durch seine Söhne Abdulla, den Vizepräsidenten des türkischen Parlaments, und Faisal, den Abgeordneten für Dschidda. Sie hielten ihn über die politischen Strömungen in der Hauptstadt auf dem laufenden, bis sie mit Beginn des Krieges eilig nach Mekka zurückkehrten.
Der Ausbruch des Krieges stürzte den Hedschas in Schwierigkeiten. Die Pilgerfahrten hörten auf, und damit kamen auch das Geschäftsleben und die Einkünfte der Heiligen Städte ins Stocken. Man fürchtete mit Recht, daß die aus Indien mit Lebensmitteln kommenden Schiffe ausbleiben würden (denn der Scherif war formell ein feindlicher Staatsangehöriger); und da die Provinz ja fast gar nichts für den eigenen Bedarf erzeugen konnte, bestand die Gefahr, daß sie in eine sehr mißliche Abhängigkeit von dem Wohlwollen der Türken geraten würde, die sie durch Einstellung des Verkehrs auf der Hedschasbahn aushungern konnten. Hussein war bisher niemals von der Gnade der Türken ganz und gar abhängig gewesen; und gerade in diesem ungünstigen Augenblick bedurften sie ganz besonders seiner Unterstützung für den »Dschehad«, für den Heiligen Krieg aller Moslemin gegen die Christenheit.
Um in der mohammedanischen Welt allgemein wirksam zu werden, mußte der Dschehad von Mekka sanktioniert werden; und in diesem Falle konnte allerdings der ganze Osten in Blut getaucht werden. Hussein war ehrenhaft, verschlagen, eigensinnig und überaus fromm. Er sah ein, daß der Heilige Krieg seinem Sinne nach mit einem Angriffskrieg unvereinbar war und zum Widersinn wurde mit einem christlichen Verbündeten: Deutschland. Daher lehnte er das Ansinnen der Türken ab und wandte sich zugleich mit der Bitte an die Verbündeten, seine Provinz nicht auszuhungern, da sein Volk an den Ereignissen keine Schuld trage. Daraufhin führten die Türken sofort eine Teilblockade der Hedschasbahn durch, eine strenge Überwachung des Verkehrs. Die Engländer gaben die Küsten des Hedschas für eine bestimmte Anzahl von Lebensmitteln frei.
Aber das türkische Ansinnen war nicht das einzige, das damals an den Scherif herantrat. Im Januar 1915 sandten ihm Jisin, Führer der mesopotamischen Offiziere, Ali Risa, Führer der Offiziere in Damaskus, und Abd el Ghani el Areisi für die syrische Zivilbevölkerung sehr bestimmte Vorschläge für einen militärischen Aufstand in Syrien gegen die Türkei. Das unterdrückte Volk von Mesopotamien und Syrien, die Komitees der »Ahad« und »Fetah« riefen ihn, den Vater der Araber, den Moslim der Moslemin, den größten Fürsten und würdigsten Nachkommen des Propheten, auf, sie vor den finsteren Plänen Talaats und Dschemals zu schützen.
Hussein war als Politiker, als Herrscher, als Moslim, als Fortschrittler und als Nationalist gezwungen, diesem Ruf Folge zu leisten. Er sandte Faisal, seinen dritten Sohn, nach Damaskus, der als sein Vertreter sich über das Vorhaben der Aufständischen genauer unterrichten und ihm Bericht erstatten sollte. Ali, seinen ältesten Sohn, sandte er nach Medina mit der Weisung, in aller Stille und unter allen ihm gut erscheinenden Vorwänden unter den Bauern und Stammesangehörigen des Hedschas Truppen auszuheben und sie zum Losschlagen bereitzuhalten, wenn Faisal das Zeichen gab. Abdulla, sein zweiter, politisch befähigter Sohn, sollte auf schriftlichem Wege herauszubekommen suchen, welche Haltung die Engländer im Falle eines arabischen Aufstandes gegen die Türkei einnehmen würden.
Faisal berichtete im Januar 1915, daß die örtlichen Vorbedingungen für einen Aufstand vorteilhaft wären, daß aber die Entwicklung des Krieges sich nicht günstig anließe für ihre Hoffnungen. In Damaskus ständen drei Divisionen arabischer Truppen, die zum Aufstand bereit wären. Zwei weitere Divisionen in Aleppo, die mit arabischen Nationalisten durchsetzt wären, würden sich bestimmt anschließen, wenn die anderen losschlügen. Diesseits des Taurus stände nur eine türkische Division, so daß man mit Sicherheit annehmen könnte, Syrien schon im ersten Ansturm in Besitz zu bekommen. Andererseits zeige aber die Bevölkerung wenig Neigung, bis zum Äußersten zu gehen, und in militärischen Kreisen wäre man überzeugt, daß Deutschland den Krieg gewinnen würde, und zwar bald. Wenn aber die Alliierten ihr australisches Expeditionskorps (das in Ägypten zusammengestellt wurde) in Alexandrette landeten und so Syrien in der Flanke deckten, dann würde die Türkei, selbst auf die Gefahr eines deutschen Endsieges, vorher leicht zu einem Separatfrieden gezwungen werden können.
Ein Aufschub trat ein, da die Alliierten nicht in Alexandrette, sondern an den Dardanellen landeten. Faisal ging selbst nach Gallipoli, um sich an Ort und Stelle genau über die Lage zu unterrichten, da ein Zusammenbruch der Türkei das Signal für den arabischen Aufstand geben würde. Dann folgte die Stockung während der Monate der Dardanellenkämpfe. In diesem blutigen Ringen wurde ein guter Teil der besten osmanischen Truppen aufgerieben. Die Schwächung der Türkei durch die ungeheuren Verluste war so groß, daß Faisal nach Syrien zurückging, da er den Augenblick zum Losschlagen für gekommen hielt, er fand aber, daß die Lage in Syrien inzwischen ungünstig geworden war.
Seine syrischen Anhänger waren verhaftet oder hielten sich versteckt, und ihre Freunde waren auf Grund politischer Anklagen gehängt worden. Die zum Aufstand bereiten arabischen Divisionen waren entweder an entfernte Fronten abgeschoben oder aufgelöst und in türkische Einheiten eingereiht worden. Die arabische Landbevölkerung war zum türkischen Militärdienst eingezogen, und ganz Syrien war dem erbarmungslosen Dschemal-Pascha ausgeliefert. Alle Haupttrümpfe Faisals waren also dahin.
Faisal schrieb seinem Vater und riet zu weiterem Aufschub, bis England völlig bereit und die Türkei der Erschöpfung nahe sein würde. Unglücklicherweise aber war Englands Lage denkbar schlecht. Die Dardanellen wurden von den schwergeschlagenen Landungstruppen geräumt. Der langsame Todeskampf von Kut-el-Amara war im letzten Stadium; und der Aufstand der Senussi, der mit dem Kriegseintritt Bulgariens zusammenfiel, bedrohte nun Englands eigene Flanken.
Faisals Lage war äußerst gefährlich. Sein Schicksal hing von den Mitgliedern der Geheimgesellschaft ab, deren Präsident er vor dem Kriege gewesen war. Er mußte als Gast Dschemal-Paschas in Damaskus bleiben, um seine militärischen Kenntnisse aufzufrischen; denn sein Bruder Ali stellte im Hedschas Truppen auf, unter dem Vorwand, daß er und Faisal sie später zur Unterstützung der Türken an den Suezkanal führen würden. So mußte Faisal als treuer Untertan und Offizier im türkischen Hauptquartier bleiben und ruhig mit anhören, wenn der brutale Dschemal in der Trunkenheit das arabische Volk beleidigte und beschimpfte.
Dschemal schickte stets zu Faisal und nahm ihn zu den Hinrichtungen seiner syrischen Freunde mit. Diese Opfer von Dschemals Justiz durften nicht zeigen, daß sie um Faisals wahre Hoffnungen wußten, noch weniger als er durch ein Wort seine Gesinnung verraten durfte, denn eine Entdeckung hätte seine Familie und vielleicht sein ganzes Volk zum gleichen Schicksal verdammt. Nur einmal fuhr es ihm heraus, daß Dschemal mit diesen Hinrichtungen gerade das bewerkstelligen würde, was er zu hintertreiben suchte; und es bedurfte der Vermittlung seiner Konstantinopler Freunde, führender Männer der Türkei, um ihn von den Folgen dieser unbedachten Worte zu retten.
Faisals Briefwechsel mit seinem Vater war schon eine Kühnheit sondergleichen. Durch Vermittlung alter Anhänger ihrer Familie, die ganz unverdächtig waren, standen sie miteinander in Verbindung. Diese fuhren auf der Hedschasbahn hin und her mit Mitteilungen, verborgen in Säbelgriffen, in Backwaren, eingenäht zwischen die Sohlen der Sandalen oder in unsichtbarer Schrift auf den Umhüllungen harmloser Pakete. Faisal berichtete stets, daß die Lage ungünstig wäre, und bat seinen Vater, den Aufstand auf eine günstigere Zeit zu verschieben.
Aber Hussein ließ sich durch die Abmahnungen seines Sohnes keineswegs entmutigen. In seinen Augen waren die Jungtürken nichts als Verruchte, die sich an ihrem Glauben und ihrem Menschenrecht versündigten – Verräter am Geist der Zeit und den höheren Interessen des Islams. Obwohl schon ein alter Mann von fünfundsechzig Jahren, entschloß er sich mit jugendlichem Draufgängertum dazu, gegen sie Krieg zu führen, sich dabei auf die Gerechtigkeit seiner Sache verlassend. Hussein vertraute so sehr auf Gott, daß er seinen militärischen Sinn brachliegen ließ und glaubte, der Hedschas könnte die Türkei im offenen Felde besiegen. So sandte er Abd el Kadir el Abdu mit einem Schreiben an Faisal und teilte ihm offiziell mit, daß nun die Truppen in Medina, die zur Front abgehen sollten, zur Besichtigung durch ihn bereitstünden. Faisal machte Dschemal davon Mitteilung und bat um Urlaub, aber zu seiner großen Enttäuschung erwiderte Dschemal, daß Enver-Pascha, der Generalissimus, auf dem Wege nach Syrien wäre, und daß sie zusammen nach Medina gehen und die Truppen besichtigen würden. Faisal hatte geplant, seines Vaters scharlachrotes Banner sofort nach seiner Ankunft in Medina zu entfalten und so die Türken zu überrumpeln; und nun waren ihm zwei unerbetene Gäste aufgehalst, denen er nach dem Gesetz der arabischen Gastfreundschaft kein Leid antun durfte, und wodurch der Aufstand so lange verzögert werden würde, daß das ganze Geheimnis in Gefahr geriet.
Schließlich aber lief alles gut ab, wenn auch die Truppenbesichtigung zu einer grausigen Ironie wurde. Enver, Dschemal und Faisal beobachteten gemeinsam, wie die Truppen auf der staubigen Ebene vor den Toren Medinas ihre Bewegungen und Schwenkungen vollführten, wie sie auf ihren Kamelen in einem Scheinkampf aufeinander losstürmten und zurückwichen oder nach uraltem arabischen Brauch ihre Pferde zum spielerischen Speerkampf spornten. »Und all das sind Freiwillige für den Heiligen Krieg?« fragte Enver zuletzt, sich an Faisal wendend. »Ja«, sagte Faisal. – »Bereit, bis zum Tode gegen alle Feinde der Gläubigen zu kämpfen?« – »Ja«, wiederholte Faisal. Und dann kamen die arabischen Führer herbei, um vorgestellt zu werden; und der Scherif Ali ibn el Hussein von den Modighs zog Faisal beiseite und flüsterte ihm zu: »Sollen wir sie jetzt töten, Herr?« und Faisal sagte: »Nein, es sind meine Gäste.«
Aber die Scheiks bestanden darauf, denn sie meinten, daß sie so mit zwei Hieben den ganzen Krieg beenden könnten. Sie waren entschlossen, Faisal einfach dazu zu zwingen, und er mußte unter sie treten, gerade außer Hörweite, aber allen sichtbar, und für das Leben der türkischen Gewalthaber bitten, die seine besten Freunde auf dem Schafott hingemordet hatten. Zuletzt mußte er sich noch entschuldigen, mit ihnen schleunigst nach Mekka zurückkehren, den Bankettsaal mit seinen eigenen Sklaven besetzen lassen und Enver und Dschemal nach Damaskus zurückgeleiten, um sie davor zu bewahren, daß sie unterwegs umgebracht wurden. Diese umständliche Höflichkeit suchte er durch den Hinweis zu erklären, daß es arabische Sitte wäre, den Gästen alles darzubringen; aber Enver und Dschemal waren äußerst mißtrauisch geworden durch das, was sie gesehen hatten, sperrten den Hedschas vollständig ab und entsandten starke türkische Truppenabteilungen dorthin. Sie dachten Faisal in Damaskus festzuhalten; aber aus Medina liefen Telegramme ein, die seine unverzügliche Rückkehr zur Vermeidung von Unruhen verlangten, und Dschemal ließ ihn, wenn auch widerwillig, gehen, unter der Bedingung, daß sein Gefolge als Geiseln zurückblieb.

Faisal.
Ölgemälde von John
Faisal fand Medina stark von türkischen Truppen besetzt; es war Hauptquartier des gesamten zwölften Armeekorps unter Fakhri-Pascha, dem tapferen alten Schlächter, der Seitun und Urfa blutig von Armeniern »gesäubert« hatte. Offenbar waren die Türken gewarnt worden, und Faisals Hoffnung auf einen überraschenden Schlag, der vielleicht ohne einen Schuß den Erfolg gesichert hätte, war zunichte geworden. Doch für Überlegungen war es zu spät. Sein Gefolge entfloh vier Tage danach aus Damaskus und ritt ostwärts in die Wüste, um bei dem Beduinenhäuptling Nuri Schaalan Zuflucht zu suchen; am gleichen Tage deckte Faisal seine Karten auf. Als er die arabische Fahne erhob, entschwanden der panislamische, übernationale Staat, für den Abdul Hamid gewirkt, gemordet und sein Leben gelassen hatte, ebenso in das Reich der Träume wie die Hoffnung der Deutschen auf die Mitwirkung des Islams bei den Weltplänen des Kaisers. Rein durch die Tatsache der Erhebung hatte der Scherif zwei phantastische Kapitel der Geschichte abgeschlossen.
Empörung ist für den Politiker der schwerste Schritt, den er unternehmen kann, und der arabische Aufstand war ein so gewagtes Hasardspiel, daß man über Erfolg oder Mißlingen nichts voraussagen konnte. Diesmal aber begünstigte das Glück den kühnen Spieler, und das arabische Heldendrama durchlief seine stürmische Bahn von Beginn über Schwäche, Not und Verzagen hinweg bis zum strahlenden Sieg. Es war das rechte Ende für ein Abenteuer, das so Hohes gewagt hatte. Aber nach dem Sieg kam eine trübe Zeit der Enttäuschung und darauf eine Nacht, da die Kämpfenden erkennen mußten, daß alle ihre Hoffnungen sie im Stich gelassen hatten. Nun mag vielleicht der Friede der letzten Ruhe über sie gekommen sein, in dem Bewußtsein, etwas Unsterbliches hinterlassen zu haben: eine leuchtende Idee den Kindern ihres Volkes.
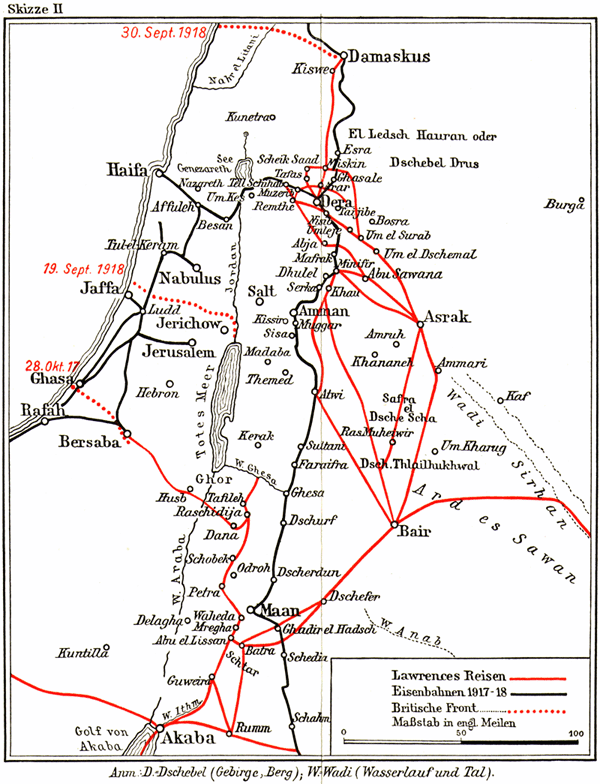
Karte 2