
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
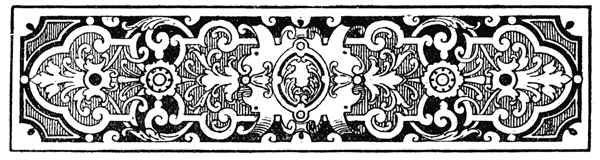
 Wie Wilhelm es vorausgesagt hatte, war es gekommen. Noch gestern war die Sache völlig ins reine gebracht worden, und schon an dem strahlenden Gesichte der Schwester hätte er bemerken können, daß sie eine glückliche Braut sei. Obwohl sie bis Mitternacht getanzt hatte, kam sie doch schon am frühen Morgen in den Garten, um ihm sogleich das wichtige Ereignis mitzuteilen, denn Auguste hing an ihrem Bruder mit großer Innigkeit, und er war stets der Vertraute all ihrer kleinen und großen Sorgen. Wilhelm wünschte ihr Glück, aber es kam etwas gezwungen heraus, oder machte er nur ein so betroffenes Gesicht, weil sie achtlos bei ihrer Erzählung die schöne Rosenknospe abgebrochen und sich an den Busen gesteckt? Sie sagte sogleich: »Mußt du nicht auch sagen, daß wir ein passendes Paar sind? Er lacht gern, ich auch, wir stimmen prächtig zusammen.«
Wie Wilhelm es vorausgesagt hatte, war es gekommen. Noch gestern war die Sache völlig ins reine gebracht worden, und schon an dem strahlenden Gesichte der Schwester hätte er bemerken können, daß sie eine glückliche Braut sei. Obwohl sie bis Mitternacht getanzt hatte, kam sie doch schon am frühen Morgen in den Garten, um ihm sogleich das wichtige Ereignis mitzuteilen, denn Auguste hing an ihrem Bruder mit großer Innigkeit, und er war stets der Vertraute all ihrer kleinen und großen Sorgen. Wilhelm wünschte ihr Glück, aber es kam etwas gezwungen heraus, oder machte er nur ein so betroffenes Gesicht, weil sie achtlos bei ihrer Erzählung die schöne Rosenknospe abgebrochen und sich an den Busen gesteckt? Sie sagte sogleich: »Mußt du nicht auch sagen, daß wir ein passendes Paar sind? Er lacht gern, ich auch, wir stimmen prächtig zusammen.«
»Ja, wenn sich nur alles so hinweglachen ließe, und Fritz scheint mir ein bißchen gar zu leichtfertig. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob du gar so glücklich mit ihm sein wirst.«
Von jedem anderen würde sie dies Wort als bittere Kränkung empfunden und es ihm sobald nicht verziehen haben; ihrem Bruder dagegen konnte sie deshalb nicht zürnen, sie sagte nur etwas gereizt und in der Weise junger Mädchen, die einen lästigen Zweifler ein für allemal abtrumpfen wollen: »Du weißt, ich kann Kopfhänger nicht leiden, und es ist gar nicht hübsch von dir, daß du gestern gegen Fritz so häßlich gewesen –« und sie bückte sich dabei nach einer prächtigen Centifolie und brach sie ab.
Wilhelm machte ein verwundertes Gesicht, der Angriff kam so unerwartet, daß er nicht ihr zweites Attentat gegen seine geliebten Rosen bemerkte.
»Ja, thu' nur nicht, als ob du noch so unschuldig wärst«, schmollte Auguste. »Er hat mir's wohl geklagt, daß du nur ihm zum Possen den Phantasten, den Bernhard, zu deinem Adjutanten ernannt hast.«
»Hat er dir auch gesagt, daß er an dem Sturze des armen Menschen schuld ist, der nun sein Lebelang lahm bleiben wird?« fragte Wilhelm mit sehr ernster Miene, und auf seinem Gesichte war deutlich die Entrüstung über den boshaften Streich des jungen Uhse zu lesen.
Die Schwester zupfte verdrießlich an der herrlichen Rose. »Was kann er dafür, daß Bernhard ein so schlechter Reiter ist? Und ich war ganz erstaunt, daß du dem albernen Menschen recht gegeben hast. Du hättest Fritz nicht schlecht machen sollen und noch dazu hinter seinem Rücken.«
Wilhelm sah, wie gnadenlos die Schwester seine Rose zerzauste, und der Unwille hierüber wie über ihren ungerechten Vorwurf brachte ihn aus seiner gewohnten Ruhe: »Ich habe nichts weiter gesagt als die Wahrheit. Es hat mir von Fritz nicht gefallen, daß er heimtückisch auf das Pferd Bernhards losschlug, und das will ich ihm auch ins Gesicht wiederholen, sobald er kommt.«
»Das wirst du nicht thun, Wilhelm!« sagte sie mit ungewöhnlich scharfer Stimme, und ihre sonst so ruhigen Augen ruhten streng befehlend auf dem Antlitz ihres Bruders.
»Ich bin ihm die Wahrheit schuldig«, entgegnete er etwas gereizt, da ihm das Auftreten der Schwester nicht gefallen wollte.
»Versuch' es, aber vergiß nicht, daß es mein Bräutigam ist, den du beleidigst, und daß ich es dir nie verzeihen werde!« Sie warf zornig die entblätterte Rose ihm zu Füßen und stürmte aus dem Garten. Wilhelm sah ihr ein wenig befremdet nach. Was war mit ihr vorgegangen? So heftig hatte sie sich gegen ihn noch nie gezeigt; und er fühlte sich anfangs von diesem Benehmen tief verletzt. Erst im Laufe des Tages kam er mehr zur Ruhe, nun ließ er der Schwester größere Gerechtigkeit widerfahren. Sprach sich nicht darin ihre grenzenlose Liebe aus, daß sie den teuren Mann gegen alle Angriffe zu schützen suchte? Und würde Helene anders gehandelt haben? Doch suchte er sich zu trösten; sie ist so goldehrlich, sie würde keine Schändlichkeit beschönigen, wenn sie eine solche erführe; aber Auguste nimmt nun einmal solche Dinge leichter. Ich will sie nicht unnütz betrüben und kann es ja für mich behalten, wie ich über meinen zukünftigen Schwager denke. Ja, helfen würd' es doch nichts, wenn ich sie auch noch so sehr warnen wollt', das hab' ich heute gesehen; und mit dem festen Entschlusse, Fritz so viel wie möglich zu schonen, trat er abends in das Haus. Er wußte schon, daß er den Bräutigam seiner Schwester dort finden würde.
Wirklich hatte sich Fritz noch vor dem Feierabend in der Scholtisei eingefunden. Er war so glücklich und hatte zu Hause keine Ruhe mehr. Der Schulze lächelte freundlich zu der stürmischen Ungeduld des jungen Burschen, die ihm ganz besonders gefiel; erkannte er doch darin, daß Auguste einmal ihren Mann am Schnürchen haben würde. Durch das Verunglücken seines Wirtschaftsschreibers Bernhard hatte er heute den ganzen Nachmittag zu Hause hocken müssen und war darüber etwas übler Laune geworden. Um so erfrischender wirkte auf ihn die Munterkeit seines Schwiegersohnes, der mit seinem frischen Humor ihn bald umzustimmen wußte.
In seiner Hast war der glückliche Bräutigam zu früh gekommen, die Geliebte war noch nicht da, und er bereute wohl im stillen seine Übereilung, aber vielleicht ließ sich die Gelegenheit benutzen, dem künftigen Schwager auch etwas ans Bein zu geben. Den Sturz Bernhards hatte er schon dem Schulzen so dargestellt, daß auf ihn nicht die mindeste Schuld fiel. – Es war nur ein leichter Klaps gewesen, den er im Scherz dem Pferde des Schreibers versetzt, und er konnte doch wahrlich nicht dafür, daß der Tintenkleckser nicht fest im Sattel saß.
Dem Schulzen war es nur ärgerlich, daß er Bernhard auf längere Zeit verlor, da er sich bereits sehr an ihn gewöhnt hatte, sonst nahm er weiter keinen Anteil an dessen Schicksal, und am wenigsten hegte er den mindesten Zweifel an den Angaben seines Schwiegersohnes.
Nachdem Fritz einige Vorfälle des gestrigen Abends in seiner drolligen Weise erzählt hatte, sagte er plötzlich: »Es war doch recht schade, daß sich Wilhelm auf dem Tanzplatz gar nicht hat blicken lassen, die Müllerstochter hat sich beinah' die Augen nach ihm ausgesehen.«
Der Schulze mochte nicht sagen, wie sehr ihn das Benehmen seines Sohnes verdrossen; er hatte noch nicht Zeit gefunden, ihn darüber zur Rede zu stellen, und er entgegnete deshalb: »Es ist gut, daß du mich daran erinnerst. Ich begreife auch nicht, was ihm in den Kopf gefahren, er wird wohl sein Lebtag ein wunderlicher Gesell bleiben.« Den Grund seines Sohnes glaubte er zu kennen; es hatte ihn verdrossen, daß er nicht Sieger geworden war, aber er hätte das nicht aller Welt zeigen sollen, und das mußte er ihm sagen. Fritz lachte vor sich hin, um anzudeuten, daß er das »Warum« sehr gut wisse.
»Er ist überhaupt zu still«, fuhr der Schulze fort, der durch dies Herzensbekenntnis dem künftigen Schwiegersohn einen Beweis seines Vertrauens geben wollte. »Er sitzt am liebsten im Garten und klebt über Blumen, als wenn dabei was herauskäme.«
»Es kommt wirklich manchmal dabei was heraus«, entgegnete Fritz mit geheimnisvoller Miene und lachte dann wieder. Der Schulze wurde aufmerksam: »Was weißt du von Wilhelm?« fragte er rasch und trat dicht an Fritz heran; seine grauen Augen ruhten so durchbohrend auf dem jungen Burschen, daß dieser beinah die Fassung verlor, obwohl er sonst sich nicht so leicht ins Bockshorn jagen ließ. Er hatte den Schulzen noch nie so gesehen, dennoch raffte er sich zu einer Antwort auf: »Nun was soll ich damit länger hinterm Berge halten? Das Ausspionieren ist nicht meine Sache, ich hab' mich nie darum bekümmert, wo der Wilhelm seine Besuche macht, aber als er gestern zum Tanz nicht kam und ich zu einigen meiner Kameraden sagte, daß es schade sei, daß er nicht gekommen, da lachten sie und meinten, die Schloßgärtnerstochter lasse ihn nicht fort.«
Der Schulze machte eine Bewegung mit der Hand, als wollte er sagen: Wenn's weiter nichts ist! Fritz ließ sich dadurch nicht stören und fuhr lebhaft fort: »Ich wollt's gar nicht glauben, aber alle versicherten mir, Wilhelm sei ganz vernarrt in das kleine Dings, er sitze jeden Sonntag bei ihr, und Bernhard habe sich schon gerühmt, daß er der künftige Schwager des Schulzen werde.« –
So leicht ließ sich der alte Fellenberg nicht den Kopf warm machen, und am wenigsten konnte er eine solche Liebschaft seines Sohnes ernst nehmen.
»Müßig Geschwätz«, sagte er geringschätzig; »Wilhelm hat schon als Kind beim Schloßgärtner gesteckt, er hat nun einmal eine Passion für diesen Kram«, und da jetzt seine Tochter ins Zimmer trat, brach er das Gespräch ab und machte sich wieder über die Schreiberei, die Liebenden sich selbst überlassend.
Bald darauf erschien auch Wilhelm vom Felde. Er begrüßte seinen zukünftigen Schwager freundlich, wie er sich vorgenommen hatte, dieser zeigte ihm jedoch die größte Kälte, die er freilich den anderen gegenüber geschickt verbarg. Als sie dann einander »Gute Nacht« sagten und ihre Hände sich kaum berührten, wußten beide, daß zwischen ihnen niemals ein freundschaftliches Verhältnis bestehen würde.
Der Schulze würde die Einflüsterungen des Schwiegersohnes nicht weiter beachtet haben, wenn nicht Auguste jetzt angefangen, in seiner Gegenwart zuweilen den Bruder zu necken und ihm scherzend vorzuwerfen, daß er die hübschen Gärtnerinnen noch mehr liebe als die hübschen Blumen.
Gewiß handelte das junge Mädchen dabei nicht aus eigenem Antrieb, sondern folgte den Anweisungen ihres Verlobten, dessen Abneigung gegen Wilhelm wuchs, je weniger derselbe sich veranlaßt sah, den ersten Schritt zur Aussöhnung zu thun. Als Auguste wieder einmal eine ähnliche Anspielung machte und Wilhelm in seiner zugeknöpften stillen Weise dazu schwieg, fragte der Schulze leichthin: »Was hast du denn mit deinem dunklen Gerede?«
»Laß dir's nur vom Wilhelm selber sagen«, entgegnete diese und schlüpfte aus dem Zimmer.
Der Vater richtete seine großen, durchdringenden Augen auf den Sohn, ohne ein Wort zu sprechen. Wohl waren dem jungen Manne die Neckereien der Schwester peinlich gewesen, und wohl hätte er gern denselben dadurch ein Ende gemacht, daß er mit seinem Vater offen und rückhaltslos gesprochen, aber stets, wenn er dazu den Anlauf genommen, hatte ihm der Mut gefehlt. Jetzt, da die entscheidende Stunde plötzlich heranrückte, fühlte er auch das Erwachen von Kräften, die bisher in ihm geschlummert hatten. Er gehörte zu jenen passiven Naturen, die gern jeden Kampf so lange wie möglich vermeiden, dann aber auch einen zähen, unerschütterlichen Widerstand leisten, den niemand von ihnen erwartet hätte.
Ruhig blickte er dem Vater ins Auge, nur seine Stimme zitterte ein wenig, als er ihm jetzt entgegnete: »Du hast mir jüngst gesagt, es sei Zeit, daß ich mich nach einer Frau umsähe; das habe ich endlich gethan.«
»Nun?« fragte der Alte gleichmütig, als Wilhelm mit seiner weiteren Erklärung etwas zögerte.
»Ich denke, du wirst mit meiner Wahl zufrieden sein«, fuhr der junge Mann nach einer kurzen Pause fort und betrachtete dabei aufmerksam die alte Schwarzwälder Wanduhr, deren Pendel sich so gleichmäßig hin und her bewegte, während sein Herz weit unruhiger zu pochen begann: »Sie ist fleißig und bescheiden, klug und anspruchslos, ich weiß, daß ich mit ihr glücklich leben werde, und meinst du nicht auch, daß dies die Hauptsache ist?« Er wandte bei dieser Frage die Augen von der Uhr auf den Vater und ließ sie einige Sekunden erwartungsvoll auf seinem Antlitz ruhen. –
»Und ich weiß noch immer nicht, wen du dir ausgesucht«, entgegnete der Schulze, der sich ans Fenster gesetzt hatte, da im Zimmer bereits eine Abenddämmerung herrschte, und auf die Kornfelder hinausschaute, die sich vor ihm ausdehnten. Trotzdem er aufmerksam den nächsten Erntesegen zu betrachten schien, war ihm kein Wort des Sohnes entgangen. Auch jetzt wandte er sein Auge von dem weiten, mächtigen Kornfelde nicht ab, das, vom Winde heftig bewegt, wie ein See auf und nieder wogte.
»Die Tochter des Schloßgärtners, Helene Winkler.« Er sprach das verhängnisvolle Wort so ruhig aus, als sei er überzeugt, daß sein Vater die Wahl seines Herzens unbedingt billigen werde.
»Hast du keine andere finden können?« fragte der Schulze und drehte jetzt dem Sohne sein Antlitz zu, in dem ein leichter Unmut aufzusteigen schien. »Ich glaube, unser Dorf ist nicht gerade arm an hübschen und reichen Mädchen, und in welchem Bauernhause du auch angeklopft hättest, du wärest überall willkommen gewesen, ich sollt's wenigstens meinen.«
»Diese reichen Bauerntöchter sind alle so dünkelhaft. Ich wüßte nicht eine, die ich zur Frau haben möchte, und ich denke, daß ich als dein Sohn nicht nötig habe, bei meiner Heirat auf Geld zu sehen.«
Der Schulze stand jetzt auf, legte die Hände auf den Rücken und wanderte mehrmals die Stube auf und ab, bevor er antwortete; dann trat er dicht an seinen Sohn hin, sah ihn mit seinen großen Augen, die in der Dämmerung noch nichts von ihrer Schärfe eingebüßt, forschend an und sagte so ruhig wie bisher: »Ich hätte dich für vernünftiger gehalten, Wilhelm.« Und als sein Sohn etwas darauf erwidern wollte, fuhr er fort: »Erst laß mich ausreden, dann magst du sprechen. Ich hätte dich für vernünftiger gehalten, dabei muß ich bleiben. Wenn du dir einbildest, daß du reich genug bist, ein armes Mädel zu heiraten, so irrst du dich sehr. Auguste bekommt zehntausend Thaler mit, und wenn du meinen Hof übernimmst, mußt du ihr noch fünftausend auszahlen. Die Scholtisei mag gut und gern dreißigtausend wert sein, aber wer nicht ordentlich zu wirtschaften versteht, der schlägt keine zwei Prozent heraus. Du bist ohnehin nicht so auf dem Platze, wie ich's gern haben möcht', und deshalb brauchst du eine tüchtige Frau, die ein bißchen dahinter ist, wo's bei dir schleppt, sonst geht's mit dir rückwärts, und wenn die Scholtisei noch größere und bessere Äcker hätte. Es ist mir leid, daß ich dir das erst sagen muß. Ich dachte, du wärest alt und verständig genug, um es selbst zu wissen.«
»Ich finde keine bessere Frau als Helene, und du brauchst keine Sorge zu haben, sie wird auch der Wirtschaft gewachsen sein«, entgegnete Wilhelm, dem die Bedenken das Vaters sehr sonderbar vorkamen.
Das Gesicht des Schulzen wurde immer finsterer. Wenn der Junge auf seine vernünftigen Auseinandersetzungen nicht hören wollte, dann mußte er ein anderes Wort mit ihm reden. Er war schon empört, daß überhaupt seinem Sohne gegenüber solche Erörterungen nötig waren.
»Du bist für dein Alter unerfahren genug«, begann er langsam, und seine Stimme erhielt einen grollenden Ton, »sonst müßtest du längst wissen, daß in eine so große Wirtschaft wie die unsere nur eine Frau paßt, die selber auf einem großen Bauerngute aufgewachsen ist und alles vom Grunde aus kennt. Hast du nicht gesehen, wie's dem Schmied Petermann ergangen, der sich ein solches Stadtpüppchen geholt? Sie gab sich sogar alle mögliche Mühe und wollte eine tüchtige Bauersfrau werden, aber es ging nicht, und sie kamen immer mehr zurück, denn du wirst wohl bei deiner Gärtnerei wenigstens so viel gelernt haben, daß man nicht eine Pflanze in jeden Boden bringen kann. Was auf fettem Erdreich aufgewachsen, soll man nicht in den Sand bringen, und umgekehrt, die kleine Helene mag ganz gut sein, ich hab' gar nichts dagegen, aber für dich paßt sie nicht, und sie kann nimmermehr deine Frau werden.«
Obwohl das Blut des Schulzen bereits heftiger zu wallen begann, hatte er mit großer Selbstbeherrschung so ruhig gesprochen, wie nur irgend möglich. Sein Sohn konnte sich wahrhaftig nicht über ihn beklagen. Es war ohnehin nicht seine Art, gleich heftig zu toben und zu lärmen, er fand es seiner Würde angemessen, stets eine große Ruhe zu bewahren, und doch übte er damit eine unbedingte Herrschaft aus, und man wagte trotz alledem nicht so leicht, seinem Willen entgegen zu treten. Er hatte eine Art und Weise, die ohne große Erregung sich unbedingten Gehorsam zu verschaffen wußte.
»Du hast recht, Vater. Ich bin alt genug, um zu wissen, was zu meinem Glücke dient, und deshalb werde ich niemand anders heiraten als Helene.« Wilhelm sprach das verhängnisvolle Wort ebenfalls ganz gelassen aus, aber es lag doch in der Ruhe, mit der die beiden diese schwerwiegende Sache verhandelten, ein großer Unterschied. Bei dem Schulzen war es die stolze Sicherheit des Mannes, der gewohnt ist zu befehlen und die bereitwilligste Unterordnung unter seinen Willen zu finden. Seine Haltung war mehr ein Ergebnis seines Charakters und seiner jahrelangen Amtsführung; die Ruhe des Sohnes dagegen war Sache des Temperaments. Er neigte zu einem gewissen Phlegma und war bei alltäglichen Vorkommnissen leicht zu lenken, weil er schon aus Liebe zum Frieden sich nicht gern gegen den Willen anderer auflehnte, und deshalb unterschätzte der Vater bei weitem seine Widerstandskraft. Er nahm auch jetzt die Erklärung seines Sohnes nicht so ernst, hielt sie wenigstens nicht für unerschütterlich und entgegnete mit einem etwas geringschätzigen Lächeln: »Ich komme mir selbst recht dumm vor, daß ich mit dir über die alberne Geschichte schwatz'. Du wirst klug thun, dem Mädel nicht erst unnütze Gedanken in den Kopf zu setzen, denn ihr könnt natürlich nie ein Paar werden.« Er war inzwischen wieder mit langsamen Schritten in der Stube auf und ab gegangen und wollte jetzt ohne weiteres das Zimmer verlassen.
Wilhelm fühlte sich durch das Auftreten des Vaters tief gekränkt; er behandelte ihn doch wie einen unerfahrenen Jungen, und noch ehe der Schulze die Thür erreichen konnte, entgegnete er hastiger und trotziger als bisher: »Vater, ich habe Helene mein Wort gegeben, und auch bei mir heißt's: Ein Mann, ein Wort!« –
Der Schulze drehte sich ganz verwundert um; er konnte bei der Dämmerung, die im Zimmer herrschte, das Gesicht seines Sohnes nicht mehr recht sehen, trotzdem suchten seine großen Augen die Dunkelheit zu durchdringen, um zu erkennen, was denn eigentlich in den »Jungen« plötzlich gefahren sei. »Du sitzest ja hoch zu Pferd – und doch sage ich dir, daß du zu dieser Heirat niemals meine Einwilligung erlangen wirst!«
»Dann müßte ich Helene ohne dieselbe heiraten!« lautete die rasche Antwort. Sie kam so schnell und entschlossen heraus, als sei Wilhelm längst mit sich selbst fertig und wolle es selbst auf das Äußerste ankommen lassen.
»Wenn ich nicht wüßte, wie nüchtern du bist, dann müßte ich denken, du seiest betrunken«, entgegnete der Schulze mit einem kurzen Auflachen.
»Warum?«
»Weil du nicht weißt, was du sagst. Beschlaf dir die Sache. Ich denke, morgen wirst du vernünftiger sein und nicht mehr solch unsinniges Zeug zusammenfaseln, und wir wollen dann vergessen, was du heute ausgekramt.«
Der Schulze legte mit seiner geistigen Überlegenheit, die er auch so oft gegen seinen Sohn herausgekehrt, die derbe Rechte fest auf dessen Schulter, und seine großen Augen ruhten jetzt durchdringend auf dem Gesicht Wilhelms, als könne er ihn damit am ehesten zur Besinnung bringen. Gerade dieses Benehmen erregte den höchsten Unmut des jungen Mannes. Er sprang auf und trat seinem Vater dicht gegenüber, so daß dem einen nicht ein Zug in dem Gesicht des andern entging. »Hältst du mich denn wirklich für ein Kind, das Ordre parieren muß? Ich bin jetzt fünfundzwanzig Jahre und kann auf eigenen Füßen stehen!« Er richtete sich bei diesen Worten in die Höhe und überragte beinahe noch um einige Zoll seinen Vater, während er gewöhnlich in seiner gebückten Haltung kleiner aussah. »Glaub' mir's nur, ich weiß schon selbst, was mir gut thut; aber es ist das Schlimme, daß die Väter gar nicht merken, daß ihre Kinder endlich herangewachsen und dann keiner sorglichen Führung mehr bedürfen.«
»So, das hab' ich noch gar nicht gewußt«, höhnte der Schulze, und seine Augen begannen zu funkeln, »wenn du dir getraust, deinen eigenen Weg zu gehen, ich hab' nichts dagegen. Aber meine Absicht steht felsenfest, weil ich sie für allein richtig halte. Entweder du führst mir eine tüchtige Bauerntochter als Hausfrau in die Scholtisei, oder du wirst hier niemals Herr werden und magst dir dein Nest wo anders herrichten.« Als Wilhelm noch etwas darauf entgegnen wollte, machte er eine abwehrende Handbewegung: »Und nun kein Wort mehr von der dummen Geschichte, du weißt ja meine Meinung und kannst dich danach richten.« Er drehte seinem Sohne rasch den Rücken zu und schritt hinaus.
Wilhelm kannte seinen Vater; es war sehr schwer, ihn von einmal gefaßten Ansichten abzubringen, und dennoch war er nicht ohne Hoffnung. »Mit einem Hiebe fällt kein Baum«, tröstete er sich, und der Vater hatte ihm ja nur einen einzigen Weigerungsgrund angegeben. Er sah nicht einmal in der Armut Helenens ein Hindernis, er glaubte nur nicht, daß sie der Bewirtschaftung eines großen Gutes gewachsen sei. Aber war denn das eine gar so schwierige Aufgabe und verlangte sie die breiten, kräftigen Schultern einer Bauerntochter? – Überall mit Hand anlegen durfte ja die Besitzerin der Scholtisei nicht; sie brauchte nur nach dem Rechten zu sehen und Fleiß und Ordnungsliebe mitzubringen. Er wollte dem Vater schon beweisen, daß Helene diese Tugenden besaß, und dann war alles gut. Er hätte nur die Kleine sehen sollen, wie sie sich zu rühren verstand und wie tüchtig sie in Garten und Wirtschaft war. Vielleicht ließ er sich doch bestimmen, über sie Erkundigungen einzuziehen, und dann mußten alle im Schlosse sagen, daß Helene ihre Pflichten mit größter Gewissenhaftigkeit erfülle.
