
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
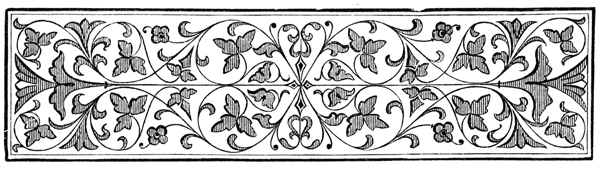
 Der Urheber des Unfalles, Fritz Uhse, kümmerte sich wenig um die Folgen seines Schabernacks. Gute Bekannte hatten ihm zwar gesagt, Bernhard habe das Bein gebrochen, und ihm seinen Sturz schuld gegeben, aber Fritz lachte nur dazu und meinte, was es denn verschlüge, wenn der Tintenkleckser jetzt herumhinken müsse. In seinem Inneren dagegen sah es doch etwas anders aus; daß Wilhelm so entschieden gegen ihn Partei genommen, wie er von allen hören konnte, verdroß ihn tief. Er hatte es mit dem Bruder seiner Geliebten immer gut gemeint, aber jetzt war es aus. Vielleicht fand sich auch einmal Gelegenheit, ihm etwas ans Bein zu geben. – Der junge Bursche lächelte bei diesem Gedanken boshaft vor sich hin. Nun fiel ihm ein, wie ehrfurchtsvoll Wilhelm die Schloßgärtnerstochter begrüßt – da konnte er sich alles erklären, weshalb der Schulzensohn Bernhard zu seinem Adjutanten gemacht und jetzt sogar einen alten Schulkameraden im Stich gelassen. Nun, er mußte ein bißchen aufpassen, um dem Duckmäuser auf die Fährte zu kommen.
Der Urheber des Unfalles, Fritz Uhse, kümmerte sich wenig um die Folgen seines Schabernacks. Gute Bekannte hatten ihm zwar gesagt, Bernhard habe das Bein gebrochen, und ihm seinen Sturz schuld gegeben, aber Fritz lachte nur dazu und meinte, was es denn verschlüge, wenn der Tintenkleckser jetzt herumhinken müsse. In seinem Inneren dagegen sah es doch etwas anders aus; daß Wilhelm so entschieden gegen ihn Partei genommen, wie er von allen hören konnte, verdroß ihn tief. Er hatte es mit dem Bruder seiner Geliebten immer gut gemeint, aber jetzt war es aus. Vielleicht fand sich auch einmal Gelegenheit, ihm etwas ans Bein zu geben. – Der junge Bursche lächelte bei diesem Gedanken boshaft vor sich hin. Nun fiel ihm ein, wie ehrfurchtsvoll Wilhelm die Schloßgärtnerstochter begrüßt – da konnte er sich alles erklären, weshalb der Schulzensohn Bernhard zu seinem Adjutanten gemacht und jetzt sogar einen alten Schulkameraden im Stich gelassen. Nun, er mußte ein bißchen aufpassen, um dem Duckmäuser auf die Fährte zu kommen.
Wie ihn auch die vermeintliche Treulosigkeit Wilhelms ärgerte, er hatte heute nicht Zeit, Grillen zu fangen. Von allen Seiten wurde ihm als Sieger gehuldigt, jeder lobte seine Tüchtigkeit, und noch eh' der Tanz begann, kam sogar der alte Schulze noch einmal auf ihn zu, klopfte ihn auf die Schulter und sagte freundlich: »Nun, Fritz, was hast du auf dem Herzen?«
Der junge Mann sah sich nach allen Seiten um, ob er gehört werde; aber die kecksten Bauernburschen hielten sich in einiger Entfernung, wenn es der Schulze darauf abgesehen, denn der Alte hatte eine Art und Weise in Blick und Haltung, die jeden zur rechten Zeit in Schranken hielt. Die beiden waren deshalb auch jetzt ganz ungestört.
»Ja, Herr Vetter, ich habe wirklich etwas auf dem Herzen«, entgegnete Fritz mit einem tiefen Seufzer, dann aber gewann schon wieder sein leichtes Temperament die Oberhand, und er setzte mit lächelndem Munde hinzu: »Ich hab' gedacht, heut' an meinem Siegestag da könnte ich gleich noch einen Sieg haben und mir die Auguste erobern.«
Der Schulze blickte einen Augenblick vor sich hin, als müsse er sich die Sache erst ordentlich überlegen. Im Grunde war er schon längst mit sich einig, dann sagte er mit großer Herzlichkeit: »Wie du die Geschichte anfängst, das ist freilich nicht ganz nach der Schnur; aber du weißt schon, daß ich wünsche, wir räumten mit manchen alten Moden endlich auf, und es ist mir weit lieber, daß du selbst bei mir um meine Tochter wirbst, als wenn du gleich deinen Vater geschickt hättest. Du bist mir als Sohn willkommen, und ich denke, wir Alten werden das übrige schon miteinander ausmachen.«
Der Schulze wollte dem jungen Manne die Rechte entgegenstrecken, aber dieser warf sich jubelnd an seine Brust, zur nicht geringen Verwunderung der in einiger Entfernung stehenden Schwarzthaler. So recht im alten, soliden Gleise ging es ohnehin nicht mehr im Dorfe zu, seitdem der jetzige Schulze das Regiment führte. Er liebte die Neuerungen und leistete den immer tiefer eindringenden städtischen Sitten und Gewohnheiten Vorschub.
Jeder junge Bursche, der vom Militär zurückkam, brachte Anschauungen und Gewohnheiten mit, die bisher in Schwarzthal nicht üblich gewesen. Früher hatte man die Neuerer so lange verhöhnt, bis sie ins alte Gleis wieder eingelenkt, beim jetzigen Schulzen war es anders. Er und seine Familie hatten schon alles Bäuerische so ziemlich abgestreift, in seinem Hause herrschte nicht mit eiserner Strenge das Herkommen, und der Schulze suchte etwas darin, sich von allen Fesseln frei zu machen, die ihm als altgewohnte Satzung unbequem erschienen. Seine Mutter war eine Städterin gewesen, er hatte einen Teil seiner Jugend bei einem Oheim zugebracht, dann beim Militär gedient und so das städtische Leben mit seiner größeren Beweglichkeit, seinen freieren Umgangsformen lieb gewonnen, deshalb war ihm der Zwang verhaßt, den sich der Bauer meistens im gewöhnlichen Verkehr auflegt. Das frische, zwanglose Auftreten Fritz Uhses fand vollends seinen lebhaftesten Beifall.
Wenn auch der Schulze sich von manch lästigen Formen frei zu machen gesucht, hatte er dennoch all seine bäuerischen Vorurteile zu bewahren gewußt, ja sie hatten in ihm noch fester gewurzelt.
Er sagte sich selbst, daß er sich so gut zu benehmen wußte wie ein Städter; – ihm gegenüber hatten sie nichts voraus; er dagegen konnte sich rühmen, daß seine Existenz auf dem allersolidesten Boden ruhte, während die meisten Leute in der Stadt von tausend Zufälligkeiten abhingen, heute reich und morgen arm waren; das machte ihn so stolz und sicher und ließ ihn mit Geringschätzung auf alle herabsehen, deren Dasein nicht eine so feste Grundlage hatte.
Der Schulze setzte sich auch jetzt wieder über alles Herkommen hinweg, erwiderte die Umarmung des jungen Mannes und sagte mit lauter Stimme, daß es die Näherstehenden noch hören konnten: »Es bleibt dabei, du bist mir als Schwiegersohn willkommen. Ein Mann, ein Wort!« Nachdem der alte Fellenberg seinen Wahlspruch ausgesprochen, wußte Fritz, woran er war; des Schulzen Gewissenhaftigkeit war ja allgemein bekannt. Dieser aber gab jetzt eine so bestimmte Erklärung um so lieber ab, da es sein Stolz nicht litt, daß er erst vorsichtig die Anfrage des alten Uhse abwartete, sondern sofort die Sache für abgemacht betrachtete. Er wußte es schon, daß der Vater Fritzens gegen eine solche Heirat keinen Einspruch erheben könnte noch würde, sondern gewiß die Verbindung als höchst vorteilhaft mit begrüßen mußte.
Und so war es auch. Fritz hatte in seinem Freudenrausche bald darauf seinen Vater aufgesucht und ihn veranlaßt, mit dem Vater Augustens die Sache vollends ins reine zu bringen. Dieser fand noch beim Feste Gelegenheit, den Schulzen beiseite zu ziehen, und wirklich verständigten sich die beiden Alten sehr rasch. Der Schulze erklärte mit jener einfachen Ruhe, hinter der sich ein gewaltiger Stolz versteckte, daß er seiner Tochter 10 000 Thaler mitgeben werde, und so blieb dem alten Uhse auch nichts weiter übrig, als ein großes Wort, wenn auch nicht gerade gelassen, auszusprechen und dem Jüngstgeborenen gleichfalls eine bare Summe von 10 000 Thalern auszusetzen, da dem Ältesten das Gut zufiel. Mit 20 000 Thalern ließ sich schon ein hübsches Besitztum erwerben, und die Zukunft der jungen Leute war also völlig gesichert.
Diese kümmerten sich wenig um die geschäftsmäßigen Abmachungen der Alten – in ihren Herzen jauchzte und jubelte ein unnennbares Glück.
Fritz wußte eigentlich gar nicht, was er in seinem Freudenrausche anfangen sollte; es war ihm zuweilen, als müsse er den ersten Besten tüchtig durchfuchteln, nur um sich Luft zu machen. Aber alle gingen ihm heute so scheu und ehrfurchtsvoll aus dem Wege; er mochte noch so übermütig aufjauchzen, im lustigen Herumschwenken mit Auguste ein Paar austanzen, niemand sagte ihm ein böses Wort oder machte ihm ein schiefes Gesicht, das er übel nehmen konnte. Er mußte seine ganz unmäßige Freude für sich behalten und konnte höchstens Auguste in seinen Taumel mit hineinziehen.
Hei, so lustig hatte ihn Schwarzthal noch nie gesehen. Er trieb die tollsten Späße und Schwänke, und selbst der Griesgrämigste mußte mitlachen, wenn Fritz in seiner überglücklichen Laune allerhand Gesichter schnitt und die kühnsten Sprünge machte. Seit vielen Jahren war es auf der großen Wiese nicht so fröhlich, so laut und lärmend zugegangen wie heut'. Fritz riß alle mit sich fort, und bis spät in die Nacht erklangen das Jauchzen und die Musik.
In der Wohnung des Schloßgärtners ging es desto stiller zu. Da Bernhard in dem Dienst des Schulzen stand, hatte Wilhelm gewünscht, der Verunglückte möchte in die Scholtisei gebracht werden, aber Helene wollte davon nichts wissen, sondern die Pflege des Bruders selbst übernehmen, und Wilhelm war zuletzt damit einverstanden, er hatte ja dann den besten Vorwand, um die Geliebte noch öfters als bisher zu sehen.
Nachdem der alte Wundarzt einen Verband angelegt hatte und Bernhard vor Ermattung in Schlaf gesunken war, blieb Wilhelm trotzdem in dem kleinen Stübchen, obwohl Helene ihn mehrmals aufforderte, doch um ihretwillen auf das hübsche Vergnügen nicht zu verzichten.
»Ich habe gar keins ohne dich«, flüsterte Wilhelm, und sein ehrliches offenes Gesicht bekundete die Wahrheit seiner Worte.
Helene blickte ihm voll inniger Dankbarkeit in die Augen. Heute hatte sie wieder den goldechten Charakter des Geliebten recht erkannt; selbst ihr Bruder, der über alle Schwarzthaler gern scharf urteilte, hatte sich über Wilhelm günstig ausgesprochen und ihn für grundehrlich erklärt. Ja, das war er, und gewiß war noch keine Lüge über seine Lippen gekommen, und deshalb wußte sie, daß er auch jetzt die Wahrheit sagte, daß sie ihm fest vertrauen konnte heute und immer.
»Aber wird man dich nicht vermissen? Und was wird dein Vater dazu sagen?« fragte sie mit einiger Besorgnis.
»Sie werden wenig nach mir fragen, und ich bin recht froh, daß ich wegbleiben kann. Ich tauge nicht in ihre Lust und weiß selbst nicht, wie es kommt, daß ich mich dort nicht behaglich fühle.«
»Dein Vater wird es gewiß nicht gern sehen, daß du dem Feste nicht beiwohnst.« Da Helene noch einmal darauf zurückkam, merkte Wilhelm ihre Absicht: »Er mag es immer erfahren, wo ich war, bei nächster Gelegenheit will ich ohnehin mit ihm sprechen.« Der junge Mann sagte die verhängnisvollen Worte so gleichmütig, als hätten sie nichts zu bedeuten und als sei er seiner Sache völlig gewiß.
Helene senkte das schöne Köpfchen auf die Brust und schwieg längere Zeit. Dann erhob sie wieder den Blick zu dem Geliebten, sah ihm mit unendlicher Zärtlichkeit in die Augen und sagte mit leiser Stimme: »Der Vater hat mir gestern so Vernunft gepredigt und ich sollt' doch der Geschichte ein Ende machen, denn sie könne doch uns beiden nichts nützen – ach und ich sollt' ihm versprechen« – weiter kam sie nicht; sie saß dicht an Wilhelms Seite und verbarg jetzt ihr thränenfeuchtes Antlitz an seiner Brust.
»Nein, Helene, versprich ihm nichts«, entgegnete Wilhelm und strich zärtlich über ihr blondes Haar. »Ich weiß schon, dein Vater traut mir nicht die nötige Kraft zu und glaubt, daß ich mich leicht unterjochen lasse; aber sei ganz ruhig, und wenn mein Vater noch so hartköpfig ist, er beugt mich nicht. Niemand auf der Welt soll uns trennen, das wirst du sehen.«
»Das ist brav, Wilhelm!« rief Bernhard, der aus seinem Schlaf erwacht war und die letzten Worte gehört hatte. Er richtete den Kopf etwas in die Höhe und fuhr in seiner phantastischen, überschwenglichen Weise fort, die gegen das ruhige Auftreten des anderen so seltsam abstach: »Ja, die Liebe ist mächtig trotz aller Tyrannei, und wen sie einmal mit Riesenarmen gepackt hat, den hebt sie in den Himmel oder schleudert ihn in einen Abgrund.«
Die Liebenden waren anfangs etwas verlegen, daß Bernhard ihre Unterhaltung mit angehört; Helene faßte sich zuerst: »Du bleibst eben wunderlich und redest immer aus deinen Büchern heraus.« –
Bernhard ließ sich durch diesen versteckten Vorwurf nicht stören: »Du hältst mich auch wohl für überspannt, wie die lieben Schwarzthaler, und doch bin ich klüger wie sie alle, und wenn ihr werdet in tiefster Bedrängnis stecken und nicht ein noch aus wissen, dann werde ich eure Vorsehung spielen, verlaßt euch nur auf mich.« Er nahm dabei eine so geheimnisvolle Miene an, als habe er wirklich das Geschick der Liebenden in seinen Händen.
Weder Helene noch Wilhelm achteten viel auf diesen Trostspruch, und der letztere bemerkte auch wirklich mit rücksichtsloser Offenheit: »Bei meinem Vater, lieber Bernhard, würdest du wenig ausrichten, aber ich verlass' mich auf mich selbst. Er mag sagen was er will, ich werde niemand anders heiraten als Helene.« Der Blick aus seinen treuen, ehrlichen Augen, den er jetzt auf das junge Mädchen richtete, sprach mehr als die höchsten Beteuerungen von seinem festen, unerschütterlichen Willen.
Die beiden Liebenden reichten sich die Hände und schauten sich mit seligem Lächeln in die Augen.
»Um so besser, trotzdem kannst du auf mich zählen, wenn es schief gehen sollte«, und obwohl ihn sein Bein bei der Bewegung heftig schmerzte, richtete er sich noch etwas mehr in die Höhe. »Wir müssen beide glücklich werden, du mit meiner, und ich mit deiner Schwester, und wenn darüber die Welt zu Grunde gehen sollte.«
Wilhelm sah seinen Freund ganz verwundert an. Sprach er noch im Fieber, oder war er wirklich bei Sinnen! Er hatte wohl bemerkt, daß Bernhard sich etwas um Auguste zu schaffen machte, aber auch, wie kühl und verächtlich sie am letzten Tage den Schreiber behandelte, den sie in ihrem Stolz tief unter sich wähnte. Wie konnte der thörichte Mensch sich nur Hoffnungen machen, wo er nicht einmal die Liebe des Mädchens für sich hatte und nun vollends seit seinem Unglück nicht für sich gewann. Wilhelm kannte zu genau den Hochmut seiner Schwester – in einen hinkenden Schreiber verliebte sie sich nie – der würde nie ihr Mann, selbst wenn der Vater zu dieser wunderlichen Verbindung Ja und Amen gesagt, und das war vollends nicht zu erwarten. »Sieh mich immer versteinert an«, rief Bernhard, und er stieß ein kurzes Lachen aus. »Ihr haltet mich alle für phantastisch und halb närrisch, ich weiß es schon – aber ich versichere dich – niemand besitzt einen so unbeugsamen Geist, der so rastlos auf sein Ziel lossteuert wie ich – ich scheue vor nichts – vor gar nichts zurück, wenn es gilt, einen Gedanken zu verwirklichen, der sich unausrottbar in mir festgewurzelt.« Das blasse, hübsche Gesicht des jungen Mannes zeigte jetzt eine Energie, eine düstere Wildheit, vor der Helene erschrak, während Wilhelm nur bedenklich den Kopf schüttelte, als wolle er sagen: »Bernhard bleibt doch ein wunderlicher Kerl.«
Die Schwester kannte jedoch den Charakter ihres Bruders besser. Sie wußte recht gut, daß bei aller Überspanntheit, die Bernhard zur Schau trug und die den Bauern so lächerlich erschien, auf dem Grunde seiner Seele etwas ruhte, was zu fürchten war. Ihr, selbst dem Vater gegenüber hatte er oft seine finstere Heimtücke gezeigt, sobald ihm nicht jeder Wunsch erfüllt worden. Bernhard hatte überhaupt einen wunderlichen Lebenslauf durchgemacht und von Jugend auf etwas Unberechenbares gezeigt. Der alte Schloßgärtner hatte es nie verstanden, seinen Sohn ins rechte Gleis zu bringen. Den furchtbaren Eigensinn des Knaben, der sehr früh zu Tage getreten, hatte der Alte anfangs mit eiserner Gewalt zu beugen gesucht, und als es ihm doch nicht gelang und der Junge davon nur störrischer und boshafter wurde, hatte er ihn seinen Weg gehen lassen und sich nicht weiter um ihn bekümmert. »Was einmal Dornenstrauch werden will, mag es bleiben«; mit diesen Worten suchte er sich zu trösten und überließ den nichtsnutzigen Burschen seinem Schicksal. Prügel und Ermahnungen halfen ja doch nichts, und er war nicht der Mann dazu, um sich täglich wegen des ungeratenen Jungen die Seele aus dem Leibe zu ärgern.
Neben seinem grenzenlosen Eigensinn zeigte der Knabe schon früh ebensoviel Eitelkeit und Dünkel; die letzten Eigenschaften trugen ihm manche Tracht Prügel ein, da die Bauernjungen auf seine spitzen Reden und Neckereien gern mit ihren Fäusten antworteten, weil sie mit dem Munde nicht so fortkonnten, wie der zungenfertige Schloßgärtnerssohn. Die Söhne der Gutsherrschaft studierten, auch Bernhard rühmte sich, er wollte kein dummer Bauernlümmel, sondern ein gelehrter Mann und vor allen Dingen Jurist werden. – Eine Äußerung seines Vaters hatte in dem jungen Kopfe diese Idee erzeugt. Wenn der frühreife Knabe bei irgend einem Versehen mit Ausflüchten und kecken Verteidigungen bei der Hand war, dann sagte der alte Winkler im Unwillen: »An dir wäre ein Jurist verdorben«, und in dem unruhigen Hirn des Knaben blieb dieser Gedanke haften. Wirklich schaffte auch der Schloßgärtner seinen Sohn auf das Gymnasium der nächsten Stadt und opferte sein sauer Erspartes, in der Hoffnung, daß sein Sohn doch endlich zur Vernunft kommen und einmal ein brauchbarer Mensch werden würde. Eine Zeit ging es auch ganz gut. Bernhard verriet ungewöhnliche Anlagen und lernte fabelhaft leicht. Mit vierzehn Jahren war er schon nach Sekunda aufgerückt. Die jungen Gymnasiasten hatten ganz insgeheim eine Verbindung gestiftet, es war eine unschuldige Spielerei, die doch den jugendlichen Herzen so viel Schwung und Begeisterung gibt; aber die Verbindung wurde entdeckt, und die Lehrer des Gymnasiums nahmen die Geschichte weit ernsthafter, als sie es verdiente.
Eine Untersuchung wurde eingeleitet – die meisten machten sogleich Geständnisse und kamen mit gelinden Strafen davon. Nur Bernhard war dazu nicht zu bewegen, obwohl die Lehrer nichts weiter forderten als sein Geständnis. Sein Starrsinn erwachte, und seiner Eitelkeit schmeichelte es, sich mit stoischem Gleichmut zu wappnen und als ein Opfer der guten Sache zu gelten. Sein jugendlicher Ehrgeiz erreichte auch wirklich das Ziel. Er wurde vom Gymnasium fortgeschickt, und da sein Vater hierin eine furchtbare Schande sah und ihm erbittert schrieb, er ziehe seine Hand von ihm ab, so blieb Bernhard nichts weiter übrig, als seinen Studien Valet zu sagen.
Als Gymnasiast hatte Bernhard die Bekanntschaft eines jungen Schreibers gemacht, der von seinem Berufe eine sehr hohe Meinung hegte und sich stets rühmte, noch einmal »königlicher Kreisgerichts-Kanzlei-Direktor« zu werden; von diesem glänzenden Titel angelockt, von seiner Verlegenheit getrieben, nahm der junge Winkler ebenfalls eine Stelle im Bureau eines Rechtsanwaltes an. Er zeigte sich äußerst anstellig und erhielt in kurzer Zeit einen tüchtigen Einblick in den Gang der Prozesse, lernte eine Menge Kniffe und Ränke kennen, mit denen sich mancher den eisernen Armen irgend eines Gesetzesparagraphen zu entwinden sucht, und sein scharfer Verstand fühlte sich von dem Leben und Treiben, das in dem Bureau eines solchen Anwaltes vorherrscht, seltsam angezogen. Sein Prinzipal war mit ihm außerordentlich zufrieden, und er rückte bald zum ersten Sekretär auf, der schon selbständig Prozeßschriften zu verfertigen hatte. Leider verscherzte er sich auch diese Stellung. Seine Eitelkeit fühlte sich geschmeichelt, wenn sich allerhand verlorene Subjekte herandrängten, die seinen besonderen Rat und Beistand beanspruchten. Er nahm sich ihrer mit Vorliebe an, suchte die unsaubersten Sachen zu verfechten, gab Schwindlern und Gaunern genaue Anweisungen, wie sie den klaren Bestimmungen des Gesetzes ein Schnippchen schlagen konnten, und fertigte mit juristischem Raffinement Kaufpunktaktionen, die nur zum Nachteil irgend eines herbeigeschleppten Opfers dienen sollten. Für Bernhard fiel bei all diesen Geschäften ein reichlicher Gewinn ab. Endlich erfuhr sein Prinzipal von seinem Treiben, das mit den strengen Anschauungen von Recht und Moral nicht in Einklang stand; er untersagte es dem jungen Winkler ernstlich, und als dieser die Warnungen nicht beachtete, blieb dem hochgeachteten Rechtsanwalt nichts weiter übrig, als einen Menschen zu entlassen, der zwar eine ungewöhnliche Begabung besaß, dessen Nebenbeschäftigung ihn selbst jedoch bloßstellen konnte.
Bernhard blieb noch in der Stadt, bis sein letzter Pfennig aufgezehrt war, und vertrieb sich die Langeweile mit Lesen von Büchern. Auerbachs Dorfgeschichten fielen ihm in die Hände; nun war sein Entschluß gefaßt. Vor seiner beweglichen Phantasie tauchte das Landleben in den bezauberndsten Farben auf. Damals, als Kind, hatte er nicht begriffen, welche Poesie darin liegt; jetzt kehrte er als gereifter Mensch zurück, jetzt wollte er in der Natur all die Chikanen vergessen, die das heimtückische Schicksal an ihm ausgeübt. Er schrieb an seinen Vater und teilte ihm seinen neuesten Entschluß mit, erhielt zwar keine Antwort, machte sich aber doch nach der Heimat auf den Weg, da auch sein Kredit in der Stadt schon erschöpft war. Diese engherzigen Menschen hatten so wenig Vertrauen! Wie anders waren die Leute auf dem Lande, kindlich, gutmütig, gläubig – für seine juristische Geriebenheit eröffnete sich gewiß ein reiches Feld. Er war wohl überzeugt, daß sein Vater bei der Heimkehr des verlorenen Sohnes kein Kalb schlachten würde, aber er wußte auch, daß der gutmütige Mann ihn nimmermehr von der Schwelle weisen könne. Und so war es auch; der Schloßgärtner überhäufte seinen Sohn nicht einmal mit vielen Vorwürfen. Freilich zeigte er ihm eben so wenig eine herzliche Teilnahme; er ließ Bernhard beginnen und treiben, was er wollte, höchstens besuchte er jetzt öfters als sonst das Wirtshaus und ertränkte seinen Kummer über den ungeratenen Sohn im Glase. Auch heute hatte der Alte sich schon früh fortbegeben, er mochte von der ganzen Festlichkeit weder etwas sehen noch hören und war ins nächste Dorf gegangen, um sich dort in aller Stille ein Räuschchen anzutrinken.
Vor etwa einem Jahre war Bernhard nach Hause gekommen. Anfangs hatte er dann und wann den Vater bei seinen Beschäftigungen zu unterstützen gesucht, bald fand er jedoch die Arbeit seiner unwürdig und lag lieber den ganzen Tag auf dem Sofa und schuf sich beim Dampfe einer Zigarre Bilder einer glänzenden Zukunft, je armseliger die Gegenwart vor ihm lag. Zuweilen suchte ihn doch schon ein Bauer auf, der von seiner juristischen Klugheit gehört, und fragte ihn um Rat. Dann war er in seinem Element, und als die Bauern sahen, daß der junge Schreiber wirklich etwas verstand und äußerst gerieben war, da imponierte ihnen sein Wissen und sie fanden sich immer zahlreicher bei ihm ein. Vielleicht wäre er ganz auf den Weg des Winkeladvokaten gedrängt worden, wenn ihm nicht die Liebe zur schönen Schulzentochter eine ganz andere Richtung gegeben hätte. Sie sehen und für sie in heißer, glühender Leidenschaft entbrennen, war eins. Damals war Fritz vom Militär noch nicht zurückgekehrt, und Augustens Herz hatte sich noch nicht völlig entschieden. Auch ihr Stolz hatte in ihrer jungen Brust nicht so tiefe Wurzel geschlagen, und deshalb betrachtete sie den jungen, hübschen Schreiber mit ganz anderen Augen als heute. Sie war so blutjung, und die übrigen Burschen fanden sie noch nicht so recht der Beachtung wert, und so mochten ihr Bernhards zärtliche und verehrungsvolle Worte, die klangen, als seien sie an ein völlig erwachsenes Mädchen gerichtet, wohl schmeicheln. Er aber nahm für Liebe, was bei Auguste kindliche Eitelkeit war, und in seiner phantastischen, überschwenglichen Weise hatte er nicht eher Ruhe, als bis er das Glück genoß, täglich um das herrliche Mädchen zu sein, und wenn er hätte beim Schulzen den niedrigsten Knechtsdienst übernehmen müssen, er wäre davor nicht zurückgeschreckt, hoffte er doch damit die Geliebte für sich zu erobern.
Zuerst suchte sich Bernhard die Freundschaft Wilhelms zu erwerben, das fiel bei dem ehrlichen Burschen nicht schwer. Nun quälte er ihn beständig mit dem Anliegen, ihm bei dem Vater die erste beste Stelle auszuwirken, und Wilhelm gelang es wider eigenes Erwarten, den Wunsch des Freundes zu erfüllen. Er machte dem Vater eines Tages den Vorschlag, Bernhard als Wirtschaftsschreiber und Art Faktotum bei sich aufzunehmen, und der Schulze zeigte sich gar nicht abgeneigt; er hatte bei seinem Amte ohnehin viel Schreibereien, und Wilhelm konnte mit vollem Recht die große Klugheit seines Schützlings rühmen; zu gleicher Zeit kitzelte es auch den Hochmut des Schulzen, sich einen solchen Schreiber zu halten, und er griff zu, da Bernhard ohnehin die bescheidensten Forderungen stellte. Freilich hatte der vorsichtige Alte sich eine vierwöchige Probe ausbedungen, doch der junge Mensch zeigte sich während dieser Zeit so anstellig, wußte dem Schulzen so um den Bart zu gehen, daß dieser mit seinem Wirtschaftsschreiber außerordentlich zufrieden war, und Bernhard gab sich alle Mühe, daß es auch später bei dieser Zufriedenheit blieb. Für das Glück, Auguste täglich zu sehen, würde er das Schlimmste ertragen haben, und Fellenberg verlangte von ihm nichts Unbilliges. Ja, der junge Wirtschaftsschreiber glaubte fest daran, sich auch die Gunst des alten Schulzen so zu erringen, daß er ihn gern als Schwiegersohn annehmen würde, und er sah sich schon am Ziel.
Da kam Fritz Uhse von den Ulanen zurück, und mit ihm zog die Unruhe in das Herz des jungen Winkler. Er gewahrte bald, daß Auguste ihm untreu wurde, denn mit seiner lebhaften Phantasie hatte er sich eingebildet, daß die hübsche Schulzentochter sterblich in ihn verliebt sei. Anstatt nun still zu resignieren, entflammte seine Leidenschaft noch weit mehr. Jetzt mußte er sie um jeden Preis dem übermütigen Bauer streitig machen und das verlorene Herz zurückerobern. Ach, er hatte es nie besessen, und sein Bemühen um ihre Gunst, sein zärtliches verstohlenes Schmachten und Augenverdrehen fand jetzt die heitere Schulzentochter einfach lächerlich und zuweilen höchst lästig. Bernhard dagegen ließ sich weder durch verächtliche Kälte noch durch stumme Gleichgültigkeit erschrecken, sondern fühlte sich wie mit tausend Banden an sie gekettet und trug sich mit der trügerischen Hoffnung, daß er dennoch alle sich ihm entgegenstellenden Hindernisse besiegen und sie endlich »sein« nennen werde.
Weder Wilhelm noch Helene teilten seine Hoffnungen. Der erstere besonders wußte, wie die Verbindung der Schwester mit Fritz Uhse eine beschlossene Sache war und sein Vater nimmermehr »nein« sagen würde, sobald der junge Vetter um die Tochter wirklich warb, und daran war jetzt nicht mehr zu zweifeln. Welche Aussichten blieben da für Bernhard? Er durfte sich nicht die mindeste Hoffnung machen, trotz alledem die Schwester für sich zu gewinnen, und offen und ehrlich, wie Wilhelm war, entgegnete er auf die kühnen Träumereien des Freundes: »Es wird dir nichts nutzen, lieber Bernhard, meine Schwester ist ebenso halsstarrig wie mein Vater, und sie ist nun einmal ganz vernarrt in den Fritz und wird keinen anderen nehmen als ihn.«
Der junge Schreiber lächelte selbstgefällig: »Sie lacht über seine albernen Späße, das ist alles. Aber mir hat zuerst ihr Herz gehört, und ich werde es wieder zurückerobern, einem Tölpel wie diesem Fritz weiche ich noch lange nicht.« Und als Wilhelm zu dieser kecken Behauptung ein sehr ungläubiges Gesicht machte und etwas entgegnen wollte, drehte Bernhard ärgerlich den Kopf auf die andere Seite und murmelte: »Denkt, was ihr wollt, ich werde euch beweisen, was wahre Liebe vermag.«
Die beiden Liebenden waren wieder sich selbst überlassen. Sie plauderten leise von einer glücklichen Zukunft, und freundliche Bilder gaukelten vor ihren trunkenen Augen.
