
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
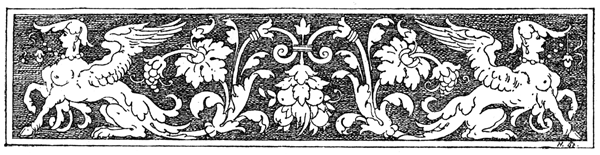
 Fritz Uhse war der übermütigste und heiterste Bursche von ganz Schwarzthal. Wenn irgendwo im Dorfe eine Tollheit begangen worden, dann hieß es: wer wird es anders sein als der lustige Fritz? Und man schoß wohl selten daneben. Welche Eulenspiegeleien und Schalksstreiche wußte man von ihm zu erzählen! Bald war der Küster mitten in der Nacht herausgetrommelt worden, um in der Familie eines Gestorbenen zu erscheinen, bald zeigte sich am Fenster einer Spinnstube ein Ziegenbock, den übermütige Hände da hinaufgehoben, und das plötzliche Auftauchen des gehörnten Tieres verbreitete den größten Schrecken, denn man glaubte schon, der Gottseibeiuns selber stattete seinen höchsten Besuch ab; dann meckerte zuweilen derselbe Bock ganz kläglich am frühen Morgen auf dem Dache eines Hauses, und mit vieler Not konnte er von der Feueresse erlöst werden, an die er angebunden war. Bei schlechtem Wetter geschah es auch wohl, daß an Kirchtagen gerade an den besten und einzig passierbaren Stellen des Weges Strohwische steckten, und nun manch dumme Magd ängstlich durch den dicksten Schmutz watete, weil sie die Strohwische als Zeichen nahm, daß der gute Weg für sie verboten sei.
Fritz Uhse war der übermütigste und heiterste Bursche von ganz Schwarzthal. Wenn irgendwo im Dorfe eine Tollheit begangen worden, dann hieß es: wer wird es anders sein als der lustige Fritz? Und man schoß wohl selten daneben. Welche Eulenspiegeleien und Schalksstreiche wußte man von ihm zu erzählen! Bald war der Küster mitten in der Nacht herausgetrommelt worden, um in der Familie eines Gestorbenen zu erscheinen, bald zeigte sich am Fenster einer Spinnstube ein Ziegenbock, den übermütige Hände da hinaufgehoben, und das plötzliche Auftauchen des gehörnten Tieres verbreitete den größten Schrecken, denn man glaubte schon, der Gottseibeiuns selber stattete seinen höchsten Besuch ab; dann meckerte zuweilen derselbe Bock ganz kläglich am frühen Morgen auf dem Dache eines Hauses, und mit vieler Not konnte er von der Feueresse erlöst werden, an die er angebunden war. Bei schlechtem Wetter geschah es auch wohl, daß an Kirchtagen gerade an den besten und einzig passierbaren Stellen des Weges Strohwische steckten, und nun manch dumme Magd ängstlich durch den dicksten Schmutz watete, weil sie die Strohwische als Zeichen nahm, daß der gute Weg für sie verboten sei.
Für alle diese Possen und Schwänke machte man Fritz Uhse verantwortlich. Er mochte wohl immer seine Helfershelfer haben, aber jeder war überzeugt, daß der tolle Fritz die Triebfeder von allem Unfug sei, der im Dorfe irgendwo geschah. Und unrecht konnte man dem jungen Burschen schwerlich damit thun. Wer in seine schelmisch blitzenden Augen sah, der konnte ihm wohl solche Streiche zumuten. Auch sein frisches, blühendes Antlitz, auf dem nicht die leiseste Spur von irgend einer Sorge zu bemerken war, verriet, daß der junge Mensch ein vom Schicksal verhätscheltes Glückskind war. Sein Vater gehörte zu den reichen Bauern Schwarzthals, und wenn er auch nicht Aussicht hatte, einmal Besitzer des Gutes zu werden, da sein ältester Bruder darauf Anspruch hatte, so mußte er eine bedeutende Summe erhalten, und seine Zukunft war völlig gesichert.
Deshalb hatte selbst der Schulze gegen eine künftige Verbindung seiner Tochter mit Fritz nichts einzuwenden, er war noch dazu mit den Uhses weitläufig verwandt, und die Keckheit des Burschen gefiel ihm. Er hatte gar nichts so Duckmäuserisches und Insichgekehrtes wie sein Sohn, und wenn der alte Fellenberg sah, wie er alles anzugreifen verstand, daß es eine Art hatte, wie er's dem besten Knecht zuvorthat an Geschick und Arbeitskraft, da hätte er oft gewünscht, daß Fritz sein Sohn gewesen wäre.
Ja, der Fritz Uhse versprach einmal, trotz aller seiner Schwänke und Possen, ein tüchtiger Wirt zu werden, nachdem er seinen jugendlichen Übermut ein bißchen ausgetobt. Was aber den alten Schulzen noch besonders für seinen jungen Vetter einnahm, war die leidenschaftliche Vorliebe für die Pferde.
Es war der Stolz Fellenbergs, zwei der prächtigsten Pferde im Stalle zu haben, und Fritz teilte seine Passion, ja, er trieb's wohl noch ein bißchen ärger. Als Junge schon hatte er keinen anderen Wunsch gehabt, als ein Pferd zu besitzen, und in seiner kecken, hinreißenden Weise war es ihm leicht gewesen, seinen gutmütigen Vater zur Erfüllung seines Wunsches zu bewegen. Nun verwuchs der junge Bursche förmlich mit seinem Pferde; er hätte am liebsten auf dem Rücken desselben geschlafen, und da dies nicht anging, lag er wenigstens die Nacht über bei ihm im Stalle. Erst die Hänseleien seiner Kameraden veranlaßten ihn, auf dies Glück zu verzichten. Fritz war nicht ohne Eitelkeit, und das fortwährende Gespött, er sei ein Pferdeknecht geworden, konnte er auf die Länge nicht ertragen. Er schlief wieder als Bauernsohn in der Stube; aber sein Pferd blieb ihm doch der liebste Genosse, und es war deshalb kein Wunder, daß er unter die Ulanen ging, als er mit 19 Jahren freiwillig sich zum Militär meldete. Kaum hatte er seine Zeit abgedient, da kam 1866, und er wurde wieder eingezogen.
Niemand war froher als Fritz Uhse. Krieg! das war so ganz nach seinem Sinn, und es gab in der ganzen Schwadron keinen tolleren, übermütigeren Kameraden als ihn. Die Kavallerie hat in jenem märchenhaft schnell beendeten Feldzuge wenig Gelegenheit gehabt, sich hervorzuthun – auch Fritz Uhse konnte nicht all die kühnen Reiterstückchen ausüben, von denen er geträumt, aber er kam doch auch mit dem Nimbus zurück, der alle umgab, die den siebentägigen Krieg mitgemacht, und der schlanke, hübsche Bursche erregte jetzt noch weit mehr Aufmerksamkeit als früher. Und wie wußte er zu erzählen! –
Es hatten wohl noch viele junge Schwarzthaler den Feldzug mitgemacht, aber keiner verstand alles so lebendig und anschaulich zu schildern, wie Fritz Uhse. Da erlebte man alles mit, und auch der alte Fellenberg hörte dem jungen Burschen gern zu. Die aufmerksamste Zuhörerin hatte er freilich an Auguste. Sie hatte ihn schon bewundert, als sie noch in die Schule ging, denn wie prächtig sah der junge Vetter in der Ulanenuniform aus, wenn er auf Urlaub nach Schwarzthal kam, und jetzt, wo er als Held aus einem ruhmreichen Kriege zurückkehrte, flog ihm rasch ihr junges, lebhaftes Herz entgegen.
Der Vater sah die Verbindung gern, das konnte man schon an der Herzlichkeit bemerken, mit der er den jungen Vetter behandelte. Wäre ihm Fritz Uhse nicht als passender Freier für seine Tochter erschienen, er würde nicht viel Aufhebens mit ihm gemacht und sich ganz einfach seine öfteren Besuche verbeten haben. Freilich hatten sie dem Sohne gegolten, denn Wilhelm und Fritz waren so ziemlich in einem Alter und von Jugend auf miteinander befreundet; aber der alte Schulze wußte bald, wo der Wind herkam und warum sich Fritz auch einfand, selbst wenn Wilhelm gar nicht da war.
Obwohl den jungen Leuten gar kein Hindernis in den Weg gelegt wurde, trieben sie es doch wie alle Liebenden und zogen eine heimliche Zusammenkunft einem öffentlichen Besuche weit vor. Ein verstohlener Händedruck, ein zärtliches Flüstern, das bleibt selbst für diejenigen noch immer der höchste Genuß, die schon auf breiter bequemer Heerstraße dem Altar zuwandern können.
Auch heute hatte Fritz Gelegenheit gefunden, seine Auguste heimlich zu sehen und zu sprechen. In dem großen Gemüsegarten, den Wilhelm in seinen Mußestunden völlig umgewandelt und mit Blumen und Strauchwerk reich geschmückt, gab es manch verschwiegenes Plätzchen, und dem jungen Burschen war es ein Leichtes, von hinten über die Felder weg in den Garten zu kommen. Der Staketenzaun hätte wohl noch einmal so hoch sein können, und Fritz wäre blitzschnell darüber hinweggekommen. In der alten Lindenlaube saßen die beiden Liebenden und hatten sich wichtige Dinge anzuvertrauen. Der Geruch des frischen Heues drang von den gemähten Wiesen herüber und mischte sich mit dem Duft der Rosen, die Wilhelms eifrige Hand vor die Laube gepflanzt. Draußen auf dem Felde war es ganz still, die Arbeiter waren bereits heimgekehrt und suchten eher als sonst ihr Lager, denn es war Sonnabend, und morgen erwartete sie ein wichtiges Fest, das ihre volle Rüstigkeit erforderte.
Nur Fritz fand noch nicht so rasch die Ruhe, er mußte erst mit der Geliebten ein Viertelstündchen verplaudern. Wie blitzten die Augen des Burschen, als er jetzt dem jungen Mädchen zuflüsterte: »Gib acht, niemand anders wird Sieger als ich. Dein Vater glaubt zwar, daß er das beste Pferd im Stalle hat, aber ich tausche nicht mit meinem Fuchs, und du sollst sehen, daß ich dem Wilhelm zuvorkomme.«
»Unseren Braunen wird Bernhard reiten«, sagte Auguste und machte ein bedenkliches Gesicht.
»Den Tintenkleckser fürchte ich am wenigsten«, entgegnete Fritz lachend.
»Er hat sich gerühmt, daß er den Preis erhalten muß«, meinte die Geliebte.
»Der armselige Kerl, er sitzt wie ein Fiedelbogen auf dem Pferde. Das wär' auch gerade einer, der mir zuvorkommen könnte«, und der Bursche lachte noch herzlicher.
Ein schwaches Geräusch ließ sich vernehmen, es war wie der tiefe Atemzug eines Menschen.
»Ich glaube, Bernhard belauscht uns«, flüsterte die Schulzentochter.
»Mag er doch«, entgegnete Fritz mit großer Sicherheit, »wenn ich morgen mir die Fahne erreite, dann spreche ich gleich mit deinem Vater. Ich hätt' schon längst mit ihm reden können, denn ich weiß, er hat nichts dagegen, aber ich mußt' doch erst wissen, ob du mir wirklich gut bist und ob nicht endlich das Augenverdrehen und Seufzen des studierten Herrn dir doch zu Herzen gegangen.«
»Du bist schlecht, Fritz, du weißt recht gut, daß ich Bernhard nicht ausstehen kann.«
»Dafür mußt du einen Kuß haben«, rief Fritz, und noch ehe sich die Geliebte zur Wehr setzen konnte, hatte er sie umfaßt und wollte einen herzhaften Kuß auf ihre Lippen drücken, als er plötzlich durch einen Anruf gestört wurde. »Wenn man sich so sicher fühlt, was hat man da nötig, nachts herumzuschleichen und den guten Ruf eines jungen Mädchens auf das Spiel zu setzen?«
Der strenge Sittenrichter, der so plötzlich aufgetaucht war, blieb wohlweislich am Eingange stehen, um schlimmsten Falls einen raschen Rückzug nehmen zu können; auch beobachtete er aufmerksam, soweit es die Dämmerung zuließ, jede Bewegung seines Gegners.
Es war ein schlanker, hübsch gewachsener Mensch, mit einem blassen, intelligenten Gesicht. Er hatte die Arme über die Brust gekreuzt und eine vornehme Haltung angenommen, doch Fritz ließ sich weder durch seine Worte, noch durch sein Auftreten einschüchtern, sondern sprang sogleich in die Höhe, trat rasch entschlossen auf den Eindringling zu und fragte mit scharfer Stimme: »Was unterstehst du dich? Noch ein Wort, und ich schlage dich zu Boden!«
Die blitzenden Augen und die bereits erhobenen Fäuste bekundeten, daß es nicht auf eine bloße Drohung abgesehen.
»Na, ich brauche mir gar nicht von dir Grobheiten einzustecken, ich werde den Schulzen fragen, ob ihm das gefällt«, und noch ehe Fritz den Gegner fassen und für seine Entgegnung züchtigen konnte, war Bernhard verschwunden.
»Der Lump!« brummte der junge Bursche ingrimmig, und sich wieder zu der Geliebten wendend, sagte er beschwichtigend: »Laß dich von dem studierten Herrn nicht einschüchtern, ich schlage ihm alle Knochen im Leibe entzwei, wenn er deinem Vater was ins Ohr setzen will, und nun sei ruhig, Auguste, morgen sehen wir uns, und ich gewinne den Preis und dich dazu.«
»Ich hab auch gar keine Furcht vor dem Narren«, sagte sie mit der größten Seelenruhe, und Fritz fühlte sich davon nicht wenig erleichtert. Er nahm jetzt flüchtigen Abschied und war verschwunden.
Als Auguste den Garten verlassen und ins Haus treten wollte, fühlte sie sich von einer Hand erfaßt. »Auguste, ich will still sein um Ihretwegen, mögen Sie daraus ersehen, wie innig ich Sie liebe«, zischelte ihr eine Stimme zu.
»Das haben Sie gar nicht nötig«, entgegnete Auguste kurz und ging an ihm vorüber. Trotz der Dämmerung konnte er bemerken, welch verächtlichen Blick sie ihm zugeworfen, als sie ihm diese Antwort erteilt.
Bernhard blieb einen Augenblick wie verdutzt an der Gartenthür stehen; seine Eitelkeit fühlte sich durch das Benehmen des jungen Mädchens tief verletzt, und dennoch sah er ihr mit Bewunderung nach. Wie keck und sicher schritt sie dahin – es war doch ein Prachtmädel – und er begriff nicht, warum sie sich gerade in den Tölpel, den Fritz, vergafft. Er richtete sich in die Höhe, strich seinen Schnurrbart und sah wohlgefällig an sich herab: »Nun, endlich müssen ihr doch die Augen aufgehen. Mit all diesen Bauerlümmeln nehm' ich's schon noch auf«, und von diesem Gedanken getröstet, schlich er von dannen.
Alle Jahre hielten die Schwarzthaler ein eigentümliches Fest ab: den Ritt um die Fahne. In wenigen Dörfern konnten die Bauern so stolz auf ihre Pferde sein als hier, und deshalb mußten sie, sobald die erste Heuernte vorüber, durch eine Art Wettrennen erproben, wer sich des besten Rosses rühmen durfte. Zu gleicher Zeit war dies Fest eine militärische Übung. Die meisten Schwarzthaler hatten bei der Kavallerie gestanden, und nun konnte jeder von den jungen Burschen zeigen, daß er noch nichts vergessen habe, während die Alten mit außerordentlichem Behagen dem Schauspiel zusahen und sich erinnerten, wie sie einst ebenso kerzengerade und stattlich zu Pferde gesessen.
Auf einer mächtig sich ausdehnenden Wiese, die von einem Hügel begrenzt wurde, fand das Fest regelmäßig statt. Eine Menge Zuschauer, selbst von den entlegensten Dörfern, hatte sich bereits eingefunden, und das bunte Menschengewimmel bekundete die große Anziehungskraft und Wichtigkeit dieses Tages.
An der einen Seite der Wiese hatten sich die Wagen mit den Bauernfrauen und Mädchen aufgestellt, während an den anderen Seiten die übrigen Dorfbewohner Platz genommen. Vor der Mitte der langen Wagenreihe war die mit Bändern und Kränzen geschmückte Fahne aufgesteckt, welche aus einem prächtigen seidenen Tuche, dem Preise des Rennens, bestand.
Auf dem vordersten Wagen saß Auguste. Sie war im Feiertagskleide und sah heute noch stattlicher aus als sonst. Für ihre Jugend hatten ihre Formen beinahe schon eine zu große Reife; aber gerade diese Fülle machte auf die Bauern einen imponierenden Eindruck. Alle erkannten an, daß die Schulzentochter die Schönste im Dorfe sei und ihr in jeder Hinsicht die Ehre des Vortritts gebühre. Sie hielt einen Kranz in der Hand, um den Sieger damit zu schmücken. Es war freilich gegen das Herkommen und noch niemals bei dieser Gelegenheit geschehen, aber Auguste hatte so lange ihren Vater mit Bitten bestürmt, bis dieser den ungewöhnlichen Schritt gut hieß, und die hübsche Schulzentochter konnte sich schon etwas erlauben, was man bei jeder anderen als lächerlich und ordnungswidrig streng verurteilt hätte.
In der Menge verloren, von niemand weiter beachtet, stand ein junges Mädchen, das nichts mit den derben, festen Gestalten gemein hatte, die sie rings umgaben. Es mochte vielleicht eben so alt sein wie Auguste, doch neben dieser kräftigen Dorfschönen würde sie noch jugendlicher ausgesehen haben. Das Gesicht war zart und vom lieblichsten Oval, die Figur kaum von Mittelgröße, aber dabei von schönstem Ebenmaß. Ihre Formen waren graziös, und wie sie ruhig dastand inmitten all der lachenden, lärmenden Gesichter, stach sie von ihrer Umgebung so seltsam ab, als gehörte sie nicht hierher.
Die Bauern mochten wohl auch dasselbe denken, denn sie beachteten die kleine Schloßgärtnerin nicht weiter. Warum sie überhaupt erst hier erschienen, würde man nicht begriffen haben, wenn man nicht gewußt hätte, daß ihr Bruder mit um die Fahne ritt. Freilich war er auch kein Bauer, und die Schwarzthaler sahen mit ziemlicher Geringschätzung auf den Federfuchser herab, doch der Schulze hatte sich nun seiner einmal angenommen, und so ließ man es gelten.
Mit welcher Ungeduld blickten Augustens Augen auf die Landstraße; endlich ließ sich das Getrapp von Pferden hören, und das aus etwa hundert Reitern bestehende kleine Geschwader sprengte in kurzem Galopp dem Festplatze zu.
An der Spitze desselben ritt der Schulzensohn, und jetzt war er doch nicht der stille, in sich gekehrte Mensch, der gern in seinem Garten hockte. Er saß fest und kerzengerade im Sattel, seine treuherzigen, ehrlichen Augen leuchteten, als er jetzt mit lauter, weithin schallender Stimme seine Kommandos erteilte. Seine militärische Haltung verriet, daß er ebenfalls gedient haben mußte, und die alte Soldatenerinnerung schien ihn jetzt zu überkommen, denn er war wie verwandelt, und Helene konnte kein Auge von ihm wegwenden. Wenn sie ihn noch nicht geliebt hätte, heute, wo er so stattlich zu Pferde saß und wie ein General so sicher seine Befehle erteilte, würde sie an ihn ihr Herz verloren haben. Aber sie liebte ihn bereits, so tief und unergründlich, wie es eben nur eine junge Brust vermag, in die zum erstenmal dies berauschende Gefühl seinen Einzug hält.
Die jungen Reiter rückten jetzt heran und hielten ihren Parademarsch um den Platz. Voran ritt die Musik, den Düppelmarsch blasend, bei dessen Klängen eine allgemeine Begeisterung die Menge erfaßte. Dann folgte der Schulzensohn, er hatte einen Strauß an der Brust, den ihm gestern Helene selbst gepflückt, und führte seine Reitpeitsche, eine Weidenrute, mit kriegerischem Anstand wie einen Degen. Hinter ihm ritten seine Adjutanten, Bernhard und Fritz. Der letztere hatte zwar gegen die Erhebung Bernhards zu dieser Ehre den lebhaftesten Einspruch erhoben, aber der sonst so fügsame Wilhelm war unerschütterlich und beharrte bei seiner Anordnung. Knirschend vor Wut mußte sich Fritz in das Unvermeidliche fügen und Seite an Seite mit dem verhaßten Tintenkleckser reiten. Sein zukünftiger Schwager hatte ihm damit einen bösen Streich gespielt, den er ihm nicht so leicht vergessen wollte. Wenn Fritz auch wußte, daß Wilhelm mit dem Schloßgärtner, dem Vater Bernhards, befreundet war, so hätte er doch nimmer geglaubt, daß der Schulzensohn in seiner Verblendung so weit gehen und gerade den Bernhard zu seinem Adjutanten wählen würde. Jeder andere wäre ihm als Kamerad recht gewesen, nur nicht dieser verhaßte Schreiber, und Fritz, der sich auf das Fest so sehr gefreut und immer durch seine unverwüstliche Heiterkeit allen voranleuchtete, saß heut' mit gerunzelter Stirn auf dem Pferde, und man konnte dem Burschen deutlich ansehen, wie lästig ihm seine Nachbarschaft war.
Obwohl sich Helene ganz bescheiden im Hintergrunde hielt, hatte sie doch der Zugführer im Vorüberreiten erkannt. Zu aller Verwunderung salutierte er vor ihr ehrfurchtsvoll mit seiner Reitgerte, und das junge Mädchen errötete bis in die Schläfen. Ihr Herz schlug hörbar. Wenn sie auch glücklich war über die Auszeichnung, fühlte sie doch eine Beklemmung, daß Wilhelm durch diesen Gruß aller Welt verraten, wie es mit ihnen stand.
Bernhard grüßte ebenso achtungsvoll, wenn auch mit einem komischen Anflug, seine Schwester, während über Fritzens hübsches Gesicht ein spöttisches Lächeln flog. Er wußte plötzlich, warum Wilhelm den Federfuchser zu seinem Adjutanten ernannt hatte und ihm auch sonst dem Vater gegenüber so die Stange hielt. Sein Freund hatte sich in das kleine, gebrechliche Dings, die Lene Winkler, vergafft!
Nun war ihm alles klar! »Er ist ein Narr«, dachte er im Weiterreiten, »und der alte Schulze wird da auch noch ein Wort mit drein zu reden haben.« Sein Gesicht hellte sich auf, denn dicht an der Fahnenstange hielt der Wagen Fellenbergs – Auguste stand jetzt hoch aufgerichtet da und hatte nur Augen für ihn.
Während Wilhelm ganz respektvoll vor seiner Schwester salutierte, konnte Fritz nicht umhin, er stieß einen lauten Jauchzer aus und schwang seine Reitgerte hoch in die Luft. Bernhard begrüßte die Schulzentochter ebenfalls ganz ehrfurchtsvoll, aber diese hatte nicht einen Blick für ihn.
Selbst der alte Schulze, der sonst an seinem Sohne manches auszusetzen hatte, war heute mit ihm zufrieden und lächelte ihm wohlgefällig zu. Auf seinem breiten, ernsten Gesicht prägte sich deutlich die Freude aus, die er empfand. Er mochte an die Zeit denken, wo er als junger Bursche ebenfalls einen solchen Zug geführt und sich wohl noch etwas stattlicher ausgenommen hatte, als jetzt sein Sohn, denn er überragte ihn beinahe um einen halben Kopf. Auch seinem jungen Vetter, der ihn so überaus achtungsvoll grüßte, nickte er wohlwollend, freundlich zu.
Auf Wilhelms Kommandoruf setzte sich der Zug von neuem in Bewegung und nahm dann in einer einzigen Linie seine Aufstellung. Ein weites, von Gräben durchschnittenes Terrain war zu durchreiten, und auf ein mit der Trompete gegebenes Zeichen begann das Wettrennen. Mit verhängten Zügeln suchte jeder dem Ziele zuzujagen, und in atemloser Spannung starrten die Versammelten auf den dunklen Knäuel, der sich aus weiter Entfernung heranwälzte und aus dem bald einzelne Reiter, denen es gelungen war, die anderen schon zu überholen, hervorragten. Zuletzt waren es nur noch drei, die sich den Sieg streitig machten, Bernhard, Wilhelm und Fritz. Der letztere ritt sein eigenes Pferd, die ersteren die des Schulzen. Wilhelm hatte anfangs vor den beiden anderen einen kleinen Vorsprung; da sah er die furchtbare Anstrengung auf dem Antlitz Bernhards, der um jeden Preis den Sieg erringen wollte, wie er sich gegen seine Schwester gerühmt. Auch ihm hatte er noch gestern gesagt: »Mein Lebensglück hängt davon ab, ich muß siegen«, und ein Mitleid erfaßte ihn mit dem armen Burschen. Er wußte, warum Bernhard so verzweifelt um die Fahne ritt, und wenn er sich auch sagte, daß seine Hoffnung vergeblich sei, wollte er ihm wenigstens diesen Triumph gönnen.
»Bernhard, vorwärts!« rief er ihm zu und dämpfte ein wenig den raschen Lauf seines Rosses.
Bernhard ließ sich den Mahnruf, den er noch dazu für Spott nahm, nicht zweimal sagen; er jagte um so toller darauf los, aber Fritz war dicht an seiner Seite; er hatte das ermunternde Wort Wilhelms auch gehört und rief höhnend: »Ja, vorwärts, Tintenkleckser!« dabei versetzte er dem Pferde Bernhards einen tüchtigen Hieb mit einer Weidenrute, so daß es, von dem unerwarteten Schlage erschreckt, hoch aufbäumte und seinen Reiter zu Boden warf. Während Wilhelm sofort auf den Verunglückten zuritt und sich um ihn bemühte, sprengte Fritz übermütig lachend davon und erreichte so zuerst das Ziel.
Mit lautem Jubelruf wurde der Bursche empfangen.
Wohl hatte man einen Reiter fallen sehen, aber niemand fragte in diesem Augenblick danach. Der Sieger allein nahm die Aufmerksamkeit aller in Anspruch.
Anstatt, wie herkömmlich, sogleich aus der Hand des Schulzen die Fahne zu empfangen, ritt Fritz zuerst auf Auguste zu, die jetzt hoch aufgerichtet auf dem Wagen stand, salutierte ehrfurchtsvoll und neigte dann den Kopf, den die Geliebte mit dem Kranz schmückte.
So hatten sie es gestern verabredet, und so war es auch gekommen, und wie strahlten die Augen des jungen Mädchens. Wenn sich auch Fritz noch so sicher gefühlt, sie hatte doch an seinem Sieg gezweifelt, und nun war sie so stolz und glücklich, wie sie es in ihrem Leben bis jetzt nie gewesen. Daß er über alle den Preis davongetragen, machte ihn ihrem jugendlichen Herzen noch weit teurer. Jetzt mußten doch alle zugestehen, daß ihr Fritz ein Prachtbursche sei, der es mit jedem aufnehmen könne.
Der Schulze hatte inzwischen die Stange, woran der Preis des Rennens flatterte, mit starkem Arm aus der Erde gerissen und schwang sie, wie zum Gruß, in der Luft. Wohl hätte er es lieber gesehen, wenn Wilhelm Sieger geworden wäre, aber auch Fritz war ihm als solcher willkommen, und damit die Leute nicht etwa glauben sollten, daß er über den Mißerfolg seines Sohnes empfindlich sei, begrüßte er den jungen Vetter, der jetzt an ihn heranritt und rasch vom Pferde sprang, desto herzlicher. Er hielt eine kräftige, echt patriotische Anrede an den jungen Burschen, rühmte seine Tüchtigkeit, und was er bei dieser Festlichkeit noch nie gethan, umarmte ihn vor aller Augen. Die guten Schwarzthaler gerieten in keine geringe Aufregung. Es ging heuer doch ganz absonderlich zu.
Fritz lehnte sich zärtlich an die Brust des Alten.
»Ich hab' Euch heut' noch viel zu sagen«, flüsterte er ihm zu. Über das Gesicht des Schulzen flog ein Lächeln: »Später, mein Sohn, da findet sich wohl ein Viertelstündchen«, und er klopfte dem jungen Manne auf die Schulter. Jetzt erst fand man Zeit, dem unglücklichen Vorfall seine Aufmerksamkeit zu schenken. Viele hatten den Sturz eines Reiters bemerkt, und nun eilte eine Menge Neugieriger darauf zu, um zu sehen, ob wirklich ein Unglück vorgekommen. Die übrigen Reiter hatten sich wenig um den Gestürzten gekümmert, sie waren achtlos vorübergesprengt, nur Wilhelm war sogleich vom Pferde gesprungen und suchte Bernhard aufzurichten, der sich nicht allein zu erheben vermochte und bald über sein zerbrochenes Bein jammerte, bald über Fritz die fürchterlichsten Verwünschungen ausstieß.
Mühselig wollte er sich am Arme Wilhelms in die Höhe richten, da aber dieser ihm nur die eine Hand reichen, mit der anderen noch das Pferd halten mußte, so brach er wieder zusammen.
»Mein Bein ist weg, ich weiß schon, ich werde lahm bleiben«, murmelte Bernhard ingrimmig, »aber das soll mir der Nichtswürdige büßen. – Ein Mann, ein Wort! wie der Schulze sagt«! – und er verschwor sich hoch und teuer.
Endlich kamen die zunächst stehenden Zuschauer zu Hilfe. Anfangs gab es Spottreden, erst als man sah, daß Bernhard einen ernstlichen Schaden genommen hatte, zeigte man eine größere Teilnahme und fragte natürlich vor allen Dingen nach der Ursache.
»Fritz hat heimtückisch meinem Pferde einen Hieb versetzt, daß es erschrocken aufbäumte und mich abwarf«, erklärte Bernhard sogleich, dessen Eitelkeit nicht duldete, daß man seinen Unfall etwa seinem Ungeschick zuschrieb. Und als er die ungläubigen Gesichter der Umstehenden sah, rief er trotz seiner Schmerzen mit großer Lebhaftigkeit: »Ist's nicht so, Wilhelm? Du bist mein Zeuge.«
Dieser bestätigte sofort die Angaben des jungen Winkler und setzte in seiner ehrlichen, geraden Weise hinzu: »Es war von Fritz wirklich ein heimtückischer Streich.«
Bernhards blasses, eben noch wutverzerrtes Gesicht hellte sich auf. »Das ist brav von dir, Wilhelm, das vergeßt ich dir sobald nicht«, sagte er mit einer Empfindung, die an dem jungen Manne völlig fremd war, der gegen alle Welt gern eine große Verbitterung zur Schau trug. Er wußte, wie sonst die reichen Söhne Schwarzthals einander beistanden, sobald es galt, jemand zu unterdrücken, den sie in ihrem Dünkel nicht für voll ansahen, und deshalb hatte für ihn die redliche Parteinahme Wilhelms besonderen Wert. Er hätte ja nur sagen dürfen, daß er nichts gesehen, und man würde ihm gern geglaubt haben.
Helene hatte von dem Unglücksfalle nichts bemerkt, denn ihre Augen waren nur auf die Fahnenstange gerichtet. Wohl hatte sie nicht gehofft, daß Wilhelm den Preis erringen würde – aber hübsch hätte sie es doch gefunden. Nun gewann ihn der junge Uhse – der einzige, gegen den sie einen geheimen Widerwillen hatte, sie wußte selbst nicht warum.
Wo blieb der Geliebte? Es hieß, ein Reiter sei gestürzt, und hastig drängte sie zur Unglücksstätte. Gott sei Dank, es war nicht Wilhelm, es war ihr Bruder. – Sie fühlte zwar das Sündhafte dieses Gedankens, er war jedoch so unwillkürlich in ihr aufgetaucht – mit jener Selbstsucht der Liebe, die jedes Unheil ertragen will, wenn nur das eine teure Haupt verschont bleibt.
Einem der herbeikommenden Burschen warf Wilhelm den Zügel seines Pferdes zu, und nun hatte er völlig freie Hand, um den Verunglückten aufzurichten. Vielleicht hätte Bernhard, auf die starke Schulter des Freundes gestützt, sich weiter helfen können, aber er mochte wohl gern sich noch schwächer zeigen, als er wirklich war, um eine desto größere Aufmerksamkeit zu erregen, und deshalb mußte Wilhelm ihn ganz auf seine Arme nehmen und ein Stück weiter tragen. Es war keine allzu schwere Aufgabe, denn Bernhard war ebenso zierlich gebaut wie seine Schwester, wenn auch etwas größer.
Jetzt kam Helene herbei; sie vermochte in ihrer Angst kein Wort hervorzubringen, und Wilhelm rief ihr schon von weitem beschwichtigend zu: »Es ist nichts, liebe Helene, dein Bruder hat sich nur beim Fallen den Fuß verrenkt.«
»Gebrochen!« schrie sogleich Bernhard dazwischen; »Helene, rufe den Wundarzt herbei, denn diese Bauern rühren für mich weder Hand noch Fuß.«
Ehe die Schwester seiner Aufforderung Folge leisten konnte, erschien der alte Dorfarzt schon selber, den die Kunde, daß ein Reiter vom Pferde gestürzt sei, sogleich herbeigelockt hatte.
»Legen Sie den jungen Mann nur hier auf die Wiese hin, wir wollen gleich nachsehen«, befahl der Alte, und mit emsiger Geschäftigkeit untersuchte er den Zustand des Verunglückten, während die Zuschauermenge immer größer wurde, die auch diese Zugabe zum Feste genießen wollte.
Bernhard ließ standhaft alles mit sich geschehen. Mochte auch der alte Dorfarzt noch so unsanft mit seinem Beine verfahren, sein blasses Gesicht entfärbte sich noch etwas mehr, er biß die Zähne zusammen, und ein schärferer Beobachter hätte wohl bemerkt, daß der junge Mensch nicht gewohnt war, Schmerzen zu ertragen, und daß er nur aus Eitelkeit so standhaft aushielt. Er mochte den Bauern doch nicht das Schauspiel gönnen, daß er laut aufjammerte, und wenn der Alte mit seinem Hin- und Herfühlen etwas nachließ, dann öffnete Bernhard sogleich die blassen Lippen zu schweren Anklagen und Verwünschungen gegen Fritz Uhse, unbekümmert um das unwillige Gemurmel, das sich um ihn erhob. Die ihn umringenden Bauern nahmen unstreitig für ihren Genossen Partei.
»Das Bein ist wirklich gebrochen«, erklärte endlich der Dorfarzt und nahm dabei eine sehr wichtige Miene an.
»Sagte ich es nicht?« rief Bernhard beinahe triumphierend. Über diese Genugthuung, daß er sogleich das Rechte getroffen und ihm wirklich von diesem Menschen etwas recht Schlimmes widerfahren sei, vergaß er fast, daß dieser Ausspruch ihn zum Krüppel machte.
»Ist es wirklich wahr?« fragte Helene entsetzt und drängte sich näher herbei. Sie hatte während der Untersuchung des Wundarztes sich scheu und ängstlich etwas beiseite gehalten und nur leise mit Wilhelm einige Worte geflüstert, der ihr den Vorfall berichten mußte.
»Gar kein Zweifel, liebes Kind«, erklärte der Heilkünstler mit großer Entschiedenheit. »Ein höchst unglücklicher Fall! Na, ängstigen Sie sich weiter nicht, Gefahr ist nicht dabei. Ein bißchen Hinken wird Ihr Bruder freilich nicht mehr los werden.«
Bei diesem Wort erkannte erst der junge Mensch seine Lage. Der Triumph über seine sichere Voraussage und sein Unglück schwand, nun überkam ihn ein wahres Entsetzen, wenn er daran dachte, daß er ewig im Dorfe zum Gespött der Bauern herumhinken würde, und er bedeckte das Gesicht mit beiden Händen, um die Thränen zu verbergen, die er nicht länger zurückhalten konnte. Während dort auf der großen Wiese bereits die Vorbereitungen zum Tanz getroffen wurden und Musik und lustige Jauchzer weithin erschallten, trug man hier den Jammernden nach Hause.
