
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
§1
Fragestellung
Der Genuss von fünf Mitteln, entdeckt seit ungefähr zwei Jahrhunderten und zur gleichen Zeit in die Ökonomie des menschlichen Lebens eingeführt, hat erst seit einigen Jahren eine so ausserordentliche Entwicklung genommen, dass die menschlichen Gesellschaftsformen in einer ganz ausserordentlichen Weise dadurch beeinflusst werden. Diese fünf Reizmittel sind:
Erstens, der Branntwein oder der Alkohol, die Grundform aller Schnäpse, deren Erscheinung in unserem Dasein aus den letzten Jahren der Herrschaft Ludwigs XIV. stammt, und der erfunden wurde, um die erstarrte Frostigkeit seines Alters wieder ein wenig aufzuwärmen.
Zweitens, der Zucker. Dieses Genussmittel hat erst in der allerletzten Zeit die Volksernährung beeinflusst, als die französische Industrie imstande war, ihn in grossen Quantitäten zu fabrizieren und zum alten Preise in den Handel zu bringen, zu einem Preise, der sicher noch sinken wird, trotz dem Fiskus, der nur darauf lauert, ihn zu besteuern.
Drittens, der Tee, gekannt seit ungefähr fünfzig Jahren.
Viertens, der Kaffee. Trotzdem der schon von den Arabern in alten Zeiten entdeckt war, hat Europa von diesem Reizmittel erst in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts erheblichen Gebrauch gemacht.
Fünftens, der Tabak, dessen Genuss durch das Rauchen allgemein und ein Missbrauch geworden ist, seit der Friede in Frankreich eingekehrt ist.
Wir wollen zuerst das ganze Problem untersuchen und einen möglichst hohen Standpunkt dabei einnehmen.
Eine bestimmte Summe menschlicher Kraft wird zur Befriedigung eines Bedürfnisses verbraucht. Es ergibt sich daraus jene Empfindung, die je nach den Temperamenten und klimatischen Verhältnissen wechselt, und die wir Lust nennen. Unsere Organe sind die Diener unserer Lüste. Fast alle haben eine doppelte Bestimmung: sie nehmen gewisse Substanzen auf, verleiben sie unserem Körper ein, erstatten sie dann ganz oder teilweise unter irgendeiner Form dem Ganzen wieder, das die Erde sein kann oder die Atmosphäre, dieses Arsenal, in das jede menschliche Kreatur die regenerativen Kräfte zurückströmen lässt. Diese paar Worte fassen in sich die Chemie des menschlichen Lebens.
Die Gelehrten werden wahrscheinlich auf diese Formel nicht anbeissen. Allein sie werden nicht einen einzigen unserer Sinne finden (und mit dem Worte »Sinn« muss man hier den ganzen Apparat eines Sinnes begreifen), der nicht diesem Grundgesetz gehorchen würde, wie auch immer die weitere Entwicklung dann vor sich geht. Jeder Exzess basiert auf einer Lust, die ein Mensch wiederholen will, wohl gemerkt, über die Grenze der gemeinen, von der Natur gegebenen Gesetze hinaus. Je weniger die menschliche Kraft in Anspruch genommen ist, desto mehr neigt sie zu Exzessen. Die Vorstellung allein genügt, um ihn unwiderstehlich zu ihnen zu treiben.
I
Für das soziale Individuum heisst leben: sich mehr oder weniger rasch ausgeben.
Es folgt: je mehr die Gesellschaft zivilisiert und in Ruhe ist, desto mehr bewegt sie sich auch auf dem Wege zu Exzessen. Das sogenannte Gleichgewicht ist für gewisse Individuen ein erbärmlicher Zustand. Vielleicht ist es das, was Napoleon mit den Worten gemeint hat: »Der Krieg ist eine ganz natürliche Lebensform.«
Um nun irgendein Nahrungs- oder Genussmittel zu absorbieren, resorbieren, zu zergliedern, zu assimilieren, wieder auszuscheiden oder neu gruppieren zu können –, alles das sind Operationen, die ohne Ausnahme den ganzen Mechanismus der Lust darstellen, – lässt der Mensch seine ganze Kraft oder einen Teil seiner Kraft durch jene Organe wirken, die eben die Diener der Lust sind, an der ihm liegt.
Die Natur will, dass alle Organe in gleichem Masse am Leben teilnehmen. Die Gesellschaft aber entwickelt im Menschen eine Art Hunger oder Durst für dieses oder jenes Vergnügen, und dadurch wird in diesem oder jenem Organe mehr Kraft angesammelt, als ihm eigentlich bestimmt ist, manchmal sogar die ganze Kraft des Körpers. So werden dann wiederum andere Organe in gleicher Weise von den äquivalenten Quantiäten beraubt werden, gleichsam verlassen von den Zuschüssen, die den Genussorganen des Körpers zufliessen. Die Folgen sind Krankheiten, schliesslich ein vorzeitiges Lebensende.
Diese Theorie ist von erschütternder Konsequenz wie alle jene Theorien, die auf Realitäten beruhen und nicht a priori bestimmte Sätze sind. Wenn das Gehirn durch konstante intellektuelle Arbeit mit Lebenskraft reichlich versorgt wird, breitet sich dort die Energie aus, weiten sich gleichsam die feinsten Membranen, bereichert sich die Gehirnsubstanz. Aber zugleich hat sie das Entre-sol, den Rumpf, verlassen, und der Mensch von Genie fällt jener Krankheit anheim, die die Ärzte gerechterweise Frigidität genannt haben. Andererseits, wenn Sie Ihr Leben zu Füssen von Diwans verbringen, auf denen charmante Frauen liegen, sind Sie immerzu verliebt, so werden Sie zum Schluss nichts anderes sein als ein Mönch, wenn Sie auch die Kutte nicht tragen.
Die Intelligenz vermag in den hohen Sphären der Empfängnis nicht zu funktionieren. Die wirkliche Kraft hat ihren Platz irgendwo zwischen diesen zwei Exzessen. Wenn man mit frecher Stirne sowohl das intellektuelle wie das verliebte Leben führt, so stirbt der Mensch von Genie, wie Raffael und Lord Byron eben gestorben sind. Keusch stirbt man durch das Übermass an Arbeit, ebenso wie man sonst durch die Ausschweifung zugrunde geht. Aber diese Todesart ist ausserordentlich selten. Der Missbrauch von Tabak, der Missbrauch von Kaffee, der Missbrauch von Opium oder Branntwein, sie alle erzeugen schwere Unordnungen im menschlichen Organismus und führen zu einem frühen Tode. Das Organ, das man in einem fort von neuem reizt, in einem fort von neuem ernährt, fällt der Hypertrophie anheim, es bekommt einen abnormalen Umfang, wird krank, beschädigt die ganze Maschinerie, die dann zugrunde geht.
So ist zwar jeder natürlich Herr über sich selbst; das ist unsere moderne Lehre. Aber wenn Leute aus den höheren Ständen oder auch Proletarier diese Zeilen lesen und dann der Meinung sind, dass sie ja niemand anderem etwas Böses zufügen als sich selbst, wenn sie Tabak rauchen wie Schornsteine oder trinken wie Alexander, so täuschen sie sich auf die befremdlichste Weise. Sie verderben die Rasse, sie erzeugen eine Generation von Bastarden, und die letzte Wirkung ist der Untergang der Nation. Und eine Generation hat nicht das Recht, die nächste zu schädigen.
II
Ernährung und Erzeugung ist Eines.
Man sollte dieses Axiom in goldenen Lettern an die Wände aller Speisesäle schreiben. Es ist merkwürdig, dass Brillat-Savarin, der doch von der Wissenschaft gefordert hat, dass sie die Terminologie der Sinne um den sens génésique erweitern soll, vergessen hat, dieses Verhältnis zu erkennen und anzumerken, das zwischen den Erzeugnissen des Menschen besteht und jenen Genussmitteln, die die Bedingungen seiner Vitalität verändern können. Ich hätte wahrhaftig sehr viel Freude gehabt, wenn ich in seinen Werken den folgenden Satz gelesen hätte:
III
Die Fischzucht erzeugt Töchter, die Schlächterei erzeugt die Söhne, der Bäcker aber ist der Vater des Gedankens.
Die Schicksale eines Volkes hängen von seiner Nahrung und seiner Diät ab. Die Kornfrüchte haben die künstlerisch veranlagten Völker geschaffen. Der Branntwein hat die indischen Rassen getötet. Ich nenne in aller Bestimmtheit Russland eine Autokratie, aufrecht erhalten durch den Alkohol. Wer will sagen, ob nicht der Missbrauch der Schokolade seine Bedeutung in dem Niedergang der spanischen Nation gehabt hat, die im Augenblick, wo die Schokolade erfunden wurde, gerade im Begriffe war, das römische Reich zu erneuern. Der Tabak hat den Türken schon jetzt sein gerechtes Teil gegeben, ebenso den Holländern, er bedroht Deutschland, aber kein einziger unter unseren Staatsmännern, die in der Regel mehr mit sich beschäftigt sind als mit den öffentlichen Angelegenheiten, – es sei denn, etwas betrifft ihre Eitelkeit, ihre Maitressen oder ihre Privatvermögen, – denkt auch nur daran, wohin Frankreich steuert durch den Missbrauch des Tabaks, den Genuss des Zuckers, der Kartoffel statt des Getreides, des Branntweins usw.

Daumier
Man untersuche nur einmal, wie verschieden die Gesichtsfarbe, die Körperbildung der grossen Männer heutzutage und der grossen Männer vergangener Jahrhunderte ist; man nehme als Exempel gerade jene, die die bestimmenden Qualitäten ihrer Epoche in sich vereinigten. Wieviel Talente jeder Art sehen wir heute zugrunde gehen, ermüdet und ermattet nach einem ersten Werke, in dem schon ein Keim von Krankheit liegt! Unsere Väter sind schuld an dem schwächlichen Willen der heutigen Zeit.
Was ich nun hier mitteilen will, ist das Resultat von Erfahrungen, die in London gemacht worden sind. Die Zuverlässigkeit meiner Mitteilungen ist mir bezeugt und bekräftigt worden von zwei Männern, die Glauben verdienen, einem Gelehrten und einem Politiker, und sie gehen auf den Kern der Fragen, über die wir uns unterhalten sollen.
Die englische Regierung hatte das Leben von drei Menschen, die zum Tode verurteilt worden waren, für vogelfrei erklärt; und da hat man ihnen die Wahl gestellt, entweder nach der gewöhnlichen Art des Landes gehenkt zu werden, oder – zu leben; allein der eine ausschliesslich von Tee, der andere ausschliesslich von Kaffee, ein dritter ausschliesslich von Schokolade, es sollte ihnen aber nicht gestattet sein, irgendein anderes Nahrungsmittel irgendeiner Art zu sich zu nehmen, irgendeine andere Flüssigkeit zu trinken. Die sonderbaren Herrschaften haben diesen Vorschlag angenommen; vielleicht hätte übrigens jeder zum Tode Verurteilte so gehandelt wie sie. Und da jedes der »Genussmittel«, das man ihnen anbot, seine Chancen hatte, so haben sie schliesslich um ihr Los gewürfelt.
Der Mann, der von Schokolade gelebt hat, ist nach acht Monaten gestorben.
Der Mann, der von Kaffee gelebt hat, hat zwei Jahre ausgehalten.
Der Mann, der von Tee gelebt hat, ist erst nach drei Jahren zugrunde gegangen.
(Ich habe den leisen Verdacht; dass die Indische Kompagnie dieses Experiment im Interesse ihres Handels herbeizuführen gewusst hat.)
Der Schokoladenmensch ist an einem entsetzlichen Zustand von Fäulnis zugrunde gegangen, von den Würmern förmlich zerfressen. Seine Glieder sind, das eine nach dem andern, abgefallen, so wie die einzelnen Teile der spanischen Monarchie.
Der Kaffeemensch ist am Brand zugrunde gegangen, als ob ihn das Feuer von Gomorrha eingeäschert hatte. Man hätte ebensogut aus ihm Kalk brennen können. Man hat es ihm sogar vorgeschlagen. Aber dieses Experiment schien in einem gewissen Gegensatz zum Glauben an die Unsterblichkeit der Seele zu stehen.
Der Mann, der sich von Tee zu nähren hatte, wurde mager, gleichsam durchsichtig, er starb an Schwindsucht, sah schliesslich aus wie eine Laterne. Man konnte ganz klar durch seinen Körper hindurchsehen. Ein Menschenfreund konnte sogar die »Times« lesen, wenn man hinter seinen Körper ein Licht stellte. Der Sinn für Decenz, der in England bekanntlich zu Hause ist, hat ein noch originelleres Experiment nicht gestattet.
Ich, für meinen Teil, kann mich nicht zurückhalten zu bemerken, wie menschenfreundlich es ist, einen zum Tode Verurteilten noch nutzbar zu machen, statt ihn brutal der Guillotine hinzuwerfen. Man ist bereits soweit, das Fett, das in den Seciersälen übrig bleibt, zur Bereitung von Kerzen zu verwenden; auf einem so schönen Wege dürfen wir wirklich nicht haltmachen! Man liefere also die Verurteilten den Gelehrten aus statt dem Henker.
Ein anderes Experiment ist in Frankreich, was den Zucker anbelangt, gemacht worden.
Herr Magendie hat Hunde ausschliesslich mit Zucker genährt. Die schrecklichen Resultate seines Experimentes sind veröffentlicht worden, ebenso wie die Todesart dieser interessanten Freunde des Menschen, dessen Laster sie teilen (die Hunde sind ebenso verspielt wie die Menschen). Aber diese Resultate beweisen für uns noch nichts.
§2
Vom Branntwein
An der Traube sind zuerst die Gesetze der Gärung enthüllt worden, ein neuer Vorgang, der zwischen den einzelnen Elementen vor sich geht unter atmosphärischen Einflüssen, so dass eine Verbindung entsteht, die den durch die Destillation erhaltenen Alkohol enthält und seitdem von der Chemie bei vielen botanischen Produkten entdeckt worden ist. Der Wein, das unmittelbarste Produkt dieser Art, ist das älteste Reizmittel. Da man jedem Herrn seine Ehre erweisen muss, soll er auch an erster Stelle gewürdigt werden. Sein Geist ist übrigens unter allen heute derjenige, der die meisten zugrunde richtet. Man hat eine fürchterliche Angst vor der Cholera, aber der Branntwein ist eine viel entsetzlichere Geissel der Menschheit.
Wo ist der Spaziergänger, der nicht irgendwo in der Umgebung der grossen Markthallen in Paris jene Ställe für menschliche Wesen entdeckt hat, die zwischen zwei und fünf Uhr in der Früh' die männlichen und weiblichen Stammgäste der Destillateure aufnehmen, deren elende Boutiquen keinen Vergleich aushalten können mit den Palästen, die man in London erbaut hat für die Kunden, die dort auch nur zu dem Zweck hinkommen, um sich zugrunde zu richten. Die Resultate aber sind die gleichen. Ställe, das ist das Wort, das wir brauchen. Die Lumpen und die Gesichter passen so gut zueinander, dass man wirklich nicht weiss, wo der Fetzen aufhört und wo das Fleisch anfängt, wo die Mütze ist und wo die Nase anfängt. Das Gesicht ist oft schmutziger als der Streifen Wäsche, den man entdeckt, wenn man genau diese von dem Branntwein gebrandmarkten, ausgemergelten, blass- oder blaugefärbten, gekrümmten Gestalten sich ansieht. Wir verdanken diesen Menschen die scheussliche Brut, die entweder gleich zugrunde geht oder den entsetzlichen »Gamin« von Paris erzeugt. Aus diesen Boutiquen kommen jene schwächlichen Wesen, die die Arbeiterbevölkerung bilden. Die Überzahl der Huren von Paris werden dezimiert durch den Missbrauch starker Schnäpse.
Da ich ein Beobachter bin, so wäre es meiner unwürdig, die Wirkungen der Trunkenheit zu ignorieren. Ich hatte die Genüsse zu studieren, die das Volk dahin locken und die selbst Menschen – sprechen wir es nur aus wie Byron, Sheridan e tutti quanti – dazu verführt haben. Es war für mich eine heikle Sache. Wenn man ans Wassertrinken gewöhnt ist, vielleicht zu dieser Gewohnheit durch die lange Gewöhnung an den Kaffee gebracht, und das ist bei mir der Fall, hat der Wein nicht mehr die geringste Macht über einen, mag auch die Quantität, die der Magen erlaubt, noch so gross sein. Ich bin ein kostspieliger Gast. Diese Tatsache, die einer meiner Freunde kannte, gab ihm den Einfall, meine Jungfräulichkeit – in dieser Angelegenheit – zu besiegen. Ich hatte niemals geraucht, und der Sieg, den er in der Zukunft sah, hatte seinen Grund in dieser Voraussetzung, dass ich diis ignotis zu opfern haben würde.
Eines Tages also, als gerade die italienischen Sänger spielten, im Jahre 1822, lockte mich mein Freund in der Hoffnung, mich die Musik des Rossini, La Cinti, Levasseur, Bordogni, La Pasta vergessen zu machen, auf einen Diwan, mit dem er, seitdem das Dessert serviert war, kokettiert hatte, und auf den er sich schliesslich hinwarf. Siebzehn leere Flaschen waren die Zeugen seiner Niederlage. Da ich aber gezwungen war, zwei Zigarren zu rauchen, übte der Tabak seine Wirkung aus, von der ich allerdings erst etwas spürte, als ich die Treppen hinunterging. Ich fand, dass die Stufen aus einer ganz weichen Substanz hergestellt seien. Aber immerhin, ich bestieg siegreich den Wagen, einigermassen vernünftig, aufrecht, nur wenig gelaunt zum Schwätzen. Dort, da ich der Meinung war, dass ich mich in einem Brennofen befinde, liess ich eine Fensterscheibe herab, die Luft tat noch das ihrige, um mich von Sinnen zu bringen; »taper« nennt's der Trinkerjargon. Ich fand, dass die Natur sehr, sehr weit sich dehne. Die Stufen im Theater der »Bouffons« erschienen mir noch weicher als die früheren, aber ohne dass irgendein Unglück geschah, setzte ich mich auf meinen Platz auf dem Balkon. Ich hätte damals allerdings nicht gewagt, zu versichern, dass ich in Paris sei, in der Mitte einer glänzenden Gesellschaft, deren Toiletten und einzelne Gestalten ich kaum zu unterscheiden wusste. Meine Seele war berauscht. Was ich von der Ouvertüre La Gazza hörte, war ganz so wie die vagen Töne, die vom Himmel in das Ohr einer Frau, die gerade in Extase ist, sich senken. Die musikalischen Phrasen kamen zu mir durch glänzende Wolken, alles fehlte ihnen, was die Menschen von Unzulänglichem in ihre Werke bringen, dafür waren sie erfüllt von jenem Gefühl des Künstlers, das etwas Göttliches ist. Das Orchester erschien mir wie ein weiches Instrument, aus dem nur die Wirkung irgendeiner Tätigkeit hervorkam, von der ich weder die Bewegung noch den Mechanismus erkennen konnte. Ich sah ja nur konfus die Bassgeigen, die goldglänzenden Röhren der Posaunen, die Klarinetten, die Lichter, aber keine Menschen. Nur ein oder zwei gepuderte, unbewegliche Köpfe, zwei aufgedunsene grimassierende Figuren, die mich beunruhigten, bemerkte ich. Halb schlummerte ich.
»Der Herr riecht nach Wein,« sagt leise eine Dame, deren Hut gelegentlich mich streifte und die wiederum, ohne dass ich es eigentlich wusste, meine Wange streifte.
Ich gestehe, dass ich etwas gekränkt war.
»Nein, gnädige Frau,« erwiderte ich, »ich rieche nach Musik.«
Ich ging fort, hielt mich ganz ausserordentlich gerade, aber ruhig und kalt wie ein Mann, der nicht die entsprechende Anerkennung gefunden hat, sich nun zurückzieht und seinen Kritikern die Furcht einflösst, irgendein höheres Wesen verletzt zu haben. Um der gewissen Dame zu beweisen, dass ich gar nicht fähig sei, übermässig zu trinken, und dass mein Geruch irgendein meinen sonstigen Sitten ganz fremder Zufall sei, überlegte ich den Plan, mich in die Loge der Herzogin von . . . (bewahren wir das Geheimnis!) zu begeben, deren schöner Kopf so merkwürdig eingerahmt war von Federn, Spitzen, dass ich den unwiderstehlichen Drang empfand, mich zu überzeugen, ob diese wunderbare Coiffüre Wirklichkeit sei oder ein Produkt jener spezifischen optischen Phantasie, die mir für einige Stunden nun geschenkt war.
Ich dachte, wenn ich einmal dort sitzen würde, zwischen dieser grossen, so eleganten Dame und ihrer zierlichen Freundin mit dem schelmischen Gesicht, dann werde kein Mensch den Verdacht haben können, dass ich unter dem Einfluss zweier Weine statt zweier Frauen stehe, jeder werde sich sagen: das ist irgendein sehr angesehener Mann, der dort zwischen zwei Frauen sitzt. Aber ich wankte noch in den unendlich langen Gängen der italienischen Oper herum, ohne die verdammte Türe dieser Loge gefunden zu haben, als die Menge, weil das Stück aus war, herausströmte und mich an eine Mauer drückte. Dieser Abend gehört sicherlich zu den poetischsten meines ganzen Lebens. Nie habe ich soviel Federn, soviel Spitzen, soviel hübsche Frauen gesehen, auch nie so viele jener ovalen, kleinen Fenstergläser, durch die Neugierige und Verliebte die Insassen einer Loge examinieren. Niemals vorher hatte ich soviel Energie wirken lassen, nie soviel Charakter gezeigt. Ich könnte sagen: Nie war ich so eigensinnig, hinderte mich nicht der angemessene Respekt vor mir selbst, eine solche Bemerkung zu machen. Die Hartnäckigkeit König Wilhelms von Holland in der belgischen Frage ist nichts im Vergleiche zu der Ausdauer, die ich darin zeigte, immer auf den Fussspitzen zu balancieren und ein angenehmes Lächeln auf den Zügen zu bewahren. Immerhin, es gab Augenblicke, wo ich zornig war, ja ich weinte sogar. Und diese Schwäche gibt mir den Vorrang vor dem König von Holland.

Dazu war ich noch von ganz entsetzlichen Vorstellungen gequält, weil ich immer an die gewisse Dame denken musste, und was die wiederum von mir denken würde, wenn ich mich nämlich nicht zwischen der Herzogin und ihrer Freundin zeigte; aber ich tröstete mich wieder, indem ich die Menschheit im allgemeinen, im ganzen gründlich verachtete. Trotz allem, ich hatte unrecht. An jenem Abend war wirklich gute Gesellschaft in den »Bouffons«. Jeder einzelne schenkte mir seine Aufmerksamkeit, jeder einzelne von ihnen wich mir zuvorkommend aus, um mich vorbeigehen zu lassen. Und schliesslich gab mir sogar eine wirklich sehr hübsche Dame den Arm, um mich hinauszuführen. Ich verdankte diese Höflichkeit der ausserordentlichen Hochachtung, die mir Rossini bezeugte, der mir ein paar sehr schmeichelhafte Worte sagte, an die ich mich allerdings nicht erinnern kann, aber die sicher ungeheuer geistreich waren; denn seine Konversation ist zum mindesten soviel wert wie seine Musik. Diese Dame war, wenn ich mich nicht irre, eine Herzogin; es mag aber auch sein, dass sie eine Logenöffnerin war. Mein Gedächtnis ist so konfus, dass ich jetzt sogar eher an die Logenöffnerin glaube als an die Herzogin. Das macht alles nichts; sie hatte Federn, sie hatte Spitzen. Immer wieder Federn, immer wieder Spitzen. Schliesslich, zum guten Ende, fand ich mich in meinem Wagen; da war aber wieder was ganz Ausserordentliches, dass nämlich mein Kutscher mir auf eine Weise ähnlich sah, dass ich ganz erschüttert war, und er war wiederum mutterseelenallein auf dem Kutschbock, auf dem Platze eingeschlafen. Es goss in Strömen, aber ich erinnere mich nicht, auch nur einen einzigen Regentropfen gespürt zu haben. Zum erstenmal in meinem Leben kostete ich eines der wundervollsten Vergnügen, die es gibt, eines der phantastischesten auf der Welt, eine unbeschreibliche Extase, jene Lüste, die man empfindet, wenn man Paris um halb zwölf Uhr abends durchsaust, mit unerhörter Schnelligkeit zwischen den Spiegelscheiben davongeführt wird, es erlebend, dass Myraden von Geschäften, von Lichtern, von Plakaten, von Gestalten und Gruppen, von Frauen unter Regenschirmen, von Ecken ganz phantastisch beleuchteter Strassen, von schwarzen Plätzen an mir vorbeieilten, – was alles ich beobachten konnte durch die Streifen des Schnürlregens hindurch; und das sind viele tausend Dinge, von denen man fälschlich glaubt, sie am hellen Tage jemals wirklich irgendwo bemerkt zu haben. Und überall gab es wiederum Federn, und überall gab es wiederum Spitzen, selbst in den kleinen Läden der Zuckerbäcker.
Seitdem verstehe ich die Lust, die die Trunkenheit gibt, sehr gut. Die Berauschtheit wirft einen Schleier über die Realität des Lebens, sie löscht das Bewusstsein aller Mühsal und aller Sorgen aus, sie erlaubt es endlich einmal, die schwere Last der Gedanken von sich abzuwerfen. Nun versteht man sogar, warum grosse Genies dieses Mittel oft angewendet haben, und warum das Volk sich ihm in die Arme wirft. Statt das Gehirn zu neuer Tätigkeit anzuregen, bewirkt die Kraft des Weines, es einzuschläfern. Statt die Wirkungen des Magens gegen die Verdauungskräfte aufzureizen, hat der Wein je nach der Kraft der Flasche, die man getrunken hat, die Macht, die Pupillen zu verdunkeln, alle Kanäle des Organismus gewissermassen zu verstopfen, der Geschmackssinn funktioniert nicht mehr, und es ist dem Trinker unmöglich, die Qualität der später noch aufgetragenen Flüssigkeiten zu unterscheiden. Der Alkohol ist einmal absorbiert und hat, zu einem gewissen Teil wenigstens, seinen Weg ins Blut angetreten. Man muss also folgendes Axiom tief in sein Bewusstsein einprägen.

Daumier
IV
Die Trunkenheit ist ein Zustand momentaner Vergiftung.
Die unvermeidliche Wirkung solcher Vergiftungen, wenn sie chronisch werden, bringt es aber auch dahin, dass das Blut des Alkoholikers sich verändert. Es bekommt einen anderen Rhythmus, indem die Grundgesetze dieser Bewegung entweder entfernt oder wenigstens ihrem Wesen nach verändert werden; so tritt eine grosse Verwirrung ein, dass tatsächlich die Mehrzahl aller Alkoholiker die Zeugungskräfte entweder ganz verliert, oder sie so verdorben wird, dass sie nur noch Menschen mit Wasserköpfen das Leben schenken können.
Man darf auch nicht übersehen, dass bei dem Trinker am nächsten Tage ein entsetzlicher Durst auftritt, manchmal sogar unmittelbar am Ende seiner Orgie. Dieser Durst ist ohne jeden Zweifel von dem Verbrauch des im Magen vorhandenen Zuckerstoffes erzeugt, oder auch dadurch, dass die einzelnen Elemente der Speicheldrüsen in ihren Zentren eben völlig beschäftigt sind; und diese physiologischen Wirkungen können uns dazu dienen, die Richtigkeit unserer Entschlüsse zu beweisen.
§3
Vom Kaffee
In diesem Stoff ist Brillat-Savarin wahrhaftig ein wenig unzuverlässig. Ich kann vielleicht seinen Mitteilungen über den Kaffee einiges hinzufügen, denn ich geniesse ihn und seine Wirkungen so ausgiebig, um Einiges davon zu wissen. Der Kaffee ist sozusagen ein Rost in unserem Innern. Viele Leute schreiben ihm die Eigenschaft zu, den Leuten zu Geist zu verhelfen. Aber alle Welt kann sich davon überzeugen, dass die langweiligeren Leute noch viel langweiliger werden, nachdem sie Kaffee getrunken haben. Und schliesslich – trotzdem die Kaffeehändler in Paris bis Mitternacht ihre Läden offen haben, es gibt Kollegen von der Literatur, die deshalb um nichts geistreicher sind.
Brillat-Savarin hat ausgezeichnet beobachtet, dass der Kaffee die Kraft hat, das Blut in Wallung zu bringen, indem er die bewegenden Geister sprühen lässt. Es kommt zu einem Zustande der Erregung, der die Verdauung beschleunigt, den Schlaf verjagt und gestattet, ein wenig länger seine zerebralen Fähigkeiten zu üben.
Ich möchte mir trotzdem erlauben, die Beobachtungen und Mitteilungen Brillat-Savarins durch persönliche Erlebnisse und die Beobachtungen einiger grosser Geister etwas zu modifizieren.
Der Kaffee wirkt auf das Diaphragma und den Plexus des Magens, von dort aus erreicht er das Gehirn durch Schwingungen, die wir nicht messen können, die bisher noch jeder Analyse unzugänglich waren. Man kann aber trotzdem annehmen, dass das Nervensystem unseres Organismus der Leiter dieser Elektrizität ist, die nun diese Substanz findet, frei macht oder sie in eine neue Bewegung umsetzt. Ihre Macht ist aber weder konstant noch absolut. Rossini hat an sich selbst dieselben Wirkungen beobachtet, die ich an mir fand.
»Der Kaffee«, hat er mir gesagt, »wirkt fünfzehn oder zwanzig Tage lang. Und das ist glücklicherweise die Zeit, um auf sehr anständige Weise eine Oper zu schreiben.« Die Tatsache stimmt. Aber die Zeit, in der man die Wohltaten des Kaffees geniessen kann, kann ausgedehnt werden. Und dass man das weiss, ist so sehr eine Angelegenheit grosser Wichtigkeit für viele Menschen, dass wir es uns nicht versagen können, die Art zu beschreiben, wie man diese köstliche Gabe auch am besten geniesst.
Ihr alle, Ihr berühmten Leuchten der Menschheit, die Ihr mit dem Gehirn lebt, nähert Euch mir und hört auf das Evangelium der Nachtarbeit, der intellektuellen Arbeit.
Erstens. Der Kaffee, den man auf türkische Art braut, hat mehr Geschmack und Kraft als der Kaffee, den man in einer Mühle mahlt.
Bei einer ganzen Reihe sozusagen mechanischer Angelegenheiten, die sich auf die Ausnützung der Genüsse beziehen, sind die Orientalen den Europäern weit voran. Das Genie dieser Leute, die man den Maulwürfen vergleichen kann, die jahrelang in ihren Löchern bleiben, ihre goldenen Augen offen auf die Natur richten so wie zwei Sonnen, enthüllt ihnen gewissermassen durch eine Intuition, was uns die Wissenschaft auf dem Wege der Analyse zeigt. Das tödliche Element des Kaffees ist das Tannin, eine bösartige Substanz, die die Chemiker noch nicht zur Genüge studiert haben. Wenn die Membranen des Magens von Tannin durchsetzt sind, oder wenn die spezifische Wirkung des Tannins im Kaffee sie durch einen zu häufigen Gebrauch gelähmt hat, dann verweigern sie jene ein wenig heftigen Zusammenziehungen, die alle geistigen Arbeiter fordern. Die Folgen davon sind dann sehr ernsthafte Störungen, wenn der Kaffeeliebhaber seine Leidenschaft fortsetzt.
Es gibt einen Menschen in London, den der Missbrauch des Kaffees zu einem verschnörkelten Krüppel gemacht hat, ähnlich den von Gichtknoten geplagten Greisen. Ich habe in Paris einen Graveur gekannt, der fünf Jahre gebraucht hat, um sich von dem Zustand zu erholen, in den ihn die Liebe zum Kaffee gebracht hat. Ein letztes Beispiel. Erst vor kurzer Zeit ist ein Künstler, Chenavard, förmlich von Kaffee verbrannt worden. Er ging ins Café, wie ein Arbeiter jeden Augenblick in die Destille geht.
Diese in den Kaffee Verliebten handeln genau so, wie man sich eben in allen Leidenschaften benimmt. Sie müssen immer in die Höhe gehen, steigern ihren Missbrauch bis zu einer verderblichen Stärke. Wer nun den Kaffee auf die türkische Art braut und siedet, der pulverisiert ihn bis zu Molekülen bizarrer Formen, die das Tannin zurückhalten und nur das Aroma freigeben. Das ist der Grund, weshalb die Italiener, die Venetianer, die Griechen und die Türken ohne Gefahr unaufhörlich Kaffee trinken können, eine Art Kaffee, die Franzosen allerdings nur verächtlich »Cafiot« nennen. Voltaire hat solchen Kaffee getrunken.
Man merke sich also das Folgende: Der Kaffee hat zwei Elemente, das eine, eine Materie in heissem oder kaltem Wasser zu lösen und frei zu machen, und dieses Element ist der Träger des Aromas. Das andere ist das Tannin, und das widersteht dem Wasser stärker und lässt sich aus der Gesamtsubstanz nur langsam und mühvoll entfernen. Daraus folgern wir dieses Axiom:
V
Man soll das kochende Wasser auf keinen Fall lange mit dem Kaffee zusammenlassen; dieser innige Kontakt ist ein Widersinn. Die Bereitung mit Spiritus heisst, den Magen damit und die Organe mit Tannin vergiften.
Zweitens. Nimmt man den andern Fall an, dass der Kaffee auf die unsterbliche Art bereitet wird: mit der Kaffeemaschine »à la de Belloy« (nicht von Belloy; der Mann nämlich, dessen weisen Überlegungen wir diese Methode verdanken, war der Cousin des Kardinals und wie er, aus der sehr alten und sehr berühmten Familie der Marquis de Belloy), so ist der Kaffee besser, wenn er durch eine Infusion von kalten Wasser erzeugt wird, als durch eine Infusion von kochendem. Das ist nun eine zweite Art, seine Wirkungen zu steigern oder zu mindern.
Tut man aber den Kaffee in eine Mühle, so entzieht man ihm sogleich das Aroma und das Tannin, so schmeichelt man nur dem Geschmack und reizt die Plexus, die wiederum Reaktionen auf die tausend Zellen des Gehirns üben.
Man hat also zwei Grade: den auf die türkische Art durch Sieden erzeugten Kaffee und den gemahlenen.
Drittens. Von der Quantität des Kaffees, den man in den oberen Behälter gibt, von der mehr oder minderen Häufigkeit des Umrührens, von dem Mehr oder Weniger an zugesetztem Wasser hängt die Stärke des Kaffees ab. Und das gibt nun die dritte Art, wie man mit dem Kaffee umzugehen hat.
Man kann also eine kürzere oder längere Zeit, ein oder zwei Wochen länger den erregenden Effekt mit einer, dann zwei Tassen durch Sieden hergestellten Kaffees erreichen, den man mit einer genau abgestuften Quantität durch eine Infusion kochenden Wassers bereitet.
Eine Woche lang durch eine Infusion von kaltem Wasser, durch Stossen des Kaffees, durch Umrühren des Pulvers und durch Verminderung des Wassers erreicht man dann wieder dieselbe Dosis von zerebraler Kraft.
Wenn man dann zu dem Maximum des Umrührens und dem Minimum von Wasser gelangt ist, dann kann man die Dosis verdoppeln und zwei Tassen nehmen; einige sehr starke Temperamente kommen dann noch bis zu drei Tassen. Und so kann man es noch ein paar Tage länger machen.
Schliesslich habe ich noch eine entsetzliche und grausame Methode entdeckt, die ich nur jenen Leuten anrate, die eine ganz ausserordentliche Natur haben, schwarze und feste Haare, eine Haut von einer Farbe zwischen dem Ocker und dem Zinnober, viereckige Hände, Beine wie die Stäbe des Geländers der Place Louis XV. Es handelt sich um den Gebrauch von gemahlenem, gerührtem, kaltem und (ganz oder fast) wasserfreiem Kaffee, den man nüchtern geniesst. Dieser Kaffee fällt sozusagen in Ihren Magen hinein, der – Sie wissen das durch die Lektüre der Werke Brillat-Savarins – eine Art von Sack ist, im Innern mit Samt gefüttert und mit Saugorganen und kleinen Wärzchen tapeziert. Er findet dort nichts, er greift also sofort diese zarte und lüsterne Fütterung an, er wird eine Art von Nahrungsmittel, begehrt die Säfte für sich. Er reisst diese Orgänchen an sich, fordert sie, wie eine Pythia ihren Gott fordert, er malträtiert diese hübschen kleinen Magenwärzchen, wie ein roher Kutscher seine jungen Pferde brutalisiert, die Plexus entzünden sich, sie flammen förmlich auf und lassen die Funken bis ins Gehirn hinauf sprühen. Die Folge davon ist eine allgemeine Aufregung, die Gedanken kommen in eine Verwirrung wie die Bataillone der grossen Armee auf dem Schlachtfelde, und die Schlacht findet eben statt. Die Erinnerungen stürmen im Laufschritt eines heftigen Angriffs mit fliegenden Fahnen. Die leichte Kavallerie der vergleichenden Vorstellungen entfaltet sich in einem grossartigen Galopp, die Artillerie der Logik kommt mit ihrem Train und dem schweren Geschütz, die Geistesblitze sind sozusagen die Sprengbomben, die Figuren stellen sich auf, das Papier bedeckt sich mit Tinte, denn die nächtliche Arbeit beginnt jetzt, und sie endet ja mit ganzen Strömen von schwarzem Wasser so wie das Schlachtfeld mit schwarzem Pulver. Ich habe einmal dieses Gebräu, auf diese Art eingenommen, einem meiner Freunde angeraten, der durchaus eine versprochene Arbeit bis zum nächsten Morgen vollenden wollte. Er hatte das Gefühl, vollständig vergiftet zu sein, er musste sich wieder ins Bett legen, blieb dann eine Zeit im Bett wie eine jungverheiratete Frau. Er war gross, blond, hatte nur wenig Haare, einen Magen aus Papiermaché, war schmächtig. Ich gestehe: meine Beobachtungsgabe war zu schwach oder zu sorglos gewesen.
Wenn Sie einmal soweit sind, Kaffee nüchtern zu sich zu nehmen und zwar in gesteigerten Emulsionen, und wenn sie dann seine Macht erschöpft haben und trotzdem den Einfall haben, das Manöver noch weiter fortzusetzen, dann werden sie ganz entsetzliche Schweissanfälle bekommen, nervöse Schwächezustände, Anfälle von Ohnmacht. Ich weiss nicht genau, was alles noch geschehen könnte, die weise Natur hat mir bisher geraten, derlei zu lassen, da ich vermutlich nicht verurteilt bin, eines jähen Todes zu sterben. Man muss sich dann darauf verlegen, die gewissen Milchspeisen zu geniessen, Huhn und weisses Fleisch zu sich zu nehmen, kurz die Waffe sinken lassen und reuig wieder zum Leben eines Flaneurs, eines Sommerfrischlers, eines einfältigen und im Verborgenen blühenden Bourgeois zurückzukehren.
Der Zustand, in den einem der Kaffee versetzt, wenn man ihn nüchtern nach der von mir gegebenen Formel geniesst, erzeugt eine Art nervöser Beweglichkeit, die eine Ähnlichkeit mit dem Jähzorn hat; die Worte werden laut, die Gesten drücken eine krankhafte Ungeduld aus, man merkt eben das Bedürfnis, dass alles so geht, wie die Gedanken in einem gehen. Man ist heftig, macht um jeder Nichtigkeit willen Lärm und gelangt schliesslich dazu, jenen ein wenig schwankenden Charakter des »Poeten« zu haben, den diesen Leuten die Krämer so vorwerfen. Man mutet andern die hellseherischen Kräfte zu, die man selber hat. Ein Mann von Geist muss sich also hüten, in diesem Zustande gesehen zu werden, oder jemandem nahe zu kommen. Ich habe diesen sonderbaren Zustand durch einige Zufälle entdeckt, die mich glücklicherweise von dieser Exaltation, die ich mir selber zugezogen hatte, ohne viel Mühsal befreit haben. Freunde, bei denen ich auf dem Lande war, sahen mich streitsüchtig und in übler Laune, bei jedem Gespräch misstrauisch. Am Tage darauf sah ich all mein Unrecht ein, und wir dachten darüber nach, was wohl der Grund gewesen sein könnte. Meine Freunde waren Gelehrte allerersten Ranges, und so hatten sie ihn nur zu bald gefunden: der Kaffee wollte sein Opfer.
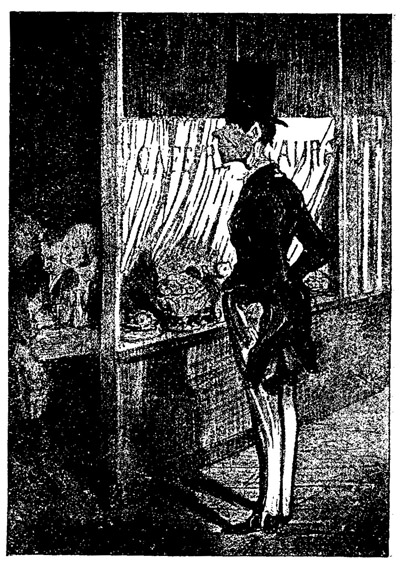
Daumier
Diese Beobachtungen sind nicht nur zuverlässig und unterliegen keinen anderen Veränderungen als jenen, die etwa aus den persönlichen Idiosynkrasien kommen; sie stimmen auch überein mit den Erfahrungen verschiedener Praktiker, unter denen ich den berühmten Rossini anführe, einen jener Männer, die am eifrigsten die Gesetze des Geschmacks studiert haben, eines Helden würdig Brillat-Savarins.
Beobachtung. – Bei gewissen schwächlichen Naturen erzeugt der Kaffee eine – übrigens – ungefährliche Kongestion des Gehirns. Statt sich angeregt zu fühlen, empfinden solche Personen Schlafbedürfnis, behaupten, dass der Kaffee sie einschläfere. Diese Art Leute mögen die Beine des Hirsches und den Magen eines Straussen haben, aber das Handwerkszeug, das ihnen für die geistige Arbeit zur Verfügung steht, ist mangelhaft.
Zwei junge Reisende, die Herren Combes und Tamisier, fanden fast alle Bewohner Abessiniens impotent. Die beiden Forscher schrecken nicht davor zurück, den Missbrauch des Kaffees, wie ihn die Abessinier aufs äusserste treiben, für dieses schändliche Missgeschick verantwortlich zu machen. Sollte dieses Buch in England Beachtung finden, dann möchten wir die britische Regierung ersuchen, die Richtigkeit dieser Hypothese an dem erstenbesten Verurteilten, der ihr in die Hände fällt, zu erproben; nur darf es nicht etwa ein Weib oder ein Greis sein.
Auch der Tee enthält Tannin, doch hat dieses dann eher narkotische Eigenschaften. Das Gehirn wird nicht angegriffen, es wirkt nur auf Plexus und Verdauungsorgane, die narkotische Substanzen ganz besonders und rasch aufsaugen. Die Art der Bereitung ist ja bekannt, aber ich bin nicht imstande, festzustellen, inwieweit die Wassermengen, die von dem Teetrinker in den Magen hineingegossen werden, teil haben an der eigentümlichen Wirkung dieses Getränkes. Wenn die zitierten Erfahrungen Englands massgebend sind, dann wäre der Tee der Erzeuger der englischen Moral, der Miss mit gelblichfahlem Teint, und aller englischen Hypokrisie und Medisance. Sicher ist, dass er nicht weniger die Moral als den Körper korrumpiert. Wo die Frauen Tee trinken, ist ihre Liebe im Kern verdorben; sie sind blass, kränklich, geschwätzig, langweilig, spröde. Bei einzelnen kräftig organisierten Naturen schafft starker Tee, in grossen Quantitäten genossen, eine seltsame Erregung, füllt sie bis oben mit Melancholie an; Träume kommen, die aber nicht den starken Glanz der vom Opium hervorgebrachten haben: diese Phantasmagorie spielt sich in einer grauen, nebligen Atmosphäre ab. Die Vorstellungen sind süsslich mild wie blonde Frauen. Man verfällt nicht in den tiefen, bleischweren Schlaf, wie ihn gesunde Naturen nach starken Anstrengungen haben, sondern einer unbeschreiblichen Schlaftrunkenheit, die an die Halbträume frühmorgens erinnert.
Kaffee und Tee machen beide, im Übermass genossen, die Haut trocken und brennend. Der Kaffee erzeugt oft Schweissausbrüche, quälenden Durst. Bei exzessivem Missbrauch dieser Genussmittel wird der Speichel dickflüssig, manchmal bleibt er sogar fast völlig aus.
§4
Vom Tabak
Ich habe mir nicht ohne Grund den Tabak fürs Ende aufgehoben. Erstens ist diese Leidenschaft am spätesten aufgekommen, und dann triumphiert sie über alle andern. Gott bewahre mich davor, an dieser Stelle die streitbaren Kräfte der Liebe beschwören zu wollen und so die Empfindlichkeiten ehrenwerter Leute zu verletzen. Aber es ist zur Genüge anerkannt, dass Herkules seinen Ruhm vor allem der zwölften Arbeit dankt, die allgemein als ganz fabelhafte Leistung erscheint; und gar heutzutage, wo die Frauen wahrhaftig unter dem Rauch der Zigarren mehr zu leiden haben, als unter dem Feuer der Liebe. Der Zucker wird allen menschlichen Wesen sehr bald ekelhaft, selbst den Kindern. Exzessiver Genuss alkoholischer Getränke gewährt eine Lebensmöglichkeit von kaum zwei Jahren, der von Kaffee schafft Krankheiten, so dass man ihn auch bald lassen kann. Rauchen aber – das meinen die Menschen ohne Mass und Einschränkung tun zu dürfen. Ein Irrtum. Broussais, der ein starker Raucher war, hatte einen herkulischen Körperbau. Ohne seine Exzesse in der Arbeit und im Rauchen hätte er mehr als hundert Jahre alt werden müssen. Er starb kürzlich, und denkt man an seine Zyklopennatur, so muss man sagen: in der Blüte der Jahre. Ein rauchwütiger Dandy bekam einen Riesenkropf und da man ihm den nicht wegschneiden konnte, musste er ins Grab.
Es ist eigentlich unerhört, dass Brillat-Savarin, der sein Werk, »Physiologie des Geschmackes« betitelt, nach seiner meisterhaften Darstellung der Bedeutung aller Teile der Nase und des Gaumens für die Geschmacksempfindung, das Kapitel vom Tabak ganz vergessen hat.
Der Genuss des Tabaks geschieht heute durch den Mund, nachdem er lange seinen Weg durch die Nase genommen hatte. Er affiziert vor allem jene zweifach bedeutsamen Organe, die Brillat-Savarin glänzend an uns festgestellt hat: den Gaumen, seine Nebenorgane und die Nasengänge. Es ist ja wahr, der Tabak hatte, als der berühmte Professor sein Buch schrieb, noch nicht in dem Masse wie heute die französische Gesellschaft in allen ihren Schichten ergriffen. Ein Jahrhundert lang wurde er mehr in Pulverform zu sich genommen, als in Rauch umgesetzt, heute aber gefährdet die Zigarre die soziale Ordnung. Die ungeahnten Lüste, die man erlebt, wenn man sich als Schornstein betätigt, erschlossen sich der Menschheit.
Bei den ersten Versuchen verursacht der in Rauch verwandelte Tabak sehr empfindliche Schwindelgefühle. Bei den meisten Neophyten dieses Kults erzeugt er eine übermässige Speichelbildung, häufig Übelkeiten, die bis zum Erbrechen führen. Trotz dieser deutlichen Warnung der bitter gereizten Natur lässt jedoch der neue Tabakanbeter nicht von seinem Vorhaben: er gewöhnt sich. Seine Lehrzeit dauert manchmal mehrere Monate. Endlich siegt der Raucher wie Mithridates, – und er hat sich das Paradies erobert. Wie sonst sollte man den Zustand des Rauchers nennen? Der Arme, gefragt: Brot oder Tabak? zaudert keinen Augenblick, den Glimmstengel zu wählen. Die gleiche Wahl trifft der Jüngling ohne Sou, der seine Schuhsohlen am Asphalt der Boulevards abwetzt, und dessen kleine Geliebte Tag und Nacht arbeitet. Der korsische Bandit, den Sie in unzugänglichen Felsenschluchten oder auf weiten Dünen, die sein Räuberauge absucht, treffen, ist sofort und gerne bereit, Ihren Feind aus der Welt zu schaffen, wenn Sie ihm ein Pfund Tabak geben. Männer von grossem Wert behaupten, dass die Zigarre ihnen über die widrigsten Ereignisse hinweghilft. Soll der Dandy zwischen einer angebeteten Frau und der Zigarre entscheiden, er wird nicht länger zögern, die Geliebte zu verlassen, als der Sträfling im Gefängnis zu bleiben, wenn er dort Tabak à discretion bekommt. Welche Macht hat wohl dieser Genuss, für den der König der Könige sein halbes Reich hingegeben hätte, und der vor allem die Lust der Elenden ist? Diese Lust, ich habe sie lange verleugnet, und man verdankte mir das folgende Axiom:
VI
Eine Zigarre rauchen, heisst Feuer schlucken.
Nun danke ich den Schlüssel zu diesem Wunderland der George Sand. Doch kann ich nur die Houka Indiens und die Narguileh der Perser gelten lassen. Wo's um materielle Genüsse geht, sind uns die Orientalen eben zweifellos weit überlegen.
Die Houka ist wie die Narguileh ein sehr elegantes Gerät. Die ungewöhnlichen und bizarren Formen reizen das Auge und verleihen demjenigen, der sich dieser seltsamen Apparate bedient, einen eigenen aristokratischen Nimbus in den Augen des erstaunten Bourgeois. Auf einem Wasserbehälter, der bauchig ist wie ein japanischer Topf, ruht eine Art von becherförmigem Pfeifenkopf aus Terrakotta, worin Tabak, Patschouli und andere Substanzen verbrannt werden, deren Rauch man nun einatmet. Denn man kann die verschiedenartigsten botanischen Erzeugnisse rauchend geniessen, von denen eines immer amüsanter ist und wirkt als das andere. Der Rauch geht durch mehrere ellenlange Schläuche aus Leder, Tierhäuten, die mit Seidenfransen, Silberfäden geziert sind; und ihr Ende ist getaucht in die Vase oben, wo wohlriechendes Wasser ist und wohin es auch aus dem Hahn tröpfelt, der von der höher gelegenen Feuerstätte den Abfluss herstellt.Man merkt hier, wie an verschiedenen anderen Stellen, Balzacs Absicht, durch eine schwere wissenschaftliche Terminologie zu tun, was man »épater le bourgeois« nennt. Und ich beim Übersetzen will ihm im Grabe nicht dieses Vergnügen stören. F.
Der Atem zieht nun den Rauch, der muss aber erst durchs Wasser durchgehen: der Horror vacui, den die Natur verspürt, zwingt dazu. Dieser Weg durch das Wasser lässt den Rauch seinen brenzlichen Beigeschmack verlieren, er wird frisch und kühl, nimmt ein feines Parfüm an, ohne jedoch die spezifischen Eigenschaften einzubüssen, welche die Verkohlung der Pflanze erzeugt. Dann wird das Aroma des Rauches in den Schlangenschläuchen aus Leder noch feiner und aromatischer und erreicht endlich den Gaumen rein und duftend. Er breitet sich auf den Papillen aus (den Wärzchen, die die Sinnesempfindungen fortleiten), die ihn gierig auffangen, und er steigt zum Hirn empor, gleich einem melodischen, weihrauchgetränkten Gebet, das zur Gottheit emporklingt.
Sie liegen da auf einem Diwan, beschäftigt, ohne etwas zu tun, Sie denken, ohne sich anzustrengen, berauschen sich, ohne zu trinken, ohne Ekel, ohne den geilen, faden Nachgeschmack des Champagners, ohne die nervösen Ermüdungszustände des Kaffees. Ihr Hirn erwirbt neue Kräfte, Sie fühlen das Gewicht Ihrer knochigen Schädeldecke nicht mehr, mit weitausgebreiteten Flügeln durchfliegen Sie die Welt der Phantasie. Sie fangen Ihre flatternden Träume ein, einem Kinde gleich, das mit seinem Netz auf himmlischen Gefilden nach Libellen jagt. Und Ihre phantastischen Wünsche erscheinen Ihnen im idealsten Lichte, so dass Sie den Reiz spüren, sie zu Wirklichkeit zu machen. Die allerschönsten Hoffnungen schweben vor Ihnen auf und nieder, und zwar nicht mehr als blosse Illusionen. Sie haben Körper und tanzen um Sie, ebenso viele Taglionis. Mit wieviel Grazie und Anmut – Ihr wisst es, Ihr Raucher! Dieses Schauspiel verschönert die Natur, alle Härten des Lebens schwinden, das Leben ist mit einem Male leicht, der Verstand wird klar, und blau wird die graue Atmosphäre der Vorstellungen. Allein, es ist seltsam: sowie die Houka erlöscht, die Pfeife, die Zigarre ausgeraucht ist, fällt auch der Vorhang über diesem Spiel. Und welchen Preis haben Sie für diesen ausserordentlichen Genuss bezahlen müssen? Untersuchen wir die Frage, wobei anzumerken ist, dass für die vorübergehenden Einwirkungen das Gleiche für den Alkohol und den Kaffee gilt.
Der Raucher hat die Speichelabsonderung unterdrückt. Unterdrückt er sie nicht völlig, so verändert er doch zumindest ihre Bedingungen, der Speichel wird in eine Art zäher, dickflüssiger Sekretion verwandelt. Endlich sind, falls der Raucher gar keinen mehr hat, alle Gefässe verschleimt, ihre Saug- und ihre Ausscheidungsorgane verstopft oder vernichtet, all die sinnreichen Wärzchen, deren wunderbarer Mechanismus in das Forschungsgebiet von Raspails Mikroskop gehört. Verweilen wir ein wenig auf diesem Gebiet.
Von allen Zirkulationssystemen im menschlichen Körper gehört die Bewegung der verschiedenen Schleimabsonderungen – dieser wundersamen zwischen Blut und Nerven eingebetteten Masse – zu den am sinnreichsten organisierten. Diese schleimigen Sekrete sind für die Harmonie unseres inneren Mechanismus von so wesentlicher Bedeutung, dass bei heftigen Gemütsbewegungen in uns ein fast gewaltsamer Hilferuf ausgelöst wird, damit in einem unbekannten Zentrum das Gleichgewicht wieder hergestellt wird. Ja, das Leben ist dann sozusagen so durstig, dass jeder, den einmal heftiger Zorn erfasst hat, sich wohl der plötzlichen Trockenheit im Schlund entsinnen wird, der Verdickung des Speichels, die plötzlich eingetreten ist und erst sehr langsam wieder dem normalen Zustand weicht. Diese Beobachtung hat mich so ungeheuer ergriffen, dass ich sie selbst auf ihre Richtigkeit hin trotz den schauerlichsten Gemütserschütterungen nachprüfen wollte. Aus diesem Grunde habe ich mich lange Zeit um die Gunst bemüht, mit zwei Herren speisen zu dürfen, die sonst ihr Beruf aus der Gesellschaft ausschaltet: dem Chef der Kriminalpolizei und dem ersten Scharfrichter am königlichen Gerichtshof in Paris. Beide sind übrigens Bürger und Wähler, erfreuen sich aller bürgerlichen Ehrenrechte wie jeder andere Franzose. Der berühmte Chef der Sicherheitspolizei versicherte mir, dass sämtliche Verbrecher, die er je verhaftet hat, ohne Ausnahme für die Dauer von einer bis zu vier Wochen die Fähigkeit, auszuspucken, völlig verloren haben. Die Mörder waren es, die am spätesten diese Fähigkeit zurückgewannen. Der Scharfrichter hatte noch nie einen Mann auf dem Wege zum Schafott ausspeien sehen, auch nicht in der Zeit, von dem Augenblicke an, wo man mit seiner letzten Toilette begann.
Es sei nun gestattet, hier noch eine Tatsache mitzuteilen. Sie ist mir von dem Kommandanten des Schiffes (in eigener Person!) erzählt worden, auf dem jene kleine Episode sich zutrug, welche mir geeignet scheint, meine Argumentation zu bekräftigen.
Auf einer königlichen Fregatte wurde auf hoher See ein Diebstahl verübt. Der Schuldige musste also unbedingt an Bord sein. Aber trotz der eingehendsten Untersuchung und trotz der überall herrschenden Gewohnheit, dass jeder die geringfügigsten Nichtigkeiten des Alltagslebens des andern beobachtet, wie die enge Gemeinschaft des Lebens zur See sie mit sich bringt, konnten weder die Offiziere noch die Matrosen dem Täter auf die Spur kommen. Die ganze Mannschaft war durch dieses Vorkommnis in Atem gehalten. Der Kapitän und sein Stab verzweifelten schon an der Möglichkeit, der Gerechtigkeit zum Siege zu helfen. Da sagte der Steuermann zum Kommandanten:
»Morgen früh haben wir den Dieb!«
Grosses Erstaunen.
Am nächsten Morgen lässt der Steuermann die ganze Mannschaft auf Deck antreten und kündigt an, jetzt werde er den Schuldigen ausfindig machen. Er befiehlt, jeder Mann solle die Hand ausstrecken, in die verteilt er sodann kleine Häufchen Mehl. Nun befiehlt er den Leuten, aus diesem Mehl mit Hilfe ihres Speichels kleine Kugeln zu drehen und schreitet die Front ab. Und es gab einen unter der Bemannung, der seine Kugeln nicht hatte machen können, der Speichel hatte ihm gefehlt.
»Dieser ist der Schuldige,« sagt der Steuermann zum Kapitän, und er hatte sich nicht geirrt.
Diese Beobachtungen und diese Tatsachen beweisen, welchen Wert die Natur den Schleimabsonderungen in ihren Beziehungen zum ganzen Organismus beimisst. Der Überschuss wird durch die Geschmacksorgane ausgeschieden und bildet den Hauptbestandteil der Magensäfte, dieser geschickten Chemiker, die aller Mühen unserer Laboratorien spotten. Jeder Arzt wird Ihnen bestätigen, dass die schwersten, hartnäckigsten und am heftigsten einsetzenden Krankheiten jene sind, die von einer Entzündung der Schleimhäute herrühren. Selbst der »Coryza«, gewöhnlich Schnupfen genannt, schaltet durch einige Tage diese kostbarste Fähigkeit aus, und ist doch nichts weiter als eine ganz leichte Reizung der Schleimhäute der Nase und des Gehirns.
Nun hemmt der Raucher diese Zirkulation in jeder möglichen Weise, indem er die Ausscheidung unterbindet, die Tätigkeit der Wärzchen vernichtet, oder diese zumindest mit säuerlichen zusammenziehenden Säften tränkt. Während der ganzen Dauer seiner Betätigung macht der Raucher denn auch einen ziemlich stumpfsinnigen Eindruck. Charakteristisch für die Nationen, die am stärksten rauchen, wie beispielsweise die Holländer, die ersten Raucher in Europa, ist ihr apathisches, stumpfes Wesen. Holland hat auch keinen Bevölkerungsüberschuss. Die in dem Lande reichlich genossene Fischnahrung, sowie die Vorliebe für eingesalzenes Fleisch und einen sehr alkoholhaltigen Wein, den sie aus der Touraine beziehen, wirken den Einflüssen des Tabaks ein wenig entgegen; dennoch werden die Niederlande immer demjenigen gehören, den es gelüsten wird, sie zu nehmen, und sie existieren im Grunde nur durch die Eifersucht der anderen Kabinette, die sie nicht unter französische Herrschaft kommen lassen wollen.
Rauch- und Kautabak haben schliesslich auch bestimmte lokale Wirkungen, die Beachtung verdienen. Sie greifen den Zahnschmelz an, bringen das Zahnfleisch zum Anschwellen, dieses scheidet einen spezifischen Geruch aus, der sich mit den aufgenommenen Speisen und Getränken vermischt und wieder den Speichel verändert.
Wir wissen auch, dass die Türken, die dem Tabak, wenn sie ihn auch durch das Auslaugen in der Wirkung etwas abschwächen, in unmässiger Weise fröhnen, frühzeitig erschöpft sind. Da nur sehr wenige Türken reich genug sind, sich einen jener berühmten Serails zu halten, in dem sie ihre Jugendkräfte vergeuden können, bleibt nur die Annahme, dass hauptsächlich Tabak, Kaffee, und Opium, diese drei in ihrer Art ähnlichen Reizmittel, zusammenwirken, um ihre Zeugungsfähigkeit sehr früh zu zerstören. Ein Türke von dreissig Jahren ist in dieser Beziehung soviel wert wie ein fünfzigjähriger Europäer. Die Frage des Klimas spielt dabei eine ganz geringfügige Rolle.
§5
Schlüsse
Die Steuerbehörde wird zweifellos diesen Ausführungen über die von ihr mit hohen Abgaben belegten Genussmittel entgegentreten. Dennoch sind sie wohlbegründet, und ich wage zu behaupten, dass die Pfeife einen durchaus nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Ruhe der deutschen Nation ausübt; denn sie raubt dem Menschen ein gewisses Ausmass seiner Energie. Der Fiskus ist von Natur stupid und antisozial. Er würde ruhig eine Nation dem Kretinismus preisgeben, wenn er sich damit die Lust schaffen könnte, die Goldstücke von einer Hand in die andere Hand laufen zu lassen, wie das die indischen Jongleure tun.
In unseren Tagen herrscht in allen Schichten der Gesellschaft eine Neigung zum Rausche, die von Moralisten und Staatsmännern bekämpft werden muss. Denn der Rausch bedeutet, in welcher Form er auch auftreten mag, eine Hemmung jeder sozialen Bewegung. Der Alkohol und der Tabak bedrohen die moderne Gesellschaft. Wenn man die Londoner Schnapspaläste gesehen hat, begreift man die Temperenzgesellschaften.
Brillat-Savarin, der als einer der ersten den Einfluss festgestellt hat, den alles, was durch den Mund in den Organismus aufgenommen wird, auf die Schicksale der Menschen ausübt, hätte seiner Arbeit den rechten grossen Wert für aller Augen gegeben, wenn er jene nützliche Statistik hätte ausführen lassen, die Grundlage seiner Theorie gewesen wäre: die Aufstellung der Beziehungen zwischen den Genüssen und den Leistungen grosser Männer. So eine Statistik wäre gewissermassen das Budget aller Dinge. Sie würde recht ernste Fragen aufhellen: wie nämlich alle Exzesse unserer Tage die Zukunft der Völker beeinflussen.
Der Wein, dieses Reizmittel der niedrigen Schichten, enthält wohl in seinem Alkohol ein schädliches Element; aber es dauert wenigstens je nach den einzelnen Konstitutionen eine recht ausgedehnte, kaum zu bestimmende Zeit, bis die Menschen jenen von uns besprochenen Prozessen anheimfallen. Und so plötzliche Einäscherungen wie die geschilderten sind ausserordentlich seltene Phänomene.
Was den Zucker anbelangt, so hat Frankreich ihn lange entbehren müssen. Und mir ist bekannt, dass die Lungenkrankheiten, deren häufiges Auftreten bei der in den Jahren 1800 bis 1814 geborenen Generation die ärztlichen Statistiker in Erstaunen setzte, dieser Entziehung zugeschrieben werden dürfen, sowie der Missbrauch Hauterkrankungen zur Folge hat.
Es ist kein Zweifel: der Alkohol, welcher die Basis der Weine und Liköre bildet, die fast von allen Franzosen unmässig genossen werden, ebenso der Kaffee und auch der Zucker, der phosphorbildende und brennbare Substanzen enthält, und die beide in immer steigendem Masse konsumiert werden, verändern die Grundlagen und Bedingungen der Zeugungskräfte. Es ist ja nunmehr doch wissenschaftlich erwiesen, dass selbst Fischnahrung die Potenz beeinflusst.
Diese Art von Besteuerung ist also vielleicht noch unmoralischer als das Spiel, zersetzender, antisozialer als die Roulette. Der Branntwein ist ein verhängnisvolles Fabrikat, dessen Verkaufslokale überwacht werden sollten. Völker sind grosse Kinder, und die Staatskunst müsste ihre Mutter sein. Die Volksernährung, auf sämtliche Beziehungen hin angesehen, bildet einen ungeheuren und sehr vernachlässigten Teil der Politik. Ich möchte sogar behaupten, sie stecke noch in den Kinderschuhen.
Diese fünf Arten von Exzessen weisen eine grosse Ähnlichkeit in ihren Wirkungen auf: den übermässigen Durst, Schweissausbruch, Verlust der Schleimabsonderung und die daraus resultierende Zerstörung der Zeugungsfähigkeit.
Das folgende Axiom sei denn in die Wissenschaft vom Menschen aufgenommen:
VII
Alle Ausschweifungen, welche die Schleimhäute affizieren, verkürzen die Lebensdauer.
Der Mensch besitzt nur eine bestimmte Summe von Lebenskräften; diese ist gleichmässig verteilt auf die Blutzirkulation, die Schleimhäute und das Nervensystem. Ein Lebenssystem zugunsten des andern berauben, heisst ein Dritteil Tod herbeiführen.
Resümieren wir also in einem bildlichen Axiom:
VIII
Wenn Frankreich seine fünfhunderttausend Mann nach den Pyrenäen schickt, dann hat es sie nicht am Rhein. Und so ist es auch mit dem Menschen.