
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Seit zwei Jahrhunderten herrscht die Violine mit unumschränkter Macht im Gebiete der Instrumentalmusik. Sie hat während dieses Zeitraumes in rascher Aufeinanderfolge die Führerschaft in der Orchester-, Kammer- und Konzertmusik erobert, und selbst das in der Gegenwart so sehr begünstigte Pianoforte vermochte ihre bevorzugte Stellung nicht zu erschüttern oder auch nur zu beeinträchtigen. Beide Instrumente stehen, ohne miteinander zu rivalisieren, vielmehr einander ergänzend da, denn ihre Leistungsfähigkeit ist eine beinahe entgegengesetzte. Wenn das tonarme, aber praktische und überwiegend der Musikidee dienende Klavier den vollen Strom der Harmonien in allen Bewegungen und Nuancen erklingen lassen kann, so eignet sich dagegen die Violine, wie kein anderes Instrument, durch schmelzenden Gesang, sinnlich schönen, schwelgerisch üppigen und farbenreichen Tonreiz vorzugsweise zur kräftigen Vermittlung für den seelischen Ausdruck. Sie wirkt in erster Linie mehr auf pathologischem, das Klavier auf ideellem Wege. Diese Eigenartigkeit erklärt auch zum Teil, warum bereits nach den ersten Entwicklungsstadien des Klavierbaues das Wirken eines Bach, Händel und andrer möglich wurde, während mit der höchsten Blütezeit des Violinbaues erst die Anfänge einer wahrhaft kunstgemäßen Behandlung des Violinspiels zusammenfallen. Die Violinspieler bedurften eben jener sinnlich packenden Tonschönheit, die ihnen das reife Produkt des italienischen Geigenbaues gewährte. Schon Corelli bediente sich einer Stradivarigeige S. C. F. Pohls »Mozart und Haydn in London«, Abteil. 2, S. 84., zugleich ein Beweis, daß diese Instrumente in Italien sofort die vollste Schätzung fanden, denn Corelli starb (1713), als Stradivari in dem Zenit seines Wirkens stand.
Die Kunst des Violinspiels in Italien erscheint wie das letzte Aufleuchten der gesamten Kunsttätigkeit des hochgepriesenen Mediceischen Zeitalters, wie ein Fortklingen der in demselben geborenen kirchlichen und weltlichen Vokalmusik, insbesondre aber der Gesangskunst, die wir am Schlusse des 17. Jahrhunderts bereits auf einer hohen Stufe der Ausbildung finden. Violinspiel und Violinkomposition stehen tatsächlich mit allen Erscheinungen der unmittelbar voraufgehenden tonkünstlerischen Tätigkeit in engster Beziehung. Während Palestrina in Rom seine Mission, reformatorisch eingreifend und neugestaltend, erfüllte, erstand der Kunst in Venedig Gabrieli. In Florenz bildeten sich sodann unter den Einwirkungen des klassischen Altertums die Anfänge der Oper, und Neapel wurde durch Carissimi vertreten. In immer stärkeren Fluß gerät nun die zu höherem Leben erweckte tonkünstlerische Stimmung, Meister reiht sich an Meister, und unter den Augen Alessandro Scarlattis und Lottis beginnt zu Ende des 17. Jahrhunderts die Kunst des Violinspiels gleich einem flügge gewordenen Aar ihre Schwingen zu entfalten.
Gewöhnlich wird Corelli als Stammvater und Begründer des kunstgemäßen Violinspiels genannt, und diese Angabe ist richtig, wenn man damit sagen will, daß er der erste epochemachende Meister desselben gewesen sei. Doch ist hierbei zu berücksichtigen, daß er diese Kunst nicht erst geschaffen, sondern daß in ihm nur, wie die Geschichte öfters zeigt, das konzentrierte Resultat einer vorangegangenen Entwicklungsphase entscheidend zutage tritt, deren Dauer rund ein Jahrhundert beträgt. Corelli war einer jener Künstler, denen, mit Goethe zu reden, eine große Erbschaft zufiel. Alle früheren Ansätze und Entwicklungslinien auf dem Gebiete des Violinspiels sowie der Violinkomposition konvergieren auf ihn, und neue Impulse gehen von ihm aus.
Was die uns zunächst beschäftigende vorcorellische Periode angeht, so ist eine zugleich vollständige und im Sinne monographischer Darstellung reinliche Herausschälung dessen, was sich auf unsern Gegenstand bezieht, nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht nur hat sich das für die Violine im weitesten Sinne in Betracht kommende Material durch neuere Forschungen beträchtlich vermehrt. Vielmehr liegt die eigentliche Schwierigkeit darin, daß die Geschichte der Violine und des Violinspiels vor Corelli eng, ja unlöslich mit der allgemeinen Geschichte der Instrumentalmusik jener Zeit verwachsen ist, und dies gilt sogar noch einigermaßen für die unmittelbar an Corelli anschließende Periode. Tatsächlich müßte die Darstellung nach Ausscheidung der Lauten-, Klavier- und Orgelmusik sowie der weniger wichtigen Literatur für einige andere Instrumente (Gambe, Violoncello, einige Blasinstrumente) die gesamte gewaltige instrumentale Produktion vom Ausgang des 16. bis ins 18. Jahrhundert hinein umfassen, somit den Kreis monographischer Betrachtung verlassend auf das Meer der großen Musikgeschichte sich verirren. Die Violine war eben mit ihrer Erfindung noch keineswegs entdeckt, sondern man schob ihr einfach zunächst die höchste Stimme zu, und ehe sich etwas, das im engeren Sinne Violinliteratur genannt werden kann, entwickelte und loslöste, verstrich geraume Zeit.
Die Anzahl italienischer Instrumentalkomponisten des 17. und 18. Jahrhunderts ist nicht nur eine außerordentlich große, sondern im allgemeinen kann man auch von jedem Tonsetzer jener Zeit, der für Violine geschrieben hat, annehmen, daß er selbst Violinspieler war, denn die Entwicklung der modernen Musik hat erst allmählich eine Lockerung dieses natürlichen Verhältnisses, welches uns heute fast als Anomalie erscheint, herbeigeführt. Aber es hieße Maß und Ziel verlieren, daraufhin diese Blätter mit Legionen verstorbener Fiedler bevölkern zu wollen. In seiner verdienstlichen, nur gelegentlich etwas zu national gefärbten sowie im Lobe etwas überschwänglichen Arbeit über die italienische Instrumentalmusik des 16. bis 18. Jahrhunderts zählt Luigi Torchi Luigi Torchi: La musica instrumentale in Italia nei secoli XVI, XVII e XVIII. Rivista musicale Italiana. Band 4-8. (1897 ff.) Eine Art musikalischer Beilage zu diesem Aufsatze hat Torchi 1897 in London bei Boosey & Co. erscheinen lassen. Ihr Titel ist: » A Collection of pieces for the Violin composed by Italian masters of the XVII. and XVIII. Centuries, harmonised and arranged with pianoforte accompaniment by Luigi Torchi.« Die Sammlung enthält 12 Sätze. Außer bekannten Meistern wie Tartini und F. M. Veracini sind darin auch wenig bekannte wie Pesenti, Vento, Cirri berücksichtigt. Es wäre nur zu wünschen, man erhielte mehr als derartige Kostproben, wenngleich auch sie dankenswert sind. Der Zustand, daß man die weitaus überwiegende Menge alter Musik nur unter den größten Unbequemlichkeiten zu Gesicht bekommen kann – vom Hören ganz zu schweigen, – wird je länger, desto unerträglicher. Im Gebiete der bildenden Kunst duldet ihn kein Mensch, und Museumsbauten kosten wahrhaftig mehr als der Neudruck alter Notenhefte. gegen 150 Tonsetzer für Streichinstrumente auf, ungerechnet also die wahrscheinlich ebenso zahlreichen Lauten-, Klavier- und Orgelkomponisten. Dabei ist er entfernt davon, Vollständigkeit anzustreben, vielmehr versichert er mehrfach, daß er aus der ungeheuren Menge der Tonsetzer nur diejenigen ausgewählt habe, die ihm für sein Thema notwendig erschienen seien. So hat er auch beispielsweise eine ganze Reihe der in diesem Buche genannten Künstler nicht besprochen Z. B. Turini, Farina, Buonamente, Neri, Laurenti, Carbonelli, Manfredi, Ferrari u. a. m.. Das Allermeiste, was produziert wurde, war eben, damals wie heute, und vielleicht damals noch mehr wie heute, Dutzendware.
Auch nur auf alle oder den größten Teil des oben erwähnten Anderthalbhunderts in diesem Buche einzugehen, ist untunlich, da die Entwicklung von Violinspiel und Violinkomposition hierdurch weniger klargelegt als vielmehr von neuem verdunkelt und unübersichtlich werden müßte. Unter der Menge sind es jedesmal nur wenige, die einen bemerkenswerten Fortschritt herbeiführen. Und obgleich es angezeigt erscheint, wie bereits in den früheren Auflagen des Buches geschehen, auch weniger bedeutende Namen in den Kreis der Betrachtung einzubeziehen, so kann doch von Vollständigkeit dabei keine Rede sein. Wem an dieser gelegen ist, der sei auf Arbeiten wie diejenige Torchis oder die lexikalischen Werke verwiesen Daß keiner der in den früheren Auflagen bereits besprochenen Komponisten dieser Epoche gestrichen worden ist, wird man verstehen und billigen, obwohl nicht bestritten werden kann, daß ebensogut wie Turini oder Buonamente Namen wie L. Viadana oder C. Grossi hätten aufgenommen werden können. Der Herausgeber hofft, keine für Entwicklung des Violinspiels wichtige Persönlichkeit übersehen zu haben..
Lange vor Corelli schon waren begabte und strebsame Musiker Oberitaliens bemüht, die Entwicklung des Violinspiels zu fördern. In der Einleitung dieser Blätter wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Herstellung der Violine in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfolgte, und daß unser Instrument erwiesenermaßen schon 1550 bei einer Festlichkeit in Rouen, nicht etwa vereinzelt, sondern in mehrfacher Besetzung zur Verwendung gekommen war. Die Anfänge des Violinspiels müssen hiernach gegen Mitte des 16. Jahrhunderts fallend gedacht werden. Natürlich war die Erlernung desselben für diejenigen, welche sich auf das Violaspiel verstanden, mit besonderen Schwierigkeiten nicht verbunden; immerhin erforderte der Übergang von dem einen zum andern Instrument einige Übung.
In Italien wurde das Violinspiel vielleicht etwas früher in Angriff genommen, als in Frankreich; eine urkundliche Nachricht liegt darüber bis jetzt noch nicht vor Über das Geigenspiel in Italien während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sowie um die Mitte desselben fehlen leider alle Nachrichten. Verdienstlich wäre es daher, wenn ein Musikkundiger dieses Landes im Interesse der Musikgeschichte Nachforschungen darüber anstellen wollte, welche sicherlich zu wertvollen Resultaten führen würden.. Daß man Violinen in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts dort bei den üblichen Musikaufführungen in der Kirche benutzte, geht aus einer Mitteilung Montaignes Montaigne schreibt: » Verone, octobre 1580. Il y avait des orgues et des Violons qui accompaignoient les chanteurs à la messe.« ( Vidal: » Les Instruments à archet.«) hervor, nach welcher dieselben während einer Meßfunktion in Verona neben der Orgel als Begleitungsinstrumente gebraucht wurden.
Im 16. Jahrhundert war es noch nicht üblich, für die verschiedenen Stimmen der Kompositionen bestimmte Instrumente vorzuschreiben, deren Auswahl mithin den Dirigenten, oder auch den Musizierenden selbst, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel überlassen blieb, wobei denn ohne Zweifel eine hergebrachte Praxis bestimmend war. Dieser Gebrauch setzte sich auch noch ins 17. Jahrhundert hinein fort. Eine in Venedig 1608 erschienene Sammlung von Instrumentalkanzonen, die Werke von Giovanni Gabrieli, Claudio Merulo, Gius. Guami, Flor. Maschera, Girolamo Frescobaldi und einer Reihe anderer Komponisten jener Epoche enthält, trägt den Titelvermerk, daß sie auf allen Instrumenten auszuführen seien. Den gleichen Vermerk haben die 19 Instrumentalkanzonen von Giov. Picchi (zu 2-8 Stimmen), die 1625 in Venedig gedruckt wurden, die vierstimmigen Kanzonen Tarquinio Merulas von 1615 u. a. m.
Giovanni Gabrieli ist, soviel man weiß, der erste Tonmeister, welcher in seinen Partituren, wenigstens teilweise, genaue Angaben bezüglich der anzuwendenden Tonwerkzeuge machte. Durch seine hervorragende Stellung als Hauptrepräsentant der venezianischen Tonschule wurde er hierin, wie in anderen Beziehungen, für die Komponisten der Folgezeit maßgebend.
Unter den von Gabrieli in seinen Werken ausdrücklich benannten Instrumenten figuriert mehrfach schon die Violine, welche von da ab neben dem Kornett, oder mit diesem abwechselnd, an der Spitze der Streichinstrumente erscheint. Bald indessen verdrängte sie vollständig das genannte Blasinstrument, um fortan die Alleinherrschaft als Instrumentalsopran in Ensemblesätzen anzutreten. Derartige Tonstücke jener Zeit sind die »Kanzone« und »Sonate«, mit denen der genannte Meister, im Anschluß an seinen Lehrer und Onkel Andrea Gabrieli, welcher bereits »Sonaten« zu fünf Stimmen gesetzt hatte, die ersten bedeutungsvollen Anfänge eines selbständigen Instrumentalsatzes von symphonischem Gepräge schuf.
In diesen Tonstücken, welche um die Mitte des 17. Jahrhunderts derart ineinander aufgingen, daß nur noch die, ursprünglich im Gegensatz zur Vokalmusik einfach als »Spielstück« zu nehmende »Sonata« fortbestand, hat Gabrieli die Rudimente der späteren, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts zu immer größerer Bestimmtheit ausgestalteten Sonatenform hingestellt In betreff der »Sonate« verweise ich auf meine Schriften »Die Violine im 17. Jahrh. und die Anfänge der Instrumentalmusik«, Bonn, bei Cohen, sowie auf die »Geschichte der Instrumentalmusik im 16. Jahrh.« (Berlin bei Guttentag), in welchen sich eingehende Darlegungen über die historische Entwickelung dieser Kunstform finden.
Da die Violine in dem kunsthistorisch so bedeutungsvollen Entwicklungsgange der » Sonata« während des 17. Jahrhunderts für die Wiedergabe dieser Kompositionsgattung eine Hauptrolle spielt, so ist es selbstverständlich, daß die ersten Stadien der technischen Ausbildung des Geigenspiels mit den allmählichen Fortschritten der Instrumentalkomposition zusammenfallen. Zugleich wurde die Handhabung dieses so wichtigen Tonwerkzeuges aber auch außerdem noch im speziellen durch besondere Violinsätze gefördert. Schon Giovanni Gabrieli schrieb eine Sonate eigens für drei Violinen.
Das von dem venezianischen Tonmeister gegebene Beispiel fand bald Nachahmer, die freilich nicht über eine gleiche schöpferische Kraft geboten. Dies macht sich nicht allein an den, der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts angehörenden Violinkompositionen fühlbar, sondern überhaupt an der gesamten, ihrem Gehalt nach größtenteils noch dürftigen instrumentalen Produktion des gedachten Zeitabschnitts. Allein wie geringwertig sich auch immer die, in diese Kategorie fallenden Erzeugnisse zur Hauptsache erweisen, – ein Verdienst ist ihnen nicht abzusprechen: sie boten den Zeitgenossen ein mehr oder minder ergiebiges Übungsmaterial dar, ganz abgesehen davon, daß die formelle Struktur des Instrumentalsatzes dadurch, wenn auch anfangs nur in bescheidenem Maße, gefördert wurde.
Als früheste nachweisbare Komposition für eine Violine allein mit begleitendem Baß ist ein von Biagio Marini Nicht zu verwechseln mit dem in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auftretenden Geiger Carlo Antonio Marini aus Bergamo, welcher gegen Ende des genannten Säkulums eine Reihe von Instrumentalkompositionen veröffentlichte. herrührendes, in seinem ersten Werk » Affetti musicali«, das im Jahre 1617 in Venedig erschien, befindliches Tonstück zu erwähnen. Diese Angabe wird von Torchi in seiner Arbeit » La musica instrumentale in Italia etc.« bestritten, da er bereits vor 1665 (in seinem Text steht versehentlich 1555) Soloviolinsonaten namhaft gemacht habe. Es handelt sich aber in diesem Falle nicht um die späteren 1655 veröffentlichten Violinkompositionen Marinis, sondern um Werke von 1617 und 1620. – Die von Torchi genannten früheren Soloviolinsonaten stammen von Montalbano (1629), Fontama (1641) und Uccellini (1649), sind also sämtlich späteren Datums. Ein zweiter Solosatz findet sich in einem drei Jahre später ebenfalls in Venedig erschienenen Sammelwerke desselben Tonsetzers. Es trägt die Überschrift: » Romanesca per Violino solo e Basso se piace« In den Musikbeilagen zu der von mir veröffentlichten Schrift »Die Violine im 17. Jahrhundert und die Anfänge der Instrumentalkomposition« habe ich die Romanesca Biagio Marinis nebst einigen andern Tonsätzen desselben vollständig mitgeteilt. und ist eine aus vier kürzeren Abschnitten bestehende Komposition, von denen jeder zwei Teile hat. Die Violinstimme bewegt sich im Umfang der ersten Lage und in durchaus einfacher, nach keiner Seite hin sich auszeichnender Gestaltung. Allem Anschein nach ist dieses Stück seiner Beschaffenheit gemäß als eine Jugend- und zugleich wohl auch als eine Gelegenheitsarbeit zu betrachten. Auf letztere deutet die Dedikation » Al Signor Gian Battista Magni Giovanetto di molto aspettatione nel Violino« hin. Daß es sich hier aber auch um eine Jugendarbeit Marinis handelt, beweisen dessen 1655, also 35 Jahre später veröffentlichten Violinkompositionen, welche von wesentlich besserer Qualität sind, als das soeben erwähnte Musikstück. Marini lebte vom Ende des 16. Jahrhunderts etwa bis um 1660, er wurde in Brescia geboren, war dort, in Venedig, Parma, dann eine lange Reihe von Jahren am kurpfälzischen Hofe zu Neuburg tätig (1626-1641), wo er auch geadelt wurde, und starb in Padua. Ein vollständiges Verzeichnis seiner erhaltenen Kompositionen in Eitners Quellenlexikon und Riemanns Musiklexikon.
Von ähnlicher primitiver Bildweise ist eine für Violine Solo gesetzte Toccata Paolo Quagliatis in dessen 1623 zu Rom erschienenem, aus zwei- und dreistimmigen Gesängen bestehenden Vokalwerk » La sfera armoniosa«. In diesem Stück sind vom Komponisten offenbar nur die notwendigsten Tonfolgen notiert; er rechnete jedenfalls bei der Ausführung auf die zu jener Zeit übliche, in verschiedenartigen Verzierungen und Läufern sich ergehende Improvisation des Violinspielers. Diese Vortragsmanier wurde Ornamentier- oder Kolorierkunst genannt. Wo die Verzierungen vom Komponisten vorgeschrieben waren, wie z. B. in den als Muster für die Musikpraxis jener Zeit geltenden Tokkaten Claudio Merulos, Andrea und Giovanni Gabrielis, oder auch in den »Intonationen« der beiden letzteren Meister, kam selbstverständlich das improvisatorische Moment nicht weiter in Frage Der Herausgeber erinnert sich, in einem Aufsatze A. Scherings (Bach-Jahrbuch 1904) gelesen zu haben, daß die Unkenntnis oder nicht genügende Kenntnis dieser Praxis zu so unzutreffenden Urteilen geführt habe, wie diejenigen Wasielewskis über ältere Violinmusik. In dieser Allgemeinheit ohne Einschränkung hingestellt liest sich der Satz sehr verwunderlich und muß entschieden zurückgewiesen werden. Nur im Vorbeigehen möchte ich erwähnen, daß Wasielewski die fragliche Praxis sehr wohl kannte, wie nicht nur aus der obigen, sondern auch aus einer Reihe weiterer Stellen des Buches hervorgeht. (Vgl. auch Wasielewskis Schrift: Geschichte der Instrumentalmusik im XVI. Jahrhundert, S. 106-109.) Was aber die Berücksichtigung und das Urteil angeht, so war der Verfasser allerdings entschieden nicht der Meinung, daß ein langsamer Satz, von dem der Komponist nur die dürftigsten Tonfolgen notiert hat und die Belebung dieses Skeletts dem Improvisationstalent des Vortragenden anheimstellt, eben hierdurch besser würde. Vielmehr zieht Wasielewski daraus den Schluß, daß der betr. Komponist im Adagio nicht viel Besonderes zu sagen hatte. Wäre das letztere der Fall gewesen, so hätte er es wohl auch getan, da die Noten eines langsamen Satzes nicht schwieriger zu schreiben sind als die eines lebhaften. »Aber es war damals so Mode.« Gewiß war es das, nur beweist das nicht, daß die betreffenden Komponisten ihre tiefempfundenen langsamen Sätze mit sich in die Grube genommen haben – oder was sonst soll es beweisen, wenn nicht, daß sie im Adagio Besseres hätten leisten können, als die meisten getan. Soviel ist wohl richtig: hätte ein Verbot gegen das Ornamentieren erlassen und durchgeführt werden können, so wären die Komponisten gezwungen gewesen, ihre langsamen Sätze interessanter zu gestalten. Aber eben das Aufkommen und Einreißen der Ornamentiermode beweist ja schon, wie die Dinge standen. Bereits L. Mozart macht die feine Bemerkung, daß so mancher Virtuose im Allegro noch befriedige oder genüge, dessen Hohlheit beim Adagio sofort zutage trete. Und mutatis mutantis gilt vom Komponisten dasselbe. Die Tiefe und Ausgiebigkeit des eigentlich schöpferischen Vermögens offenbart sich im langsamen Satze unzweideutiger als im Allegro. Warum befriedigt denn ein Corellisches oder Tartinisches Adagio auch ohne, oder doch mit sparsamen Verzierungen? Und was heißt Ornamentieren anders, als die Schwäche der musikalischen Substanz oder auch die des Vortragenden mit vielen kleinen Tönen zudecken? Es ist charakteristisch, daß gerade die übelberufensten Virtuosen, wie Lolli und Boucher, der Verzierungsmanie ausbündig huldigten, und daß die einsichtigsten Musiker, wie etwa L. Mozart (auch andere), ihr mit scharfer Mißbilligung und Spott entgegentraten. Zwar handelte es sich hierbei zunächst um Ausartungen, indem schließlich auch da verziert wurde, wo es nicht in der Absicht des Komponisten gelegen hatte, während seitens derjenigen Komponisten, die diese Notiz veranlassen, auf die Improvisation des Spielers von Haus aus gerechnet wurde. Eine geschmack- und maßvolle Ornamentik ist daher bei solchen Sätzen auch heute notwendig, und es ist nützlich, über die Grundsätze einer solchen sich zu verständigen. Nur muß festgehalten werden, daß das ästhetische Urteil sich an das halten muß, was der Künstler geschaffen, und nicht an das, was andere hinzugetan. Daß die betr. Erscheinung kunsthistorisch verständlich ist, heißt nicht, daß zuliebe dieses Verstehens die Beurteilung der künstlerischen Werte sich verschieben müßte. Wir leiden heutzutage gerade genug an diesem Mißverständnis, als daß man ihm nicht überall, wo es sich geltend macht, entgegentreten müßte. Sind Erscheinungen, die wir ohne Widerrede als Ausartung empfinden (z. B. das absolute Virtuosentum oder dekadente Literaturerzeugnisse), nicht kunsthistorisch und psychologisch verständlich? oder müssen es sein? Aber werden sie deshalb lobenswert? Wenn alles verstehen alles verzeihen heißt, so heißt es doch nicht alles löblich finden.. Quagliati wirkte in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts in Rom.
Ein Jahr nach dem Erscheinen von Quagliatis » La sfera armoniosa« veröffentlichte Francesco Turini, geb. um 1590 zu Prag, gest. in Brescia 1656, bei Bartolomeo Magni in Venedig folgendes Werk: » Madrigali à una, due, tre voci, con alcune sonate à 2 e 3, libro primo e secondo. 1624 Ein Exemplar dieses Turinischen Werkes besitzt die Breslauer Stadtbibliothek. Die Bekanntschaft mit den darin befindlichen »Sonaten« verdanke ich der besonderen Güte des Herrn Dr. Emil Bohn in Breslau..« Die drei darin befindlichen »Sonaten« sind für zwei Violinen und Baß gesetzt. Sie lassen den für seine Zeit gewandten Kontrapunktisten erkennen, zeigen aber weder in betreff der Geigenbehandlung noch in formeller Hinsicht irgend einen Fortschritt gegen Giov. Gabrieli.
Mehr Interesse als die beiden vorerwähnten Violinsätze Marinis und Quagliatis gewähren die Geigenkompositionen des Mantuaners Carlo Farina, und zwar schon deshalb, weil sie Tonstücke mit der Bezeichnung » Sonata« enthalten.
Farina muß, wie aus dessen Berufung nach Dresden an den kursächsischen Hof (um 1625) geschlossen werden darf Etwa 10 Jahre später war Farina bei der Danziger Ratsmusik angestellt., ein für seine Zeit ausgezeichneter Violinist gewesen sein. Dort führte er sich durch sein erstes, dem Kurfürsten Johann Georg I. gewidmetes Kompositionswerk ein, welches unter folgendem Titel in der sächsischen Hauptstadt erschien:
» Libro delle Pavane, Gagliarde, Brando, Mascherata, Aria Franzesa, Volte, Balletti, Sonate, Canzone à 2. 3. 4. Voci, con il Basso per Sonare, di Carlo Farina Mantovano, Sonatore di Violino dell' Serenissimo Elettore di Sassonia dedicato all' istessa Serenissima Altezza. Novamente compost & dato in luce. Dresdae apresso Wolfgango Seiffert. Anno 1626 Die in meiner Schrift: »Die Violine im 17. Jahrh.« usw. (Bonn bei Cohen) Seite 28 ausgesprochene Vermutung, daß das obige Werk Farinas verloren gegangen sein möchte, hat sich als nicht zutreffend erwiesen. In der Landesbibliothek zu Kassel ist neuerdings ein vollständiges Exemplar sämtlicher von Farina veröffentlichter Kompositionen aufgefunden worden, während in Dresden, wo der italienische Künstler lebte und wirkte, nur der » Cantus« von dem zweiten seiner 1626 erschienenen Werke existiert. Das Vorhandensein von Farinas Werken in der Kasseler Bibliothek erklärt sich aus den nahen Beziehungen des kursächsischen zum landgräfl. hessischen Hofe. In dem dritten von Farina herausgegebenen und dem Landgrafen Georg II. von Hessen (Schwiegersohn Joh. Georgs v. Sachsen) gewidmeten Werke befindet sich eine Gagliarde à 4 voci mit folgender Überschrift: » Questa Gagliarda e stata Sonata & cantata in Ecco, sopra le nozze dell' Eccellentissimo Landgrafia d'Hassia quando fu rappresentata in musica la Comedia della Dafne (Oper v. Schütz) à Torga.«.«
Dieses Werk enthält sechs Pavanen, sechs Gagliarden, 1 Brando (franz. Bransle) zu 20 Teilen, eine Mascherata zu 20 Teilen, eine Aria franzesa und drei Volten. Sämtliche Tonsätze sind durchgehends vierstimmig. Sodann folgen an dreistimmigen Stücken: zwei Balletti, drei Sonaten, und an zweistimmigen zwei Sonaten und eine Kanzone. Die Sonaten sind betitelt: » la Polaca«, » la Capriola«, » la Moretta«, » la Franzesina« und » la Farina«. Die Kanzone führt die Überschrift » la Marina«.
Da die selten gewordenen Werke Farinas wichtige Bedeutung für die kunstgemäßen Anfänge des Violinspiels und der Violinkomposition haben, so mögen die Titel der auf die soeben zitierte Sammlung noch folgenden Bücher hier wörtlich angeführt werden. Es erschien zunächst:
»Ander Teil Newer Gagliarden, Couranten, Frantzösische Arien, benebenst einem kurtzweiligen Quodlibet, von allerhand seltzsamen Inventionen, dergleichen vorhin im Druck nie gesehen worden, Sampt etlichen Teutschen Täntzen, alles auf Violen anmutig zu gebrauchen. Mit Vier Stimmen. Bestellet durch Carlo Farina von Mantua, Churf. Durchl. zu Sachsen bestalten Violisten, Dreßden, gedruckt in der Churf. S. Buchdruckerey durch Gimel Bergen. In Vorlegung des Authoris. Anno M. D. C. XXVII.«
Es sind in dieser Sammlung außer dem »kurtzweiligen Quodlibet« enthalten: Vier Pavanen, acht Gagliarden, zwölf Correnten, zwei französische Arien und drei Balletti allemanni. Das Werk ist der Kurfürstin Magdalena Sibylla, geb. Markgräfin zu Brandenburg, gewidmet. Die Zueignungsschrift trägt das Datum des ersten Januar 1627.
Demnächst folgt: » Il terzo libro delle Pavane, Gagliarde, Brandl, Mascherata, Arie franzese, Volte, Corrente, Sinfonie à 3. 4. Voci, con il Basso per sonare, di Carlo Farina Mantovano etc. etc. In Dresda alle spese dell' istesso autore. Anno M. D. C. XXVII.« Die Zueignung an den Landgrafen Georg von Hessen ist vom 25. März 1627 datiert.
Inhalt: Sechs Pavanen zu 4, acht Gagliarden zu 4, ein Brando zu 4, eine Mascherata zu 4, zwei französische Arien zu 4, drei Volten zu 4, sechs Correnten zu 4 und sechs Symphonien zu 3 Stimmen.
Das folgende Werk ist betitelt: » Il quarto libro delle Pavane, Gagliarde, Balletti, Volte, Passamezi, Sonate, Canzon: à 2. 3 & 4. voci, con il Basso per sonare di Carlo Farina etc. Novamente composto et dato in luce, dedicato all' Eccellentissimo & Reverendissimo Principe & Sig. Cardinal Ernest d'Harrach Arcivescovo di Praga etc. Anno 1628. In Dresda. Appresso Gio: Göckeritz, Musico dell' Serenissimo Elettore di Sassonia.« Die Dedikationsschrift ist vom 1. März 1628.
Der Inhalt des 4. Buches besteht aus vier Pavanen zu 4, vier Gagliarden zu 4, vier Balletten zu 4, drei Volten zu 4, zwei Passamezzi zu 3, zwei Balletten zu 3, zwei Sonaten zu 3 (betitelt la Greca und la Cingara), einer Sonate ( detta la fiama) zu 2, und einem Kanzon ( la Bolognesa) zu 2 Stimmen.
Der Titel des letzten von Farina veröffentlichten Werkes heißt:
»Fünffter Teil Newer Paduanen, Gagliarden, Brandi, Mascharaden, Balletten, Sonaten. Mit 2. 3 und 4. Stimmen auff Violen anmutig zu gebrauchen. Gestellet durch Carolo Farina von Mantua, Churf. Durchl. zu Sachsen bestelten Violisten vnd zugeschrieben dem Wolgebornen Herrn, Herrn Johann Wilhelm, Freyherrn von Schwanberg etc. Gedruckt zu Dresden in der Churf. S. Buchdruckerey durch Gimel Bergen, im 1628. Jahr.«
Die Dedikationsschrift ist datiert: »Dreßden den 20. Aprilis Anno 1628. Unterschrieben ist sie: » Carolo Farina von Mantua, Churf. Sächß. Violista Außer den Bezeichnungen »Violen« und »Violisten« wird hier noch der ungewöhnliche Ausdruck » Violista« gebraucht, was zu der irrigen Meinung verleiten könnte, daß Farina am Dresdener Hofe als Violaspieler angestellt war, während er demselben doch als » Suonatore di Violino« diente, wie auf dem Titel des ersten Werkes ausdrücklich angegeben ist. Es wurde eben, wie auch andere Beispiele zeigen, zu Anfang des 17. Jahrhunderts nicht so genau zwischen den Ausdrücken Violine und Viola unterschieden, wie in späterer Zeit. Giov. Gabrieli gebraucht gelegentlich in seinen Kompositionen demgemäß das Wort Violine für Viola, und Giov. Battista Vitali nennt sich auf einem seiner Werke » Sonatore di Violino da Brazzo«..«
Inhalt: Vier Pavanen zu 4, sechs Gagliarden zu 4, ein Brando zu 4, eine Mascherata zu 4, zwei Ballette zu 4, eine Sonate ( detta la Semplisa) zu 3, und eine Sonate ( detta la desperata) zu 2 Stimmen.
Unsern Anteil nehmen insbesondre die in diesen fünf Musiksammlungen enthaltenen Sonatensätze in Anspruch. Farina hat in denselben wohlweislich von der durch Gabrieli eingeführten Vielstimmigkeit der instrumentalen Komposition abgesehen: er war, wie sich aus seinen Arbeiten leicht erkennen läßt, der polyphonen Schreibweise keineswegs in dem Maße gewachsen, um kompliziertere Gebilde unternehmen zu können, und demgemäß geht er nicht über den vierstimmigen Satz hinaus. Dagegen schließt er sich dem von Gabrieli befolgten Prinzip der formellen Gestaltung an. Dieses Prinzip bestand darin, eine gewisse Anzahl in keiner wesentlichen Beziehung zueinander stehender Sätze, von denen jeder einzelne ein bestimmtes, imitatorisch durchgeführtes Motiv enthält, unter gelegentlicher Einschiebung von Zwischengliedern zu einem größeren ganzen Tonbau zu vereinigen.
Sodann hat Farina auch die durch Gabrieli von dessen Kanzonengestaltung auf die » Sonata« übertragene dreiteilige Anordnung adoptiert, und zwar derart, daß der mittlere, im Tripeltakt stehende Satz von zwei Stücken in gerader Taktart eingeschlossen wird. In der Regel ist der erste Satz der längere, ausgedehntere, der dritte dagegen der kürzere. Bei diesem letzteren Stück, welches mehr wie ein kurzes Postludium wirkt, ist es denn auch, einzelne Ausnahmen abgerechnet, weniger auf die Anwendung der soeben erläuterten formellen Bildweise abgesehen.
Der Instrumentalsatz Farinas zeugt von einem leicht und bequem produzierenden Talent. Zugleich offenbart derselbe aber auch alle jene Mängel, welche den Arbeiten der meisten Tonsetzer jener Periode anhaften. Häufig fehlt es diesen noch in harmonisch modulatorischer Beziehung an Bestimmtheit und voller Klarheit, eine Erscheinung, die mit dem damals herrschenden Übergangsstadium aus dem diatonischen in das chromatische Tonsystem zusammenhängt. Alle Kompositionen von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ab bis zur Mitte des 17. lassen dies mehr oder weniger, und keineswegs zu ihrem Vorteil, erkennen.
Aber auch sonsthin finden sich bei Farina, und ebensowohl bei den Instrumentalkomponisten der nächsten Folgezeit, wie hier vorgreifend bemerkt sei, teils Unbehilflichkeiten, teils Unsauberkeiten des Satzes an rhythmischen Stillständen, übeltönenden Fortschreitungen und Zusammenklängen, unsymmetrischen Perioden, – Erscheinungen, die ganz allmählich erst im Verlaufe vieler Dezennien überwunden wurden. Indessen haben trotz alledem diese Leistungen eine nicht zu verkennende wichtige Bedeutung. Sie bilden die notwendigen Zwischenglieder in dem Entwicklungsgange der instrumentalen Kunst, ohne welche diese nicht zu ihrer Vervollkommnung gelangt wäre.
Farina hat sich, wie das Verzeichnis seiner Kompositionen ergibt, nach dem Vorgange G. Gabrielis auch in der Instrumentalkanzone versucht; doch wird aus dieser die Bedeutung, welche er für die Violinkomposition und das Violinspiel hat, nicht so anschaulich wie aus seinen drei- und zweistimmigen »Sonaten«. Die letzteren geben die deutlichste Vorstellung von Farinas Geigentechnik. Man ersieht aus ihnen, daß er einen bereits weit vorgeschrittenen Standpunkt im Vergleich zu andern gleichzeitigen und selbst spätern Erzeugnissen dieser Gattung erreicht hatte. Mannigfaltig entwickelte und schnell bewegte Figuration, welche bis in die dritte Lage hinaufsteigt, und in einzelnen Fällen sogar doppelgriffige Kombinationen kennzeichnen die ungewöhnliche Gewandtheit des damals ohne Frage hervorragenden Geigenmeisters. Dabei benutzte er, wie bereits vor ihm der Brescianer Francesco Turini, gelegentlich auch schon die G-Saite In meiner wiederholt zitierten Schrift: »Die Violine im 17. Jahrhundert und die Anfänge der Instrumentalkomposition« habe ich S. 36 gesagt, daß die Benutzung der G-Saite zuerst in Tarquino Merulas Kompositionen erfolgt sei, welche einige Jahre später im Druck erschienen, als die damals mir noch nicht zugänglich gewesenen Turinischen und Farinaschen..
Es ist hier noch eine umfangreichere Arbeit Farinas, nämlich das Capriccio stravagante in Betracht zu ziehen, welches sich in dem zweiten, zu Anfang des Jahres 1627 von ihm veröffentlichten Sammelwerke befindet.
Vorzugsweise erregt dieses, auf dem Titel des betreffenden Werkes als »kurtzweiliges Quodlibet« bezeichnete Capriccio stravagante Dieses Musikstück habe ich bereits in der ersten Auflage meines Buches, soweit es die damals allein mir zugänglich gewesene erste Stimme ( Cantus) gestattete, eingehend besprochen. Gegenwärtig bin ich, nachdem ich die in der Kasseler Bibliothek vollständig vorhandene Ausgabe von Farinas Werken benutzen konnte, in der Lage, ein abschließendes Urteil über das Capriccio stravagante fällen zu dürfen. unsre Aufmerksamkeit dadurch, daß in ihm der erste, allerdings ziemlich grotesk ausfallende Versuch gemacht wird, das vielseitige Ausdrucksvermögen der Violine zur Geltung zu bringen. Von dem Drang nach charakteristischer Tonsprache geleitet, verlor sich Farina dabei in eine grob materialistische Richtung, was ihm indessen um so weniger zum Vorwurf gemacht werden kann, als seine Zeit noch nicht für den Ausdruck jener tondichterischen Stimmungen reif war, welche in den instrumentalen Werken unsrer Kunstheroen so wunderbar schöne Blüten getrieben haben. Man steckte eben noch viel zu sehr in den Mühen und Sorgen um die technisch formale Musikgestaltung, um schon mit künstlerisch durchgebildetem Sinn die mannigfachen Regungen und Aufwallungen des Gemüts- und Seelenlebens in Tönen, ohne Zuhilfenahme des dichterischen Wortes, widerspiegeln zu können.
Das Streben nach Tonmalerei war in jener Zeit keineswegs durchaus neu. Bereits in einem dem 16. Jahrhundert angehörenden Werk wird der absonderliche Versuch gemacht, ein Schlachtengemälde auf der Laute geben zu wollen. Nicht zu verwundern ist es daher, wenn Farina es unternahm, mittelst der weit ausdrucksfähigeren Geige allerhand »seltzsame Inventionen« darzustellen, d. h. Tierlaute und verschiedene Instrumente nachzuahmen.
Man könnte sich versucht fühlen, das kurzweilige Quodlibet Farinas für einen burlesken Faschingschwank zu halten, wenn aus den am Schlusse dieses Stückes gegebenen Erläuterungen Diese Erläuterungen sind nur in dem auf der Dresdener Bibliothek befindlichen » Canto« des fraglichen Werkes zu finden. In dem vollständigen Kasseler Exemplar fehlen sie merkwürdigerweise. nicht zu ersehen wäre, mit welchem Ernst und mit welcher Wichtigkeit der Verfasser seinen Gegenstand behandelt. So sagt er u. a.: »das Katzengeschrey anlanget wird folgender gestalt gemacht, daß man mit einem Finger manchen Ton, da die Noten stehen, mehlichen unterwartz zu sich zeuhet, da aber die Semifusen geschrieben sein, muß man mit dem Bogen bald vor, bald hinter den Steak (Steg) vffs ärgste und geschwindeste als man kan faren, auff die weise wie die Katzen letzlichen, nach dem sie sich gebissen vnd jetzo außreissen, zu thun pflegen.«
Andere Fingerzeige gibt der Autor für die Ausführung des Lagenwechsels, der Doppelgriffe, des Tremolo, sowie für die Imitation des Flautino (die Flöten still, stille), des » Fifferino della Soldatesca« (Soldatenpfeifchen), des »Hundegebells« und der » Chitarra spagnuola« (spanische Zither), – ein Beweis, daß diese Art, die Violine zu benutzen, neu war.
An weiteren Kuriositäten enthält das kurzweilige Quodlibet die Nachahmung des » Pfifferino« (klein Schalmeygen), der »Pauken oder Soldatentrommel« ( il tamburo), der »Heerpauken« ( gnachere), der »Trommeten« ( la trombetta), des » Clarino« (Clarin), der » Lyra« (Leyer), der » Lyra variata« (die Leyer vff ein ander Art), des »Tremulant« ( il tremulo), sowie des Hahnengeschreis ( gallo) und des Hennengegackers ( gallina).
Alle diese in musikalischer Hinsicht völlig wertlosen Kunststücke ergeben eine große Mannigfaltigkeit an Spielmanieren im Umfange der drei ersten Lagen, welche Zeugnis von einer schon weit entwickelten Finger- und Bogenfertigkeit ablegen. Auffallend ist es, daß im Verlauf des langen Stückes nicht ein einziges Mal vom Triller Gebrauch gemacht wird, der übrigens auch in den Sonaten Farinas nur ganz vereinzelt, in Zweiunddreißigstel-Noten ausgeschrieben, vorkommt, während er in den früher erschienenen Tokkaten usw. von Claudio Merulo und den beiden Gabrielis vielfach benutzt ist.
Werfen wir schließlich noch einen Gesamtblick auf die musikalische Gestaltung des Capriccio stravagante. Dasselbe besteht aus einer großen Zahl kleiner, mosaik- oder vielmehr potpourriartig aneinander gefügter Tonsätze, die, wie schon aus dem vorstehend Gesagten entnommen werden kann, von verschiedenartigstem, mannigfaltigstem Gepräge sind. Der bunte, völlig zusammenhanglose Eindruck des Ganzen wird noch durch einige hier und da eingeschobene Zwischensätze im langsamen ( Adagio) und geschwinden ( Presto) Tempo wesentlich verstärkt. Der Satz ist durchgehends vierstimmig. Indessen erweisen sich die drei unteren Stimmen, wenn sie an einzelnen Stellen auch imitatorisch gehalten sind, im allgemeinen als einfach begleitende, harmoniebestimmende. Die Violinpartie, welcher die erste bevorzugte Stimme zufällt, bekommt dadurch etwas Obligates, Solistisches, wie denn auch in einigen Partien der Komposition sich eine entschieden virtuose Tendenz hervordrängt. Überdies ist die klangliche Gesamtwirkung nicht allein mehrenteils ziemlich dürftig, sondern stellenweise, wie z. B. bei der sehr naturalistisch gehaltenen Nachahmung des Katzengeschreies, auch geradezu abstoßend. Kann solchergestalt das kurzweilige Quodlibet seiner Totalität nach nur als ein Musikstück von untergeordneter Bedeutung bezeichnet werden, so ist doch nicht zu verkennen, daß Farina sich in ihm um die Förderung der Geigentechnik in nicht geringem Maße verdient gemacht hat, weshalb denn eine nähere Beleuchtung desselben dem Zweck dieser Blätter angemessen erschien.
Ähnliches wie von Farinas Tonmalereien dürfte von den Sonaten für 2, 3 und 4 Instrumente gelten, die Stefano Pasino im Jahre 1679 erscheinen ließ und die wir deshalb trotz ihrer späteren Entstehungszeit an dieser Stelle erwähnen. Auch er ahmte in einer derselben Tierstimmen nach: Nachtigall, Truthahn, Henne, Kröte usw. Nach Torchi sind die Sonaten musikalisch ungenießbar, zerfahren und geschmacklos, was die in solchen Späßen liegende »Bereicherung« der Technik mehr als aufheben und einen gehörigen Rest auf seiten des schlechten Geschmacks lassen dürfte. Übrigens werden wir später sehen, daß um etwa dieselbe Zeit, wie Pasino, auch ein deutscher Violinist und Komponist, Joh. Jakob Walther, sich in analogen Experimenten erging.
Nächst Farina ist der Brescianer Violinist und Komponist Giambattista Abkürzung von Giovanni Battista. Fontana zu erwähnen, welcher 1630 während derselben in Italien herrschenden Pestepidemie starb, die auch Girolamo Amati dahinraffte. Er gehörte, wie uns von Giov. Battista Reghino, dem Herausgeber der Fontanaschen Sonaten, in der dazu verfaßten Vorrede erzählt wird, zu den »ausgezeichnetsten Violinvirtuosen seiner Zeit«, und wurde als solcher nicht nur in seiner Vaterstadt, sondern auch in Venedig, Rom und Padua gefeiert. In letzterer Stadt starb er.
Von den 1641 durch Reghino veröffentlichten, aber mindestens schon im dritten Dezennium des 17. Jahrhunderts entstandenen Sonaten Fontanas sind sechs ausdrücklich für eine Violine und Baß bestimmt. Die übrigen verteilen sich auf Tonsätze zu einer und zwei Violinen mit und ohne Fagottbegleitung, ausgenommen eine Sonate, welche für drei Violinen gesetzt ist. Der in diesen Musikstücken eingenommene Standpunkt ist sowohl in betreff der formellen Anordnung, sowie bezüglich des Aufgebotes an Mitteln im wesentlichen derselbe wie bei Farina. Und auch die Geigenbehandlung beider Männer bewegt sich ziemlich innerhalb derselben Grenzen. Allein Farinas Schreibweise darf, teilweise wenigstens, den Vorzug größerer Gewandtheit nicht nur in rein musikalischem Betracht, sondern auch in Ansehung der schon komplizierteren Violintechnik beanspruchen. Indessen hatte Fontana als Geiger, nach Reghinos Zeugnis zu urteilen, jedenfalls ungewöhnliche Bedeutung für die Mitlebenden.
Letzteres dürfte auch von dem römischen Geiger Michel Angelo Rossi zu behaupten sein, der sich übrigens auch als Organist und Komponist auszeichnete. Er wurde zu Rom geboren und lebte dort von 1620 bis gegen 1660. Im Jahre 1625 führte er daselbst eine Oper » Erminio sul Giardano« auf. In dem Prolog dieses Werkes gab er selbst die Rolle Apollos. Fétis berichtet, die Vorrede der 1627 veröffentlichten Partitur besage, Rossi habe so liebliche und volle Töne auf seiner Violine hervorgebracht, daß dadurch sein Triumph gerechtfertigt worden sei, als die Musen ihn in einem Wagen (auf der Bühne) herbeigeführt hätten. 1657 gab Rossi heraus: » Intavolatura d'organo e cembalo«. Violinkompositionen von ihm kennt man nicht.
Mehr musikalischen Wert, als die Arbeiten Farinas und Fontanas, haben die Instrumentalkompositionen Giovanni Battista Buonamentes. Gerber führt seinen Namen an, verweist aber bei demselben auf den Artikel Bonometti Gerbers dort gegebener Bericht über Bonometti ist dann von Fétis in seiner Biographie universelle des musiciens mit Hinweglassung des letzten Satzes reproduziert worden.. Mittlerweile ist erkannt, daß es sich um zwei verschiedene Komponisten handelt, wie dies bereits früher vermutet wurde. Giovanni Battista Bonometti gab in Venedig 1615 ein Sammelwerk heraus, » Parnassus musicus etc.« betitelt. Hier haben wir es nur mit Buonamente zu tun, der mit Vornamen ebenfalls Giovanni Battista hieß. Er war um 1626 »Kaiserlicher Hofmusikus« und zehn Jahre später Kapellmeister beim heil. Konvent des S. Francesco in Assisi. Dies geht aus der Überschrift des 6. Buches eines von ihm veranstalteten Sammelwerkes hervor, um dessentwillen er unser Interesse in Anspruch nimmt. Der Titel desselben lautet vollständig: » Sonate et Canzoni a due, tre, quattro, cinque et a sei voci, del Cavalier Gio. Battista Buonamente, Maestro di Capella nel Sacro Convento di S. Francesco d'Assisi, libro sesto, nuovamente dato in luce, con il suo Basso continuo, dedicate al molto Illustre Signor, & Patron mio osservandissimo il Signor Antonio Goretti, con Privilegio. In Venetia, appresso Alessandro Vincenti MDCXXXVI.« Dieses Werk befindet sich in der Landesbibliothek zu Kassel, sowie in der Breslauer Stadtbibliothek (Eitner, Riemann).
Der Inhalt besteht in 5 Sonaten zu 2, 3 Kanzonen zu 2 und 3 Sonaten zu 3 Stimmen (hiervon eine Sonate für 2 Violinen und Basso da brazzo ò fagotto und 2 Sonaten zu 3 Violinen); ferner in 1 Sonate für 4 Violinen, 1 Kanzon für 4 Violinen, 1 Sonate für 2 Violinen und 2 Bässe, 1 Kanzon für 4 Viole da brazzo, und 3 Kanzonen zu 4, 1 Kanzon zu 5, und 1 Sonate zu 5 Stimmen ohne Bestimmung der Instrumente. Endlich enthält die Sammlung noch eine Sonate für 2 Violinen oder Kornette und 4 Tromboni oder Viole da brazzo, sowie 1 Kanzon für 2 Violinen und 4 Tromboni.
Bei Buonamente kehrt zuerst die von G. Gabrieli gepflegte Vielstimmigkeit des Instrumentalsatzes wieder. Geht er auch nicht über den sechsstimmigen Satz hinaus, so tragen doch seine Arbeiten teilweise das bei Gabrieli hervortretende symphonische Gepräge. Ganz unverkennbar hat Buonamente sich die instrumentalen Schöpfungen des venezianischen Meisters, wenn er nicht gar ein Schüler desselben war, zum Muster genommen. Dies geht unzweideutig aus der Anlage und Durchführung seiner Tonsätze, sowie aus Wahl und Zusammenstellung der Instrumente hervor, durch welche das Klangkolorit bestimmt war. Jedenfalls war Buonamente für den damaligen Standpunkt der Instrumentalkomposition eine hervorragende Erscheinung: er zeichnet sich vor den zeitgenössischen Komponisten insbesondere durch größere Klarheit der Struktur und der harmonisch modulatorischen Folge, durch mehrenteils symmetrischen Periodenbau, sowie durch eine wenigstens teilweise befriedigende Gesamtwirkung seiner Erzeugnisse aus.
Im übrigen nimmt er sich, gleich seinen Vordermännern, das mehrgliedrige, oben erläuterte Gestaltungsprinzip des Gabrielischen Sonatensatzes zur Richtschnur, wenn auch nicht mehr mit voller Strenge. Auch wird der Bau der einzelnen, zu einem Ganzen vereinigten, bei ihm schon miteinander kontrastierenden Glieder teilweise ausgeführter, langatmiger. Es finden sich unter Buonamentes Sonaten ein- und dreisätzige. Diese letzteren sind wie bei Farina und Fontana angeordnet, so daß das erste und dritte im geraden Takt stehende Stück durch einen im Tripeltakt stehenden Satz getrennt ist.
Die in dem Sammelwerk Buonamentescher Kompositionen vom Jahr 1636 befindlichen Sonaten für 3 und 4 Violinen sind unverkennbare Nachbildungen der uns überkommenen und schon erwähnten Gabrielischen » Sonata con tre violini«, nur mit dem Unterschied, daß Buonamente die Spieltechnik bis in die dritte Lage ausdehnt. Nehmen sie nach dieser Seite hin nun auch keinen neuen Standpunkt im Vergleich zu Farina ein, so bezeichnen sie doch in musikalischer Hinsicht einen erfreulichen Fortschritt.
Bezüglich der Geigentechnik tut nun aber wiederum Tarquinio Merula Merula ( Cavaliere) war 1623 Kapellmeister an St. Maria zu Bergamo, im nächsten Jahre Organist am Hofe Sigismund III. in Warschau, weiterhin wieder in Oberitalien, zuletzt (1662) in Cremona. Doch erscheinen diese Angaben nicht durchaus sicher. einen bemerkenswerten Schritt vorwärts. So namentlich in seinen, im vierten Dezennium des 17. Jahrhunderts veröffentlichten Instrumentalkompositionen, welche stellenweise einen schnelleren und komplizierteren Lagenwechsel fordern. Insbesondere sind die für jene Zeit neu erscheinenden Oktavengänge aus der dritten in die erste Position hervorzuheben. Sie kommen in dem Kanzon » la Cancelliera« vor und zeigen, daß der ursprünglich dem Vokalsatz nachgebildete Kanzonencharakter sich seit Gabrieli wesentlich umgewandelt und ein mehr instrumentales Gepräge gewonnen hatte, gleichwie die Gesamtgestaltung dieser Kompositionsgattung im formellen Betracht schon merklich den Duktus der überkommenen »Sonate« annimmt. Um die Mitte des 17. Jahrhunderts zeigt sich dieser Prozeß ganz vollzogen. Die Kanzone wird von da ab in den Hintergrund gedrängt, und die »Sonata« gelangt zur alleinigen Herrschast. In einzelnen Fällen sind die Instrumentalsätze als » Sonate ôver Canzoni« bezeichnet, woraus hervorgeht, daß beide Ausdrücke für ein und dieselbe Sache, also ohne prinzipielle Unterscheidung gebraucht werden. So ist es bei den Violinkompositionen Uccellinis, herzoglicher Kapellmeister in Modena, aus dem Jahre 1649, welche folgenden Titel haben:
» Sonate ôver Canzoni da farsi à Violino solo e Basso continuo, opera quinta di D. Marco Uccellini. Capo di Musica del Serenissimo Signore Duca di Modena. In Venetia appresso Alessandro Vincenti. 1649 Befindlich in der Landesbibliothek zu Kassel..«
Dieses Werk enthält 13 Sonaten für Violine und Baß, sowie ein Stück mit der Überschrift: » Trombetta sordina per sonare con un Violino solo.«
Ein anderes Violinwerk Uccellinis sind 33 Sonaten teils für zwei, teils für eine Violine mit Baßbegleitung, das als Op. 4 im Jahre 1645 erschienen, ein drittes zwanzig Korrenten und zehn Arien für Solovioline mit einer zweiten Violine ad libitum. Die Arien dieses letzteren Werkes sind teilweise über damals populäre Melodien komponiert, im übrigen, wie auch die Sonaten, hinsichtlich ihres musikalischen Gehaltes ohne weitere Bedeutung. Auch Torchi nennt neuerdings Uccellinis Kompositionen maniriert und genielos.
Kann man Uccellinis Violinsonaten auch keinen künstlerischen Wert beimessen, so sind sie doch von positiver Bedeutung durch die weit vorgeschrittene instrumentale Technik, welche sich in ihnen offenbart; denn der Spielumfang der Geige ist in denselben bereits bis zur sechsten Lage hinaufgeführt. Von dieser Ausdehnung bieten die bis jetzt zum Vorschein gekommenen Instrumentalkompositionen aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts kein zweites Beispiel. Zwar teilt Winterfeld in den Musikbeilagen zu seinem »Johannes Gabrieli« einen Violinsatz Claudio Monteverdes vom Jahre 1610 mit, welcher bis zum dreigestrichenen f hinaufreicht, doch ist es sehr möglich, daß derselbe für eine kleinere Violine, nach Art der Quartgeige oder »kleinen Diskant-Geige«, wie Prätorius sie nennt, bestimmt war. Diese letztere war in den Tönen c, g, d, a, also eine Quart höher als die Violine, gestimmt. Man konnte also das dreigestrichene f auf ihr erreichen, ohne die dritte Lage zu überschreiten. Uccellini hat aber seine Sonaten für die gewöhnliche Violine geschrieben, was aus dem Gebrauch des G der kleinen Oktave unwiderleglich hervorgeht. Uccellini muß ein Violinist von ganz ungewöhnlicher Begabung mit der Richtung auf das Virtuose gewesen sein. Er bewegt sich in verschiedenartigen Spielmanieren mit großer Freiheit im Umfang von drei vollen Oktaven. Daß er aber nicht allein über eine große Fingergeläufigkeit, sondern auch über eine gewandte, in mannigfachen Stricharten sich ergehende Bogentechnik gebot, geht aus seinen » Sinfonie boscarecie« hervor. In den Musikbeilagen zu meiner Schrift »Die Violine im 17. Jahrhundert« habe ich Beispiele daraus mitgeteilt. Späterhin brachte Uccellini in Florenz und Neapel Opern seiner Komposition zur Aufführung.
Als der gleichen Periode wie die vorangegangenen Künstler angehörig erwähnen wir an dieser Stelle noch Bartolommeo Montalbano da Bologna und Martino Pesenti. Über den ersteren findet sich näheres in des Verfassers Schrift »Die Violine im XVII. Jahrhundert« sowie bei Torchi. Im Jahre 1629 erschienen von ihm in Palermo, wo er an S. Francesco Kapellmeister war, Sinfonien für eine und mehrere (bis 4) Violinen mit Begleitung von Orgel und (zweimal) Posaune. Nach Torchi zeigen die Kompositionen das Bestreben nach charakteristischen Wirkungen sowie nach einem instrumentalen Stil. Speziell sei in einigen die Violine mit reichen Figurationen in brillantem Stile bedacht. Auch gelegentliche Vortragsbezeichnungen sowie Bindebögen kommen bei ihm schon vor.
Von Martino Pesenti, der von Geburt an blind war und um 1600 in Venedig geboren wurde, wissen wir nicht viel. Ein Verzeichnis seiner Werke geben Fétis und Eitner. Torchi rühmt seinen in den Jahren 1630-45 erschienenen, verschiedenen Tanztypen angehörigen Kompositionen melodische Frische und Klarheit nach und findet ihn besonders bestrebt in der innerlichen Ausbildung der Melodie. Er arbeite mit modernen Intentionen.
Die bisher als Belege für die Entwicklung des Violinspiels und der Violinkomposition herangezogenen und betrachteten Kunsterzeugnisse der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nehmen unsere Aufmerksamkeit noch in besonderem Sinne dadurch in Anspruch, daß sich an ihnen das Erwachen und Erstarken des Sinnes für rein instrumental erfundene Musik verfolgen läßt und auch schon darüber hinaus die Anfänge einer eigentlichen Violinliteratur sich bemerklich machen. Wie rasch diese Entwicklung fortschritt, beweist der Umstand, daß nur drei Jahrzehnte später bereits der erste Klassiker des Violinspiels und der Violinkomposition, Corelli, den Schauplatz betritt, während, wie wir sahen, noch bis zum zweiten Viertel des Jahrhunderts die Wahl der Instrumente oft in das Belieben der Ausführenden gestellt blieb.
Die erwähnte Entwicklung erstreckt sich sowohl auf die Erfindung der Motive und Figurationen, die ein immer instrumentaleres Gepräge aufweisen und sich vom Vokalsatz mehr und mehr entfernen, als auch auf die Gestaltung der Tonsätze selber. Es wurde bereits bemerkt, daß die anfangs getrennten Arten der Instrumentalkanzone und der » Sonata« allmählich ineinander aufgegangen waren, woraus sich ein Kunstprodukt ergab, welches bereits die äußere, obwohl nicht schon ein für allemal feststehende Anordnung der späteren Sonatenform erkennen läßt In betreff derselben verweise ich auf meine schon mehrfach zitierte Schrift: »Die Violine im 17. Jahrhundert«, Bonn bei Cohen.. Die Zahl der einzelnen Abschnitte oder Teile des Sonatensatzes war noch mehrfach eine schwankende. In Buonamentes Instrumentalwerken findet sich beispielsweise eine einsätzige Sonate, während unter den von Massimiliano Neri 1645 und 1651 erschienenen Kompositionen dieser Art sich eine aus 7, durch Takt und Tempo voneinander verschiedenen Sätzen gebildete Sonate findet. Ein gleiches ist der Fall bei einer Sonate Bassanis vom Jahre 1683. Aber solche Fälle sind doch nur als Ausnahmen zu bezeichnen. In der Regel war der Sonatensatz von Mitte des 17. Jahrhunderts ab drei- oder vierteilig, wobei eine Abwechselung zwischen geradem und ungeradem Takt beobachtet wurde. Eine derartige Anordnung mußte für die notwendig auf scharf gesonderte Gegensätze hindrängende künstlerische Empfindung ebenso naheliegen, wie das Alternieren von schnelleren und langsameren Zeitmaßen.
Eine Art von Übergang zu der mehrsätzigen Form findet sich in den bereits erwähnten Sonaten Fontanas, die nach seinem Tode im Jahre 1641 herausgegeben wurden. Sie sind noch meist einsätzig, aber die in Takt wie Bewegung kontrastierenden Einzelabschnitte enden mit einer vollständigen Kadenz, nach der eine Pause gemacht werden konnte. In ähnlicher Weise sind Uccellinis Sonaten Op. 4 (1645) als dreisätzig zu bezeichnen, die Tempi: grave, allegro, adagio sind vom Komponisten angegeben. Der erste Tonsetzer jedoch, der eine wirkliche Trennung der Sonate in mehrere (meist 3) Sätze vollzieht, ist der bereits genannte Biagio Marini, der übrigens auch einer der ersten war, die dem Allegro eine langsame Einleitung vorausschickten.
Innerhalb dieser zunächst noch ziemlich äußerlich kontrastierenden Elemente bewegte sich die Sonatenkomposition unter Anwendung kontrapunktischer Künste, welche auf das ursprüngliche Vorbild gewisser Vokalkompositionen zurückdeuten, mehrenteils im zwei-, drei- und vierstimmigen Satz bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Von da ab erfuhr die Sonate eine weitere Durchbildung ihrer einzelnen Teile. Sehr wesentlich wirkte hierbei der Umstand mit, daß dieses Kunstprodukt von dem bezeichneten Zeitpunkt ab für die Klavierkomposition nutzbar gemacht wurde. Und wenn auch die Violinsonate im 18. Jahrhundert nach Corellis Auftreten durch Tartini inhaltlich noch eine Steigerung erfuhr, so war es doch das erwähnte Tasteninstrument, mit dessen Hilfe der Sonatensatz in fortgesetzter formeller Ausgestaltung endlich jene typisch durchgebildete Struktur erhielt, welche zu allgemeinster tonkünstlerischer Geltung gelangte. Dies bewirkte nach dem einflußreichen Vorgange Domenico Scarlattis und Philipp Emanuel Bachs der Großmeister Joseph Haydn. Er faßte die bis dahin gewonnenen Errungenschaften der Sonatenkomposition zusammen und verwertete dieselben insbesondere für den ersten, eigentlichen Sonatensatz mit seiner sinnreich gedachten, planvollen Durchführungstheorie.
Wie hoch nun aber auch dasjenige zu veranschlagen ist, was die eben genannten Männer in der angedeuteten Beziehung geleistet haben, das unvergängliche Verdienst, die entwicklungsfähigen Grundlagen zu der in Rede stehenden, für die moderne Instrumentalkomposition so überaus bedeutsamen und maßgebenden Kunstform gefunden zu haben, gebührt den Italienern. Sie schufen während einer hundertjährigen mühevollen Arbeit jenes wohlgefügte Gerüst, aus welchem nach dessen vollständigem Ausbau schließlich die unvergleichlich schönen und erhabenen Wundergebilde deutschen Geistes und Gemütes, sowie deutscher Phantasie hervorwuchsen.
Es ist hier noch zu erwähnen, daß von Mitte des 17. Jahrhunderts ab eine sorgfältige Unterscheidung zwischen der » Sonata da chiesa« (Kirchensonate) und der » Sonata da camera« (Kammersonate) üblich war. Die katholische Kirche, stets darauf bedacht, ihrem Kultus reichen, auf die Sinne berechneten Schmuck und Glanz zu geben, machte in spekulativer Weise die Künste ihrem Dienste untertan. Skulptur und Malerei waren ihr von jeher tributpflichtig, und noch heute findet man nicht wenig Kirchen in Italien, die eher den Eindruck von reichhaltigen Museen, als von Stätten der Gottesverehrung hinterlassen. In gleicher Weise wurde die Tonkunst, zunächst natürlich die Vokalmusik, zur Dienstleistung herangezogen, und als die Instrumentalmusik ihre ersten Entwicklungsstadien durchlaufen hatte, fügte man auch sie mit besonderer Berücksichtigung des Violinspiels dem musikalischen Teile des Rituale hinzu. So entstanden allmählich Kirchensonate und Kirchenkonzert, die lange Zeit hindurch einen integrierenden Teil der Meßfeierlichkeit bildeten. Gegen eine derartige Anwendung der schönen Künste ist, wenn gewisse Grenzen innegehalten werden, nichts einzuwenden; denn die große Masse, welche nicht leicht die Fähigkeit besitzt, sich aus eigener Kraft zu idealer Betrachtung emporzuschwingen, wird durch künstlerische Medien gemütlich angeregt und damit zugleich aus den werkeltäglichen Vorstellungen unmerklich zu andächtiger Stimmung und religiöser Beschaulichkeit hingeleitet. Vor allem ist hierzu aber die Musik wohlgeeignet.
Wurde solchergestalt einerseits die Anwendung der Tonkunst zu rituellen Zwecken gewinnreich für die Hebung religiösen Sinnes, so war mit derselben andererseits ein wesentlicher Vorteil für die Künstler sowohl wie auch für das Publikum verbunden. Die ersteren fanden Gelegenheit, ihre Kräfte in öffentlichen, von allen Ständen besuchten Versammlungen zu entfalten; das letztere wurde in unbeschränktem Maße der Annehmlichkeit teilhaftig, seinen Geschmack zu bilden, und die solchergestalt popularisierte Kunst des Violinspiels erwarb sich zahlreiche Freunde, Förderer und zugleich einen ansehnlichen Zuwachs an jugendlichen, der Pflege des anziehenden Instrumentes sich widmenden Kräften. War die katholische Kirche durch die Ausbeutung der bildenden Künste einem Museum vergleichbar, so erinnerte sie in musikalischer Beziehung an einen Konzertsaal, ein Verhältnis, das in Italien noch gegenwärtig, wenn auch mehrenteils mit einem starken Beigeschmack von Profanation fortbesteht.
Die Kirchensonate bestand aus Tonstücken freier Erfindung in wechselnder Bewegung und Taktart und war ihrer Bestimmung gemäß, die gottesdienstliche Handlung verherrlichen zu helfen, von feierlich ernstem, würdevollem Gepräge. Im Zusammenhange damit steht die in ihr vorzugsweise zur Anwendung gebrachte strengere kontrapunktische Gestaltungsweise, welche vereint mit der hier geoffenbarten Idealrichtung den Ausgangspunkt für das höher stilisierte Tonschaffen der Folgezeit im Gebiete des Instrumentalen bildet. Die Kirchensonate begann in der Regel mit einem breiter ausgeführten Satze lebendigeren Charakters im Vierviertel-Takt, auf welchen ein ruhig getragenes, gravitätisches Stück im Tripel-Takt folgte. Den Beschluß macht dann, wenn die Komposition dreisätzig war, wiederum ein in bewegterem Tempo gehaltener Satz in meist knapper Fassung. Bei jenen Sonaten, welche aus einer größeren Anzahl von Sätzen bestanden, waren die einzelnen Teile von kürzerem Umfang und mitunter sogar nur einige Takte lang. Der Wechsel von gerader und ungerader Bewegung wurde aber auch hier beobachtet. In den lebhaft gehaltenen Sätzen spielte das Fugato eine wesentliche Rolle.
Der Kirchensonate entgegengesetzt war die Anordnung der Kammersonate. Sie diente hauptsächlich zur Kultivierung der verschiedenen Tanzformen mit ihren Abarten der »Aria«, der »Mascherata«, des »Balletts« usw. Mehrenteils wurden die in der Kammersonate zusammengestellten Tonsätze durch ein kurzes Largo oder Adagio eingeleitet, für welches die Bezeichnung » Intrada« nicht ungebräuchlich war. Eine feste Ordnung der Tanzstücke scheint erst allmählich bei der Kammersonate eingeführt worden zu sein. Nach und nach näherte sich dieselbe aber dem Charakter der Kirchensonate dadurch, daß ihr Tonstücke freier Erfindung von ernst gehaltenem Ausdruck einverleibt wurden. Hierdurch gewann die Kammersonate immer mehr Ähnlichkeit mit der Kirchensonate, so daß beide Arten zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts nicht mehr zu unterscheiden waren. Das eigentümliche Wesen der Kammersonate ging indessen dadurch nicht verloren: sie lebte als »Suite« (gleichbedeutend mit Partite oder Partie) im 18. Jahrhundert neben der Sonate selbständig noch eine geraume Zeit hindurch fort und scheint neuerdings eher wieder modern zu werden.
Die gebräuchlichsten Tänze des 17. Jahrhunderts waren: die Pavane, Corrente, Gagliarde, Giga, Sarabande, Allemande, Volte, Passacaglia, sowie der Brando (franz. Bransle), Passamezzo und Menuett.
Manche dieser Tänze befruchteten nicht allein die frei erfundene Instrumentalkomposition, wie dies z. B. in betreff des 6/8- und 12/8-Taktes der Giga augenfällig ist, sondern gingen auch, nachdem sie einen idealen Zug angenommen hatten, in das Gebiet der höher stilisierten Komposition über.
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts waren es zunächst die italienischen Meister Massimiliano Neri und Giovanni Legrenzi, welche sich mit dem Sonatensatz befaßten. Sie förderten denselben nicht sowohl mit spezieller Beziehung auf das Violinspiel, als vielmehr auf rein musikalische Zwecke. Hier gab es für die Instrumentalkomposition noch viel zu tun, ehe sie höheren künstlerischen Anforderungen zu entsprechen vermochte. Vor allem hatte man auf einen größeren Wohllaut des Zusammenklanges der verschiedenen Stimmen eines Musikstückes das Augenmerk zu richten. Sodann war auch das modulatorische Element einer sorgfältigeren Behandlung zu unterziehen, die Rhythmik mehr zu vermannigfaltigen und der Periodenbau mit Rücksicht auf klare, symmetrische Verhältnisse abzurunden. In diesen Beziehungen erwarb sich namentlich Legrenzi Verdienste. Mit besonderem Geschick behandelte er auch die Chromatik, deren Anwendung in ausgedehnterem Maße übrigens schon von Farina in dessen Sonate » la desperata« für den charakteristischen Ausdruck versucht wurde.
Auf Legrenzi folgt eine bedeutende Zahl strebsamer Tonsetzer Oberitaliens, von denen hier nur solche als bemerkenswert hervorgehoben seien, welche zugleich Violinspieler von Fach waren. Diese sind: Giovanni Battista Vitali, Giovanni Battista Bassani, Giuseppe Torelli, Tommaso Antonio Vitali und Antonio Veracini.
Giov. Battista Vitali, um 1644 in Cremona geboren, war Kompositionsschüler des Maurizio Cazzati. Dann begann er seine Laufbahn als » Sonatore di Violino Brazzo«, wie er sich selbst auf dem Titel seines ersten gedruckten Werkes nennt, im Orchester der Hauptkirche S. Petronio zu Bologna. Vom 1. Dezember 1674 bis zu seinem am 12. Oktober 1692 erfolgten Tode war er Mitglied der herzoglichen Kapelle in Modena.
Vitali hat als Komponist hauptsächlich die Kammersonate kultiviert und namentlich durch bestimmtere Ausprägung der melodieführenden Stimme, sowie durch klare und gewandte Behandlung der zu seiner Zeit üblichen Tanzformen diese Kompositionsgattung vorwärts gebracht. Gleichzeitig ist er als einer der ersten zu bezeichnen, welche die Kammersonate durch Einschaltung größerer, frei erfundener Instrumentalsätze im Stil der Kirchensonate zu bereichern und ihr mehr musikalisches Gewicht zu geben versuchten.
Aber auch für die Kirchensonate selbst ist er nicht ohne Bedeutung durch das Streben nach charakteristischem, teilweise schon vom konventionellen Zwange sich befreiendem Ausdruck.
Nach Torchi war Vitali einer der vorgeschrittensten und originellsten Musiker, außerdem einer der besten Violinisten seiner Zeit. Unter seinen zahlreichen Werken, von denen viele der Vokalmusik angehören, sind die ersten Instrumentalkompositionen » Correnti e balletti da camera a due violini e basso continuo«. Sie tragen noch sehr einfachen Charakter und erschienen 1666. Dann folgen im Jahre 1668 Sonaten für zwei Violinen und Baß, 12 an der Zahl, weiterhin wieder balletti, Sonaten für mehrere Instrumente (bis 5) und noch eine Reihe gleichartiger Werke bis zum Schlusse des Jahrhunderts. Seine Sonaten sind nach unserem Gewährsmann nicht nur an interessanten Themen und Einzelzügen reich, sondern offenbaren mit als die ersten eine innere musikalische Einheitlichkeit des Charakters an Stelle einer mehr zufälligen Zusammenordnung mehrerer Stücke unter einen gemeinsamen Namen Vitali gehört, wie Torchi angibt, zu den nicht zahlreichen Komponisten, die eine in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einreißende Entartung des Geschmacks an sich selbst überwanden und dadurch den schon damals gelegentlich drohenden, später zur Tatsache werdenden Verfall der italienischen Musik hintanhielten. Hierdurch würde seinen Werken, die Torchi ausführlich bespricht, noch eine besondere kunsthistorische Bedeutung zukommen. Auch das Menuett soll zum erstenmal bei ihm in der italienischen Instrumentalmusik vertreten sein. Wenn aber Torchi das Gleiche auch von dem Scherzo behauptet und zum Beweise den Anfang einer Passacaglia aus Vitalis » Artifici musicali« anführt, so darf man wohl dieser Behauptung und der anschließenden, daß das Scherzo nicht aus dem Menuett entstanden sei, skeptisch begegnen. Von allem anderen abgesehen, ist der als Scherzo bezeichneten Form ein kontrastierender Mittelsatz wesentlich, der bei Virali fehlt. – Der Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt, daß in dem letztgenannten Werke Vitalis eine Reihe seltsamer Kuriositäten vorkommen: Kanons, in denen bestimmte Töne vermieden sind, Krebs- und Zirkelkanons, sowie vierstimmige Sätze, die zweistimmig notiert sind – die beiden andern Instrumente spielen die aufgeschriebenen zwei Stimmen von rückwärts(!) – und ähnliche Späße, die beweisen, daß Vitali eine Neigung zu dergleichen besaß..
In derselben Richtung, aber mit noch mehr Erfolg war Giovanni Battista Bassani, geb. gegen 1657 in Padua, gest. 1716 in Ferrara, als Instrumentalkomponist tätig. Dieser Künstler fordert unsere besondere Aufmerksamkeit als Lehrer Corellis, des ersten epochemachenden Violinmeisters.
Bassani bildete sich unter Anleitung des Franziskanerpriesters und Opernkomponisten Castrovillari in Venedig, wurde zunächst Organist und Musikmeister der Ordensbruderschaft » della morte« in Modena, 1680 Musikdirektor an der Basilika S. Petronio zu Bologna und endlich 1690 Kapellmeister in Ferrara, wo er starb. Durch seine vielseitige kompositorische Tätigkeit – er war auch im vokalen Gebiet als Tonsetzer vielfach tätig – hatte er sich ungewöhnliche Gewandtheit sowohl im strengen, wie im freien Stil angeeignet, die auch seinen Instrumentalwerken eigen ist und sich namentlich in den Allegrosätzen durch klare, saubere und abgerundete Gestaltungsweise offenbart.
Es existieren zwei Instrumentalwerke Bassanis im Druck, von denen das eine der Kammer- und das andere der Kirchensonate gewidmet ist. Nach beiden Richtungen hin tritt er nicht bahnbrechend oder auch nur erweiternd auf. Vielmehr bewegt er sich in den Grenzen der Überlieferung. Allein die Behandlung des Ganzen, sowie die organische Durchbildung des Details, läßt eine höhere Stufe der Meisterschaft gegen die Vordermänner erkennen. Bassani war ein sehr geschickter Violinspieler, wie denn auch seine Behandlung der Geige durchaus sachgemäß ist, ohne sich indessen in technischer Beziehung auszuzeichnen.
Mehr war dies bei Giuseppe Torelli der Fall. Im Besitz einer natürlich ungezwungenen Gestaltungsgabe schuf er eine ziemlich große Reihe von Werken, in denen die Technik des Violinspiels einen bedeutenden Schritt vorwärts tut. Und dies nicht allein im Passagen-, sondern auch im doppelgriffigen und sogar im akkordischen Spiel. Hierin zeigt er unverkennbar eine entschiedene Überlegenheit über die vorhergehenden Meister, zugleich aber auch eine bravourmäßige, virtuosisch gefärbte Tendenz, ohne jedoch (ebensowenig wie seine Vordermänner) die von Uccellini gezogene Grenze des tonlichen Umfanges der Geige zu überschreiten.
Auch in anderer Beziehung bereicherte Torelli die Violinkomposition. Er hatte den glücklichen Gedanken, die überkommene » Sonata« für mehrstimmige Sätze zu verwerten, in denen die Violine auf obligate Art dominierend aus dem Ensemble hervortritt. Hiermit war das Instrumentalkonzert gewissermaßen als Gegenstück zu dem lange schon vorher existierenden Vokalkonzert gegeben.
Für diese seine Erzeugnisse führte Torelli den Namen Concerti ein. Schon 1686 veröffentlichte er als Op. 2 ein » Concerto da camera« (Kammerkonzert) für 2 Violinen und Baß, und außerdem ein » Concertino per camera« für eine Violine und Baß, letzteres ohne Angabe der Jahreszahl und des Druckortes.
Seine bedeutendsten in diese Kategorie gehörenden Arbeiten sind aber die sogenannten » Concerti grossi«, welche ein Jahr nach dem Tode ihres Autors als Op. 8 erschienen. Der Inhalt dieses Werkes besteht aus zwölf Nummern, von denen die eine Hälfte für eine Sologeige mit Begleitung von zwei Ripienviolinen, Bratsche und Baß oder einer großen Laute (arcileuto) und Orgel, die andere dagegen für zwei Soloviolinen mit dem gleichen Akkompagnement gesetzt ist. Mit diesen Konzerten wurde Torelli der Vorläufer für die gleichartigen Kompositionen Corellis, Vivaldis und Tartinis, wobei jedoch zu bemerken ist, daß das Concerto grosso (auch der Name) um dieselbe Zeit an mehreren Stellen auftaucht. Wer ihn zuerst verwendete, ist gleichgültig und in Hinsicht auf die meist zwischen Komposition und Veröffentlichung verstreichende Zeit kaum genau zu bestimmen. Von Lorenzo Gregori, einem ziemlich talentlosen und deshalb auch schnell wieder vergessenen Komponisten jener Tage, sind » Concerti grossi a più stromenti« aus dem Jahre 1698 bekannt geworden, wenig später folgte Alessandro Scarlatti mit gleichartigen Kompositionen. Und auch die Werke dieser Tonsetzer waren nicht ohne Vorgänger, wie in Scherings Buch A. Schering, Geschichte des Instrumentalkonzerts. Leipzig 1905 (Breitkopf & Härtel). S. 38 ff. nachzulesen.
Torellis anderweite Kompositionen sind: eine 1686 erschienene Sonatensammlung für zwei Violinen und Violoncell nebst beziffertem Baß, ein im folgenden Jahre veröffentlichtes Heft » Sinfonien« zu 2, 3 und 4 Streichinstrumenten und Orgel ( Op. 3) nebst Konzerten zu 4 Stimmen ( Op. 5) und eine Sammlung » Concerti musicali« für Streichquartett und Orgel, welche 1698 als Op. 6 ediert wurde. Diese Arbeiten waren, wie die Beteiligung der Orgel ergibt, für die Kirche bestimmt.
Torelli hat auch Kammersonaten für Violine geschrieben. Dieselben entsprechen ihrer Beschaffenheit nach ganz dem Modus der Kirchensonate und enthalten daher keine Tänze mehr, sondern nur noch Musikstücke freier Erfindung im langsamen und bewegten Zeitmaß. Diese Umgestaltung der Kammersonate, zu welcher Giov. Battista Vitali die ersten Versuche machte, wurde von den tonangebenden Meistern des 18. Jahrhunderts adoptiert.
Aus Torellis Schaffen geht hervor, daß dieser Künstler einen lebhaft vordringenden Geist besaß, der für die Fortschritte des Violinspiels und der spezifischen Violinkomposition ungewöhnlich einflußreich wurde. Seine Werke, die den wohlgeübten, gewandten Kontrapunktisten erkennen lassen, sind, wenn auch keineswegs von tieferem Gehalt, so doch von eigentümlichem, und dabei stets natürlich fließendem Ausdruck. Die aus Skalen und Akkorden abgeleitete Figuration ist lebendig, schlank und von rhythmischer Bestimmtheit, selbstverständlich alles dies immer im Geist und Geschmack seiner Zeit. Die langsamen Sätze stehen gegen die schnellen zurück. Sie sind meist kurz und, wie es scheint, nur des äußeren Gegensatzes halber da. Offenbar wußte der Tonsetzer hier noch ebensowenig, wie die allermeisten seiner Zeitgenossen, etwas Besonderes auszusprechen.
Gegen Mitte des 17. Jahrhunderts in Verona geboren, trat Torelli im September 1686 als » suonatore di Violetta« in die Kapelle der S. Petronio-Kirche in Bologna ein. Von 1689 ab wirkte er bei der Tenor-Viola und nach dieser Zeit zugleich auch als Violinspieler in demselben Orchester mit. 1695 und 1700 hielt er sich, wie neuerdings Schering nachgewiesen, in Wien, in der Zwischenzeit als Konzertmeister am markgräflichen Hofe in Ansbach auf. Aber bereits 1701 kehrte er, wie es scheint, durch mangelnde Erfolge verbittert, nach Bologna zurück, wo er im Jahre 1708 starb.
Torelli gehört zu den italienischen Violinmeistern, die teils durch schöpferisches Wirken, teils durch unmittelbare Lehre einen wesentlichen Einfluß auf die Entwicklung deutschen Geigenspiels ausgeübt haben. Es wird deshalb noch weiterhin seiner zu gedenken sein.
Eine wie beachtenswerte Erscheinung neben Torelli der Bologneser Geiger Tommaso Vitali, Sohn des S. 77 genannten Giov. Battista Vitali, war, ist aus einer variierten Ciaconna Dieses Musikstück ist in der von Ferd. David bei Breitkopf und Härtel herausgegebenen »Hohen Schule des Violinspiels« mitgeteilt. Die Abweichungen der Davidschen Bearbeitung vom Original sind freilich, gleichwie bei den meisten anderen in der genannten Sammlung befindlichen Kompositionen, teilweise erheblich. Doch kann man sich danach trotzdem ein annähernd richtiges Bild von Vitalis Schreibweise machen. desselben zu entnehmen. In diesem Tonsatz äußert sich ein durch gehaltvolle Stimmung und geistreiche Behandlung gekennzeichnetes Schaffen, das seinen Schwerpunkt in dem harmonisch Modulatorischen findet. Aus dem kurzen, scharf rhythmisierten Thema ist eine Reihe kontrastierender Variationen entwickelt, deren ornamentale Figuration keineswegs als äußerliche virtuose Zutat, sondern vielmehr als charakteristisch geartete Entwicklungsglieder des Grundgedankens erscheinen. Dieses Erzeugnis erscheint als ein bemerkenswerter Vorläufer der bekannten Bachschen Ciaconna für Violine Solo, die uns freilich erst die Tiefen des tondichterischen Vermögens vollständig erschließt. Die tüchtige musikalische Bildung, welche Tommaso Vitali besaß, wird auch durch dessen Kirchensonaten bezeugt, von denen ein Heft mit zwölf Nummern als Op. 1 im Jahre 1693 zu Modena erschien. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Bologna geboren, gehörte er dem dortigen Orchester von S. Petronio als Violinist an und war von 1677 ab als Führer der Hofkapelle zu Modena tätig. Er soll viele gute Schüler gebildet haben. Doch wird von diesen nur namhaft gemacht:
Girolamo Nicolo Laurenti, der Sohn des zu seiner Zeit angesehenen, 1644 in Bologna geborenen und gleichfalls im Orchester von S. Petronio angestellten Violinisten und Tonsetzers Bartolomeo Girolamo Laurenti. Vor Vitalis Unterricht genoß er denjenigen Torellis. Nach Beendigung des musikalischen Studiums trat er als Violinist in das Orchester der Kathedrale seiner Vaterstadt Bologna. Er starb hier am 26. Dezember 1752. An Kompositionen veröffentlichte er sechs Kirchenkonzerte für Streichinstrumente und Orgel. Sein am 18. Januar 1726 verstorbener Vater gab eine gleiche Anzahl von Konzerten (1720) und außerdem (1691) Kammersonaten für Violine und Violoncell als Op. 1 heraus.
Auch ein Florentiner Violinist zeichnete sich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts aus: Antonio Veracini. Er war im Dienste der Großherzogin Vittoria von Toscana und veröffentlichte zwei Sonatenhefte für die Kirche und eines für die Kammer, letzteres im Jahre 1696. Veracini zeigt sich in diesen Kompositionen als ein Tonsetzer von Begabung und tüchtiger Bildung. Sein Stil ist edel, vornehm und gewählt, nicht nur in den Allegrosätzen, sondern auch namentlich in den Stücken langsamer Bewegung, in denen bis dahin immer nur ausnahmsweise erst eine klar gegliederte Periodisierung und ausdrucksvollere Melodik zum Vorschein gekommen war. Veracinis Kammersonaten sind durchaus, wie diejenigen Torellis, nach Art der Kirchensonate gehalten. Im Hinblick auf dieselben gehört er zu den wenigen Vertretern der Instrumentalkomposition jener Tage, welchen es um eine ernste, gediegene Richtung, auch in der weltlichen Musik, zu tun war.
Die Wirksamkeit der soeben betrachteten und mancher andern hier nicht erwähnten Meister Vgl. S. 58 f. liefert den Beweis, daß das italienische Violinspiel in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts schon allgemeinere Vertretung gefunden hatte. Durch die leicht begreifliche Bevorzugung, welche die Geige nicht lange nach ihrer Einführung in die Musikpraxis von seiten der Tonsetzer vor dem bisher für die melodieführende Stimme benutzten Kornett (Zinken) gefunden, war derselben eine herrschende Stellung im Orchester zugefallen. Dieser Umstand konnte nur günstig auf Pflege und Verbreitung des schnell zur Beliebtheit gelangten Instrumentes wirken. Nun fanden sich auch bald Fachmänner, welche mit mehr oder weniger Erfolg bemüht waren, die durch Kultivierung des Sonatensatzes gewonnenen Resultate für die Geigenkomposition zu verwerten. Nach dem Auftreten Farinas in Mantua und Uccellinis in Parma taten sich fast gleichzeitig Florenz, Bologna, Modena und Padua durch angesehene und einflußreiche Persönlichkeiten im Gebiete der Instrumental- und zugleich auch der Violinkomposition hervor. Unter diesen Städten nahm Bologna unbestritten den ersten Rang ein: es glänzte zum zweiten Male, wie schon früher durch seine Malerschule, so jetzt für eine geraume Zeit durch sein Musikleben. Den Mittelpunkt desselben bildete die 1666 gegründete » Accademia filarmonica«, deren Mitglied oder gar Präsident zu sein für eine besondere Auszeichnung galt. Viele der besten Musiker des damaligen und späteren Italiens gehörten ihr an, namentlich wenn sie in Bologna selbst lebten, und als der Pater Martini (geb. 1706, gest. 1784) durch seine musiktheoretische Gelehrsamkeit die altberühmte Metropole akademischer Bildung zu einem tonkünstlerischen Areopag Europas erhoben hatte, dem sogar Mozart sich unterwarf, stand Bologna auf der Höhe seines musikalischen Ansehens. Außerdem hatte der Ort längere Zeit hindurch neben Venedig Bedeutung durch den schwunghaft betriebenen Notendruck, welchen demnächst, wie hier vorgreifend bemerkt sei, Amsterdam, London und Paris, auch namentlich in betreff der Violinliteratur, an sich rissen.
Geigenspiel und Geigenkomposition waren nun in Italien so weit vorgeschritten, daß sich für diese Kunstzweige förmliche Zentralpunkte bilden konnten, die von einheimischen und auswärtigen Talenten aufgesucht wurden, um die befruchtende Lehre eines bestimmten, epochemachenden Meisters hinauszutragen in die weite Welt. Den Reigen eröffnete Arcangelo Corelli, der in Rom wirkte.
Wer sich eine Vorstellung von dem hohen Ansehen machen will, in welchem Corelli bei seinen Zeitgenossen und namentlich bei römischen Kunstmäzenen stand, mag uns für einen Augenblick in das Pantheon zu Rom, diesen durch den päpstlichen Stuhl zu einer modernen Kirche und Ruhmeshalle umgewandelten heidnischen Tempel, folgen. Hier ruhen links vom Eingange, neben Raffaels Asche, die irdischen Überreste des beinahe vergötterten Violinmeisters, dem man die überschwänglichen Epitheta » Princeps musicorum«, » Maestro dei Maestri« und » virtuosissimo di Violino e vero Orfeo di nostri tempi« beilegte. Dort ist Corellis Gedächtnis für die Nachwelt auf einer Marmortafel mit vergoldeter Schrift also verewigt:
D. O. M.
Arcangelo Corellio e Fusignano Philippi Wilhelmi Comitis
Palatini Rheni S. R. J. Principis ac Electoris Beneficentia
Marchionis de Ladensbourg
Quod Eximiis Animi Dotibus
Et incomparabili in Musicis Modulis Peritia
Summis Pontificibus apprime carus
Italiae atque exteris Nationibus Admirationi fuerit
Indulgente demente XI P. O. M.
Petrus Cardinalis Ottobonus S. R. E.
Vic. Can.
Et Galliarum Protector
Liiristi Celeberrimo
Inter Familiares suos jam diu adscito
Ejus Nomen Immortalitati commendaturus
M. P. C.
Vixit annos LIX. Mens. X. Dies XX.
Obiit VI Id. Januarii Anno Sal. MDCCXIII.
An dieser geweihten Stelle wurde der Jahrestag seines Todes so lange feierlich begangen, als noch ein Schüler Corellis in Rom vorhanden war. Diesem fiel dabei das Ehrenamt zu, die zu Gehör gebrachten ausgewählten Kompositionen seines Meisters nach den überkommenen Traditionen zu leiten. Man sieht, es hatte sich ein förmlicher Corelli-Kultus ausgebildet. Derselbe mag unserer Zeit einigermaßen übertrieben erscheinen, da es doch nur ein Violinspieler war, dem er galt. Allein es darf ruhig ausgesprochen werden: Corellis Mitlebende würdigten seinen Genius ganz richtig. Sie erkannten, daß er ausübend und schaffend der Geige die höhere Weihe des Kunstadels verliehen hatte. Mit echt künstlerischem Sinn normierte er Violinspiel und Violinsatz in den wesentlichsten Grundzügen und hinterließ dadurch der musikalischen Welt ein sicheres Fundament, auf welchem die weitere Entwicklung dieser Sonderkunst Schritt vor Schritt erfolgen konnte.
Corelli hatte den Beruf zu erfüllen, die Tätigkeit der Vertreter seines Faches während eines vollen Jahrhunderts abzuschließen und zu krönen. Nicht bahnbrechend und neugestaltend trat er auf. Ihm fiel die Aufgabe zu, das verwertbare Material der überkommenen Instrumental- und Violinkomposition in eklektischer Weise zusammenzufassen und für höher stilisierte Hervorbringungen zu verwerten, welche zugleich eine methodische Behandlung des Geigensatzes und mithin auch des Geigenspiels darboten. Dadurch nahm er einen Standpunkt ein, der ihm die ehrenvolle Anerkennung seiner Zeitgenossen als » Maestro dei Maestri« eintrug.
Es darf nicht übersehen werden, daß schon in Bassanis, Torellis und Antonio Veracinis Werken sich einzelne Tonstücke finden, welche Corellis wohl wert und würdig wären. Was indessen diesen Meister vor jenen auszeichnete, ist ein durch den Verkehr mit bedeutenden Künstlern und hervorragenden Kunstliebhabern genährtes und geläutertes Schönheitsgefühl. Und diese für einen schöpferischen Geist so unerläßliche Eigenschaft, welche sich durch Adel des Sinnes und Vornehmheit des Ausdrucks namentlich in den späteren Arbeiten Corellis kundgibt, ist es wohl zumeist, wodurch er unter seinen gleichzeitigen Berufsgenossen eine ausgezeichnete und dominierende Stellung behauptete.
Corellis schöpferische Tätigkeit ist uns in sechs verschiedenen Werken aufbewahrt. Das erste derselben wurde 1683 in Rom, wo der Meister von 1681 an bis zu seinem Tode verweilte, unter dem Titel: » XII Sonate a trè, due Violini e Violone, col Basso per l'Organo« als Op. I veröffentlicht. Der Satz ist zur Hauptsache normal, indes ebensowenig schon ausgezeichnet durch bedeutsamen Inhalt, wie durch völlige Selbständigkeit. Ein Anlehnen an die Vorgänger, namentlich an Bassani, seinen Lehrmeister, ist unverkennbar. Doch tritt überall Corellis Eigentümlichkeit hervor, sich einfach und klar auszudrücken. Dabei ist aber die Schreibweise noch nicht ganz frei von unschönen Fortschreitungen der Stimmen und einzelnen Härten des Zusammenklanges.
In seinem ersten Werk neigt sich der Meister vorwiegend zur viersätzigen Formgebung, die allerdings, wie wir sahen, schon vor ihm neben der dreisätzigen Anordnung gebraucht worden war, während sonsthin der Sonatensatz ab und zu noch zwischen einer größeren oder kleineren Anzahl von Teilen unstet hin und her geschwankt hatte. In der Regel ist in seinen Erzeugnissen die Folge: Adagio, Allegro, Adagio, Allegro. Mitunter sind die beiden ersten Sätze auch Allegros. Andererseits kommt es aber auch wieder vor, daß die drei ersten Stücke im langsamen Tempo stehen und nur das letzte ein schnelles Zeitmaß hat. Eine Ausnahme von der Vierzahl macht die siebente Sonate. Sie hat drei Teile, nämlich: Allegro, Adagio, Allegro. Sämtliche 12 Nummern des Werkes gehören der Kirchensonate an.
Das zweite, der weltlichen Instrumentalmusik gewidmete Werk hat den Titel: » XII Sonate da camera a trè, due Violini e Violone o Cembalo, in Roma 1685.«
In demselben behandelt Corelli hauptsächlich Tanzformen. Meist sind drei Tänze mit einem voraufgehenden Präludium ( Largo oder Adagio) zu einem Ganzen verbunden. Einige Sonaten weichen jedoch hiervon ab. Die erste derselben besteht aus einem Präludium, welchem Allegro, Corrente und Gavotte folgen. In der zweiten finden sich drei Stücke: Allemande, Corrente und Giga. Die dritte enthält: Präludio (Largo), Allemande (Allegro), sodann ein Adagio freier Erfindung und zum Schluß eine zweite Allemande. Noch abweichender ist die zwölfte Sonate gestaltet. Sie besteht aus einer Ciaconna und einem längeren Allegro, welches sich mit Beziehung auf den Einleitungssatz als eine freie Anwendung der Variationenform erweist.
Aus diesem Werke geht hervor, daß Corelli in demselben noch den von Giov. Battista Vitali eingenommenen Standpunkt insofern festhält, als er in der Kammersonate Tanzformen mit Tonsätzen freier Erfindung vermischt, was aber bei ihm zugleich zu anderen, neuen Versuchen hinsichtlich der Zusammenstellung verschiedenartiger Tonsätze führt. Wenn Corelli hier noch nicht dem von Torelli und Veracini in betreff der Kammersonate gegebenen Beispiel folgt, so dürfte es sich daraus erklären, daß sein zweites Werk vor die fraglichen Erzeugnisse jener Männer fällt. Denn in einem Teil seiner 1700, also 15 Jahre später erschienenen Solo-Violinsonaten macht Corelli von der für die Kammersonate erzielten gewinnreichen Neuerung Gebrauch.
Seine beiden folgenden Sonatensammlungen gab Corelli unter den Titeln heraus:
»
Sonate da Chiesa a trè, due Violini e Violone, o Arcileuto, col Basso per l'Organo, opera terza, in Roma 1689« und
»
Sonate da Camera a trè, due Violini et Violone, o Cimbalo da Arcangelo Corelli, opera quarta, in Bologna 1694.«
Jedes dieser Werke enthält wiederum 12 Sonaten. Sie sind ihrer formellen Beschaffenheit nach wesentlich den in Op. 1 und 2 vereinigten Sonaten entsprechend. Aber die Art der Schreibweise zeigt in allen Beziehungen schon eine feinere, gereinigtere Durchbildung. Es ist der reife, mit bewußter Meisterschaft waltende Künstler, der nunmehr, befreit von den Fesseln des Schulzwanges, zu uns spricht. Dies geht auch insbesondere aus der Behandlungsweise der Tanzformen hervor. Sie erscheinen teilweise nicht mehr in ihrer ursprünglichen Bedeutung, sondern nehmen, namentlich wo sie in breiterer formeller Gestaltung auftreten, einen idealen Charakter an. Diese stilvollere Behandlung des Tanzes, welche schon durch Giov. Battista Vitali einigermaßen vorbereitet war, nähert sich entschieden dem Wesen der höheren Instrumentalmusik und deutet auf jene schon hervorgehobene Wechselwirkung zwischen der Kirchen- und Kammersonate hin, die eine gegenseitige Befruchtung beider Arten zur Folge hatte.
Verlieh die weltliche Instrumentalmusik der kirchlichen einerseits eine Bereicherung der Rhythmik, so wurde dagegen andererseits die ideale Tongestaltung der Kirchensonate maßgebend für die Kammersonate. Sie hatte sich nach und nach Tonsätze zugeeignet, deren Beschaffenheit an die » Musica sacra« erinnerte. Dies wirkte auf die Behandlung gewisser Tanzformen zurück, welche dem Ausdrucke nach möglichst in Einklang mit den neben ihnen stehenden Musikstücken freier Erfindung zu bringen waren, wodurch sie veredelt und zu Charakterstücken erhoben wurden. So wird z. B. die Allemande in Corellis zweitem und viertem Werk nicht allein in breiterer, obwohl immer zweiteiliger Form, sondern auch auf ganz verschiedenartige, einander scharf entgegengesetzte Weise behandelt. In der zweiten Sonate ( Op. 2) erscheint sie als Adagio, in der dritten als Allegro und als Presto, in der sechsten wiederum als Largo usf.
Nach Prätorius Syntagma mus. Teil III, Abt. 2, S. 25. war die Allemande »nicht so fertig vnd hurtig, sondern etwas schwermütiger und langsamer, als der Gaillard«. Dies paßt nicht mehr zu den mannigfachen Abstufungen des langsamen und schnellen Zeitmaßes, in welchen Corelli sich ergeht. Überdies hat auch der Charakter dieser Tonstücke, von denen nur der Rhythmus noch eine Reminiszenz an den Ursprung gibt, nichts Tanzartiges mehr.
Ähnlich verhält es sich mit den Sätzen, welche » Tempo di Gavotta« überschrieben sind. Es ist nicht mehr der Tanz in seinem ursprünglichen Wesen, sondern ein in Bewegung und Rhythmus an denselben erinnerndes, höher stilisiertes Tonbild.
Dieselbe Erscheinung wiederholt sich in den Suiten Bachs und Händels, sowie später in den Instrumentalwerken Haydns und Mozarts, hier insbesondere bezüglich des Menuett.
Corellis fünftes Werk: » Sonate a Violino e Violone o Cembalo, a Roma 1700«, welches zwölf Kammersonaten für Violine solo enthält, zeigt ganz in ähnlicher Weise, wie die vier ersten Sonatenwerke des Meisters, die Formgebung der kirchlichen sowohl, als auch der weltlichen Instrumentalmusik Nr. I und Nr. XII dieses Op. 5 sind in D. Alards » Maîtres classiques du Violon« erschienen.. Die ersten 6 Sonaten in vierteiliger Bildung (nur die sechste Sonate enthält als fünften Teil eine » Follia« mit 16 Variationen) Von Ferd. David in freiester Bearbeitung herausgegeben. sind nach dem Modus der Kirchensonate, die übrigen dagegen nach dem der früheren Kammersonate gestaltet. In der ersten Hälfte dieser Sammlung tritt also Corelli, dem Beispiel Torellis und Ant. Veracinis folgend, nun auch für die Umbildung der Kammersonate nach Maßgabe der Kirchensonate entschieden ein. Dabei legt er aber den Schwerpunkt der Komposition in die Violinstimme.
Die bisherige polyphone Bildweise des Sonatensatzes zeigte das Prinzip der möglichsten Gleichberechtigung aller Stimmen, wodurch der Violine eine koordinierte Stellung zugewiesen war. Die Geige, in eine erste und zweite eingeteilt, erschien nur insofern bevorzugt, als sie führend und leitend auftrat. Die ersten Versuche im Sonatenfache für eine Violine allein mit Baß, denen wir bei Farina und Fontana begegneten, zeigen dasselbe Prinzip: Beide Stimmen halten sich bis zu einem gewissen Grade das Gleichgewicht und konzertieren sozusagen miteinander. Auch in Veracinis Kammersonatenwerk ( Op. 3) ist noch durchaus dieser Standpunkt festgehalten. Uccellini macht hiervon in seinen Violinsonaten mit einfacher Baßbegleitung eine Ausnahme, und nach ihm, wenn auch nur teilweise, Torelli. Diesen beiden nun schließt sich Corelli an, indem er die Violinpartie in seinem fünften Werk gleichfalls bevorzugt, wodurch der Baß in ein mehr untergeordnetes, begleitendes Verhältnis tritt. Hiermit war die eigentliche Solo-Violinsonate gegeben und zugleich die entschiedene prinzipielle Ausscheidung des spezifischen Violinsatzes (ähnlich wie in Torellis Concerti grossi) innerhalb des Gebietes der Instrumentalkomposition vollzogen.
Corellis Solo-Sonaten behaupten in betreff ihres von tieferem künstlerischem Ernst beseelten Gehaltes und einer stilvolleren Behandlung der Geige unbedingt den Vorrang vor den früheren gleichartigen Produktionen.
Dasselbe gilt auch hinsichtlich des sechsten und letzten Werkes Corellis: » Concerti grossi con due Violini e Violoncello di concertino obligati a due altri Violini, Viola e Basso di concerto grosso ad arbitrio che si potranno radoppiare, Roma, Decembre 1712.« Die Dedikation an den Kurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz ist vom 3. Dezember 1712 datiert.
Ob oder wieweit die in dieser Sammlung vereinigten Musikstücke auf Anregung der Torellischen » Concerti grossi« entstanden, welche bereits 1709, also drei Jahre vor den gleichnamigen Kompositionen Corellis im Druck erschienen, ist nicht festzustellen. Denn wir sind durch Georg Muffat darüber unterrichtet, daß der Meister schon im Jahre 1682 Concerti grossi komponiert und in seiner Behausung zur Aufführung gebracht hat. Ein Vergleich seiner ersten gedruckten Kompositionen (1683 u. 85) mit den im 6. Werke vereinigten Konzerten läßt wohl den Schluß zu, daß es sich in dem letzteren Werk durchweg um spätere Kompositionen des Meisters handelt, sagt aber nichts Bestimmtes über die Zeit ihrer Entstehung aus. Schering weist (S. 49) darauf hin, daß jedenfalls eins und das andere der Konzerte aus Op. 6 schon im Jahre 1709 bekannt war, also 3 Jahre vor der Drucklegung. Aus alledem ergibt sich die ungezwungene Annahme, daß Torellis Veröffentlichung Corelli in dem Entschlusse, eine Sammlung gleichartiger Kompositionen herauszugeben, zum mindesten bestärkte. Natürlich wird er dann die schon existierenden wenigstens teilweise mit darin aufgenommen haben, hat jedoch ebenso wahrscheinlich noch neue hinzukomponiert.
Corellis Op. 6 enthält acht Kirchen- und vier Kammerkonzerte, deren Gestaltung zur Hauptsache auf der damals üblichen Anordnung beruht. Die vier Kammerkonzerte bestehen demgemäß aus einer Zusammenstellung von Tanzformen und Tonsätzen freier Erfindung. Unterscheiden sich mithin die » Concerti grossi« hinsichtlich ihrer äußeren Erscheinung nicht von der zwei-, drei- und vierstimmigen » Sonata« jener Periode, so erhalten sie doch etwas Eigenartiges durch die schon von Torelli bewirkte Einführung von Solo- und Ripienstimmen. Diese Anordnung ist aber bei Corelli wesentlich abweichend von Torellis Behandlungsweise der obligaten und akkompagnierenden Instrumente. Nicht um Solostimmen mit untergeordneter Begleitung, sondern um drei konzertierende Partien, vertreten durch zwei Violinen und ein Violoncell, mit Hinzufügung einer harmonieergänzenden Bratsche, handelt es sich in Corellis Konzerten. Die beiden Ripiengeigen sind nur im Tutti beschäftigt, gehen dann aber fast immer im strengen Unisono mit den Solostimmen. Der Satz ist daher im wesentlichen vierstimmig. Nur in vereinzelten Fällen und vorübergehend sind die Violinen in den Ripienstimmen anders geführt als die entsprechenden Soloinstrumente, wodurch sich denn stellenweise eine sechsstimmige Behandlung ergibt. Der » Continuo« führt die einfachen Fundamentalbässe aus.
So entfaltet sich ein wechselndes Tonspiel zwischen zwei und drei Solostimmen und dem Ensemble, ohne daß es zu einem absoluten Dominieren der obligaten Instrumente kommt. Dem zur Anwendung gebrachten Stile gemäß erscheint vielmehr alles musikalisch gleichberechtigt. Einfachheit, Schlichtheit und klare, folgerichtige Bestimmtheit ist ein Grundzug dieser Musik. Aber dabei hat sie zugleich etwas vornehm Pathetisches, eine gewisse Größe, die in dem ernst gemessenen Schritt kräftig gesunder Tonfolgen sich ausspricht. Freilich verbindet sich damit nicht selten eine an Monotonie streifende Stabilität des Ausdrucks, die sowohl in der engbegrenzten Modulationsmanier, wie auch in dem oft gleichartigen Metrum des Periodenbaues fühlbar wird. Eine wechselreichere Mannigfaltigkeit in diesen Beziehungen herbeizuführen, war der sich anschließenden Epoche vorbehalten.
Genau betrachtet, ist hier die Basis zu orchestraler Schreibweise gelegt. Corellis mehrstimmiger Instrumentensatz im sogenannten » Concerto grosso« wurde in der Tat maßgebend für die nächste Folgezeit. Er erinnert bisweilen stark an Händels Orchesterstil. Dieser große Meister trat während seines längeren römischen Aufenthaltes in nahe Beziehung zu Corelli, und es ist unverkennbar, daß er dessen methodisch normale Behandlung des Streichquartetts in sich aufnahm, um sie, seiner eminenten künstlerischen Begabung entsprechend, in gesteigerter Wirkung für die eigene schöpferische Tätigkeit zu verwerten.
Die Formgebung der Corellischen Kompositionen zeichnet sich durch Bestimmtheit und plastische Klarheit aus. Dies ist jedoch nur im allgemeinen zu nehmen. Die allmähliche Detailausbildung der einzelnen Sonatenteile, insbesondere aber die des ersten Satzes blieb der Folgezeit überlassen und war, wie schon erwähnt wurde, vorzugsweise das Werk der deutschen Tonmeister. Nichtsdestoweniger hat sich auch Corelli ein Verdienst um den Sonatensatz erworben, und zwar durch die klare, übersichtliche Struktur der einzelnen Tonstücke, sowie durch den edlen, vornehmen Ausdruck, namentlich in den Adagios. Auch den Allegrosätzen ist meist gehaltene Würde eigen, die ein Grundzug von Corellis Wesen sein mochte, doch treten sie inhaltlich gegen die langsamen Stücke zurück. Teilweise bestehen sie aus einer rhythmisch belebten Figuration, die, ähnlich wie bei allen seinen Vorgängern, indessen nicht mehr in demselben Grade, etüdenartig ist. Dies gilt jedoch nur von den Tonsätzen freier Erfindung und nicht von den Tänzen, bei denen der Tonsetzer weit mehr sein Augenmerk auf eine angemessene Handhabung der Rhythmik, als auf die wenig dabei in Betracht kommende Figuration zu richten hatte.
Eine besonders hervorstechende Seite der späteren Corellischen Musik beruht in dem Wohllaut der Klangwirkung. Der Meister kannte sein Instrument gründlich; er schrieb, auf die damals mit vereinzelten Ausnahmen ziemlich allgemein üblichen drei ersten Lagen sich beschränkend, aus der Natur desselben heraus und erhob es durch seine breite, getragene und schön empfundene Kantilene zu einer Repräsentantin des Gesanges. Es ist freilich bei ihm noch nicht die Melodik der späteren Meisterzeit anzutreffen, die in ihrer individuellen und zugleich mannigfaltigen Ausprägung völlig andere Kunstziele verfolgt. Corellis Musik hat einen etwas asketisch spiritualistischen Zug von monotoner Färbung, der mit dem Kirchenton seiner Zeit zusammenhängt und mehr oder weniger auch bei allen anderen damaligen Instrumentalkomponisten durchschimmert.
Corelli war während seines mehr als dreißigjährigen römischen Wirkens in der Lage, beide Seiten seiner Kunst, die kirchliche und weltliche, zu allgemeinster Geltung zu bringen. Seine Leistungen, die sich mit seinem Kunstgeschmack und einer liebenswürdigen, durch Anspruchslosigkeit und Sanftmut ausgezeichneten Persönlichkeit verbanden, hatten ihn bald zum bevorzugten Liebling auserwählter künstlerischer und gesellschaftlicher Kreise gemacht. Er unterhielt ein enges freundschaftliches Verhältnis zu den Malern Cignani und Maratti, mit deren Hilfe er seine leidenschaftliche Vorliebe für Gemälde durch allmähliche Erwerbung einer wertvollen Bildersammlung befriedigte. In der vornehmen Gesellschaft war der kunstsinnige Kardinal Pietro Ottoboni sein Hauptgönner und Freund. In dem Palast desselben, wo er bis zum Tode seine Wohnung hatte, ließ er auch vorzugsweise sein allgemein bewundertes Spiel ertönen, dessen Zartheit und Anmut von den Zeitgenossen ausdrücklich gerühmt wird.
Ottoboni war der einflußreichste und mächtigste Beschützer der Tonkunst im damaligen Rom. Sein Haus, gewissermaßen der musikalische Mittelpunkt der Weltstadt, mußte für den Mangel an tonkünstlerischer Gemeinpflege entschädigen. Crescimbeni, Mitbegründer der arkadischen Akademie, deren Ehrenmitglied bekanntlich auch Goethe während seines römischen Aufenthaltes wurde, berichtet, daß im Palaste des Prälaten jeden Montag eine musikalische Produktion stattfand, wobei Direktion und Solospiel ein für allemal Corelli zufielen. Das Orchester bestand aus den besten Musikern der Stadt, und die Vokalpartien wurden von Mitgliedern der sixtinischen Kapelle ausgeführt, deren oberster Chef Ottoboni war. Die bald zu hohem Rufe gelangten Montagsmusiken des Kardinals bildeten natürlich auch einen Hauptanziehungspunkt für fremde Künstler, und so konnte es nicht fehlen, daß Händel, der unerreichte Heros des biblischen Oratoriums, eine Zierde dieses Kunsttreibens wurde, nachdem er in Rom heimischer geworden war. Der biedere, urkräftige Deutsche geriet indessen mit Corelli bei einer der Zusammenkünfte in einen Konflikt, dessen mögliche Konsequenzen nur durch des Italieners mild versöhnliches Benehmen vermieden wurden. Händel führte nämlich in einer der Ottobonischen Akademien die Ouvertüre zu seiner Oper » il Trionfo del Tempo« auf, und da Corelli die Violinpartie nicht zur Zufriedenheit des Komponisten interpretierte, riß dieser ihm, heftig wie er war, die Violine aus der Hand, um die von ihm intentionierte Vortragsweise durch Vorspielen anzudeuten. Corellis Antwort war: » Ma, caro Sassone, questa Musica è nello stile Francese, di ch'io non m'intendo.« In diesen mild abwehrenden Worten des Meisters offenbart sich auf schöne Weise die Kundgebung einer Bescheidenheit, die den Mann von Würde nur das in Anspruch nehmen läßt, was ihm gebührt. Sie beruht im Grunde auf dem Gefühl, welches Corelli bestimmte, bei anderer Gelegenheit freundlich seine Violine aus der Hand zu legen, als sich während seines Spieles eine Konversation vernehmen ließ, indem er, befragt warum er aufhöre, erklärte, »er besorge die Unterhaltung zu stören«. –
Die vornehme Welt wetteiferte um die Ehre, Corelli als ihren Gast zu bewirten, und bei allen wichtigen musikalischen Ereignissen stand er an der Spitze des Orchesters. Unter den durch ihren Rang hervorragenden Persönlichkeiten wurde er insbesondere von der Königin Christine ausgezeichnet, welche nach ihrer Thronentsagung Rom besuchte. Bei den in ihrem Hause veranstalteten Festlichkeiten kam auch ein von dem Veroneser Guidi gedichtetes und von Pasquini komponiertes allegorisches Drama zur Darstellung, bei welchem niemand anders das aus 150 Personen bestehende Orchester dirigieren durfte, als unser Meister. Einen besonders warmen Verehrer hatte Corelli ferner an dem Pfalzgrafen Philipp Wilhelm bei Rhein, der ihm nicht nur den Titel eines Marchese von Ladenburg verlieh, sondern auch die Gedenktafel, deren Inschrift oben mitgeteilt wurde, an seiner Ruhestätte im Pantheon aufrichten ließ.
Corellis Ruhm als Violinist und Tonsetzer drang so schnell in die musikalische Welt, daß er bald Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit wurde. Begabte Kunstjünger von nah und fern wendeten sich an ihn, um seiner Lehre teilhaftig zu werden, und tätige Musikhändler lieferten dem Publikum verschiedene und wiederholte Auflagen seiner allerorten viel begehrten Werke. Nächst den Originalausgaben erschienen Nachdrucke von den vier ersten Sonatensammlungen in Amsterdam, Paris und London. Die gesuchteste und populärste seiner Schöpfungen, Op. 5, erlebte sogar kurz hintereinander fünf Ausgaben. Diese Sonatenkollektion wurde überdies von Francesco Geminiani, dem Schüler Corellis, zu Konzerten für Streichinstrumente nach dem Vorbilde der » concerti grossi« ( Op. 6) umgearbeitet und zu London veröffentlicht. Der Titel ist: » XII Concerti grossi, con due Violini, viola e Violoncello di concertini obligati, e due altri violini e basso di concerto grosso, quali contengono preludi, allemande, correnti, gighe, sarabande, gavotte e follia. Composti della prima e della seconda parte dell' opera 5 di Corelli, da Francesco Geminiani. London. (Ohne Jahreszahl.)
Eine Partiturausgabe der Werke Corellis (mit Ausschluß von Op. 5) erschien in zwei Foliobänden gleichfalls in London unter Redaktion des 1667 in Berlin geborenen Tonsetzers und Musikschriftstellers Johann Christian Pepusch, welcher eine Reihe von Jahren in der englischen Hauptstadt lebte und wirkte.
Die Titel beider Bände lauten:
»
The Score of the Four Setts of Sonatas compos'd by Arcangelo Corelli for two Violins & a Bass« und
»
The Score of the twelve Concertos, compos'd by Arcangelo Corelli. For two Violins & a Violoncello, with two Violins more a Tenor & Thorough Bass for Ripieno Parts, which may be doubled at pleasure.«
Übrigens gab die außerordentlich lebhafte Teilnahme der Musikwelt an Corellis Kompositionen auch zu Falsifikaten Veranlassung. In Amsterdam druckte man 9 Sonaten von Ravenscroft Ein Zeitgenosse Corellis, der als ausgezeichneter Virtuose auf dem Hornpipe (Hornpfeife) galt, aber auch Geiger war, als solcher an dem Theater von Goodmansfield wirkte und sich namentlich durch den Vortrag der Corellischen Kompositionen auszeichnete., welche ursprünglich zu Rom (1695) veröffentlicht waren, unter Corellis Namen nach. Ebenso ist ein Heft, » Sonate a tre«, welches als ein » opera posthuma« Corellis in Amsterdam erschien, apokryphischer Natur.
Machten sich einerseits die Verleger viel mit Corellis Musik zu schaffen, so ergingen andererseits an ihn selbst schmeichelhafte und dringende Anerbietungen von auswärts her. Namentlich ließ ihm der König von Neapel Engagementsanträge machen, die er jedoch entschieden ablehnte. Die glückliche Stellung, welche er in Rom einnahm, die ihm von allen Seiten entgegengebrachten Huldigungen, endlich die engen, mit ausgezeichneten Männern geschlossenen Freundschaftsbündnisse, – alles dies macht es erklärlich, wenn er den glänzendsten Lockungen widerstand. Zudem scheint es, als ob Corelli seinem ruhigen, beständigen Charakter gemäß kein Freund wechselnder Existenz war. Man weiß mit Bestimmtheit nur von einer größeren Reise, die er nach Beendigung seiner Studien und unmittelbar vor der Niederlassung in Rom unternahm. Sie führte ihn für einige Zeit nach Deutschland in die Dienste des bayrischen Hofes Chrysander berichtet im 2. Bande seiner Händelbiographie (S. 387), daß Corelli auf seinen Kunstreisen (?) in Deutschland während der Jahre 1680-1685 sich längere Zeit in Hannover bei seinem Freunde, dem Konzertmeister Farinelli, aufgehalten habe. Dieser Besuch gehört nicht in das Bereich der Unmöglichkeit. Doch ist es zweifelhaft, ob Corelli sich wirklich so lange in Deutschland aufhielt, wie hier angegeben ist, da anderen Mitteilungen zufolge der Meister schon gegen Ende 1681 nach Italien zurückkehrte..
Wie wenig Corelli auch daran dachte, Rom mit Neapel zu vertauschen, so konnte er schließlich doch nicht umhin, wenigstens einen Besuch in letzterer Stadt zu machen, da der König den dringenden Wunsch hatte, ihn zu hören. Er machte sich auf die Reise, welche indessen für ihn verhängnisvoll wurde, da die Erlebnisse derselben seinen Lebensabend trübten. Hatte er eine Ahnung davon, als er sich weigerte, nach Neapel zu gehen, oder glaubte er die Rivalität der dortigen Violinspieler scheuen zu müssen? Neapel war unbeschadet des Ranges, welchen Venedig und Bologna behaupteten, zu jener Zeit die musikalisch bedeutendste Stadt Italiens. Sie besaß nicht nur eine fruchtbare Musikschule, aus der eine Reihe berühmter Tonmeister hervorging, sondern vor allem in Alessandro Scarlatti einen bahnbrechenden Genius. Überdies florierte dort die Gesangskunst. Daneben war die Instrumentalmusik in angemessener Weise vertreten, wie wir aus Burneys Berichten ersehen, obwohl Neapel gerade im Violinspiel zu keiner Zeit außerordentliche Erscheinungen hervorbrachte. Corelli mochte über diese Verhältnisse orientiert sein, denn seine Maßnahmen für den Neapler Besuch zeigen deutlich, daß er sich nicht dem Zufall preisgeben wollte. Er erwählte, um sich in jedem Falle eines guten Akkompagnements zu versichern, zwei erprobte Violinisten und einen Violoncellisten zu seinen Reisegefährten, ohne jedoch dadurch die künstlerischen Demütigungen abwenden zu können, welche seiner harrten. Nach erfolgter Ankunft in Neapel wurden seine Kompositionen aufgeführt; das Orchester bewährte sich so vortrefflich, daß Corelli, davon überrascht, seinen Leuten zurief: » Si suona à Napoli!« So gut aber das erste Debüt vonstatten ging, so wenig erfolgreich war das zweite für Corelli. Er spielte bei Hofe eine seiner Sonaten aus Op. 5. Der König, vielleicht schlecht gelaunt, vielleicht auch mit übertriebenen Vorstellungen von Corellis Kunst erfüllt, fand sich veranlaßt, mitten im Spiel des Meisters das Gemach zu verlassen, – eine Art fürstlicher Courtoisie, die ganz im Einklang mit der rücksichtslosen, den ehemaligen Neapler Hof auszeichnenden Willkürherrschaft steht. Noch schlimmer fast erging es Corelli aber, als er veranlaßt wurde, in einer Operette Scarlattis mitzuspielen. Ausschließlich an die Technik seiner eigenen Kompositionen gewöhnt, geriet er bei einer bis in die fünfte Lage hinaufsteigenden Passage ins Stocken, was sofort von den Mitspielern bemerkt wurde. Corelli, dem, wie wir bei der Begegnung mit Händel sahen, in seinem heimischen Berufskreise jene kaltblütige, über so manche Verlegenheit des Lebens hinweghelfende Ruhe keineswegs fehlte, geriet auf fremdem künstlerischen Terrain in Verwirrung. Er vermochte sie nicht mehr zu bewältigen und spielte das folgende Stück, die Vorzeichnung übersehend, aus C-dur statt C-moll. Scarlatti ließ ein » Ricomminciamo«! erschallen. Allein es half nichts, und der römische Gast mußte sich eine Berichtigung gefallen lassen. Jetzt war das Maß der Beschämung voll; Corelli wußte nichts Besseres zu tun, als sofort in aller Stille abzureisen. Doch die Seele des Meisters vermochte sich nicht wieder von den erlebten Eindrücken zu befreien. Alles deutet darauf hin, daß ihm ferner das nötige Selbstvertrauen fehlte. Er wähnte sich gegen andere Künstler zurückgesetzt, und insbesondere ein Violinspieler namens Valentini aus Florenz, der trotz geringerer Leistungen die Aufmerksamkeit der römischen Musikkreise erregte, steigerte seine Verstimmung. Corelli verfiel in eine förmliche Melancholie, die den Rest seines Lebens verkürzte, denn er starb bald darauf am 12. Januar 1713.
Corelli wurde im Februar 1653 zu Fusignano bei Imola in der Romagna geboren. Die Elemente der Musik lernte er von dem päpstlichen Kapellmeister Matteo Simonelli, an dessen Stelle später, da die Violine vorzugsweise sein Interesse erweckte, Bassani trat. Sein Leben war durch Mäßigkeit in jeder Beziehung ausgezeichnet. Händel pflegte ihn mit folgenden Worten zu schildern: »Gemälde, die er umsonst sehen konnte, und Sparsamkeit waren seine Lieblingsneigungen; seine Garderobe war ausgesucht dürftig, für gewöhnlich trug er sich schwarz und hing einen blauen Mantel darüber, dabei lief er immer zu Fuße und machte närrische Weigerungen, wenn wir ihn bereden wollten, auch einen Wagen zu nehmen.« Seine Gemäldesammlung sowie sein bedeutendes Vermögen – es wird auf 50 000 Taler angegeben, – vermachte er seinem Freunde, dem Kardinal Ottoboni, der das Geld indessen an die Verwandten des Künstlers verteilen ließ. Das höchste und köstlichste Besitztum aber, dessen er sich erfreute, die von ihm zu höherer Bedeutung erhobene Kunst des Violinspiels, vererbte er auf seine Schüler, von denen die namhaftesten Geminiani, Locatelli, Somis, Baptiste, Castrucci, Carbonelli und Mossi sind.
Der älteste von diesen, Giovanni Battista Somis Fétis gibt ihm, jedenfalls aus Versehen, den Vornamen Lorenzo. Die obigen Angaben sind Reglis » Storia del Violino«, Torino 1863, entnommen. Lorenzo soll ein Bruder von ihm gewesen sein, der ebenfalls Violinist war., geb. 1676 im Piemontesischen, faßte schon in jungen Jahren den Entschluß, Rom zu besuchen, um sich unter Corellis Anleitung dem Studium der Violine zu widmen. Sein reges Kunstinteresse führte ihn aber auch nach Venedig zu Antonio Vivaldi, der dort als Direktor des Konservatoriums » della Pietà« eine wichtige musikalische Stellung bekleidete. Er nahm die Einflüsse beider Meister in sich auf und suchte aus deren Vereinigung eine besondere Richtung zu entwickeln, welche für die von ihm begründete piemontesische Schule entscheidend wurde. In der Errichtung derselben ist Somis' Hauptverdienst zu suchen, denn sie wurde, wie die weitere Darstellung ergeben wird, von großer Wichtigkeit für die violinspielende Welt. Seine eigenen Schüler waren u. a. Giardini, Leclair, insbesondere aber Pugnani.
Nachdem Somis sich zu Turin niedergelassen, übertrug man ihm die Funktion des Soloviolinisten und Orchesterdirektors an der Hofkapelle, deren Leistungsfähigkeit er durch sein intelligentes Wirken wesentlich hob. Als Tonsetzer war Somis unbedeutend. Seine Violinsonaten sind von dürftiger Beschaffenheit und ohne allen Kunstgehalt. Er starb am 14. August 1763. Über sein Violinspiel findet sich in Baillots Violinschule folgendes Zitat von Hubert le Blanc: »Somis, Pugnanis Lehrer, trat in die Schranken; er vereinte Majestät mit dem schönsten Bogenstriche in Europa (!), überschritt die Grenze, wo man leicht scheitert, überstieg die Klippe, woran man strandet, mit einem Wort, er gelangte zu dem schönsten Ziele des Violinspielers, zur Haltung einer ganzen Note. Ein einziger Bogenstrich währte ... daß einem der Atem ausbleibt, wenn man nur daran denkt.«
Als namhaftester Repräsentant der Corellischen Schule darf Francesco Geminiani gelten. Geb. 1680 zu Lucca, wurde er zunächst Schüler eines gewissen Carlo Ambrogio Lunati, genannt il Gobbo, in Mailand. Sodann begab er sich nach Rom in die Lehre Corellis. Nach Burney hatte auch Alessandro Scarlatti tätigen Anteil an seinen musikalischen Studien genommen. Geminiani brachte es als Violinspieler und Komponist für sein Instrument zu einer ungewöhnlichen Leistungsfähigkeit. Trotzdem scheint er als Musiker gewissen unerläßlichen Anforderungen nicht entsprochen zu haben. Wenigstens stimmen alle Berichterstatter darin überein, daß er nicht imstande gewesen sei, ein Orchester anzuführen, da seine unruhige, maßlose Spielweise sich allzusehr in den Gegensätzen des Eilens und Retardierens, also in der Anwendung des » Tempo rubato« gefallen habe. So mußte er in Neapel, wo ihm das Amt des Konzertmeisters übertragen worden, diese Funktion schließlich mit derjenigen eines Bratschisten vertauschen, weil er, anstatt dem Orchester eine sichere Stütze zu sein, dasselbe vielmehr durch seine Tempowillkür in Verwirrung brachte. Auch in London, wohin sich Geminiani 1714 wandte, um dort eine dauernde Existenz zu begründen, vermochte er sich nicht als Orchesterdirigent geltend zu machen. Er war hier hauptsächlich als Violinlehrer, Tonsetzer und musikalisch theoretischer Schriftsteller tätig.
Geminianis gesamtes Leben und Wirken läßt eine eigentümliche Mischung unvermittelter Gegensätze erkennen. Er war als Solospieler in London hochgeschätzt, und doch machte er von dieser Eigenschaft verhältnismäßig wenig Gebrauch; sein Musikertum erwies sich lückenhaft, und wiederum war er Künstler genug, um an sein Auftreten bei Hofe die Bedingung zu knüpfen, daß er nur spielen werde, wenn Händel ihm akkompagniere, da es außer diesem in London niemand vermöge. Er gerät in materielle Bedrängnis, die ihn überhaupt vielfach im Leben verfolgte und einmal sogar ins Gefängnis führte, und als sein Schüler und Gönner Graf Essex sich's angelegen sein läßt, ihm eine einträgliche Kapellmeisterstelle in Irland zu verschaffen, lehnt Geminiani das Anerbieten unter dem Vorwande ab, daß er katholisch sei und doch unmöglich seine Religion gegen die protestantische vertauschen könne. Indessen wird (bei Gerber) hinzugefügt, daß der eigentliche Grund wohl das Gefühl der Unfähigkeit für einen derartigen Wirkungskreis gewesen sei. Manches in Geminianis Leben deutet auf ein sorgloses Sichgehenlassen hin. Wie ohne Plan und Folge tut er bald dieses, bald jenes. Er gibt Unterricht, komponiert, verfaßt theoretische Schriften, spielt gelegentlich öffentlich, geht aber vorzugsweise seiner Liebhaberei für Gemälde nach, mit denen er einen verlustbringenden Handel treibt. Und so fließt sein langes Leben hin, ohne daß er es zu einer erträglichen Existenz bringt. Er beschloß sie zu Dublin am 17. oder 24. September 1762, als er sich besuchsweise bei seinem Schüler M. Dubourg aufhielt. Offenbar verstand Geminiani nicht die Gunst des Augenblicks zu nutzen. Bei seiner Ankunft in London mußte er um so größeres Aufsehen durch sein Spiel und seine Kompositionen erregen, als man dort nicht im mindesten verwöhnt war, denn das Violinspiel lag zu Anfang des 18. Jahrhunderts daselbst noch sehr im argen. Sehr bald wurde dies freilich anders. London schwang sich schnell zum Eldorado fremder Gesangs- und Instrumentalvirtuosen empor, die scharenweise in der britischen Residenz erschienen, um ihre Kunst gleich einer seltenen Ware mit Gold aufwiegen zu lassen, und so hatte Geminiani in der Folge mit manchen seiner Genossen unter dem Druck einer bedeutenden Konkurrenz zu leiden.
Geminiani hat eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Violinkompositionen, sowohl Sonaten als Konzerte, geschrieben Die vollständigen Verzeichnisse der Werke Geminianis, sowie aller weiterhin noch vorkommenden Violinkomponisten sind in Fétis » Biographie universelle des musiciens« zu finden. Vergl. in betreff derselben auch die neueren deutschen Musiklexika, sowie Eitners Quellen-Lexikon.. Es offenbart sich in ihnen ein solides Wesen, zugleich aber auch ein Mangel an völlig durchgebildetem Geschmack und Schönheitsgefühl, der sich ganz besonders in einer unsichern Behandlung der melodischen und rhythmischen Verhältnisse fühlbar macht. Diese Schwäche der Geminianischen Geistesprodukte hat schon Burney richtig erkannt und angedeutet. Wenn aber der englische Kunstrichter von »verwegenen, wilden Ergießungen« dieses Komponisten berichtet, so fühlt man sich zum Widerspruche aufgefordert. Wir möchten seine Musik eher unfertig, unregelmäßig und eckig nennen, als verwegen und wild. Wahrscheinlich hat Burney die Eigenschaften seines Spiels unwillkürlich mit auf seine Kompositionen übertragen. Unter denselben befindet sich auch eine Bearbeitung von Corellis, seines Lehrers, Violinsonaten Op. 5 als Concerti grossi (für 6 Stimmen).
Geminianis Arbeiten entbehren einer schönen Sinnlichkeit. Es fehlt ihnen an Prägnanz, Gedankenkraft, Unmittelbarkeit des Ausdrucks sowie an natürlichem melodischen und modulatorischen Fluß. Und die in seiner Musik etwa durchbrechenden sympathischen Momente erscheinen viel mehr als ein Ergebnis angeeigneter als ursprünglicher Ausdrucksweise. Steht somit seine produktive Tätigkeit dem Gehalt nach gegen die seines Lehrers Corelli, an den er sich vielfach anlehnt, entschieden zurück, so zeigt sie doch den Fortschritt wesentlich gesteigerter Violintechnik. Daß diese ihn in hohem Grade nicht nur praktisch, sondern auch theoretisch beschäftigte, beweist seine Violinschule. Unter den Italienern war Geminiani der erste, welcher ein solches violinpädagogisches Werk verfaßte Man hat gewisse theoretische Werke des 16. Jahrhunderts als Violinschulen bezeichnet. So z. B. Hans Gerles »Musica teutsch, auf die grossen vnd kleinen geygen« (1532). Dieses Lehrbuch ist aber, wie die andern gleichartigen Erzeugnisse jener Zeit, keineswegs eine Violin-, sondern eine »Geigen«-, d. h. eine Viola- oder Gamben-Schule. Als älteste, im Druck erschienene Violinschule dürfte die, mit einer Violaschule zusammen von dem berühmten englischen Gambenspieler Christopher Simpson 1660 herausgegebene zu bezeichnen sein. Der Titel lautet: » A brief Introduction to the skill of Musick. In twoo Books. The first contains the Grounds and Rules of Musick. The second, Instructions for the Viol and also for the Treble-Violin. The third edition enlarged. To which is added a third Book, entitulad, the Art of Descant or composing Musick in Parts, by D. Thom. Campion. With annotations thereon by Mr. Ch. Simpson. London, printed by Will. Godbid for John Playford, at his shap in the Inner Temple, 1660.« Mit Beziehung auf die Violine enthält das Werk folgende Abschnitte! » Instructions for the Treble-Violin« und » Several lessons for the Violin, both by Notes and Letters.«. Es erschien 1740 in englischer Sprache unter dem Titel: » The art of playing the violin, containing rules necessary to attain perfection on that instrument etc.«; London. Diese Violinschule erlebte kurz nacheinander wiederholte Auflagen in England und Frankreich; auch eine deutsche Übersetzung wurde 1785 zu Wien veranstaltet, obwohl Leopold Mozarts treffliche Violinschule inzwischen (1756) zum Vorschein gekommen war, – ein Beweis mehr, daß sie ihrer Zeit als ein geschätztes und gesuchtes Lehrbuch galt.
Der Inhalt des Werkes handelt in 23 Paragraphen von den Elementen des Violinspiels, nämlich von der Haltung der Geige und des Bogens, von der Fingersetzung, von den Tonleitern in verschiedenen Lagen, Trillern, Verzierungen, Arpeggios, Doppelgriffen usw. usw. Man sieht, es ist eine Darstellung des folgerichtigen, aus dem Wesen der Sache abgeleiteten Lehrganges. Die Behandlung des Stoffes bleibt freilich auf das Wesentlichste beschränkt. Jedoch die Fundamentallehren, welche Geminiani gibt, gelten heute noch wie damals. So war denn Corellis fruchtbringende Lehre in ihren Grundzügen durch das geschriebene Wort der Mit- und Nachwelt verkündet.
Sonderbar sind zum Teil die Bemerkungen, welche Geminiani in dem mit Vorliebe behandelten Abschnitte über die Verzierungen gibt, denn sie beweisen, daß man zu jener Zeit, in realistischem Streben befangen, Wesen und Ausdrucksfähigkeit der Musik teilweise noch in Dingen suchte, die wir lediglich als Ornamente betrachten. So heißt es in der deutschen Übersetzung der Schule: »Der untere Triller geschwind und lang geschlagen, ist fähig eine Fröhlichkeit auszudrücken, kurz und sanft geschlagen, kann er eine zarte Leidenschaft bilden. Der Vorschlag von oben taugt, eine Anmutigkeit, eine Freude oder die Liebe auszudrücken. Der Vorschlag von unten hat die nämlichen Eigenschaften. Der Zwicker ist fähig, verschiedene Leidenschaften auszudrücken, z. B. den Zorn oder die Herzhaftigkeit, wenn er stark und lang ist. Freude und Zufriedenheit, wenn er kurzer und schwächer ist. Die Furcht, den Verdruß oder das Klagen, wenn er sehr schwach ist und die Note verstärket wird, und endlich Lust und Anmutigkeit, wenn er kurz gemacht und die Note zärtlich verstärkt wird, usw.« Diese spekulative Richtung, welche ihr Seitenstück in der Schubartschen Charakteristik der Tonarten findet, machte indes bald einer verständigeren Auffassung Platz, und schon in Mozarts Violinschule, die nur sechzehn Jahre später erschien, findet sich keine Spur mehr davon. Überhaupt geht der deutsche Meister nicht nur gründlicher, sondern auch rationeller zu Werke. So eifert er z. B. gegen den damals noch vielfach üblichen Z. B. in T. Cross, » Nolens volens Violin Tutor« 1695. ( Davey, History of English music. 1895.) und auch von Geminiani ausdrücklich empfohlenen Brauch, dem Schüler das Griffbrett zur Erleichterung der Intonation einzuteilen und mit Strichen zu versehen, indem er sagt: »Ich kann hier jene närrische Lehrart nicht unberührt lassen, die einige Lehrmeister bey der Unterweisung ihrer Lehrlinge vornehmen: wenn sie nämlich auf den Griff der Violin ihres Schülers die auf kleine Zettelchen hingeschriebene Buchstaben aufpichen, oder wohl gar an der Seite des Griffs den Ort eines jeden Tones mit einem starken Einschnitte oder wenigstens mit einem Ritze bemerken. Hat der Schüler ein gutes musikalisches Gehör, so darf man sich nicht solcher Ausschweifungen bedienen: fehlet es ihm aber an diesem, so ist er zur Musik untauglich, und er wird besser eine Holzaxt als die Violin zur Hand nehmen.« Dagegen gibt Mozart derjenigen Haltung der Violine, bei welcher sich das Kinn rechts vom Saitenhalter befindet, den Vorzug, während Geminiani schon lehrt, daß das Kinn des Spielers auf der linken Backe der Violine ruhen müsse, wie es allein zweckmäßig und richtig ist. Der praktische Teil von Geminianis Violinschule, bestehend in 12 Violinübungen, kann nur einen sehr relativen Wert beanspruchen. Es ist diese Partie, wie in den meisten derartigen Werken, die bei weitem schwächste Seite. Abgesehen davon, daß es zu den Unmöglichkeiten gehört, in so engem Rahmen auch nur annähernd das Übungsmaterial für Ausbildung des Schülers zu konzentrieren, wird gewöhnlich der Fehler einer sprunghaften oder doch zu schnell fortschreitenden Folge gemacht, und diese Übelstände zeigen sich auch in Geminianis Schulexempeln.
Außer seiner Violinschule veröffentlichte der Künstler noch andere theoretische Werke, von denen hier nur » Guida Armonica o Dizionario armonico« (1742) und » The Art of accompagnement« etc. (1755) angeführt seien. Das erstere Werk soll nach Fétis' Versicherung seinerzeit zur Bereicherung des harmonischen Satzes beigetragen haben, – eine Behauptung, für deren Richtigkeit uns der französische Autor den Beweis schuldig bleibt.
Von Geminianis Schülern nennen wir hier Matthiew Dubourg, geb. 1703 in London. Er war ein natürlicher Sohn des Tanzmeisters Isaac. Seine künstlerische Laufbahn eröffnete er als Knabe bei dem »musikalischen Kohlenmann« John Britton, in dessen Musiksaal er, um gesehen zu werden, auf einem Stuhle stehend, mit Corellis Kompositionen debütierte. Als Geminiani 1714 nach London kam, wurde Dubourg sein Schüler und bildete sich zu einem bedeutenden Violinisten. Vorzugsweise soll er sich im Vortrage des Zarten und Pathetischen ausgezeichnet haben. 1728 wurde er an Stelle Coussers zum Kapellmeister in Dublin, 1735 zum Kammermusikus des Prinzen von Wales und 1752 als Nachfolger Festings zum Direktor der königl. Musik ernannt. Von seinen zahlreichen Kompositionen wurde nichts gedruckt. Er starb (nach Gerber) in London (nach Pohl in Dublin) am 3. Juli 1767.
Sein Schüler John Clagg soll ihn an Fertigkeit und Gewandtheit übertroffen haben. Derselbe verlor, wie Gerber berichtet, durch übermäßiges Studieren den Verstand und endigte im Bedlamhospital, welchem er 1742 übergeben wurde.
Ein weiterer Schüler Geminianis ist Michael Christian Festing, der in London geboren wurde und am 24. Juli 1752 starb. Er war königl. Kammermusiker, um 1742 Kapellmeister in Ranelagh Gardens und Mitbegründer der Londoner » Society of Musicians« zur Unterstützung bedürftiger Musiker. Einige Violinwerke sowie Vokalkompositionen von ihm sind bekannt.
Eine andere Bedeutung als Geminiani gewann für das Violinspiel Pietro Locatelli. Er ist mit Rücksicht auf sein drittes Werk » L'arte del Violino, XII Concerti cioè, violino solo con XXIV Capricci ad Libitum etc.«, welches in Amsterdam (1733 nach Fétis) erschien, als Vater des modernen Violinvirtuosentums anzusehen. Da jedoch das Virtuosentum erst im weiteren Verlaufe des 18. Jahrhunderts zu einer Macht wurde, so ersparen wir eine nähere Betrachtung von Locatellis erwähntem Werk auf später und lassen es an dieser Stelle bei einem kurzen Überblick seines anderweiten Schaffens bewenden. Außer mehreren Sammlungen Concerti grossi, von denen die erste, op. 1, im Jahre 1721 erschien, sind 12 Kammersonaten für Violine und Baß, gefolgt von einem capriccio ( op. 6) aus dem Jahre 1737 für uns von Interesse.
Die Urteile über diese Werke sind merkwürdig verschieden. Fétis, der ein warmer Bewunderer Locatellis ist, erklärt, daß seine Sonaten und Konzerte voll graziöser Ideen sind und sich durch elegante Faktur hervortun, und über das zehnte Werk des Komponisten, » Contrasto armonico«, welches » Concerti à quattro« enthält, fügt er hinzu, es gelte für die schönste Arbeit Locatellis und zeichne sich durch Gefühl und gute Harmonie aus. Auch Torchi in seiner öfter zitierten Arbeit über die italienische Instrumentalmusik ist seines Lobes voll. Er nennt Locatelli neben dem jüngeren Veracini, Tartini und Vivaldi als Hauptvertreter einer der glänzendsten Perioden der italienischen Musikgeschichte und der Musikgeschichte überhaupt, vergleicht den Stil bereits seines ersten Werkes mit demjenigen Händels, den er sogar an Belebtheit der Zeichnung, Schwung der Leidenschaft und Abwechslung übertreffe, findet in seinen weiteren Werken noch eine bedeutende Weiterentwicklung und feiert vor allem sein op. 6, die 12 Kammersonaten für Violine, die trotz gewisser Opfer an das rein technische Element durch Macht der Konzeption, Verve und Schönheit wahre Muster italienischer Instrumentalkunst seien.
Man wird sagen dürfen, daß Torchi hier wie an andern Stellen seiner verdienstvollen Arbeit, veranlaßt einerseits durch die warme Bewunderung der musikalischen großen Vergangenheit seines Vaterlandes, andererseits durch die betrübende Vernachlässigung, die die modernen Italiener gerade ihrer nationalen Musik angedeihen lassen, den Mund etwas voll nimmt. Wenigstens wird sein Lob durch die Ausführungen Scherings wesentlich modifiziert, der in Locatellis Konzerten, wie auch der Verfasser des vorliegenden Buches, den Gehalt der Corellischen nicht wieder erreicht findet, sowie von kleinlicher Arbeit, mangelnder konstruktiver Kraft, äußerlichen Effekten und zwar ausdrucksvollen, aber nur zu oft in weinerliche Sentimentalität zurückfallenden Mittelsätzen redet. Auch das Urteil Scherings, daß Locatelli vielfach aus der gleichzeitigen Oper Anregungen schöpfte, und daß er ein »leidenschaftlicher Programmusiker« war, spricht nicht für eine starke und ursprüngliche schöpferische Kraft. Schließlich dürfte noch das rasche und dauernde Verschwinden seiner Werke vom Schauplatz ein freilich nur mit Vorsicht abzuwägendes Symptom sein. – Ein hübsches Cantabile aus der ersten Sonate des 6. Werkes teilt Torchi in der S. 53 genannten Sammlung mit.
Über Locatellis äußere Lebensumstände ist nur wenig bekannt. Zu Bergamo 1693 geboren, wurde er frühzeitig von seinen Eltern nach Rom geschickt, um dort Corellis Unterricht zu empfangen. Nach mehreren Reisen ließ er sich in Amsterdam nieder. Hier machte er sich durch Einrichtung stehender, von ihm geleiteter Konzerte verdient, mit denen er den Grund zu einem regelmäßigen öffentlichen Musikleben der altberühmten Handelsstadt legte. Die Kunstfreunde Amsterdams ließen es dagegen nicht an Beweisen aufrichtigster Wertschätzung fehlen und legten beim Ableben des Künstlers, wie es beim Verluste teurer Personen geschieht, Trauerzeichen an. Locatelli starb 1764.
Pietro (nach Pohls Angabe Prospero) Castrucci, geb. 1689 zu Rom, trat 1715 als trefflicher Violinist in die Dienste des Grafen Burlington, der ihn nach London zog. Hier übernahm er die Direktion des italienischen Opernorchesters und tat sich besonders als Solospieler in Händels Opern hervor, in denen ihn Quantz 1727 hörte. Angeblich soll Castrucci das Modell zu Hogarths » enraged Musician« abgegeben haben. Doch ist die Sache einigermaßen zweifelhaft. Riepenhausen, der Herausgeber von Lichtenbergs Erklärungen zu Hogarths Kompositionen, sagt über die betreffende Darstellung: »In keinem Hogarthschen Blatte haben die Erklärer so viele Schwierigkeiten gefunden, oder vielmehr finden wollen, als in dem vor uns liegenden, indem sie sich weder über die Hauptfigur noch über die Beiwerke vereinigen können. Die erste Schwierigkeit, welche die Erklärer beschäftigt, ist der Name des entrüsteten Violinspielers. Roquet hält ihn für einen Italiener, den das Geräusch von London in Wut bringt; Nichols für den berühmten Castrucci, Ireland aber, dem Lichtenberg folgte, für John Festin (einen damals in London lebenden Flöten- und Oboenspieler). Das Ganze ist, wie bereits Lichtenberg vermutete, gegen die Italienische Oper und wahrscheinlich gegen Castrucci gerichtet.« Castrucci hatte das Unglück, später wahnsinnig zu werden, und man behauptet, daß sein maßloser Kunstenthusiasmus die Ursache davon gewesen sei. Er unterlag seinen Leiden 1769. Castrucci veröffentlichte zu London zwei Sonatenwerke und 12 Violinkonzerte. Die von ihm in Cartiers » L'art de Violon« mitgeteilte Violinfuge verrät keine hervorragende Begabung für die Komposition.
Carbonelli (Stefano), dessen Geburtsjahr unbekannt ist, folgte 1719, nachdem er schon längere Zeit in Rom gewirkt, einer Einladung des Herzogs von Rutland nach London, der ihn in sein Haus aufnahm. Aus Dankbarkeit komponierte Carbonelli 12 Violinsolos, die er seinem Gönner widmete. 1720 wurde er Vorspieler bei der neu gegründeten Londoner Musikakademie. Fünf Jahre später gab er diese Stellung aber auf, um als Orchesterführer beim Drury-Lane-Theater einzutreten. Doch auch hier hielt er nicht lange aus; er schied aus seinem Wirkungskreise aus, um sich an Händels Oratorienaufführungen zu beteiligen.
Carbonelli scheint ein unbeständiger Charakter gewesen zu sein. In späteren Jahren gab er die Musik gänzlich auf und widmete sich dem Weinhandel, wobei er es bis zum königl. Hoflieferanten brachte. Als solcher starb er hochbetagt im Jahre 1772 zu London.
Von Giovanni Mossi ist weiter nichts bekannt, als daß er nach vollendeter Lehrzeit bei Corelli sich in den römischen Musikkreisen durch sein Violinspiel rühmlich hervortat, und daß er fünf verschiedene Werke, teils Sonaten, teils Konzerte für die Geige veröffentlichte. Von jenen hebt Torchi die im Jahre 1720 veröffentlichten Kammersonaten für Violine und Baß als besonders trefflich hervor. Die von ihm mitgeteilten Notenbeispiele erwecken den Wunsch, eine oder die andere der Mossischen Sonaten der Allgemeinheit wieder zugänglich gemacht zu sehen.
Unter den namhaften Vertretern der Corellischen Schule findet sich auch ein Franzose, Baptiste Anet, in betreff dessen wir auf den Abschnitt über das französische Violinspiel verweisen.
Corellis ruhmreiches Wirken hatte der neuen Kunst in Italien, zumal in den nördlichen Provinzen der Halbinsel, einen mächtigen Aufschwung gegeben. Sie war bereits mit Beginn des 18. Jahrhunderts in alle Lebenskreise eingedrungen, und es gehörte gewissermaßen zum guten Ton, entweder Violine zu spielen, oder doch für dies Instrument Musik zu setzen. Mitglieder vornehmer Familien komponierten und spielten mit Fachmännern um die Wette. Es sei nur an die Venezianer Gebrüder Marcello erinnert, die sich gleichfalls der Instrumentalkomposition zuwendeten, obwohl das eigentliche Gebiet ihrer Tätigkeit die Vokalkomposition war. Auch der Klerus, getreu dem alten Herkommen, die schönen Künste pflegen und fördern zu helfen, beteiligte sich nach wie vor mit Eifer und Erfolg an dem geschäftigen Treiben. Wiederum bietet die märchenhafte Lagunenstadt Venedig, welche demnächst aufs neue wichtigen Anteil an dem Entwicklungsgange der Violinkomposition nahm, für diese Erscheinung ein glänzendes Beispiel. Dort hatte die Tonkunst seit Beginn des 16. Jahrhunderts neben der Malerei einen fruchtbaren Boden gefunden. Eingebürgert durch den Niederländer Adrian Willaert († 1563) wurde sie von dessen Nachfolgern Cyprian de Rore, Andrea und Giovanni Gabrieli, Caldara Zwei Sätze einer Sonate Caldaras (1700) teilt L. Torchi in der Collection Boosey mit. und Lotti (sämtlich wichtige Vertreter des Kirchenstiles) fortgeführt. Als die um 1600 aufgekommene Oper dann nach hundertjährigem Wachstum mehr und mehr in den Vordergrund des öffentlichen Lebens getreten war, nahmen die Musiker Venedigs, obwohl die weitere Entwicklung dieser Kunstgattung vorzugsweise der neapolitanischen Schule überlassen blieb, gleichfalls an der Bühnenkomposition teil. Der Name Marcello wurde schon erwähnt. Bedeutende venezianische Opernkomponisten ihrer Zeit waren ferner Francesco Cavalli (etwa 1600-1676) und Marc Antonio Cesti (geb. etwa 1620 in Arezzo, gest. 1669 in Venedig). Der erstere, ein Schüler Monteverdes, hat 42 Opern geschrieben, von Cesti kennen wir 12. In den Werken dieser Männer beginnen denn auch die Violinen eine wichtigere Rolle im Orchester zu spielen, als ihnen bei Monteverde noch eingeräumt wurde. Ritornelle und Zwischenspiele werden meist den Violinen allein überlassen, nicht minder werden sie zu Wirkungen besonderer Art, z. B. bei dem Eintritt der Stimme eines Geistes, verwendet, wo sie lange Akkorde auszuhalten haben (H. Kretzschmar »Die Venet. Oper usw.«, Vierteljahrschr. f. Musikwissensch. 1892). Tätig zeigten sich ferner in diesem Gebiete Tommaso Albinoni und Antonio Vivaldi. Der erstere schrieb 49, der letztere 31 Opern. Beide Männer waren aber auch sehr fleißige Instrumentalkomponisten mit besonderer Bevorzugung der Violine. Hier lassen sie den Einfluß der Corellischen Satzweise erkennen.
Über das Leben Albinonis, eines 1674 geborenen Venezianers (gest. 1745), fehlen alle näheren Nachrichten. Man ist durch die von ihm vorhandenen Kompositionen, deren vollständiges Verzeichnis Fétis mitteilt, nur über seine Tätigkeit als Tonsetzer unterrichtet. Daß er nicht Musiker von Fach war, darf mit Gewißheit aus dem Titel seines ersten Sonatenwerkes für 2 Violinen und Baß geschlossen werden, welcher neben dem Epitheton » Musico di Violino« die ausdrückliche Bezeichnung » Dilettante Veneto« enthält. Nichtsdestoweniger zeigen seine Arbeiten ein ernstes, gründliches Studium, und im Hinblick auf formelle Gewandtheit hält er gleichen Schritt mit den namhaftesten Komponisten seiner Zeit. Hierin besteht aber auch sein ganzes Verdienst. Albinonis Musik ist von der philisterhaftesten Trockenheit. Kaum gelingt es ihm momentan einmal, sich über den leeren Schematismus des Formenwesens zu erheben, in dem er vielmehr völlig aufgeht. Die leere Figuration tritt meist an Stelle melodischer Gestaltung, und in diesem Sinne sind seine Allegrosätze reichlich bedacht, während das Adagio ihn fast immer nur vorübergehend beschäftigt.
Diesem Urteile schließt sich neuerdings auch Torchi an, indem er Albinoni summarisch unter denjenigen Komponisten aufführt, die um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts eine Verflachung und Veräußerlichung der instrumentalen Produktion veranlaßten, der gleichzeitig durch Corelli und den älteren Veracini erfolgreich entgegengetreten wurde. Diese Veräußerlichung betrifft teils die musikalische Geringwertigkeit der verarbeiteten Gedanken selbst, teils das Formelhafte und Schematische ihrer Verarbeitung. Dieses mußte einerseits zur Vielschreiberei, anderseits dazu führen, die als nötig empfundene Mannigfaltigkeit in Äußerlichkeiten zu suchen, unter denen Überladung mit technischem Detail sowie das ausartende Verzierungswesen speziell in den langsamen Sätzen vorzüglich zu nennen sind. Aber auch die oft wiederkehrende Neigung gerade der am gründlichsten veralteten italienischen Künstler dieser Epoche zur Programmusik sowie ihre Beeinflussung seitens der Oper hängt sicher hiermit zusammen, da die malende Musik sowohl als die malende Poesie oder die erzählende Malerei Abartungen sind, die nur zu leicht Ausartungen werden und stets auf eine Schwäche oder Unsicherheit des künstlerischen Instinkts, oft ganzer Perioden, hindeuten.
Übrigens spricht Schering Albinoni ein nicht unbeträchtliches musikhistorisches Interesse in Hinsicht auf seine Konzerte zu, die eine vermittelnde Stellung zwischen dem älteren und neueren Konzertstil einnehmen, und gibt weiter an, daß wenigstens einzelne seiner Kompositionen, speziell sein fünftes Werk, neben gediegener Kontrapunktik auch schöpferische Phantasie offenbaren. Wenn jedoch Fétis zusammenfassend bemerkt, daß Albinoni mehr Talent im Gebiete der Instrumentalmusik als in seinen Opern zeigt, so müssen die letzteren tatsächlich Musterstücke unvergleichlicher Sterilität und Langweiligkeit sein. Unwillkürlich drängt sich die Frage auf, wo die Venediger Geduld und Wohlwollen hernahmen, um solche Bühnenwerke ruhig mit anzuhören, da ausdrücklich berichtet wird, daß Albinonis Opern fast ohne Ausnahme über die venezianische Bühne gingen. Es scheint indes, daß man in diesem Punkt nicht zu anspruchsvoll war; denn auch Vivaldis Kompositionen, die freilich größere Bedeutung für die Violinliteratur beanspruchen dürfen, offenbaren weder viel Phantasie noch poetische Stimmung.
Antonio Vivaldi Die Mitteilungen über Vivaldi erscheinen im wesentlichen unverändert. Die sachlichen Grundlagen, auf denen Torchi sowie auch Schering (Gesch. d. Instr.-Konzerts) zu einem vorteilhafteren Urteil über Vivaldi kommen, sind nicht abweichend von denen des Verfassers. Es handelt sich vielmehr um eine verschiedenartige Bewertung derselben Dinge. Dem Herausgeber scheint aus dem Vergleich der ihm bekannt gewordenen Urteile früherer und neuerer Autoren sowie aus dem, was er selbst von Vivaldis Musik kennt, hervorzugehen, daß er zu denjenigen Talenten gehörte, denen zu einem wahrhaft bedeutenden Künstler nichts abgeht als die Fähigkeit und das Bedürfnis innerlicher seelischer Vertiefung des von ihnen Hervorgebrachten – damit freilich das Beste und im höheren Sinne einzig Wertvolle. Ist ein solcher Mensch ein spekulativer Kopf, so wird er rein äußerlich betrachtet vieles Neue bringen und hierdurch für seine Zeit eine Bedeutung erhalten, die endet, sobald die technischen von ihm versuchten Neuerungen, soweit sie in künstlerischem Sinne ergiebig gemacht werden konnten, Gemeingut geworden sind. Der Kunsthistoriker, soweit er rein wissenschaftlich verfährt, wird einen solchen Künstler günstiger beurteilen, als derjenige Betrachter, der neben der historischen Bedeutung, ja über ihr, die menschlich-künstlerischen Werte aufsucht. Müßten wir uns bei dem Namen Beethoven zunächst daran erinnern, daß er Posaunen und Menschenstimmen in die Symphonie eingeführt, Bachesrauschen, Vogelstimmen und Gewitter »darzustellen« versucht, den ersten Sonatensatz durch thematische und konstruktive Erweiterungen bereichert, viele neue Figuren und Harmonien erfunden habe – und weiter nichts, so würde er uns herzlich gleichgültig sein, so sicher auch dann ein Einfluß auf die musikalische Produktion der Mit- und Nachwelt festzustellen sein würde. Das Entscheidende ist in jedem Falle, ob jemand etwas neues innerlich Geschautes zu sagen hat und daher mehr oder weniger bewußt zu neuen Worten, Formen, Farben, Instrumenten, Figuren kommt, oder ob er alle diese Dinge anwendet, weil es ihm gerade in den Sinn kommt, sie anzuwenden, einer mehr oder weniger äußerlichen Abwechselung zuliebe. Der neue Mensch wird sich neu ausdrücken, aber die bloße Anwendung neuer Ausdrucksmittel schafft nichts Neues von Wert. – Eine definitive Entscheidung könnte bei Vivaldi nur durch öffentliche Aufführungen gegeben werden. gleichfalls in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Venedig geboren (gest. 1743), war Abbate, also Weltgeistlicher mit dem Beinamen il preto rosso, den man ihm seines roten Haupthaares wegen gegeben hatte. Die Ausübung seines klerikalen Berufes scheint ihn nicht sonderlich belastet zu haben, obwohl nach Gerber seine Neigung zur Bigotterie so stark war, daß er den Rosenkranz nicht eher aus der Hand legte, bis er die Feder ergriff, um eine Oper zu schreiben; denn es ist uns ein Vorfall aus seinem Leben aufbehalten, welcher erkennen läßt, wie sorglos und gemächlich er den kirchlichen Dienst versah. Einstmals, da er seine tägliche Messe las, überkam ihn die Kompositionslaune. Ohne Bedenken unterbrach er die priesterliche Funktion, begab sich in die Sakristei, um dort seiner musikalischen Gedankenbürde sich zu entledigen, und kehrte, nachdem dies geschehen war, an seinen Platz zur Beendigung der Zeremonie zurück. Die Sache wurde natürlich auf der Stelle anhängig gemacht und Vivaldi wegen dieses Disziplinarvergehens von der kirchlichen Behörde inquiriert. Man ließ indessen Gnade vor Recht ergehen und schritt zu dem bequemen Auskunftsmittel, ihn für einen Menschen zu erklären, dessen Kopf nicht ganz in Ordnung sei. Doch erhielt er die Weisung, sich in Zukunft des Messelesens gänzlich zu enthalten.
Wer sollte im Hinblick auf dieses Ereignis nicht glauben, daß Vivaldi ein tiefsinniger, gedankenreicher, von dem heiligen Geist der Kunst inspirierter Tondichter gewesen sei? Und doch ersehen wir aus der Beschaffenheit seiner massenhaften Kompositionen, von denen in der königl. Privatmusiksammlung zu Dresden allein 80 Violinkonzerte aufbewahrt werden, daß nur die holde Gewohnheit des Daseins als Ursache einer so sträflichen Extravaganz betrachtet werden kann. Gewiß, Vivaldi war ein Vielschreiber in des Wortes verwegenster Bedeutung. Er gehört zu jenen Naturen, die im Besitze bedeutender Technik und außerordentlichen Formgeschickes immerdar zur Produktion bereit sind, ohne viel nach Bedeutung und Gehalt des Hervorgebrachten zu fragen. In der Tat enthalten seine Kompositionen (wir fassen hier zunächst diejenigen für Violine ins Auge) nur selten Regungen tieferer Empfindung, beachtenswerter Gedankenkraft und wahrhafter Kunstweihe. Zur Hauptsache ist es bei ihm immer die Form, welche den musikalischen Geist beschäftigt. Hier aber gelang es Vivaldi, einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf seine Zeitgenossen auszuüben. Er ist, um es mit einem Worte zu sagen, wenn auch nicht der Schöpfer, so doch der Verbesserer des »Konzertes im italienischen Stil«, dessen gesamte Struktur zu Anfang des vorigen Jahrhunderts maßgebend für alle Komponisten ohne Ausnahme wurde. Gerber bemerkt richtig, daß Vivaldi mit seinen Konzerten mehr als 30 Jahre den Ton in dieser Kunstgattung, namentlich für die von Quantz und Benda beliebte Manier angegeben hat. Dem ist hinzuzufügen, daß selbst ein Genius wie Joh. Seb. Bach es nicht verschmähte, eine Reihe (der Zahl nach 16) Vivaldischer Violinkonzerte für Klavier und 4 für Orgel zu bearbeiten, offenbar in der Absicht, die leichtflüssige formgewandte Satzweise des Italieners für seine eigenen ähnlichen Arbeiten zu verwerten. Denn daß Bach mit diesen Transkriptionen dem berühmten Zeitgenossen eine Huldigung habe darbringen wollen, ist um so weniger anzunehmen, als unser Großmeister weder Muße noch Neigung zu solchen Höflichkeitsbezeigungen hatte, des Umstandes nicht zu gedenken, daß gerade diese Arbeiten zu Bachs Lebzeiten unbekannt blieben. Sie wurden erst in neuerer Zeit der Öffentlichkeit (Leipzig bei Peters) übergeben, so daß Vivaldi gewiß nichts von der verbesserten Auflage seiner Kompositionen erfahren hat.
Ein Kunstgeist wie Joh. Seb. Bach genießt das seltene Vorrecht, alles auf seiner Laufbahn ihm Begegnende sich anzueignen, um es für die Kunst zu verwerten. Er hat die Italiener sicherlich so gut studiert, wie irgend ein Deutscher, und z. B. auch von Vivaldi gelernt, wie man Konzerte im »italienischen Stil« schreiben müsse. Freilich sind durch die Umprägung erst Münzen von Gehalt entstanden. Es kann hier um so weniger die Absicht vorliegen, einen Bach auf Kosten Vivaldis zu feiern, je tiefer die Kluft ist, welche beide Männer voneinander trennt. Man vergleiche indessen einmal das Vivaldische Konzert, welches sich in der Privatmusiksammlung des Königs von Sachsen befindet, mit der Bachschen Bearbeitung und sehe, was aus dem dürren Skelett des italienischen Komponisten geworden ist Ähnlich wird es sich mit den andern Vivaldischen Konzerten verhalten, welche Bach für das Klavier bearbeitet hat. In Spittas Bach-Biographie (Bd. II, S. 984) findet sich die Mitteilung, »daß das zweite Konzert der Klavier-Arrangements in Vivaldis Op. 7, Nr. 2 zu finden sei, das erste in Op. 3, Nr. 7, das neunte in Stravaganza 1«. Von den »Orgelkonzerten« Bach-Vivaldis ist besonders der erste Satz des zweiten (A-moll) bemerkenswert.. Wahrlich, wie durch Zauberkraft ist hier ein kümmerlich begrüntes Grasbeet in ein gefälliges Blumenstück verwandelt!
Je weniger Phantasie und Tiefe Vivaldi in seinen Kompositionen zeigt, desto erfinderischer ist er in Äußerlichkeiten aller Art. Er hat Konzerte für eine, zwei, drei und vier Violinen mit Begleitung geschrieben, die eine sinnreiche, mannigfaltige und dazu völlig fachgemäße Behandlung der Solopartien aufweisen. So existiert von ihm ein Tripelkonzert (F-dur), in dessen mittlerem Stück ( Andante) die kantileneführende Violine von der zweiten und dritten Solovioline durch Pizzicatofiguren und Arpeggios begleitet wird. Ein anderes Konzert für zwei Violinen ist mit der Intention gesetzt, die zweite Solopartie als »Echo der ersten aus der Ferne« erklingen zu lassen.
Auch in der Instrumentation griff Vivaldi zu Neuerungen, die eine Bereicherung des Kolorits ergeben. Zwar hatte schon Albinoni durch Benutzung von Oboen das Streichorchester zu ergänzen versucht und Torelli in seinen Concerti grossi neben diesen noch Trompeten, auch wohl Hörner oder Posaunen gelegentlich zur Anwendung gebracht. Aber erst Vivaldi ging hierin insofern weiter, als er verschiedenartige Blasinstrumente in eigentümlicher und selbständiger Weise, gelegentlich schon in modernem Sinne instrumentierend, neben dem Ensemble der Streicher verwendete. Namentlich bedient er sich der Hörner und Oboen, gelegentlich auch der Flöten, in dem angedeuteten Sinne. Auch den Fagott zieht er herbei, läßt ihn jedoch nicht immer selbständig, sondern meist im Einklang mit den Bässen auftreten. Bei außerordentlichen Anlässen verstieg sich Vivaldi sogar zu einem für seine Zeit seltenen Aufgebot an Instrumentalmitteln. In der königl. Privatmusiksammlung zu Dresden befindet sich ein Partiturvolumen, welches drei zu Ehren des Kurfürsten Friedrich Christian von Sachsen bei dessen Anwesenheit in Venedig (1740) von Vivaldi komponierte und im » Pio Ospitale della Pietà« aufgeführte Konzerte enthält. Das erste derselben ist folgendermaßen instrumentiert: » 2 Flauti, 2 Teorbe, 2 Mandolini, 2 Salmò, 2 Violini in Tromba Marina, et un Violoncello.« Das dritte Konzert hat dagegen folgende völlig abweichende Instrumentation: » Viola d'amour, Leuto e con tutti gl' Istromenti Sordini.« Dergleichen Klangkombinationen waren damals in der Instrumentalmusik, wenigstens für Italien, völlig neu. Ganz wesentlich unterscheiden sie sich von der Instrumentationsweise G. Gabrielis und dessen Nachahmers Buonamente. Diese Männer benutzten neben den Streichinstrumenten hauptsächlich das Kornett und die Posaune. Flöte und Fagott kommen nur ausnahmsweise vor, so z. B. bei Massimiliano Neri. Während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts blieb der Instrumentalsatz in Italien hauptsächlich auf die üblichen Streichinstrumente beschränkt.
Wie sehr Vivaldi durch seine Anlage auf eine Bereicherung äußerer Ausdrucksmittel hingewiesen war, ersehen wir übrigens auch aus einer Mitteilung Quantzens, welcher im Hinblick auf die Bühnenkompositionen des Venezianers sagt, »er habe bei seiner Anwesenheit in Rom den sogenannten lombardischen Geschmack eingeführt und die Römer dadurch dergestalt eingenommen, daß sie fast nichts hätten hören mögen, was nicht in diesem Geschmack geschrieben gewesen«. Gerber fügt dem erläuternd hinzu: »Das Besondere dieses Geschmacks besteht einzig und allein in den verschobenen Akzenten, oder in dem Tempo rubato, dessen sich die Violinisten jetzt häufig bedienen. Wenn man z. B. das Wort Leben also singen läßt, daß zwar die Silbe Le- auf den Niederschlag kommt, aber eine kurze Note enthält; und hingegen die Silbe -ben, eine lange Note, aber im Aufschlag. Beispiele von dieser Manier findet man in Pergoleses › Stabat mater‹ und noch neuerlich in einer Ariette aus › Cosa rara‹ von Martin.«
Übereinstimmend hiermit berichtet Hiller in seinen Lebensbeschreibungen berühmter Männer: »Die Vivaldischen Konzerte hatten auf Quanz auch einen wichtigen Einfluß als Kompositionen. Er nahm sie sich zum Muster. 1742 ging er nach Rom, wo eben der durch Vivaldi eingeführte lombardische Geschmack aufgekommen war; dieser Geschmack ist kein anderer, als wenn von zwei gleichen Noten die erste um die Hälfte kürzer gemacht und der zweiten ein Punkt beigefügt wird Über diese Spielmanier bemerkte Quantz in seiner Flötenschule, sie habe »ohngefähr im Jahre 1722« ihren Anfang genommen. Indessen findet sie sich schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mehrfach bei gewissen Komponisten Oberitaliens, so z. B. bei Biagio Marini, Giov. Battista Fontana und Marco Uccellini..«
Auch in der Programmusik hat Vivaldi sich versucht, doch nicht in dem harmlos naiven Sinn, wie Farina und nach ihm der deutsche Geiger Joh. Jakob Walther S. diesen im folgenden Abschnitt über das deutsche Violinspiel., sondern auf anspruchsvollere Weise. In seinem » Cimento dell' Armonia«, einem aus 12 Violinkonzerten zu 4 und 5 Stimmen bestehenden und als Op. 8 edierten Sammelwerke, ist ein Stück zur Schilderung eines Seesturmes und ein anderes zur Darstellung einer Jagd bestimmt. Bei weitem bezeichnender aber für die in solcher Richtung von Vivaldi unternommenen Bestrebungen erscheinen die vier ersten Konzerte dieser Sammlung, welche der gründlichsten Tonmalerei gewidmet sind. Als erläuterndes Programm hat der Komponist denselben vier wie es scheint selbstverfaßte Sonette vorangestellt, welche die Freuden und Leiden der Jahreszeiten erläutern. Sie beginnen mit dem Frühling und schließen mit dem Winter, und in dieser Reihenfolge bewegen sich auch die dazu komponierten Konzerte, von denen jedes einzelne mit spezieller Beziehung auf das dazu gehörige Gedicht eine der Jahreszeiten behandelt. Wie sorgfältig nun auch Vivaldi bei seiner Tonmalerei zu Werke gegangen ist, – es mögen ihm doch Zweifel darüber entstanden sein, ob man seine tondichterischen Intentionen überall erkennen und verstehen werde; denn er bezeichnet die einzelnen Verse der Sonette mit Buchstaben, welche zugleich in den Konzerten an den entsprechenden Stellen vermerkt sind, um so dem Spieler handgreiflich zu Gemüte zu führen, was die Tonfolgen im einzelnen Falle ausdrücken sollen.
Belustigend ist es, was alles Vivaldi musikalisch darzustellen sucht. Hier eine gedrängte Mitteilung davon.
In dem mit » la Primavera« überschriebenen Konzert wird der Beginn des Frühlings, der Vogelgesang, das Murmeln des Quells, der Blitz und Donner, der schlafende Ziegenhirt mit seinem treuen Hunde und der von einer Schalmei begleitete Tanz zwischen Hirten und Nymphen musikalisch geschildert.
Der Sommer beginnt mit der ermüdenden Hitze, worauf der Kuckucksruf und das Girren der Turteltaube ertönt. Darauf folgt der linde West- und der stürmische Nordwind. Hieran schließen sich Klagen des um seine Wohlfahrt besorgten Bauern, nach denen im Finale ein furchtbares Ungewitter mit obligatem Hagelschlag in Szene gesetzt wird.
Gemütlicher ist der Herbst ausgemalt: er wird durch Tanz und Gesang der Landleute eingeleitet, in deren Mitte sich alsbald ein infolge des Weingenusses hin und her taumelnder Bruder Lustig bemerklich macht, worauf alle miteinander sich zu einem erquickenden Schläfchen niederlegen. Alsdann ertönen Jagdrufe; die Freunde der waidmännischen Belustigung kommen herbei und verfolgen das flüchtende Wild, welches, tödlich getroffen, zur erwünschten Beute der Schützen wird.
Endlich im vierten Konzert erfolgt die Schilderung des Winters. Zunächst versinnbildlicht uns der Komponist in Tönen das Zittern der Glieder bei Sturm und Frost, sowie das Umherlaufen und Aneinanderschlagen der Füße zur Erwärmung, und überdies die vor Kälte klappernden Zähne. Nachdem dies alles gründlich ausgemalt ist, wird uns eine Szene am wärmenden Herd vorgeführt, und hierauf eine Schlittschuhpartie, bei welcher die ungeschickt Ausgleitenden natürlich niederfallen. Dies Vergnügen wird aber alsbald vom Tauwetter bringenden Scirocco unterbrochen. Das Ganze schließt mit dem tosenden Kampfe der auf das nahende Frühjahr hindeutenden Winde aller Himmelsgegenden.
Das Interessanteste an diesen Kompositionen möchte wohl die durch dieselben hervorgerufene Vermutung sein, daß sie möglicherweise den Anstoß zu Haydns »Jahreszeiten« gegeben haben. Die Idee, diesen Gegenstand für ein oratorisches Werk zu verwerten, ist allerdings ungleich glücklicher, als eine bloß instrumentale Behandlung desselben, die bekanntlich auch L. Spohr in einem symphonischen Werk ohne durchgreifenden Erfolg versucht hat; denn das gesungene Wort, unterstützt durch andeutende Tonmalerei im Orchester, vermag bei weitem mehr und besser gewisse menschliche Handlungen, sowie jene Betrachtungen und Gemütsstimmungen, welche aus der Anschauung des Naturlebens hervorgehen, zum bezeichnenden und verständlichen Ausdruck zu bringen. Das eigentlich Unterscheidende zwischen dem italienischen und deutschen Tonsetzer ist indessen in diesem Falle die produktive Leistungsfähigkeit. Haydn machte in seinen »Jahreszeiten« sehr schöne Musik, was man von Vivaldis gleichnamigem Werk nicht behaupten kann. Seine Gestaltungsweise ist hier wie in seinen andern zahlreichen Kompositionen reizlos, wenn auch mehrenteils ganz verständig. Zumeist ist es das formelle Geschick, sowie die Vielgestaltigkeit des für die Violine ersonnenen Passagenwerkes, was bei Vivaldi zur Anerkennung auffordert. Manche dieser Figurationen sind in technischer Beziehung schwierig, wobei denn zu bemerken ist, daß die Geigenmeister jener Zeit eine große Bogengewandtheit in Ausführung gewisser, jetzt nur noch selten vorkommender Arpeggios gehabt haben müssen, bei denen auf jede Note ein besonderer Strich kommt, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Vivaldis Konzerte und Sonaten zeigen eine schematisch formfeste Struktur von entschiedenem, scharf ausgeprägtem Duktus. Der im Hinblick auf Torelli, Corelli und Albinoni durch ihn bewirkte Fortschritt besteht hauptsächlich in der breiteren und dabei stets klar gegliederten Entwicklung der Allegrosätze. Sie wird durch eine freiere, mannigfaltigere, nicht immer leicht ausführbare Figuration belebt, deren natürlich sich ergebende Folge dem Gang der Musikstücke eine ungezwungene Bewegung verleiht. Also auch hier, gleichwie in der Instrumentation, bewirkte Vivaldi eine wesentliche Modifikation. Er vervollständigte und festigte gleichsam das Gerüst der Sonatenform und versah dadurch die Zeitgenossen mit einem Kunstapparat, dessen Anwendung eine sichere Basis für das weitere Schaffen ergab. Man hatte durch Vivaldi bestimmtere Haltpunkte für die Formgebung gewonnen und konnte, auf dieselben gestützt, um so unbefangener sich dem Zuge der Inspiration überlassen, ohne zu sehr durch das »Wie« der Gestaltung in Anspruch genommen zu werden.
Vivaldi bekleidete in Venedig, wie aus den Titeln verschiedener seiner Kompositionen zu ersehen ist, das Amt eines Maestro de Concerti am Pio Ospitale della Pietà, nachdem er einige Zeit als Violinist in Diensten des Landgrafen Philipp von Hessen-Darmstadt gestanden und dann 1713 in seine Vaterstadt zurückgekehrt war. Daneben führte er den Titel » Musico di Violino«. Die Lehre auf diesem Instrument verdankte er seinem Vater Giovanni Battista Vivaldi, einem bei der Kapelle von S. Marco angestellten Violinisten. Das » Pio Ospitale della Pietà« war eine der vier venezianischen Musikschulen. Nach Lord Edgecumbes Reminiszenzen und Kellys Mitteilungen bestanden in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts vollständige Konservatorien musizierender Damen, die in der Kirche ganze Oratorien aufführten. Es waren Waisenhäuser, von reichen Bürgern der Stadt erhalten. La Mercadante Pohl: »Mozart und Haydn in London.« Eine venezianische Musikschule namens Mercadante finde ich sonst nirgend angegeben. Die vier bekannten Konservatorien Venedigs waren: Ospitale della Pietà, Ospetaletto, gli Mendicanti und gl' Incurabili. war berühmt durch seine Sängerinnen, la Pietà durch sein Orchester. In letzterem waren 1000 Mädchen, von denen 140 die Instrumentalbegleitung bei den Aufführungen versahen. Dittersdorf berichtet über diese Konservatorien in seiner Autobiographie: »Es taugt niemals, wenn man von einer Sache vorher zuviel eingenommen ist. Nicht nur in Wien hatte ich vorlängst gehört, sondern auch unterwegs erzählte mir Signora Marini, daß agl' incurabili und alla Pietà zu Venedig ein Orchester von Frauenzimmern wäre, das sowohl in Absicht der Singstimme als der Exekution alle Orchester in Italien überträfe. Kaum konnte ich den Tag erwarten. Aber wie fand ich mich betrogen! Die Komposition dieses Oratoriums war sehr mittelmäßig; die Violinen waren durch das ganze Stück verstimmt, und wenn eine Aria aus dem D fa oder E la fa kam, griffen die Violinstimmen um einen Achtel- auch wohl Viertelton zu hoch Ein ähnliches, doch allgemeiner gehaltenes Urteil findet sich in Reichardts musikalischem Kunstmagazin Bd. 2, S. 17. – Genauere Nachrichten über die Konservatorien Venedigs enthalten Hillers »Wöchentliche Nachrichten«, Jahrg. 2, S. 176 ff..« Einen Überrest dieser Institute fand Spohr noch 1816 bei seinem Aufenthalte in Venedig vor. Er sagt darüber: »Um vier Uhr besuchten wir die zum Findelhause gehörige Kirche, wo von den weiblichen Findlingen eine Messe gegeben wurde. Das Orchester und der Chor waren ausschließlich von jungen Mädchen besetzt; eine alte Musiklehrerin schlug den Takt, eine andere akkompagnierte auf der Orgel. Es gab da mehr zu sehen als zu hören, denn Komposition und Ausführung waren gleich schlecht. Die Mädchen hinter den Geigen, Flöten und Hörnern nahmen sich sonderbar genug aus; die Kontrabassistin konnte man leider nicht sehen, weil sie hinter einem Gitter versteckt war. Unter den Stimmen gab es einige gute und eine besonders merkwürdige, die bis zum dreimal gestrichenen g sang; der Vortrag war von allen abscheulich.« Heute ist von diesen Musikschulen kaum noch etwas übrig, und auch wohl zur Zeit ihrer Blüte haben sie höhere künstlerische Bedeutung nicht gehabt. Die einzige uns bekannte namhafte Persönlichkeit wenigstens, welche aus dem Konservatorium della Pietà hervorging, war die Violinspielerin Regina Strinasacchi, jene Künstlerin, für welche Mozart in Wien die B dur-Sonate mit Violinbegleitung komponierte. Regina Strinasacchi, eine der bedeutendsten Violinvirtuosinnen des vorigen Jahrhunderts, wurde 1764 zu Ostiglia bei Mantua geboren. Sie spielte mit Auszeichnung neben berühmten Künstlern im Pariser Concert spirituel, machte 1784 eine größere Kunstreise nach Deutschland und verheiratete sich 1785 mit dem Violoncellisten Johann Konrad Schlick, Herzogl. Gothaischem Konzertmeister. Nach dessen Tode lebte sie in Dresden und starb dort 1839. Leop. Mozart berichtet über sie: »Sie spielt keine Note ohne Empfindung, sogar bey den Sinfonien spielte sie Alles mit Expression, und ihr Adagio kann kein Mensch mit mehr Empfindung und rührender spielen als sie; ihr ganzes Herz und Seele ist bey der Melodie, die sie vorträgt; und ebenso schön ist ihr Ton und auch Kraft des Tones. Überhaupt finde, daß ein Frauenzimmer, die Talent hat, mit mehr Ausdruck spielt als eine Mannsperson.«
Abgesehen von diesen venezianischen Musikschulen, die mit geringen Ausnahmen wohl hauptsächlich für örtliche Bedürfnisse berechnet waren, zog Vivaldis persönliches Ansehen einzelne bedeutende auswärtige Talente nach Venedig. Wir sahen schon, daß Somis, der Schüler Corellis, Vivaldi aufsuchte. Außer diesem führt Gerber einen Deutschen: Daniel Theophil Treu Über Treu vgl. den folgenden Abschnitt »Deutschland« dieses Buches. (er hatte seinen Namen italianisiert und nannte sich demzufolge auch Fedele) als Schüler Vivaldis an. In diesem Zusammenhange mag eine Notiz M. Brenets ( Les concerts en France sous l'ancien régime) über eine sonst, wie es scheint, unbekannte Violinistin Platz finden. Sie lautet: » Mme Tasca, Vénetienne, de la musique de l'empereur, se présenta le 8. Septembre (1750) avec un concerto de sa composition, ›dans le goût de Vivaldi‹.«
Der Richtung Vivaldis verwandt ist der venezianische Instrumentalkomponist Francesco Antonio Bonporti (geb. 1678, gest. 1740). Auch er bietet ein bemerkenswertes Beispiel für die rege Beteiligung des Dilettantismus an der Violinkomposition. Mit Selbstbewußtsein nennt er sich » Nobile dilettante e familiare aulico di S. M. Cesarea«, bezüglich seiner Stellung am Wiener Hofe. Es sind von ihm verschiedene, dem damaligen Standpunkt angemessene Violinwerke im Druck erschienen. Sie lassen völlige künstlerische Durchbildung erkennen; doch kann von einem bestimmenden Einfluß Bonportis auf die Entwicklung der von ihm vertretenen Kompositionsgattung keine Rede sein. Nach Schering ist dies Urteil dahin zu ergänzen, daß Bonportis Musik an eigenen ansprechenden Zügen sowohl melodischer als rhythmischer Art nicht arm ist. Ausführlicher findet man ebendort sein aus Violinkonzerten bestehendes Op. 11 besprochen.
Ein weiterer venezianischer Geiger ist Giorgio Gentili, der um 1708 Violinist an der herzogl. Kapelle dort war und sich 1714 noch im Dienste befand. Von Kompositionen seiner Hand zählt Eitner auf: 12 Sonaten zu drei Stimmen (Amsterdam), 12 Konzerte zu vier Stimmen (Venedig 1716) und 12 Kammerkonzerte. Weitere Nachrichten über ihn fehlen.
Durch Corelli und Vivaldi war der Boden für eine Erscheinung bestellt, die im engen Anschluß an diese Meister eine neue Epoche des italienischen Violinspiels und nicht minder der Violinkomposition eröffnet. Wir erkennen dieselbe in Giuseppe Tartini. Dieser höchst bedeutende Meister wurde aber in dem ersten Stadium seiner Künstlerlaufbahn außer den obengenannten Vorbildern durch eine dritte Persönlichkeit so wesentlich beeinflußt, daß es notwendig erscheint, die Wirksamkeit der letzteren erst näher ins Auge zu fassen, bevor Tartinis Kunstmission einer Würdigung unterzogen wird. Es ist Francesco Maria Veracini mit dem selbstgewählten, seinen Geburtsort Florenz anzeigenden Beinamen » Fiorentino«.
Florenz war, wie die vorhergehende Darstellung zeigt, bereits frühzeitig in den Kreis derjenigen italienischen Städte getreten, welche nicht allein durch tonkünstlerische Bestrebungen überhaupt, sondern namentlich durch rege Teilnahme an dem Entwicklungsgange des Violinspiels und der Violinkomposition sich hervortaten. Wir erblickten in Antonio Veracini, dem Onkel des gleichnamigen berühmten Zeitgenossen Tartinis, einen namhaften Vertreter der Violine, dessen Tätigkeit entschieden auf eine Vermittlerrolle zwischen den verschiedenen hierhergehörigen Kunsterscheinungen der ersten und zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts deutet. Antonio Veracini war der Lehrmeister seines Neffen Francesco Maria und höchstwahrscheinlich auch der Florentiner Violinisten Valentini und Bitti.
Die Bekanntschaft von Giuseppe Valentini, geb. zwischen 1680 und 1690, (gest. 17..) machten wir schon in Rom, wo er bei Corellis Rückkehr aus Neapel als Solospieler auftrat. Er war zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Diensten des Großherzogs von Toskana und auch Komponist für sein Instrument. Fétis führt von ihm neun Werke an. Das siebente derselben, Concerti grossi zu 4 und 6 Stimmen, welches 1710 in Bologna erschien, ist von Torchi und neuerdings von Schering besprochen worden. Der erstere Autor gibt u. a. an, daß das Werk auch in violintechnischer Hinsicht bemerkenswert sei. Ein in Cartiers » L'art de Violon« mitgeteiltes Adagio Valentinis ist nicht uninteressant, doch sehr gesucht in harmonischer Beziehung. Um 1735 war er noch in Diensten des Florentiner Hofes.
Martinello Bitti (geb. 16.., gest. 17..), gleichfalls am Florentiner Hofe tätig, stand zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Blüte, wie aus einer Mitteilung Gerbers hervorgeht, nach welcher der deutsche Kapellmeister Stölzel bei seiner Anwesenheit in Florenz (1714) ihn kannte. Diese Männer wurden jedoch durch ihren Landsmann Francesco Maria Veracini (geb. 1685 in Florenz, gest. 1750 bei Pisa) völlig in Schatten gestellt. Wenn sein Andenken nach einer kurzen glanzvollen Laufbahn bis auf unsere Tage herab erlosch, so darf sich die Gegenwart des schönen Vorrechts erfreuen, die Verdienste dieses Künstlers wieder zur Anerkennung zu bringen.
Veracinis Leben war im allgemeinen kein glückliches; es wurde mehrfach von den Bitterkeiten dieses Daseins heimgesucht und endete schließlich sogar mit jenen Enttäuschungen, denen schon so manche bedeutende Kraft unterlegen ist. Zum Teil waren diese traurigen Erfahrungen ohne Zweifel selbst verschuldet, zum Teil aber auch durch Neid, Mißgunst und widrige Umstände hervorgerufen. Veracini war eine echte Künstlernatur und als solche von eigenwilligem, leidenschaftlichem, zu Exzessen geneigtem Wesen. Er litt außerdem an einem gewissen Hochmut, und in seinem Selbstgefühl ging er sogar so weit, sich gelegentlich zu der Äußerung »Ein Gott und ein Veracini« hinreißen zu lassen. Einem unbedeutenden Menschen hätte man dergleichen unter mitleidigem Lächeln ungestraft hingehen lassen. Allein Veracini hatte das Glück und, man darf sagen, zugleich das Mißgeschick, ein genialer Mensch zu sein, und so wurde er denn neben enthusiastischer Anerkennung auch gelegentlich Gegenstand der Intrige. Für sein leicht provozierendes Wesen gibt Gerber (nach Burney) folgenden Beleg: »Als sich Veracini einstmals gerade am Feste della Croce zu Lucca befand, wo gewöhnlich die ersten Meister Italiens zusammentreffen, um bey dieser Gelegenheit ihre Kunst zu zeigen, gab auch er seinen Namen an, um ein Violinsolo zu spielen. Als er nun ins Chor trat, um bei der ersten Violine Platz zu nehmen, fand er diesen schon durch den Pater Girolamo Laurenti Vergl. S. 82. von Bologna besetzt, welcher ihn fragte, wo er hin wolle? An den Platz der ersten Violine, antwortete Veracini. Laurenti macht ihm darauf begreiflich, daß dies jederzeit seine Stelle sey, daß er aber, wenn er ein Koncert spielen wollte, denselben entweder bey der Vesper oder während der hohen Messe einnehmen könne. Mit großer Verachtung kehrte ihm hierauf Veracini den Rücken zu, und suchte sich nun selbst den alleruntersten Platz im Orchester aus. Während nun Laurenti sein Koncert spielte, rührte Veracini keine Saite an, indem er mit großer Aufmerksamkeit zuhörte. Als die Reihe zu spielen an ihn kam, wollte er kein Koncert spielen, wohl aber ein Solo, wozu er den Violoncellisten Lanzetti aus Turin zum Begleiter verlangte. Nun spielte er am Rande des Chors sein Solo auf eine Manier, als ob er mit Gewalt in öffentlicher Kirche das Evviva auspressen wollte. Und als er an die Cadenz kam, drehte er sich nach Laurenti um und schrie: › Cosi si suona per fare il primo Violino!‹«
Ein derartiges Benehmen würde heute freilich mehr Anstoß erregen als damals, da man die Kirche halb als Konzertsaal betrachtete, und außerdem Wettkämpfe zwischen ausübenden Künstlern schon an der Tagesordnung waren. Doch ist es klar, daß Veracini sich auf diesem Wege keine Freunde erwerben konnte.
Schon 1714 trat er mit großem Erfolg in London auf. Von hier wandte er sich nach Venedig, wo ihn der Kurprinz Friedrich August von Sachsen 1716 hörte und engagierte. Er begab sich infolgedessen nach Dresden, und nachdem er dem Kurfürsten 1717 drei Violinsonaten überreicht hatte, wurde er als Kammerkomponist angestellt. Das Glück war ihm jedoch in seiner neuen Stellung nicht lange günstig, denn er erlebte bald einen Unfall, der ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Über die Veranlassung dazu sind zwei voneinander abweichende Versionen vorhanden. Gerber berichtet nach Matthesons Erzählung, daß Veracini »wegen häufigen Lesens chemischer Schriften und wegen dem Eifer in dem Studio seiner Kunst plötzlich närrisch wurde, so daß er sich am 13. August 1722 zwei Stock hoch zum Fenster hinunter stürzte, wobei er doch noch mit einem Beinbruch davon kam«. Dagegen wird im Cramerschen Magazin berichtet, »daß dieser Sturz aus Verzweiflung und Scham erfolgt wäre, indem drei Tage vorher sein unerträglicher Stolz gegen die deutschen Mitglieder der Dresdner Kapelle in Gegenwart des Königs und des ganzen Hofes dadurch so sehr wäre gedehmüthigt worden: daß einer der dasigen untersten Ripienisten das Koncert, welches Veracini soeben gespielt hatte Fétis bemerkt, daß es sich dabei um ein Pisendelsches Konzert gehandelt habe, welches Veracini a vista spielen mußte., unmittelbar darauf, auf Pisendel's Veranlassung, nachspielen mußte. Und da es Pisendel vorher insgeheim fleißig mit ihm durchgegangen hatte, erhielt er vom ganzen Hof den Preis vor dem Italiener«. Diese Lesart, welche sich bei den Biographen Veracinis mehrfach wiederfindet, hat wohl die größere Wahrscheinlichkeit für sich; denn es fehlte in Dresden zu keiner Zeit an Reibungen und mancherlei unwürdigen Boudoirmachinationen zwischen den vom Hofe oft einseitig bevorzugten Italienern und der deutschen Künstlerschaft. Der Konzertmeister Pisendel, dessen nähere Bekanntschaft wir weiterhin zu machen haben, mochte sich ebensosehr durch Veracinis Leistungen als Violinspieler und Tonsetzer, wie durch sein persönliches Auftreten zum Widerstande aufgefordert fühlen. Die Art dieses Widerstandes ist freilich, selbst wenn man das höchste Maß der Gereiztheit gegen Veracini voraussetzt, um so verwerflicher, als sie von einem Manne ausging, dessen Charakter für unantastbar galt. Die Biographen Pisendels lassen sich's wohl angelegen sein, dessen rechtschaffenen Sinn und Frömmigkeit zu rühmen, indem sie ausdrücklich bemerken, »er habe täglich mit Eifer die heilige Schrift gelesen«. Sie gelangen indessen nicht zu dem naheliegenden Schluß, daß dieser so bibelfeste Konzertmeister, uneingedenk der christlichen Lehre von der Nächstenliebe, sich zu einer Handlungsweise verleiten ließ, die im grellen Widerspruch mit Edelsinn und Manneswürde steht. Hätte Pisendel sich selbst in einen Wettkampf mit Veracini eingelassen, wenn er sich kräftig genug dazu glaubte, oder demselben doch einen ebenbürtigen Rivalen entgegengestellt, so wäre der Italiener im ungünstigen Falle wenigstens mit dem Gefühl unterlegen, einem Stärkeren weichen zu müssen. Allein ihn unvorbereitet aufs Glatteis zu führen, mit einem untergeordneten Ripienisten zu konfrontieren, dem man dasselbe Stück heimlich für diesen Zweck einstudiert hatte, um Veracini desto sicherer dem Spott seiner Feinde preiszugeben, ist feige und unmännlich. Mag man die Sache, vorausgesetzt, daß sie auf voller Wahrheit beruhe, ansehen wie man will, auf Pisendel bleibt ein Makel haften, und unwillkürlich gedenkt man der gewichtigen, zweischneidigen Worte Marcus Antonius: »Doch Brutus ist ein ehrenwerter Mann.«
Veracini wurde von den Folgen seines Sturzes, bei dem er außer einer Hüftverletzung einen zweimaligen Beinbruch erlitt, zwar geheilt, behielt aber für sein ganzes Leben einen lahmen Fuß. Nach seiner Genesung verließ er Dresden, hielt sich demnächst in Böhmen und Italien auf und ging 1736 wieder nach England. Hier konnte er indes nicht mehr zu der früheren Geltung kommen. Fétis berichtet, daß man seinen Stil veraltet fand, und daß ihm selbst die Vergleichung mit Geminiani nachteilig gewesen sei. Er kehrte 1747 in sein Heimatland zurück und starb 1750 bei Pisa in gedrückten Verhältnissen.
Als Komponist genoß Veracini bei seinen Zeitgenossen keine sonderliche Anerkennung. Man goutierte seine Musik nicht und machte ihr den Vorwurf grillenhafter und kapriziöser Bizarrerie. Wir urteilen heute über dieselbe anders und finden sie vielmehr geistreich, originell, voll Feuer, Noblesse und Tiefe der Empfindung. Um Veracinis Bedeutung als Violinkomponist zu ermessen und richtig zu würdigen, muß man die Geigenliteratur des achtzehnten Jahrhunderts genau kennen. Doch schon bei einer einfachen Vergleichung mit den namhaftesten Violinkomponisten seiner Zeit gelangt man zu der Einsicht, daß er einer der vornehmsten Repräsentanten seines Faches war. Zugleich begreifen wir aber auch, warum der Künstler während seines Lebens nicht durchdringen konnte. Seine Zeit war nicht auf den Ton gestimmt, welchen er anschlug. In der Tat, Veracini sondert sich durch gewisse Eigentümlichkeiten wesentlich von der normalen, sozusagen objektiven Gestaltungsweise der damaligen Violinmeister ab. Im Gegensatz zu ihnen ist sein Ausdruck von scharfer individueller Ausprägung. Für die oft fein zugespitzte melodische und modulatorische Bewegung, sowie für die Handhabung der reicheren, minutiöseren Harmonik seiner Musik gab es zu jener Zeit kaum schon empfängliche Gemüter. Man war durch Corelli insbesondere an eine breitere, gemessenere, dem Kirchenstil verwandte Behandlungsweise der Violine gewöhnt. So wird es denn erklärlich, daß Veracinis subjektiverer Ausdruck uns geläufiger und sympathischer ist, als dem damaligen Publikum.
Veracinis Musik zeichnet sich insbesondere durch eine für seine Zeit ungewöhnliche Freiheit der melodischen und thematischen Gestaltung, nicht minder aber durch kühne, wahrhaft moderne harmonische Wendungen aus. Ein zweites Merkmal ist die eigentümliche Anwendung der Chromatik, mit deren Hilfe er die feinsten Schattierungen und Stimmungen auszudrücken weiß. Endlich ist seine Musik, abgesehen von einzelnen Exzentrizitäten, übersichtlich klar und durch leicht beflügelten Schwung der Allegrosätze ausgezeichnet.
Es existieren von ihm zwei in Dresden (1721) und in London und Florenz (1744) gedruckte Violinwerke mit je 12 Violinsonaten Die von Ferd. David bei Breitkopf & Härtel, sowie vom Verfasser dieser Blätter bei B. Senff in Leipzig und Simrock in Berlin herausgegebenen Kompositionen sind aus denselben entnommen. – Drei weitere Sätze teilt Torchi in der Collection Boosey mit.. Die von ihm hinterlassenen Manuskripte, bestehend in einigen Konzerten und Symphonien für zwei Violinen, Viola, Violoncello und Basso continuo per il clavicembalo, sind unbekannt geblieben. Außerdem werden drei in London gedruckte und wenigstens zum Teil daselbst aufgeführte Opern Veracinis bei Gerber namhaft gemacht.
Als Violinspieler fand Veracini die höchste Beachtung. Fétis bemerkt, daß er schon während seines ersten Londoner Aufenthaltes als ein Wunder von Geschicklichkeit betrachtet wurde, und durch Burney wissen wir, daß er ihn bei der zweiten Anwesenheit in der Weltstadt trotz seines zunehmenden Alters doch noch immer auf eine ungewöhnliche Art spielen hörte. Andern Nachrichten zufolge soll ihm bei glanzvollem, durch jedes Orchester hindurchdringenden Ton eine außerordentliche Beherrschung des Trillers, der Arpeggien, Doppelgriffe und insbesondere der Bogenführung eigen gewesen sein. In letzterer Beziehung war er denn auch von wichtigstem Einfluß auf Tartini, der ihm 1716 (oder 1714) in Venedig begegnete. Als nämlich Veracini dort auftrat, ließ man, um ihm einen künstlerischen Wettkampf anzubieten, Tartini aus Padua kommen. Beide Meister sollten bei einer, zu Ehren des schon erwähnten Kurprinzen von Sachsen im Palast der Donna Pisana Mocenigo veranstalteten Akademie um die Palme des Vorranges streiten. Als aber Tartini Veracinis kühne und ganz neue Spielart gehört hatte, zog er es vor, ohne in die Schranken getreten zu sein, das Feld zu räumen und Venedig zu verlassen. Welche Wirkung dieses Zusammentreffen mit Veracini auf Tartini hatte, werden wir im folgenden Kapitel erfahren.
Giuseppe Tartini wurde den 12. April 1692 zu Pirano in Istrien geboren. Sein Vater Giovanni Antonio, ein Florentiner, von den Bürgern Parenzos aus Dankbarkeit für Dotierung der städtischen Kathedrale zum Nobile des Orts erwählt, gab ihm eine treffliche Erziehung. Anfangs besuchte er die Priesterschule » dell' Oratorio di S. Filippo Neri«, sodann aber die der » Padri dalle scuole Pie« zu Capo d'Istria. Hier erhielt er neben dem wissenschaftlichen Unterricht Anleitung in den Elementargegenständen der Musik und des Violinspiels. Tartinis Eltern hegten den Wunsch, ihren talentvollen Sohn dem geistlichen Stande zu widmen. Doch als sie sahen, daß sich seine Natur gegen das schwarze Gewand sträubte, schickten sie ihn 1710 nach Padua, um ihn dort durch das Rechtsstudium für die advokatorische Praxis vorbereiten zu lassen. Allein Tartini war ein jugendlicher Brausekopf, dem die Künstlernatur schneller als andern Menschen das Blut durch die Adern trieb. Wie konnte da der schlau besonnene, mit kaltem Verstande abwägende Advokat zu seinem Rechte kommen? Er versäumte nicht geradezu sein Studium, bevorzugte aber doch seine Lieblingsneigungen: Musik und Fechtkunst. Die letztere übte er mit solcher Meisterschaft aus, daß er den Entschluß faßte, als Fechtmeister nach Neapel oder, wenn es ihm dort nicht glücken sollte, nach Frankreich zu gehen. Allein hieran wurde er, von Amors Pfeil getroffen, glücklicherweise verhindert, denn was die Welt an Tartinis Klinge verlor, gewann sie hundertfach an seinem Violinbogen. Er verliebte sich in eine junge Paduanerin, deren Lehrer er war, und ohne eine menschliche Seele in sein süßes Geheimnis zu ziehen, schritt er auf der Stelle auch zur Heirat, wie es einem resoluten Studenten jener Zeit wohl anstehen mochte. Seine Eltern waren freilich, als sie nachträglich davon Kunde erhielten, so erzürnt auf ihn, daß sie fortan ihm jede Unterstützung versagten. Noch schlimmer erging es Tartini aber in seinem Wohnort selbst, denn es währte nicht lange, so drohte ihn das Geschick in der Person des Kardinals Giorgio Cornaro, Bischofs von Padua, zu ereilen. Derselbe, durch die Familie seiner Neuvermählten Riemann (Mus. Lex.) gibt an, daß der Kardinal Cornaro selbst ein Verwandtet von Tartinis Gattin gewesen sei. dazu ermächtigt, ließ den Studiosus juris verfolgen. Was blieb Tartini übrig, als das Weite zu suchen, wenn er nicht den Händen der Familienrache anheimfallen wollte? Notgedrungen ließ er seine Schöne im Stich und machte sich als Pilger verkleidet auf den Weg nach Rom. Umherirrend im Lande, erreichte er indessen nicht sein Reiseziel, sondern blieb im Minoritenkloster zu Assisi bei einem Verwandten seiner Eltern. Hier fand er die seinem Inkognito erwünschte Freistatt.
Die Einförmigkeit des Klosterlebens mochte Tartini nach dem bunt bewegten Studentenleben und der wie durch einen Sturmwind jäh verscheuchten Liebesmorgenröte wenig behagen. Sie gereichte ihm indessen zum Wohle, da die stille, gleichförmige Lebensweise unter frommen Brüdern ihm hinreichende Muße zu Selbstschau und Einkehr in sein Inneres ließ. Seine Leidenschaften wichen allmählich einer besonnenern Lebensanschauung, und Tartini verdankte seiner längeren, unfreiwilligen Villegiatur zu Assisi nichts Geringeres, als die Aneignung eines ruhigen, gesetzten und bescheidenen Wesens. Musik war hier seine Hauptbeschäftigung. Er nahm das Studium der Violine wieder mit Eifer auf, und ein Pater namens Boemo (sein eigentlicher Name war Czernohorski) ging ihm bei seinen sonstigen musikalischen Übungen zur Hand. Seine Fortschritte waren so bedeutend, daß er sich bald an Sonn- und Feiertagen während der kirchlichen Zeremonie als Solospieler hören lassen konnte. Der Zufall wollte es, daß er dabei von einem dem Gottesdienst beiwohnenden Paduaner erkannt wurde. Dieser verriet den Aufenthaltsort Tartinis, und er wurde infolgedessen der Welt wiedergegeben; denn als seine ihm treu gebliebene Gattin ihn davon benachrichtigte, daß der Zorn des Kardinals Cornaro und ihrer Familie nicht nur einer versöhnlichen Stimmung Platz gemacht habe, sondern daß auch die eheliche Verbindung gebilligt werde, kehrte der Flüchtling nach Padua zurück.
Nicht lange war Tartini daheim, als seine denkwürdige Begegnung mit Veracini in Venedig stattfand, von der bereits am Ende des vorigen Kapitels die Rede war. Diese Begegnung erst hob Tartini auf denjenigen künstlerischen Standpunkt, durch den er sich für seine Lebensaufgabe völlig geschickt machte. Obwohl als Künstler schon in hohem Ansehen stehend, ließ er es sich doch nicht verdrießen, abgeschieden von dem Schauplatze seines Wirkens, die empfangenen Eindrücke in einem erneuerten Studium zu verwerten und zu verarbeiten. Kein Opfer war ihm zu groß; er trennte sich von seiner Frau und begab sich für längere Zeiten nach Ancona, wo er zurückgezogen von der Welt seiner Kunst lebte und namentlich den freieren, vielseitigeren Gebrauch des Bogens zum Gegenstande seiner besonderen Aufmerksamkeit machte. Nicht eher trat er wieder vor das Forum der Öffentlichkeit, bis er seinem künstlerischen Ehrgeiz Genüge getan hatte. So rüstete sich Tartini für sein Tagewerk.
Nunmehr konnte der zum beherrschenden Meister seines Instruments gewordene Künstler in Padua eine seinen Leistungen entsprechende Position erwarten und fordern. Sie wurde ihm 1721 durch die Anstellung als Soloviolinist und Orchesterchef bei der Kirche des heiligen Antonius von Padua zuteil. Die Kapelle derselben, zu jener Zeit unter Leitung Francesco Antonio Valottis, bestand aus 16 Sängern und 24 Instrumentalisten und galt als eine der besten italienischen Kunstanstalten.
Tartinis Ruf verbreitete sich nicht nur im Vaterlande, sondern auch über dasselbe hinaus so schnell, daß er schon zwei Jahre nach erfolgter Anstellung eine Einladung von Prag her erhielt, um bei den Krönungsfeierlichkeiten Kaiser Karls VI. mitzuwirken. Diese Berufung wurde zugleich Veranlassung zu einem dreijährigen Aufenthalt (1723-25) des Meisters in der böhmischen Hauptstadt, da der kunstsinnige Graf Kinski sich nicht die Gelegenheit entgehen ließ, eine so ausgezeichnete Persönlichkeit an sich zu fesseln. Hier hörte ihn Quantz, dessen Urteil über Tartini folgendermaßen lautet: »Er war in der Tat einer der größten Violinspieler. Er brachte einen schönen Ton aus dem Instrument. Finger und Bogen hatte er in gleicher Gewalt. Die größten Schwierigkeiten führte er ohne sonderliche Mühe sehr rein aus. Die Triller, sogar Doppeltriller, schlug er mit allen Fingern gleich gut. Er mischte, sowohl in geschwinden als langsamen Sätzen, viele Doppelgriffe mit unter und spielte gern in der äußersten Höhe. Allein sein Vortrag war nicht rührend und sein Geschmack nicht edel, vielmehr der guten Singart ganz entgegen.«
Ein Gewährsmann wie Quantz hat allen Anspruch auf Glaubwürdigkeit. Und doch kann man es bei seinem Urteil über Tartini nicht bewenden lassen. Wenn er sagt, daß Tartinis Vortrag nicht rührend gewesen sei, so mag er recht behalten. Es kann ein Künstler tiefes Gefühl offenbaren, ohne geradezu zu rühren. Zudem lehrt die Erfahrung, daß nichts relativer ist als Urteile über Gefühl, denn jeder hat eine andere Art zu empfinden. Ist es nicht vorgekommen, daß man die warmblütige, tiefempfundene Musik Mozarts kalt und marmorglatt genannt hat? Hat Spohr nicht den Vorwurf einer zu kühlen Vortragsweise ertragen müssen? Es gibt Leute genug, die für ein durchgebildetes, harmonisch maßvolles und in seinen Linien sich bewegendes Gefühl durchaus kein Verständnis haben. Sie können nur durch Gefühlsexzesse, heftige Kontraste, oft sogar auch nur durch ein karikiertes Pathos oder vielmehr durch die Grimasse des Gefühls in Bewegung gesetzt werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Geschmack; er ist ein proteusartiges, schwer zu kontrollierendes Ding, abhängig von Bildung und individueller Auffassungsgabe desjenigen, der urteilt. »Ohne Geschmack und der guten Singkunst entgegen« sollte Tartini gespielt haben, er, der ausdrücklich den Grundsatz aufstellte, daß man gut singen müsse, um gut spielen zu können S. Campagnolis Violinschule. Leipzig, Breitkopf & Härtel., – er, der über Spieler, welche durch ihre Technik zu glänzen suchten, äußerte: »Das ist schön! das ist schwer! aber hier (mit der Hand aufs Herz deutend) hat es mir nichts gesagt«? Wenn irgend etwas angezweifelt werden darf, so ist es die Richtigkeit des Quantzschen Urteiles. Widerlegt wird es zunächst durch eine Mitteilung Lahoussayes, eines Schülers Tartinis. »Nichts«, so sagt er, »könnte das Erstaunen und die Bewunderung ausdrücken, welche mir die Vollendung und Reinheit seines Tones, der Reiz des Ausdruckes, die Magie seiner Bogenführung, mit einem Wort, die gesamte Vollendung seiner Leistungen verursachte.« Dann aber bedarf es nur eines flüchtigen Blickes auf Tartinis Werke. Wer die in ihnen enthaltenen, ebenso tief empfundenen als melodiösen Adagios schreiben konnte, der ließ es auch sicherlich nicht an geschmackvoll edler und gesangreicher Behandlung des Instrumentes fehlen, für welches er schrieb, es wäre denn, daß man der Annahme huldigen wollte, Tartini sei erst als alter Mann zu Gefühl und Vortrag gelangt, – eine Voraussetzung, die sich von selbst entkräftet; denn wer in der Blüte seiner Jahre nicht feinfühlig ist, wird es überhaupt nie werden. Gewiß, der gute, brave Quantz war entweder schlecht gelaunt, als er Tartini hörte, oder er hatte Vorstellungen absonderlichster Art über Gefühl und Vortrag.
Tartini konnte sich, nachdem er seine Prager Beziehungen abgebrochen hatte und nach Padua zurückgekehrt war, wo er 1728 eine hohe Schule des Violinspieles errichtete, nie wieder dazu entschließen, das Vaterland und den heimischen Wirkungskreis zu verlassen, so glänzende Anerbietungen ihm auch in der Folge zuteil wurden. Selbst den Lockungen des guineenreichen England, das immer bereit war, in Ermangelung eigener künstlerischer Produktivität fremde Kräfte auszubeuten, vermochte er zu widerstehen. Denn obwohl der Meister in Padua nicht mehr als ein standesgemäßes Auskommen hatte – sein Gehalt wird auf 400 Dukaten angegeben – so lehnte er doch eine Einladung des Lord Midlesex nach London ab, welcher ihm die Summe von 3000 Pfund Sterling verhieß. Anspruchslosen Sinnes gab er dem Vermittler dieser Offerte, Marchese degli Obbizzi, folgende Antwort: »Ich habe eine Frau, die mit mir gleichen Sinnes ist, und keine Kinder. Wir sind mit unserm Zustande sehr zufrieden; und wenn sich je in uns ein Wunsch regt, so ist es doch der nicht, mehr zu besitzen als wir haben.« Daß er uneigennützig war, beweist sein Wohltätigkeitssinn. Er unterstützte Witwen und Waisen, ließ Kinder armer Eltern auf seine Kosten unterrichten, und unterwies unbemittelte Schüler gegen eine geringe Entschädigung oder gar umsonst.
Tartinis Lebensabend wurde durch ein schmerzhaftes Fußleiden getrübt, das auch die Ursache seines Todes war. Er starb, von seinem Favoritschüler Nardini mit kindlicher Liebe gepflegt, im 78. Lebensjahre, am 26. Februar 1770, tief betrauert von den Freunden und Verehrern der Kunst. In der Parochialkirche Santa Catarina zu Padua fand er seine Ruhestätte. Sie trägt die einfache Inschrift: » Joseph Tartini sibi et conjugi suæ posuit. Obiit IV Kal. Mart. MDCCLXX. Aet. LXXVIII.« Giulio Meneghini, sein Schüler und Amtsnachfolger, veranstaltete am 31. März desselben Jahres in der Servitenkirche eine solenne Gedächtnisfeier. Bei derselben wurde von der Kapelle, welcher er vorgestanden, ein Requiem Valottis aufgeführt. Das Elogium hielt der Abbáte Franzago. Dasselbe erschien 1770 und in zweiter Auflage 1792 zu Padua im Druck.
Tartini ist nicht minder in Wort und Schrift gefeiert worden als Corelli. Die Verehrer seiner Kunst versäumten es nicht, ihn in Epigrammen zu preisen, von denen uns die beiden nachstehenden aufbehalten sind. Das erstere derselben war für Tartinis Bildnis bestimmt:
Tartini haud potuit veracius exprimi imago
Sive lyram tangat, seu meditetur, is est.
Das zweite dagegen lautet:
Hic fidibus, scriptis, claris hic magnus alumnis.
Cui par nemo fuit, forte nec ullus erit.
Und auch die Stadt Padua, wennschon sie kein römisches Pantheon besaß, in welchem man den Meister wie seinen Vorläufer Corelli hätte verewigen können, ließ es an einem äußeren Zeichen der Verehrung nicht fehlen. Am südlichen Teil des Orts liegt ein anmutiger Spaziergang, » Prato della Valle« genannt Jetzt Piazza Vittorio Emanuele II.. Hier befindet sich unter einer beträchtlichen Anzahl von Bildsäulen berühmter Paduaner und anderer hervorragender Männer, welche die dortige Universität besucht, auch Tartinis Statue mit der Inschrift:
Jos. Tartini. Piranensi.
In Patav. Basilic. D. Antonii
Fidium. Profess. Primario.
Eximio. Scriptis. et Alumnis.
Clarissimo.
Perenne. Monumentum. Gloriæ.
Aere. Collato.
Bon. Art. Amatores.
P. C.
An. MDCCCVI.
Zu seinen Füßen liegen Geige und Bogen und als Hindeutung auf seine Tätigkeit als Theoretiker auch Bücher. Die linke Hand ist auf die Büste Valottis gestützt, während die rechte auf diese hinweist. Endlich hat seine Vaterstadt dem Meister ein dauerndes Denkmal gesetzt: dasselbe wurde am 2. August 1896 in Pirano feierlich enthüllt.
Tartinis geistiges Wirken läßt eine Doppelnatur ungewöhnlicher Art erkennen. Der Meister war nicht nur hervorragend als Komponist, sondern beteiligte sich auch mit eifrigster Hingebung an der Untersuchung wissenschaftlicher Probleme, deren Lösung ihn sein ganzes langes Leben hindurch beschäftigte. Er hatte während seiner Studien in Ancona beim Violinspiel die Wahrnehmung gemacht, daß das Erklingen von Doppelgriffen einen dritten Ton, den sogenannten Kombinationston (Differenzton) erzeugt Man setzt die Zeit dieser Entdeckung in das Jahr 1714. Doch findet hier möglicherweise ein Irrtum statt, da Tartini sich vielleicht erst 1716 nach Ancona zurückzog, wie S. 127 schon gesagt wurde.. Aus dieser Beobachtung zog er zunächst einen wesentlichen Vorteil für die Intonation, da er fand, daß der dritte Ton nur dann hörbar wurde, wenn die Intervalle in voller Reinheit ertönten. Und so sorgsam war er in dieser Hinsicht, daß er auch jederzeit seinen Schülern die Berücksichtigung dieses Kriteriums bei ihren Studien anempfahl Leopold Mozart empfiehlt in seiner Violinschule gleichfalls dasselbe Verfahren zur Erzielung einer guten Intonation bei Doppelgriffen, – ein Beweis, daß er alles Neue, was einer Berücksichtigung wert war, in Betracht zog und sofort zur Anwendung brachte.. Doch beruhigte er sich nicht bei der bloßen Tatsache. Er war bemüht, eine Erklärung für diese Erscheinung zu finden, sie wissenschaftlich zu begründen. Hier reichten indessen weder seine Kenntnisse aus, noch bot der damalige Standpunkt der Akustik sichere Haltpunkte für die Erklärung des beobachteten Phänomens. Tartini half sich im Drange nach Erkenntnis so gut wie er konnte. Er verfaßte, vielleicht um sich selbst zunächst klarer über diese Materie zu werden, ein umfangreiches theoretisches Werk, welches er 1754 zu Padua unter dem Titel: » Trattato di musica secondo la vera scienza dell' armonia« drucken ließ. Es handelt in folgenden sechs Hauptabschnitten: 1) Vom harmonischen Phänomen usw., 2) Vom harmonischen Zirkel usw., 3) Vom musikalischen System usw., 4) Von der diatonischen Skala usw., 5) Von den alten und modernen Tonarten, 6) Von den Intervallen und Modulationen der modernen Musik. Diese Schrift wurde bald nach ihrer Veröffentlichung Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung, und Tartini erwarb sich infolgedessen namentlich die Gegnerschaft Pronys, Serres (in Genf), Mercadier de Belestats und später auch J. J. Rousseaus Fétis gibt über die von den genannten Männern veröffentlichten Streitschriften und deren Inhalt in seiner » Biographie universelle« unter dem Artikel Tartini ein eingehenderes Raisonnement, dessen Wert zu bestimmen ich mir nicht getraue.. Die Widerlegungen, zunächst der beiden erstgenannten Männer, bekehrten indessen Tartini nicht; er gab vielmehr 1767 ein zweites Buch: » De' principii dell' armonia musicale contenuta nel diatonico genere« heraus. In diesem Werke machte er dem Franzosen Remieu gegenüber, der das Phänomen des dritten Tones 1743 gefunden haben wollte, den Anspruch der Priorität für seine Entdeckung geltend. Die Serresche Streitschrift wurde durch eine » Risposta di Giuseppe Tartini alla critica del di lui Trattato di Musica di Mons. Serre di Ginevra (in Venezia 1767)« beantwortet. Diese Broschüre soll den Generalpostmeister Grafen Thurn und Taxis, einen Schüler und Freund Tartinis, zum Verfasser haben. Auch wird (bei Fétis) eine Schrift des genannten Grafen: » Risposta di un anonimo al celebre Signor Rousseau circa il suo sentimento in proposito d'alcune proposizioni del Sig. G. Tartini« ( in Venezia 1769) zitiert.
Man sieht, Tartini war unmittelbar und mittelbar in einen umfangreichen Federkrieg verwickelt worden, der freilich unerledigt blieb, da man sich nicht verständigte und wegen unzureichender Sachkenntnis auch nicht verständigen konnte. Erst in neuester Zeit ist das Phänomen des Kombinationstones durch Helmholtz' S. Helmholtz: »Die Lehre von den Tonempfindungen«, S. 228 ff. Es wird in diesem Werke übrigens bemerkt, daß der Organist Sorge die Kombinationstöne 1740 zuerst entdeckt habe, während sie von Tartini angeblich schon vor 1720 beobachtet wurden. geniale Beobachtungen und Untersuchungen vollständig erkannt und erklärt worden. Man weiß nun, daß »der Kombinationston entsteht, wenn die von zwei Tönen gleichzeitig erregten Schwingungen so weite Elongationen besitzen, daß sie nicht mehr als verschwindend klein angesehen werden können. Die Folge hiervon sind dann Vibrationen der Luft oder wenigstens der Gehörknöchelchen, welche den Kombinationston erzeugen« Pisko, Die neueren Apparate der Akustik. Einleitung S. IX. Wien C. Gerolds Sohn, 1865. – Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht unterlassen, den Leser, welcher sich für das Verhältnis der Musik zur Akustik interessiert, auf das sehr verständlich und anregend geschriebene Werk des leider zu früh verstorbenen Dr. Alfred Jonquière »Grundriß der musikalischen Akustik« hinzuweisen. Jonquière hatte Mathematik und Physik studiert, sich aber weiterhin, bei seinen beträchtlichen Anlagen für die Musik, und speziell für die Violine, dieser zugewendet. Er war in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre Zögling der Hochschule für Musik in Berlin, ein guter Violinist und gediegener Musiker, dabei wissenschaftlich wie menschlich hoch gebildet. Sein oben erwähntes, 1898 erschienenes Erstlingswerk fand verdiente günstige Aufnahme. Sein durch Melancholie veranlaßter, freiwilliger Tod im Frühjahr 1899 überraschte schmerzlich alle die, die ihn gekannt und auf seine Talente Hoffnung gesetzt hatten..
Tartini hatte sich übrigens so sehr in die Theoreme der Tonkunst vertieft, daß er noch in späten Lebensjahren eine Schrift: » Delle ragioni et delle proporzioni« in sechs Büchern verfaßte. Er vermachte dieselbe seinem Freunde, dem Paduaner Professor Colombo mit dem Wunsch, sie zu verbessern und herauszugeben. Doch ist die Arbeit spurlos verschwunden.
Wir haben vorstehend, soweit es der Raum dieser Blätter gestattet, in allgemeinen Umrissen Tartinis schriftstellerische Tätigkeit anzudeuten versucht. Sie ist bedeutend genug, um ein helles Licht auf des Künstlers scharf ausgeprägte Verstandesrichtung zu werfen. Denn obwohl es ihm trotz allen Bemühens nicht gelang, eine unantastbare systematische Begründung theoretischer Fragen, insbesondere aber der Lehre von dem Kombinationstone zustande zu bringen, so spricht doch der Umstand, daß namhafte Männer der Wissenschaft es der Mühe wert erachteten, auf seine Anschauungen ausführlich einzugehen, sehr vernehmlich für seine Denkkraft. Burney wendet im Hinblick auf Tartinis theoretische Arbeiten das Sokratische Wort an: »Was ich davon verstehe, ist vortrefflich, und deswegen bin ich geneigt zu glauben, daß das, was ich nicht verstehe, gleichfalls vortrefflich ist.« Allerdings wird Tartinis Ausdrucksweise in seinen Schriften als eine oft unklare und schwülstige bezeichnet. Der schon genannte Professor Colombo soll diese freilich nicht empfehlenswerte Eigentümlichkeit der Darstellung dadurch erklärt haben, daß sein Freund Tartini »ein schlechter Rechenmeister und ein noch schlechterer Mathematiker gewesen sei«. Er habe sich deswegen bei seinen musikalischen Berechnungen ein ganz eigenes Verfahren ausgedacht, das ihm durch die Übung ebenso leicht geworden sei, als es andern unverständlich blieb, und demzufolge seine Thesen in mancherlei mathematische und algebraische Dunkelheiten eingehüllt. Wie dem nun auch sei, wie hoch oder gering man den positiven Wert von Tartinis Schriften veranschlagen möge, es ist sicher, daß er als ausübender und schaffender Musiker eine höhere Bedeutung für uns hat, wie als Mann der Wissenschaft.
Tartini war als Komponist von einer ungemeinen Fruchtbarkeit. Wenn man den Berichten älterer und neuerer Schriftsteller trauen darf, so wäre nur der kleinste Teil seiner Violinwerke in die Öffentlichkeit gedrungen. Gerber gibt an, daß sich »über zweihundert Violinkonzerte und ebensoviel Violinsolos als Manuskripte in den Händen seiner Landsleute befänden«, – eine Zahl, die offenbar zu hoch gegriffen ist. Der Franzose Fayolle S. dessen Schrift » Paganini et Bériot«, Paris, Legouest 1831, und Allgem. mus. Ztg. vom Jahre 1812, Nr. 26. begnügt sich schon mit 100 Sonaten und ebensoviel Konzerten im Manuskript. Die Kollektion von Farrenc in Paris soll gegen 100 Sonaten von Tartini enthalten haben. Fétis dagegen macht die Angabe, Tartini habe außer seinen gedruckten Werken 48 Sonaten für Violine und Baß und 127 Konzerte für Violine Solo mit Begleitung des Streichquartetts hinterlassen, von denen sich ein großer Teil abschriftlich auf der Konservatoriumsbibliothek zu Paris befinde. Es wird sich schwerlich heute noch ermitteln lassen, inwieweit diese Behauptungen wahr sind, denn die Originalmanuskripte der Tartinischen Werke, welche (nach Gerber) in den Besitz des Grafen Thurn und Taxis zu Venedig übergingen, dürften kaum mehr beisammen, sondern in der ganzen Welt zerstreut sein. Jedenfalls hat Tartini weit mehr Musik geschrieben als veröffentlicht. Bei meiner wiederholten Anwesenheit in Padua sah ich durch Vermittelung des Kapellmeisters an der Basilica S. Antonio, Melchiore Balbi, einige Manuskripte Tartinis in der Bibliothek der genannten Kirche. Es waren sogenannte » Sonate da chiesa« mit Quartettbegleitung.
Die von Tartini gedruckten Werke, deren vollständiges Verzeichnis Fétis mitteilt, belaufen sich auf einige 50 Sonaten mit Baß und 18 Konzerte mit Quartettbegleitung. Sie erschienen vom Jahre 1734 ab meist zu Amsterdam, London und Paris in verschiedenen Ausgaben. Bemerkenswert ist es, daß sich unter denselben nur eine Triosonate für 2 Violinen und Baß findet Unter den Notenbeständen der Basilica S. Antonio in Padua befinden sich einige handschriftliche Sonaten Tartinis für zwei Violinen und Baß, die aber inhaltlich kein besonderes Interesse zu erregen vermögen., während diese von seinen Vorgängern und Zeitgenossen so sehr kultivierte Gattung bis zu Ende des 18. Jahrhunderts in Mode blieb.
Auch eine Vokalkomposition, ein Miserere, schrieb Tartini, welches am Karmittwoch des Jahres 1768 zu Rom in der sixtinischen Kapelle aufgeführt wurde. Der Baron Agostino Forno, Verfasser eines Elogiums auf Tartini, welches bei dieser Gelegenheit verlesen wurde, weist diesem Werke den ersten Platz unter allen Schöpfungen des Meisters zu. »Weit entfernt die Lobreden des Barons Forno zu verdienen«, bemerkte Fétis im Hinblick darauf, »wurde dieses Stück für so schwach befunden, daß man einstimmig beschloß, es nicht wieder aufzuführen, und wirklich ist es seitdem nicht mehr gehört worden.«
Wenn wir Tartinis sämtliche uns zugänglich gewordene Instrumentalwerke betrachten, so empfangen wir den Eindruck einer geistig bedeutenden Persönlichkeit. Im wesentlichen auf Corelli und Vivaldi gestützt, deren Werke ihm bereits feste Normen für die formell und geistig einzuschlagende Richtung boten, vermochte er bei seiner hohen Begabung die Violinkomposition gegen seine Vorgänger um eine beträchtliche Stufe emporzuheben. Der durch ihn bewirkte Fortschritt ist nach Form und Gehalt gleich groß. Die Motive werden vollwichtiger, langatmiger und von reinerem, mannigfaltigerem melodischen Gepräge; das Passagenwerk läßt eine organischere Entfaltung sowie einen inneren Zusammenhang mit dem ganzen Satzgefüge erkennen. Harmonie und Modulation erweitern sich bei kerniger Einfachheit und klarer Plastik der Gestaltung zu reicherem Ausdruck. Endlich klärt sich die Struktur, namentlich der Allegrosätze, durch schärfere Hervorhebung der kontrastierenden Elemente ab, wie sich denn auch hier und da unverkennbar Ansätze zu Seiten- und Mittelmotiven bemerklich machen. Doch ist es dem Meister nicht genug, in den genannten Beziehungen höheren Ansprüchen gerecht zu werden; er offenbart nicht minder den Drang, mit seiner Musik eine bestimmte, poetisch gefärbte Stimmung auszudrücken, und oft gelingt es ihm.
Auf das rein technische Element bezüglich ist hinzuzufügen, daß Tartini, wie bereits aus der S. 129 mitgeteilten Bemerkung sich ergibt, allen virtuosen Gelüsten abhold war. Seine bedeutende Technik stand durchaus im Dienste künstlerischer Gesinnung und Darstellung, es ist dies einer von manchen sympathischen und gewinnenden Zügen, die das Bild des Meisters bei genauer Betrachtung aufweist. Denn in der Mitte des 18. Jahrhunderts war die Verführung, auf Kosten künstlerischer Qualität mit Violinkünsten zu prunken, eine vielmal größere als heutzutage, wo nur noch Techniker phänomenaler Art, und selbst diese kaum, zu fesseln vermögen, eben da man ein hohes Maß technischen Könnens jetzt einfach voraussetzt. Hiermit übereinstimmend hebt auch Torchi als Kenner der italienischen Instrumentalmusik ausdrücklich hervor, daß Tartini in technischer Hinsicht, entgegen dem vielfach in Akrobatentum und schädigende Übertreibung ausartenden Gebahren der meisten Violinkomponisten jener Zeit, eine gesunde, alles Technische in den Dienst der künstlerischen Idee stellende Richtung innehielt und vertrat, so daß es sich als solches gar nicht bemerklich macht.
Ein lyrisch elegischer Zug, gesättigt von warmer Empfindung, erfüllt wesentlich die langsamen, getragenen Tonstücke Tartinis. Besonders glänzende Beispiele dafür bieten die beiden Sonaten in G moll, Nr. 10, Op. 1 (ehemals unter dem Namen » Didone abandonnata« bekannt), sowie Nr. 1, Op. 2 Sie befindet sich in der von C. Witting bei Holle in Wolfenbüttel herausgegebenen »Kunst des Violinspiels«. und insbesondere die sogenannte Teufelssonate, die auch in G moll steht Neu herausgegeben u. a. in D. Alards » Maîtres classiques du Violon«. Dort auch noch zwei andere Sonaten des Meisters. – Weitere Sonaten Tartinis gab der Verfasser des vorliegenden Werkes heraus. Es sind noch mehrere Kompositionen des Meisters, darunter auch Konzerte, wieder herausgegeben worden, leider nicht planmäßig und in recht verschiedener Güte der Bearbeitung. Auch hier täte ein einheitliches Vorgehen sehr not.. Im engen Anschluß an Corelli und Vivaldi geht er mithin nicht nur an formeller, sondern auch nach inhaltlicher Seite über beide Meister hinaus, indem er bestimmte Stimmungsgebiete betritt. Doch erreicht er noch nicht die freiere Tongestaltung Veracinis. Dieser offenbart mehr individuelles Tonleben; er eröffnet bereits die Perspektive auf eine kommende Zeit, während Tartinis Empfindungswelt noch ganz entschieden unter dem Einfluß des kirchlichen Pathos steht: nur in sehr vereinzelten Fällen macht er den Versuch, sich der ihn beherrschenden Sphäre zu entziehen. Dies erklärt sich zum Teil daraus, daß viele seiner Sonaten und Konzerte ausschließlich für die Kirche geschrieben wurden, der er bis in seine spätesten Lebensjahre mit ungeschwächtem Eifer als Solospieler diente. Es wird (bei Gerber) ausdrücklich berichtet, »sein Eifer für den Dienst seines Schutzheiligen (S. Antonio) sei so groß gewesen, daß er trotz der Verpflichtung, nur an hohen Festen in der Kirche zu spielen, selbst noch bei seinen schwachen und kranken Nerven selten eine Woche vorbeiließ, ohne einmal zu spielen«. Und Fayolle erwähnt übereinstimmend hiermit: »Man erzählt, daß der Meister noch im hohen Alter in die Hauptkirche von Padua ging, um daselbst das Adagio seiner Sonate, genannt › Imperator‹ Dieser Name wird dem Adagio der 5. Sonate ( B dur) in Op. 6 beigelegt., zu spielen.«
Der von Tartini eingenommene Standpunkt als Violinkomponist war für geraume Zeit der herrschende. Seine Nachfolger bewegen sich vorzugsweise in den von ihm gesteckten Grenzen, bleiben jedoch in Erfindung und Größe des Stils bedeutend gegen ihn zurück. Nur hin und wieder lassen sie eine Erweiterung gewisser technischer Seiten des Violinspiels und ein Hinüberneigen zum weltlichen Tone erkennen. Hiervon sind in ersterer Beziehung selbst die Violinwerke eines Mannes wie Porpora, der indes hauptsächlich Vokalkomponist war, nicht auszunehmen. Seine zwölf Violinsonaten Zwei derselben (I und IX) erschienen neu in D. Alards » Matîres classiques da Violon«. (mit Baß) zeigen formfeste, tüchtige Arbeit, doch sind sie trocken, ohne Schwung und nüchtern, oft auch überladen in ornamentaler Hinsicht. Einen tatsächlichen Fortschritt gegen Tartini bewirkte für die Violinkomposition erst Viotti.
Tartini liebte es, sich für die produktive und reproduktive Tätigkeit dichterisch anzuregen. Algarotti Es ist wahrscheinlich jener Venezianer, welcher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu Padua studierte, Schriftsteller war und später von Friedrich dem Großen als dessen Kammerherr in den Grafenstand erhoben wurde. Vgl. übrigens Allgem. mus. Ztg. von 1812, Nr. 26. versichert, daß er die Gewohnheit hatte, ein Sonett von Petrarca zu lesen, ehe er an die Komposition ging, »um, an einen bestimmten Gegenstand anknüpfend, sich nicht in leere Phantasien zu verirren«. Diese Angabe findet entsprechende Ergänzung durch eine Mitteilung Lipinskis An den Verfasser dieser Blätter.. Derselbe ließ es sich nämlich bei seiner zwischen die Jahre 1817-1820 fallenden Anwesenheit in Oberitalien angelegen sein, Erkundigungen über Tartinis Spielweise einzuziehen. Zu Triest fand er noch einen unmittelbaren, bereits hochbejahrten Schüler des Meisters. Auf Lipinskis Frage, wie Tartini dies und jenes seiner Werke vorgetragen habe, reichte der Italiener ihm ein Gedicht, forderte ihn auf es durchzulesen, und veranlaßte ihn sodann, ein Tartinisches Adagio zu spielen, um ihm die Methode begreiflich zu machen, nach welcher der Komponist beim Vortrag der Musik zu Werke gegangen sei. Zugleich berichtete er, daß Tartini sich häufig Reime seiner Lieblingsdichter unter die Violinstimme geschrieben habe, deren Inhalt ihm gewissermaßen ein poetischer Leitfaden für seinen Ausdruck gewesen sei. Offenbar hat es sich hierbei um nichts anderes gehandelt, als um die poetische Anregung und Erweckung einer besonderen Stimmung, deren er vielleicht mehr bedurfte als andere Künstler. Dieses Verfahren Tartinis deutet aber zugleich auf eine Eigenart seines inneren Wesens, infolge deren er gelegentlich nur unter dem direkten Eindruck von poetischen Bildern tonkünstlerisch tätig zu sein vermochte. Bezeichnend dafür ist, daß er auch Mottos über die einzelnen Stücke seiner Kompositionen zu setzen pflegte, die er auf geheimnisvolle Weise in einer eigens dazu erfundenen, für Uneingeweihte völlig unverständlichen Chiffreschrift ausdrückte. Der bereits verstorbene Kapellmeister Melchiore Balbi in Padua besaß den Schlüssel zu dieser Chiffreschrift Er war so gefällig, mir näheren Aufschluß darüber zu geben.. Nach dieser ergibt sich für einen Sonatensatz die Aufschrift: » Ombra cara«, für eine andere: » Volgete il riso in pianto o mie pupille«. Wie leicht zugänglich übrigens Tartini einem gewissen Mystizismus war, beweist am deutlichsten seine Sonate » Il Trillo del Diavolo«. Ihre phantasmagorische Einkleidung zeigt wiederum, wie gern der Künstler sich an bestimmte Objekte anlehnte. Diesmal wird aber die unverkennbare Hinneigung dazu durch eine visionäre Nuance illustriert. Nach Lalandes Bericht Voyage d'un François en Italie, 1765 u. 66. Tom. 8., der die näheren Entstehungsumstände dieser Sonate angeblich aus Tartinis eigenem Munde empfangen hatte, war folgendes (Tartini ist selbst als Erzähler eingeführt) die Veranlassung zu der Komposition: »In einer Nacht (es war im Jahre 1713) träumte mir, ich hätte meine Seele dem Teufel verschrieben. Alles ging nach meinem Wink; mein neuer Diener kam jedem meiner Wünsche zuvor. Unter anderen Einfällen hatte ich auch den, ihm meine Violine zu geben, um zu sehen, ob er wohl imstande sein würde, etwas Hübsches darauf zu spielen. Aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine Sonate hörte, so wunderbar und so schön, mit so viel Kunst und Einsicht vorgetragen, daß auch der kühnste Flug der Phantasie sie nicht zu erreichen vermochte. Ich wurde so hingerissen, entzückt, bezaubert, daß mir der Atem stockte, und ich erwachte. Sogleich ergriff ich meine Violine, um wenigstens einen Teil der im Traume gehörten Töne festzuhalten. Umsonst. Die Musik, welche ich damals komponierte, ist zwar das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe, und ich nenne sie noch die Teufelssonate: aber der Abstand zwischen ihr und jener, die mich so ergriffen hatte, ist so groß, daß ich mein Instrument zerbrochen und der Musik auf immer entsagt haben würde, wenn es mir möglich gewesen wäre, mich des Genusses, den sie mir gewährte, zu berauben.«
Ist es nicht, als ob man ein Märchen aus Tausend und eine Nacht oder Dr. Fausts berühmte Teufelsverschreibung hörte? Und doch mochte Tartini selbst vollkommen überzeugt von der Wahrheit seines Traumes sein, wie etwa ein Mensch, welcher glaubt, infolge von Halluzinationen Geister gesehen oder gesprochen zu haben. Wenigstens hatte er als Wahrzeichen des geträumten Erlebnisses in seinem Musikzimmer, wie der deutsche Gelehrte Christoph Gottlieb Murr (bei Gerber) berichtet, die »Teufelssonate« der Tür gegenüber hängen.
Wir haben Tartinis Bedeutung als Violinspieler und Komponist für sein Instrument zu charakterisieren versucht und müssen ihn nun noch als Lehrmeister betrachten. In dieser Beziehung kann sein Wirken nicht hoch genug veranschlagt werden.
Der Beginn von Tartinis Lehramt wird übereinstimmend in das Jahr 1728 gesetzt. Von diesem Zeitpunkte ab strömten wohl hauptsächlich die Kunstjünger nach Padua, um der Unterweisung des berühmten Mannes teilhaftig zu werden, welcher von seinen Zeitgenossen bezeichnend » Maestro delle Nazioni« genannt wurde; denn zu seinen zahlreichen Schülern gehören nicht nur Italiener, sondern auch Deutsche und Franzosen. Tartini mußte ein um so besserer Lehrer sein, je mehr er dem autodidaktischen Studium verdankte. Ihm waren die Bedingungen eines kunstgemäßen Violinspiels im reiferen Alter völlig klar geworden. Erst als er Veracini gehört hatte, schlug er ein streng methodisches Verfahren ein, nach welchem er mit größter Gewissenhaftigkeit verfuhr. Namentlich widmete er dem Gebrauch des Bogens seine besondere Aufmerksamkeit. Er hatte die Stange förmlich ab- und eingeteilt, um bei seinen Strichübungen völlig systematisch verfahren zu können, und erlangte dadurch eine ungemeine Beherrschung des rechten Armes. Fayolle teilt hierüber in seiner schon zitierten Schrift » Paganini et Bériot« folgendes mit: » Tartini avait deux archets, l'un marqué sur la baguette de la division à quatre temps, l'autre de celle à trois temps. C'est dans ces divisions qu'il obtenait toutes les subdivisions de l'infiniment petit; et, comme il lui était prouvé que le poussé vertical était plus bref que le tiré perpendiculaire, il faisait jouer la même pièce en tirant comme en poussant, avec les mêmes inflexions. Aussi avait-il écrit en grosses lettres cette maxime sur son pupitre: Force sans raideur et flexibilité sans mollesse.«
Die Resultate seiner Bogenführungsstudien legte Tartini in dem Werke » Arte dell' arco« (50 Variationen über eine Gavotte Corellis) nieder. Dieses Werk, welches die hohe pädagogische Begabung seines Autors erkennen läßt, ist gleichzeitig als Studie für die linke Hand intentioniert. Ein auf ähnliche Zwecke berechnetes Seitenstück dazu findet sich in den melismatischen Veränderungen des Adagios der fünften Sonate ( Op. 2), welche die damals übliche Art und Weise der mannigfachen ornamentalen Metamorphose eines melodischen Motivs erkennen lassen.
Wenn jemand dazu berufen war, eine Violinschule zu schreiben, so ist es Tartini. Wir ersehen dies aus einer Lektion, die er auf brieflichem Wege seiner Schülerin Maddalèna Lombardini-Sirmen erteilt. Klarer, bestimmter und eindringlicher können gewisse wichtige Elemente des Violinspiels nicht gelehrt werden, als hier geschieht. Dieser Brief Tartinis ist ein zu wichtiges Dokument, um desselben bloß andeutungsweise zu gedenken. Wir geben ihn in der Hillerschen Übersetzung S. J. A. Hillers Lebensbeschreibungen berühmter Tonkünstler, auch Allgem. mus. Ztg. vom Jahre 1803, Nr. 9., wie folgt:
»Meine hochgeschätzte Signora Maddalèna.
(Padua, d. 6. März 1760.)
Endlich habe ich mich, mit der Hilfe Gottes, von dem beschwerlichen Geschäfte losgemacht, das mich bisher verhindert hat, Ihnen mein Versprechen zu halten. Je mehr es mir am Herzen lag, desto mehr betrübte mich der Mangel der Zeit. Wir wollen nun, in Gottes Namen, durch Briefe anfangen; und wenn Sie, was ich hier vortrage, nicht genugsam verstehen, so schreiben Sie, und fordern von mir die Erklärung alles dessen, was Ihnen unverständlich ist. Ihre vornehmste Übung muß den Gebrauch des Bogens betreffen: Sie müssen darüber unumschränkter Meister werden sowohl in Passagien als im Kantabile. Das Aufsetzen des Bogens auf die Saite ist das erste. Es muß mit solcher Leichtigkeit geschehen, daß der erste Anfang des Tons, welcher herausgezogen wird, mehr einem Hauche auf die Saite, als einem Schlage ähnlich scheint. Nach diesem leichten Aufsatze des Bogens wird der Strich sogleich fortgesetzt, und nun können Sie den Ton verstärken, soviel Sie wollen, da nach dem leichten Aufsatze keine Gefahr mehr ist, daß der Ton kreischend oder kratzend werde. Dieses leichten Ansatzes mit dem Bogen müssen Sie sich in allen Gegenden desselben bemeistern, sowohl in der Mitte, als an den beiden äußersten Enden; sowohl im Hinauf- als im Herunterstriche. Um der Sache auf einmal mächtig zu werden, übt man sich zuerst mit dem messa di voce auf einer bloßen Saite, z. B. auf dem a. Man fängt vom pp an, und läßt den Ton immer nach und nach stärker werden, bis zum ff , und dieses Studium muß man sowohl mit dem Herunter- als mit dem Heraufstriche vornehmen. Fangen Sie diese Übung sogleich an, und wenden Sie wenigstens täglich eine Stunde Zeit darauf, zwar nicht ununterbrochen: sondern vormittags eine halbe Stunde und nachmittags wieder so viel. Erinnern Sie sich dabei, daß dies das wichtigste und schwerste Studium ist. Wenn Sie damit zustande sind, dann wird Ihnen das messa di voce nicht weiter Mühe machen, das mit einem und demselben Bogenstriche vom pp anfängt, bis zum ff steigt, und wieder aufs pp zurückkommt. Das geschickteste Aufsetzen des Bogens auf die Saite wird Ihnen leicht und sicher geworden sein, und Sie werden mit Ihrem Bogen alles machen können, was Sie wollen. Um nun ferner die Geschwindigkeit des Bogens, die von der leichten Berührung abhängt, zu erhalten, ist der beste Rat, daß Sie täglich eine oder die andere Fuge des Corelli, die ganz aus Sechzehnteilen besteht, spielen. Dieser Fugen sind drei in den Sonaten a Violino Solo, opera V. Auch die erste, in der ersten Sonate aus D dur ist dazu dienlich. Sie müssen sie zuerst langsam, dann immer etwas geschwinder spielen, bis Sie dieselben in der möglichsten Geschwindigkeit herausbringen. Ich muß Ihnen aber dabei noch einen doppelten Rat geben; der erste, daß Sie sie mit einem kurzen Bogenstriche, das ist: abgestoßen, und mit einem kleinen Absatze zwischen jeder Note spielen. Sie sind folgendergestalt geschrieben:
sie müssen aber gespielt werden, als ob sie so geschrieben wären:

Der andere: daß Sie sie, im Anfange, mit der Spitze des Bogens spielen, hiernach aber, wenn es Ihnen damit gelingt, mit der Gegend des Bogens zwischen der Spitze und der Mitte desselben; und endlich, wenn auch dieses gut vonstatten geht, mit der Mitte des Bogens selbst. Vergessen Sie dabei nicht, daß Sie diese Fugen nicht immer mit dem Herunterstriche, sondern bald mit dem Herunter- bald mit dem Heraufstriche anfangen müssen. Um Leichtigkeit des Bogens zu erhalten, ist auch das Überspringen einer Saite von ungemein großem Nutzen, und wenn man Fugen mit Sechzehnteln folgender Art studiert:

Sie können sich selbst von dieser Gattung so viele erfinden, als Sie wollen, und in einem jeden Tone. Sie sind in der Tat nützlich und notwendig.
In Ansehung des Aufsetzens der Finger auf das Griffbrett empfehle ich Ihnen eine Sache, die für alles hinreichend ist. Sie besteht darin: Nehmen Sie eine Stimme der ersten oder zweiten Violine, es sei von einem Konzert, von einer Messe oder einem Psalm; alles, folglich auch die Violinstimme einer Symphonie, eines Trios usw. ist dazu dienlich. Stellen Sie die Finger nicht in die gewöhnliche Lage, sondern in die halbe Heute wird sie die zweite Lage genannt. Applikatur; d. i., den ersten Finger in g auf der e-Saite, und spielen Sie die ganze Violinstimme in dieser Lage durch, so daß sich die Hand nie aus derselben verrücken läßt, als wenn Sie auf der untersten Saite das a und auf der ersten das dreigestrichene d zu nehmen haben; Sie müssen aber sogleich wieder in die vorige Applikatur zurückkehren. Dies Studium muß so lange getrieben werden, bis Sie imstande sind, eine jede Violinstimme, die nichts Konzertmäßiges enthält, auf den ersten Anblick vom Blatt zu spielen. Gehen Sie sodann mit der Applikatur weiter hinauf, mit dem ersten Finger in das "a, und üben diese ebenso fleißig als die erste. Wenn Sie auch in dieser sicher sind, so nehmen Sie die dritte vor, mit dem ersten Finger in "b, und suchen sich in dieser ebenso fest zu machen. Auf diese kann noch eine vierte folgen, da der erste Finger ins dreigestrichene c auf der e-Saite gesetzt wird. Sie haben sodann eine Skala von Applikaturen, daß Sie, wenn Sie dieselben recht in der Gewalt haben, sich rühmen können, vom Griffbrette Meister zu sein. Dies Studium ist notwendig und ich empfehle es Ihnen.
Das dritte Stück nun ist das Trillo. Ich verlange es von Ihnen langsam, mäßig, geschwind und ganz geschwind. In der Ausführung sind diese verschiedenen Triller notwendig; denn es ist nicht an dem, daß eben das Trillo, das zu einem geschwinden Satz gut ist, auch zu einem langsamen dienen könne. Um die Sache mit einem Mal abzutun und aus einer Übung nicht zwei zu machen, so fangen Sie auf einer bloßen Saite an, es mag a oder e sein; der Bogen muß langsam, wie bei einem messa di voce geführt werden. Das Trillo hebe ganz langsam an, gehe immer, nach und nach, durch unmerkliche Grade, ins Geschwindere fort, bis es ganz geschwind geworden ist, wie dies Beispiel zeigt:

Binden Sie sich aber nicht so ganz genau an dieses Beispiel, in welchem der Übergang von Achteln sogleich zu Sechzehnteln, und von diesen zu andern, wieder um die Hälfte kleineren Noten, zu Zweiunddreißigteilen ist. Nein, dies hieße springen, und nicht gehen. Stellen Sie sich zwischen den Achteln und Sechzehnteln andere Noten vor, die weniger als Achtel und mehr als Sechzehntel gelten, so daß, wenn Sie mit Achteln anfangen, diese dem Werte der Achtel am nächsten kommen, und im Fortgange sich immer mehr und mehr den Sechzehnteln nähern, bis sie wahre Sechzehntel werden; und so auch im Übergange von diesen zu Zweiunddreißigsteln. Diese Übung nehmen Sie fleißig und mit Sorgfalt vor. Aber fangen Sie sie immer auf der bloßen Saite an; denn wenn Sie das Trillo auf der bloßen Saite gut machen lernen, so wird es Ihnen um so viel leichter werden mit dem zweiten, mit dem dritten und selbst mit dem vierten Finger, mit welchem Sie besondere Übungen werden vornehmen müssen, weil er der kleinste unter seinen Brüdern ist.
Weiter gebe ich Ihnen jetzt nichts auf; aber dies ist schon viel, und von großem Nutzen, wie Sie sich davon leicht überzeugen werden. Schreiben Sie mir, ob Sie alles, was ich Ihnen hier vortrage, wohl begriffen haben. Ich bin usw.«
Es ist zu bedauern, daß Tartini seiner vorstehend mitgeteilten brieflichen Lektion keine weitere Folge gegeben hat. Zwar existiert noch eine selten gewordene didaktische Arbeit von ihm, doch nur die Kenntnis derselben könnte Aufschluß darüber geben, inwiefern sie pädagogischen Wert hat. Es ist nach Fétis ein » Trattato delle appoggiature si ascendenti che discendenti per il violino, come pure il trillo, tremolo, mordente, ed altro, con dichiarazione delle cadenze naturali e composte«. Das Originalmanuskript ist nie im Druck erschienen. Dagegen veranstaltete Tartinis Schüler Lahoussaye eine französische Übersetzung des Werkes, welche 1782 in Paris (bei Pietro Denis) unter folgendem Titel erschien: » Traité des agréments de la musique, contenant l'origine de la petite note, sa valeur, la manière de la placer, toutes les differentes espèces de cadences etc.« –
Unter Tartinis zahlreichen Schülern sind die namhaftesten: Bini, Nardini, Manfredi, Ferrari, Meneghini, Joh. Gottl. Graun, Pagin und Lahoussaye. Auch Pugnani, der ein Schüler von Somis war, genoß eine Zeitlang Tartinis Unterweisung.
Bini, mit Vornamen Pasqualini, geb. gegen 1720 zu Pesaro (gest. 17..), wurde von seinem Meister als besonders wohlgeratener Schüler gepriesen. Burney berichtet, daß, als ein Engländer Wiseman Tartini um Stunden bat, dieser ihn an Bini mit den Worten wies: » Io lo mando ad un mio scolare che suona più di me, e me ne glorio per essere un angelo di costume e religione.« Nachdem Bini einen drei- bis vierjährigen Lehrkursus in Padua absolviert hatte, wurde er vom Kardinal Olivieri nach Rom berufen, wo er alle Musikkreise durch die Kühnheit und Vollendung seines Spiels in Erstaunen setzte. Für Montanari S. denselben weiter unten. wurde er dort ein gefährlicher Nebenbuhler. Es wird sogar behauptet, daß für diesen Künstler die Überlegenheit Binis der Grund zu einem geistigen Siechtum wurde, welches mit dem Tode endete. Man kennt weder Kompositionen von Bini, noch ist eine Angabe über die Zeit seines Ablebens vorhanden. Einer seiner beachtenswerteren Schüler war der Neapolitaner Emanuele Barbella, als dessen Schüler wiederum der gerühmte, längere Zeit in Amsterdam lebende Violinspieler Ignazio Raimondi zu nennen ist.
Barbella, der 1773 in Neapel starb, hatte zum Kompositionslehrer einen gewissen Michele Gabbaloni und später den fruchtbaren Opernkomponisten Leonardo Leo. Dieser pflegte, wenn auf Barbella die Rede kam, wie Fétis mitteilt, scherzend zu bemerken: » Non per questo, Barbella è un vero asino che non sa niente!« Gerber berichtet indessen, daß dieser Ausspruch eine Selbstkritik Barbellas war, deren er sich in einem an Burney gesendeten Berichte über seine Künstlerlaufbahn bediente. Die von Cartier in dessen » L'art de Violon« mitgeteilte Violinsonate Barbellas ist ein höchst unbedeutendes Musikstück Eine Sonate (II) von ihm in Alards » Maîtres classiques du Violon«..
Größere Geltung als Bini erlangte in der musikalischen Welt Pietro Nardini, geb. 1722 zu Fibiana im Toskanischen, gest. 7. Mai 1793 in Florenz. Schubart Schubarts gesammelte Schriften Bd. 5, S. 70. charakterisiert sein Spiel folgendermaßen: »Nardini war Tartinis größter Schüler, ein Geiger der Liebe, im Schooße der Grazien gebildet. Die Zärtlichkeit seines Vortrags läßt sich unmöglich beschreiben: jedes Komma scheint eine Liebeserklärung zu seyn. Sonderlich gelang ihm das Rührende im äußersten Grade. Man hat eiskalte Fürsten und Hofdamen weinen gesehen, wenn er ein Adagio spielte. Ihm selbst tropften oft unter dem Spielen Thränen auf die Geige. Jeden Harm seiner Seele konnte er auf sein Zauberspiel übertragen: seine melancholische Manier aber machte, daß man ihn nicht immer gern hörte; denn er war fähig, die ausgelassenste Phantasie vom mutwilligsten Tanze auf Gräber hinzuzaubern. Sein Strich war langsam und feierlich; doch riß er nicht, wie Tartini, die Noten mit der Wurzel heraus, sondern küßte nur ihre Spitzen. Er stackierte ganz langsam, und jede Note schien ein Blutstropfen zu seyn, der aus der gefühlvollsten Seele floß. Man behauptet, daß eine unglückliche Liebe der Seele dieses großen Mannes diese schwermütige Stimmung gegeben, denn Personen, die ihn vorher gehört, sagen, daß sein Styl in jüngeren Jahren sehr hell und rosenfarbig gewesen sey.«
Nardini erhielt die erste musikalische Erziehung in Livorno, wohin die Eltern bald nach seiner Geburt gezogen waren. Dann genoß er die Lehre des Paduaner Meisters, aus der er mit dem vierundzwanzigsten Lebensjahre entlassen wurde. Allgemein wird Nardini als Lieblingsschüler Tartinis bezeichnet. Daß er den Meister in seiner letzten Krankheit wie den eigenen Vater pflegte, wurde schon mitgeteilt. 1753 wurde Nardini als Sologeiger an den Württemberger Hof berufen, wo ihn auch Schubart hörte. In dieser Stellung verblieb er bis 1767, da er es dann infolge der Reorganisation der Stuttgarter Kapelle vorzog, nach Italien zurückzukehren. Hier fand er am florentinischen Hofe eine seiner Bedeutung entsprechende Stellung als Soloviolinist und Dirigent der großherzoglichen Kapelle, die ihn bis zu seinem am 7. Mai 1793 erfolgten Tode in Anspruch nahm.
Von Nardinis Kompositionen ist nur der kleinere, bei Fétis verzeichnete Teil in die Öffentlichkeit gedrungen. Sie zeigen ein anmutiges, liebenswürdiges Talent. Größe des Stils ist ihnen nicht eigen. Dagegen entschädigen sie teilweise durch reizvolle Sinnigkeit, ungetrübte naive Heiterkeit sowie durch Adel und Frische der Empfindung. So vor allem die D dur-Sonate Neu herausgegeben von F. David bei Breitkopf & Härtel sowie in D. Alards » Maîtres classiques du Violon«., die zu den lieblichsten Blüten der italienischen Violinmusik jener Epoche zählt und sich namentlich auch durch eine für die damalige Zeit höchst bemerkenswerte formelle Ausgestaltung des ersten Allegrosatzes hervortut. Sie hat etwas von dem Mozartschen Schönheitssinn, ja mehrere Themen erinnern direkt an diesen Meister. Sonsthin finden sich in Nardinis Sonaten einzelne Kantilenensätze, denen eine anmutende Süßigkeit des Ausdrucks eigen ist Einer davon (bezeichnet: aus Sonate V), auf den obige Bezeichnung genau zutrifft, bei Torchi in der Collection Boosey., während die mit Passagen nicht selten überladenen Allegros meist etwas Konventionelles und, man darf sagen, Veraltetes an sich tragen. Es fehlt hier offenbar an erfinderischer Kraft. Übrigens gehört Nardini zu jenen Violinkomponisten des achtzehnten Jahrhunderts, die auf der Grenzscheide des kirchlichen und weltlichen Musiktones stehen.
Als Schüler des Nardini sind anzumerken: der Pisaner Giulio Maria Lucchesi, Giuseppe Moriani, geb. 16. August 1752 zu Livorno (war im Vortrag Haydnscher und Boccherinischer Quartette ausgezeichnet), die Florentiner Francesco Sozzi (zu Anfang des 19. Jahrh. Violinist in Augsburg) und Francesco Giuliani, Francesco Vaccari, geb. 1773 zu Modena (lebte hauptsächlich in Spanien), Pollani in Rom, und der Engländer Thomas Linley.
Thomas Linley, geb. zu Bath 1756, ließ sich bereits mit 8 Jahren als Konzertspieler hören, nachdem er in London bei Boyce Violinunterricht gehabt. 1770 reiste er nach Florenz, um unter Nardini zu studieren. Zwei Jahre später kehrte er in seine Heimat zurück. Der talentvolle Künstler ertrank bei einer Wasserpartie am 7. August 1778.
Francesco Giuliani, geb. um 1760 zu Florenz, war dort vielseitig tätig als Violinist, Harfenist, Gesangs- und Klavierlehrer. Nardini und Bartolomeo Felici waren seine Lehrer. Eine Zeitlang war er Violinist am nuovo teatro in Florenz. Sodann finden wir ihn 1795 als Direktor und ersten Violinisten am königl. Theater ebenda. Im Mailänder Opernverzeichnis wird er 1785 auch unter die Opernkomponisten gerechnet. (Nach Eitners Quellenlexikon, dort auch die Aufzählung seiner Werke.)
Der Lucchese Filippo Manfredi, geb. gegen 1738 (gest. 1780), war ein Landsmann und Freund Boccherinis. Mit diesem verband er sich zu einer Kunstreise (Boccherini war bekanntlich Violoncellist), welche ihn 1768 auch nach Paris führte. Hier machte er, namentlich durch den Vortrag der Boccherinischen Trios und Quartette, denen man damals in der französischen Hauptstadt entschieden den Vorzug vor den Haydnschen Kammerkompositionen gab, ungemeines Aufsehen. Freilich war dasselbe, wie es scheint, nicht durchaus günstiger Art. » Manfredi, premier violon, n'a point eu le succès qu'il espéroit. On a trouvé sa musique plate, son exécution large et moelleuse, mais son jeu fol et désorderé.« So heißt es in den » Mémoires secrets« vom 2. April 1768. Die Genossen wandten sich dann nach Madrid, wo sie beide in die Dienste des Infanten Don Louiz, Bruder des Königs, traten. Fétis führt einige Kompositionen Manfredis an. Die in Cartiers » L'art de Violon« von ihm mitgeteilte Sonate ist nicht ohne Würde und Charakter, bietet aber das Hauptinteresse durch die damals noch nicht häufige Anwendung des Oktavenspieles. Auch D. Alard hat in den » Maîtres classiques« eine Sonate, Nr. 6 von Manfredi.
Zu den besten Schülern Tartinis wird auch Domenico Ferrari, geb. 17.. zu Piacenza, gezählt. Von seinem Lehrmeister entlassen, fixierte er sich zunächst in Cremona, um zurückgezogen von der Welt weiteren Studien zu leben, die ihn auf eine ausgedehntere Anwendung der Flageolettöne und des Oktavenspiels hinleiteten. Als er sich stark genug glaubte, in der musikalischen Welt eine Rolle spielen zu können, begab er sich auf Reisen; 1749 war er, wie Dittersdorf berichtet, ungefähr 9 Monate in Wien, »und ärndtete hier sowohl beym kaiserl. Hofe als auch bey der Theaterdirektion, sowie bey Privatliebhabern nicht nur den größten Beyfall, sondern auch die reichlichste Belohnung ein. Ganz Wien hielt ihn damals für den größten Violinspieler« Dittersdorfs Selbstbiographie S. 44. Vgl. auch die Besprechung Dittersdorfs in diesem Buche. Vier Jahre später nahm er neben seinem Mitschüler Nardini ein Engagement beim Herzog von Württemberg an. Schubart sagt (Bd. V S. 96) über seine Leistungen: »Aus Bizzarrerie schlug er gerade den verkehrten Weg des Tartini ein. Seine Bogenwendung ist nicht gerade, sondern krumm. (Es ist unklar, was Schubart damit meint.) Er strich nicht mit Allgewalt, sondern glitschte nur über die Saite weg, verließ die Peripherie des Steges, wagte sich hoch ans Griffbrett hinauf, und brachte dadurch einen Ton hervor, der ungefähr dem glich, wenn man ein Glas ganz sanft reibt, daß seine Krystallrinde dröhnt. Der Fehler dieses großen Meisters aber war, daß er aus Eigensinn nicht das annahm, was Tartini Gutes hatte.« Jedoch war Schubart auch kein unbedingter Lobredner der Tartinischen Schule, von der er sagt, »daß ihr majestätisch-träger Zug die Geschwindigkeit des Vortrags hemme, und zu geflügelten Passagen gar nicht geschickt sey. Indessen«, fährt er fort, »sind die Zöglinge dieser Schule unverbesserlich gut für den Kirchenstyl, denn ihr Strichvortrag hat gerade soviel Kraft und Nachdruck, als zum wahren Ausdruck des pathetischen Kirchenstyls erforderlich ist.«
Im Jahre 1754 ließ sich Ferrari in Paris im Concert spirituel hören. Der Mercure vom Mai 1754 bezeichnet seine Leistungen als » la perfection même«, wobei man sich freilich der damals noch nicht allzuhoch gespannten Ansprüche des Pariser Publikums zu entsinnen hat.
Ferraris gedruckte Werke bestehen in 6 Heften zu Paris und London erschienener Violinsonaten. Das aus denselben in Cartiers » L'art de Violon« mitgeteilte Allegro erweckt keine sonderliche Meinung zugunsten seines produktiven Talents: es ist nüchtern, nichtssagend und etüdenhaft. Eine Sonate (II) erschien in Alards » Maîtres classiques du Violon«. – Von Stuttgart begab sich Ferrari wiederum nach Paris. Eine von hier aus beabsichtigte Londoner Reise kam nicht mehr zur Ausführung, da er, angeblich infolge eines Mordanfalles (1780), sein Leben verlor.
Von Giulio Meneghini (geb. 17.., gest. 17..) ist uns weiter keine biographische Nachricht aufbehalten als die, daß er der Amtsnachfolger seines Lehrmeisters war. Lipinski hörte bei seiner schon erwähnten Anwesenheit in Italien über ihn, daß er sich durch einen ungewöhnlich starken Ton ausgezeichnet, welcher ihm den Beinamen » la Tromba« eingetragen habe. Dies ist glaubhaft; denn bei Gerber wird außer Meneghinis eines um dieselbe Zeit auftretenden Giulietto Tromba als Schüler Tartinis und Musikdirektor (?) an der Kirche des h. Antonius zu Padua gedacht. Man kann kaum zweifeln, daß Gerber infolge eines Versehens, oder durch den Namen Tromba dazu verleitet, aus ein und derselben Person zwei verschiedene gemacht hat.
Höchstwahrscheinlich war auch Domenico dall' Oglio (Dalloglio), geboren zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Padua, ein Schüler Tartinis. 1735 begab er sich mit seinem Bruder, einem Violoncellisten, nach Petersburg und blieb daselbst 19 Jahre lang im Dienste des kaiserl. Hofes. 1764 nahm er seinen Abschied, um in seine Heimat zurückzukehren. Aber auf der Reise dahin starb er nahe bei Narva infolge eines Nervenschlages. Von seinen mannigfachen Kompositionen existieren nur Kopien, da er nichts drucken ließ.
Die Franzosen Pagin und Lahoussaye finden ihre Erledigung in dem Abschnitte über das französische Violinspiel.
Zu den hervorragendsten Zöglingen Tartinis zählen außerdem Joh. Gottl. Graun und Pugnani. Der erstere war indessen zunächst in der Dresdner, der zweite dagegen in der piemontesischen Schule gebildet; beide Künstler werden deshalb erst weiterhin zu berücksichtigen sein.
Andere aus Tartinis Lehre hervorgegangene, doch minder bedeutende Künstler waren: Alberghi, Carminati Er trat 1753 im Conc. spirituel auf. (ein Venezianer, der zu Lyon wirkte), der Graf Thurn und Taxis (Österreichischer Generalpostmeister zu Venedig), Obermayer (ein Prager Dilettant), Don Paolo Guastarobba (ein Spanier), Petit Er trat 1738 im Conc. spirituel auf., Pagni, Nazari Ein Schüler von ihm war Giuseppe Antonio Capuzzi, Violinmeister am Musikinstitut und Orchesterdirektor an der Kirche S. Maria Maggiore zu Bergamo. Er wurde 1740 in Brescia geboren und starb zu Bergamo den 18. März 1818. (1770 erster Violinist in Venedig), Holzbogen, Kammel, Lorenz Schmitt, Angiolo Morigi (geb. 1752, erster Violinist am Hofe zu Parma), Giuseppe Signoretti (gegen 1770 zu Paris) und Karl Matthäus Lehneis (1766 Konzertmeister in der Dresdner Kapelle).
Ein Schüler des soeben genannten Alberghi war Cristofero Babbi. Nach Gerber war er geboren in Cesena 1748 und wurde um das Jahr 1780 Kurfürstl. sächs. Konzertmeister in der Dresdner Kapelle. Außer Symphonien, einiger Flötenmusik und einer Kantate nennt Gerber als Kompositionen von ihm mehrere Violinkonzerte und Streichquartette.
Endlich ist hier noch der Signora di Sirmen, geb. Maddalena Lombardini, als einer Schülerin Tartinis zu gedenken. Sie eröffnet den Reigen einer stattlichen Reihe von Violinspielerinnen, deren Bekanntschaft wir zum Teil weiterhin machen werden. M. Lombardini, geboren zu Venedig gegen Mitte 1735, war zugleich Sängerin und empfing die erste musikalische Ausbildung im venezianischen Konservatorium »dei Mendicanti«. Das fortgesetzte Studium unter Tartini, der ihr auch die bereits zitierte briefliche Lektion erteilte, förderte sie so weit, daß sie in Italien als Rivalin Nardinis angesehen wurde. Zu Paris erregte sie dann im Concert spirituel Aufsehen durch die in selbstverfaßten (später veröffentlichten) Kompositionen offenbarte Brillanz und Energie ihres Spieles. Eine violinspielende Dame übte damals noch als solche den Reiz der Neuheit aus Um hiervon zu profitieren, hatten die geschäftskundigen Leiter des Konzerts dafür gesorgt, daß man sie in Paris nicht vor ihrem Auftreten im Concert spirituel hörte. Man erfreute sich nun doppelt an diesem » phénomène rare« und bemerkte hauptsächlich im Adagio » cette sensibilité qui charactérise si bien son sexe«. » Son violon«, sagt ein anderer Journalist jener Tage schmeichelhaft, » est la lyre d'Orphée dans les mains d'une grâce.« (Nach Brenet, Les Concerts en France.) Im Jahre 1768 trug sie in Paris mit ihrem Gatten Louis di Sirmen, welcher Violinist und Kapellmeister an der Kirche S. Maria Maddalena zu Bergamo war, ein Doppelkonzert vor. In demselben Jahre ließ sie sich auch in London beifällig hören. Von 1774 ab scheint sie ausschließlich als Sängerin tätig gewesen zu sein. Als solche war sie zunächst an der Pariser Oper und dann (1782) am Dresdner Hofe tätig. Ihr Todesjahr ist unbekannt.
Die piemontesische Schule, die ihren Sitz in Turin hatte und sich fast gleichzeitig mit der Paduaner, nur um ein weniges früher bildete, trägt nicht den autonomen Charakter der beiden anderen italienischen Hauptschulen. Ihr Begründer G. B. Somis war, wie man gesehen hat, ein Schüler Corellis, und außer Vivaldi wurde sie weiterhin auch durch Tartini wesentlich beeinflußt. Diese Ineinsbildung verschiedener Richtungen verlieh der piemontesischen Schule jene Eigenschaften, die sie ganz besonders befähigten, den Entwicklungsgang des Violinspiels, wenigstens teilweise, bis ins 19. Jahrhundert hinein zu bestimmen.
Als unmittelbare Schüler G. B. Somis', dessen Wirken schon geschildert wurde, sind zu nennen: Giarbini, Chiabran, Friz, Pugnani und Leclair. Wir berücksichtigen hier zunächst die ersteren vier Künstler und verweisen in betreff Leclairs auf die Geschichte des französischen Violinspiels.
Felice Giardini (er selbst nennt sich in dem Buch der Londoner » Society of Musicians« vom Jahre 1755 Felice de Giardini) wurde am 12. April 1716 zu Turin geboren. Im Knabenalter schon wurde er der Musik bestimmt. Man ließ ihn in das Chorknabeninstitut des Mailänder Domes eintreten und zugleich den Gesang-, Klavier- und Harmonieunterricht eines gewissen Paladini genießen. Doch bald zeigte sich seine ungewöhnliche Begabung für die Violine, und diese wurde Veranlassung, den Knaben wieder nach Turin zurückzunehmen und der Lehre Somis' zu übergeben. Nach wenig Jahren fühlte er sich stark genug, um eine selbständige Tätigkeit zu beginnen. Er ging zunächst nach Rom, und da hier keine Aussicht zu einem Wirkungskreise war, nach Neapel. Dort fand er Aufnahme im Orchester des S. Carlo-Theaters. Giardini war damals noch ein sehr junger Mann, mehr geneigt mit der Kunst zu spielen, als sich ihr pietätvoll unterzuordnen. Bald wurde er aber auf drastische Weise von dieser jugendlichen Tändelei geheilt. »Er machte es sich nämlich«, so berichtet Gerber übereinstimmend mit anderen, »zum angelegensten Geschäfte, alles, was ihm vorkam, zu variiren, und jeden Satz mit Manieren zu verbrämen. Nichts desto weniger, erzählte er selbst, erwarb ich mir durch diese Ungereimtheiten bey den Unwissenden ungemeine Hochachtung. Eines Abends aber, als eine Oper von Jomelli aufgeführt wurde, kam dieser ins Orchester und setzte – sich neben mich. Ich beschloß sogleich, den Maestro di Capella eine Probe von meiner Kunst und meinem Geschmacke hören zu lassen, und gab meinen Fingern und närrischen Einfällen, in dem nächsten Ritornello zu einer pathetischen Arie, vollen Spielraum. Schon hatte ich eine Zeitlang sein beyfälliges Bravo erwartet, als er mir mit einer derben Ohrfeige lohnte.« Diese Ermahnung war nicht unfruchtbar geblieben; denn Giardini gab mit anerkennenswerter Offenheit später zu, »nie eine bessere Lektion von einem großen Meister empfangen zu haben«. Jedenfalls wurde er durch dieselbe trefflich für seine weitere Tätigkeit als Orchesterdirigent vorbereitet; denn ein solcher muß, wenn er eine Autorität sein soll, vor allen Dingen den übrigen mit gutem Beispiel in Ausübung des Berufes vorausgehen. Und Giardini wurde ein sehr gerühmter Orchesterführer.
Er wandte sich von Neapel, Deutschland durchziehend, nach London, wo er auch den größten Teil seines Lebens zubrachte. Über die Zeit seines dortigen Auftretens lauten die Angaben verschieden. Sein Biograph Regli gibt an, daß er schon 1744 in London gewesen sei, Pohl Mozart und Haydn in London, B. I, S. 170 ff. dagegen behauptet, Giardinis Name erscheine erst 1751 in englischen Zeitungen. Dies würde freilich noch nicht gegen Reglis Annahme sprechen, da Giardini sich möglicherweise vorerst von der Öffentlichkeit zurückgehalten haben könnte. Doch ist solches nicht wahrscheinlich, am allerwenigsten an einem Orte wie London, wo damals wie heute unbemittelte Künstler mehr als anderswo auf den Erwerb angewiesen waren.
Diese Unsicherheit dürfte durch eine neuerliche Angabe Brenets (in seinem mehrfach zitierten Buche über die Konzerte in Frankreich) zugunsten Pohls zu entscheiden sein. Brenet teilt mit, daß G. im Jahre 1750, auf der Durchreise von Italien nach London begriffen, mehrfach im Concert spirituel aufgetreten ist. Demnach müßte dieses resp. der Anfang des nächstfolgenden Jahres als der Übersiedlungstermin Giardinis nach London betrachtet werden.
Giardinis erstes Auftreten in London am 27. April 1751 war von glänzendem Erfolg begleitet. Burney schildert den Eindruck seiner Leistungen als etwas Außerordentliches und fügt hinzu, daß sie eine neue Epoche im Konzertleben Londons gebildet hätten. Bald war er der Liebling des vornehmen Publikums, welches ihn als Gesang- und Violinlehrer begehrte und sich zu den in seinem Hause veranstalteten Musikmatineen drängte. Auch ein öffentlicher ehrenvoller Wirkungskreis wurde ihm an der italienischen Oper zuteil, deren Orchesterleitung er 1752 nach Festings Tode mit Auszeichnung übernahm. Doch dies alles war dem spekulativen Italiener nicht genug. Er beteiligte sich 1756 an der Geschäftsführung der Oper, erlitt aber dabei so bedeutende Einbuße, daß er genötigt war, sich alsbald wieder davon zurückzuziehen. Diese Erfahrung konnte ihn jedoch nicht abhalten, nachdem er von 1761-1762 wieder mehr Solo gespielt, sein Glück nochmals als Impresario während der Jahre 1763-1765 zu versuchen. Hierbei verlor er den Rest seiner ganzen Habe, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als das saure Brot eines Musiklehrers. Weiterhin gestalteten sich die Verhältnisse Giardinis wieder etwas besser; er wurde während der Jahre 1770 bis 1776 als Vorsteher zu den Musikfesten in Worcester, Gloucester und Hereford engagiert, und gewiß hätte auch in London seine Stellung von neuem sich gehoben, wenn nicht 1773 Wilhelm Cramers Auftreten daselbst erfolgt wäre, gegen dessen jugendlich frische Erscheinung er nicht mehr aufkommen konnte. Beide Künstler traten zwar in ein angenehmes Verhältnis, allein dies konnte nicht verhindern, daß Giardinis Stern mehr und mehr erblich. Unter solchen Umständen mochte der in eine untergeordnete Position Gedrängte es für ratsam halten, London ganz zu verlassen; er kündigte sein letztes Auftreten an. Allein er blieb trotzdem, übernahm 1774 bis 1780 die Funktion des Orchesterchefs im Pantheon, sowie von 1782-1783 die gleiche, schon früher bei der italienischen Oper innegehabte Stellung und verließ dann erst (1784) England, um nach Italien zurückzukehren. Indes nach Verlauf von sechs Jahren sehen wir ihn schon wieder in London bemüht, eine Opera buffa, doch nur vorübergehend, im kleinen Haymarket-Theater einzurichten, worauf er dann infolge des Mißlingens dieses Planes die Weltstadt 1791 für immer verließ. Er versuchte mit der von ihm geworbenen Truppe nochmals sein Glück in Petersburg und Moskau. In letzterer Stadt ereilte ihn, den achtzigjährigen Greis, endlich am 17. Dezember 1796 der Tod.
Giardinis Leben gewährt, wie dasjenige so vieler anderer Künstler jener Zeit, ein wenig erfreuliches Bild wechselreicher Gegensätze. Seiner ausübenden Künstlerschaft zufolge hätte er sich ohne Frage eine ruhige, behagliche und dauernde Stellung erringen können. Allein es scheint, daß er Phantomen nachjagte, deren Verwirklichung außer dem Bereich seiner Sphäre lag, und so wird er von dem Selbstverschulden des Ungemachs wohl nicht ganz freizusprechen sein, das ihm bis ans Lebensende folgte. Vielleicht hat dazu sogar eine gewisse Unsolidität Giardinis in Handel und Wandel mit beigetragen. Hierauf deutet wenigstens eine (von Pohl) mitgeteilte Tatsache. Giardini trieb einen ausgedehnten Handel mit Geigen, von denen er stets bedeutenden Vorrat hielt. Der Prinz von Wales, ein eifriger Musikfreund, bei dessen Privatkonzerten Giardini zeitweilig Vorspieler war, erhandelte auch eine Violine von ihm, die, für eine echt italienische ausgegeben, mit hohem Preise bezahlt wurde. Während Giardinis Abwesenheit von London machte sich eine Reparatur an dem Instrument notwendig, und bei dieser Gelegenheit ergab das Innere desselben als Verfertiger den englischen Violinfabrikanten Banck. Der Prinz rächte sich für diesen gemeinen Betrug, der einer härteren Bestrafung würdig gewesen wäre, gleichwohl auf echt ritterliche Art. Als nämlich Giardini aus Italien, wo er gewesen war, nach London zurückkehrte und unbeirrt durch seine Handlungsweise den Versuch machte, das alte Verhältnis zu dem fürstlichen Herrn wieder anzuknüpfen, ließ dieser ihm mitteilen, daß bei der zweiten Geige ein Platz für ihn offen sei, wenn er ihn annehmen wolle, worauf der beschämte Künstler, den zarten Wink wohl verstehend, nichts weiter von sich hören ließ.
Als Violinspieler erregte Giardini in London nachhaltige Bewunderung durch schönen Ton und reich nuancierten Ausdruck. Hier mag ihm eine gediegenere Richtung eigen gewesen sein als im Leben. Franz Benda wenigstens, eine unbezweifelbare Autorität im Fache des Violinspiels, äußerte sich gegen Burney mit Entzücken über den reinen, vollen, weichen Ton, über den edlen Vortrag und das seltene Improvisationstalent Giardinis. Nicht minder wird er als Führer des Orchesters gerühmt. Trotz hochfahrenden, eigenwilligen, zänkischen und nicht leicht zur Anerkennung geneigten Wesens wußte er sich bei seinen Untergebenen durch bewährte Tüchtigkeit in Respekt zu setzen, um so mehr, als sein Tadel überzeugend war. In der italienischen Oper zu London führte er zuerst die gleiche Streichart bei den Violinen ein.
An Giardinis Kompositionen – er schrieb auch fünf zu London aufgeführte Opern, sowie ein Oratorium »Ruth«, – möchte die musikalische Welt nicht viel verloren haben. Man darf dies aus seinen sechs, als Op. 7 zu London herausgegebenen Solosonaten schließen, die sich in dem Fahrwasser einer gewöhnlichen Gestaltungsweise bewegen und jedes geistigen Aufschwunges entbehren. Ebenso ist die in Cartiers » L'art de Violin« mitgeteilte Komposition Giardinis von unbedeutender Beschaffenheit. Auch von den beiden ganz hübschen Sätzen Giardinis, die neuerdings Torchi mitgeteilt hat, läßt sich kaum mehr sagen. Der Anfang des ersten langsamen Satzes verspricht Besseres, als seine Fortführung hält.
Als namhafter Schüler Giardinis ist hier Giuseppe Maria Festa, geb. 1771 in Trani (Neapel), einzureihen. Den ersten Unterricht empfing er von seinem Vater. Nachdem er dann unter Giardini studiert, hatte er noch Lolli zum Lehrer. 1816 wurde er Konzertmeister am Theater San Carlo in Neapel. Denselben Rang bekleidete er später auch bei der Privatmusik des Königs beider Sizilien. Er soll ein ungewöhnliches Direktionstalent besessen haben, und Gerber bemerkt von ihm, daß er »einer der wenigen (?) großen Geiger Italiens« gewesen sei. Seinen Tod fand er zu Neapel am 7. April 1839. Nach Rossinis Mitteilung soll Festa ein ausgezeichneter Quartettspieler gewesen sein. Auch erfahren wir aus dieser Quelle, daß Festa, seiner eigenen Äußerung zufolge, das Beste, was er gekonnt, Ludwig Spohr zu verdanken hatte, mit dem er in Neapel lebhaft verkehrte Ferd. Hillers »Tonleben unserer Zeit«. Leipzig 1868..
Francesco Chiabran (auch Chabran), ein geborner Piemontese und Neffe Somis', trat 1723 ins Leben. Nachdem er den Unterricht seines Onkels genossen, wurde er 1747 bei der königlichen Musik in Turin angestellt. Doch verließ er seinen Platz 1751 und wandte sich nach Paris, wo er Glück machte. Der » Mercure de France« vom Jahre 1751 enthält folgendes, echt französisches Urteil über ihn: » Les applaudissements qu'il reçut la première et la seconde fois qu'il parut Im Concert spirituel., ont été poussés dans la suite jusqu'à une espèce d'enthousiasme. L'exécution la plus aisée et la plus brillante, une légèreté, une justesse, une précision étonnante, un jeu neuf et unique, plein de traits vifs et saillans, caracterisent ce talent aussi grand que singulier. L'agrément de la musique qu'il joue, et dont il est l'auteur, ajoute aux charmes de son exécution.« Man hat, ohne irgendwie an der Künstlerschaft Chiabrans zu zweifeln, sich dabei zu vergegenwärtigen, daß das französische Violinspiel im Verhältnis zu Italien und Deutschland noch ziemlich weit zurück war. Jede bedeutendere Erscheinung mußte also dort einen ungeheuern Eindruck hervorrufen. Auch wolle man sich zum Beweise des Gesagten das auf Seite 150 mitgeteilte Urteil des » Mercure« über Ferrari vergegenwärtigen.
Über Chiabrans weiteren Lebensgang hat man keine Kunde, wie auch die Zeit seines Todes unbekannt geblieben ist. Von seinen wenigen Kompositionen – er veröffentlichte 3 Hefte Sonaten und eine Konzertsammlung – teilt Cartier zwei Stücke mit, unter denen die Sonate »La chasse« das anziehendere ist Eine Sonate (V) in Alards » Maîtres classiques du Violon«.. Obwohl nach keiner Seite hervorragend, mag es seinerzeit wesentlich zum Amüsement des Publikums beigetragen haben, da es, außer einer an das Jagdvergnügen erinnernden Tonmalerei, gewisse Klangeffekte der Violine in günstiges Licht stellt. Es scheint übrigens, daß sich der damaligen Violinkomponisten eine Art von Manie für die »Jagdsonate« bemächtigte; denn Cartier gibt in seiner » L'art de Violon« nicht weniger als sechs, mit » La chasse« betitelte Kompositionen von verschiedenen Komponisten jener Periode. Das zweite bei Cartier vorhandene Stück von Chiabran, ein Allegro aus der fünften Violinsonate, bietet lediglich Interesse durch die ausgedehntere Anwendung der Flageolettöne.
Der Schweizer Caspar Friz, geb. 1716 zu Genf, wird als ein ausgezeichneter Violinspieler von großer Energie des Tones und der Bogenführung gerühmt. Er starb 1782 in seiner Vaterstadt, der er unausgesetzt sein Streben und Wirken widmete. Burney sah und hörte ihn dort 1770. Von seinen Kompositionen (Violinsonaten, -duos, Streichtrios und -quartette sowie Symphonien) befindet sich ein Allegrosatz in Cartiers Violinschule von sehr bestimmtem charakteristischem, doch veraltetem Gepräge.
Der bedeutendste und für die Folgezeit einflußreichste Schüler Somis' war Gaetano Pugnani (geb. 27. Nov. 1731 in Turin, gest. 15. Juni 1798 ebenda). Er setzte das von seinem Meister begonnene Werk fort und widmete sich mit großer Vorliebe, aber auch besonderem Glücke dem Lehrfach. Durch ihn erhielt die piemontesische Violinschule neue Befruchtung; denn nachdem er die Überlieferungen in einem regelmäßigen Kursus verarbeitet hatte, begab er sich zu Tartini, um dessen Lehre teilhaftig zu werden. In ihm vereinigt sich mithin die römische und Paduaner Schule, des Vivaldischen Einflusses auf Somis nicht zu vergessen. Pugnani fand mit einundzwanzig Jahren bereits einen bedeutenden Wirkungskreis als Dirigent der Privatkonzerte des Königs von Sardinien. So sehr ihn derselbe befriedigen mochte, hegte er doch den Wunsch, auch außerhalb seines Vaterlandes sich Anerkennung zu erwerben. Es gehörte damals schon zum Metier, Paris oder London zu besuchen, um sich gleichsam von der großen Welt das Maturitätszeugnis ausstellen zu lassen. Pugnani begab sich zunächst (1754) nach Paris, wo er sehr günstige Aufnahme fand. Der Mercure berichtet, daß sein Erscheinen (am 2. Febr. 1754) mit Enthusiasmus von den Kennern begrüßt worden sei » qui dirent ne point connaître de talent supérieur«. Dann besuchte er London, wo er Konzertmeister der italienischen Oper wurde. Er war weiterhin bis 1770 auf Reisen. In diesem Jahre aber kehrte er in die Heimat zurück, wurde Vorspieler am Turiner Hoftheater und begann zugleich sein Lehramt, dem er bis zum Tode (1798) mit Eifer oblag.
Pugnanis Spielweise soll sich vornehmlich durch schönen Ton und breite, doch zugleich gewandte, ebensosehr für den großen Stil als für das graziöse Genre geeignete Bogenbehandlung ausgezeichnet haben. Die Behauptung Fétis', daß seine Kompositionen klassisch seien, beruht indes auf einem starken Irrtum, man müßte denn das Wort »klassisch« gleichbedeutend mit »langweilig« nehmen. Pugnanis Musik ist gehaltlos, süßlich fade und in jeder Beziehung unbedeutend. Vgl. die von Witting bei Holle in Wolfenbüttel, und von Alard bei Schott in Mainz herausgegebenen Sonaten Pugnanis. – Allerdings fällt Torchi über Pugnani ein weit günstigeres Urteil, doch tritt gerade hier ein einseitig nationaler Standpunkt störend hervor, indem er ihm zu besonderem Ruhme anrechnet, daß er dem schon damals in die italienische Musik eindringenden deutschen Einflüsse nicht oder wenig nachgegeben habe. Man möchte eher wünschen, daß er es getan hätte; denn mit bloßer Süßigkeit, sei sie auch noch so national, hat sich noch niemand die Unsterblichkeit erschrieben. – Das von Torchi in der Collection Boosey mitgeteilte Largo (aus der ersten Sonate des Op. 6) ist übrigens ein recht hübsches Stück. Nicht alle seine Kompositionen, unter denen sich auch mehrere Bühnen- und Kirchenwerke befinden, sind veröffentlicht worden, sondern nur acht Piecen, darunter Violinsonaten, Konzerte, Duos, Trios, Streichquartette, Quintette und Symphonien.
Über seine Persönlichkeit findet sich in der Allgemeinen musikalischen Zeitung vom Jahre 1813, Nr. 34 folgendes: »In Gaetano Pugnani verbanden sich sehr achtungswürdige Eigenschaften mit auffallenden Schwächen zu einem so seltsamen Ganzen, als das ist, welches sein wohlgetroffenes und kaum glaubliches Porträt darstellt. Als der erste Violinist seiner Zeit in Italien, und zwar was gründliche Kenntnis, bewundernswerte Geschicklichkeit und auch edlen ausgebildeten Geschmack anlangt, war er überall gesucht und ausgezeichnet; Redlichkeit, Gutmütigkeit, Mildtätigkeit gegen Notleidende bezeichneten ihn als Menschen und erwarben ihm Achtung und Liebe. Den Notleidenden gehörte der größere Teil seines beträchtlichen Einkommens. Sein ganzes bedeutendes Vermögen vermachte er zu einer Stiftung für Arme. Jovialität, treffender Witz, gesellige Talente und Weltbildung zeichneten ihn als Gesellschafter aus und verschafften ihm Zutritt in die besten Zirkel. Neben diesem stach aber in seinem Wesen wunderlich genug – ab und hervor: eine kokettierende, ganz kleinliche, sehr leicht zu verwundende Eitelkeit, und eine zerfließende Schwäche gegen das andere Geschlecht, die in spätem Alter nur in pedantische, süßliche Stutzerei auslief, sich auch in seinem An- und Aufzuge verkündigte, und mit seiner abenteuerlichen, fast grotesken Figur nur desto auffallender kontrastierte. Er trug eine schwülstige, aufgetürmte Frisur, einen knappen, abgezwackten Frack aus blauer Seide und einen großen Strauß an seiner Brust, das gehörte auch in seiner letzten Zeit noch zu seiner gewöhnlichen Erscheinung. Diese vorgenannten Eigenschaften machten ihn nicht selten zur Zielscheibe des Spottes. Einer schönen geistvollen Dame von Stande den Hof zu machen, von ihr wohl gar als Cicisbeo ausgezeichnet zu sein: das war sein höchstes Glück, und sein schlimmster Feind, wer ihn in dieser süßen Träumerei und Einbildung störte.«
Sehr charakteristisch erscheint für Pugnanis närrisches Wesen eine Anekdote, die nebst ein paar andern Erzählungen aus des Künstlers Leben in der Allgem. mus. Zeitung an derselben Stelle mitgeteilt wird: Als Pugnani reiste, erhielt er eine Empfehlung an den Prinzen M. in Mailand. »Wer sind, Sie?« fragte ihn der Prinz beim Eintritt ziemlich trocken, als er den Brief noch nicht gelesen und nur die wunderliche Figur gesehen. Schnell verwundet antwortete Pugnani: » César, le Violon à la main!«
Die bemerkenswertesten Schüler Pugnanis waren: Conforti, Molino, Bruni, Olivieri, Radicati, Polledro, Traversa, Romani, Borghi, Borra, Janitsch und vor allen Viotti.
Antonio Conforti, nicht Conforte, wie Fétis ihn nennt, geb. 1743 im Piemontesischen (gest. 17..), wird als sehr geschickter Violinspieler gerühmt. Burney traf ihn 1772 in Wien, wo er eines bedeutenden Ansehens genoß. Dies ist indes alles, was man von ihm weiß.
Ebenso spärlich fließen die Nachrichten über Ludovico Molino. Geboren in Fossano, war er 1798 der Nachfolger seines Lehrmeisters als erster Violinist am königlichen Theater zu Turin. Er spielte ebenso meisterhaft die Harfe wie die Violine, und auf beiden Instrumenten ließ er sich im Jahre 1809 zu Paris hören. Er starb im Alter von 84 Jahren. Nach Regli war sein Vorname Luigi; auch weicht dieser Biograph von Fétis darin ab, daß er ihn nicht ausdrücklich als Schüler Pugnanis aufführt.
Molino hat einige Kompositionen für Violine, Harfe und Pianoforte veröffentlicht.
Antonio Bartolomeo Bruni lebte und wirkte, nachdem er bei Pugnani studiert, vom 22. Lebensjahre ab (1781) bis kurz vor seinem Ende in Paris. Sein schwieriger, zu Bizarrerien geneigter Charakter gab zu öfterem Positionswechsel Veranlassung. 1780 ließ er sich im Concert spirituel hören. Gegen 1789 trat er an Mestrinos Platz als Orchesterchef des Theaters » Monsieur«, doch bald wurde er hier durch Lahoussaye ersetzt. Sodann übernahm er das Vorspieleramt an der komischen Oper, und als er auch hier sich nicht zu halten vermochte, wurde er zum Mitglied der Kommission für die Künste ernannt und trat an die Spitze des Orchesters der Bouffons. Endlich zog er sich ganz vom Pariser Musiktreiben zurück (1801) und setzte sich in der Vorstadt Passy, der ehemaligen Residenz Rossinis, zur Ruhe. Vor seinem Tode kehrte er nach seinem Geburtsort Coni (Piemont) zurück, in dem er, am 2. Februar 1759 geboren, 1823 auch starb.
Als Tonsetzer war Bruni ziemlich fleißig. So schrieb er außer 22 Opern, die er in Paris zur Aufführung brachte, 4 Sonatenwerke für Violine, einige Konzerte, 28 ehedem sehr geschätzte Hefte Violinduetten und 10 Quartettwerke. Auch eine Violin- und Violaschule verfaßte er. Die letztere erlebte eine von Breitkopf & Härtel in Leipzig veranstaltete Übersetzung ins Deutsche.
Als begabter Schüler Pugnanis gilt auch A. Olivieri, geb. 1763 zu Turin. Er war lange Zeit Mitglied der Kapelle des Königs von Sardinien, sah sich indessen plötzlich genötigt, einer jähzornigen Handlung halber, die er zum Teil unverschuldet beging, nach Neapel zu fliehen. Olivieri war nämlich für die musikalischen Unterhaltungen eines vornehmen Hauses engagiert. Bei einer derselben erschien er, mit Ungeduld erwartet, zu spät. Der Hausherr überhäufte ihn wegen seiner Unpünktlichkeit mit Vorwürfen, und als diese kein Ende nahmen, zerschlug der durch diese unhöfliche Begegnung aufs äußerste gereizte Künstler seine Violine auf dem Kopfe des Gastgebers, suchte aber auch sofort das Weite. In Neapel war indessen seines Bleibens auch nicht; er besuchte Paris und Lissabon, kehrte jedoch 1814 für immer nach der französischen Hauptstadt zurück. Sein Violinspiel, das als ungemein brillant und delikat geschildert wird, mußte er in späteren Jahren wegen allzugroßer Starkleibigkeit aufgeben. Fétis kannte ihn noch im Jahre 1827. Die Zeit seines Todes ist nicht ermittelt.
Felice de Radicati, von einer vornehmen, doch verarmten Turiner Familie abstammend, wurde 1778 geboren. 1815 erhielt er die Berufung als erster Violinist am Orchester der Basilica S. Petronio zu Bologna. Doch blieb er hier nicht lange; denn es wird von einer 1816 unternommenen Reise berichtet, die ihn nach Wien führte. Dort starb er am 14. April 1823 infolge einer tödlichen Verwundung, die er sich bei einer verunglückten Wagenfahrt zugezogen. Radicati war neben seinem Violinspiel auch als Opern- und Quartettkomponist sowie als Tonsetzer für sein Instrument tätig. Sein Biograph Regli behauptet sogar, daß er im Hinblick auf Boccherini als Renovator des italienischen Quartettstils betrachtet werde, – eine Phrase, die der Widerlegung nicht bedarf, da abgesehen von dem Umstande, daß das Streichquartett seine Fortentwicklung nicht in Italien, sondern in Deutschland fand, ersteres Land seit Boccherini nichts von Bedeutung in dieser Kunstgattung geleistet hat. Wenigstens ist nicht das mindeste von den gleichartigen Bestrebungen neuerer italienischer Komponisten bis auf unsere Zeit gekommen.
Mit Radicati sei zugleich dessen bemerkenswerter Schüler Giuseppe Ghebart, geb. am 20. Nov. 1796 im Piemontesischen, genannt. 1814 wurde er Mitglied der königl. Kapelle zu Turin, und 1839 trat er an Polledros Stelle, die ihm 1846 definitiv übertragen wurde. Engagementsanerbietungen von Paris (für die italienische Oper) und von Dresden (für das Konzertmeisteramt der königl. Kapelle) lehnte er ab. Um die deutsche Instrumentalmusik machte er sich insofern verdient, als er der erste war, welcher dieselbe in Turin einführte.
Obwohl Giambattista (Giovanni Battista) Polledro nur einige Monate den Unterricht Pugnanis genoß, so ist er nichtsdestoweniger zu dessen Schülern zu rechnen; denn er verdankte dem Meister ohne Zweifel seine höhere Ausbildung als Violinspieler. Ursprünglich dem Handelsstande bestimmt, welchem sein Vater angehörte, entschied man sich im Hinblick auf das musikalische Talent des Knaben doch bald für die Tonkunst. Sein erster Lehrer auf der Violine war der geschickte Geiger Mauro Calderara (bei Fétis wohl irrtümlich Coldarero) zu Asti. Dann wurde Gaetano Vai, erster Violinist an der Kathedrale desselben Ortes, sein Führer. Endlich in seinem 15. Lebensjahre begab er sich nach Turin zu Pugnani, der ihn alsbald auch dem Orchester des königl. Theaters einverleibte. 1801 unternahm er einen ersten Konzertausflug nach Mailand, und 1804 wurde ihm die Anstellung als erster Violinist an der Kirche St. Maria Maggiore in Bergamo zuteil. Doch er verweilte hier nicht lange, sondern begab sich auf eine größere Kunstreise, die ihn bis in das Innere Rußlands führte. In Moskau war er beim Fürsten Tatischeff 5 Jahre engagiert. Dann besuchte er Petersburg, Warschau, Berlin und Dresden. In letzterer Stadt wurde er 1814 für die Hofkapelle als Konzertmeister gewonnen. Sein Wirken währte hier bis 1824, da ihn dann Carlo Felice von Sardinien unter glänzenden Anerbietungen nach Turin berief, um die königl. Kapelle zu reorganisieren. Er bekleidete hier das Amt eines Generaldirektors der Instrumentalmusik. 1844 hatte er das Unglück, von einem Nervenschlage getroffen zu werden, infolgedessen er nach neunjährigen Leiden am 5. August 1853 in seiner Vaterstadt Casalmonserrato alla Piovà verschied, wo er den 10. Juni 1781 geboren worden war. Der Künstler hat verschiedene, nach kurzer Frist jedoch schon verschollene Violin- und Vokalkompositionen veröffentlicht.
Als Violinspieler fand Polledro die einstimmige Anerkennung seiner Zeitgenossen. Die Allgem. musik. Zeitung vom Jahre 1807 enthält S. 281 und 675 folgende einander ergänzende Urteile aus Wien, Prag und Leipzig über ihn: »Herr Polledro zeigte sich als ein wirklich großer Violinspieler, der den Ruf, der ihm vorherging, vollkommen rechtfertigte. Sein Spiel ist in der Tat groß zu nennen. Er verachtet alle kleinlichen, dem Konzerte nicht angemessenen Verzierungen, und verbindet Empfindung mit Kunstfertigkeit. Das Staccato scheint indessen ganz aus seinem Spiele verbannt zu sein. Seine Kompositionen sind eben nicht tief eindringend. – Polledro ist der letzte Schüler Pugnanis, und wenn es wahr ist, daß der Meister in seinen Schülern fortlebe, so muß es den älteren Verehrern der Kunst einen doppelten Genuß gewähren, Pugnani und Polledro zugleich zu hören. Er spielte zweimal mit einem Erfolge, dessen sich hier, außer Mozart, kein Tonkünstler rühmen kann. Der Zauber seines Tones, die höchste Reinheit, die großen riesenmäßigen Schwierigkeiten, welche er lächelnd gleich einem Kinderspiel überwand, und dabei auch sein zarter, feiner, delikater Vortrag mußten entzücken.«
»Wir halten Herrn Polledro unter allen italienischen Violinisten, die nach Viotti zu uns gekommen sind, durchaus für den vorzüglichsten. Seine Kompositionen und sein ganzes Wesen, noch weit mehr aber sein Spiel, zeugen von ungewöhnlichem Geist, Talent, feiner Ausbildung und Geschmack überhaupt, alles dieses in trefflicher Schule und mit großem Fleiß auf seine Kunst, aber auch ganz im Sinne seiner Nation gewendet. Sonach ist das Ernste und Gehaltene der besten deutschen Violinisten so wenig, als das Glänzende und Ausgearbeitete der besten französischen sein Vorzug: wohl aber hinreißende Leichtigkeit und Fertigkeit, Anmut und Zierlichkeit, Heiterkeit und Laune. Und was die Künstlichkeit seines Spiels betrifft, so haben wir besonders in Sprüngen und vollgriffigen Sätzen so viel Sicherheit, Reinheit, Leichtigkeit und Galanterie noch nirgends gefunden.«
Von den Violinspielern Gioachimo Traversa de la musique da prince de Carignan. (Brenet.), Romani, Ludovico (nach Pohls Angabe Luigi) Borghi Eine Sonate Borghis (I, Op. 6) in D. Alards » Maîtres classiquei du Violon«. und Borra wissen wir kaum mehr, als daß sie Schüler Pugnanis waren. Der erstere fand 1770 glänzende Aufnahme in Paris, Romani und Borghi waren etwa um dieselbe Zeit (Borghi um 1780) in London tätig, und Borra scheint in seiner Vaterstadt Turin gelebt zu haben.
In betreff Anton Janitsch', welcher gleichfalls ein Schüler Pugnanis war, verweisen wir auf den Abschnitt über das Violinspiel Deutschlands.
Auch eine Violinspielerin ist aus Pugnanis Lehre hervorgegangen: Luigia Gerbini. Sie soll außerdem Viottis Unterricht genossen haben. (Pougin, Viotti et l'école moderne de violon.) Sie trat mehrfach in Deutschland mit günstigstem Erfolg auf, wie ein Referat der Allgem. musik. Zeitung vom Jahre 1807 (Nr. 25) aus Wien beweist, worin »ihre außerordentliche Kraft des Bogens, deren Stärke in Passagen und Schwierigkeiten für ein Frauenzimmer beinahe, bis zum Unglaublichen geht«, gerühmt wird. Ähnlich lautet eine Notiz in demselben Kunstorgane (vom Jahre 1811, S. 737) aus Paris: »Mad. Gerbini, die mit fast männlicher Kraft und Präzision weibliche Anmut verbindet, schließt sich an die ersten hiesigen Virtuosen. Ich habe sie z. B. ein Konzert von Spohr vortragen hören, dessen außerordentliche Schwierigkeiten sie mit aller Leichtigkeit und Sicherheit überwand, ohne dabei den Geist und schönen Ausdruck im geringsten hintanzusetzen.«
Luigia Gerbini soll eine ebenso gute Sängerin als Violinistin gewesen sein. In beiden Eigenschaften ließ sie sich am 13. Nov. 1790 am Théâtre de Monsieur in Paris hören. Sie trat in einem italienischen »Zwischenspiel« in einem Akt auf, welches sich il dilettante betitelte. Das » Journal de Paris« berichtet hierüber unterm 15. Nov.: »Das ital. Zwischenspiel ... war sehr geeignet, die verschiedenen Talente von Signora Gerbini zur Geltung kommen zu lassen ... Es ist ein richtiges Konzert ... Signora Gerbini hat in den von ihr gesungenen Stücken eine sehr schöne Stimme entfaltet, und sie hat darauf ein Violinkonzert auf eine Weise gespielt, die mit den gefeiertsten Virtuosen wetteifert. Die Beifallsbezeugungen waren wiederholt und einstimmig.« Pougin ( Viotti et l'école moderne de violon) fügt hinzu: »Trotzdem scheint der Erfolg nicht von Dauer gewesen zu sein, denn der ›Dilettant‹ und Signora Gerbini konnten nicht öfter als zweimal auf der Bühne des Théâtre de Monsieur erscheinen.« Weitere Nachrichten über die Künstlerin fehlen leider.
Wir kommen zu Viotti, mit Vornamen Giovanni Battista (geb. 23. Mai 1753 zu Fontanetto da Po, gest. 3. März 1824 zu London), dem hervorragendsten Vertreter der piemontesischen Schule, der mit Corelli und Tartini das glänzende Dreigestirn des italienischen Violinspiels im 18. Jahrhundert bildet. Dieser Meister darf als der eigentliche Fortsetzer der vor ihm erstandenen epochemachenden Richtungen des Violinspiels und der Violinkomposition angesehen werden. In beiden Beziehungen hatte der gegebene Standpunkt sich ausgelebt. Über die Tartinische Violinsonate war man nicht weiter hinausgekommen; im Gegenteil: die Nachfolger des Paduaner Meisters begnügten sich zur Hauptsache mit Nachbildungen der vorhandenen Muster und verfielen so mehr oder minder einem für den Fortschritt der Kunst unergiebigen Formalismus. Vor allem aber bedurfte das Violinkonzert einer Regenerierung. Die einfache monotone, mit dem Soloinstrument wenig kontrastierende Quartettbegleitung Tartinis erwies sich nicht mehr als ausreichend, namentlich nachdem die Orchesterwerke Haydns und ferner Zeitgenossen eine wesentliche Bereicherung des Orchesterapparats und damit erhöhte Forderungen für die Instrumentalmusik bewirkt hatten. Diesen zeitgemäß gesteigerten Bedürfnissen wurde unter den Italienern des 18. Jahrhunderts zuerst Viotti gerecht. Zwar sahen wir, daß schon Vivaldi das Orchester seiner Konzerte erweiterte und durch Hinzuziehung von Blasinstrumenten bereicherte, allein es waren dies vereinzelte Erscheinungen, gleichsam Experimente, denen der günstige Boden einer Fortentwicklung fehlte. Diese Bestrebungen gingen für Italien spurlos vorüber; sie fanden keine Nachahmung, und es ist nicht ein Fall bekannt, daß Tartini z. B. von der Instrumentationsweise Vivaldis Gebrauch gemacht hätte.
Bei Viotti kehrt im wesentlichen die moderne, organisch gegliederte Orchestrierung Haydns wieder, dessen Symphonien bereits 1764-65 in Paris und London Eingang fanden. Und dies nicht allein. Viotti hat auch, gleich anderen Komponisten jener Zeit, den ganzen Satzbau der Haydnschen Symphonie in seinen Hauptzügen, soweit er auf das Konzert Anwendung finden konnte, namentlich aber die scharf ausgeprägten Gegensätze der Haupt- und Seitenmotive adoptiert. Dieser architektonische Ausbau der Sonatenform bezeichnet wiederum den Fortschritt Viottis im Bereiche der Violinkomposition gegen Tartini, wie ein solcher zwischen dem letzteren Meister sowie Vivaldi und Corelli wahrzunehmen ist.
Charakteristisch für Viottis Schaffen ist der Umstand, daß er die bisher so stark kultivierte Violinsonate (mit beziffertem oder unbeziffertem Baß) wenig berücksichtigt. ES existieren im ganzen nur 18 dahingehörige Musikstücke von ihm. Dagegen veröffentlichte er 29 Konzerte mit Orchesterbegleitung, 2 Konzertanten für 2 Violinen, 21 Streichquartette, 21 Trios für 2 Violinen und Violoncell, 51 Violinduetten, drei Divertissements für Violine und Klavier und eine Klaviersonate. Der größere Teil davon, zumal der Trios und Quartette, ist veraltet und für unsere Zeit nur sehr bedingungsweise verwertbar. Die besten Violinwerke sind dagegen der musikalischen Welt in neuen Ausgaben wieder zugeführt worden. Unter ihnen nimmt einen besonders hervorragenden Platz das a-moll-Konzert (Nr. 22) ein; es zeichnet sich durch einfach edle Schönheit der Gestaltung, Adel der Empfindung und wirksame Behandlung der Violine sowie des Orchesters aus Dieses sowie das 24. Konzert Viottis sind auch in D. Alards » Maîtres classiques du Violon« erschienen.. Man hat behauptet, daß bei der Instrumentation desselben Cherubini hilfreiche Hand geleistet habe. Doch ist dies nicht erwiesen. Es wird übrigens vielen Violinkomponisten jener Zeit, z. B. Lolli, Giornovichi und sogar Rode nachgesagt, daß sie der tatsächlichen Mitwirkung anderer, im Orchestersatz erfahrener Musiker benötigt gewesen seien, und ohne Zweifel ist dies mehrfach vorgekommen. Von Lolli wird sogar berichtet, er habe nichts weiter als die Violinstimme aufgesetzt und die weitere Ausführung befähigteren Leuten überlassen. Seine Kompositionen sind von einer Beschaffenheit, die dies glaublich macht.
Als Violinspieler erklomm Viotti nicht minder eine höhere Stufe der Kunst. Wenn ihm von seinen Landsleuten nicht die überschwänglichen Huldigungen dargebracht wurden, deren Corelli und Tartini sich erfreuten, so liegt dies keineswegs daran, daß er Geringeres leistete als diese. Man muß sich zunächst vergegenwärtigen, daß die Kunst des Violinspiels zu Ende des vorigen Jahrhunderts schon eine große Verallgemeinerung gefunden hatte, daß mithin die Wirkung derselben nicht mehr so exklusiv sein konnte als zu Lebzeiten Corellis und Tartinis. Dann auch ist zu berücksichtigen, daß Viotti die zweite Hälfte seines Lebens, also die eigentliche Meisterzeit, im Ausland zugebracht hat; nur einmal kehrte er 1788 vorübergehend in seine Heimat zurück, um für die italienische Oper in Paris Gesangskräfte zu engagieren. Während er in England und Frankreich seine Triumphe feierte, war er daheim vielleicht schon so gut wie vergessen.
Viotti wurde am 23. Mai 1753 zu Fontanetto, einem kleinen Ort des piemontesischen Bezirks Crescentino geboren. Er offenbarte frühzeitig bedeutendes musikalisches Talent, und dies veranlaßte seinen Vater, einen Hufschmied, der als Dilettant auf dem Horn nicht ungeschickt war, ihn die Anfangsgründe der Musik zu lehren. Zu seinem Lieblingsinstrument erkor er sogleich die Violine. Gegen 1764 kam ein Lautenspieler Giovanni nach Fontanetto, dessen Unterricht der Knabe, doch nur für kurze Zeit genoß. Er war dann wieder zur Hauptsache sich selbst überlassen, machte aber doch solche Fortschritte, daß er 1766 bei einem Kirchenfest in Strambino, wohin ihn der Vater mitgenommen, durch seine Leistungen Aufmerksamkeit erregte. Der dortige Prälat Francesco Rora erkannte sein Talent und war insofern für die weitere künstlerische Ausbildung desselben tätig, als er ihn mit einem Empfehlungsschreiben an die in Turin lebende Marchesa von Voghera versah. Bei dieser traf ihn ein Mitglied der königlichen Kapelle, Namens Celognetti, welcher sofort darauf drang, den kleinen Viotti zu hören. Man brachte eine Sonate von Besozzi herbei, die der Knabe zum Erstaunen der Anwesenden à vista mit der Freiheit und Sicherheit eines fertigen Musikers spielte. Als man ihm ein Lob dafür zuteil werden ließ, antwortete er im vercellesischen Dialekt: » Ben par susì a l'é niente.« (Das ist eine Kleinigkeit.) Man fand diese Äußerung anmaßend, und um den Knaben bescheidener zu machen, legte man ihm eine schwere Sonate von Domenico Ferrari vor. Aber auch diese bewältigte er, so daß Celognetti darauf drang, den begabten Kunstjünger nicht wieder von der Stelle zu lassen. »Kennst du das Theater?« fragte er den Kleinen. »Nein, mein Herr.« »Du hast also keinen Begriff davon. Komm, ich will dich hinführen.« Kaum war Viotti ins Orchester getreten, so saß er auch schon unter den Violinisten und spielte die ganze Oper mit, als ob er sie gleich den andern einstudiert hätte. In das Haus der Marchesa zurückgekehrt, fragte man ihn, was er etwa Bemerkenswertes an der Aufführung gefunden. Statt jeder Antwort spielte er nach dem Gehör Verschiedenes aus der Oper vor und gewann dadurch die erhöhte Teilnahme seiner Zuhörer. Für seine Zukunft war von da ab gesorgt. Der Sohn der Marchesa, welcher später Erinnerungen an Viotti aufgezeichnet hat, äußert sich folgendermaßen über denselben: »Ich war durch den Eindruck dieses natürlichen Talents so hingerissen, daß ich alles zu tun beschloß, um solche schöne Anlagen nicht unentwickelt zu lassen. Ich wies ihm eine Wohnung in meinem Palast an und gab ihm Pugnani zum Lehrer. Die Erziehung Viottis kostete mich mehr als 20 000 Franken, aber ich bereue dieses Geld nicht! Die Existenz eines solchen Künstlers konnte nicht zu hoch bezahlt werden Der Originaltext lautet nach Regli folgendermaßen: » Li fu allora, rapito da un genio cosi naturale, io mi decisi di fare ciò che abbisognava, affinchè tante belle disposizioni non riuscissero infruttuose. Io gli assegnai un allogio nel mio palazzo, e gli diedi per maestro il celebre Pugnani. L'educazione di Viotti mi costò più di venti mila franchi; ma a Dio non piaccia che io pianga il mio danaro! La vita di un simile artista non potrebbe essere abbastanza pagata.«.«
Nachdem Viotti der Lehre Pugnanis entwachsen war, unternahm er in Begleitung desselben seine erste Kunstreise im April 1780. Ihr Weg führte sie zuerst nach der Schweiz. In Genf trat Viotti wiederholt in Konzerten auf (auch schloß er dort Freundschaft mit dem Geiger Imbault, einem Schüler von Gaviniés). Die beiden Künstler wandten sich dann über Deutschland nach Polen und Rußland, wo ihn die Kaiserin Katharina mit Auszeichnungen überhäufte und, wiewohl vergeblich, zu halten versuchte, und blieben sodann einige Zeit in Berlin. Hier war es, wo Viotti zum erstenmal mit Giornovicchi zusammentraf, mit dem er sich später noch einmal messen sollte. Dieser, wie man weiterhin sehen wird, sehr exzentrische und mit einem beträchtlichen Maße von Eigenliebe begabte Künstler, ein Schüler von Lolli, ahnte in dem jüngeren Kollegen, wie es scheint, von Anfang an einen gefährlichen Rivalen. Bei dieser ersten Zusammenkunft gelegentlich einer musikalischen Soiree bei dem Prinzen von Preußen blieb die Superiorität freilich noch unentschieden, da keiner der beiden Künstler vom Glück begünstigt wurde.
Viotti spielte unvorbereitet ein kaum fertig gewordenes Konzert seiner Komposition und blieb hinter dem zurück, was er sonst hätte leisten können. Giornovicchi bemerkte es und erging sich in ironischem Lobe. Aber unmittelbar darauf passierte es ihm selbst, daß er in einem seiner bekanntesten Rondos stecken blieb, worauf der gereizte Italiener nicht ermangelte, ihm die eingesteckten spitzen Worte mit Zinsen zurückzugeben, indem er ihn seiner tiefen Verehrung versicherte. Zweifelsohne war es dieser Vorfall, der Giornovicchi etwa 12 Jahre später, als er mit Viotti zugleich in London war, veranlaßte, ihn törichterweise zu einem Wettkampf in prahlerischer Weise herauszufordern, in dem er unterlag. (Das Nähere hierüber siehe bei Giornovicchi.)
Ob Viotti sodann allein oder in Begleitung von Pugnani noch London aufsuchte, ist nicht feststehend, wahrscheinlich aber trennten sich die Künstler in Berlin, und Viotti reiste allein nach London, wo er gewaltigen Enthusiasmus erregte. Niemals hatte dort ein Instrumentalist gleiche Wirkung ausgeübt, und selbst Geminianis Andenken, das dort noch nach dessen Tode in hohem Ansehen gehalten wurde, machte er durch sein Auftreten völlig erlöschen. Auch in London war man umsonst bemüht, Viotti festzuhalten. Wer hätte wohl ahnen können, daß er an demselben Orte, wo er Lorbeeren und Gold erntete, später die Rolle eines Apollopriesters mit dem Dienste Merkurs vertauschen würde?
Von London begab sich Viotti Anfang 1782 nach Paris, wo er von seinem ersten (17. März 1782) bis zu seinem letzten (8. September 1783) Auftreten im Concert spirituel eine Reihe bis dahin unerhörter Triumphe feierte.
»Viottis erstes Auftreten im Concert spirituel zu Paris«, so bemerkt Fétis, »läßt sich schwer beschreiben. Niemals hatte man etwas gehört, was seiner Vollendung als Geiger nahe kam. Niemals hatte ein Violinist schöneren Ton, gleichen Glanz, Schwung und eine ähnliche Mannigfaltigkeit gezeigt. Und ebenso überragten seine Kompositionen alles, was bis dahin (im Gebiete der Violinliteratur) erschienen war.« Ähnliches wird in der Berliner Musikzeitung vom Jahr 1794 aus London berichtet: »Viotti ist wahrscheinlich jetzt der größte Violinist in Europa. Ein starker, voller Ton, unbeschreibliche Fertigkeit, Reinheit, Präzision, Schatten und Licht mit der reizendsten Einfachheit verbunden, machen die Charakteristik seiner Spielart aus, und die Komposition seiner Konzerte übertrifft alle mir bekannten Violinkonzerte. Seine Themata sind prachtvoll und edel, mit Verstand durchgeführt, geschmackvoll mit großen und kleinen Massen verwebt, und gewähren bei den Wiederholungen dem Hörer jedesmal neues Vergnügen. Seine Harmonie ist reich ohne Überladung, der Rhythmus ist richtig und nicht steif, der Satz rein und der Gebrauch der Blasinstrumente von großem Effekt. Mit einem Wort: Viottis Kompositionen sowie sein Vortrag sind gleich hinreißend.«
Seine Fachgenossen zollten ihm nicht geringere Bewunderung als die öffentliche Stimme, und Baillot z. B. verstieg sich sogar zu dem ekstatischen Ausruf: » Je le croyais Achille, mais c'est Agamemnon.« Auf derartige hochtrabende Phrasen, die eben in jener Zeit aufkamen, ist nicht zu großes Gewicht zu legen; sie hängen wesentlich mit der sich mehr und mehr bahnbrechenden virtuosen Richtung des Violinspiels zusammen, und wir werden noch mehrfach ähnlichen überspannten Expektorationen begegnen. Ließ doch auch Viottis Schüler J. B. Cartier, wie hier gleich erwähnt werden mag, eine Medaille auf seinen Meister mit der Umschrift » Nec plus ultra« prägen.
Auch an anderweiter Anerkennung fehlte es dem Künstler in Paris nicht. Insbesondere erregte er das Interesse der königlichen Protektoren Glucks, Marie Antoinette, welche ihm den Titel ihres Akkompagnateurs nebst einer jährlichen Rente von 6000 Franken verlieh. Die ihm gewordene Auszeichnung vermochte indessen nicht, seine damals bereits erwachte allzu rege Empfindlichkeit gegen Zufälligkeiten, von der wir noch weiteres hören werden, in Schranken zu halten. Es wird darüber (Allgem. mus. Ztg., Bd. 14, S. 435) folgendes mitgeteilt: Viotti empfing eine Einladung zum Hofkonzert nach Versailles. Der ganze Hof versammelt sich, das Konzert fängt an. Bei den ersten Takten des Solo ruht das tiefste Schweigen auf dem ganzen Saal, als plötzlich im Nebenzimmer eine kreischende Stimme ertönt: »Platz für Monsieur, den Grafen v. Artois!« Unwillen über die Störung und Ehrfurcht gegen den Störer verursachen eine allgemeine Bewegung. Während derselben nimmt Viotti sein Instrument unter den Arm und verläßt den Saal, wo der ganze Hof versammelt war, zum großen Ärger der Anwesenden. Hier war Viotti in vollem Rechte, wenn er die Würde der Kunst wahrte; daß er es jedoch mit Voranstellung seiner Persönlichkeit in einer Weise tat, die alle konventionellen Rücksichten verletzte, ist vielleicht zu entschuldigen, aber nicht zu rechtfertigen.
Wir haben gesehen, daß es Viotti keineswegs an enthusiastischer Anerkennung der Zeitgenossen fehlte. Um so auffallender ist eine von nun an durch sein ganzes ferneres Leben sich durchziehende Tendenz, seinem eigenen Genius – man kann es nicht wohl anders ausdrücken – ungetreu zu werden. Nicht befriedigt von seiner unübertroffenen Meisterschaft und den sich an dieselbe knüpfenden glänzenden Resultaten verfolgte er, weiterhin sich von seiner Sphäre entfernend, materielle Interessen, die für ihn eine Quelle bitterer Erfahrungen wurden. Der Hang zur kaufmännischen Spekulation muß tief in der Natur des italienischen Nationalcharakters begründet liegen, wie es denn auch bezeichnend für dieses Volk ist, daß durch dasselbe der kaufmännische Verkehr in Theorie und Praxis hohe Ausbildung erfuhr. Nicht wenige italienische Künstler des 18. Jahrhunderts gaben sich, neben dem ursprünglichen Berufe, meist zu eigenem Schaden merkantilen Unternehmungen hin. Von Locatelli wird erzählt, daß er in Amsterdam einen Saitenverkauf etabliert habe, Geminiani handelte mit Bildern, Carbonelli trieb Weinhandel, und Giarbini opferte seine materielle Existenz dem verlockenden Geschäft eines Opernimpresario. Auch Muzio Clementi (geb. 1752 zu Rom), der einflußreiche Meister des Klavierspieles und der Klaviersonate, handelte mit Pianofortes und erwarb dadurch ein ansehnliches Vermögen. Daß dieser Erwerbssinn bei ihm durch den Hang zu übertriebener Sparsamkeit beeinflußt war, ist kaum zu bezweifeln. Denn der letzteren war er in fast lächerlichem Maße ergeben, wie uns Spohr in seiner Selbstbiographie erzählt. Er traf den Klaviermeister in Petersburg am – Waschkübel, wie er eben in Gemeinschaft seines Schülers John Field die Strümpfe reinigte. Spohrs Verwunderung darüber bemerkend, äußerte der Italiener mit aller Seelenruhe, man täte wohl, sich in Petersburg die Wäsche selbst zu besorgen, da sie zu teuer sei, und er rate ihm, seinem Beispiel zu folgen. Spohr hatte indessen besseres zu tun, als Strümpfe zu waschen.
Wenn auch Viotti derartigen Extravaganzen völlig fremd blieb, so trat er doch in die Fußtapfen Giardinis, dessen Geschick er schließlich teilte. Der Meister hatte sich, wie Fétis angibt, schon 1787, wahrscheinlich infolge seines weiterhin zu erörternden Rücktrittes von der Öffentlichkeit als Violinspieler, um die Direktion der Pariser Oper beworben. Sein Gesuch blieb indessen unberücksichtigt. Da erhielt 1788 der Leibfriseur Maria Antoinettes, Léonard genannt Sein eigentlicher Name war Autier. Während der Revolution zum Tode verurteilt (1794), kehrte er später nach Frankreich zurück und starb im Jahre 1820., das Privilegium für ein Opernunternehmen. Dieser trug Viotti sofort die Leitung der Bühne an und kam damit dessen Wünschen entgegen. Freilich sorgte er in künstlerischer Beziehung sehr wohl für das ihm anvertraute Institut; denn er zog Sänger ersten Ranges herbei, unter denen sich Mandini, Vigagnoni, Mengozzi, Rafanelli, Banti und Signora Marichelli befanden. Dementsprechend war das Orchester besetzt, an dessen Spitze der Violinspieler Mestrino stand. In der ersten Zeit prosperierte das Unternehmen, dem auch Viottis Freund Cherubini seine Kräfte widmete, nach Wunsch. Die Vorstellungen des Théâtre de Monsieur fanden anfangs in den Tuilerien statt, wurden jedoch in das Winkeltheater de la foire Saint-Germain verlegt, als der Hof 1790 von Versailles in die Pariser Residenz einzog.
In diese Zeit fällt ein anderes großes Projekt Viottis, das zum Glück für ihn nicht zur Ausführung gelangte. Er suchte die Direktion der kgl. Akademie der Musik und zugleich damit das Privileg für alle Theater, Konzerte und anderweitigen musikalischen Veranstaltungen in ganz Frankreich zu erlangen. Er erbot sich, 3 Millionen Frank Kaution zu stellen, kurz, es war ein im größten Maßstabe geplantes Unternehmen. Wäre es zustande gekommen, so war das mindeste, daß die Kautionssumme in dem Sturme der unmittelbar bevorstehenden Revolution kassiert und damit eine unerträgliche Schuldenlast auf Viotti gewälzt worden wäre.
Er hatte bereits Schwierigkeiten genug mit dem Théâtre de Monsieur. In der foire St.-Germain konnte das Institut auf die Dauer nicht bleiben, und man warb deshalb in vornehmen Kreisen Teilnehmer für die Begründung einer neuen Schaubühne, welche in der rue Feydeau errichtet, in den letzten Tagen des Jahres 1790 fertig und am 6. Januar 1791 eröffnet wurde.
Aber von seiner Begründung an hatte das » Théâtre Feydeau« schwer unter den immer bedenklicher werdenden Zeitläuften zu leiden. Trotz aller Anstrengungen der Teilnehmer blieb das aristokratische Publikum, auf welches bei der Gründung gerechnet worden war, mehr und mehr aus. Ein Teil des Personals mußte infolgedessen entlassen werden, und schon im August 1792 brach das ganze Unternehmen in sich zusammen.
Inzwischen erschien auch die persönliche Sicherheit Viottis sowie Léonards gefährdet, teils durch ihre Beziehungen zum Hofe, teils durch absurde, gegen Viotti im » Journal général de la cour et de la ville« geschleuderte Verdächtigungen, auf die der vornehm empfindende Künstler nur durch Schweigen reagiert hatte. Léonard begab sich nach Rußland, und Viotti reiste nach London, ein ruinierter Mann; denn sein gesamtes mühsam erworbenes Vermögen war in dem Zusammenbruch des Theaters daraufgegangen.
In London galt es nun, eine neue Existenz zu gründen. Der Meister mußte, um dieses möglich zu machen, seinem Gelübde entsagen, nicht wieder als Violinspieler an die Öffentlichkeit zu treten.
Um jedoch zu verstehen, was es mit diesem Gelübde für eine Bewandtnis hatte, müssen wir nochmals zu Viottis Pariser Tätigkeit und speziell zu den Jahren 1782-83 zurückkehren.
Der Künstler hatte während dieser Jahre vielfach im Concert spirituel den Beifall des dort versammelten Pariser Publikums in einem Maße genossen, daß er, dadurch verwöhnt, schon sorgfältig das Verhalten seiner Zuhörerschaft abwog und sich von den Kundgebungen derselben mehr als billig abhängig zeigte. So mußte denn auch er alsbald die trübe Erfahrung machen, wie sehr derjenige sich täuscht, der auf die Beständigkeit und Unwandelbarkeit des Tagespublikums rechnet. Einstmals war das Konzert, in welchem er sich hören ließ, weniger besucht als sonst, und wahrscheinlich mit infolge davon übten seine Leistungen nicht die gewohnte Zündkraft aus. Am folgenden Tage ließ sich in denselben Räumen ein Violinist hören, dessen Begabung mit Viottis Talent nicht entfernt in Parallele gestellt werden konnte. Allein der Zuhörerraum war überfüllt, und das Rondo des vorgetragenen Konzertstückes gefiel so sehr, daß es nicht allein da capo verlangt wurde, sondern auch den Stoff der Unterhaltung in musikalischen Kreisen für mehrere Tage bildete. Dieser Vorfall, der einem Manne von Urteilsfähigkeit über die wechselnden Amüsementsbedürfnisse des großen Haufens höchstens eine ironische Bemerkung abgenötigt hätte, reichte hin, den italienischen Maestro derart zu verletzen, daß er nichts Geringeres beschloß, als fortan sich der Öffentlichkeit zu entziehen A. Pougin ( Viotti et l'école moderne de violon) hält diese, gleichwohl von allen Autoren außer einem überlieferte Anekdote für nicht genügend begründet. Nach ihm ist der wahre Grund, der Viotti zu seinem Entschluß bewog, nicht mehr in Paris öffentlich zu spielen, nicht bekannt.. Wirklich war seine Gereiztheit so andauernd, daß er dem gefaßten Entschluß während des Pariser Aufenthaltes treu blieb. Nur in befreundeten Privatzirkeln ließ er sich noch hören, wie er denn auch für einige Zeit die Stelle eines Orchesterchefs in einer von dem Prinzen von Conti und den Herren v. Soubise und v. Guémenée gestifteten Musikgesellschaft annahm.
Außerdem bildete er in dieser Zeit mehrere seiner – nicht zahlreichen – Schüler, vor allem aber war er kompositorisch tätig: die ersten 20 seiner 29 Violinkonzerte fallen in die Zeit dieses seines ersten Pariser Aufenthaltes.
Ferner veranstaltete Viotti in seiner Behausung, die der innig mit ihm befreundete Cherubini mit ihm teilte, allsonntägliche Quartettakademien, in denen er vor geladenen Zuhörern auch seine neu komponierten Orchesterwerke probierte. Hierzu eine Einladung zu erhalten, war eine Gunst, die man zu schätzen wußte. Vor allem trafen sich sämtliche Pariser Violinisten dort, um musikalischen Austausch zu pflegen, hauptsächlich aber, um den Meister spielen zu hören: Puppo, Mestrino, Imbault, R. Kreutzer und viele andere. Mit den meisten derselben stand Viotti auf mehr oder minder freundschaftlichem Fuße. Gelegentlich durfte man auch einen beschwerlichen Gang nicht scheuen, um den Künstler zu hören. Als er einstmals bei einem seiner Freunde, einem Mitgliede der Nationalversammlung spielte, welcher fünf Treppen hoch wohnte, äußerte er lakonisch: »Lange genug sind wir zu ihnen (zu den Zuhörern) hinabgestiegen, mögen sie denn heute auch einmal zu uns heraufkommen.«
Viottis unmutsvolle Verstimmung gegen das Pariser Publikum hatte sich selbst noch nicht gelegt, als er 1802, also 18-19 Jahre nach jenem Ereignis, Paris wieder besuchte, und nur mit Mühe war er zu bewegen, vor einer Elite von Künstlern im Konservatorium sich hören zu lassen.
Wir kehren jetzt zu Viottis Übersiedlung nach London zurück, wo er im Jahre 1792, wie wir mitgeteilt haben, mit leeren Taschen einzog.
Damals bildeten Salomons in Hanover Square stattfindenden, durch Haydns persönliche Mitwirkung auf ihren Kulminationspunkt gebrachten Konzerte das Zentrum des musikalischen London. Sobald Salomon von Viottis Anwesenheit hörte, beeilte er sich, sein Auftreten in diesen Konzerten zu erlangen. Viotti willigte ein und begründete scheinbar mühelos und in kurzer Zeit seine Stellung als tonangebender Violinmeister auf neue. Auch begann er für diese Konzerte die zweite Serie seiner Violinkonzerte zu schreiben und erklomm in ihnen den Höhepunkt seines Schaffens für sein Instrument. Von 1794 ungefähr an nahm er ferner teil an der Leitung von Kings theatre, wobei er sich jedoch auf die Direktion des Orchesters beschränkte.
Inmitten dieser so schnell erblühten reichen inneren wie äußeren Tätigkeit fehlte es dem berühmten Künstler auch nicht an Freunden. Insbesondere ist hier eine reiche und musikalische Familie, namens Chinnery, zu erwähnen, mit deren Gliedern ihn ein inniges Freundschaftsverhältnis verband, das seinen Ausdruck auch in der Widmung mehrerer Kompositionen Viottis, darunter sein letztes Violinkonzert in e-moll, gefunden hat. In den Memoiren der Malerin Vigée-Lebrun, die Ende 1802 oder Anfang 1803 einige Wochen im Schoße dieser Familie zubrachte und dort mit Viotti zusammentraf, ist uns ein anziehender Einblick in dieses Idyll gewährt. » J'allais passer – schreibt sie – quinze jours chez Mme. Chinnery à Gilwell, où se trouvait le célèbre Viotti. La maison était de la plus grande élégance, et l'on m'y fit une réception charmante.« Nachdem sie diese hübsch beschrieben, heißt es weiter: » ... aussi les quinze jours que j'ai passés à Gilwell ont-ils été pour moi des jours de joie et de bonheur. Mme. Chinnery était une très belle femme, dont l'esprit avait beaucoup de finesse et de charme. Sa fille Außerdem waren noch zwei Knaben vorhanden, denen Viotti auch Unterricht erteilte. Einen sehr liebenswürdigen Brief des Meisters an einen derselben, Walter, teilt A. Pougin in seinem Buche Viotti et l'école moderne mit, dem ich diese Notizen entnehme., âgée alors de quatorze ans, était surprenante par son talent sur le piano, en sorte que tous les soirs cette jeune personne, Viotti et Mme. Chinnery, qui était très bonne musicienne, nous donnaient des concerts charmants.«
So schien sich alles zu vereinigen, um Viotti für Paris und die dort ausgestandenen Unannehmlichkeiten zu entschädigen. Da wandte sich ein haltloser Verdacht politischer Konspirationen auf ihn und führte zu seiner ganz unvermuteten Ausweisung aus England.
Dies war im Jahre 1798 Nach Pougin, im übrigen wird meist das Jahr 1795 angegeben.. Gekränkt und mißmutig mußte sich Viotti den Umständen fügen. Er wandte sich nach Hamburg und nahm seinen Aufenthalt in dem nahe gelegenen Schönfeldt auf einem ihm von seinem Eigentümer, dem Engländer George Smith, zur Verfügung gestellten Landsitze. Dort lebte er in fast absoluter Einsamkeit 3 Jahre hauptsächlich seiner schöpferischen Tätigkeit. Namentlich schrieb er hier einen Teil seiner besten Violinduetten. Die Stimmung, unter der sie entstanden, spiegelt sich in der Vorrede des einen Heftes derselben ab, welche die Äußerung enthält: » Cet ouvrage est le fruit du loisir que le malheur me procure. Quelques morceaux ont été dictés par la peine, d'autres par l'espoir.«
Im Jahre 1801 konnte er von jedem Verdachte gereinigt nach London zurückkehren, wo er bis zum Jahre 1818 seinen dauernden Wohnsitz hatte. Wenig nur wissen wir aus jener Zeit von seinem Leben, und dieses Wenige ist zum Teil sehr sonderbar. Auf eine öffentliche künstlerische Tätigkeit ließ er sich nicht wieder ein. Kaum daß er an der Bildung der Philharmonie Society im Jahre 1813 teilnahm, indem er nach Grove einigemal dort dirigierte und einmal ein Quartett von sich aufführen ließ. Im übrigen beteiligte er sich allen Nachrichten zufolge an einem Weinhandel, von dessen Erträgen er hauptsächlich lebte. Viotti, der große, ehedem gefeierte Künstler, ein Weinhändler! Ist dies nicht die bare Ironie eines freilich teilweise selbstverschuldeten Geschicks? –
Zwei Besuche in Paris fallen in jene Zeit, der eine im Jahre 1802, der zweite 1814. Auch diesmal waren es nur seine künstlerischen Freunde, die sein Spiel genießen durften, welches sich nach seines Schülers Baillots Bericht noch beträchtlich bereichert und vertieft hatte. Gelegentlich seines zweiten, anscheinend sehr kurzen Besuches in Paris fand von seiten des Konservatoriums ihm zu Ehren ein schnell improvisiertes Konzert statt. Baillot berichtet, daß Viotti dort erschienen sei »wie ein Vater inmitten seiner Kinder«. Tief gerührt durch die nicht endenwollenden Ovationen schloß er seinen alten Freund Cherubini in die Arme, worauf sich Jubel und Zuruf verdoppelten.
Es war vier Jahre später, 1818, daß Viotti London verließ, um, wie er dachte, dauernd nach Paris zurückzukehren. Abermals war er von der Welle des Geschicks, ein Schiffbrüchiger, an den Strand geworfen worden, sein Weinhandel hatte ihn, wie jenes Theaterunternehmen, zum zweitenmal völlig ruiniert.
Auch jetzt noch blieb er seinem Vorsatz treu. War es jener, genialen Naturen nicht selten eigene Starrsinn, war es, wie Fétis doch wohl nicht zutreffend meint, Verständnislosigkeit dafür, daß er mit einer einzigen Konzertreise ein Vermögen wieder gewinnen mußte, waren es noch andere, tiefer verborgene Gründe? Wer wollte dies erkunden, da der Künstler sich nicht darüber geäußert.
Noch einmal bewog man ihn, sich hören zu lassen, in einem dem bereits erwähnten ähnlichen, zu seinen Ehren von den Pariser Künstlern veranstalteten Konzert. Viotti selbst war bis zu Tränen gerührt. Man bat ihn zu spielen, er willigte ein und spielte sein letztes Konzert in e-moll. Einer der anwesenden Konservatoriumsschüler war so erregt, daß er bei des Meisters erstem Bogenstrich in lautes Schluchzen ausbrach.
Wieder war es das Theater, dem der ergraute Künstler sich zuwendete. Am ersten November 1819 übernahm er die früher vergeblich von ihm angestrebte Direktion der Pariser Oper zugleich mit der des Théâtre Italien, welche Stellen kurz vorher miteinander verbunden worden waren. Das Gehalt betrug 12 000 Franken. Auf den Tag zwei Jahre später, am 1. November 1821 legte er, verärgert und verbittert, sein Amt nieder und wurde mit der Hälfte seines Gehaltes pensioniert.
Viotti hatte sich mit voller Energie in die undankbare Aufgabe gestürzt. Die Oper befand sich damals in einem dem Verfall nahen Zustande, und es gelang ihm nicht, sie daraus zu befreien. Seine Zeit war voll angefüllt mit Unerfreulichem. » Mon pauvre talent!« schreibt er einmal grimmig an seinen alten Schüler Rode. » Est-il assez cruel de se sentir encore dans toute son énergie, et de ne pouvoir ni toucher son instrument, ni composer une note? Ho! vie infernale!«
Die Unannehmlichkeiten häuften sich. Schon die Übernahme brachte ihm beinah ein Zerwürfnis mit seinem Freunde Cherubini Einen diesbezügl. Brief Viottis an Cherubini hat Pougin in seinem zitierten Buche aus dem Besitz der noch in Florenz lebenden Tochter Cherubinis, Mme Rosellini, herausgegeben ( pag. 92), der auf denselben Posten reflektiert hatte. Im Februar 1820 erfolgte die Ermordung des Herzogs von Berry, Neffe von Louis XVIII., als er aus der Oper kam. Viotti war damals abwesend, in England. Die Oper wurde aus Anlaß dieses Ereignisses nach der rue Favart verlegt. Das alte Gebäude wurde abgerissen, eine Sühnekapelle zu errichten begonnen, die aber nie vollendet wurde. Heute steht eine Fontäne dort.
Der neue Saal erwies sich als zu klein und ungenügend, große Werke zur Aufführung zu bringen. Das Publikum war unzufrieden, man schob alle Schuld auf Viotti. Im Mai 1821 wurde die Oper wieder verlegt, aus der rue Favart in das Théâtre Louvois. Dort fanden 4 Vorstellungen statt, dann mußte man damit aufhören, da das Resultat gleich Null war. Zwei Monate vergingen, auch die Verlegung in die rue Favart hatte eine zweimonatliche Pause im Gefolge gehabt. Endlich konnte die neue Bühne ( rue Le Peletier) eingeweiht werden (am 16. August 1821).
Aber Viotti war erschöpft. Unter den ungünstigsten Umständen hatte er gearbeitet, sogar trotzdem eine Reihe, freilich kleinerer Novitäten gebracht – jetzt schien das Ärgste überwunden, aber von allen Seiten kamen Intriguen, Verdächtigungen, und Viotti gab endlich seine Demission.
Noch scheint er kurze Zeit das Théâtre Italien geleitet zu haben, und es mag ihm eine kleine Entschädigung für soviel Ärger gewesen sein, daß in einem Artikel des » Le Miroir« vom 31. Oktober 1821, der über seinen Rücktritt von der Oper berichtete, seiner künstlerischen Qualitäten als Virtuose und Komponist » M. Viotti, quoiqu' étranger, a honoré la France; il fut à la fois le compositeur le plus habile et l'exécutant le plus brillant de son époque.« »... nous avons toujours séparé le musicien du directeur« etc., aber auch seiner Direktion des Théâtre Italien mit Ehren gedacht wurde: » jamais l'Opéra-Italien ne nous a paru mieux administré«.
Mit Viottis Rücktritt endet, was wir von seinem Leben wissen. Es ist ein unerfreulicher Gedanke, daß dieser so bedeutende Künstler in grollender Zurückgezogenheit seine letzten Jahre verlebt habe.
Dennoch ist dies das wahrscheinlichste, es sei denn, er habe, durch sein wechselvolles Schicksal weise gemacht, in stiller Resignation die Heiterkeit seiner Seele wiedergefunden. Nur gelegentlich seines etwas über zwei Jahre später stattfindenden Todes ging noch einmal eine kurze Nachricht durch die Zeitungen. Er starb in England, wahrscheinlich nur auf einer Reise befindlich, nach kurzer Krankheit. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat sich neuerdings feststellen lassen, daß London (nicht Brighton) der Ort, der 3. März 1824 der Tag seines Todes ist. Seine Grabstätte ist unbekannt.
Eine durchaus interessante Persönlichkeit steht hinter diesem wechselvollen, einer äußeren Einheitlichkeit so ganz entbehrenden Leben. Und da seine Persönlichkeit bedeutend war, erhält diese problematische Existenz etwas durchaus Tragisches. Hierhin und dorthin getrieben, Italiener von Geburt, Franzose nach dem Felde seiner Tätigkeit und seines bedeutendsten Einflusses, nach England für lange Zeit geworfen und dort, wie es scheint, sich am wohlsten fühlend, einige Jahre im Exil in Deutschland verbringend, kann er nirgend mit seinem ganzen Sein Wurzel fassen. Der größte Violinspieler und bedeutendste Violinkomponist seiner Epoche, nachwirkend bis auf den heutigen Tag, was so wenigen Vertretern seiner Kunst zuteil geworden, tritt er vom Podium, ehe noch seine Kunst die höchste Reife gewinnt, und gönnt von da ab nur vereinzelten Fachgenossen und wenigen Freunden, sich an so reichen Gaben zu erfreuen und zu bilden. Eigensinnig verschmäht er es, aus seinen besten Talenten materiellen Vorteil zu ziehen, lieber wird er Weinhändler, wird er Impresario und büßt zu wiederholten Malen alles ein, was er erworben. So steht er da, seltsam aus Größe und Weltunverstand gemischt.
Noch eins ist merkwürdig, merkwürdig an sich, merkwürdiger bei einem Künstler, am merkwürdigsten bei einem italienischen Künstler: die Frauen scheinen in seinem Leben keine irgendwie erhebliche Rolle gespielt zu haben. Vielleicht erklärt dies manches von seiner inneren wie äußeren Existenz, insbesondere seine Ruhelosigkeit.
Viotti war sehr lebhaft, ein geistvoller Gesellschafter, von gewinnenden, vornehmen Manieren, in der Kleidung gewählt, in seiner Jugend sogar elegant. Seine Haare waren blond, er trug sie anfänglich lang, in späteren Jahren war seine Stirne hoch und kahl. Guter Billardspieler, trefflicher Reiter, zeigte er in allem, womit er sich abgab, viel Geschick.
Seine Erziehung war sorgfältig, er liebte die Literatur und bevorzugte als junger Mann Rousseau besonders. Damit zusammenhängend, bewies er eine außerordentliche Liebe zur Natur und für das Landleben. Ein Schmetterling, eine Blume, eine Frucht konnte ihn immer aufs neue entzücken Viele andere interessante Einzelzüge findet der Leser in dem mehrfach zitierten Werke » Viotti et l'école moderne de Violon« von A. Pougin..
Viotti ist unter den Italienern als der letzte, wahrhaft große Repräsentant des klassischen Violinspiels zu bezeichnen. Im Besitze einer virtuos gebildeten Technik, hat er in seinem künstlerischen Wirken doch nichts mit jenem absoluten Virtuosentum gemein, welches, die ideale Bedeutung der Kunst verkennend, das Mittel für den Zweck substituiert. Hierüber gibt ein Blick auf seine Kompositionen unzweifelhaften Aufschluß. Dieselben tragen, soweit sie nicht durch ihren veralteten Duktus oder durch geringen Gehalt dem Geschick der Vergänglichkeit anheimgefallen sind, den Stempel echten, gediegenen Musikertums. Offenbar galt das Streben ihres Autors vorzugsweise dem Geistigen, Idealen in der Kunst, – ein Standpunkt, welcher den Vertretern des reinen Virtuosentums völlig fremd ist. Es ist freilich ein nur verhältnismäßig kleiner Teil von Viottis Violinkompositionen für die Nachwelt übrig geblieben, aber dieser steht in seiner Trefflichkeit und Tüchtigkeit als ein rühmliches und unvergängliches Denkmal seiner künstlerischen Gesinnung und Tatkraft da. Der Meister hat, wie wenige, die Violine als Gesangsinstrument zu behandeln gewußt. Seine melodischen Motive tragen bei aller Einfachheit einen sinnig naiven, anmutig edlen, bisweilen von einem vornehmen Gefühlspathos durchleuchteten Zug. Zugleich befreit er die Violinkomposition vollständig von den Traditionen des Kirchenstils, der sich inzwischen in dem Maße, als die Kunst mehr und mehr ins öffentliche Leben trat, allmählich in ein rein konventionelles Wesen verloren hatte. Seine Musik offenbart durchweg einen entschieden freien, sozusagen weltlichen Charakter, sowohl in der Kantilene wie in den feurig belebten, glanzvollen, nie die Grenzen des Schönen überschreitenden Passagen und Figuren.
Als Lehrmeister für sein Instrument war Viotti hauptsächlich während des Pariser Aufenthaltes tätig; er war es, der dem französischen Violinspiel jenen Aufschwung gab, in welchem die Glanzperiode dieser Schule gipfelt. Seine namhaftesten Zöglinge sind Rode, Alday, Libon, Labarre, Cartier, Robberechts und Durand, deren nähere Betrachtung in dem Abschnitt über Frankreich erfolgen wird. Hier sei nur zweier seiner Schüler, der Violinistin Parravicini, geb. Gandini, und Mori's gedacht. Die erstere, geb. 1769 zu Turin, wurde unter Viottis Nach Gerber war sie eine Schülerin Pugnanis. Fétis dagegen führt sie übereinstimmend mit Regli als Schülerin Viottis an. Neuerdings spricht sich Pougin ( Viotti et l'école moderne) gegen ihre Viottischülerschaft aus. Als Viotti Italien verlassen habe, sei sie noch zu jung dafür gewesen, (?) als sie nach Paris kam (1798), war Viotti lange nicht mehr dort, so bleibe von 1792 an nur England, und ein Aufenthalt der Parravicini dort sei nicht bekannt. Ferner sei bei ihrem ersten Auftreten in Paris nirgendwo Erwähnung geschehen, daß Viotti ihr Lehrer sei, auch habe sie in den zwei Konzerten, in denen sie auftrat, keine Komposition von Viotti gespielt. – Das alles ist freilich nicht zwingend, und so mag die Künstlerin bis auf weiteres ihren Platz an dieser Stelle behalten. Anleitung eine Spielerin von nicht gewöhnlichem Ruf. Von 1798 bis 1802 trat sie nacheinander in Paris, Leipzig, Dresden und Berlin auf. Der » Courier des spectacles« vom 10. März 1798 widmet ihr eine sehr anerkennende Besprechung, die er schließt: » Cette artiste, en un mot, est digne d'occuper un rang distingé dans les meilleurs concerts.« Ebenso günstig war die Aufnahme eines zweiten, im folgenden Monat von ihr gegebenen Konzertes. In der Allgem. mus. Ztg. (Bd. 1, S. 552) findet sich folgendes Urteil über sie: »Festigkeit, Reinheit, Deutlichkeit des Tons, Annehmlichkeit und Eleganz des Vortrags ohne Überladung und Verschnörkeley, Kraft des Bogens und Ausdauer in anstrengenden Schwierigkeiten ohne Derbheit und Rauhigkeit, viel männliches ohne Verleugnung zarter Weiblichkeit, erwarben dieser Virtuosin allgemeinen Beyfall.« Reichardt berichtet über sie in seiner mus. Ztg. Bd. I, S. 78: »In der Tat steht sie unter allen Violinspielern um so mehr einzig da, weil ihr Spiel so männlich kraftvoll ist. Ihre ersten Meister waren Pugnani (?) und Viotti, und auf diesen Stamm konnte Kreutzer, der sie zuletzt in Paris unterrichtete, (?) seine originelle und energische Manier am besten pfropfen. Mad. Albergati übertrifft an Fülle und Stärke des Tons und an mächtiger Bogenführung manchen sonst braven Violinspieler. Ihr ganzes Spiel ist höchst vollkommen.«
Anders lautet freilich Spohrs Urteil, welcher die Künstlerin in Neapel hörte; in seiner Selbstbiographie sagt er über sie: »Ich bin es schon gewohnt, mein Instrument von Frauenzimmern mißhandeln zu hören, so arg wie von Mad. Parravicini aber habe ich es noch nicht gehört. Dies nahm mich um so mehr Wunder, da sie sich einigen Ruf erworben hat und voller Prätensionen ist. Sie hat eine vorzügliche Violine von Stradivari und zieht im Gesange einen leidlichen Ton heraus; dies ist aber auch ihr ganzes Verdienst. Übrigens spielt sie in schlechtem Geschmack mit überladenen und gehaltlosen Verzierungen und die Passagen undeutlich, unrein in der Intonation und überhudelt in den Bogenstrichen.« Man hat sich hierbei allerdings zu vergegenwärtigen, daß die Spielerin bereits in ziemlich vorgerücktem Lebensalter stand, als Spohr sie hörte.
Die Parravicini scheint für einige Zeit ihrem Berufe entsagt zu haben, da sie sich von ihrem Gatten trennte, um die Maitresse des Grafen Albergati zu werden. Doch später kehrte sie wieder zu öffentlicher Kunsttätigkeit zurück, wie wir aus ihrem 1827 erfolgten Auftreten in München ersehen, wo man, obwohl sie bereits 58 Jahre alt war, noch die »Kraft ihres Bogens« bewunderte. Seit jener Zeit aber fehlen alle Nachrichten über sie.
Francesco (nach Pougin Nicolas) Mori, 1796 von italienischen Eltern in London geboren, war nur einige Monate hindurch Viottis Schüler, nachdem er bereits eine bedeutende Höhe künstlerischer Ausbildung erklommen hatte. Großer Ton und ungemeine Gewandtheit der linken Hand zeichneten sein Spiel aus. Er war der erste Violinlehrer an der damals ins Leben gerufenen königl. Akademie der Musik zu London und eine Zeitlang auch Dirigent der philharmonischen Konzerte daselbst. Er starb im Sommer 1839.
Eine Reihe italienischer Geiger des 17. und 18. Jahrhunderts kann nicht direkt mit einer der besprochenen Schulen in Verbindung gebracht werden. Sie folgen hier in wesentlich chronologischer Reihenfolge.
Von Alessandro Orologio ist nur bekannt (Eitner, Qu.-L.), daß er Violinist und 1580 Kammermusikus an der Prager Hofkapelle war. 1603 Vizekapellmeister, wurde er 1613 mit Regierungsantritt des Kaisers Matthias in den Ruhestand versetzt, lebte aber noch 1630 als »Hofkomponist« in Prag. Seine Werke sind Madrigale und Canzonetten.
Ein für seine Zeit hervorragender Violinspieler scheint der um die Mitte des 17. Jahrhunderts in der Kapelle des Erzherzogs Ferdinand Karl v. Österreich angeführte Giovanni Antonio Pandolfi Mealli gewesen zu sein. Torchi gibt an, daß seine Solosonaten für Violine ( Op. 3 und 4), die 1660 in Innsbruck erschienen, von einer besonderen technischen Schwierigkeit seien, ja er nennt sie die schwersten der bis zu diesem Zeitpunkte von ihm erwähnten. Dieser rein technischen Höhe entspricht (nach Torchi) freilich der Gehalt nicht, der lediglich musikalisches Akrobatentum sei und von Entartung des Geschmacks Zeugnis ablege. Nähere Nachrichten über den Künstler können zurzeit nicht gegeben werden.
Carlo Mannelli, der in Pistoja geboren wurde, lebte ums Jahr 1682 in Rom. Sein Lehrer dürfte sein Vater D. Camillo Mannelli gewesen sein, da berichtet wird, daß er den Sohn frühzeitig in seiner Kapelle angestellt habe. Mannelli gab als Op. 1 Sinfonien für Violine solo heraus, die jedoch unbekannt sind. Dagegen kennen wir in seinem Op. 2 ein weiteres aus 14 Sonaten für 2 Violinen und Laute (oder Violoncell) mit Orgelbaß bestehendes Violinwerk vom Jahre 1682. Torchi gibt über dasselbe an, es sei sorgfältiger in Bezeichnungen und Bindebögen, als es zu jener Zeit üblich gewesen, fällt aber über den Verfasser das Urteil, er sei lediglich ein » compositore tecnico di violino«.
Wenig ist bekannt über Pietro degli Antonij, doch sind seine Werke nach Torchi sowohl für die Entwicklung der Sonatenform als auch ihres musikalischen Inhalts wegen von Interesse. Im Jahre 1671 veröffentlichte er Correnten usw. für Violine oder Spinett (?) mit Begleitung anderer Instrumente, im Jahre 1676 als Op. IV zwölf Sonaten für Violine solo und Baß, die hinsichtlich der technischen Behandlung des Instrumentes bemerkenswert sind. Dasselbe gilt von seinem im Jahre 1686 erschienenen fünften Werke, das ebenfalls Violinsonaten enthält. Auch sein Bruder Giovanni Battista, der Organist war, hat Balletti, Correnti usw. für Violine im Jahre 1688 herausgegeben, die nach Torchi gleichfalls beachtenswert sind.
Pietro degli Antonij wurde um 1645 (nach Fétis um 1630) in Bologna geboren und war gegen 1680 ebendort an Maria Maggiore Kapellmeister. In derselben Eigenschaft finden wir ihn später an den Kirchen S. Stefano (ca. 1686) und S. Giovanni (1697). Er soll zuerst das Kornet gespielt haben. Näheres über ihn ist nicht bekannt.
Ein weiterer der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angehöriger Violinist war Andrea Grossi, der in den Diensten des Herzogs von Mantua stand. Außer den von Gerber erwähnten Sonaten seiner Hand, die 1696 in Bologna erschienen, sind durch Torchi drei frühere Werke dieses Künstlers bekannt geworden, die zwischen 1679 und 1685 entstanden und Balleti, Correnten, Sarabanden usw. für 2 Violinen u. Baß sowie Sonaten für 2, 3, 4 und 5 Instrumente enthalten.
Evaristo Felice dall'Abaco, von dem eine Reihe von Werken kürzlich neu herausgegeben wurde Denkmäler der Tonkunst in Bayern, erster Jahrgang (1900). Er enthält eine ausführliche biographische Einleitung von Ad. Sandberger und ausgewählte Instrumentalwerke Abacos. war als Komponist eine bedeutsame Erscheinung, spielte außerdem Violine und Violoncell, doch ist uns nicht überliefert, ob er in dieser Eigenschaft gleich Hervorragendes leistete, weshalb wir ihn an diesem Orte nur kurz behandeln können.
Abaco wurde am 12. Juli 1675 in Verona geboren, wo seine Familie zu den angesehenen zählte. Jedenfalls erfuhr er in seiner Jugend die Einwirkung Giuseppe Torellis, der gleichfalls Veroneser war und bis zur Mitte der achtziger Jahre des Jahrhunderts dort lebte. Im Jahre 1696 finden wir Abaco in Modena, wo er möglicherweise Schüler Tommaso Vitalis gewesen ist. Er wirkte dort, ohne angestelltes Mitglied der Kapelle zu sein, in der Oper, bei den Kirchenmusiken usw. mit. In Modena blieb er bis 1701.
Am 1. April 1704 wurde er in München als Kammermusiker des Kurfürsten Maximilian II. Emanuel angestellt und zwar für das Violoncell. In dem Getriebe des spanischen Erbfolgekrieges folgte der Künstler seinem Herrn im folgenden Jahre nach Brüssel und teilte auch weiterhin sein Geschick, bis er im Jahre 1715 nach München zurückkehrte. Als Konzertmeister und kurfürstlicher Rat lebte Abaco in München bis zu seinem Tode, der am 12. Juli, seinem Geburtstage, im Jahre 1742 erfolgte.
Abacos Kompositionen, die in der zeitgenössischen Instrumentalliteratur eine hohe Stelle einnehmen, bestehen aus 6 Werken, von denen das erste, dritte und vierte Kammer- und Kirchensonaten für eine und 2 Violinen und Violoncell, die übrigen Konzerte teils für vier, teils für mehr Stimmen enthalten. Sie erschienen mit Ausnahme des in Paris gedruckten Op. 3 sämtlich in Amsterdam; die ersten fünf zwischen 1705 und 1717, das letzte wahrscheinlich um 1730 Näheres in den »Denkmälern« l. c..
Die Violinisten Tessarini und Cosimi werden in nähere Beziehung zu Corelli gebracht. Es ist jedoch zweifelhaft, ob sie unmittelbare Schüler des Meisters waren.
Carlo Tessarini, » Professore di Violino« und » Compositore di musica«, wie er sich auf seinem Bildnis nennt, geboren 1690 zu Rimini, war erster Violinist an der Metropolitankirche zu Urbino und genoß als solcher seit dem Jahre 1724 eines bedeutenden Rufes in Italien. Es existieren von ihm mehrere Violinkompositionen. Die Angabe Burneys, daß er im zweiundsiebzigjährigen Alter nach Amsterdam gekommen sei und dort Werke in einer modernen, von seinen früheren Arbeiten völlig abweichenden Manier zur Aufführung gebracht habe, weist Fétis mit dem Bemerken zurück, daß es sich hierbei um nichts anderes handele, als um eine damals in Amsterdam erfolgte Veröffentlichung zweier Werke, von denen das eine die französische Ausgabe einer Violinschule: » Grammatica di musica, divisa in due parti per imparare in poco tempo a suonar il Violino etc.« gewesen sei. Der Titel der französischen Ausgabe des Werkes lautet: » Nouvelle Methode pour apprendre par théorie dans un mois de temps, à jouer du Violon, divisée en trois classes; avec des leçons à deux violons par gradation, Amsterdam 1762.« In meinem Besitze befindet sich die französische Ausgabe dieser Violinschule, auf deren Titel aber nicht Amsterdam, sondern Paris als Verlagsort, doch ohne Jahreszahl, angegeben ist. – In einem von Liepmannssohn 1870 zu Paris veröffentlichten antiquarischen Katalog ist ein handschriftliches Exemplar (angeblich » manuscript autographe«) der Tessarinischen Violinschule unter folgendem Titel aufgeführt: » Grammatica di musica insegna il modo facil e brieve per bene imparare di sonare il violino. opera prima. Roma 1741.« Bestätigt sich die Angabe, daß es sich hier um ein Manuskript Tessarinis handelt, so würde dadurch konstatiert sein, daß diese Violinschule schon 21 Jahre vor Veröffentlichung der französischen Ausgabe und ein Jahr nach dem Erscheinen von Geminianis Violinschule verfaßt worden ist.
Aus dieser Ankündigung geht hervor, daß die in unserer Zeit nicht selten vorkommende Charlatanerie, Sprachen und Künste in kürzester Zeit lehren zu wollen, keineswegs eine Erfindung neuesten Datums ist. Jedenfalls war es Tessarini hierbei nur um eine in die Augen fallende Reklame zugunsten seiner Violinschule zu tun; denn daß er wirklich geglaubt haben sollte, man könne in einem Monat Violine spielen lernen, ist schlechterdings nicht anzunehmen, weil man ihn sonst der Schwachsinnigkeit zeihen müßte, wozu kein Grund vorhanden ist.
Tessarinis Violinschule besteht aus einer dürftigen Behandlung der für die Technik erforderlichen Elementargegenstände. Der Autor begnügt sich damit, seinen Stoff, mit Einschluß einiger für die erste, zweite, dritte und siebente Lage berechneter Übungsstücke, alles in allem auf 10 Seiten zu absolvieren. Was er gibt, ist weniger, als die der Entstehung nach ältere Violinschule Geminianis darbietet, weshalb keine Veranlassung vorliegt, näher darauf einzugehen. Nur sei noch bemerkt, daß Tessarini seine Violinschule in drei Abschnitte eingeteilt hat, zu denen je 12 » Leçons de gradation« gehören, die aber als selbständige Werke und also unabhängig von der Violinschule im Druck erschienen.
In seinen Kompositionen lehnt Tessarini sich entschieden an Corelli an, ohne sich irgendwie auszuzeichnen. Seine Violinsätze haben mehrenteils etwas Etüdenartiges, und die dazu gehörenden Baßbegleitungen sind mit geringen Ausnahmen von gewöhnlicher Beschaffenheit. Sein Todesjahr ist unbekannt.
Nicolo Cosimi wurde zu Rom in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts geboren. Er ging 1702 nach London und veröffentlichte dort zwölf Violinsolos. Einige Zeit darauf kehrte er nach Italien zurück und starb dort bald. Er wird von Burney als ein vorzüglicher Violinspieler gerühmt.
Francesco Montanari, gegen Ende des 17. Jahrhunderts zu Padua geboren, wirkte von 1717 bis an sein Ende (1780) als Zelebrität des Violinspiels am St. Petersdome zu Rom. Seine Arbeiten gewähren kein besonderes Interesse. Sie sind meist inhaltsleer und häufig von ziemlich roher, unsauberer Gestaltung Günstiger urteilt Schering über seine in Dresden befindlichen Violinkonzerte (l. c. S. 102). Torchi erwähnt ihn nicht. Besseres leistete, zumal in formeller Hinsicht, Giuseppe Matteo Alberti Ein anderer Violinist Alberti, Pietro mit Namen, stand nach Fétis und Eitner in Diensten des Prinzen Carignan, Bruders des Herzogs von Savoyen. Er ließ sich im Jahre 1697 vor Louis XIV. als Violinist hören. Royer in Amsterdam druckte 1700 dreistimmige Sonaten von ihm als Op. 1. Weiteres ist über ihn nicht bekannt. geb. um 1685 zu Bologna (gest. 17..), dessen Amt und Würden aus dem Titel seines ersten, 1713 in genannter Stadt veröffentlichten Werkes zu ersehen sind: » X Concerti per Chiesa, e per Camera, ad Uso dell' Academia eretta nella Sala del Sig. Co. Orazio Leonardo Bargellini, Nobile Patrizio Bolognese, composti e dedicati al sudetto Signore da G. M. Alberti, Musico Sonatore di Violino nella Perinsigne Collegiata di S. Petronio di Bologna, et Accademico Filarmonico.« Der Autor erinnert in diesen Kompositionen, von denen 5 Kirchenkonzerte und 5 sogenannte Symphonien (d. h. Konzerte ohne obligate Violine) sind, an Corellis Satzweise. Der Titel seines dritten Werkes in englischer Ausgabe ist: » Solos for a Violin with a Thorough-Bass for the Harpsicord or Bass Violin, composed by G. M. Alberti. Opera terza.« Alberti war zuerst Schüler eines gewissen Manzolini, weiterhin wurde Pietro Minelli, der zu den Philharmonikern in Bologna gehörte und 1712 starb, sein Lehrer. Im Jahre 1713 wurde Alberti die oben erwähnte Anstellung als Violinist an San Petronio zuteil, im folgenden Jahre erwarb er die Mitgliedschaft der philharmonischen Akademie, zu deren Präsidenten er im Jahre 1721 gewählt wurde. Ein Verzeichnis seiner Werke (Konzerte, Sinfonien, Sonaten usw.) gibt Eitner. Torchi und Schering sprechen sich über die ihnen bekannt gewordenen Werke in günstigem Sinne aus. Nach Burney wurden die Instrumentalstücke Albertis zu ihrer Zeit häufig in den Konzerten von Provinzialstädten aufgeführt.
Ein anderer wenig älterer Bolognesischer Violinspieler von Auszeichnung war Francesco Manfredini (geb. 1673, gest. 17..). Er ließ 1704 » Concertini per Camera a Violino e Violoncello« als Op. 1 drucken, denen noch » Sinfonie da chiesa« und » Concerti a due Violini etc.« als Op. 2 und 3 folgten. 1704 wurde er zum Mitglied der Philharmonischen Gesellschaft seiner Vaterstadt ernannt.
Ein gerühmter Violinvirtuose war Giovanni Madonis, geb. zu Venedig in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 1726 kam er in Gesellschaft von italienischen Opernsängern als deren Dirigent nach Breslau. Anfangs 1729 ließ er sich zu Paris im » Concert spirituel« hören, was ihm eine Anstellung bei den » Violons ordinaires de la musique du roi« eintrug. Aber schon 1731 folgte er einem Rufe nach Petersburg, wo er lange Zeit hindurch in hoher Schätzung stand.
Nicola Matteis, Violin- und Gitarrenvirtuose, ließ sich um 1672 – nach älteren Angaben erst 1690 – in London nieder. Er war der erste überragende italienische Violinspieler, der nach England kam, und erregte so großes Aussehen, daß die bis dahin dort sehr mißachtete Geige an Stelle der Viola schnell zu großer Beliebtheit in der Themsestadt gelangte. Evelyn »hörte niemals einen sterblichen Menschen ihn auf der Violine erreichen, der Ton seiner Violine war wie der Klang einer Menschenstimme«. North (» Memoirs of Musick«, herausgegeben von Rimbault 1846) ergänzt diese Mitteilung dahin, Matteis habe sich besonders im Wechsel von Arcato- (wohl Legato) und Staccatospiel, im Tremolo und in raschen Gängen ausgezeichnet – alles Dinge, die in England vordem noch niemand gehört habe. Obgleich er arm nach England kam, verdiente er viel Geld durch sein Spiel. Gute Einnahmen verschaffte er sich auch durch seine suitenartigen Kompositionen für zwei Violinen, die er zu hohen Preisen nicht nur an seine Schüler, sondern auch an Liebhaber aus freier Hand verkaufte. Dieser Einkünfte erfreute er sich indes nicht dauernd, da er einem dissoluten Lebenswandel verfiel, infolge dessen er starb.
Seinen Sohn Nicola Matteis, nach Gerbers Angabe auch Mattheis oder Mathys geheißen, hatte er frühzeitig zu einem vorzüglichen Violinisten erzogen, der mit »unnachahmlicher Simplizität und Zierlichkeit« die Corellischen Geigensoli zu spielen verstand. Quantz berichtet über ihn, daß er zu denselben »neue Manieren«, d. h. Verzierungen u. dgl. gesetzt habe. Gegen 1717 begab er sich nach Wien, wo er einige Zeit hindurch in der kaiserl. Kapelle als erster Violinist tätig war. Später ging er nach Prag, wo er die Ballettmusik zu der für die Krönungsfeierlichkeiten Karls VI. von Fux komponierten Oper » Costanza e Fortezza« schrieb. Er war noch 1727 in der böhmischen Hauptstadt. Sodann kehrte er wieder nach England zurück und nahm in Shrewsbury seinen Wohnsitz, wo er, wie Burney, der sein Schüler war, berichtet, bis zu seinem Tode (1749) als Violinist und Sprachlehrer lebte.
Der Cremoneser Geiger Gasparo Visconti, geboren in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, lebte zu Anfang des 18. Jahrhunderts in London und veröffentlichte dort im Jahre 1703 sechs Solo-Violinsonaten, welche auch in einer zweiten Ausgabe bei Royer in Amsterdam erschienen.
Gian Pietro Guignon, geb. 10. Februar 1702 zu Turin, gest. 30. Januar 1774 (nach Regli) zu Versailles, kam in jungen Jahren nach Paris und widmete sich zunächst dem Studium des Violoncells, das er bald darauf mit der Violine verrauschte. 1733 trat er in die Dienste des Königs von Frankreich und wurde Violinmeister beim Vater Ludwigs XVI. Diese Stellung trug ihm am 15. Januar 1741 den Titel und die Rechte Nach ihnen konnte gegen Erlegung einer französischen Pistole jeder Tonkünstler in allen Provinzen des Königreichs für zünftig erklärt werden. Doch machte Guignon keinen Gebrauch davon, sondern nannte sich bloß auf seinen Werken Roi des Violons. (Wiener Musikztg. v. J. 1821, S. 588.) über den » Roi des Violons« und die damit in Verbindung stehende » Confrérie de Saint-Julien« ist das Erforderliche in dem dritten Abschnitt d. Bl., betreffend das französische Violinspiel, mitgeteilt. des sogenannten Geigerkönigs ein, eine mittelalterliche Institution, die mit ihm zugleich erlosch. Kaum war Guignon im Besitze seines Patents, so erließ er auch schon Reglements für die Organisten und Komponisten Frankreichs. Die hierüber entstandenen Streitigkeiten konnten schließlich nur durch einen Parlamentsbeschluß geschlichtet werden, welcher am 30. Mai 1750 erfolgte und Guignon seines Geigerkönigamtes und der daran geknüpften vermeintlichen Prärogative für verlustig erklärte. Nach anderer Mitteilung hat er erst im März 1773 das Amt niedergelegt. Jedenfalls erlosch es mit ihm (vgl. Weckerlin, Nouveau [sic] Musiciana). Guignon soll sich als Violinspieler durch vorzüglichen Ton und leichte, gewandte Bogenführung ausgezeichnet haben. In Paris erschienen einige seiner Kompositionen. Er starb in Versailles am 30. Januar 1774.
Ausgezeichneten Ruf als Violinvirtuose und Komponist genoß Francesco Ciampi, geb. 1704 zu Massa bei Sorrento im Neapolitanischen. Seine Opern scheinen besonders gute Aufnahme in Venedig gefunden zu haben; denn 1728 begab er sich dorthin, um den größten Teil derselben in der Lagunenstadt aufzuführen.
Der Geiger Pietro Antonio Avondano (Avontano), geboren zu Anfang des 18. Jahrhunderts in Neapel, ließ 1732 in Amsterdam zwölf Sonaten für Violine und Baß als Op. 1, und außerdem einige in Deutschland und Paris herausgekommene Duos für Violine und Baß drucken. Überdies machte er sich durch die Opern: » Berenice« und » Il mondo nella Luna« bekannt. Nach Fétis' Angabe befinden sich die Manuskripte zweier Oratorien von seiner Komposition, nämlich » Giod« und » La morte d'Abel« in der königl. Bibliothek zu Berlin.
Giovanni Piantanida, geb. 1705 in Florenz, ging 1734 mit einer italienischen Operngesellschaft nach Petersburg und ließ sich dort mit großem Beifall hören. Im Winter 1737-1738 konzertierte er erfolgreich in Hamburg. Dann wandte er sich nach Holland und von hier wiederum, wie so viele seiner in jener Zeit unstet umherziehenden italienischen Berufsgenossen, nach der Heimat. 1743 trat er im Concert spirituel auf. Im Jahre 1770 hörte ihn Burney in Bologna, überrascht durch seine Leistungen als Violinist. Gegen 1782 starb er dort. Von seinen Kompositionen erschienen sechs Violinkonzerte und ebensoviel Trios für zwei Geigen und Baß im Druck. Nach dem, was Torchi über seine Sonaten für zwei Violinen und Baß vom Jahre 1742 berichtet, wäre Piantanida ein formell und technisch sehr geschickter Komponist eklektischer Richtung gewesen.
Als ein vorzüglicher Geiger wird Andrea Zani bezeichnet, welcher in den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts zu Casale-Maggiore in der Lombardei geboren wurde. Es sind von ihm 12 Violinkonzerte, sowie zwei Hefte Sonaten für Violine und Baß, überdies aber auch noch sechs Concerti grossi und sechs Symphonien für Streichinstrumente gedruckt worden.
Über den Piemontesen Giuseppe Canavasso ist nur so viel bekannt, daß er zwischen 1735 und 1753 als trefflicher Geiger und Komponist für sein Instrument in Paris lebte. Er trat 1741 und weiterhin im Concert spirituel auf. Neuerdings sind durch eine Arbeit über die Turiner Hofkapelle ( Gazetta da Milano 1891) die Namen zweier anderer Violinspieler Canavasso, Marc' Aurelio und Paolo, bekannt geworden. Der erstere wurde am 9. März 1746 angestellt und war 1785 noch tätig. Paolo, zugleich mit Marc' Aurelio angestellt, starb bald nach 1775. (Eitner, Qu.-L.)
Der Romagnole Carlo Giuseppe Toeschi, eigentlich Toesca della Castellamonte, dessen Jugendgeschichte unenthüllt ist, trat 1756 als Violinist in die Mannheimer Kapelle, in welcher er 1768 als zweiter Konzertmeister tätig war. 1778 folgte er dem Hofe nach München. Er wurde 1724 geboren und starb am 12. April 1788. Schubart bemerkt über ihn: »In der Bogenlenkung ist er bei weitem kein Cannabich: Dieser befehligt Heere, jener kaum ein Bataillon. Indessen besitzt er doch etwas ganz Eigenthümliches: er hat sich eine besondere Manier im Symphonienstyl zu eigen gemacht, von ausnehmender Kraft und Wirkung. Sie (die Symphonien, deren er 7 schrieb) beginnen mit Majestät, und strudeln so nach und nach im Crescendo fort; spielen voll Anmuth im Andante und enden sich im lustigen Presto. Doch fehlte ihm die Mannichfaltigkeit; denn hat man eine Symphonie von ihm gehört, so hat man sie alle gehört.« Außer Symphonien ist einige Kammermusik von ihm vorhanden.
Sein Sohn Giovanni Battista, nach Lipowskys mus. Lex. in Mannheim, nach Fétis' Angabe in Italien geboren, war Schüler Joh. Carl Stamitz' und Cannabichs. Er folgte seinem Vater 1788 im Amte und starb zu München am 1. Mai 1800. Als Komponist war er seinem Vater überlegen. Wir besitzen von ihm 18 Symphonien, 10 Quartette und 6 Trios.
Auch er hatte einen Sohn, Carlo Teodoro, geb. 1770 in Mannheim, den er zu einem geschickten Violinspieler heranbildete. Als solcher fand er einen Wirkungskreis in der Münchener Kapelle.
Francesco Galeazzi, nach Regli geb. 1738 (nach Fétis 1758) zu Turin, wirkte als erster Violinspieler im Teatro Valle zu Rom. Er verfaßte außer verschiedenen Instrumentalkompositionen ein zweibändiges Werk: » Elementi teoretico-pratici di musica, con un saggio sopra l'arte di suonare il violino analizzata, e a dimostrabili principii ridotta: opera utilissima a chiunque vuol applicare con profitto alla musica, e specialmente ai principianti, dilettanti e professori di Violino.« Roma 1791 und 1796. Als Todesjahr dieses Künstlers gibt Fétis 1819 an, während bei Regli jede Bemerkung darüber fehlt.
Der Florentiner Violinvirtuose Salvatore Tinti, geb. gegen 1740, lebte im Alter zu Venedig, wo er im Jahre 1800 starb. Er ließ mehrere Instrumentalwerke drucken, unter denen Streichquartette hervorzuheben sind.
Als einer seiner Schüler wird der 1781 in Livorno geborene Violinist Angelo Puccini erwähnt, welcher den ersten Unterricht von Vanacci erhielt. Dann ging er nach Florenz, um der Lehre Tintis teilhaftig zu werden. Zugleich genoß er die Unterweisung Zingarellis im Kontrapunkt. Nach Hause zurückgekehrt, empfing er Kompositionsunterricht bei Cecchi. Es existieren von ihm Konzerte, Sonaten und Violinduos.
Über einen Violinisten Carlo Zuccari (oder Zuccarini) findet sich bei Gerber, daß er sich 1761 durch 6 Violinkonzerte im Manuskript bekannt gemacht habe und möglicherweise mit dem von Burney 1770 in Mailand gehörten Vorgeiger des Orchesters identisch sei, der für einen tüchtigen Geiger gegolten habe. Von gedruckten Werken zählt Gerber auf: Art of Adagio playing (Solostück für Violine und Baß, London). 3 Trios für 2 Violinen und Baß. Handschriftlich: 6 Duette für Violine und Violoncell, 7 Sonaten und 3 Sonaten für Violine und Baß. Dieselben Angaben hat Fétis, der hinzufügt, daß Zuccari um 1750 am Theater der opéra italien in London tätig gewesen sei. Brenet ( les Concerts en France) gibt an, daß ein italienischer Violinist Zuccarini 1737 in Paris in der Académie royale gespielt habe. Möglicherweise handelt es sich um dieselbe Persönlichkeit. Weiteres scheint über ihn nicht bekannt zu sein.
Giuseppe Demachi (auch Demacchi), geb. gegen 1740, war Mitglied der königl. Kapelle zu Turin und wirkte seit 1771 als geschätzter Geiger in Genf. In Paris und Lyon erschienen mehrere seiner Violinwerke. Das bei Cartier von ihm mitgeteilte Allegro ist trocken und etüdenhaft.
Luigi Tomasini, geb. 1741 oder 42 in Pesaro, gehörte der von Jos. Haydn bis 1790 geleiteten Kapelle des Fürsten Esterhazy als Konzertmeister an, für die er bald nach dem Jahre 1761 gewonnen wurde. Haydn, der ihn seiner näheren Freundschaft würdigte, schätzte seine Leistungen außerordentlich und pflegte gegen ihn zu äußern: »So wie Du spielt mir Niemand meine Quartette zu Dank C. F. Pohls Haydn-Biographie I, 262. (Breitkopf & Härtel.)« Auch der Fürst hielt große Stücke auf ihn und bewies dies nach dem am 25. April 1808 erfolgten Tode Tomasinis dadurch, daß er die Witwe mit einer Pension von 400 und deren noch nicht mündige Kinder mit einer Jahressumme von 200 Gulden bedachte. Obwohl Tomasini ein ausgezeichneter Geiger war, so begab er sich doch niemals auf Kunstreisen. Nur ein einziges Mal ließ er sich 1775 in einer musikalischen Produktion der Wiener Tonkünstler-Sozietät als Solospieler hören. Von seinen Kompositionen sind zu nennen: Il Concerti a Violino princ. con accompagnamento, II Sonate a Violino solo e Basso, XII Quartetti a 2 Violini, Viola e Violoncello, XII Variations pour le Violon, Trois Duos concertants pour deux Violons, Trois Quatuors, œuvre 8. Außerdem schrieb er für den Fürsten Esterhazy speziell XXIV Divertimenti per il Paridon (Baryton), Violino e Violoncello.
Auch Tomasinis Sohn, mit Vornamen Anton, geb. am 17. Februar 1775 zu Eisenstadt, gest. daselbst am 12. Juni 1824, war ein vortrefflicher Violinist. Man rühmte seinen »schönen, vollen Ton, seine bedeutende Geläufigkeit und überaus leichte Auffassung«. Er gehörte gleichfalls der fürstl. Esterhazyschen Kapelle an und ließ sich mehrfach als Solist in Wien hören. Aber durch sein leichtsinniges Leben ging er in den besten Jahren zugrunde.
Fétis erwähnt in seiner » Biographie des musiciens« einen Künstler namens Tomasini, der 1834 das Konzertmeisteramt in Neu-Strelitz bekleidete und sich 1840 im Haag, sowie 1845 in Düsseldorf als Solospieler hören ließ. Möglicherweise war es ein Sohn des Anton Tomasini.
Giovanni Giuseppe Cambini war zuerst Schüler eines gewissen Polli, bildete sich aber später nach Nardini und Manfredi so weit heran, daß er als Violinspieler eine gewisse Geltung erlangte. Seine Haupttätigkeit entfaltete er indessen im Gebiete der Instrumentalkomposition, für die er sich durch ein dreijähriges Studium beim Pater Martini in Bologna vorbereitet hatte. Seine Produktion war so massenhaft, daß er sich den wenig ehrenhaften Namen eines Geschwind- und Vielschreibers erwarb. Fétis zählt von seinen Werken nicht weniger als 60 Symphonien, 144 Streichquartette, 29 konzertierende Symphonien und mehr als 400 Piecen für verschiedene Instrumente auf. Außerdem setzte er 19 Opern. Seit 1770 war der Schauplatz seines Wirkens Paris. Seine Kompositionen wurden hier zwar aufgeführt, doch ebenso schnell vergessen als gehört. Er starb in der französischen Hauptstadt 1825 in ärmlichen Verhältnissen. Geboren wurde er am 13. Februar 1746 zu Livorno.
Von dem Neapolitaner Guerini wird nur berichtet, daß er während der Jahre 1740-1760 in den Diensten des Prinzen von Oranien im Haag stand und dann nach London ging. In Amsterdam wurden 14 verschiedene Werke für Violine und Begleitung von ihm gedruckt. Der in Cartiers Violinschule befindliche Prestosatz seiner Arbeit ist von durchaus gewöhnlichem Charakter.
Gleicherweise ist über den Violinspieler Francesco Falco nichts weiter bekannt, als daß er seit 1773 in der Pariser Kapelle stand und während seines dortigen Wirkens einige Violinsonaten drucken ließ, welche 1776 auch in London erschienen.
Als ein ausgezeichneter Violinspieler wird Giovanni Battista Noferi (auch Nofieri) genannt, der in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts geboren wurde und auch als Komponist tätig war. In letzterer Eigenschaft erscheint er nach dem von Cartier veröffentlichten Allegro für Violine solo als sehr unbedeutend.
Sebastiani Bodini stand gegen 1756 beim Markgrafen von Baden-Durlach als Konzertmeister in Diensten, nachdem er vorher in der herzogl. Württembergischen Kapelle gewesen war.
Eligio Celestino wirkte als Konzertmeister am Mecklenburg-Schweriner Hofe zu Ludwigslust von 1781 bis zu seinem Tode, 24. Januar 1812. Er war 1737 in Rom geboren. Burney, der ihn dort im Jahre 1770 kennen lernte, berichtet, daß er um diese Zeit der beste römische Violinspieler gewesen sei. Vor seiner Niederlassung in Ludwigslust bereiste er während der Jahre 1775-1780 Frankreich und Deutschland als Konzertspieler. In seinem sechzigsten Lebensjahre ließ er sich noch in London mit bestem Erfolg hören. In Berlin und London wurden 1786 und 1798 einige Violinkompositionen von ihm gedruckt. Ein viel gerühmter Schüler von ihm war der deutsche Geiger Christian Ludwig Dieter.
Der Mailänder Nicolo Mestrino darf als einer der bedeutenderen Violinisten seiner Zeit bezeichnet werden. Auch als Komponist für sein Instrument war er tätig, obwohl, wie Fétis versichert, nicht alle unter seinem Namen gedruckten Musikstücke von ihm herrühren. Seine Jugendgeschichte ist unbekannt. Geboren 1748, war er anfänglich in Diensten des Fürsten Esterhazy, dann aber etwa um sein dreißigstes Lebensjahr in denen des Grafen Ladislaus d'Erdödy. 1786 besuchte Mestrino Paris und spielte im Concert spirituel, worauf er sich eine angesehene Stellung als Orchesterchef des Theaters Monsieur machte. Seine ausgezeichnete Befähigung für dieses Amt gab Veranlassung, ihn an die Spitze der 1789 gegründeten und, wie schon mitgeteilt wurde, von Viotti geleiteten italienischen Oper zu Paris zu stellen. Im September des folgenden Jahres aber schon ereilte ihn der Tod, und in seine Funktion trat Puppo.
Giuseppe Puppo, geb. 12. Juni 1749 in Lucca, gehört zu den wenigen namhaften, aus der neapolitanischen Schule hervorgegangenen Violinisten. Es wurde bereits wiederholt ausgesprochen, daß diese Schule bei weitem weniger ergiebig für das Instrumentenspiel war als für Gesang und Komposition. Von älteren Geigern, die dort ihre Ausbildung fanden, wäre hier nur noch Michele Mascitti, geb. am Schlusse des 17. Jahrhunderts, erwähnenswert. Dieser lebte viel auf Reisen in Italien, Deutschland und Holland und trat schließlich in die Dienste des Herzogs von Orleans. Seine Violinkompositionen, von denen Fétis 7 verschiedene Werke anführt, zeichnen sich durch prosaisches und ungemein trockenes Wesen aus. Hervorragender war jedenfalls Puppo. Zwar kann auch er keine sonderliche Geltung als Tonsetzer beanspruchen, allein als Violinist muß er Bedeutendes geleistet haben. Man rühmte seinem Spiel vorzugsweise einen von sanfter Melancholie erfüllten Ausdruck nach. Dieser scheint eine Hauptseite seines ganzen Wesens gebildet zu haben, dem überdies ein unsteter, beinahe abenteuerlicher Zug eigen gewesen sein mag.
Puppo gehörte zu jenen Naturen, denen es Bedürfnis ist, sich von Einbildungen beherrschen zu lassen. So glaubte er durch ein in London gegebenes Konzert ein reicher Mann geworden zu sein, der die Hände in den Schoß legen könne. Unbesorgt lebte er in den Tag hinein, solange das Geld ausreichte. Dann erst kam er wieder zur Besinnung und griff aufs neue zur Violine, um für seine materiellen Bedürfnisse zu sorgen. Eine andere selbstgeschaffene, durch Lahoussaye widerlegte Fiktion war die, sich einen Schüler Tartinis zu nennen, obwohl er nicht einmal in Padua gewesen war. Viotti pflegte ihn öfters mit seinem angeblichen Lehrmeister Tartini zu necken. Namentlich in Lahoussayes Gegenwart brachte er gern die Rede darauf und bat diesen dann, etwas in der Manier des Paduaner Meisters zu spielen, indem er hinzufügte: »Nun, Freund, gib recht acht. Lahoussaye wird Dir eine Idee von Tartinis Spiel geben.«
Nirgend fand Puppo lange Ruhe; er wechselte ebenso oft Stellung wie Wohnort. 1775 ging er nach Paris; von hier trieb es ihn nach Madrid, Lissabon und London. In letzterer Stadt blieb er bis 1784. Sodann nahm er seinen Aufenthalt wieder in Paris, wohin er durch Viotti zum Nachfolger Mestrinos an die italienische Oper berufen worden war. Als dieses Unternehmen bald darauf infolge der Revolutionsstürme einging, trat er zum Théâtre Feydeau hinüber. Sodann war er am Théâtre français de la République bis 1799 tätig. Endlich sah er sich auf das Lehramt angewiesen. Diese Position mochte ihm indessen nicht behagen; denn er entfernte sich 1811 unter Zurücklassung seiner Familie heimlich von Paris und wandte sich nach Neapel. Dort fand er am Theater S. Carlo eine Stelle als erster Geiger und zweiter Orchesterchef. Nach Verlauf einiger Jahre beabsichtigte der Impresario dieser Bühne, ihm außer seiner bisherigen Funktion auch die Direktion der Ballettmusik zu übertragen. Allein Puppos Künstlerstolz empörte sich über diese Zumutung, und in heroisch weltschmerzlichem Tone schrieb er unter den ihm vorgelegten Kontrakt statt seines Namens die Worte: » Fame e morte, si; ma ballo, no!« Die Folge dieser Resolution war, daß der Direktor von S. Carlo ihn des Dienstes entließ (1817). Sein Weg führte ihn nun seiner Vaterstadt Lucca zu; doch fand er hier ebensowenig ein Unterkommen wie in Florenz. Er hatte, bei freilich sehr vorgerücktem Alter, alle Lust zum Arbeiten verloren und geriet in Bedrängnis, von der ihn nur die Fürsorge eines Professor Taylor befreite, durch dessen Vermittelung er in einem Florentiner Hospital Unterkunft fand. Lange genoß er aber diese Wohltat nicht, da er schon im folgenden Jahre am 19. April verschied. Von seinen Kompositionen ist wenig bekannt.
Als ein indirekter Sprößling der Paduaner Schule ist Bartolommeo Campagnol, geb. 10. September 1751 in Cento bei Bologna, zu betrachten, da er den Unterricht zweier Schüler Tartinis, nämlich Don Paolo Guastarobbas und Nardinis genoß, nachdem er die erste Ausbildung durch einen Schüler Lollis, namens Dall' Ocha Seinen Namen sucht man vergeblich in den Handbüchern der Tonkünstler. Gerber führt nur eine Signora Vittoria dall' Occa an, die sich als Violinvirtuosin 1788 in Mailand hören ließ. empfangen hatte. In seinem zwölften Lebensjahre wurde er von seinem Vater, einem Kaufmann, der Lehre Guastarobbas in Modena übergeben. Hier förderte er gleichzeitig seine theoretische Ausbildung. Nach dreijährigem Kursus trat er 1766 in das Orchester seiner Vaterstadt. Doch schon zwei Jahre später verließ er dieselbe, um sich dem jungen Violinspieler Lamotta Über diesen fehlen gleichfalls alle Nachrichten. Man kennt nur einen Violinisten Lamotte (s. d. in dem Abschnitte über das deutsche Violinspiel). Es muß dahin gestellt bleiben, ob dieser mit Lamotta identisch ist. anzuschließen, dessen Talent ihn so sehr fesselte, daß er ihn bis Venedig und Padua begleitete. In letzterer Stadt pflog er dessen Umgang mehrere Monate lang und empfing dadurch mannigfache Anregungen für das eigene Studium. Sodann begab er sich 1770 nach Rom, ließ sich dort mit Beifall hören, wandte sich aber bald nach Faenza. In dieser Stadt verweilte er, gefesselt durch den Verkehr mit dem Kapellmeister und Violinspieler Paolo Alberghi Auch Alberghi ist in keinem der gangbaren Lexika verzeichnet. Vgl. S. 151., ein halbes Jahr. Hierauf nahm Campagnoli einen fünfjährigen Aufenthalt in Florenz, teils unter Nardinis Leitung studierend, teils selbst Schüler bildend. Auch war er dort im Pergolatheater Anführer der zweiten Violine. Denselben Dienst versah der Künstler weiterhin zeitweilig am Teatro Argentina in Rom. Von 1777 bis 1779 war er Konzertmeister beim Fürstbischof von Freisingen, reiste dann nach Polen und wurde auf seiner Heimkehr in Dresden vom Herzog Karl von Kurland engagiert. 1783 unternahm er eine Reise nach dem nördlichen Europa, die ihn bis Stockholm führte. Hier verweilte er drei Monate und erwarb die Mitgliedschaft der königl. Akademie. Nach erfolgter Rückkehr unternahm er von Dresden aus 1784 eine Reise in sein Vaterland, hielt sich dann wieder in Deutschland auf und ging 1788 abermals nach Italien. Dieses unbeständige Leben hörte für Campagnoli auf, als er 1797 das Konzertmeisteramt bei den Leipziger Gewandhauskonzerten übernahm; denn mit Ausnahme einer Reise nach Paris (1801) widmete er sich ohne Unterbrechung seinem Wirkungskreise, bis er im Jahre 1818 Leipzig infolge einer Berufung als Musikdirektor nach Neustrelitz verließ. Hier starb er am 6. November 1827.
Die vorhandenen Mitteilungen über Campagnolis Violinspiel lauten dahin übereinstimmend, daß dasselbe sich nicht sowohl durch Größe des Stils, als vielmehr durch Sauberkeit der Tonbildung und Intonation, sowie durch gewandte Beherrschung des Griffbretts auszeichnete. Spohr, welcher ihn 1804 in Leipzig hörte, sagt von ihm: »er spielte ein Konzert von Kreutzer sehr brav. Seine Methode ist zwar veraltet, er spielt aber rein und fertig«. Wenn man aus diesen und andern Bemerkungen einerseits den Schluß folgern darf, daß Campagnoli von den namentlich durch Viotti bewirkten Wendungen des Violinspiels unberührt geblieben war, so ist andererseits nicht zu verkennen, daß er auch kein reiner Repräsentant der Paduaner Schule mehr war, welche großen Ton und breite, schwere Bogenbehandlung forderte. Doch stützte er sich bei Abfassung seiner Schule teilweise auf die Lehre Nardinis, wie er ausdrücklich in der Vorrede zu derselben bemerkt. Diese Schule, welche unter dem Titel » Nouvelle Méthode de la Mécanique progressive du jeu de Violon« etc. erschien, enthält eine Menge Notenbeispiele und Etüden, in denen schätzbares Übungsmaterial niedergelegt ist. Bemerkenswert sind für jene Zeit die Abhandlungen über das Spiel auf einer Saite, sowie über die Flageolettöne. Die Prinzipien, welche Campagnoli in betreff seiner Materie entwickelt, sind unanfechtbar; denn sie gründen sich auf jene Elemente des Violinspiels, die als die wahren bereits lange vor ihm festgestellt waren. Der von ihm befolgte Lehrgang dagegen ist für ein derartiges Studienwerk nicht methodisch genug. Zudem erscheint der Umstand, daß sämtliche Übungsstücke vom Autor selbst herrühren, als wesentlicher Fehler, weil dadurch Monotonie und Einseitigkeit erzeugt werden. Übrigens ist Campagnolis Violinschule, wie auch das, was er als Tonsetzer für sein Instrument geschrieben (einige Sonaten und Duetten), niemals zu großer, allgemeiner Anerkennung gelangt. Der Grund für diese Erscheinung kann kaum in etwas anderem als in der mittleren Güte seiner Arbeiten gesucht werden D. Alard hat in den » Maîtres classiques du Violon« vier Präludien und zwei Fugen von Campagnoli für Violine solo neu herausgeben..
Der auf deutscher Erde geborene Violinist und Komponist Federigo Fiorillo, ein Sohn des Neapolitaners Ignazio Fiorillo, welcher Kapellmeister in Braunschweig und weiterhin in Kassel war, kam 1753 in erstgenannter Stadt zur Welt. Er machte seine ersten musikalischen Versuche auf der Mandoline; dann widmete er sich dem Studium der Geige. Unter wessen Leitung dies geschah, ist zweifelhaft. Im Jahre 1780 ging er nach Polen, und um 1783 war er Musikdirektor in Riga. Hier blieb er zwei Jahre. 1788 ließ er sich, nachdem er im Concert spirituel zu Paris aufgetreten war, in London nieder. Dort scheint et mit seinem Violinspiel nicht durchgedrungen zu sein; denn er war genötigt, 1794 als Bratschist im Salomonschen Quartett mitzuwirken. Auch deutet hierauf der Umstand, daß er London bald verließ, um sich in Amsterdam niederzulassen. Sein Todesjahr ist nicht bekannt.
Sehr tätig war Fiorillo als Tonsetzer in verschiedenen Gebieten der Instrumentalkomposition. Von allen seinen Werken, deren vollständiges Verzeichnis sich bei Fétis findet, haben ihn nur seine 36 Violinkapricen überlebt, welche als höchst wertvolle Etüden noch heute allgemein geschätzt sind. Dieses Werk erschien in mehreren Ausgaben. Spohr schrieb zu demselben eine zweite begleitende Violine und A. Tottmann eine Klavierbegleitung.
Alessandro Rolla, geb. am 22. April 1757 zu Pavia, gest. am 15. September 1841 zu Mailand, war ursprünglich Klavierspieler, ging dann aber zur Violine über, auf welcher er Schüler eines gewissen Renzi, sowie des Violinisten Giacomo Conti war. Dieser letztere gehörte 1790 der kaiserl. Kapelle in Petersburg an, war aber später (etwa ums Jahr 1793) Direktor bei der italienischen Oper in Wien. Dort starb er 1804.
Rolla hatte als Violinspieler in seinem Vaterlande einen geachteten Namen, den sein Sohn Antonio, der ehemalige Dresdner Konzertmeister, geb. 18. April 1798 zu Parma, gest. 19. Mai 1837, auch in Deutschland bekannt machte. 1782 war Rolla, der Vater, in Parma, 1802 wurde er Orchesterdirektor am Theater della Scala und 1805 Lehrer des Violinspiels beim Konservatorium zu Mailand.
Einer seiner besten Schüler war Bernardo Ferrara, geb. 7. April 1810 zu Vercelli. 1821 begab er sich nach Mailand, um auf dem dortigen Konservatorium zu studieren, hauptsächlich aber, um unter Rollas Leitung das Violinspiel auszubilden. 1830 war er erster Violinist am Theater Carcano zu Mailand, 1835 Orchesterdirektor der Kapelle zu Parma. Ein Jahr später wurde er als Lehrer des Violinspiels am Mailänder Konservatorium der Nachfolger seines Lehrmeisters. Gesundheitsrücksichten nötigten ihn, 1861 ins Privatleben zurückzukehren. Sein Todesjahr ist nicht bekannt.
Als Zeitgenossen Pugnanis und Viottis sind Gaetano Vai, aus Chieri gebürtig, und Giacomo Conti zu nennen. G. Vai war lange Zeit als geschätzter Violinspieler in Paris und Genf tätig. Später ließ er sich in Asti nieder und bekleidete dort das Amt eines ersten Violinisten bei der städtischen Kapelle. Eine ihm angetragene Stellung in der königl. Kapelle zu Turin lehnte er ab, weil er die Unabhängigkeit vorzog. Regli rühmt ihm große Sauberkeit der Intonation und Präzision des Vortrags, sowie ein ungewöhnliches Improvisationstalent nach. Über sein Geburts- und Todesjahr sind keine Nachrichten vorhanden.
G. Conti war nach Gerbers Mitteilungen 1790 als erster Violinist sowohl in der kaiserl. russischen, wie in der fürstl. Potemkischen Kapelle tätig. Seit 1793 lebte er dann als Direktor des italienischen Opernorchesters in Wien. Dort ließ er auch verschiedene Violinkompositionen, bestehend in Solos, Konzerten und Duetten drucken. Er starb 1804 in Wien.
Ein weiterer namhafter Violinist in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war Giuseppe Giorgis, geb. 1777 in Turin. Er war Schüler eines gewissen Colla und nicht, wie mehrfach angegeben, Viottis. Zu Anfang des vorigen Jahrhunderts (1807) trat Giorgis in Paris auf. Dann war er Mitglied der Kapelle des Königs Jerôme von Westfalen. Doch büßte er diese Stellung infolge der Ereignisse von 1813 ein. Nach mehrfachen Reisen fand er 1820 Anstellung im Orchester der komischen Oper zu Paris, trat aber schon 1834 in Ruhestand.
Bereits bei früherer Gelegenheit wurde gesagt, daß als Ausgangspunkt des violinistischen Virtuosentums ein Werk von Pietro Locatelli zu betrachten sei (S. 103).
Wenn man sich vergegenwärtigt, daß Locatelli ein direkter Schüler von Corelli war, so berührt es merkwürdig, daß fast gleichzeitig mit der ersten bedeutsamen Entwicklung des Solo-Violinspiels auch die ersten Grundlinien der Schattenseite dieser Kunst gezogen wurden; merkwürdiger aber noch, daß dies ein Mann unternahm, der in der Mehrzahl seiner Kompositionen, wie wir sahen, durchschnittlich nicht nur als ein ruhiger, besonnener Kunstbürger, sondern in einzelnen Werken sogar als wohlempfindender, achtbarer Musiker erscheint.
Das in Betracht kommende Werk Locatellis, sein Op. 3, ist betitelt: » L'arte di Violino. XII Concerti cioè, violino solo con XXIV Capricci ad libitum ... Violino primo, Violino secondo, Alto, Violoncello solo e Basso. opera terza. Amsterdam.« Die 24 Capricci, von denen hier die Rede ist, waren dazu bestimmt, gleich einer sehr ausgedehnten Kadenz, am Schlüsse der einzelnen Konzertsätze vom Solisten gespielt zu werden. Zu jedem der zwölf Konzerte gehören zwei derselben.
Die Sitte selbst bürgerte sich bereits gegen Ende des 17. und im Anfang des 18. Jahrhunderts ein. Doch wurden die Kadenzen oder Capricci im allgemeinen dem Improvisationstalent des Spielers überlassen, obwohl gelegentliche Ausnahmen, z. B. bei Vivaldi Schering, Geschichte des Instrumentalkonzerts, S. 111. vorkommen. Indem nun Locatelli in seinem genannten Werk eine förmliche Sammlung ausgearbeiteter und höchst virtuosenhafter Erzeugnisse dieser Art schuf und gedruckt hinterließ, sicherte er sich in der Geschichte des Violinspiels ein Gedächtnis, freilich ein solches von einigermaßen zweifelhafter Beschaffenheit. Denn während seine sämtlichen andern Werke einer frühen und nach dem Zeugnis älterer wie neuerer Musikforscher nicht ungerechten Vergessenheit anheimfielen, gaben die 24 Capricci, wie wir sehen werden, selbst für Paganini einen Anknüpfungspunkt ab.
Die Capricci selber sind etüdenartige Musikstücke, in denen neben verwertbarem Material eine Fülle schwierigster Aufgaben für das Fingerheldentum der Violine angehäuft ist. Diesen Zweck verfolgt Locatelli so rücksichtslos, daß er darüber alle höheren künstlerischen Forderungen außer Augen läßt. Daß der formelle Bau der Musikstücke lose, mosaikartig ist, begreift sich aus ihrer Bestimmung, eine Art äußerst ausgedehnter Kadenzen zu bilden. Aber auch der Inhalt ist künstlerisch reiz- und bedeutungslos. Gewisse Passagen wechseln in monotoner, unvermittelter Folge miteinander ab. Dabei sucht der Komponist die äußersten Grenzen des Instrumentes auf; ja, er überschreitet diese Grenzen, und nicht befriedigt davon, ergeht er sich in den halsbrechendsten Kombinationen des mehrstimmigen Spiels, völlig unbekümmert darum, ob das, was er ersonnen, sich durch eine künstlerische Idee oder doch wenigstens durch eine gute violingemäße Klangwirkung rechtfertigt Acht der Capricci sind von C. Willing bei Holle in Wolfenbüttel herausgegeben worden, ein » Labyrinth de l'harmonie« von D. Alard in den » Maîtres classiques du Violon«. – Das ganze Werk erfuhr kürzlich unter dem übersetzten Titel » l'Art du Violon« eine Neuausgabe von Edouard Nadaud (bei Costallat & Cie., Paris)..
Es soll nicht bezweifelt werden, daß die Förderung der Technik durch Stellung ungewöhnlicher Aufgaben bedingt ist; aber keinesfalls darf darunter die Natur des betreffenden Organs bis zur Unkenntlichkeit leiden wie bei Locatelli. Beispielsweise nur ein paar Proben:

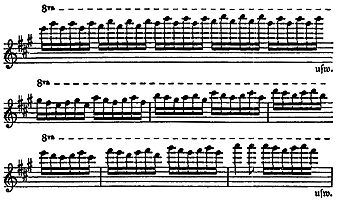
Vorstehendes gehört ohne Frage in den Bereich der Charlatanerie. Die Interpretin des Instrumentalgesanges wird hier zu einer Quälmaschine für Fingerdressur, Handverrenkungen und Gehörsnerven herabgewürdigt, und der Grundcharakter der Violine ist damit vernichtet. Die beiden letzteren Beispiele, darf man sonder Scheu als Ausbrüche einer narrenhaften Phantasie bezeichnen. Man wird bei denselben eher an alles andere als an Musik erinnert.
Konnte Locatelli sich sobald von der klassischen Lehre Corellis emanzipieren, so darf man sich wahrlich nicht über die Ausschreitungen wundern, denen weiterhin andere Violinisten anheimfielen. Und wenn er im Hinblick auf die technische Handhabung der Violine sicher eine ungewöhnliche Erscheinung war, so muß doch hervorgehoben werden, daß gerade denjenigen seiner Arbeiten, durch die er sich von den Zeitgenossen hauptsächlich unterscheidet, maß- und geschmackvolle Behandlung mangelt, wie auch bereits frühere Beurteiler tadelten. Burney gibt an, daß Locatellis Kompositionen mehr Erstaunen erregten als Genuß erweckten, wobei er wahrscheinlich zunächst das besprochene Werk im Auge hatte.
Freilich zeigt die Violinliteratur des 18. Jahrhunderts deutlich, daß Locatelli mit den 24 Capricci nur in vereinzelten Fällen und erst verhältnismäßig spät Einfluß gewann. Der Entwicklung des Violinspiels war durch Corelli und die ihm folgenden Meister im ganzen und großen zunächst eine andere Bahn vorgezeichnet. Es fehlte im allgemeinen noch an hinreichendem Zündstoff für das blendende und täuschende Brillantfeuerwerk des absoluten Virtuosentums, dem wir später als einer in gewissem Sinne wohl erklärlichen Ausgeburt der Kunst begegnen. Vielmehr war es ein anderer Violinist, der wenige Jahrzehnte später, der allmählich sich verändernden Zeitströmung folgend und sie seinerseits steigernd, den Beginn der virtuosen Epoche des Violinspiels ankündigt, ein weit schlechterer Musiker als Locatelli, aber zweifellos ein bedeutender Violinakrobat: Antonio Lolli.
Zwischen Locatelli und Lolli besteht der große Unterschied, daß der erstere insbesondere als Tonsetzer und auch hier nur in einem seiner Werke virtuose Zwecke befolgte, während Lolli vom Podium aus seine bravurösen Leistungen von Petersburg bis Sizilien und von Wien bis Paris und London dem entzückten Publikum vorführte. Damit mag auch zusammenhängen, daß Lolli – anders wie Locatelli – sofort Nachahmer fand, wofür nur auf Giornovicchi, Woldemar, Alexander Boucher, Scheller und Durand hingewiesen sei, die uns insgesamt später begegnen werden.
Im allgemeinen zwar stand bei Lollis Auftreten das Violinspiel noch wesentlich unter der Botmäßigkeit der Corelli-Tartinischen Kunst, deren Zielpunkt nichts weniger als das Virtuosentum, sondern vielmehr ein gediegenes, durch Wesen und Bedeutung der Kirche beeinflußtes Musikertum war. Allein schon machten sich gegen Mitte des 18. Jahrhunderts hier und da Anzeichen eines andern Geistes bemerkbar, jenes Geistes, welcher von den idealen Forderungen der Kunst sich entfernend, mit Hingebung für äußere Effekte und persönliche Erfolge arbeitet. Eine derartige, unverkennbar auf virtuose Gelüste hindeutende Tendenz offenbart bereits Giardinis übel belohnte Sucht Vgl. S. 153., in den Arienritornellen der Opern als Improvisator und Solospieler glänzen zu wollen. Ein ähnliches Beispiel zeigt der Engländer Matthiew Dubourg S. denselben S. 103 d. B., ein Schüler Geminianis, welcher, wie hier nachträglich mitgeteilt sei, in einer Arie Händels eine so maßlose Kadenz einlegte, daß der ungeduldig gewordene Komponist sich am Schlusse derselben zu dem sarkastischen Zuruf: »Willkommen zu Hause, Herr Dubourg« veranlaßt fand.
In der Kirche freilich, welche früher hauptsächlich der Schauplatz für das öffentliche Wirken der Soloviolinisten gewesen war, fanden derartige Bestrebungen, wo sie auch immer zutage treten mochten, keinen günstigen Boden. Hier beherrschten, wenigstens vor der Hand, die tonangebenden Meister einer klassischen Richtung nicht allein das Terrain, sondern es fehlte auch an allen offenen Kundgebungen der zur Andacht versammelten Menge, an jenen Beifallsbezeigungen nämlich, welche so leicht geeignet sind, die Künstlereitelkeit herauszufordern und in ihren Extravaganzen zu bestärken. Begünstigender wirkte in dieser Hinsicht schon das Theater, dessen Szene indessen immer ein nicht völlig zu überwindendes Gegengewicht zu den etwaigen Übergriffen der Instrumentalmusik bildete. Als aber gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts in Paris und London Institute zur ausschließlichen Pflege der Tonkunst entstanden, als sich dort den Sängern und Solospielern Konzertsäle eröffneten, in welchen die Stimme des Publikums nicht nur unbehindert erscholl, sondern auch zu einer bedenklichen Macht wurde, da wucherte die Schmarotzerpflanze des Virtuosentums, für deren süßes Gift selbst ein Viotti hinsichtlich seiner Beziehungen zum Publikum nicht ganz unempfänglich blieb, schnell empor.
So lassen sich denn bald nach Mitte des 18. Jahrhunderts zwei nebeneinander hergehende, streng gesonderte Richtungen des Violinspiels erkennen und bis auf die Neuzeit herab verfolgen. Die eine, im gediegenen Musikertum wurzelnde – wir nennen sie die musikalisch künstlerische – legt den Accent wesentlich auf geistige Wirkungen, auf den Ausdruck eines Kunstideals; die andere hingegen, die virtuose, erhebt das Mittel – die Technik – zum letzten Kunstzweck und ist vorzugsweise bestrebt, durch das Raffinement äußerer, die Sinne blendender Effektmittel um die Gunst des Publikums zu buhlen und persönliche Erfolge zu erringen. Diese Kennzeichen charakterisierten das ungebührlich sich hervordrängende Virtuosentum sogleich bei seinem Entstehen. Unersättliche Ruhmes- und Beifallsbegierde waren damals wie auch später die Losungsworte für das Gros der ausübenden Künstler: ja es wurde sogar, wie die weitere Darstellung zeigen wird, gebräuchlich, zur Befriedigung persönlicher Eitelkeit und lächerlichen Ehrgeizes förmlich um die Palme des Vorranges angesichts des Publikums zu streiten, einander in öffentlichen Wettkämpfen zu überbieten. Die inzwischen ansehnlich erweiterte Technik des Violinspiels bot dazu in der ausgedehnteren Anwendung der Flageolettöne, des Staccatos, der Terzen- und Oktavengänge, sowie in der rücksichtsloseren Benutzung der höheren Griffbrettlagen zahlreiche verführerische Hilfsmittel. Was hiervon etwa nicht im Verlaufe des vorgetragenen Musikstückes verwertet werden konnte, wurde in der Schlußkadenz (dem vorhin besprochenen Capriccio) zur Schau gestellt. Wie aber diese Kadenzen beschaffen waren, darüber gibt Dittersdorf in seiner Lebensbeschreibung Aufschluß. Er sagt dort (S. 47): »Kadenzen waren damals gäng und gäbe, aber blos in der Absicht, damit der Virtuos seine Geschicklichkeit, aus dem Stegreif etwas hervorzubringen, zeigen konnte. Nachher aber kam man davon ab, vermutlich deswegen, weil durch die Ungeschicklichkeit des Tonkünstlers manchmal das, was er im Konzerte selber gut vortrug, bey der Kadenz wieder verhunzt ward. Dagegen aber entstand eine neue Sitte, die ich nur beym Fortepiano und an Männern, wie Mozart, Clementi und andern großen schöpferischen Genies leiden mag, die, um durch das sogenannte Fantasieren ihre schnelle Erfindungskraft zu zeigen, in ein simples Thema übergehen, das sie alsdann nach allen Regeln der Kunst einigemal variiren. Da fanden sich denn aber sehr bald eine Menge kleiner Männerchen, die das alles wie die Affen nachmachten, und jetzt ist die Variir- und Fantasirsucht so allgemein, daß man überall, wo man in Konzerten ein Fortepiano anschlagen hört, gewiß sein darf, mit verkräuselten Thematen regalirt zu werden. Und es wird einem nun gar übel, wenn man unbärtige Burschen Unternehmungen, worauf sich nur Meister einlassen sollten, waghalsen hört, und man möchte davonlaufen, wenn man ihre mit Katzensprüngen und anderem tollen Zeuge angefüllten unreifen Hirngeburten mit ansehen muß. Wie ärgerte ich mich, als ich vor einigen Jahren einen Dulon mit seiner Flöte hintreten sah, und sein Fantasiren mit anhörte, in welchem er, mit meinem ehrlichen krummbeinigten Hausknecht zu reden, allerhand Schnirkel und Kribrefax herdudelte und mit Variationen – nota bene – ohne irgend ein Accompagnement endigte!« –
Das Virtuosentum ist einerseits ebenso oft verurteilt als andrerseits mit jubelndem Beifall belohnt worden. Beide Tatsachen stehen schroff einander gegenüber und lassen keine Vermittelung zu, da die Gründe ihrer Erscheinung durchaus entgegengesetzter Natur sind. Das beifallspendende Publikum richtet sich nach momentanen Eindrücken, nach dem größeren oder geringeren Behagen, welches bei ihm durch eine Leistung erregt wird, und es mag sich immerhin zu Gunsten einer Sache erklären, die ihm Unterhaltung und angenehme Zerstreuung gewährt oder auch bewunderndes Staunen ablockt. Allein hiermit ist weiter nichts erwiesen als die Existenz eines beifällig Aufgenommenen. Einen sichern Maßstab der Beurteilung ergibt erst die ruhige, vom künstlerischen Standpunkt aus unternommene objektive Betrachtung. Und hier ist die unbedingte Verwerfung des Virtuosentums als Selbstzweck geboten. Nicht als ob die ausübende Tonkunst einer technisch virtuosen Durchbildung entraten könnte. Im Gegenteil, je vollendeter diese letztere ist, desto reiner und vollkommener wird auch die Wirkung des dargestellten Kunstwerkes sein. Doch darf das virtuose Element aus seiner sekundären Stellung als Diener der Kunst nicht heraustreten; immer nur soll es Mittel zum Zweck sein. In diesem Sinne wirkten die hervorragenden Meister des Violinspiels – wir erinnern nur an Viotti, Rode, Kreutzer, Spohr – als eigentliche Träger der Entwicklung und des Fortschrittes; ihre auf uns gekommenen Werke bezeugen es. Sie verschmähten es, die ihnen zu Gebote stehende virtuose Technik um ihrer selbst willen auszubeuten, und ordneten sie vielmehr dem höheren Kunstzweck unter. Das absolute Virtuosentum, welches umgekehrt verfährt, erscheint hiernach wie eine Anomalie. Wirklich ist es in seiner Selbstverherrlichung auch eine Entartung des Musikertums, dem es schielend zur Seite steht. Diese Wahrheit kann keineswegs durch den Einwurf entkräftet werden, daß das Virtuosentum Anteil an der Entwicklung der Technik hat, zumal dieser Anteil sehr relativer Natur ist; denn nur bedingungsweise waren und sind die technischen Errungenschaften des Virtuosentums für die Kunst verwertbar. Im engsten Zusammenhange hiermit steht der Umstand, daß unter den zahlreichen Vertretern des exklusiven Virtuosentums kein einziger eine epochemachende Schule gebildet hat. Dies vermochten nur jene Klassiker des Violinspiels, deren künstlerische Bildung in dem tüchtigen gediegenen Musikertum wurzelt. Sie schufen, ausübend und produzierend, den Kanon des Violinspiels, auf dessen unverrückbarer Basis diese Kunst bis heutigen Tages ruht, während die Repräsentanten des Virtuosentums gleich Meteoren nur wenige für das Gedeihen der Kunst bemerkenswerte Spuren ihrer Tätigkeit hinterließen. Die einseitige Bevorzugung der Technik hielt sie fern von jeder künstlerischen Vertiefung, und es ist charakteristisch für die Vertreter dieser Richtung, daß sie keine guten Musiker sind.
Dieser Mangel wird vorzugsweise und von allen Seiten übereinstimmend an Lolli hervorgehoben. In Fétis' » Biographie universelle« heißt es geradezu von ihm: »Er war ein schlechter Musiker, der keinen Takt hielt, und dem es selbst schwer wurde, in dieser Beziehung seinen eigenen Kompositionen gerecht zu werden.« Mehr noch zeigte sich dies bei fremden Kompositionen. Gerber berichtet: »In England kam er in außerordentliche Verlegenheit, als ihm der Prinz von Wales ein Quartett von Haydn vorlegte. Als er nach mancherlei Entschuldigungen wie gezwungen wurde, die Partie zu übernehmen, so erstaunte man nicht wenig, als man sahe, daß er gar nicht fortkommen konnte.« Hiermit übereinstimmend sagt sein Biograph in der Allg. mus. Ztg. vom Jahre 1799 (Nr. 37): »Lolly war im engsten Sinne des Wortes kein Musiker; weil er nur seine Geige praktisch, aber nie wahre Musik theoretisch studiert hatte. Im Adagio konnte Lolly nicht gefallen. Er überlud es allzusehr mit Verzierungen; auch waren seine Adagios alle kurz, als wenn er seine Schwäche in diesem Falle gefühlt hätte. Als Ripienist im Orchester war Lolly nicht zu gebrauchen. Er las mit Mühe vom Blatt weg, rupirte das Tempo und mußte seine Verzierungen einschalten.«
Daß Lolli als Musiker alles zu wünschen übrig ließ, geht unzweifelhaft aus seinen Kompositionen hervor. Dieselben enthalten meist völlig gedanken- und charakterlose, aus leeren, trivialen Phrasen zusammengesetzte Musikstücke. Man wird ihnen kein Unrecht tun, wenn man sie der Hauptsache nach den unwürdigsten, gesinnungslosesten Produkten der Geigenliteratur des 18. Jahrhunderts beigesellt Eine Sonate (VI) in Alards » Maîtres classiques du Violon«.. Geschmacklos überladene Passagen, Figuren und Rouladen spielen die Hauptrolle darin; sonst erinnert die Behandlung des Instruments in technischer Beziehung sehr entschieden an das moderne Virtuosentum. Lolli sucht, gewissermaßen mit Locatelli wetteifernd, die äußersten Grenzen der Violine auf, um sein Publikum zu verblüffen. Übrigens waren die urteilsfähigen Zeitgenossen über die Beschaffenheit seiner Machwerke sehr wohl orientiert. Burney bemerkt, »sein Kompositionsstyl sei so bizarr gewesen, daß der größere Teil seiner Zuhörer ihn als Narren betrachtet habe«. Sein schon erwähnter Biograph aber berichtet folgendes: »Als Komponist war Lolly gar nichts. Er hatte nicht einmal einen richtigen Begriff von Harmonie; Generalbaß und Theorie waren ihm ganz fremd. Er schrieb seine Ideen und Passagen nieder, ohne sich darum zu bekümmern, ob er aus dem Es moll ohne Vorbereitung ins E dur über und eben auf diese Weise ins Es dur zurück ging (seine gestochenen Arbeiten sind alle von anderen umgearbeitet), wenn nur die Passage brillant für sein Spiel war. Nun bat er einen Freund, ihm die Stimmen unterzulegen, mit dem ausdrücklichen Verbot, keine Note der Oberstimme zu verrücken. Das war gewiß eine peinliche Arbeit; daher kam es, daß seine Konzerte – vermutlich absichtlich, immer fehlerhaft ausgeschrieben waren, um auch diese Blöße zu decken; denn das beste Orchester mußte ihn nach dem ersten Ritornell ganz Solo spielen lassen, wenn man nicht ein Katzengeheule hören wollte. Beim zweiten und dritten Tutti und beim Schluß fand man sich, natürlich dem Gehör nach, wieder zusammen. Er tischte daher meist Solosonaten auf, in denen er mehr im Geleise blieb, sich nur selten hören ließ, und seine unsinnigen Übergänge, von denen eben geredet wurde, vermied. Hier ging er aber zu furchtsam zu Werke. Mit aller, sein Instrument und eigentümliches Spiel erhebender Phantasie und Läufen, oder andern Sätzen, hob er sich selten über die Quinte hinweg, die er zur Abwechselung oft ins Moll übertrug Hier, wie auch schon vorher, wird der Berichterstatter in seinen Mitteilungen unklar. Statt Quinte ist wohl Dominante zu setzen., und trillerte dann monotonisch seine Phantasien fort, die demohngeachtet, seines künstlichen Spieles wegen, auffallend gefielen. Hier war es nun leicht, Trommelbässe unterzulegen, aber freilich keine duetten mäßige Imitationen oder gar kanonische oder kontrapunktische Sätze für den begleitenden Violoncello, welche des Altvater Benda Violinsonaten für den Kenner verewigen.«
Je weniger Geltung Lolli als Musiker und Tonsetzer genoß, desto mehr Aufsehen erregte er als Virtuos im Allegrospiel. Wir geben auch hierüber die Urteile seiner Zeitgenossen unverkürzt, unter denen Schubart (ges. Schriften Bd. 5, S. 69 ff.) zunächst zitiert sei. Nachdem er ihn in seiner exzentrischen Ausdrucksweise als den »Shakespeare« unter den Geigern bezeichnet, sagt er: »Er vereinigte die Vollkommenheiten der Tartinischen und Ferrarischen Es muß daran erinnert werden, daß Ferrari ein Schüler Tartinis war und nie eine eigene Schule gegründet oder gebildet hat. Dies hat Schubart offenbar nicht gewußt. Schule nicht nur in sich, sondern fand noch einen ganz neuen Weg. Sein Bogenstrich ist unnachahmlich. Man glaubte bisher, geflügelte Passagen ließen sich nur durch einen kurzen Strich ausdrücken; er aber zieht den ganzen Bogen, so lang er ist, die Saiten herunter, und bis er an die Spitze desselben ist, so hat der Hörer schon einen ganzen Hagelsturm von Tönen gehört. Über das besitzt er die Kunst, ganz neue, noch nie gehörte Töne aus seiner Geige zu ziehen. Er ahmet alles bis zur äußersten Täuschung nach, was im Thierreiche einen Ton von sich giebt ( sic!). Seine Geschwindigkeit geht bis zur Zauberei. Er stößt nicht nur Oktaven, sondern auch Decimen mit der höchsten Feinheit ab, schlägt den doppelten Triller nicht nur in der Terze, sondern auch in der Sexte; und schwindelt in den höchsten Luftkreis der Töne hinauf, so daß er oft seine Konzerte mit einem Ton endigt, der das non plus ultra der Töne zu sein scheint.« An einer andern Stelle sagt Schubart: »der größte Virtuos – unter allen mir jemals bekannt gewordenen, der größte war Lolly, der starke unerreichbare Geiger.«
Ähnlich urteilt der schon wiederholt zitierte Biograph Lollis. Er nennt ihn »einen der ersten Violinspieler, die je aus Welschland auf deutschen Boden verpflanzt worden sind. Sein Oktavengang auf dem mißlichen Instrumente war so rein, als wenn er auf dem bestgestimmten Klavier abgespielt worden wäre. Die gefährlichsten Sprünge von der Tiefe zur äußersten Höhe waren ihm Kinderspiel, und da wirbelte er in hundert verschiedenen schattierten Passagen herum, als wenn die Geige für seine linke Hand erfunden wäre, und die rechte entsprach ganz ihrer linken Schwester. Das war nicht die moderne Führung des Bogens, wo man seine Wirkung in abgestutzten, hüpfenden Strichen zu finden glaubt, und den langen, schmelzenden Zug desselben, der der Singstimme ihren Wohlklang ablugt, vernachlässigt; weil die meisten jungen Virtuosen im Voltigieren mehr gethan haben, um sich etwas darauf zu Gute zu thun, dem Großvater über den Kopf hinwegzuspringen. Lollys Vortrag war nicht so. (Ich rede hier lediglich vom Allegro.) Seine Intonation ist nicht zu übertreffen und der Ton, den er der Geige abzulocken wußte, war so unnachahmlich schön, daß man wechselsweise eine Tenor- oder Sopranstimme, eine Hoboe und Flöte zu hören glaubte. Sein Triller blieb sich auch in doppelten (?) Terzen gleich. Claudius, der Wandsbecker Bote, sagt 1772 über ihn (hier zitiert der Berichterstatter aus dem Kopf), lieber Vetter Asmus! wenn er doch den Mann gehört hätte! Sieht er! Der Mann hat zehn Finger an der linken Hand und fünf Bogen in der rechten Hand. – Ich kann es ihm nicht besser beschreiben, als: stelle er sich zwei recht geübte Schlittschuhläufer vor, die in kräuselnden Figuren pfeilschnell umeinander herumfliegen.«
Die vorstehenden Mitteilungen zeigen zur Genüge, welches Staunen Lollis unerhörte Art, die Violine zu behandeln, erregte. Die Keckheit und Neuheit seiner Spielart mußte um so bestechender wirken, je weniger man auf eine derartige Erscheinung vorbereitet war. Und doch behielt man Besinnung genug, dem Virtuosen zuliebe nicht den wahren künstlerischen Standpunkt preiszugeben. Offen bezeichnete man seine Achillesferse und hieß ihn einen »schlechten Musiker«. Gewiß, wenn wir auch bei Lolli, den Kaiser Joseph II. im Vergleich zu andern Geigern der damaligen Zeit wohl sehr bezeichnend einen »Faselhans« nannte S. Dittersdorfs Selbstbiographie., eine eminente Leistungsfähigkeit voraussetzen, so kann uns dies im Hinblick auf die Berichte seiner Zeitgenossen doch nicht von der Annahme abhalten, daß er in der Hauptsache die Violine, das Instrument des Gesanges, zu einem Turnapparat für Finger und Bogen herabgewürdigt hatte. Trotz seiner vielbewunderten Technik vermochte er nicht einmal ein Adagio vorzutragen, und als er einst gebeten wurde, ein solches zu spielen, schlug er es lachend mit den Worten ab: »Ich muß Ihnen sagen, daß ich aus Bergamo gebürtig bin. In Bergamo sind wir alle geborene Narren, und ich bin einer von den vornehmsten daraus S. Gerbers Tonkünstlerlexikon..« Ist es nicht wahrhaft tragikomisch, zu sehen, wie der Mann, bemüht durch Selbstironie seine künstlerische Blöße zu decken, sich sein eigenes Urteil sprach?
Lollis äußere Existenz war ganz seiner virtuosen Richtung entsprechend. Er führte, wie uns berichtet wird, ein unstetes, dissolutes Leben, frönte der Leidenschaft fürs Spiel, brachte Cytheren übertriebene Opfer und gab sich leichtsinniger Verschwendung hin. Die letztere Eigenschaft äußerte sich namentlich auch durch den mit Schmucksachen getriebenen Luxus. Zudem durften Livreebediente und eigene Equipage nicht fehlen. Übrigens wird er als ein schöner Mann von angenehmem Wesen und geselliger Tournüre geschildert. Dittersdorf, dem er persönlich bekannt war, nennt ihn sogar einen vollkommenen, im Umgange bescheidenen, artigen und jovialen Weltmann. Zu seinen Gunsten spricht jedenfalls die ihm nachgerühmte Eigenschaft, daß er anderen Künstlern volle Gerechtigkeit widerfahren ließ.
Über Lollis Bildungsgang sind keine Nachrichten vorhanden. Man kennt nicht einmal mit Bestimmtheit sein Geburtsjahr, welches zwischen 1728 und 1733 schwankt (sein Geburtsort ist Bergamo) und nimmt an, daß er sein eigener Lehrmeister auf der Violine gewesen sei. 1762 trat er in die Dienste des Herzogs von Württemberg, bei dem er mit Nardini gleichzeitig als Sologeiger engagiert war. Gegen Ende 1773 begab er sich nach Petersburg, wurde angeblich der Günstling Katharinas II., zog aber 1778 schon wieder gen Süden. Im folgenden Jahre erschien er in Paris und trat mit großem Erfolg im Concert spirituel auf, wo er auch 1764 bereits gespielt hatte; 1785 wandte er sich nach London. Hier verschwand er plötzlich, um in Italien wieder aufzutauchen. Dann trat er 1791 wieder in Berlin, 1793 in Palermo, 1794 in Wien und 1796 in Neapel auf. In Palermo fand er 1802 sein Ende.
Lolli hinterließ der musikalischen Welt zwei Schüler, Woldemar und Giornovicchi, die, wie Fétis meint, kaum geringere Narren waren als ihr Lehrer. Über den zweiten derselben mögen hier im Anschluß an Lolli sogleich die notwendigen Mitteilungen erfolgen, da seine Einordnung an anderer Stelle wegen zweifelhafter Nationalität unmöglich erscheint.
Jean Mane Giornovicchi Pohl (Mozart und Haydn in London) schreibt: Jarnowick ist nur eine Verstümmelung seines Namens, die sich das Publikum zu Schulden kommen ließ und gedankenlose Biographen nachschrieben. Er selbst nennt sich stets Giornovicchi. (auch Jarnowick, Cernovicki oder Garnowick) wurde nach einer von ihm selbst im Register der Berliner Großloge 1780 gemachten Notiz zu Palermo 1745 geboren. Soweit wir über sein Tun und Treiben unterrichtet sind, erscheint er als ein würdiger Zögling Lollis, dessen virtuose Richtung auch auf ihn überging. Seinem Spiel wird große Reinheit und Sauberkeit sowie geschmackvolle Zierlichkeit nachgerühmt; doch mangelte ihm (nach Fétis) Tonfülle und Breite des Spiels. Im Widerspruch hiermit steht Dittersdorfs Urteil (Selbstbiographie, S. 233), welches besagt, daß Giornovicchi »einen schönen Ton aus dem Instrument zog, vortrefflich im Adagio sang, und – trotz gewisser Minauderien mit einem Wort: für die Kunst und das Herz spielte«. In der von Reichardt herausgegebenen Berliner mus. Ztg., Jahrg. 1, S. 4 findet sich folgende Charakteristik Giornovicchis: »Er hatte einen vollkommen reinen und klaren, wiewohl nicht starken Ton, eine ganz reine Intonation und große Leichtigkeit im Bogen und in seinem ganzen Vortrage. Die vollkommene Aisance, mit der er alles, was er spielte, vortrug, setzte auch den Zuhörer in die angenehmste Stimmung. Freilich hatte er die Klugheit, nichts zu unternehmen, dessen er nicht völlig gewiß war, und nur seine eigenen ziemlich einförmigen Kompositionen vorzutragen. Gegen die größten der neueren Violinisten gehalten spielte er überhaupt keine großen Schwierigkeiten. Der Vortrag seines Adagios war, wenngleich angenehm, doch meistens kalt und ohne weitere Bedeutung; auch dieses schien er an sich selbst zu kennen, und man hörte ihn fast nie ein ganz ausgeführtes Adagio spielen; lieber wählte er die Form der Romanze, die er naiv und sprechend vortrug. Er war besonders merkwürdig darin, wie ein Virtuose sich, selbst gegen seinen Charakter, einen bestimmten Kunstcharakter zu seiner Virtuosität vorsetzen und durchführen, auch durch beständiges Streben nach der Vervollkommnung und Erhaltung des einmal angenommenen Charakters, sich bis ans Ende gleichmäßig interessant erhalten kann ... Es wäre dem Verstorbenen und seinen Freunden, die viel Verdruß an ihm erlebten, zu wünschen gewesen, daß er dieselbe Harmonie in seinem Charakter und seiner Lebensweise gehabt hätte. Er war aber von sehr heftiger, fast wüthender Gemüthsart, und dergestalt dem Spiel und andern Leidenschaften ergeben, daß er von alle dem Glück, welches er in Paris und London, in Italien, Deutschland, Rußland und Polen erlebte, wenig wahren Gewinn und nie ruhigen Genuß gehabt hat.« Im Jahre 1770 trat er im Pariser Concert spirituel auf, ohne jedoch sogleich Beifall zu finden, der ihm erst zuteil wurde, als er sich mit einem Konzert eigener Komposition hören ließ. Ja das Publikum fand an dieser und seinem Spiel so großen Gefallen, daß er eine Reihe von Jahren hindurch in seltenem Maße der Liebling desselben wurde. Dies mochte ihn übermütig machen und seinem Hang zu extravaganter Lebensweise, zu Spiel und Ausschweifungen mannigfacher Art bedenklichen Vorschub leisten. Er trieb es endlich so weit, daß er wegen eigentümlicher, nicht näher aufgehellter Umstände, bei denen seine Ehre gefährdet war, im Jahre 1779 Paris plötzlich verlassen mußte.
Giornovicchi wandte sich nunmehr nach Berlin. Auf der Durchreise gab er zwei Konzerte in Frankfurt a. M. (12. und 16. Sept.) Auf den Programmen nennt er sich charakteristischerweise »erster Violinist von Frankreich« und Konzertmeister des Prinzen Rohan Guimenée. (Israel, Frankfurter Konzert-Chronik von 1713-1780. Frankfurt a. M. 1876.) In Berlin fand Giornovicchi in der Kapelle des musikliebenden Prinzen Friedrich Wilhelm, des Nachfolgers Friedrich des Großen, Engagement, sah sich indessen auch hier genötigt, kollegialischer Streitigkeiten mit dem Violoncellisten Duport halber 1783 das Feld zu räumen. Eine größere Kunstreise, auf der er Wien, Warschau, Petersburg und Stockholm besuchte, führte ihn endlich 1791 nach London, wo er am 4. Mai zuerst auftrat. Hier wurde er vom Glück begünstigt, doch nur, bis Viotti von Paris eintraf. In eitler Selbstüberschätzung forderte er den italienischen Meister bei der ersten Begegnung nach Art eines Charlatans zu einem Geigenwettkampf mit diesen Worten heraus: » Il y a long temps, que je vous en veux; vidons la querelle, apportons nos violons, et voyons enfin qui de nous deux sera César ou Pompée.« Viotti stellte ihn durch seine Leistungen in Schatten und überließ ihn dem Spott seiner Gegner. Die erlittene Niederlage suchte er durch folgende, seiner Herausforderung ganz ebenbürtige Äußerung zu paralysieren: » Mai foi, mon cher Viotti, il faut avouer qu'il n'y a que nous deux qui sachions jouer du violon Die zu dieser Begegnung gehörige Vorgeschichte vgl. pag. 169 d. B..« Eine Anekdote, die Giornovicchis Eigenliebe wie seine Exzentrizität nicht übel charakterisiert, möge hier Platz finden. Auf einer Reise sich in Lyon vorübergehend aufhaltend, hatte er ein Konzert für den damals sehr beträchtlichen Preis von sechs Franken den Platz angekündigt. An dem Konzertabend fand er einen völlig leeren Saal vor. Aufgebracht und sehr gekränkt kündete er, um sich zu rächen, ein Konzert für den halben Preis zum nächsten Tage an. Diesmal strömte das Publikum in Masse herbei, aber statt des erwarteten Ohrenschmauses wurde ihm die Nachricht, daß der Künstler vor einer Stunde die Stadt verlassen habe.
Giornovicchis anmaßendes Wesen nötigte ihn, auch London 1796 zu verlassen. Er lebte dann einige Jahre in Hamburg. Sein Virtuosenmetier vernachlässigte er von da ab mehr und mehr; er vertauschte die Violine mit dem Billard, auf dem er Meister war, und von dessen Erträgnissen er dann auch hauptsächlich lebte. 1802 machte er sich indessen wieder auf die Wanderschaft nach Petersburg; dort erging es ihm aber mit Rode wie in London mit Viotti. Wie es scheint, mußte ihm das Billardspiel auch diesmal Ersatz leisten; denn er starb in der russischen Hauptstadt mit dem Queue in der Hand am 21. November 1804. Nach Fétis' Angabe veröffentlichte Giornovicchi von seinen Kompositionen 15 Konzerte, 3 Streichquartette, Violinduetten, Sonaten für Violine und Baß und einige Symphonien. Sie sind sämtlich längst verschollen Ein Verzeichnis der nachzuweisenden gibt Eitner (Quellen-Lexikon). und für die Gegenwart auch wohl völlig ungenießbar geworden.
Ein Schüler Giornovicchis war Johann Bliesener. Das Nähere über diesen findet sich im nächsten Abschnitt.