
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Den Italienern war das beneidenswerte Los beschieden, in der Epoche des »Cinquecento« bahnbrechend und normgebend aufzutreten. Zwar erblicken wir die anderen Nationen des europäischen Okzidents, namentlich die Niederländer und Deutschen, gleichzeitig in reger Kunsttätigkeit. Doch sie verhielten sich der Hauptsache nach, soweit sie nicht noch unter dem bestimmenden Einflusse des romantischen Zeitalters standen, den Italienern gegenüber wesentlich rezeptiv. Diese wurden freilich für die Lösung ihrer Kunstmission durch ein seltenes Zusammenwirken mannigfacher Umstände besonders begünstigt. Mächtig beeinflußt von dem bildenden und läuternden Geist der antiken Kunst, deren nächste Erben sie waren, entwickelte sich ihre bevorzugte künstlerische Anlage um so glänzender, je mehr dieselbe durch Adel der Empfindung, Poesie der Auffassung und plastische Ineinsbildung des Formellen und Geistigen im Kunstwerk unterstützt wurde. Begünstigt durch einen lachenden Himmel, durch glückliche klimatische Verhältnisse und eine reizvolle Natur, gestaltete sich, diesen innern Eigenschaften entsprechend, auch ihre äußere Existenz zu einem vorwiegend heiteren und sinnlich schönen, von gesunder Lebensfülle durchdrungenen Dasein. Mit einem Wort: von allen Seiten her wirkten in diesem Lieblingsvolke der Musen fördernde Bedingungen für die blütenreiche und fruchtbringende Kunsttätigkeit des späteren Mittelalters zusammen; eine Kunsttätigkeit, die alsbald auf die Nachbarvölker in einer ihrer Begabung und Eigentümlichkeit entsprechenden Weise bestimmenden Einfluß übte. So sehen wir denn die Italiener ihr für die Entwickelung der modernen Kunst bedeutsames Tagewerk zu Anfang des 15. Jahrhunderts mitten im Ausströmen der romantisch -mittelalterlichen Kunst mit voller Hingebung beginnen. Was nun um diese Zeit Männer wie Filippo Brunelleschi für die Architektur, Jacopo della Quercia und Lorenzo Ghiberti für die Skulptur, sowie Masaccio und Fra Filippo Lippi für die Malerei waren, das wurde etwa 100 Jahre später Palestrina für die Tonkunst, wenn auch zunächst nur für die Vokalmusik, aus der jedoch die Instrumentalmusik sehr bald ihre Lebensnahrung sog.
Die Tonkunst war nicht so glücklich, sich auf mustergültige Schöpfungen einer antiken Welt stützen zu können, wie die bildenden Künste. Sie ist im Gegensatz zu den letzteren die eigentlich moderne Kunst. Aus den zwar sinnreichen, aber doch starren und unfreien kontrapunktischen Gebilden der Niederländer, dieser verdienstlichen Erfinder unserer heutigen Musik, mußte erst etwas Lebensvolles entwickelt, gestaltet werden. Allein es ist nicht zu verkennen, daß der blühende Zustand der übrigen Künste wohl geeignet war, hier den Mangel klassischer Vorbilder einigermaßen zu ersetzen. Palestrinas Wirksamkeit fällt in die Periode des höchsten Aufschwunges italienischer Kunst. Raffael hatte bereits gelebt und gewirkt; Michel Angelo befand sich noch in voller Tätigkeit. Gefühl und Geschmack waren durchgebildet, und der große musikalische Reformator des Kirchenstiles wurde gleich allen andern Tonmeistern der Folgezeit durch eine unerschöpfliche Fülle des edelsten Kunststoffes befruchtet.
Es ist genugsam bekannt, welche unvergänglichen Verdienste die Italiener sich in diesem Zeitraume um die Gesangskunst erwarben, nicht minder, welch einen wichtigen Einfluß sie demnächst auf die Entwickelung und künstlerische Handhabung der Vokal- und Instrumentalformen ausgeübt haben. Dasselbe gilt von ihnen ebensosehr in betreff des Instrumentenspieles, speziell aber der Streichinstrumente, und unter diesen zunächst wieder der Violine, die sie zuerst einer methodisch kunstgemäßen Behandlung zugänglich machten. Bevor dies indes geschehen konnte, mußte erst das betreffende Kunstorgan geschaffen werden. Und auch diese Aufgabe fiel ihnen zu. Sie lösten dieselbe in epochemachender Weise, indem sie mannigfache, bis heute unerreichte Musterleistungen im Gebiete des Streichinstrumentenbaues hervorbrachten: ein abermaliger Beweis für ihren seltenen Ton- und Formensinn.
Über Ursprung und Heimat der Streichinstrumente ist bis jetzt noch nichts Bestimmtes festgestellt. Nur Vermutungen existieren darüber. Manche meinen, daß sie aus Indien zu uns gekommen, wieder andere, daß sie arabischer oder maurischer Herkunft seien. Jedenfalls ist das Geschlecht der Streichinstrumente alt. Doch reicht die Genesis derselben schwerlich bis in die vorchristliche Zeit zurück. Zwar besaßen die alten Völker nachweislich schon Saiteninstrumente, wie z. B. die Lyra, die Kithara usw. Diese wurden indessen mit dem Plektrum oder auch mittelst der Finger zum Ertönen gebracht. Den Bogen, welcher das charakteristische Moment für die Streichinstrumente bildet, kannten sie nicht. Seine Erfindung erfolgte wohl erst im Laufe der ersten Jahrhunderte des christlichen Zeitalters Fétis glaubt, daß die Streichinstrumente von dem Ravanastron, einem angeblich uralten indischen Bogeninstrument abstammen. Hiernach hätte man also in Indien den Gebrauch des Bogens schon in vorchristlichen Zeiten gekannt. Dies ist aber nicht erwiesen, und ebensowenig, daß der europäische Okzident den Bogen von Indien her erhalten habe..
Gewiß wäre es einer Untersuchung wert, welche Entwickelungsstadien der Bogen anfangs durchgemacht hat. Denn gleichwie die Stange desselben sich aus Rudimenten hervorgebildet hat, ebenso wird zweifelsohne der zur Tonerzeugung erforderliche Bezug des Bogens mannigfache Wandlungen erlebt haben, ehe man sich der Haare des Pferdeschweifes dazu bediente. Ausdrücklich ist die Benutzung derselben für den gedachten Zweck in Hugo von Trimbergs »Renner« erwähnt, welcher zu Ende des 13. Jahrhunderts gedichtet wurde. Es heißt dort, daß »einer mit eines pferdes zagel streichet über vier schafes darm«. Doch mag diese Praxis auch schon wesentlich früher bestanden haben.
Die älteste Form des Bogens dürfte allem Anschein nach die eines mehr oder minder stark gekrümmten Bügels gewesen sein, woraus sich denn auch der Name »Bogen« erklären würde. In Herbés Cost. françs. (Paris 1837) findet sich eine dementsprechende, aus dem 8. Jahrhunderte herrührende Abbildung. Wenig später kommt aber auch schon die gestreckte, nur an der Spitze noch gekrümmte Form des Bogens zum Vorschein, wie aus der weiterhin mitzuteilenden Abbildung der im 9. Jahrhundert gebräuchlich gewesenen »Lyra« hervorgeht.
Nach und nach veränderte sich die konvexe Biegung der Stange etwas; sie bestand indessen bis zum 16. Jahrhundert fort und steigerte sich sogar in einzelnen Fällen wieder zusehends, wie aus folgender bildlicher Skala zu entnehmen ist Diese und die noch folgenden Abbildungen sind teils aus Fétis' Schrift »Stradivarius«, teils aber aus dem zu Rühlmanns »Geschichte der Streichinstrumente« gehörenden Atlas, sowie aus Vidals » les instruments à archet« entlehnt..
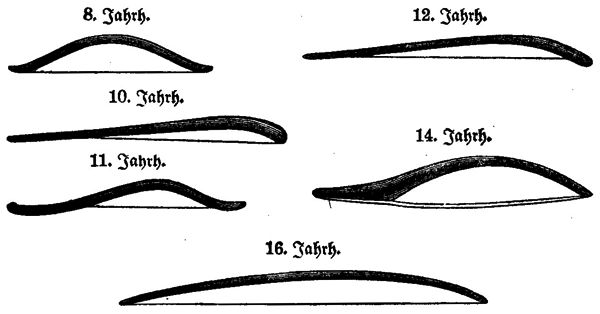
Die hier gegebenen Beispiele enthalten nicht alle, sondern nur die wesentlichsten Modifikationen der Bogenkonstruktion während des 8.-16. Jahrhunderts.
Vom 17. Jahrhundert ab nähert sich der Bogen mehr und mehr der heutigen Gestalt. Die Wandlungen, welche dieses, für die fortschreitende Pflege der Streichinstrumente so wichtige Requisit im Laufe der Zeit erfuhr, werden durch folgende Abbildungen deutlich veranschaulicht.
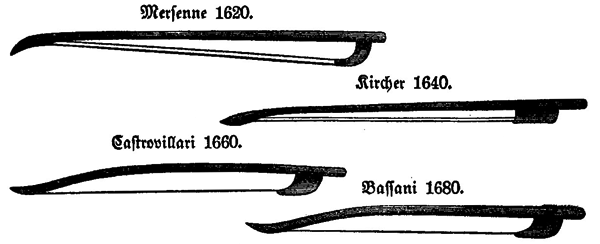
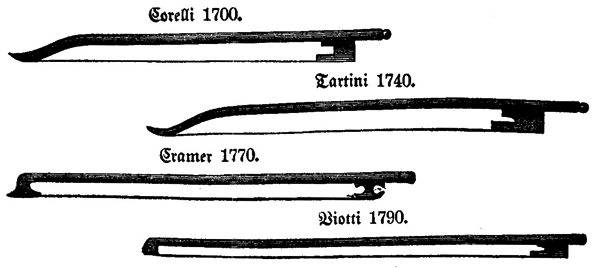
Die Stange wird zunächst gerade und ist bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts nur noch an der Spitze abwärts, weiterhin aber aufwärts gebogen; eine Flexibilität verstand man der ersteren indessen noch nicht zu geben. Dagegen machte man im Laufe des 17. Jahrhunderts durch eine Vorrichtung am Frosch bereits Versuche, der Behaarung des Bogens eine verschiedenartige Spannung zu verleihen. Diese Absicht wurde jedoch erst völlig erreicht, nachdem man zu Anfang des 18. Jahrhunderts am unteren Ende des Bogens die Schraube angebracht hatte. Sodann war man darauf bedacht, Holz von leichterem Gewicht zur Bogenfabrikation zu verwenden. Mit allen diesen wesentlichen Verbesserungen hatte man freilich noch nicht das Ideal des Bogens zu erreichen vermocht. Dieses schuf erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts der Franzose François Tourte, geb. 1747 zu Paris, gest. daselbst im April 1835. Ursprünglich zum Uhrmacher bestimmt, widmete er sich nach Verlauf einiger Jahre der schon von seinem Vater mit Erfolg betriebenen Bogenfabrikation, brachte es aber darin ungleich weiter als dieser.
Das Hauptverdienst Fr. Tourtes besteht darin, der von ihm konkav gebogenen Stange des Bogens jene außerordentliche Elastizität verliehen zu haben, welche die kompliziertesten Stricharten zuläßt, ohne dadurch die Festigkeit und unveränderliche Dauerhaftigkeit des Fabrikates in Frage zu stellen. Zur Erreichung dieses, auf genauer Berechnung beruhenden Resultates gebot er nicht nur über die erforderliche Handgeschicklichkeit, sondern auch über eine feine, durch Bemerkungen und Fingerzeige bedeutender Geiger geschärfte Beobachtungsgabe. Gleichzeitig gab Tourte dem Bogen eine gefällige, elegante Gestalt: seine Arbeiten zeichnen sich nicht nur durch die Schlankheit und Geschmeidigkeit der Stange, sondern speziell auch durch die Zierlichkeit des von ihm eigentümlich hergestellten Kopfes aus.
Im besonderen verbesserte Tourte die Konstruktion des Bogens für den praktischen Gebrauch noch dadurch, daß er den Schieber am Frosch anbrachte, mittelst dessen dieser letztere verschlossen wird, sowie durch die Zwinge an demselben, vermöge deren die Haare des Bogens eine bandförmig ausgebreitete Lage erhalten. Von den verschiedenen zur Bogenfabrikation geeigneten Holzarten bevorzugte er das Fernambukholz als das geeignetste, welches seitdem auch fast ausschließlich für den fraglichen Zweck benutzt wird.
Die seit nahezu hundert Jahren bewahrte Güte der Tourteschen Bögen ist unübertroffen geblieben. Aber unter seinen Nachfolgern befinden sich einige, die ihm in ihren Leistungen nahekommen und in einzelnen Fällen wohl auch ebenbürtig sind. Zu ihnen gehören Eury (erste Hälfte des 19. Jahrhunderts), Lafleur (geb. 1760 zu Nancy, gest. 1832 in Paris), dessen Sohn Joseph René (geb. 1812 in Paris, daselbst gest. 1874), François Lupot (geb. 1774 in Orléans, gest. 1837 zu Paris), der Engländer John Dodd und endlich noch Dominique Peccate (geb. 1810 in Mirecourt). Dieser arbeitete zunächst bei Vuillaume in Paris und errichtete dann später eine eigene Werkstätte. Seine Bögen werden von Kennern für die besten nächst Tourteschen gehalten.
Gute Violinbögen fabrizierte in Deutschland Ludwig Christian August Bausch zu Leipzig, wo er am 26. Mai 1871 starb. Geboren wurde er am 15. Januar 1805 in Naumburg.
Unter den Bogenfabrikanten der Neuzeit dürfte demnächst wohl F. N. Voirin in Paris als einer der vorzüglichsten zu bezeichnen sein. Er wurde 1833 in Mirecourt geboren, kam 1855 nach Paris, arbeitete zunächst 15 Jahre lang bei Vuillaume und gründete 1870 ein eigenes Atelier. Voirin starb im Mai des Jahres 1885.
Einen ausgezeichneten Bogenfabrikanten besitzt gegenwärtig auch England in dem zu London wirkenden I. Tubbs.
Von den übrigen europäischen Nationen tun sich nur noch die Deutschen in diesem Kunstzweige hervor. Wie treffliches sie indessen auch darin nach dem Vorbilde der besten Muster leisten, – die Superiorität speziell in diesem Fache wird den Franzosen nicht streitig zu machen sein.
Die allmähliche Verbesserung des Bogens ging mit der fortschreitenden Entwickelung des Streichinstrumenten-, insbesondere aber des Violinspiels Hand in Hand. Dieses letztere wurde indessen doch zunächst durch die steigende Vervollkommnung der fraglichen Instrumente selbst mächtig beeinflußt. Je handlicher sie im Laufe der Zeit wurden, und je mehr sie an Klangschönheit gewannen, desto mehr wurden die Bemühungen der ausübenden Künstler in betreff der Tonbildung und der technischen Fortschritte unterstützt und gefördert.
Gleichwie der Bogen, hat auch der Bau der Streichinstrumente vielfache Umgestaltungen und Neuerungen erlebt. Die älteste bis jetzt bekannt gewordene urkundliche Erwähnung dieser Tonwerkzeuge findet sich in dem Evangelienbuch des Benediktinermönches Otfried, welcher bekanntlich im 9. Jahrhundert lebte. Bei Aufzählung der Instrumente, welche zur Verherrlichung der himmlischen Freuden benutzt werden, nennt er u. a. die » lira« und » fidula«.
Von dieser » lira« (Lyra) Dieses sehr primitive einsaitige Tonwerkzeug ist nicht mit den späteren gleichnamigen Instrumenten des 16. und 17. Jahrh. zu verwechseln. gibt der Abt Gerbert in seinem Werke über die mittelalterliche Musik folgende, aus dem St. Blasius-Kodex entnommene Abbildung, welche ein einsaitiges, mit Steg, Saitenhalter und zwei hufeisenähnlichen Schallöffnungen zu beiden Seiten des Steges versehenes Streichinstrument darstellt.
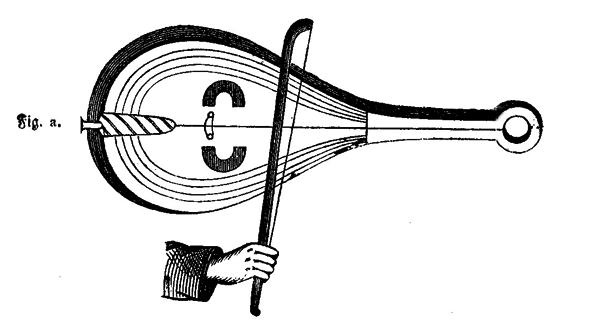
Dieses Tonwerkzeug ist unverkennbar das Urbild der späteren, von Virdung (1511) erwähnten und von Agricola (1529) beschriebenen »klein Geigen«, wie nachstehende Abbildung ersehen läßt.
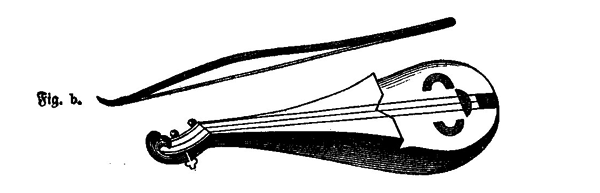
Die Gestalt des Klangkörpers ist im wesentlichen hier wie dort dieselbe. Der Hauptunterschied besteht darin, daß bei der »klein Geigen« das Griffbrett eine erhöhte Lage, und daß sie statt einer Saite deren drei hatte. Diese »klein Geigen« Die Franzosen nannten dieses Instrument wegen dessen Ähnlichkeit mit einer Hammelkeule » gigue«., welche in drei Größen, für den Diskant, sowie Alt und Tenor Für den Alt und Tenor war ein und dieselbe Größe des Instrumentes gebräuchlich. und für den Baß existierte, fand keine weitere Ausbildung und scheint auch schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts aus der Musikpraxis verschwunden zu sein, da Prätorius in seinem Syntagma mus. (1614-1620) weder mit Wort noch bildlicher Darstellung ihrer gedenkt Neben der » lira« und »fidel« waren ehedem noch drei andere Bogeninstrumente in Gebrauch, nämlich der wälische Crwth, das Trumscheid ( tromba marina) und das Rebec (Ribeca, Ribeba oder Rubeba, auch Rubella genannt), die aber sämtlich durch die Fortschritte des Instrumentenbaues allmählich außer Gebrauch kamen und dann völlig in Vergessenheit gerieten. Das Rebec war in betreff seiner Montierung ähnlich eingerichtet, wie die »klein Geigen«, unterschied sich aber von dieser wesentlich durch gedrungene Gestalt seines Resonanzkörpers, welcher eine ovale Form hatte..
Eine andere Bewandtnis hatte es mit der gleichfalls von Otfried erwähnten » fidula«, welche als Vorläuferin der späteren »Fidel« gelten darf. Fehlt es bis jetzt auch an einer authentischen Abbildung der fidula des 9. Jahrhunderts, so kann doch mit Wahrscheinlichkeit aus dem Namen derselben gefolgert werden, daß sie dasjenige Streichinstrument ist, welches sich nach und nach zur »Fidel« des 13. und 14. Jahrhunderts entwickelte.
Der Klangkörper dieser »Fidel« war, wie die in Zeichnungen, Malereien und Skulpturen überlieferten Abbildungen erkennen lassen, nach einem von der » lira« durchaus abweichenden Prinzip gestaltet. Während die lira als charakteristisches Merkmal eine kürbisähnlich ausgebauchte Rückseite hatte, bestand die Fidel aus der durch zargenartige Zwischenglieder miteinander verbundenen Ober- und Unterdecke, – eine Einrichtung, welche schon vorher bei dem wälischen Crwth bestand und von diesem, wie man annimmt, auf die Fidel übertragen wurde. Unterscheidet sich diese hierdurch schon durchaus von der lira, so auch noch insbesondere durch die zu beiden Seiten am mittleren Teil des Korpus angebrachten Einbiegungen. Im 13. und 14. Jahrhundert waren diese noch nicht stark hervortretend, wie folgende Figur zeigt.
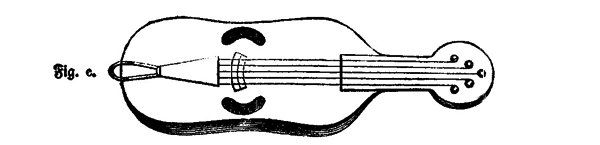
Aber schon mit dem 15. Jahrhundert beginnen die fraglichen Einbiegungen sich zu vergrößern. Sie hatten die Form der Figur d, welche ganz gitarrenartig ist.
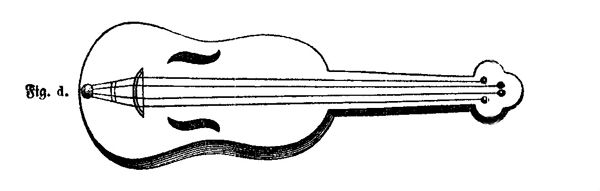
Zugleich erhält die Fidel an der oberen, nach dem Halse zu gelegenen Hälfte des Korpus eine sehr merkliche Verjüngung gegen die untere Hälfte, ähnlich, wie sie bei unseren heutigen Streichinstrumenten üblich ist.
Diese Fidelform fand im Laufe des 15. Jahrhunderts eine weitere Ausbildung durch die bügelartigen, von hervorspringenden Ecken begrenzten Seitenausschnitte, welche notwendig schon die Zerlegung der Zargen in Ober-, Mittel- und Unterzargen bedingte. In dem aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts herrührenden Psalmenbuch des Königs René befindet sich nebenstehende bildliche Darstellung, welche das eben Gesagte gut veranschaulicht.

Die Gestaltung des Resonanzkastens dieses Instrumentes zeigt den Übergang zu der, Anfangs des 16. Jahrhunderts allgemeiner auftretenden und dann durchgängig akzeptierten Geigen- (Violen-) Form, aus der schließlich unsere heutigen Streichinstrumente hervorgingen. Vgl. hierzu die betreffenden Abbildungen in der Gesch. d. Instrumentalmusik im 16. Jahrh. vom Verf. d. Blätter. Taf. III und IV. Es versteht sich von selbst, daß die mannigfachen Veränderungen, denen die Streichinstrumente im Laufe der Zeit unterworfen waren, nicht plötzlich und stoßweise vor sich gingen, sondern daß immer erst nach vielen Versuchen, in Benutzung der dabei gemachten Erfahrungen allgemeiner akzeptierte Resultate gewonnen wurden. Ehe man diese letzteren aber erreichte, war die Zahl der Modifikationen in betreff der Formgebung eine ungemein große, wenn es dabei auch nicht an einem durchgehenden Grundtypus fehlte S. den Atlas zu Rühlmanns Gesch. d. Streichinstrumente. Taf. VII.. Überträgt man von Fig. e die Seitenausschnitte auf Fig. d, und gibt den f-Löchern an dieser letzteren eine umgekehrte Stellung, so erhält man die Violenform, von der nur noch ein Schritt zur Erzeugung der Violine zu tun war.
Neben der Bezeichnung »Fidel« wurde frühzeitig auch der Name »Geige« gebräuchlich. Nach Grimms Wörterbuch der deutschen Sprache kommt das letztere Wort aber doch erst im 12. Jahrhundert »beim Empfange eines Herren« vor, während der Terminus » fidula«, wie nachgewiesen, bereits im 9. Jahrhundert und wahrscheinlich auch schon vorher erscheint. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts hatte man indessen, in der Schriftsprache wenigstens, den Ausdruck »Fidel« aufgegeben. Virdung in seiner »Musica getutscht« (1511) und bald nach ihm Agricola in seiner »Musica instrumentalis« sprechen nur noch von »Geigen«. Gleicherweise setzt auch Luther anstatt des von ihm anfänglich noch gebrauchten »Fidel« später »Geige«. Die erstere Bezeichnung hat sich jedoch neben dem Wort Geige in der Umgangssprache fort und fort erhalten, wird aber nur im unedeln Sinne benutzt, wie denn auch der Ausdruck »Fiedler« gleichbedeutend mit einem schlechten Geiger ist.
Über den Ursprung des Wortes »Geige« sind die Meinungen zurzeit noch sehr geteilt. Manche leiten es von dem französischen » gigue« ab, welches Wort angeblich zuerst im Wörterbuch des Johannes de Garlandia (1210-1232) gebraucht wird S. Lavoix: Historie de l'Instrumentation (Paris 1878). S. 14. – Nicht glücklich erscheint der Versuch Rühlmanns (Gesch. d. Bogeninstrumente), das Wort » gigue« mit Beziehung auf den Terminus »Geige« von »Chika« abzuleiten, welcher Ausdruck nach Czerwinskys Gesch. d. Tanzkunst (S. 63) von den Kongonegern für einen gewissen Tanz gebraucht wird. Angeblich kann man die »Chika« noch heute in Spanien tanzen sehen. So berichtet Friedrich v. Hellwald in Nr. 8 der geographischen Zeitschrift »Globus« vom Jahr 1891. Mit Chika sollen die Neger übrigens auch ein berauschendes Getränk bezeichnen, welches sie bei ihren ausgelassenen wollüstigen Tänzen genießen.. Andere dagegen, unter ihnen Autoritäten der Sprachwissenschaft, sind der Ansicht, daß der Terminus »Geige« deutscher Abstammung sei. In Grimms Wörterbuch wird darüber folgendes gesagt: »Fidel scheint von romanischem, Geige von deutschem Ursprunge, ist aber auch zu den Romanen, wie jenes zu den germanischen Völkern gelangt. Guten Anhalt findet das Wort (Geige) wirklich im Germanischen, der ihm im Romanischen fehlt, in dem uralten Stamme gag ( gig), der in reichster Ausgestaltung wesentlich eine gaukelnde Bewegung bezeichnet. Das eigentlich Unterscheidende bei der Geige gegen andere Tonwerkzeuge ist der Gebrauch des Strichbogens, und dessen Bewegung scheint eigentlich in gîge bezeichnet, wetterauisch geigen bedeutet noch jetzt ›mit dem Fidelbogen auf und ab fahren‹.«
Die Gebrüder Grimm sind übrigens der Meinung, daß mit dem Namen »Geige« zugleich der für die Spieltechnik bedeutsame Gewinn des Griffbrettes erfolgte. Sie sagen, daß »das deutsche Wort, indem es neben oder auch für das romanische, also vornehmere Wort eintrat, zugleich in der Sache eine Neuerung, einen Fortschritt mit sich gebracht haben müßte, der auch das romanische Gebiet eroberte; dieser Fortschritt soll aber in der Einführung des Griffbrettes bestanden haben, das der videle fehlte, während der alte Fidelbogen auch für die Geige fortdienen konnte. – Wie übrigens die Geige die ältere Fidel endlich verdrängte, daß sie außer dem Gebrauch bei Dichtern nun höchstens als Strohfidel noch lebt, so ward die Geige seit dem 16. und 17. Jahrhundert aus Italien her von der Violine, ursprünglich viole, bedrängt und zum Teil verdrängt. So ist im Niederländischen das alte Wort schon im 16. Jahrhundert geschwunden, denn Junius nom. 245b, 246 nennt nur veele (Fidel), Kilian nur vele und vioole, franz. viole und violonsse, franz. violon; jetzt viool. – Bei uns hat sich doch Geige in einer gewissen Ehre erhalten oder ist wieder dazu gekommen, zwar nicht im Hause und Alltagsleben, aber in der höheren Kunstsprache, wo Geige, Geigenspiel, selbst ein großer Geiger höher klingen können als die alltägliche Violine, Violinist u. dergl.«
Übereinstimmend mit den Gebr. Grimm spricht sich Diez in seinem Wörterbuch der romanischen Sprachen bezüglich der etymologischen Bedeutung des Wortes Geige aus; es heißt dort unter dem Artikel Giga: » Giga italienisch, altspanisch, provenzalisch gigue, gigle altfranzösisch, – ein Saiteninstrument, neuspanisch giga, neufranzösisch gigue, ein Tanz mit Musikbegleitung, vom mittelhochdeutschen Gîge, neuhochdeutsch Geige, dies vom starken Verbum gigen.«
Im Anhange zu Diez' Wörterbuch spricht Scheler die Vermutung aus, »es könnte sowohl dem romanischen giga Geige als dem französischen gigue gigot Bein, Hammelkeule (hieraus gigotter sich hin und her bewegen) als gemeinschaftliche Quelle ein deutsches Verb mit der Bedeutung › tremere, motitare‹ zugewiesen werden, welchen Sinn althochdeutsch geigan , dem altnordischen geiga nach zu schließen, wirklich gehabt haben muß«.
Auch der um die mittelalterliche Musikgeschichte so hochverdiente Coussemaker vertritt die Meinung, daß das französische gigue vom deutschen »Geige« abstamme.
Zu Anfang des 16. Jahrhunderts gab es nach Virdungs und Agricolas Mitteilungen – beide Autoren gedenken weder des wälischen Crwth (Chrotta) noch des Rebec – folgende Streichinstrumente:
1) »Große Geigen« mit 5 resp. 6 Saiten
2) »Große oder kleine Geigen« mit 4 Saiten
3) »Kleine Geigen« mit 3 Saiten
mit Bünden,
ohne Steg und
Befestigung der Saiten am sog. Querriegel als Ersatz für den Saitenhalter.
4) »Kleine Geigen« mit 3 Saiten Das Nähere über alle diese »Geigen« und ihre Einrichtung ist aus meiner Geschichte der Instrumentalmusik im 16. Jahrh. und den dazu gehörenden Abbildungen zu ersehen. Der Verf.. – Ohne Bünde mit Steg und Saitenhalter.
Die Form der unter 4) aufgeführten kleinen Geigen war, wie schon früher bemerkt, eine mandolinenartige, wogegen die unter 1) bis 3) erwähnten großen und kleinen Geigen, welche teils nach Art unserer heutigen Violine, teils aber nach Art des Violoncellos oder auch Kontrabasses gehandhabt wurden, schon annähernd die Form der soeben genannten Tonwerkzeuge, wenn auch erst in primitiver Weise hatten. Alles erscheint an diesen Instrumenten noch ziemlich unbeholfen und plump. Die Seitenausschnitte sind unverhältnismäßig lang gestreckt; der Hals, ohne besonders hergerichtetes Griffbrett, zeigt noch eine unförmliche und sehr wenig handliche Gestalt. Ob die Resonanzdecke dieser Streichinstrumente gewölbt war oder nicht, ist unerwiesen. Jedenfalls wurde die Klangfähigkeit durch die in derselben befindlichen drei Schallöcher, von denen das eine in kreisrunder Rosettenform wie bei der Gitarre in der Mitte, die andern beiden sichelförmigen dagegen in den oberen Backen des Instrumentes angebracht waren, ganz wesentlich beeinträchtigt. Da diese Tonwerkzeuge weder Steg noch Saitenhalter hatten, so mußte der Querriegel, an welchen die Saiten angehängt wurden, als Ersatz für beide Requisite dienen. Man hat sich daher die obere Kante des Querriegels für die Benutzung der einzelnen Saiten in konvexer Rundung zu denken.
Gleichzeitig aber gab es auch noch eine andre, von Virdung und Agricola nicht erwähnte Art von Geigen, welche nach Form und Einrichtung unsern modernen Streichinstrumenten schon bedeutend näherstanden, wie die vorher besprochenen: sie repräsentieren eine höhere Stufe der Entwicklung des Streichinstrumentenbaues. Judenkünig (Wien 1523), Hans Gerle (Nürnberg 1532) und Ganassi del Fontego (Venedig 1542) geben von ihnen Abbildungen, die im wesentlichen miteinander übereinstimmen. Die Seitenausschnitte zeigen an ihnen schon eine verkürzte, mehr zusammengezogene Form, wodurch der Resonanzkasten eine gedrungenere, für den Gebrauch zweckmäßigere Gestalt erhält. Die Rose inmitten der Oberdecke ist ganz beseitigt, und die beiden sichelförmigen Schallöcher sind in den mittleren Teil des Instruments zu beiden Seiten des vorhandenen Steges hinuntergerückt. Statt des Querriegels erscheint der am Zargenknopf befestigte Saitenhalter. Zugleich findet auch das eigens hergerichtete und auf dem Halse befestigte Griffbrett schon Anwendung, wie die von Gerle gegebene Zeichnung deutlich erkennen läßt. Ob der bei dem wälischen Crwth bereits angewandte Stimmstock für diese Streichinstrumente auch schon gebräuchlich war, ist aus den Musikschriftstellern des 16. Jahrhunderts nicht zu ersehen. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es der Fall, zunächst vielleicht nur, um den Druck des Steges auf die Oberdecke zu paralysieren, welche bei diesen Geigenarten seit dem 15. Jahrhundert, und vielleicht auch schon vorher, die gewölbte Form besaß Fétis berichtet über eine von Giov. Kerlino im Jahre 1449 gebaute Viola, welche stark gewölbt war, und die er selbst bei einem Pariser Instrumentenmacher sah..
In Deutschland hießen diese von Judenkünig, Gerle und Ganassi del Fontego abgebildeten Streichinstrumente gleichfalls Geigen, während in Italien der Name Viola Fr. Diez ist der Ansicht, daß das Wort Vióla von dem provenzalischen víula ( víola) herkommt. Er sagt a. a. O.: »zu bemerken ist zuvörderst, daß der Provenzale zweisilbig víula víola spricht (der Diphtong iú ist ihm unbekannt); aus víola konnte wohl franz. vióle, ital. vióla werden, nicht aus vióla das provenz. víola: man muß also von der provenz. Form als der ältesten ausgehen und darf nicht außer acht lassen, daß das Wort, wie alle mit v anlautenden, vorzugsweise lateinische Herkunft in Anspruch nimmt. Der mittellateinische Ausdruck für dasselbe Instrument ist vitula ..., welcher im Laufe des 17. Jahrhunderts auch bei uns heimisch wurde, für dieselben üblich war. Die Viola existierte, ebenso wie die von Virdung und Agricola beschriebenen älteren Geigen, in mehreren der Größe nach voneinander unterschiedenen Exemplaren, deren Stimmungsverhältnisse, wie es scheint, von der im 14. Jahrhundert aus dem Orient nach dem europäischen Abendlande gebrachten Laute entnommen waren. Von diesem nach Art der Gitarre gehandhabten Instrumente sind auch wahrscheinlich die Bünde des Griffbretts entlehnt H. Riemann hat zuerst auf dieses Moment aufmerksam gemacht. S. in dessen Musiklexikon den Artikel »Bünde«. Über die Laute vergl. auch des Verf. d. Bl. »Geschichte der Instrumentalmusik im 16. Jahrh.« Berlin bei J. Guttentag., welche bei den älteren Geigen- und Violenarten seit dem 14. Jahrhundert zur Erleichterung der Intonation im Gebrauch standen. Nur jene mandolinenförmigen, von der mittelalterlichen » lira« abstammenden »Geigen« hatten aus Gründen der abweichenden Fingertechnik keine Bünde. Es wurden nämlich auf diesen Tonwerkzeugen mit dem ersten und zweiten Finger je zwei nebeneinanderliegende Halbtöne gegriffen, wobei die Bünde hinderlich gewesen wären. Auf den übrigen ausschließlich mit Bünden versehenen Geigenarten fiel dieser Grund fort, da jeder Ton seinen besonderen Finger hatte.
Im Verlaufe des 16. Jahrhunderts, insbesondere aber in der zweiten Hälfte desselben, vermannigfaltigte sich die Viola, so daß dieser Name nicht mehr eine besondre Spezies von Streichinstrumenten, sondern eine mehrgliedrige Gattung derselben bezeichnete. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts zählte Prätorius in seinem Syntagma mus. folgende in der Musikpraxis gebräuchliche Arten auf:
1) Gar große Baß-Viol. 2) Groß Baß Viol de Gamba in drei verschiedenen Stimmungen. 3) Klein Baß Viol de Gamba in fünf verschiedenen Exemplaren. 4) Tenor- und Alt-Viol de Gamba in je zwei verschiedenen Stimmungen. 5) Cant Viol de Gamba (Violetta picciola) in vier verschiedenen Exemplaren. 6) Viol Bastarda in fünf verschiedenen Stimmungen und 7) Viola de Braccio in vier verschiedenen Exemplaren.
Aus diesen Violenarten gingen nach und nach der Kontrabaß, das Violoncell, die Bratsche Der Name »Bratsche« war schon im 13. Jahrh. für eine gewisse Schmucknadel gebräuchlich. und die Violine hervor.
Das zuletzt genannte Instrument, welches hier unsre besondre Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ist, wie schon der Name desselben zeigt, durch eine modifizierte Verkleinerung der Viola entstanden; denn Violino bedeutet das Diminutiv von Viola, gleichwie Violone (Kontrabaß) das Augmentativ zu diesem Wort bildet.
Die Violine oder »rechte Discantgeig«, wie sie Prätorius auch nennt, existiert nachweislich seit Mitte des 16. Jahrhunderts. Ihre Geburtsstätte ist in Oberitalien oder in Frankreich zu suchen. Wieweit Weckerlins Weckerlin, Musiciana. 3 Teile. Paris. Vermutung begründet ist, man habe wahrscheinlich schon im 15. Jahrhundert in Frankreich die Viola in kleineren Proportionen hergestellt und daraus die Violine (zunächst in einer dreisaitigen Form) geschaffen, muß hier dahingestellt bleiben. Als Stütze für seine Anschauung führt er an, daß Monteverde im Orchester des » Orfeo« (1608) die Violine als » violino piccolo alla francese« bezeichnet.
Da es ferner nunmehr sicher ist, daß der Erfinder der Violine, Kaspar Tieffenbrucker, über den wir alsbald Näheres hören werden, um 1550 in Lyon lebte und wirkte, gewinnt die Anschauung, Frankreich sei die Heimat unsres Instrumentes, weiter an Wahrscheinlichkeit. Da jedoch die Tradition sowie eine starke Möglichkeit dafür spricht, daß Tieffenbrucker in seiner Jugend sich in Oberitalien eine Zeitlang aufgehalten habe, kann nichts Stichhaltiges dagegen eingewendet werden, er habe bereits damals und dort die Violine erfunden.
Es muß nun aber die Frage gestellt werden, ob man bei der Violine von einem Erfinder überhaupt reden darf. Da das Bedürfnis nach einem Sopranstreichinstrument vorlag, ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß viele Instrumentenmacher damaliger Zeit Experimente in dieser Richtung anstellten. Daß Tieffenbrucker einer von ihnen, vielleicht der am ersten oder am meisten erfolgreiche war, muß angenommen werden. Dies ist das Sicherste, was derzeit über diesen Punkt zu sagen ist.
Eine frühe, interessante, neuerdings durch Weckerlin in seinem zitierten Buche bekannt gewordene Erwähnung der Violine stammt auch aus Frankreich und merkwürdigerweise ebenfalls aus Lyon. Philibert Jambe-de-Fer So lautet der Name korrekt. Walther in seinem Lexikon (1732) hat daraus gemacht: Philibert Jambe, geboren in Fère. Gerber zitiert ihn im alten Lexikon (unter Philibert) richtig, im neuen nach Walther., aus Lyon gebürtig, ließ dort im Jahre 1556 eine kleine Schrift drucken, deren Titel lautet: » Epitome musical de tons, sons et accordz ès voix humaines, fleustes d'Alleman, fleustes à 9 trous, violes et violons etc.« Gegen den Schluß dieses Werkchens wird mitgeteilt, die französische fünfsaitige Viole stimme in Quarten, die Violine habe 4 Saiten, die in Quinten gestimmt seien. Weiterhin heißt es: » On appelle violes celles desquelles les gentilhommes marchands et autres gens de vertu passent leur temps. Le violon est celui duquel on use en danserie communément, et à bonne cause; car il est plus facile à accorder, la quinte étant plus douce à ouïr que la quarte. II est aussi plus facile à porter, qui est chose fort nécessaire, en conduisant quelque noce ou momerie momerie ist unser deutsches Mummerei, Maskerade..« Sowohl für das Vorkommen der Violine wie hinsichtlich des damals von ihr noch eingenommenen Ranges ist die Stelle von Interesse.
Was nun Oberitalien angeht, so wurde dort seit der Mitte des 15. Jahrhunderts (spätestens) ebenso schwunghaft als erfolgreich der Bau nicht nur von Streichinstrumenten, sondern überhaupt von Saiteninstrumenten verschiedener Art betrieben. Namentlich waren die dort gefertigten Lauten ein sehr geschätzter Artikel, nicht minder aber auch die Violen. Dies beruhte keineswegs auf einem Zufall. Die Waldungen der an Oberitalien grenzenden Abhänge der Südtiroler Alpen lieferten jene Tannenholzart, welche für die Resonanzdecke der Saiteninstrumente erfahrungsmäßig ein Material von vorzüglichster Beschaffenheit ergab. Sehr erklärlich ist es daher, daß in der Nähe dieser Fundorte Werkstätten für den Saiteninstrumentenbau entstanden.
Schon zu Anfang des 15. Jahrhunderts lebte ein deutscher Lautenfabrikant Namens Laux (Lucas) Mahler in Bologna, und um die Mitte desselben wirkte der bereits genannte Instrumentenmacher Giov. Kerlino Höchstwahrscheinlich stammte Kerlino aus Deutschland her. S. meine Schrift: »Das Violoncell und seine Geschichte«, S. 6 (Leipzig, Breitkopf u. Härtel). in Brescia. Namhafte Lauten- und Violenbauer (die Fabrikation der Lauten und Violen lag zum Teil in ein und derselben Hand) des 16. und 17. Jahrhunderts waren sodann die Italiener: Testator ( il vecchio) in Mailand, Pietro Dardelli in Mantua, Morgato Morella in Mantua oder Venedig, Vettrini, Peregrino Zanetto, Giovanni Montichiari (Montechiaro) und Giovanni Giacomo della Corna in Brescia, sowie Venturo Linarolli in Venedig.
Die von diesen Männern gegründeten Werkstätten wurden alsbald durch Zuzug talentvoller Arbeiter von Norden her vermehrt. Insbesondere besitzen wir Kunde von mehreren Instrumentenmachern des 16. und 17. Jahrhunderts mit dem seltsamen Namen Dieffopruchar (nach anderer Schreibart Tieffopruchar, Tieffoprucar, Duiffopruggar, Dieffoprukhar, Duiffoprugar, Dieffenbruger, Duiffoproucart usw.). Dieser Name samt seinen vielen Varianten, deren Zahl sich angeblich auf 43 belaufen soll, ist durch Verwelschung des deutschen, heute noch in Bayern vorkommenden Geschlechtsnamens Tieffenbrucker (Tieffenbrücker, Tiefembrucker) entstanden Ein analoges Beispiel bietet der in Italien vorkommende Name Cocapieller, welcher durch Verwelschung des deutsch. »Guggenbühler« entstanden sein soll..
Zu Anfang des 16. Jahrhunderts lebte in Bologna ein Duiffopruggar mit dem Vornamen Uldrich. Derselbe war Lautenfabrikant Die Familie Heimsoeth in Bonn besitzt eine Laute von Uldrich D., deren Wölbung des Resonanzkastens aus Elfenbeinspänen gebildet ist.. Hundert Jahre später besaß Venedig einen Lautenmacher Magnus Duiffopruggar. Außer diesem gedenkt Baron in seiner »Untersuchung der Laute« noch eines Vendelinus sowie eines Leonardus Tieffenbrucker.
Die Lauten dieser Männer, welche vielleicht ein und derselben Familie angehörten, waren ehedem sehr beliebt und gesucht. Größere Berühmtheit aber erlangten die Erzeugnisse des im 16. Jahrhundert tätig gewesenen Instrumentenmachers Gaspard Duiffoproucart, welcher unser besonderes Interesse insofern beansprucht, als er nicht nur Lauten, sondern, außer Harfen und Violen, auch Violinen anfertigte.
Über diesen merkwürdigen Mann sind seither mancherlei Nachrichten verbreitet worden. Eine kürzlich in Paris erschienene Broschüre » Gaspard Duiffoproucart et les luthiers lyonnais du XVI. siècle. Etude historique accompagnée de pièces justificatives et d'un portrait en héliogravure par le Dr. Henry Coutagne. Paris, libraire Fischbacher (Société anonyme) 1893.« Coutagne war seines Zeichens Arzt in Lyon, er starb im Februar 1896. Auch als Komponist machte er sich unter dem Pseudonym Paul Claës bekannt., deren Verfasser Henry Coutagne heißt, liefert aber die Beweise, daß jene Nachrichten fast durchgängig unrichtig sind. Die Quelle dieser Falsa ist in einem, von dem französischen Schriftsteller Roquefort 1812 für die »Biographie Michaud« gelieferten Artikel zu suchen, in welchem es wörtlich heißt:
»Gaspard Duiffoprugcar est né dans le Tyrol Italien vers la fin du XVe siècle; il a voyagé en Allemagne, puis en Italie, et s'est fixé à Bologne au commencement du XVIe siècle. Lorsque le roi François Ier se rendit en 1515 dans cette ville pour établir le concordat avec le pape Léon X, il enrôla Duiffoprugcar parmi les artistes qu'il voulait ammener en France, et l'installa à Paris pour y fabriquer les instruments à archet de sa Chapelle royale. Mais notre artiste, incommodé par le climat froid et nébouleux de la capitale, demanda la permission de se retirer à Lyon et y serait mort avant le milieu du siècle.«
Dieser Bericht beruht, wie Coutagne überzeugend nachgewiesen hat, auf willkürlicher Erfindung, ist aber später von andern Schriftstellern (zunächst von Fétis), unter Hinzufügung von mancherlei Modifikationen, anstandslos benutzt worden. Ich habe bona fide von den bis dahin unwiderlegt gebliebenen Berichten über Duiffoproucart Gebrauch gemacht, bin nunmehr aber in der angenehmen Lage, auf Grund der Schrift Coutagnes Zuverlässiges mitteilen zu können.
Gaspard Duiffoproucart war ein Deutscher und wurde 1514 geboren, was mit Evidenz aus seinem 1562 von Pierre Woeirot gravierten, im » cabinet des estampes« der » Bibliothèque Nationale« zu Paris aufbewahrten Porträt hervorgeht. Seine Heimat war Bayern, sein Familienname: Tieffenbrucker. Ob er mit den vorerwähnten Instrumentenmachern gleichen Namens in verwandtschaftlicher Beziehung stand, bleibe dahingestellt.
Über Kaspar Tieffenbruckers Jugend-, Lehr- und Wanderjahre gibt Coutagne keinen Aufschluß. Es kam ihm eben nur darauf an, die spätere Lebensperiode des Meisters aufzuklären, während welcher derselbe in Lyon seßhaft war, wofür sich das erforderliche Beweismaterial in den dortigen Archiven vorgefunden. Zu welchem Zeitpunkt speziell Tieffenbrucker seinen Aufenthalt in Lyon nahm, hat sich nicht feststellen lassen. Sicher aber ist, daß er im Jahre 1553 dort wohnte und sein Geschäft betrieb. Seine Niederlassung in der genannten Stadt hatte gute Gründe. Dieser Ort bot ihm durch weitverzweigte Handelsbeziehungen besondere Vorteile für den lohnenden Vertrieb seiner Erzeugnisse dar. Durch reichlichen Absatz seiner von den Zeitgenossen hochgeschätzten Instrumente gelangte er bald zu den Mitteln, die es ihm möglich machten, im Jahre 1556 einen Weinberg » à la côte Saint-Sébastien« bei Lyon zu kaufen, auf welchem er sich ein von Hof und Garten umgebenes Wohnhaus erbaute. Dieser Grundbesitz mochte es ihm erwünscht machen, sich in den französischen Untertanenverband aufnehmen zu lassen, was ihm auch zwei Jahre später durch königl. Dekret gewährt wurde. In demselben ist »Fressin« als Geburtsort des » Caspar Dieffenbruger, alleman, faiseur de lutz« angegeben. Coutagne bemerkt dazu, es könne unter »Fressin« kein anderer Ort verstanden werden, wie die bayrische Stadt Freising. Nach begründeter Vermutung hielt sich Tieffenbrucker um das Jahr 1560 in Nancy am Hofe des Herzogs Karl III. von Lothringen auf ( Jacquot, » La musique en Lorraine«, 3. Ausg., Paris 1886).
Nicht lange sollte Tieffenbrucker sich seines Besitztums erfreuen, da die französische Regierung im Jahre 1564 den schon vorher gefaßten Plan zur Ausführung brachte, » à la côte Saint-Sébastien« eine Zitadelle zu errichten. Zunächst wurden Tieffenbruckers Liegenschaften noch nicht davon berührt. Da sein Haus sich aber nach Fertigstellung der fortifikatorischen Anlage innerhalb des Grabens der Zitadelle befand, wurde die Demolierung desselben als notwendig erachtet. Man expropriierte die Besitzung Tieffenbruckers, unterließ indessen, ihm die dafür festgesetzte Entschädigungssumme im Betrage von 9245 livres, 14 sols und 4 deniers auszuzahlen. Seine Verhältnisse gingen nun immer mehr zurück, so daß er mit seiner Familie (Frau und vier Kinder) in große Bedrängnis geriet, wodurch seine Arbeitskraft, wie es scheint, gebrochen wurde. Vom Kummer hingenommen und gebeugt, starb er 1570 oder 1571. Nach seinem Tode machte die Regierung das an ihm begangene Unrecht wieder gut, indem sie seinen Hinterbliebenen eine lebenslängliche Rente zuerkannte.
Die authentischen, durch Coutagnes Broschüre vermittelten Nachrichten über Tieffenbrucker, soweit sie dessen Existenz in Lyon betreffen, sind vorstehend nicht nur deshalb eingehender mitgeteilt worden, weil es sich um eine für jene Zeit berühmte Persönlichkeit handelte, sondern auch, weil Tieffenbrucker als »Erfinder« der Violine bezeichnet worden ist. Wenn für diese Behauptung freilich stichhaltige Beweise fehlen, so kann doch nicht bezweifelt werden, daß Tieffenbrucker zur Herstellung des fraglichen Streichinstruments wesentlich mitgewirkt hat.
Die Beschaffung eines derartigen, der Sopranstimme entsprechenden Tonwerkzeuges war damals schon ein Bedürfnis geworden, auf dessen Realisierung die Instrumentmacher ohnehin ihr Augenmerk richten mochten. Seither hatte im instrumentalen Chor hauptsächlich das Kornett (der Zinken) die melodieführende Stimme vertreten, weil den Violen der sopranartige Klang fehlte. Dieses Blasinstrument aber war dem Charakter der Violen nicht homogen, und so lag das Verlangen nahe, ein diesen letzteren verwandtes, dabei aber möglichst dem Sopran entsprechendes Streichinstrument zu schaffen. Nachdem dies geschehen, wurde das neue Kunstprodukt, welches den Namen »Violine« erhielt, sehr bald Gegenstand der Beachtung und Würdigung, wie es denn auch das Kornett weiterhin aus seiner dominierenden Stellung vollständig verdrängte. Wann die Violine zuerst in der Musikpraxis Verwendung fand, ist noch nicht vollständig aufgeklärt. In Frankreich existierte der Name »Violon« schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts In seiner Schrift » Antoine Stradivari« (Paris 1856) sagt Fétis, der Name » Violino« finde sich schon in Lanfrancos » Scintille di musica« (Brescia 1533). Doch beruht diese Angabe auf einem Irrtum. Lanfranco gebraucht in seiner vorgenannten Schrift immer nur den Ausdruck » Violone«, woraus Fétis » Violino« gemacht hat. – Nach Federigo Sacchis Ermittelungen soll der Name » Violino« in der ital. Sprache vor dem Jahre 1562 nicht vorkommen. ( Gazetta musicale di Milano, 1891 6. settembre.). Doch soll unter diesem Ausdruck, wie Coutagne behauptet, keine exakte Übersetzung des Terminus » Violino« zu verstehen sein.
Daß Tieffenbrucker bereits vor Anfertigung seines oben erwähnten Porträts (1562) tatsächlich Violinen gebaut hat, geht unzweifelhaft aus den Darstellungen der Instrumente hervor, welche Pierre Woeirot nach den ihm vorgelegten Modellen des Meisters unter dessen Bildnis angebracht hat. Eines dieser Instrumente ist unverkennbar eine mit 5 Saiten bezogene und mit Bünden auf dem Griffbrett versehene Violine. Ihre Gestalt entspricht mit Ausnahme der oberen Hälfte des Korpus, welche etwas länger ist als die untere und nach dem Halse zu schmal ausläuft, gänzlich der späteren Geigenform. Ferner befindet sich ganz links im Schatten, halb verdeckt, ein viersaitiges, soviel sich sehen läßt völlig violinähnliches Instrument. Leider scheint keine der von Tieffenbrucker gebauten Violinen bis auf unsere Zeit gekommen zu sein. Denn die Echtheit jener sechs von Niederheitmann in dessen Broschüre »Cremona« (3. Aufl. 1897) erwähnten, dem Tieffenbrucker zugeschriebenen Exemplare ist im Hinblick auf Coutagnes Ermittelungen mehr als zweifelhaft geworden. Da Tieffenbrucker erst 1514 geboren ist, sind wenigstens die Jahreszahlen 1510-17, die sich in jenen Instrumenten finden, sämtlich falsch, oder die Violinen sind nicht von Tieffenbrucker. Hierauf bezüglich wird behauptet, daß Vuillaume, von dem man weiß, daß er eine Zeitlang durch für echt ausgegebene Kopien italienischer Geigeninstrumente seinen Unterhalt erwarb (vgl. S. 46 dieses Buches), auch Tieffenbruckersche Geigen imitiert habe. Haben jene von Niederheitmann beschriebenen Instrumente auch ein sehr altes Aussehen, wodurch gewiegte Kenner und erfahrene Fachleute bestimmt worden sind, sie für echt zu erklären, so muß man doch entschieden bedenklich werden, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Inschriften der fraglichen Violinen nach Ort und Zeit mit den fingierten Angaben Roqueforts auffallend übereinstimmen, woraus denn zu folgern wäre, daß diese Instrumente auf Grund der Roquefortschen Fiktionen, also erst nach dem Jahre 1812 fabriziert worden sind, was ebenfalls auf Vuillaume paßt. Ihr Verfertiger war zudem allem Anschein nach wirklich ein Franzose, da ihre Inschriften den Vornamen Tieffenbruckers im französischen Idiom tragen, nämlich » Gaspard«. Wären sie in Bologna entstanden, wie auf den Inschriften ausdrücklich angegeben ist, so würde das italienische » Gasparo« gebraucht worden sein. Falls nicht erneute Funde und Nachforschungen mehr Klarheit in die Angelegenheit bringen, wird über eine bloße Möglichkeit, daß ein oder die andere Tieffenbruckersche Violine bis auf unsere Zeit gekommen sein kann, nicht hinauszugelangen sein.
Nach Tieffenbrucker ist als Geigenmacher zunächst Gasparo da Salò (geb. um 1542, gest. 14. April 1609) zu erwähnen. Er begründete in betreff des Violinbaues die Brescianer Schule, und zwar fast gleichzeitig mit der durch Amati ins Leben gerufenen Cremoneser Schule.
Gasparo di Bertholotti, genannt da Salò nach seiner am Gardasee gelegenen Geburtsstadt Salò, arbeitete von 1560, nach anderen von 1568-1609 in Brescia, gab sich aber hauptsächlich, da der Bedarf an Violinen zu seiner Zeit noch nicht sehr groß war, mit der Fabrikation von Violen und Bässen ab. Die wenigen von ihm vorhandenen Violinen, von denen eine im Besitz Ole Bulls war, haben, wie sehr sie auch von Kennern und Liebhabern geschätzt werden mögen, für die Gegenwart ein mehr kunsthistorisches als praktisches Interesse. Denn die unzweifelhaft echten und wohlerhaltenen Exemplare dieses Meisters sind höchst selten und dadurch zu sogenannten Kabinettstücken geworden. Dann aber entsprechen sie auch, was ihre Klangfähigkeit betrifft, nicht mehr den hochgespannten solistischen Anforderungen der Gegenwart. Ihre äußere Erscheinung läßt, namentlich den Erzeugnissen der Cremoneser Schule gegenüber, gleichfalls unbefriedigt; sie hat etwas ungemein Steifes, Eckiges, man möchte sagen pedantisch Unfreies. Es konnte kaum anders sein. Mußte doch erst die innere und äußere Norm des Violinbaues gefunden und festgestellt werden. Und um dies zu erreichen, bedurfte es noch einiger Dezennien angestrengter Arbeit.
Gasparo da Salòs unmittelbarer Nachfolger ist der Brescianer Giovanni Paolo Maggini Über Magginis Leben und Wirken erschien 1892 in London eine interessante Schrift unter dem Titel: » Gio. Paolo Maggini, his life and work, compiled and edited from material collected and contributed by William Ebsworth Hill and his sons William, Arthur & Alfred Hill by Margaret L. Huggins.« Verlag von W. E. Hill & Sons, 38 New Bond Street, London W., Novello, Ewer & Co. London and New York. 1892.. Er wird als ein Schüler des ersteren bezeichnet, doch liegen keine Beweise dafür vor. Lediglich glaubt man aus einer gewissen Übereinstimmung der Arbeiten beider Künstler auf ein derartiges Verhältnis schließen zu dürfen. Mit den Geigen des Maggini hat es eine ähnliche Bewandtnis wie mit denen seines Vorgängers. Sie sind gleichfalls selten geworden und gelten im allgemeinen nicht mehr für Instrumente ersten Ranges, obwohl sie höher geschätzt werden als die Erzeugnisse Gasparo da Salòs. Eine sehr gut erhaltene und außerordentlich wohlklingende Violine von Maggini besaß der belgische Geigenmeister Charles de Bériot. Maggini wurde geboren am 25. August 1580 zu Botticini, er starb um 1640.
Magginis Violinen sind bedeutend ansehnlicher als diejenigen Gasparo da Salòs, zeigen aber noch nicht die volle Schönheit der Cremoneser Meister. Der Formgebung des Resonanzkastens fehlt es an Schlankheit und fein abgewogenem Ebenmaß der Verhältnisse sowohl hinsichtlich des Umrisses wie der Wölbungen, und den f-Löchern mangelt schwungvolle Zeichnung: sie sind etwas zu gestreckt und spitz geraten. Charakteristisch für seine Instrumente ist die nicht selten auf ihnen angebrachte doppelte Adereinlage an den Rändern, welche auf der Unterdecke häufig in arabeskenartige Verschlingungen ausläuft.
Nach dem Vorbilde Magginis arbeiteten außer seinem Sohne Pietro Santo Maggini die Italiener Matteo Bente, Javietta Budiani, Antonio Moriani, Peregrino Zanetto, sowie Domenico und Gaetano Pasta. Doch sind die Instrumente aller dieser Männer nicht ausgezeichnet durch Klangschönheit.
Bei weitem höher zu stellende Leistungen als die Brescianer erreichten die Meister der Cremoneser Schule Vgl. hierüber » Cremona«, eine Charakteristik der ital. Geigenbauer etc.« von Friedr. Niederheitmann, 3. Aufl. 1897, redigiert von Dr. E. Vogel, sowie Piccolellis wertvolles Werk » I Liutai antichi e moderni« (1885) mit einem Nachtrag (1886), welches über die Italiener, insbesondere die Amati , viele neue Aufschlüsse enthält., welche, wie schon bemerkt, durch Andrea Amati, geboren um 1535, gestorben nach dem 10. April 1611, den Sprößling einer vornehmen Familie Cremonas, begründet wurde. Zwar war dieser Senior der Geigen-Amatis, obwohl seine Instrumente schon so hohe Schätzung fanden, daß er für die Kapelle Charles IX. von Frankreich eine bedeutende Zahl Violinen, Violen und Bässe zu liefern hatte, in seinen an die Brescianer Fabrikanten erinnernden Leistungen noch weit entfernt von den Musterleistungen seiner Nachkommen; aber schon in seinem Sohne Girolamo offenbart sich ein bedeutsamer Fortschritt in der Geigenbaukunst, sowohl hinsichtlich der äußeren Erscheinung als auch in betreff der Klangschönheit.
Andrea Amati hatte noch einen zweiten Sohn, mit dem Vornamen Antonio. Dieser war der ältere der Brüder und hielt sich ziemlich genau an die Überlieferungen seines Vaters, während Girolamo von denselben, insbesondere hinsichtlich einer gefälligeren Formgebung, abwich. Antonio wurde geboren um 1555, Girolamo um 1556. Nur das Todesjahr des jüngeren ist sicher bekannt, er starb 1630 an der Pest. Da Antonio damals etwa 75 Jahre alt war, ist er sicher nicht viel später gestorben. Damit wird die Echtheit einer Anzahl Geigen der Brüder – sie waren eine Zeitlang gemeinsam tätig – welche Zettel aus den Jahren 1661 bis 1698 (!) tragen, äußerst fraglich. Man kann annehmen, daß um jene Zeit wohl noch Zettel, aber keine unverkauften Violinen der Brüder mehr vorhanden waren. Etwas näher geht E. Vogel in der unter 2 Ein älterer Bruder Nicolas, Francesco Alessandro geheißen, hat möglicherweise ebenfalls Violinen gebaut. Vgl. E. Vogel in der Vierteljahrschr. f. Musikwissensch. 1888. p. 519 ff. zitierten Abhandlung auf diese Frage ein.
Die ungewöhnliche Begabung des Girolamo Amati für den Streichinstrumentenbau vererbte sich auf dessen Sohn Nicola, geb. 3. Dezember 1596, gest. 12. April 1684, mit welchem diese Familie bezüglich der Violinfabrikation ihren Höhepunkt erreichte Ein älterer Bruder Nicolas, Francesco Alessandro geheißen, hat möglicherweise ebenfalls Violinen gebaut. Vgl. E. Vogel in der Vierteljahrschr. f. Musikwissensch. 1888. p. 519 ff.
Nicola Amati blieb anfangs den väterlichen Überlieferungen treu. Dann aber unternahm er selbständige Versuche, welche ihn schließlich zu einer ansehnlicheren, räumlich entwickelteren Formgebung der Violine führten. Die ungewöhnlich hohe Wölbung indessen, welche er seinen Instrumenten zugleich gab, ließ die Vorteile des etwas vergrößerten Formates nicht ganz zur Geltung gelangen. Es kommt daher, daß dem leise verschleierten, doch hinreichend klaren Silbertone seiner Geigen Breite, Kraft und Sonorität des Klanges mangelt. Nichtsdestoweniger sind dieselben stets hoch geschätzt worden; sie können aber trotz ihrer vorzüglichen Eigenschaften, sehr vereinzelte Fälle ausgenommen, nicht mehr den heutigen so gesteigerten Ansprüchen an Konzertinstrumente vollständig Genüge leisten. Die Technik der Arbeit an ihnen ist vollendet und in den einzelnen Teilen harmonisch übereinstimmend. Nur die Schnecke, obwohl an sich schön geschnitten, ist etwas zu zierlich im Vergleich zum Korpus des Instrumentes.
Der Sohn des Nicola, wiederum Girolamo benannt (geb. 26. Februar 1649, gest. 21. Februar 1740), welcher die Reihe der Amati beschließt, nimmt unsere Aufmerksamkeit nicht weiter in Anspruch, da seine wenigen Arbeiten nur von mittlerer Güte sind.
Nicola Amati fordert unsern künstlerischen Anteil noch insbesondre, weil er der Lehrmeister des Antonius Straduarius, oder Antonio Stradivari Über Stradivari erschien 1902 ein Prachtwerk unter dem Titel: » Antonio Stradivari, His life and work (1644-1737) by W. Henry Hill, Arthur F. Hill, F. S. A. a. Alfred E. Hill. With an introductory note by Lady Huggins. London, William Hill a. Sons. 1902.« (Vergl. d. Anm. bei Maggini.) Die unten folgenden Notizen über das Leben Stradivaris sind diesem Werk entnommen., geb. 1644, gest. 18. Dez. 1737, dieses hervorragendsten aller Geigenbaukünstler bis auf unsere Tage ist. Diesem herrlichen Meister wohnte nicht nur ein außerordentliches Genie für seinen Beruf inne; er gehört auch zu jenen unverwüstlichen Kraftmenschen, die bis in ihr hohes Alter unaufhörlich schaffen und wirken. Stradivari überdauerte drei Generationen, und gleichwie Tizian, das Haupt der Venezianischen Malerschule, als neunundneunzigjähriger Greis ein Bild schuf, so fertigte Stradivari, der ruhmreichste Vertreter der Cremoneser Schule, in seinem zweiundneunzigsten Lebensjahre noch eine Violine. Die Entwicklung dieses aus einem Cremoneser Patriziergeschlecht abstammenden Künstlers ist ebenso folgerichtig als glücklich. Zunächst schließt er sich eng an das Vorbild seines Lehrers an, mit einer Genauigkeit, die es erlaubt scheinen läßt, daß seine ersten Gebilde den Namen Amatis tragen. Dann folgt eine längere Periode in seinem Leben, aus der nur wenige Instrumente von ihm vorhanden sind. Fétis ist der Ansicht, daß er sich damals mehr mit Versuchen als mit wirklicher Produktion beschäftigt habe. Man darf dieser Meinung beipflichten, denn es ist gewiß, daß die beispiellosen Leistungen, welche Stradivari später in seinem Fach hinstellte, nur als Resultate eines langjährigen, mühevollen Studiums aufgefaßt werden können. In den Jahren 1684 und 1685, entscheidender 1690, also erst im reiferen Mannesalter, vermochte er auf seiner preisgekrönten Laufbahn mit Sicherheit einen Schritt vorwärts zu tun. Wir sehen ihn indes auch um diese Zeit noch teilweise an die Überlieferungen der Amatischen Schule gebunden. Er verändert zwar schon wesentlich die Wölbung und Stärkeverhältnisse der Ober- und Unterdecke sowie die Lackierung und bringt dadurch die Violine ihrer Vollendung immer näher; dennoch aber behalten seine Instrumente noch Amatische Reminiszenzen, von denen sie sich vor Ablauf eines weiteren Dezenniums nicht völlig befreien. Auf der Grenzscheide des 17. und 18. Jahrhunderts sodann erblicken wir Stradivari in voller Selbständigkeit. Seine Instrumente aus den Jahren 1700-1725 tragen den Stempel des eigenen Stils, jenes Stils eben, der ihn zum Meister aller Meister des Violinbaues machte. Die empfangenen Traditionen existieren für ihn nur noch in ihrer Allgemeingültigkeit; im besondern sehen wir ihn durchgängig mit dem vollen Bewußtsein des freischaffenden Genius verfahren. Die hervorstechendste prinzipielle Modifikation besteht in der soeben schon angedeuteten flacheren Wölbung der Decken, die in dieser mäßigen Erhebung kaum noch bei einem andern einflußreichen Meister des Violinbaues wieder vorkommt. Ihr ist es hauptsächlich zuzuschreiben, wenn der Ton seiner Geigen jene allgemein bewunderten Eigenschaften der Fülle, des Glanzes und Gehaltes erhielt, welche Amati seinen Erzeugnissen nur teilweise und auch nur in geringerem Grade zu geben vermochte.
Stradivari erschöpfte seine Kunst nach allen Beziehungen hin: er schuf das Ideal der Geige. Ihm stand ein sicher treffender Blick für harmonische, man möchte sagen malerische Verhältnisse zu Gebote, und seine kunstgeübte Hand, die nichts Unschönes zu gestalten vermochte, war seinem geläuterten Geschmack untertan. Sie gab dem Instrument in seinen Hauptkonturen edle, schwunghafte Linien, deren fein empfundener arabeskenartiger Zug sich auf alle Einzelteile bis ins kleinste Detail überträgt. Die Wölbungen und Biegungen sind von schöner, wellenförmiger Bewegung, die Ausladungen der Backen von schönstem ebenmäßigen Verhältnis, und der in seiner Totalität zu vollendeter Plastik durchgebildete Körper endigt mittelst des Halses in einer kräftigen, energisch zusammengezogenen, von gleichsam frei schwebenden Spiralen umflossenen Schnecke, deren elastischer Schwung an sich ein Meisterstück der Bildhauerkunst genannt werden darf. Beschlossen wird der Gesamteindruck endlich durch den Firnis, welcher alle Teile des Instruments mit Ausnahme des Halses bedeckt. Dieser Firnis, der trotz aller Bemühungen bis heute noch nicht wieder hergestellt worden ist, dient einerseits zum Schutz des Instruments gegen Witterungseinflüsse, andrerseits zur Hebung der äußern Erscheinung. Jeder der epochemachenden Meister des Violinbaues bewahrt auch in dieser Hinsicht seine Eigentümlichkeit. Nicola Amati hat einen klaren Lack von goldgelber, fast blonder Farbe angewendet. Das Kolorit des von Stradivari gebrauchten, mehr pastosen Firnisses ist dagegen tiefer und farbensatter; es wechselt zwischen tiefem, bernsteinartig funkelndem Rot und saftigem Kastanienbraun. Dabei ist es zugleich von einem wachsartigen, mattglänzenden und doch wieder auch feurigen Lüster, dessen volle Durchsichtigkeit Textur und Spiegel des mit größter Sorgfalt ausgewählten Holzes in ein um so günstigeres Licht stellt.
Die in jedem Betracht vollendete äußere Erscheinung, welche Stradivari seinen Gebilden zu geben wußte, hätte ihm indes keineswegs allein schon jene hervorragende Stellung unter seinen Fachgenossen angewiesen, wenn ihm nicht zugleich in dem ausgebildetsten Tonsinne eine Eigenschaft eingeboren gewesen wäre, ohne die seine Instrumente ihren eigentlichen Wert, den Hauptreiz der Klangschönheit nämlich, entbehrt haben würden. Jeder wahre Künstler trägt ein seiner Begabung und Werktätigkeit entsprechendes Ideal in sich, und unverrückt arbeitet er auf die Verwirklichung desselben hin. Gleichwie der Maler mit seinem innern Auge Bilder sieht, der Musiker mit seinem innern Ohr Melodien und Harmonien vernimmt, also hört der Instrumentenmacher innerlich den elementaren Ton erklingen. Es ist dies nicht irgend ein Ton, sondern ein nach Charakter, Farbe und Gehalt bestimmter Ton, mit einem Wort: ein Tonideal. Je stärker, je mächtiger nun dasselbe in der Seele des gestaltenden Künstlers lebt, je reiner und schärfer es ausgeprägt ist, desto vollkommener wird auch, das technische Vermögen vorausgesetzt, die Klangfähigkeit des von ihm gefertigten Instruments sein. Und Stradivari ist auch in dieser wesentlichsten Beziehung, wenn nicht das unerreichte, so doch das unübertroffene Muster. Seine Violinen sind tonbeseelte Kunstorgane, die freilich noch der kundigen Hand des ausübenden Musikers bedürfen, um ihre unvergleichlichen Reize entfalten zu können. Ihr Ton erfüllt die mannigfachsten Anforderungen der Klangschönheit. Er ist sopranartig singend, metallisch kraftvoll, glänzend, edel, und wiederum auch einschmeichelnd süß, sanft und geschmeidig. Sein Volumen ist ungemein konzentriert, und die ihm eigene intensive Energie verleiht ihm eine bewundernswerte Tragfähigkeit. Dabei gewährt die eigentümlich schillernde Tonqualität dem Spieler die Möglichkeit verschiedenartiger Farbengebung, welche trotz des ausgesprochensten Violincharakters an die menschliche Stimme sowie an verschiedene Blasinstrumente, z. B. an die Flöte, Klarinette, Oboe und auf der G-Saite an das Horn erinnert. Endlich ist aber dem Klangwesen der Stradivari-Violinen noch ein, durch Worte nicht näher zu bezeichnender poetisch verklärter Schmelz eigen, der in dieser eigenartigen Ausprägung sich nicht wieder bei andern Meistern des Geigenbaues geltend macht.
So ausschließlich auch für den Hörer der Tongehalt eines Instruments in Betracht kommt, so ist er doch keineswegs getrennt von der Formgebung desselben zu denken. Man kann freilich nicht sagen, daß eine Geige schön klingt, weil sie schön aussieht; ihre äußere Schönheit ist etwas durchaus Relatives. Wohl aber ist es erwiesen, daß die Konstruktion, also die Form des Schallkörpers, in inniger Wechselwirkung zum Tongehalt desselben steht. Je zweckmäßiger nun diese Konstruktion ist, je mehr die einzelnen Teile zueinander und zum Ganzen in Proportion sich befinden, je harmonischer also die Durchbildung des Geigenkörpers ist, desto mehr muß auch der Tongehalt gewinnen. Diese Tatsache läßt sich bei allen Meistern des Violinbaues beobachten, und bei Stradivari zeigt sie sich in höchster Vollendung. Hieraus resultiert mit Evidenz, daß seine Formgebung, welche von Kennern schön genannt wird, keine zufällige, sondern eine notwendige ist.
Die zahlreichen Nachahmer des Meisters haben nichts unversucht gelassen, in seine Fußtapfen zu treten. Man hat die Violinen Stradivaris nach allen Seiten hin aufs genaueste analysiert, untersucht und ausgemessen; man hat geglaubt, auf wissenschaftlichem Wege zu dem Geheimnis seines Verfahrens gelangen zu können, man hat endlich seine Instrumente täuschend kopiert, und trotz alledem nicht die gewünschten Resultate zu erreichen vermocht. Sehr natürlich, denn es fehlte die Hauptsache bei diesem Beginnen, der schaffende Geist, welcher sich in den Leistungen Stradivaris so glänzend manifestiert. Es ist den Menschen hier ebenso ergangen, wie in allen andern Dingen, wo die sklavisch treue, aber seelisch tote Nachahmung an die Stelle freier schöpferischer Tätigkeit tritt.
Die Gegenwart besitzt noch eine beträchtliche Anzahl Stradivarischer Instrumente, darunter auch Bratschen und Celli; Fétis schätzt ihre Gesamtzahl auf mehr als 1000. Ein Teil derselben ist nebst den Erzeugnissen andrer italienischer Meister leider durch den Vandalismus unberufener Pfuscherhände zugrunde gerichtet worden. Es gab nämlich eine Zeit, da man in dem Wahn befangen war, die italienischen Instrumente seien zu stark im Holz und könnten durch Beseitigung dieses vermeintlichen Übelstandes nur gewinnen. So wurde ein nicht geringer Teil der vorhandenen Instrumentenbestände durch Ausschaben oder, wie der Handwerksausdruck besagt, durch »Ausschachteln« des Resonanzbodens und der Unterdecke geschwächt und auf diese Weise gewissermaßen degeneriert, ein ebenso beklagenswerter als unersetzlicher Verlust für die musikalische Welt. Der Wert guter, unverdorbener Instrumente aus der italienischen Meisterzeit ist mit dadurch bei dem gesteigerten Bedürfnis der Gegenwart ungemein in die Höhe gegangen. Stradivari soll für seine Geigen mit 4 Louisdor honoriert worden sein. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts kosteten sie bereits 100 Louisdor, und gegenwärtig erhebt sich der Preis für eine wohlerhaltene Violine dieses Meisters bis zu 20 000 Mark und mehr. Nicht selten ist hierbei die Liebhaberei entscheidend, die bekanntlich in betreff von Kunstgegenständen mitunter an Monomanie grenzt. Man weiß, daß es in der englischen Geldaristokratie Persönlichkeiten gibt, die lediglich des toten Besitzes halber wertvolle oder auch seltene Kunstschätze käuflich erwerben, ohne einmal anderen den Mitgenuß an denselben zu gewähren. Es sollen unter diesen seltsamen Liebhabern auch einige existieren, die im Besitz kostbarer Stradivarigeigen sich dem anspruchslosen Vergnügen widmen, dieselben nicht etwa zu spielen, sondern gelegentlich nur zu besehen. Tatsache ist es jedenfalls, daß die Zahl der intakten noch vorhandenen italienischen Meisterinstrumente für die musikalische Praxis, wenigstens vor der Hand, auf bedauerliche Weise durch einen unfruchtbaren Privatbesitz geschmälert wird.
Was Stradivari nach 1725, also etwa von seinem 80. Lebensjahre ab noch geschaffen hat, läßt mehr und mehr die Schwäche des Alters erkennen. Hauptsächlich von seinen beiden Söhnen Omobono Felice, geb. 14. Nov. 1679, gest. 8. Juni 1742, und Giacomo Francesco, geb. 1. Febr. 1671, gest. 11. Mai 1743, sowie von seinem Schüler Carlo Bergonzi bei der Arbeit unterstützt, war er in dieser Zeit zudem überwiegend auf dem Wege der Anleitung tätig. Dennoch entsagte er, wie wir gesehen haben, erst ein Jahr vor seinem Tode völlig dem so lange mit vollster künstlerischer Hingebung gepflegten Beruf.
Stradivari ist nach dem Hillschen Werke nicht in Cremona selbst, vielleicht aber in dessen Nachbarschaft geboren im Jahre 1644. Über seine Jugend ist absolut nichts bekannt. Sicher zeigte er früh Talent zum Geigenbau und wurde bald der Schüler Nicola Amatis in Cremona. Diese alte Tradition, an der Stradivaris frühere Instrumente kaum Zweifel ließen, ist nunmehr durch das früheste Dokument, welches wir aus seinem Leben besitzen, erhärtet worden. Es ist der Zettel einer Violine von 1666, auf dem er sich nennt: Antonius Stradiuarius Cremonensis, Alumnus Nicolaij Amati.
Schon im folgenden Jahre, am 4. Juli 1667, ehelicht er Francesca, geb. Feraboscha, die junge Witwe eines gewissen Capra, die, wie aus den sich mannigfaltig widersprechenden Registern doch hervorgeht, einige Jahre älter als der 23jährige war. Seine Eile ist verständlich, da noch im selben Jahre (21. Dezember) das erste Kind, eine Tochter, geboren wurde. Ihr folgten noch 5 Kinder, darunter die beiden Geigenbauer.
Francesca starb im Mai 1698, im folgenden Jahre schritt Stradivari, 55 Jahre alt, zu einer zweiten Ehe mit Signora Antonia Maria Zambelli. Er zeugte mit ihr noch 5 Kinder, 1 Tochter und 4 Söhne. Im ganzen hatte er 11 Kinder, worunter 8 Söhne. Von ihnen starb der letzte im Dezember 1781. Näheres über die Familie findet sich in dem Hillschen Werk.
Stradivari erlebte mit 93 Jahren noch den Tod seiner zweiten Frau, der am 3. März 1737 erfolgte, am 18. Dezember desselben Jahres folgte er ihr in die Ewigkeit nach. – Über sein Haus, die bis 1809 erhaltene Begräbnisstätte und viele Einzelheiten wolle man Hills erschöpfendes Werk vergleichen.
Nicht als Schüler, wie man bisher meist annahm, wohl aber als ebenbürtiges Genie tritt neben Stradivari Giuseppe Guarneri. Auch in dieser Familie, wie bei den Amati, geht die Kunst des Geigenbaues durch mehrere Generationen. Als Stammvater wird Andrea Guarneri, geb. um 1626, genannt. Einer der ersten Schüler des Nicola Amati, fällt seine Tätigkeit zwischen die Jahre 1650-1695. Er hält sich in seinen Arbeiten zur Hauptsache an die Überlieferungen seines Lehrers. Sein Todestag ist der 7. Dezember 1698.
Als Sohn und Schüler des Andrea Guarneri folgt dann ein Giuseppe Guarneri, 1666 bis gegen 1739, der sich teils an Stradivari, teils an seinen Vetter, den schon genannten gleichnamigen und bei weitem bedeutenderen Giuseppe Guarneri anlehnt. Ein älterer Sohn des Andrea G., namens Pietro, geb. 1655, dessen Produktionszeit von 1690-1725 angegeben wird, ansässig in Mantua, blieb trotz großen Fleißes gegen die Leistungen seines Bruders zurück.
Ferner erscheint noch ein Enkel des Andrea Guarneri, gleichfalls Pietro, tätig 1725-1740, Sohn des Giuseppe, auf dem Schauplatz der Familientätigkeit, dessen Instrumente denjenigen seines Vaters und Lehrers nahekommen. Geboren wurde er 1695.
Endlich entsproß aus einer Seitenlinie der Guarnerifamilie das Haupt derselben, der bereits wiederholt genannte Giuseppe Guarneri, mit dem seltsamen Beinamen » del Gesù«, geb. den 16. Okt. 1687 zu Cremona, gest. nach 1742. Sein Vater, Giovanni Battista, war ein Bruder des Andrea Guarneri.
Man besitzt von diesem Künstler, den manche Kenner mit Stradivari gleichstellen, Instrumente aus den Jahren 1725 bis nach 1742. In der Tat kann ein Teil seiner Geigen mit den besten gleichartigen Erzeugnissen Stradivaris rivalisieren. Ja, diesen wird von den exklusiven Verehrern Guarneris die Superiorität zuerkannt. Dies ist indes lediglich Geschmacksache. Genug, daß beide Männer in ihrer Sphäre Außerordentliches geleistet haben. Immerhin muß dem älteren Meister ein Vorsprung vor dem jüngeren, wenigstens in einer Beziehung, zuerkannt werden: wie tüchtig und gediegen auch die besten Violinen Guarneris gestaltet sind, ihnen mangelt nicht selten die Vollendung der Arbeit. Das Tonvolumen der Guarnerigeigen ist im allgemeinen scheinbar breiter und namentlich für den Spieler frappanter als das der Stradivarigeigen. Doch fehlt ihm in der Regel das konzentriert Zusammenhaltende und Intensive der letzteren. Auch hat er bei aller Noblesse nicht völlig den vergeistigten Charakter des Stradivaritones. Guarneri adoptierte die flache Wölbung Stradivaris; in manchen minder wichtigen Beziehungen der Formgebung unterscheidet er sich aber von demselben sehr wesentlich, so namentlich im Zuschnitte der f-Löcher, welche an die Brescianer Schule erinnern, und in den Windungen der bei Stradivari ungleich schöner und regelmäßiger gebildeten Schnecke. Über das Leben Guarneris werden romanhafte Dinge erzählt, allein sie sind nicht verbürgt. So viel geht aber mit Sicherheit aus den durch mündliche Tradition auf uns gekommenen Berichten hervor, daß er ein unstätes Leben voller Bedrängnisse führte: er scheint eines jener halt- und charakterlosen Genies gewesen zu sein, die, ihren Leidenschaften ergeben, jeder glücklicheren Gestaltung des Daseins gewaltsam entgegenarbeiten. Man hat hierin die Erklärung für die oft nachlässige, wenn auch im allgemeinen von hoher Begabung zeugende Arbeit gesucht, durch welche eine Anzahl seiner Instrumente gekennzeichnet ist. Eines der schönsten Exemplare, ehedem Paganinis Favoritgeige, die der epochemachende Virtuose scherzweise seine »Kanone« nannte, befindet sich infolge testamentarischer Verfügung unter Schloß und Riegel in dem Palazzo municipale zu Genua. Auch sie ist, gleich manchen Stradivarigeigen, durch einen Akt persönlicher Eitelkeit auf immer für die ausübende Kunst des Violinspiels verloren.
Mit Giuseppe Guarneri schließt die Glanzepoche des italienischen Geigenbaues ab Das Nähere über die außer der Brescianer und Cremoneser noch unterschiedenen italienischen Schulen (Neapolitaner, Florentiner, Venezianer) wolle man in Spezialwerken (Piccolellis, Niederheitmann u. a.) vergleichen.. Es folgt nun eine beträchtliche Zahl zum Teil sehr geschickter Männer, die als Nachahmer der vorhandenen Muster tätig sind, aber nur als Instrumentenmacher zweiten und dritten Ranges gelten. Die namhaftesten derselben sind: Matthias Albani, Schüler von Nicola Amati, lebte und wirkte von 1650 bis 1709; Carlo Bergonzi (1712-1750), Stradivaris sehr geschätzter Schüler, der die Arbeiten seines Meisters so getreu zu kopieren verstand, daß in manchen Fällen die Autorschaft zweifelhaft bleibt; Alessandro Gagliano (1640-1725), angeblich Schüler Stradivaris; Paolo Grancino in Mailand (1665-1690), Schüler des Nicola Amati, nebst seinen Söhnen Giov. Battista und Giov. Grancino; Lorenzo Guadagnini (1695-1742), neben Bergonzi der angesehenste Schüler Stradivaris; Giovanni Battista Guadagnini (1750-1785); Domenico Montagnana (1700 bis 1750), gleichfalls Schüler Stradivaris; Francesco Rugieri; Giacinto Rugieri; Vincenzo Rugieri; Giovanni Battista Rogeri; Pietro Giacomo Rogeri Wie Piccolellis nachgewiesen, handelt es sich um zwei Familien, Rogeri und Rugieri, die zu gleicher Zeit, beide meist in Cremona, lebten und tätig waren. Sie suchten durch Beinamen ihre Instrumente auseinanderzuhalten, so bezeichnete sich Joh. Bapt. Rogeri als Bon., was natürlich Bononiensis (aus Bologna) heißen sollte, aber lange Zeit als bonus (der Gute) gelesen wurde. Näheres bei Piccolellis.; Santo Seraphin (1730 bis 1745); Nicola Gusetto (um 1730); Lorenzo Storioni (1770-1799) und Carlo Giuseppe Testore (1690-1720).
In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, also etwa ein Menschenalter nach Stradivaris Tode, gewahren wir ein allmähliches Erlöschen der Geigenbaukunst in Italien. Die Ausläufer der Hauptstämme sterben nach und nach ab, und kein junger Nachwuchs tritt an ihre Stelle. Allenfalls wäre nur noch Francesco Pressanda, welcher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Turin nach Stradivaris Vorbild arbeitete, zu erwähnen.
Eine Reminiszenz jener Glanzepoche des italienischen Geigenbaues, welche sich heute noch geltend macht, ist die römische und neapolitanische Darmsaitenfabrikation, deren qualitative Ergebnisse immer den Vorzug vor allen andern derartigen Erzeugnissen bewahrt haben. Es scheint, daß in dieser Beziehung Klima und Material von bestimmendem Einfluß sind.
Die Tatsache, daß der Geigenbau von den Italienern zuerst in hingebender Weise kultiviert wurde und durch sie alsbald seine vollste und reichste Ausbildung erfuhr, steht offenbar mit einer Seite der eigentümlichen Kunstanlage dieses Volkes im engsten Zusammenhang. Die reiche Stimmbegabung desselben und die daraus folgende Feinfühligkeit betreffs des elementaren Wohlklanges bildeten eine Grundursache dafür. Als zweites Bedingnis tritt dann der Sinn für einfache, plastische und leicht übersichtliche Verhältnisse der Formgebung hinzu. Sehr charakteristisch ist es für den Kunstgeist der Italiener, daß sie an der, von den Deutschen mit außerordentlichem Erfolg bewirkten Ausbildung und Vervollkommnung des Klaviers S. Oskar Pauls »Geschichte des Klaviers«. Leipzig bei Payne. 1868. keinen hervorragenden Anteil nahmen. Die umständliche Mechanik dieses Instrumentes, welche heute eine höchst komplizierte und künstliche ist, erregte nicht weiter ihr Interesse, während die Vervollkommnung eines so einfachen Organismus, wie derjenige der Violine, ihre rastlose Tätigkeit beinahe zwei Jahrhunderte hindurch fesselte. Daß dann unter den einzelnen Provinzen Italiens die Lombardei der Hauptschauplatz dieser Tätigkeit wurde, ist ganz natürlich. Hier wirkte nämlich die geographische Lage bestimmend ein. Das weitverzweigte Gebiet der Alpen, an deren Fuß sich die fruchtbare, von einem seit alten Zeiten kunst- und gewerbfleißigen Volksstamme bewohnte Lombardei hinstreckt, lieferte, wie schon früher bemerkt, jene treffliche Qualität des Tannenholzes, die für die Oberdecke (Resonanzboden), den wichtigsten Teil der Violine, ein sehr wesentliches Erfordernis ist.
Das Holz der Gebirgstanne erweist sich keineswegs durchweg verwertbar für den Instrumentenbau. Der Standort des Baumes, dessen völlige Reife vorauszusetzen ist, kommt dabei vornehmlich in Frage. Gutes Resonanzholz bedingt vor allem die Eigenschaften möglichster Dichtigkeit und Homogenität. Die Natur erzeugt sie indessen vorzugsweise in den Regionen der Gebirgswelt, wo Klima und Jahreszeitenwechsel die meiste Stabilität haben, wo Wachstumsperiode und Vegetationsunterbrechung möglichst regelmäßig und gleichförmig alternieren. Ein weiteres Erfordernis ist dürrer, magerer Felsboden, damit der Wuchs mäßig langsam vor sich geht. Eine fette, humusreiche Erdschicht liefert schnell aufschießendes, säftereiches und sozusagen schwammiges Material, welchem schlechterdings für den Instrumentenbau die nötige Konsistenz fehlt.
Die richtige Auswahl des Holzes fordert von dem Instrumentenmacher eine gründliche Kennerschaft, welche nur durch langjährige Erfahrung und feine Beobachtungsgabe erworben werden kann. In dieser Hinsicht bekunden die italienischen Meister des Geigenbaues, wenigstens diejenigen ersten Ranges, ihre Überlegenheit über die Spätergekommenen. Freilich waren sie bei der Wahl ihres Materials weniger beschränkt als die neuere und neueste Zeit. Denn infolge der seit lange schon bestehenden Massenfabrikation von Streichinstrumenten aller Gattungen sind die dazu geeigneten Holzvorräte so erschöpft, daß wahrhaft gutes Resonanzholz jetzt zu den Seltenheiten gehört.
Man findet übrigens schon bei den Erzeugnissen italienischer Meister zweiten und dritten Ranges aus dem 18. Jahrhundert häufig die Verwendung eines mittelmäßigen Deckenholzes. Diese Erscheinung dürfte sich indes mehr auf unzureichende Einsicht der betreffenden Produzenten als auf einen damaligen Mangel an brauchbarem Holze gründen. Jedenfalls ist die Tatsache feststehend, daß mit Beginn der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bereits die Kunst des Violinbaues sehr schnell in Verfall geriet, sei es nun, daß die Traditionen der Hauptschulen durch Zufall bald verloren gingen, oder daß die Vertreter derselben ihre Erfahrung und Kunstfertigkeit nicht weiter vererbten.
Es wurde vorhin bemerkt, daß die Resonanzdecke den wichtigsten Teil der Violine bilde. Hiermit soll keineswegs die Bedeutung der übrigen Violinteile, als Unterdecke, Zargen, Hals, Steg, Stimme und Balken unterschätzt werden. Die vier ersteren derselben werden in der Regel von Ahornholz (nur selten haben die alten Meister statt des Ahorn Birnbaumholz zur Unterdecke verwendet), die beiden letzteren, gleich der Oberdecke, von Resonanzholz gefertigt. Bei Fétis findet sich die von Vuillaume herrührende Angabe, daß die Cremoneser Meister ihr zum Geigenbau erforderliches Ahornholz aus Kroatien, Dalmatien und sogar aus der Türkei bezogen haben.
Unter den berühmtesten Instrumentenmachern des 17. Jahrhunderts glänzt auch ein deutscher Name: Jakob Stainer Von Ruf (1892) und Lentner (1898) erschienen neuerdings biographische Arbeiten über Stainer., geb. 14. Juli 1621 im Dorfe Absam bei Hall im Unterinntale, gest. 1683. Er bildete sich in der Metropole des Geigenbaues, und zwar bei Nicola Amati, wie es heißt. Seine Violinen wurden ehedem hoch geschätzt Wie sehr dies noch in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Fall war, ist aus Löhleins Violinschule (1774) zu ersehen. In derselben wird S. 129 gesagt: Stainer habe »seinen Lehrmeister (Amati) übertroffen«, und seinen (Stainers) Geigen gebühre »zum Solospielen der Vorzug vor allen übrigen«. Über Stradivaris Geigen bemerkt Löhlein dagegen, sie hätten »plumpe Schnecken und Ecken eine eigene Art f-Löcher« und seien »stark im Holtze«. »Sie haben daher«, so fährt L. fort, »einen festen durchdringenden, Hoboeartigen, aber dabey dünnen Ton.« Heute gilt von allen diesen Behauptungen in betreff der Geigen Stainers und Stradivaris das gerade Gegenteil.; in neuerer und neuester Zeit sind sie jedoch durch die italienischen Instrumente ersten und zweiten Ranges mehr und mehr in den Hintergrund gedrängt worden. Stainers Arbeiten lassen hinsichtlich ihrer äußeren Erscheinung den Einfluß seines Lehrmeisters nicht verkennen, obwohl in ihnen die Schönheitslinie, namentlich was die gar zu starke Wölbung betrifft, etwas eingebüßt hat. Sie sind aber ebenso gediegen als sauber ausgeführt. Der zwar nicht große und etwas spitze, doch anmutige Ton seiner Violinen erinnert gleichfalls an Amati; nur ist ihm nicht völlig die sympathische Noblesse seines Vorbildes eigen. 1645 heiratete er, 1669 wurde er vom österreichischen Kaiser zum »Hofgeigenmacher« ernannt, was aber nicht verhinderte, daß er mit seiner Familie in die drückendste Not geriet Seine Geigen wurden ihm mit 6 Gulden das Stück bezahlt.. Dazu kamen religiöse Verfolgungen. So vom Schicksal heimgesucht, starb er im Wahnsinn.
Jakob Stainer stand als Künstler bei seinen Lebzeiten in ungewöhnlichem Ansehen und nicht minder nach seinem Tode als Hauptbegründer der Tiroler, mithin einer spezifisch deutschen Geigenbauschule. Er hat viele Schüler und Nachahmer gefunden, von denen die erwähnenswertesten Matthias Albani aus Bozen, geb. 1621, gest. 1673, Egidius oder Urban Klotz (1660-1675) und dessen Sohn Matthias (1653-1743?) aus Mittenwald sind. Der letztere, der übrigens nach einer Version Schüler von Nicola Amati gewesen sein soll, legte in seiner Vaterstadt den Grund zu der dort betriebenen Geigen- oder richtiger gesagt Streichinstrumentenfabrikation im großen, und diese ist heute die Haupterwerbsquelle der Bewohner des bayerischen, hart an der Tiroler Grenze belegenen Gebirgsstädtchens. Man hat dort das Prinzip der geteilten Arbeit eingeführt. Abgesehen davon, daß einzelne Beteiligte ganze Instrumente für sich fertigen, besteht im allgemeinen die Einrichtung, daß der eine Oberdecken, der andere Unterdecken, ein dritter Zargen, ein vierter Hälse u. s. f., und zwar nicht bloß vorübergehend, sondern jahraus jahrein, doch nur während der Wintermonate, macht. Diese einzelnen Teile werden in verschiedenen Graden je nach Beschaffenheit der Arbeit von den sogenannten »Verlegern«, angesehenen Einwohnern des Orts, honoriert, die mit der Ware einen ausgedehnten, sogar überseeischen Handel treiben. Für die Zusammenstellung der einzelnen Teile zu einem Ganzen gibt es besondere Arbeiter, desgleichen für Lackierung und Montierung der Instrumente. In Mittenwald bestehen gegenwärtig zwei dergleichen »Verleger«, die Handlunghäuser Neuner und Hornsteiner, sowie Baader und Komp. Die bayrische Regierung ließ es sich angelegen sein, für die Hebung der Mittenwalder Instrumentenfabrikation mancherlei zu tun. So gründete sie in Mittenwald eine Geigenmacherschule, welcher italienische und Tiroler Instrumentenexemplare namhafter Meister als Modelle überwiesen wurden. Dann auch gewährte sie den Mittenwaldern das Recht, jeden für den Streichinstrumentenbau besonders geeignet erscheinenden Baum der bayrischen Staats- und Privatwälder zum amtlichen Taxwert anzukaufen.
Außer in Mittenwald wird auch in vielen Ortschaften des sächsischen Vogtlandes, namentlich aber in Markneukirchen und Klingenthal die Instrumentenfabrikation schwunghaft betrieben. Die Anfänge dieser Industrie reichen bis in die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück. Den Grund dazu legten böhmische Einwanderer. S. »Die Fabrikation mus. Instrumente usw. im kgl. sächs. Voigtlande« v. Berthold und Fürstenau. (Leipzig bei Breitkopf & Härtel, 1876.) Obige auf die sächsische Instrumentenfabrikation bezügliche Notizen sind dieser Broschüre entnommen.
Wie bedeutend die Instrumenten- und Saitenfabrikation schon zu Ende des 18. Jahrhunderts im sächsischen Vogtlande betrieben wurde, zeigt ein Bericht in der Allgem. musik. Ztg. vom Jahre 1800 (Nr. 1). Es finden sich dort folgende Angaben: »In Neukirchen arbeiteten jahraus, jahrein 78 Meister (mit Gesellen und Lehrlingen) an Geigen, Bratschen, Bässen usw., und 26 Meister (mit Gesellen und Lehrlingen) an Bögen, 30 an Darmsaiten. In Klingenthal arbeiteten 85 Meister (mit Gesellen und Lehrlingen) an Geigen. Neukirchen lieferte jährlich 30 000 Bund Saiten, 18 000 Geigen, 50 bis 60 Kontrabässe, 6000 Messinginstrumente und 18 000 Violin- und Baßbögen. Doch gibt es Jahrgänge, in denen diese Ziffern (nach Maßgabe der Bestellungen) um vieles überstiegen werden. In Klingenthal und Umgegend beschäftigt man sich überwiegend mit dem Geigenbau. Das Minimum der dort jährlich gefertigten Violinen beträgt 36 000 Stück.«
Seit jener Zeit hat der Vogtländer Instrumentenbau, und was dazu gehört, einen großartigen Aufschwung genommen. Zu Beginn der siebziger Jahre wurden in Markneukirchen alljährlich etwa 3200 Dutzend Violinen, 40-50 Dutzend Violoncelle, 7-800 Bässe, 1000 Dutzend Gitarren, 4000 Zithern, 30 Lauten und Mandolinen, 40 Harfen, 550 Trommeln, 80 Dutzend Tamburins und 12 Dutzend Metronome (ohne Uhrwerk, seit 1870 auch mit Uhrwerk) gearbeitet. Außerdem lieferte Markneukirchen ungefähr 36 000 Dutzend Violin-, Violoncell- und Baßbögen pro Jahr. An Holzblasinstrumenten wurden gefertigt: 17 000 große und 10 000 kleine Flöten, 2500 Flageoletts und 3000 Klarinetten. (Über die Fagottfabrikation fehlen nähere Angaben.) Ferner wurde eine große Zahl von Blechinstrumenten zu der angegebenen Zeit im Laufe eines Jahres zu Markneukirchen fabriziert. Für diesen Zweig waren damals über 400 Arbeiter in dem Orte tätig. Diese Zahlen zeigen, welche Steigerung der Instrumentenbau allein in Markneukirchen erfahren hat. Auch die Saitenfabrikation läßt dies ersehen. In den siebziger Jahren wurden in dem genannten Orte alljährlich etwa 450 000 Stock (= 13 500 000 Stück) Darmsaiten gemacht. Selbstverständlich hat sich diese Produktion bis heute noch wesentlich vermehrt, da die Bedürfnisse für das In- und Ausland fortwährend steigen. Rechnet man hinzu, was außerdem in Klingenthal und anderen Ortschaften des sächsischen Vogtlandes jahraus jahrein zustande gebracht wird, so ergibt sich ein staunenswertes Resultat der dortigen Industrie.
Was nun speziell den Geigenbau betrifft, der hier allein für uns in Frage kommt, so ist darüber folgendes zu bemerken: Die Vogtländer Verfertiger von Violinen arbeiteten ursprünglich und bis in die neuere Zeit nach einem eigenen unansehnlichen Modell. Diese so erzeugten und unter dem Namen »Vogtländer Geigen« bekannten Instrumente, welche noch vielfach bei Musikern und anspruchslosen Dilettanten im Gebrauche sind, haben einen ihrem unvorteilhaften Bau entsprechenden kleinen, dünnen Ton. Seit etwa vier Dezennien aber nahm man die Meistergeigen der Cremoneser Schule zum Vorbild und brachte es dann bald zu besseren Leistungen. Gegenwärtig gibt es in Markneukirchen sehr geschickte Arbeiter. Unter ihnen ist beispielsweise Heinrich Heberlein jun. mit Auszeichnung zu nennen.
Natürlich werden in Markneukirchen usw. Instrumente verschiedener Qualität geliefert, wonach sich auch die Preise richten.
Jede größere deutsche Stadt besaß übrigens, seitdem der Geigenbau sich nach und nach verallgemeinerte, wenigstens einen, wenn nicht einige mehr oder minder geschickte Instrumentenmacher. Von denselben seien hier nur genannt: Daniel Achatius Stadlmann († 27. Okt. 1744, 64 Jahre alt) in Wien; Leopold Witthalm (zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts) in Nürnberg; Simpertus Niggell in Füssen bei Hohenschwangau; Anton Bachmann (geb. 1716, gest. 1800) zu Berlin; Ulrich Eberle in Prag; Jauch in Dresden; Hunger in Leipzig; Schonger in Erfurt; Ernst in Gotha; J. Karl Leeb († 1819, 27 Jahre alt) in Wien; Franz Geisenhof († 1821, 67 Jahre alt) in Wien, und dessen Schüler Joh. Bapt. Schweitzer († 1875, 77 Jahre alt) in Pest; Anton Fischer († 1879, 85 Jahre alt) in Wien; Nikolaus Sawitzki († 1850, 58 Jahre alt), und der Schüler J. B. Schweitzers, Gabriel Lemböck. Mit letzterem, welcher am 16. Okt. 1813 in Pest geboren und seit 1840 in Wien etabliert ist, kommen wir auf die deutschen Streichinstrumentenmacher der Gegenwart, unter denen Gabriel Lemböck eine hervorragende Stellung einnimmt. Seine Leistungen sind insbesondere in Österreich hochgeschätzt, wie seine Ernennung zum k. k. Hof-Instrumentenmacher und mannigfache ihm im Vaterlande zuteil gewordene Auszeichnungen beweisen. Aber auch in den weitesten Kreisen des Auslandes genießt er ebensoviel Ruf als Ansehen. So ist er im Besitz aller Weltausstellungs-Medaillen. Am 15. Februar 1879 feierte Lemböck das 50jährige Jubiläum als Instrumenten- und Geigenbauer.
Nächst Lemböck wäre dem Alter nach Karl Adam Hörlein, geb. 1829 zu Winkelhof in der Nähe von Würzburg, zu erwähnen. Hörlein war während der vierziger Jahre bei Joseph Vauchel, ehedem Hofinstrumentenmacher des Großherzogs von Toskana, in der Lehre. Diesem für seine Zeit tüchtigen Manne verdankt er eine gute Grundlage. Weitere Ausbildung empfing Hörlein in Wien, wo er sich drei Jahre lang aufhielt und zunächst beim Hofinstrumentenmacher Anton Hoffmann, sodann aber bei Gabriel Lemböck arbeitete. Im Jahre 1853 ließ er sich in Kitzingen und 1866 in Würzburg nieder, wo er noch gegenwärtig tätig ist. Hörleins Leistungen im Reparieren alter, sowie im Anfertigen neuer Instrumente werden von Kennern und Liebhabern ungemein geschätzt Es ist derselbe Streichinstrumentenmacher, welcher nach genauer Angabe Hermann Ritters, Professor an der Würzburger Musikschule, Violen von großem Format und sonorem, voluminösem Klang gefertigt hat. Siehe hierüber Ritters Schrift: »Die Geschichte der Viola alta und die Grundsätze ihres Baues.«.
Zu den vorzüglichsten deutschen Geigenmachern der Neuzeit gehörte August Riechers, geb. am 8. März 1836 in Hannover, gest. 4. Jan. 1893 in Berlin. Er begann seine Laufbahn bei L. Bausch in Leipzig, hielt sich dann in mehreren Städten zur weiteren Ausbildung auf und ließ sich 1862 in seiner Vaterstadt nieder. Auf speziellen Wunsch Joseph Joachims, der seit lange schon das Talent und die außergewöhnliche Leistungsfähigkeit Riechers', insbesondere auch für die Wiederherstellung alter wertvoller Instrumente, ehrend anerkannt hatte, verlegte er sein Atelier im Herbst 1871 nach Berlin. Riechers hat sich gleich seinen Kollegen bei dem Bau seiner im Laufe der Zeit zahlreich gefertigten Instrumente – es sind an 1600 Violinen und über 200 Violoncelle aus seiner Werkstatt hervorgegangen – die Muster der altitalienischen Meister ersten Ranges, speziell Stradivari, zum Vorbild genommen. Die wichtigste Eigenschaft für einen Geigenmacher ist, ganz abgesehen von der erforderlichen technischen Meisterschaft, ein fein ausgebildeter Tonsinn. Er muß wissen, wie eine gute Violine zu klingen hat, und überdies die Fähigkeit besitzen, den innerlich vorgestellten Ton dem Instrumente gleichsam zu imprägnieren. Daß Riechers über diese Kunst gebot, beweisen seine Arbeiten, deren Vortrefflichkeit durch glänzende Zeugnisse Joachims, Sarasates, Miska Hausers, Ole Bulls und anderer berühmter Geigenmeister beglaubigt worden ist. Wir verdanken Riechers außerdem eine ebenso sachgemäße wie interessante Darstellung des Geigenbaues A. Riechers: »Die Geige und ihr Bau«, 1893. Nach dem Tode Riechers' herausgegeben von Wilh. Jos. v. Wasielewski..
Guten Ruf als Violinbauer besitzt ferner W. Lenk. Geboren 1840 in Schönbach bei Eger in Böhmen, bildete er sich für sein Fach zunächst in Markneukirchen unter der Leitung Klühers, arbeitete dann fünf Jahre lang in Berlin, sodann bei Ernst Liebig in Breslau, und weiterhin in Wien, Pest und München. Gegenwärtig ist er in Frankfurt a. M. etabliert. Bei der 1881 stattgehabten allgemeinen deutschen Patent- und Musterschutzausstellung in dieser Stadt wurde ihm die silberne Medaille für seine Leistungen zuerkannt.
Außer den vorstehend erwähnten deutschen Bogeninstrumentenmachern gibt es gegenwärtig noch einige andere beachtenswerte Männer dieses Faches, wie z. B. Otto Schüneman, Direktor der Geigenmacherschule zu Schwerin, Neuner in Berlin, Höhne in Weimar, Hammig in Leipzig und Hofinstrumentenmacher Ramstler in München. Sie alle beweisen durch ihre Leistungen, daß der deutsche Geigenbau in den letzten Dezennien einen höchst erfreulichen Aufschwung genommen hat, und daß die nächsten Generationen hoffentlich keine Ursache haben werden, um einen, allerdings mit jedem Jahrzehnt wünschenswerter erscheinenden, Zuwachs an guten und selbst ausgezeichneten Violinen besorgt zu sein.
Frankreich wurde von Italien her etwa um dieselbe Zeit, ja, wie es scheint, sogar noch früher als Deutschland in betreff des Streichinstrumentenbaues beeinflußt Über die französischen Geigenbauer älterer und neuerer Zeit finden sich speziellere Mitteilungen in H. M. Schletterers »Studien zur Geschichte der französischen Musik«. Th. II, S. 104 ff. (Berlin bei R. Damköhler.). Denn schon gegen 1566 hatte Andrea Amati Violinen, Violen und Bässe für den Hof Charles IX. zu liefern. Trotz dieser Vorbilder blieb aber die einheimische Fabrikation lange Zeit hindurch mittelmäßig. Wenn auch der Grund hiervon teilweise darin gelegen haben mag, daß sich in Frankreich anfangs nicht die rechten Leute für diesen Industriezweig fanden, so darf doch wohl als Hauptursache der geringen Ergebnisse im 17. und 18. Jahrhundert jener engherzige Zunftzwang angesehen werden, welcher zu jener Zeit dem französischen oder, was damit gleichbedeutend war, dem Pariser Handwerkertum auferlegt war. Die Korporation der Pariser Instrumentenmacher, welche aus vier Abteilungen, nämlich aus den Fabrikanten für Saiteninstrumente, für Blasinstrumente, für Orgeln und für Klaviere bestand, hatte Statuten, welche fremdländischen Arbeitern den Zuzug aufs äußerste erschwerten, wenn nicht ganz unmöglich machten. Damit war ein stagnierender Zustand gegeben, der nur durch die Einwirkung frisch herzukommender tüchtiger Kräfte hätte beseitigt werden können. In einem falsch verstandenen Patriotismus beschränkten sich die Franzosen aber auf sich selbst. Mit Formensinn begabt, ahmten sie die Muster des italienischen Geigenbaues äußerlich nach, ohne ihnen jedoch die Haupteigenschaft eines schönen Tones geben zu können. Als derartige Verfertiger von Streichinstrumenten werden namhaft gemacht: Pilet, Despous, Véron, Médard, Boquay, Pierray, Gaviniés, der Vater des berühmten französischen Geigers, Guersan, Saint Paul, Claude Boivin und Vuillaume von Mirécourt, der Vater des bekannten Pariser Geigenmachers.
Erst mit dem Auftreten des Nicolas Lupot in Paris, zu Ende des 18. Jahrhunderts, begann die Streichinstrumentenfabrikation Frankreichs sich zu heben. Dieser Mann war mit Verständnis in die Kunst Stradivaris eingedrungen, dessen Meisterleistungen sein Ideal wurden. Im Jahre 1758 zu Stuttgart geboren, wo sein Vater, ein Franzose, als Violinbauer lebte, empfing er von Diesem die erste Unterweisung für seine spätere Berufstätigkeit. Im Jahre 1767 wandte sich der alte Lupot mit seinem Sohn wieder der Heimat zu und ließ sich in Orléans nieder, von wo der letztere 1794 nach Paris ging, um sich dort für immer seßhaft zu machen. Er starb 1824. Seine Instrumente, an denen nur die nicht vollkommen geglückte Lackierung zu wünschen läßt, fanden in Frankreich bald nach ihrer Vollendung großen Beifall. Gegenwärtig werden sie ihres ausgezeichneten Klanges halber aber auch im Auslande sehr geschätzt und infolgedessen mit um so höheren Preisen bezahlt, als die ohnehin nicht in großer Zahl existierenden Exemplare sich mehrenteils in festen Händen befinden.
Lupots bester Schüler, Nicolaus Eugen Gand (gest. 6. Febr. 1892), setzte die in der Lehre empfangenen Traditionen fort und lieferte eine ziemlich bedeutende Anzahl guter Instrumente.
Ein andrer Zögling Lupots ist Sebast. Philippe Bernadel, geb. 1802 in Mirécourt, gest. 1870. Nachdem er sich in seinem Heimatorte vorgebildet, kam er nach Paris und trat als Arbeiter bei Nicolas Lupot, sodann aber bei dem obengenannten Gand ein. 1826 errichtete er eine eigne Werkstatt, welche bis 1859 bestand. Dann ging er mit seinen beiden Söhnen Ernst August und Gustav Adolph ein Kompagniegeschäft unter der Firma Bernadel et Fils ein. Diese Verbindung erfuhr nach dem Tode des alten Bernadel, welcher übrigens schon 1866 sich ins Privatleben zurückgezogen hatte, dadurch eine Veränderung, daß die Söhne Bernadels sich mit Eugen Gand zu der noch gegenwärtig in Paris bestehenden Firma vereinigten.
Gleichzeitig mit Nicolas Lupot und nach ihm war eine nicht geringe Anzahl respektabler französischer Geigenmacher tätig, von denen hier nur François Chanot hervorgehoben sei. Geb. 1788 in Mirécourt, bildete er sich ursprünglich zum Marineingenieur aus. Akustische Versuche, mit denen er sich nebenbei beschäftigte, gaben ihm Veranlassung, im Jahre 1817 eine Violine von absonderlicher Beschaffenheit zu konstruieren. Die äußere Form derselben war die schon im 15. Jahrhundert üblich gewesene gitarrenartige. Im Innern seines neu hergestellten Instrumentes hatte er die gänzlich vom Herkommen abweichende Einrichtung getroffen, daß der Balken, anstatt unter der G-Saite hinlaufend, in der Mitte der Resonanzdecke angebracht und der Stimmstock nicht hinter, sondern vor dem Steg plaziert war. Auf diese so hergestellte Geige nahm Chanot ein Patent, welches ihm aber keine sonderlichen Vorteile gewährt haben mag; denn schon 1824 gab er, nachdem sein Bruder Georg, ein feiner Kenner und geschickter Reparateur alter Meisterviolinen, 1819 als Gehilfe bei ihm eingetreten war, die Instrumentenfabrikation wieder auf, um zu seinem eigentlichen Berufe zurückzukehren. Er starb 1828 als Ingenieur erster Klasse in Rochefort.
Die bedeutendste Erscheinung unter den französischen Geigenbauern des 19. Jahrhunderts war unstreitig J. B. Vuillaume, der Sprosse einer Instrumentenmacherfamilie in Mirécourt, wo er am 7. Oktober 1798 geboren wurde und auch seine erste Ausbildung empfing. Als er 1818 nach Paris kam, wurde er zunächst von François Chanot als Mitarbeiter für den Violinbau nach dessen neukonstruiertem Modell beschäftigt. Indessen scheint ihn diese Tätigkeit, vielleicht in richtiger Erkenntnis der Unzweckmäßigkeit des Chanotschen Verfahrens, nicht befriedigt zu haben. Wenigstens wechselte er nach Verlauf von drei Jahren schon die Kondition und trat bei dem Orgelbauer Lêté als Gehilfe ein, dessen Kompagnon er von 1825-1828 wurde, von dem er sich dann aber trennte, um ein eigenes Geschäft zu begründen. In der ersten Zeit seiner selbständigen Wirksamkeit fanden sich für seine Instrumente wenig Liebhaber, was ihn dazu veranlaßte, sein Glück dadurch zu versuchen, daß er die Geigen und Violoncelle der italienischen Meister nachahmte und diese Imitationen für echte Instrumente verkaufte. Diese wenig reelle Unternehmung gelang vollkommen. Er erzielte mit diesen Fabrikaten einen großen Absatz, vermöge dessen er den Grund zu seinem Reichtum legte. Später baute er hauptsächlich nach dem Vorbilde Stradivaris, ohne jedoch diese, in großer Anzahl gefertigten und nach allen Himmelsrichtungen versandten Erzeugnisse als Originale auszugeben. Seine Instrumente waren ehedem von jungen Geigern sehr begehrt und sind es zum Teil, namentlich in Frankreich, auch jetzt noch. Indessen werden sie, wie wohl die Mehrzahl aller neuen Streichinstrumente, sich in der Zukunft, was die Dauerhaftigkeit und Unveränderlichkeit des Tonwertes angeht, erst noch zu bewähren haben; denn viele um die Mitte des 19. Jahrhunderts und später noch fabrizierte Geigen und Violoncelle haben infolge der Anwendung künstlich ausgetrockneten Resonanzholzes nicht gehalten, was sie anfangs versprachen.
Vuillaume war ein außerordentlich intelligenter und geschickter Künstler seines Faches. Er verstand sich auf gewisse Finessen des Geigenbaues wie kein andrer seiner Zeitgenossen. Insbesondre hatte er es in der Zubereitung des Firnisses sehr weit gebracht. In dieser Beziehung gab es bei seinen Lebzeiten für ihn keinen Nebenbuhler, und da im Geigenhandel sehr häufig mehr Wert noch auf die äußere Erscheinung als auf den Klang der Instrumente gelegt wird, so ist es begreiflich, daß seine Fabrikate den reichlichsten Absatz im Publikum fanden. Er starb hochbetagt in Paris am 19. März 1875.
Auch in den Niederlanden wurde der Streichinstrumentenbau zeitweilig schwunghaft betrieben. Vielleicht gab ein gewisser Palate, der sich nach italienischen Meistern gebildet hatte und anfangs des 17. Jahrhunderts in Lüttich arbeitete, den Anstoß dazu. Ihm sind anzureihen: Rottenbrouck und Snoeck zu Anfang des 18. Jahrhunderts, de Combles, angeblich ein Schüler Stradivaris und in Tournay gegen Mitte des 18. Jahrhunderts seßhaft, Boussu, um die Mitte desselben Jahrhunderts zu Eterbeck-les-Bruxelles, Peter Jacobs, zu Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts in Amsterdam, Peter Rombouts, ebendaselbst von 1720-1740, Jean Koeuppers (1755-1780) im Haag und der Franzose Lefebre, welcher sich Amati zum Vorbilde genommen hatte, 1720 bis 1735 in Amsterdam.
Der Anteil, welchen die übrigen Kulturländer des westlichen Europa an der Entwickelung des Violinbaues genommen haben, ist ein zu vereinzelter und untergeordneter, um an dieser Stelle Berücksichtigung zu finden.
Es hat im Laufe der Zeit nicht an neuerungsbeflissenen Naturen gefehlt, die, unbefriedigt von den Meisterleistungen des italienischen Geigenbaues, in Wort und Tat bestrebt waren, eine neue Ära desselben herbeizuführen. An der Spitze derselben stehen zu Anfang des 19. Jahrhunderts die Franzosen Savart und der schon genannte François Chanot, die die wunderlichsten Experimente anstellten, um ihrem reformatorischen Drang Luft zu machen. Savarts mehr theoretisch-wissenschaftliche Bemühungen sind nicht ganz wertlos, obwohl ihre Resultate keinen Einfluß auf die Praxis ausgeübt haben. Chanot dagegen, der bestrebt war, durch Taten zu wirken, hat nur Kuriosa zuwege gebracht, die kaum vorübergehend die Aufmerksamkeit der musikalischen Welt erregten. Andre machten für die Violine eine kreis- oder tellerförmige Struktur geltend, noch andre brachten Modelle in ungewöhnlichen Holzarten oder in verschiedenen Metallen zum Vorschein. Alle diese mannigfachen Versuche haben nichts andres dargetan, als die unübertreffliche Vollendung der italienischen Meisterwerke. Man hat die Irrwege erkannt, auf denen man sich eine Zeitlang befand, und jetzt bescheidet man sich in Ermangelung erneuerter selbständiger Produktion mit der möglichst verständnisvollen Nachahmung des Besten, was die Vergangenheit uns hinterlassen hat.