
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Seeckts Gestalt umgab etwas Geheimnisvolles. Dabei war sein größtes Geheimnis, daß er meist gar keins hatte. Die Größe Seeckts war bis zu einem gewissen Grade seine unnachahmliche Art, einfach zu sein. Seine Art wurde allerdings oft nicht verstanden. Trotz dieser Einfachheit ist es wiederum unmöglich, Seeckt mit Schlagworten abzutun. Dazu war er wieder zu kompliziert. In irgendeine schlagwortähnliche Prägung hat er wohl niemals hineingepaßt. So ist es auch falsch, ihn einen Junker zu nennen. Es kommt schließlich darauf an, was man unter einem Junker verstünde. Das Wort ist wieder zu Ehren gekommen. Wenn man darunter einen innerlich und äußerlich fein gegliederten, hochgezüchteten Menschen versteht, dann war er ein Junker. Ein Vollblutjunker im Bewußtsein seines Wertes. Will man beim Junker eine, gleichviel ob sympathische oder unsympathische, Befangenheit sehen, so war Seeckt kein Junker. Nicht das Enge, sondern das Weite, das Große war sein Feld.
Seeckt war echter Edelmann und Aristokrat, körperlich und seelisch. Wir haben uns wieder daran gewöhnt, die Quellen des Seins der Einzelpersönlichkeit in unseren Voreltern zu suchen. Edles wächst nun einmal nicht in einem Menschenalter. Dazu braucht es Generationen. Die Ahnentafel Hans von Seeckts gibt mancherlei bedeutsamen Aufschluß über die Voraussetzungen seines Wesens.
Eine Kleinigkeit sei dabei vorausgeschickt. Der Vater und die Mutter Seeckts waren Vetter und Base, rechte Geschwisterkinder. Außerdem waren vermutlich die Urgroßmutter Seeckts väterlicherseits und die Ururgroßmutter mütterlicherseits, beide aus der Familie Stenzler, miteinander verwandt. Es ist also ein gewisses Maß von Inzucht sicherlich vorhanden, in diesem Falle mit dem Erfolge der Wertsteigerung und nicht der Wertminderung.
Die Seeckts sind der Überlieferung nach ein altes ungarisches Adelsgeschlecht, das wohl schon geraume Zeit vor 1700 von Ungarn nach dem schwedischen Rügen eingewandert ist. Diese Überlieferung stand immerhin so fest, daß 1786 die Verleihung des Adels durch den deutschen Kaiser nur als eine Wiederaufnahme eines früheren Adels aufgefaßt wurde. Das Wappen der Familie zeigt eine Taube mit dem Ölzweig im Schnabel, die Wappenfarben sind blau-gelb. Es mag dem Generalmajor von Seeckt später einmal eigenartig vorgekommen sein, als er in Spa, Versailles und London an Friedensverhandlungen teilnahm, die keine Friedensverhandlungen waren, daß gerade er zu diesem unfriedlichen Friedenswerk ausersehen war, der die Friedenstaube im Wappen führte.
Die Familie von Seeckt ist von der Insel Rügen bald auf das Festland herübergegangen, hat in Pommern Seeckt schreibt einmal der Mutter, er fühle sich als Pommer, habe aber Heimatgefühl eigentlich nur für Berlin gehabt. noch vor 1800 Grundbesitz erworben und bis zum Aussterben der Familie auch behalten, wenngleich dieser Besitz Hans von Seeckt insofern nicht mehr persönlich als Besitz berührte, weil er an den Bruder des Großvaters überging Seeckt hat dem alten Familiengut Nepzin in Pommern große Anhänglichkeit bewahrt. In seinen hinterlassenen Notizen findet sich eine ganz kurze Skizze einer Einleitung zu seinen Erinnerungen. Dort steht: »In einer preußischen Offiziersfamilie bin ich aufgewachsen, in der noch etwas Erdgeruch der einstigen pommerschen Familienheimat wehte.«. Erst Seeckts Großvater wurde Offizier. Man kann also nicht einmal im Mannesstamm der Namensträger behaupten, daß Hans von Seeckt, wie so oft geschrieben wird, aus einer Soldatenfamilie stammte. Gewiß sind die Seeckts und auch alle anderen Vorfahren in breiter Ausdehnung nicht nur Soldaten gewesen, sondern haben auch ihre Soldatenpflicht treu mit einer nicht geringen Anzahl von Todesopfern auf den Schlachtfeldern verschiedener Kriege bewiesen. Aber die eigentliche militärische Tradition beschränkte sich für Hans von Seeckt ausgesprochen auf die letzten zwei Generationen. Es ist nicht zu verkennen, daß unter den Vorfahren die akademischen Berufe und in ihnen der Theologe etwas hervorragten. Das geistige Element, man möchte fast sagen das durchgeistigte, das Seeckts feines Gesicht von innen heraus belebte, wird verständlich aus solcher Ahnenreihe. Vom Großvater väterlicherseits mag der unverkennbare Zug harter preußischer Pflichterfüllung stammen. Ihm ist der Lebensweg nicht leicht gemacht worden. Seine dienstliche Entwicklung fällt gerade in die Zeiten der Stagnation in der Armee. 1816 war Rudolf von Seeckt aus schwedischen in preußische Dienste übergetreten, selbstverständlich in der Hoffnung, daß in einem Preußen, das soeben glorreich Leipzig und Waterloo geschlagen hatte, auch in der Zukunft Ruhm und Ehre zu gewinnen sein würden. Es kam anders. Die Kräfte von Volk und Staat waren zu stark beansprucht worden. Teils suchte man im Biedermeier Ruhe, teils kamen sogar politische Rückschläge, im ganzen eine Zeit, die eher rückwärts statt vorwärts gehen wollte. So hat es denn Rudolf von Seeckt erst mit 53 Jahren in Minden zum Major gebracht. Mit 61 Jahren ging er als Oberst ab. Als sein Sohn später ein besonders günstiges Avancement zum Major hatte, gratulierte ihm Rudolfs Schwager Zastrow 1869 mit dem Hinweis darauf, daß dies ein Ausgleich für das unerhört mühselige Fortkommen des Vaters sei. Das Avancement dieses Sohnes Richard war allerdings so ungewöhnlich, daß er jünger General wurde als sein berühmt gewordener Sohn Hans.

|
|
|
Die Mutter
|
Der Vater
|
Der Großvater Rudolf von Seeckt hatte eine Droysen zur Mutter. Die Droysens müssen kluge und besinnliche Männer gewesen sein. Dieser Zweig der Familie läßt sich in Pommern bis um 1600 nachweisen. Sie sind damals schon angesehene Leute gewesen, mit dem bodenständigen Adel versippt. Die Familie soll aus Italien eingewandert sein. Wenn also auch im ganzen der nordische, bis zum schwedischen Gothenburg herauf und wiederum nach Osten bis jenseits der Weichsel führende Einschlag bei Hans von Seeckt überwiegt, so ist es doch wesentlich, festzustellen, daß das Zierliche, Feine in seinem äußeren und Wesen immerhin mit der vermutlichen ungarischen und italienischen Blutmischung zusammenhängen kann. Hans von Seeckts Vorfahren sind Köpfe, die man lange und nachdenklich betrachten muß, klare, kluge, feine Gesichter, nicht ohne einen kleinen Zug selbstbewußter Härte; Menschen, die um ihren eigenen Wert wissen und doch Güte zeigen.

Kinderbild im Alter von 4 Jahren
Der Großvater Rudolf von Seeckt heiratete Emma Israel. Die Israels, die einen alten nordischen Namen, wie andere Familien in Deutschland auch, aus Frömmigkeit einer biblischen Bezeichnung angeglichen hatten, waren rein schwedischen Ursprungs; Ratsherren, Schiffseigner, Offiziere, die es schon von Beginn des 18. Jahrhunderts an recht zu Wohlstand gebracht hatten. Das hat freilich nicht ändern können, daß der Werdegang Rudolf von Seeckts für die Kinder keine nennenswerten Glücksgüter hinterließ. Die Großmutter Emma muß eine besonders liebenswerte Frau gewesen sein. Ihr Sohn Richard hat jedenfalls an ihr mit inniger Liebe gehangen. Von beiden Eltern schreibt er, daß sie »die selbstlosesten Naturen und nur auf das Wohl ihrer Kinder bedacht waren«.

Das Geburtshaus Hans v. Seeckts
in Schleswig, Herrenstall 15
Der Werdegang des Vaters Richard August von Seeckt, der bis zum Kommandierenden General und zum Ritter des Schwarzen Adlers führte, ist naturgemäß nicht ohne Eindruck auf die Entwicklung von Hans von Seeckt gewesen. Das Leben verließ frühzeitig die Enge und gab Eindrücke, die allein schon durch den Wechsel, aber auch durch die Mannigfaltigkeit der Beziehungen ganz unwillkürlich den Gesichtskreis erweitern mußten. Der Vater Richard von Seeckt war von Haus aus ein lebenslustiger und fröhlicher Mensch, der eine Vorliebe für die Jugend hatte. Trotzdem war er ein sorgsamer Hausvater, der es verstand, den Zuschnitt des Hauses bald so zu gestalten, daß er doch schon in der Bataillonskommandeurszeit eine ausgesprochen repräsentative Note aufwies Eine erhebliche Anzahl von Angaben über das Elternhaus und die Jugendzeit Hans v. Seeckts machte seine Schwester, Gräfin von Rothkirch und Trach in Liegnitz.. Der Vater Seeckts war, wenn auch ohne überragende Bildung, von Natur klug und schrieb einen oft mit Bewunderung gerühmten flüssigen Stil. Die Handschrift des Vaters, namentlich die Unterschrift, hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit der des Sohnes. Aber diese Ähnlichkeit war nicht nur rein äußerlich. Der Vater Seeckt hatte eine Art, Briefe zu schreiben, die in der Anordnung der Sätze, der Worte und der Schrift wie ein künstlerischer Rhythmus anmutete. Dazu kam eine betonte Kürze der Ausdrucksweise, die beim Vater allerdings nur in Briefen von besonderer Bedeutung vorkam, denen er einen besonderen Klang geben wollte. Sonst wurde der Vater gelegentlich auch weitschweifig. Der Sohn aber erbte Rhythmus und Kürze. Übrigens war der Vater ungewöhnlich musikalisch, eine Begabung, die sich nur sehr wenig vererbt hat. Seine Tochter blieb gänzlich unmusikalisch, und Hans von Seeckt ist nie ausübend in der Musik gewesen. Freilich hat er wie die Mehrzahl aller großen Soldaten, besonders Moltke, Musik außerordentlich geliebt, gern und viel Musik gehört und gelegentlich seiner besonderen Verehrung für die Melodien Mozarts bewegten Ausdruck gegeben in Worten ungewöhnlich weicher Ausdrucksart. Es mag für Hans von Seeckt bezeichnend sein, daß er gerade Mozart liebte, von dem Wagner einmal gesagt hat: Seine Kompositionen seien so, als wenn die ewige Harmonie sich mit sich selber unterhielte. Das Ausgeglichene, das innerlich Harmonische mag die begründende Verbindung zu Mozartscher Musik gewesen sein. Hans von Seeckt war überhaupt, richtig gesehen, eine Künstlernatur. Er hat auch seinen eigenen Beruf als Künstler gehandhabt und wie eine Kunst verstanden. Er suchte in sich, in seinen Taten und in seiner Umwelt die Harmonie, das Schöne. Daraus erklärt sich, ganz anders, als es viele auffassen, der seelische Gleichmut nicht als Zwang äußerer Haltung, sondern als innere Harmonie.
Es wird auf den Werdegang des Vaters, also des Generals der Infanterie Richard von Seeckt, noch so weit zurückzukommen sein, als der Sohn ihn im Elternhaus miterlebt. Das ist die Zeit bis 1885. Danach kommt der Vater kurze Zeit nach Bromberg und alsdann als Divisionskommandeur und Kommandierender General nach Posen. Er erreicht nicht nur das Ansehen, das einem so hohen Offizier leicht und ohne weiteres zufällt, sondern er steht in hoher Gnade bei seinem Kaiser, der ihn 1897 à la suite des Infanterie-Regiments Nr. 55 Bülow v. Dennewitz stellt und ihn 1901 zum Chef des Infanterie-Regiments Nr. 16 v. Sparr macht. Ein Briefwechsel beweist freundlichste Beziehungen zum König Georg von Sachsen. General von Seeckt ist in der ganzen Bevölkerung allgemein ungewöhnlich beliebt. Diese Beliebtheit kommt sehr deutlich zum Ausdruck in den Abschiedsbriefen und in seiner Ernennung zum Ehrenbürger von Posen bei seinem Ausscheiden. Zu denen, die seinen Fortgang lebhaft bedauern, gehört auch der Kardinal Erzbischof von Stablewski. Er schreibt ihm am 28. 1. 1897: »... Ich fühle schon jetzt, wie das Scheiden eines Freundes weh tun wird … Meinen Empfindungen will ich heute keinen Ausdruck geben. Es findet sich doch noch eine stille Stunde, in welcher ich … das werde sagen können, was ich einem solchen Freunde aus des Herzens Tiefen dankend zu sagen verpflichtet bin – auch wenn der Freund es ahnt und kennt.« Es ist später gelegentlich die Meinung aufgetaucht, der Kommandierende General von Seeckt sei 1897 vielleicht doch verabschiedet, weil er zu polenfreundlich gewesen sei. Freilich hat er keinen Zweifel darüber gelassen, daß er gemeinsam mit dem Oberpräsidenten Graf von Zedlitz für ein, wie er es nannte, gerechtsames Entgegenkommen gegenüber der polnischen Bevölkerung innerhalb der deutschen Reichsgrenzen eintrat. Graf von Hutten-Czapski schreibt 1936 in seinem Buche: Sechzig Jahre Politik und Gesellschaft: »Seeckt Gemeint ist also der Vater. war ein entschiedener Gegner antipolnischer Politik, suchte den Verkehr mit den markantesten Persönlichkeiten der polnischen Gesellschaft, drang aber mit seinen Ansichten in Berlin nicht durch. Mit mir unterhielt er sich oft sehr einsichtig über die Zustände in der Provinz Posen … Seeckt war das Vorbild eines Soldaten aus der Epoche des deutsch-französischen Krieges, hatte aber mehr politisches Verständnis als die meisten anderen …« Da sich damals seine Auffassungen nicht mit denen in Berlin deckten, mag es dort gelegentlich auch unliebsam vermerkt worden sein, daß von polnischer Seite viel in seinem Hause verkehrt wurde. Ausschlaggebend sind diese Umstände ohne jeden Zweifel nicht gewesen, weil der General ganz sicher in diesen Dingen nicht zu weit ging. Er kannte die notwendige Grenze sehr wohl. In Straßburg hatte er allzu große Nachgiebigkeit des Statthalters v. Manteuffel gegenüber der elsaß-lothringischen Bevölkerung keineswegs gebilligt. Im übrigen war es Tatsache, daß Seeckt seit 1896 krank war und aus diesem Grunde ging. Jedoch der Sohn Hans entsann sich sehr viel später durchaus noch der Auffassung seines Vaters und zog aus ihr mindestens Folgerungen bewußter Objektivität.
Unter den Auszeichnungen des Vaters beansprucht eine vielleicht besondere Beachtung. Unter der Verleihungsurkunde des Sterns zum Roten Adlerorden II. Klasse mit Eichenlaub steht die Unterschrift des alten Kaisers, die wohl mit zu den letzten zählen wird. Sie ist am 18. Januar 1888 geschrieben.
Der Vater ging 1897 zunächst auf Reisen, zog dann nach Berlin, wo der Sohn Hans ihn nicht allzu häufig mehr gesehen hat, und starb schließlich 1909 in Schlesien.
Die Gabe und die Liebhaberei des Vaters, Gedanken schriftlich festzulegen, hatten nicht nur während der Kriegszeit eine umfangreiche Korrespondenz mit seiner Frau zur Folge, sondern führten ihn auch dazu, in späteren Jahren eine Art von Tagebuch zu führen.
Aus der Kriegskorrespondenz mag eine kleine Episode Erwähnung finden. Richard von Seeckt war in den Schlachttagen des August am Bein ziemlich schwer verwundet und kehrte erst wieder zur Belagerung von Paris zurück, etwa als endlich die Beschießung begann. Er hat dann die Kämpfe um Le Bourget mitgemacht. Durch den Brand der Tuilerien und sonstige erkennbare Anzeichen konnte man von außen her die Wirkung des Kommune-Aufstandes und der Gegenaktion der Regierungstruppen einigermaßen beobachten. Sobald es ging, ließ die deutsche Regierung der Bevölkerung von Paris Lebensmittel zuführen. Bei irgendeiner Gelegenheit kam es nun in diesen Tagen dazu, daß der Major von Seeckt mit seinen Offizieren zum Essen bei einem vornehmen Franzosen in der Gegend von Le Bourget war. Bei Tisch brachte der französische Hausherr einen sehr feinen Trinkspruch von genau vier Worten aus. Er sagte: »Nos amis, les ennemis.« Es drückt sich darin der Dank dafür aus, daß in bitterster Stunde der Deutsche als Feind hochherzig genug war, zu helfen. Man kann den Franzosen nicht gut nachsagen, daß sie in einer Situation, in der die Not unser Volk viel härter angefaßt hat, uns etwa ähnlich hochherzig geholfen hätten.
Aus den Tagebüchern der letzten Lebenszeit ist etwas erwähnenswert, was vielleicht nicht ohne Einfluß auf den Sohn geblieben ist. Es geht durch diese Niederschriften eines um die Siebzig doch merklich alternden Mannes ein Zug zur Frömmelei, der in seinen Ausdrucksformen nicht ungekünstelt und natürlich blieb. Hans von Seeckt ist bis an sein Lebensende ein tief religiöser Mensch geblieben, der sein Christentum ernst nahm. Aber in seiner Scheu, etwas von seinem Innern, von seiner Seele nach außen mehr zu zeigen, als es unbedingt erforderlich war, lag es ihm nicht, religiöse Dinge zu betonen. Dies mag zu einer ausgesprochenen Zurückhaltung in der äußeren Betonung religiöser Formerfüllung gesteigert worden sein dadurch, daß nach seinem Geschmack der Vater sie allzusehr betonte.
Im Jahre 1860 hatte der damalige Hauptmann von Seeckt seine rechte Kusine Auguste von Seeckt geheiratet. In ihren Zügen ist manches, was sich beim Sohne wiederfindet. Vor allen Dingen die eigentümliche Reinheit der Linienführung um Stirn und Nase, der aus einem merkwürdigen Kontrast von Weichheit und Härte zusammengestellte Mund und das eigenartig aristokratische Kinn. Sie stammte aus einer Familie, in der schöne Frauen häufig waren, was insbesondere für ihre Mutter Charlotte von Schubert gilt. Klein und zierlich, war Auguste von Seeckt selbst nicht eigentlich schön, freilich sehr anziehend zu nennen. Aber sie und ihre Mutter, die die große Welt vielleicht ein wenig aus dem Hause des alten schwedischen Geheimrats Ernst Konstantin von Schubert kennen konnten, sonst aber eigentlich mehr zu Vorfahren Menschen eng begrenzten Wirkungskreises hatten, waren ausgesprochen das, was man gesellschaftlich eine große Dame zu nennen pflegt: Haltung, Würde verbreitend, Ehrfurcht verlangend. Wir verstehen heute, die wir die manchmal geradezu fürstliche Haltung Seeckts in seinen älteren Jahren kennen, vielleicht mehr als die Gefährten der Jugend, daß die Schwester dem Vater und der Sohn der Mutter näherstand. Auguste von Seeckt nahm das Leben etwas schwer. Hans schreibt einmal später selbst von der Mutter: »Die Gabe, sich das Leben leicht zu machen, hat sie nicht.« Sie war wohl ungewöhnlich klug, wie die meisten ihrer Vorfahren und viele ihrer Verwandten. Aber sie war von Natur betont ernst, leicht bedenklich, wiederum den Haushalt äußerst scharf regierend, gesellschaftlich erheblich reservierter als der Vater. Vielleicht war sie sogar etwas steif. Es gab Menschen, die in der Geselligkeit in ihrer Nähe froren. Wer aber in Not zu ihr kam, fand ein warmes, gütiges Herz. Man kann nicht leugnen, daß sie stark am Alten hing. Angeborene Königstreue ließ sie in jedem Beugen vor Geld eine Verflachung der Sitte sehen. Sehr religiös, stand sie dem Pietismus nicht fern. Ihr fast unerbittlicher Ernst hat sich auf den Sohn, wenngleich bei ihm durch viel echten Humor gemildert, vererbt. Unter dem Tode des ältesten und des jüngsten Kindes litt sie so offensichtlich, daß etwas Schweres, Trauriges in ihrem Wesen sie bis zu ihrem Lebensende nie ganz verlassen hat. Das hat sie nicht gehindert, ihrer Schwiegertochter eine überaus freundliche Schwiegermutter zu sein. Die Ehe der Eltern Seeckts war ungewöhnlich harmonisch, es fiel buchstäblich nie ein unfreundliches Wort. Vielleicht trug mit dazu bei die Gabe des Vaters, der die Mutter klug oft nicht widerstrebte, die Härten des Lebens weniger zu meistern, als ihnen auszuweichen. Freilich wurde dieses Verfahren vom Vater, womit nun die Mutter nicht immer einverstanden war, etwas auch auf die Lebensleitung der Kinder übertragen. Es geschah nicht so leicht, daß der Vater irgendeinen Mißerfolg im Werdegang der Kinder mit Tadel belegte oder ernstlich rügend bemerkte. Tatsächlich ist der Vater wohl nur ein einzig Mal wirklich böse geworden, wie das dann leicht so geht, vielleicht an falscher Stelle. Als nämlich der junge Leutnant Hans von Seeckt eines Tages über die normalen, wirklich nicht bedenklichen Leutnantsschulden nach Hause berichtete, da äußerte sich das Mißfallen des ja nun allerdings den Freuden der Jugend inzwischen fern gerückten Vaters doch ziemlich deutlich.
Mag der Sohn, wie gesagt, der Mutter sein Leben lang mit dem Gemüt etwas näher gestanden haben als dem Vater, so ist doch der väterliche Einfluß immer unverkennbar. Noch Ende 1912 schreibt der Sohn: »... Oft frage ich mich, wie mein Vater sich wohl in irgendeiner Lage verhalten hätte. Dann sage ich mir wohl, daß ich in seinem Sinn vielleicht handele, nur daß bei ihm alles durch seine große Herzensgüte gemildert wurde, während bei mir das gleiche als Schroffheit wirkt.« Die besondere Zuneigung zur Mutter hat der Sohn 1912 einmal in sehr zarten Worten ausgedrückt: »... Dein letzter Brief enthielt eine etwas trübe Bemerkung über das Almosenhafte der Liebe. ›Und wenn Dich ein Heer von Bacchanten begleitete, den Weg hinab gehen wir alle allein‹, sagt ein mir besonders lieber neuerer Schriftsteller. An das ›einsame‹ müssen wir uns alle gewöhnen, früher oder später. Doch hoffe ich, daß Du das nicht in einer Art von Bitterkeit geschrieben hast und unter dem Eindruck eines gewissen Verlassen- oder Vernachlässigtseins. Das Leben führt uns doch nur äußerlich so auseinander, zwingend zwar darin, aber doch machtlos, was den inneren Zusammenhang betrifft. Dessen sei gewiß …«
Der Großvater mütterlicherseits, Friedrich von Seeckt, war zu seiner Zeit als königlich preußischer Appellationsgerichtspräsident in Pommern fast eine Berühmtheit. Als 1856 die Universität Greifswald ein Jubiläum feierte, wohnte der König von Preußen bei ihm. Friedrich von Seeckt genoß eine allgemein verbreitete Verehrung, die sich in einer Fülle von Anerkennungen äußerte. 1867 schreibt ihm der preußische Kronprinz als Statthalter in Pommern einen langen, herzlichen Glückwunschbrief: »... Habe ich doch als Statthalter der Provinz, welcher Ihr amtliches Wirken seit einem halben Jahrhundert in fast ununterbrochener Folge angehört, die großen Verdienste kennen und würdigen gelernt, welche Sie sich hierbei um die Rechtsordnung und die Rechtspflege Neu-Vorpommerns erworben haben. Denn wie Sie einst in das Dunkel und die Verworrenheit seiner provinziellen Gesetze Licht und Klarheit brachten und dies damit wieder zu einer auch den Laien zugänglichen und verständlichen Rechtsquelle erschlossen, so haben Sie demnächst, an die Spitze des höchsten Gerichtshofes in diesem Landesteile berufen, diesem das schönste Kleinod des Richters zu erhalten und zu mehren verstanden: das Vertrauen der Gerichtseingesessenen zu der unerschütterlichen Unparteilichkeit seiner Rechtspflege …« Friedrich von Seeckts Frau Charlotte von Schubert muß in ihrer Jugend eine sehr schöne Frau gewesen sein, die auch der spätere Kaiser Wilhelm I. geschätzt hat. Er schenkte ihr ein Armband von großer Kostbarkeit. Bis in ihr hohes Alter hinein blieb sie eine ungewöhnlich kluge Frau, die eine gewisse Großartigkeit des Lebensstils wagte. Vielleicht trug dazu bei der Verkehr mit einer ganzen Anzahl Schubertscher Verwandter, die sich in hohen russischen Generalstellen befanden.
Aus der Ehe Richards und Augustes von Seeckt sind vier Kinder hervorgegangen. Der älteste und der jüngste Sohn starben früh. Als zweites Kind wurde die Tochter Marie, später Gräfin von Rothkirch und Trach, und am 22. April 1866, also wenige Wochen, bevor der Vater die Mutter mit ihren drei Kindern verließ, um den Böhmischen Krieg mitzumachen, in Schleswig als drittes Kind Johannes Friedrich Leopold von Seeckt geboren. Die ersten Lebensjahre des Knaben werden etwas unruhig. Kurz vor der Geburt Hansens war der Vater in die Garde versetzt. Bald nach Kriegsende wird er Korpsadjutant beim II. Korps, dessen Kommandierender General der Kronprinz von Preußen war. Infolgedessen war damals der Sitz des II. Korps nicht Stettin, sondern Berlin. 1868 wird der Vater in das Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment versetzt, bei dem er bis zum Herbst 1874, also auch während der ganzen Kriegszeit, verblieb. Der junge Hans lernt damit die Stadt kennen, in der er einen wesentlichen und den wichtigsten Teil seines Lebens verbringen sollte. Man wohnte zunächst in der Regentenstraße, also in dem Viertel Berlins, das seiner späteren Wirksamkeit als Chef der Heeresleitung recht nahe lag. Später siedelte man in die Cantianstraße über, die es heute nicht mehr gibt. Hans hat hier auch mit der Schule begonnen. Sie ist ihm zunächst nicht schwer gefallen. Die Mutter berichtet einmal brieflich, daß es ihm leichter würde als dem älteren Bruder, daß er aber kein ganz einfaches Kind und manchmal recht unnütz sei. Übrigens nennt ihn der Vater einmal einen hübschen Jungen. So sehr viel wurde im Elternhause aus den Kindern nicht gemacht. Sie hatten sich mit der damaligen Selbstverständlichkeit als Kinder dem Ganzen einzufügen. Das mag dem allerdings recht lebhaften Kinde nicht immer ganz leicht gefallen sein. Jedenfalls war er dem Großvater manchmal zu laut. Als er ihm bei einer Sommerreise in Wiesbaden einst sein lautes Wesen verwies, erklärte Hans, er wollte auf den Neroberg, um da einmal so laut schreien zu können, wie es ihm paßte.
Als der Vater 1874 nach Detmold versetzt wurde, begann nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Kinder eine Zeit, die allen stets in besonders froher Erinnerung geblieben ist. Daß sich hie und da einige kleine Schwierigkeiten zwischen dem königlich preußischen Kommandeur und dem regierenden Fürsten von Lippe-Detmold ergaben, Kompetenzschwierigkeiten, von denen wir heute mit Humor Kenntnis nehmen, berührte die Kreise der Kinder nicht. Man hatte ein wunderschönes Haus, einen großen Garten, die finanzielle Lage war fühlbar gebessert, man sah sehr viel Gäste. Der junge Hans beginnt seine ersten Reitversuche, die vielleicht der Anlaß geworden sind, daß er Zeit seines Lebens ein recht guter Reiter blieb, dem man noch in späterem Alter eine weiche Hand nachrühmte. Er ist auch noch als Chef der Heeresleitung mit einer bei ihm ungewöhnlichen, fast ausgelassenen Freude Jagden mitgeritten. Auf der Schule kommt er gut vorwärts, ohne irgendwie Besonderes zu leisten, und macht ausgiebig seine üblichen Jungensstreiche.
Das Jahr 1881 bringt die Versetzung des Vaters als Brigade-Kommandeur nach Straßburg. Hans ist hier ziemlich viel sich selbst überlassen und tritt bemerkbar hinter der nunmehr ausgehenden Tochter zurück. Angeblich nutzte er dieses Unbeachtetsein dahin aus, daß er sogar einmal sitzen geblieben ist. Ob es stimmt, läßt sich nicht mit Gewißheit feststellen. Wenn es stimmt, hat es der in solchen Dingen recht nüchtern denkende Vater keineswegs mit besonderem Groll vermerkt. So ist es jedenfalls der Schwester in Erinnerung geblieben. Die Straßburger Schulen hatten damals noch Sommerabitur. Dadurch kommt es, daß Hans von Seeckt am 17. Juli 1885 zu Straßburg die Reifeprüfung besteht. Das Zeugnis der Reife ist recht interessant. Aufmerksamkeit und Fleiß sind nur im ganzen gut. Dann aber heißt es in Deutsch wörtlich: »Von Seeckt ist in der deutschen Literatur ungewöhnlich belesen und hat für die Werke derselben ein feines tiefdringendes Verständnis, das namentlich auch in seinen sehr guten Aufsätzen nach der kritisch-ästhetischen Seite hin in erfreulicher Weise zutage trat. Die Examensarbeit war gut. Schlußurteil sehr gut.« Man muß schon zugeben, daß dies Urteil dem kritischen Vermögen jenes Schulmannes, der es abgab, ein recht günstiges Zeugnis ausstellt. Dieser Lehrer hatte bei dem jungen Menschen einen der stärksten und bleibenden Wesenszüge der Persönlichkeit erfaßt, nämlich die kritisch-ästhetische Begabung Über den Ordinarius der Oberprima schreibt Seeckt fast genau 30 Jahre später: »Heute hatte ich einen netten Brief von dem von mir nachhaltig verehrten Lehrer, Professor Theobald Ziegler, damals Straßburg, der mich in der Zeitung gefunden und seinen alten Schüler erkannt hatte.«. Man darf annehmen, daß das »sehr gut« in Deutsch im Einvernehmen mit einem wohl ausschließlich durch das »Verständnis für die Schönheit der griechischen Autoren und die Fertigkeit geschmackvoller Übersetzung« erreichten »gut« in Griechisch wesentlich dazu beigetragen hat, über sonstige Fährnisse in nicht weniger als vier anderen Fächern hinwegzuhelfen. Erstaunlich ist, daß man der Beurteilung in Geschichte ansieht, sein Lehrer habe sich nur mit äußerster Mühe zu einem »genügend« bewegen lassen. Eigenartig ist ein etwas absprechendes Schlußurteil im Turnen. Dem steht gegenüber, daß er sonst körperlich keineswegs als junger Mensch etwa linkisch war, ohne freilich besonders turnerisch gewandt zu sein. Man konnte ihn auch nicht eigentlich zart nennen, obwohl er ganz gewiß körperlich kein Kraftmensch war. Jedenfalls hat er in seiner militärischen Entwicklung niemals körperliche Schwierigkeiten gehabt. Es muß ihm also irgend etwas an der Art der körperlichen Schulung in Straßburg wahrscheinlich nicht gepaßt haben. Das etwas magere Reifezeugnis hindert nicht, daß der Statthalter in Straßburg den mulus als Belohnung mit den Eltern zum Essen einlädt.
Der Vater läßt ihn beim Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiment Nr. 1 eintreten, an das ihn selbst die Feldzugserinnerungen von 1870/71 offensichtlich enger banden, als die von 1866 an das Augusta-Regiment.
Über dieses Alexander-Regiment hat 1926 beim Abgange Seeckts ein sozialdemokratischer Journalist, den man sonst nicht gern zitiert, ein eigenartiges Urteil abgegeben:
»Seeckt stammte aus der Garde-Infanterie des alten Heeres, und zwar aus dem berühmten Alexander-Regiment. Für den Kenner der kaiserlichen Wehrmacht sagt das schon allerhand … Bei den Alexandrinern erzog man den Mann von Welt. Die Alexanderleute waren durchweg gescheite Burschen, tüchtige Militärs und – eine Seltenheit in der alten Armee – kaltschnäuzige Diplomaten und zugeknöpfte Gentlemen gewesen … Groener oder … Reinhardt wären im Alexander-Regiment, das von Vornehmheit nur so triefte, bald an die Luft gesetzt worden. Hier in dieser Atmosphäre der Generalstabs-Diplomatie wuchs Seeckt heran und blieb Alexandriner bis auf den heutigen Tag, das heißt er blufft die Leute, die er düpieren will und die er für seine Winkelzüge braucht, daß ihnen das Wasser aus den Augen rinnt.«
Hieran war so viel falsch, als der Verfasser an Gehässigkeit in seine Sätze hineinbringen mußte, um die Leser seiner Zeitung zu befriedigen. Es war auch grundfalsch, ausgerechnet Seeckt nachzusagen, daß er die Leute bluffe. Gerade das hat Seeckt nie getan. Er hat keinen Gegner für dümmer gehalten, als er war. Er hat genau gewußt, daß der politische Bluff immer von der anderen Seite schließlich früher oder später, und zwar meist früher, durchschaut und dann lediglich als ein Zeichen der Schwäche erkannt wird. Aber sonst stand in den Sätzen manches, was gar nicht schlecht beobachtet war. Gescheite Burschen, tüchtige Militärs waren diese Alexander-Offiziere jedenfalls. Es war ganz gewiß eine ausgezeichnete Truppe, in deren Verband der junge Avantageur eintrat, eine vorzügliche Schule altpreußischer Pflichtauffassung. Später ist so viel an alten Garde-Truppenteilen herumkritisiert worden, daß man wohl vermuten kann, Hans von Seeckt hätte ein Wort zu ihrer Ehre gefunden, wenn er selbst in dankbarer Erinnerung an sein altes Alexander-Regiment sein Leben beschrieben hätte. Unter manchem anderen Vorwurf ist der Garde nachgesagt, sie sei zu fein gewesen. Zu fein zum Sterben auf dem Schlachtfeld war diese Garde jedenfalls nicht, und das sagt wohl alles. Eine Truppe, die ihren Mannschaftsersatz sich bevorzugt aus dem ganzen Reich aussuchen durfte und deren Offizierkorps seinen Nachwuchs aus lebhaftem Angebot auszuwählen in der Lage war, hätte schon grobe Fehler in ihrer Entwicklung machen müssen, wenn sie nicht zu den Besten des deutschen Heeres gehört hätte. Mindestens mußte die Garde so gut sein wie jeder andere Truppenteil, der günstige Voraussetzungen für sich hatte. Wenn man das Offizierkorps fein nannte, so ist das ja nun vielleicht noch kein Vorwurf, der sich länger aufrechterhalten läßt, als man einem gedankenlosen Schlagwort zu huldigen beabsichtigt. Gerade die innere und äußere Struktur Seeckts ist so angetan von persönlicher Feinheit, daß man nur wünschen möchte, diese seelische, charakterliche und auch sonstige Feinheit möge niemals als ein Nachteil, sondern immer als ein Vorzug anerkannt bleiben.
Es wird nicht sehr häufig sein, daß man von der Hand eines großen Soldaten einen eigenen Bericht von den ersten Stunden seines militärischen Lebens hat. Es ist ein Brief an die Eltern vorhanden vom 8. August 1885:
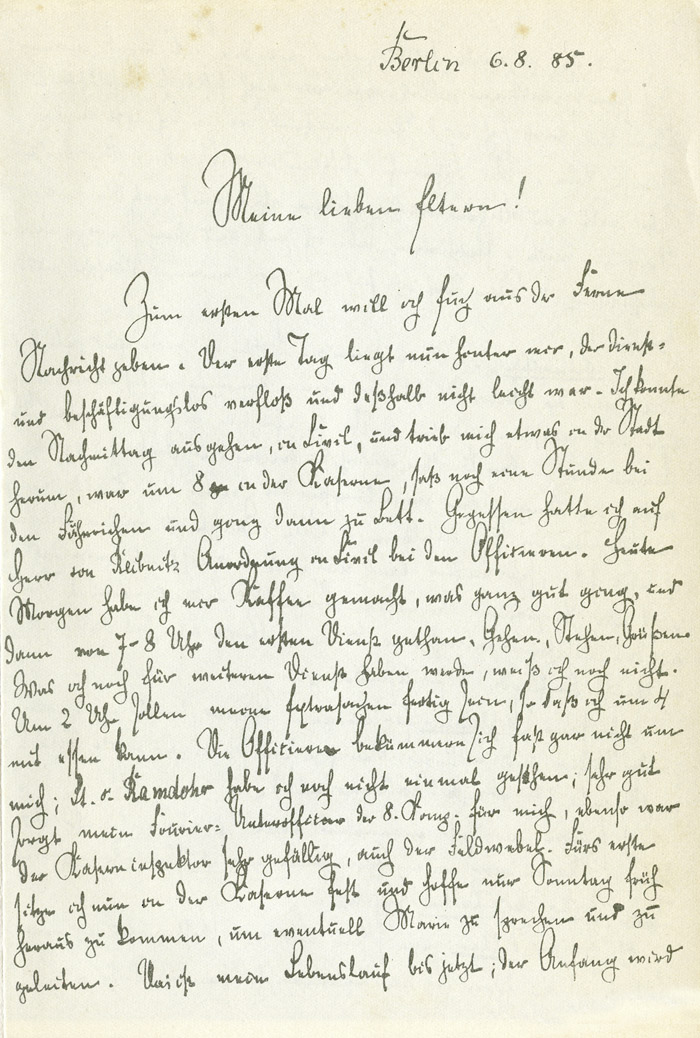
Brief an die Eltern vom 6. August 1885
»Meine lieben Eltern!
Der erste Tag liegt nun hinter mir, der dienst- und beschäftigungslos verfloß und deshalb nicht leicht war. Ich konnte den Nachmittag ausgehen, in Zivil, und trieb mich etwas in der Stadt herum, war um 8 Uhr in der Kaserne, saß noch eine Stunde bei den Fähnrichen und ging dann zu Bett. Gegessen hatte ich auf Herrn von Reibnitz Anordnung in Zivil bei den Offizieren. Heute morgen habe ich mir Kaffee gemacht, was ganz gut ging, und dann von 7 bis 8 Uhr den ersten Dienst getan. Gehen, stehen, grüßen … Sehr gut sorgt für mich mein Unteroffizier der 8. Kompanie, ebenso war der Kasernen-Inspektor sehr gefällig, auch der Feldwebel … Der Anfang wird und ist ja nicht leicht; aber mit der Zeit wird man sich schon gewöhnen; alles was mir noch fehlt, ist Gesellschaft, aber das wird sich auch schon machen, wenn ich erst mehr Dienst habe. Die Fähnriche Lüttken und Schmeling sind beide sehr nett und liebenswürdig, haben aber auch viel Dienst und liegen weit. Geschlafen habe ich gut und ohne Ungezieferbelästigung …«
Es folgen dann eine ganze Reihe von Wünschen an die Mutter um Wäsche, Teller, Gläser und auch Möbel, da er sein Zimmer noch ziemlich ungemütlich findet. Er schließt die Aufzählung seiner Wünsche: »... daß Ihr das alles nach Eurem Einsehen und das heißt am besten einrichten werdet, weiß ich sicher … Wenn mein Brief noch etwas melancholisch klingt, so schiebt das auf die Ungewohntheit der neuen Lebensweise und ein gewisses Gefühl des Unbehagens. Ihr habt mich so lange Jahre mit Güte und Sorge überhäuft, daß ich mich nicht so leicht in diese spartanische Einfachheit hineingewöhnen kann. Aber den Kopf oben behalten und den Humor nicht verloren, wie Du, lieber Vater, sagst. Es wird sicher gut gehen. Für alle die Güte und Freundlichkeit, die Ihr mir so viele lange 19 Jahre erwiesen, Euch danken zu wollen, wäre ein törichtes Versuchen, das soll mein ganzes Leben …
Lebt wohl, meine geliebten Eltern
Euer gehorsamer und dankbarer
Sohn.«
Nun sollte er also die hohe Grenadiermütze tragen, die es nur im 1. Garde-Regiment und im Alexander-Regiment gab Tatsächlich hat Seeckt die friderizianische Blechmütze nicht von diesem Augenblick an, sondern erst etwas später getragen. Sie wurde am 9. Februar 1894 dem Alexander-Regiment verliehen.. Man kann wohl sagen, daß sie dem jungen eleganten Menschen ausgezeichnet stand. Aber ihm stand schließlich alles, das schlichte Feldgrau ebenso wie der friderizianische Schmuck. Er hätte im Rokoko eine gleich gute Figur gemacht wie unter dem Stahlhelm: einfach, weil er immer er selbst blieb.
Er findet sich schnell hinein in die neue Umgebung. In den alten Garderegimentern wurde unheimlich viel Dienst getan, so daß der junge Hans den Ernst des Soldatenberufs sehr bald kennenlernt. Das hat ihn nicht gehindert, von Anfang an mit seiner inneren Fröhlichkeit immer wieder obzusiegen und zu erkennen, daß der kein guter Soldat werden wird, dem Humor und echte Lebensheiterkeit abgehen. Nach wenigen Tagen schon hat er den Anschluß an die Umgebung, die ihm zunächst recht fremd war, gefunden. Am 26. 8. 1885 schreibt er an die Schwester:
»... Ich bin heute abend ganz solide zu Hause, freilich auch so müde, daß ich nach diesen Zeilen direkt linksum mache, dann liege ich zu Bett. Mein Zimmer ist nämlich so breit, daß ich zuweilen ausgehen muß, um Platz zu haben, meine langen Beine auszustrecken. Doch ist meine Kajüte noch verhältnismäßig ganz gemütlich, und neulich abends nach der Ressource besuchten mich sämtliche Fähnriche, um bei mir noch ein ganz kleines Glas zu trinken. Zwei saßen auf dem Bett, zwei auf Stühlen, zwei auf der Waschtoilette und einer auf dem Koffer. Gut, daß es nur eine halbe Stunde dauerte, sonst wären wir wohl erstickt. Die Eleganz ist schwach, wie man denn überhaupt auf diese ganz verzichten muß. Am meisten tun mir meine Hände leid. Freilich besitze ich überhaupt keine heilen Knochen mehr … Ich wollte, Du könntest Deinen Bruder sehen, wie er zwischen 20 Grenadieren sitzt … Heute habe ich selbst ein Seitengewehr blitzblank gescheuert. Die Leute sind amüsant. Alle wollen sich gern mit mir unterhalten. Morgen kommt etwas Abwechslung. Ich marschiere mit dem Bataillon zum Exerzieren zur Einsamen Pappel. Was ich dabei soll, ist mir noch schleierhaft. Aber es ist doch etwas anderes. Eigentlich sollte ich beim Nachkommando während des Manövers zurückbleiben. Ich remonstrierte aber beim Feldwebel, so daß ich zu den Manövern mitkomme …«
Am 1. März 1886 geht er nach Hannover auf Kriegsschule. Die Stadt gefällt ihm, und er kann, wie er der Schwester schreibt, nicht genug den netten Ton im Kameradenkreise rühmen. Der Dienst ist anstrengend, aber es bleibt doch auch Zeit zu gesellschaftlichen Unternehmungen, Theater und Fahrten nach Herrenhausen. Am Ende der Kriegsschulzeit fällt er selbst in einem Briefe ein zusammenfassendes Urteil über diese Monate:
»Ich freue mich, daß die Kriegsschulzeit vorbei ist. Nicht allein aus dienstlichen Gründen, die ja auf der Hand liegen, sondern auch aus anderen Ursachen freue ich mich auf Berlin. Es fehlt hier auf der Kriegsschule doch in vielen Beziehungen das, was man gemütlich nennt, und Bekanntschaften und Leben tragen so sehr den Stempel, daß es nur auf ein paar Monate ist. Ich verkenne ja nicht, daß man vielleicht nie mehr in seinem Leben so ausgelassen, jugendlich vergnügt sein wird, daß man selten sich so fröhlich wieder zusammenfindet. Aber andererseits muß ich sagen …, daß der Kreis doch nur klein ist, an den man mit Liebe zurückdenkt. Es mag sein, daß ich nicht recht dazu angelegt bin, Freundschaften zu schließen, aber es ist schade, daß ich immer wieder bei den Leuten den Teufelsfuß sehe und der Spott mir dann näherliegt als das freundliche Wort. Doch kann ich wenig klagen; meine Stellung ist recht gut, und der Beiname, den mir meine Berliner Kameraden gaben, Allvater, ist nichts weniger als beleidigend. Aber es ist leider wahr, ich komme mir doch so alt vor neben den andern, wo doch kein Jahresunterschied ist, und ich möchte um alles nicht blasiert sein …«
Besondere Anstrengungen, hervorzutreten, macht er nicht. Das Abschlußzeugnis der Kriegsschule weist als Gesamturteil ein glattes Gut auf, und in den einzelnen Urteilen mit Ausnahme von Planzeichnen nur gute und sehr gute Prädikate. Das Abgangszeugnis bescheinigt ihm geistige und militärische gute Beanlagung, Fleiß und Gewissenhaftigkeit, ruhigen und gesetzten Charakter. Wie man sieht, eigentlich nichts Ungewöhnliches, wohl aber eine feste Grundlage, auf der sich viel entwickeln kann, und vor allen Dingen eine gewisse Geschlossenheit der Persönlichkeit, die frühzeitig sich bemerkbar macht.
Zum Regiment zurückgekehrt, tut er seinen Dienst, wie ihn eben jeder gut beanlagte junge Gardeoffizier macht. Er ist auch durchaus bereit, die Freuden, die die Garnison Berlin bietet, als junger Mensch gern und lebenshungrig zu genießen. Über die Hoffestlichkeiten, an denen er vielfach teilnahm, schreibt er 1910, als es sich darum handelt, ob seine Nichte, die Komtesse von Rothkirch, daran teilnehmen soll, ein ganz treffendes Urteil. Er meint, die Nichte dürfe diese äußere Darstellung von echter Würde, echter Pracht und Glanz der Macht des Deutschen Reiches mitzuerleben, nicht versäumen. Und dann kommt, fast typisch, ein Nachsatz, der die leise Skepsis im Wesen Seeckts andeutet. Er fügt hinzu, so schön farbenprächtig und wirklich geschmackvoll diese Feste seien, es bliebe naturgemäß zum Schluß auch hier eine leise Enttäuschung nicht aus. Aber das sei wohl bei allen Vergnügungen jeder Art so. Dadurch solle die Nichte sich nicht stören lassen. Es ist also ganz klar, daß Seeckt hinter diesen Hoffestlichkeiten nicht eine leere Form, sondern allerdings die würdige Darstellung des kaiserlichen Glanzes und darin der Macht des Volkes sah und sehen wollte. Innere Kraft kam äußerlich in Formen zum Ausdruck, die in althergebrachtem Wesen ihren Sinn dadurch so leicht darzustellen vermochten, daß ihnen Gewohnheit und Brauch zu Hilfe kam, der in Jahrhunderten sich lebendig und ungezwungen entwickelt hatte. Im Grunde enthielt gerade der Zwang höfischer Etikette Stil und eine sehr schwer nachahmliche äußere Haltung, die doch immer nur das Spiegelbild innerer Haltung sein kann. Das Zeremonielle ist ja nichts anderes als der äußere Ausdruck für die Ehrwürdigkeit des Altgewohnten und Erprobten. Wer in Hoffesten nur leeren Prunk sehen wollte, der denke an England. Nicht alles Alte ist wertlos, nur weil es alt ist. Seeckt hatte, wenn er auch nie an Äußerlichkeiten hing, doch ein feines Gefühl für die äußere Form, wenn sie innere Werte zum Ausdruck brachte oder auch nur andeutete. Wer jemals eines dieser alten Hoffeste im Berliner Schloß im Glanz der bis 1912 noch echten Kerzen mit der Farbigkeit der damaligen Uniformen und Orden und in der vielleicht etwas steifen Würde des Hoftones gesehen hat, der wird diese Eindrücke nicht leicht vergessen.
War der Freundeskreis in Hannover nicht sehr groß, so war er, als Seeckt zum Regiment zurückgekehrt war, ausgesprochen begrenzt. Es ist nicht so, daß der junge Seeckt nicht kameradschaftliche Beziehungen im ganzen Offizierkorps gehabt hätte; ganz im Gegenteil. Aber freundschaftlich schloß er sich doch nur einem engeren Kreise an. Er war, wie sich einer der Freunde einmal ausdrückte, das äußerste Gegenteil von ruhmredig; wenn nicht still, so doch wenig redend. Aber was er sagte, hatte Hand und Fuß. Er schloß sich wirklich nicht leicht an. Man hätte ihn schon in jungen Jahren für kühl halten können, wenn nicht eine spürbare Tiefe seines Wesens oft diesen Eindruck wieder aufgehoben hätte. So ist der junge Seeckt vielleicht etwas langsamer im Offizierkorps warm geworden als dieser oder jener andere, war aber von vornherein als ein äußerst zuverlässiger und vortrefflicher Kamerad bekannt. Zu dem engeren Freundeskreis gehörten die Leutnants von Bismarck, von Biehler, von Hülsen und von Kemnitz Kemnitz hatte den Spitznamen »Doktor« und wird auch stets in Briefen so genannt.. Dieser Kameradenkreis genoß nun alle die Freuden des großstädtischen Lebens, wobei der sehr formgerechte elegante junge Leutnant von Seeckt gern für etwas kitzlige gesellschaftliche Angelegenheiten herausgesucht wurde. Übrigens ist der Freundeskreis, wie das etwas dem Geist der Zeit entspricht, nicht einmal frei von gelegentlicher romantischer Überschwenglichkeit und lyrischer Viktor-Scheffel-Stimmung. Es sind freilich die schlechtesten Leutnants nicht, die sich für Verse begeistern können.
Der Verkehrskreis blieb überdies durchaus nicht einseitig begrenzt. Man sagt dem alten Offizierkorps leicht nach, daß es sich kastenmäßig abgeschlossen hat. Das trifft wohl nur insofern zu, als es fast instinktiv den Verkehr mit Kreisen ganz gleich welchen Standes, welcher Volksschicht und welcher Wirtschaftslage zu meiden bestrebt war, die in ihrer gesamten Lebensauffassung nicht mit einer soldatischen Gesinnung und allem, was damit nun einmal notwendig zusammenhing, harmonieren konnten. Es ist zuzugeben, daß im gesamten Verlauf des 19. Jahrhunderts und insbesondere in seinem letzten Viertel sich immer mehr Kreise von der soldatischen Lebensauffassung abwandten und daher das Offizierkorps sich immer mehr gegen die Außenwelt tatsächlich abschloß. Das ist aber selbst um die Jahrhundertwende niemals so weit gegangen, daß eine einseitige geistige Einstellung herauskam. Als einst ein Regiments-Kommandeur kurz vor dem Kriege einen zur Kriegsakademie einberufenen Offizier dahin qualifizierte, er sei Soldat und nur Soldat, da bemerkte eine ausschlaggebende Persönlichkeit: Das ist gut gemeint, aber eigentlich ein militärisches Todesurteil. Jedenfalls schloß sich der Freundeskreis um Seeckt in keiner Weise von der nichtmilitärischen Umwelt ab. Seeckt selbst hat dabei damals und auch später eine deutliche Vorliebe für den Verkehr in feingeistigen Künstlerkreisen gehabt. Unter anderem verkehrte er viel auch im Hause Anton von Werners. Daß dieser Verkehr weit über das gewöhnliche Maß hinaus innere Bande geknüpft hatte, beweist ein Brief der Tochter nach dem Tode des Vaters aus dem Jahre 1915 an General von Seeckt: »... Ich wollte Ihnen kurz danken, wie ich es mit den Hunderten, die geschrieben haben … tun muß. Aber ich bringe es nicht fertig, weil ich Ihnen ganz besonders danken möchte deshalb, weil er, der nun so still geworden ist, sich über Ihren Brief so sehr gefreut haben würde. Wie sehr haben Sie ihn verstanden. Daß zwischen Ihnen und ihm ein Band war, das über das Konventionelle hinwegging, Sie haben es gespürt und, was mich freut – Sie haben es genossen. Und wie recht haben Sie: Er gehörte ja zu uns. Das tat er wirklich, und alle seine Gedanken waren bei Ihnen allen da draußen an der Front, in Sorge um sein heißgeliebtes deutsches Vaterland … In einer Nacht wollte er plötzlich Stühle haben, weil Kaiser Wilhelm, Bismarck und Moltke zum Rathalten kommen wollten … Das letzte, was er deutlich sagte, war: Ihr müßt stark sein und aushalten. Eine große warme lebenspendende Flamme ist erloschen …«
Aus dem zweifellos hohen Stand des Alexander-Regiments ragt der junge Leutnant zunächst nicht besonders hervor. Er ist als sehr kluger und vor allen Dingen charakterlich zuverlässiger Mensch bekannt, als ein Offizier, in dem etwas drinsteckt. Vielleicht fallen von vornherein seine Winterarbeiten einigermaßen auf. Er wird dann nach einiger Zeit, nämlich im Februar 1892, beim I. Bataillon, dessen Kommandeur Oberstleutnant von Ramdohr war, Adjutant. Auch das ist nicht einmal sonderlich früh.
Eine eigenartige Episode aus dem Jahre 1888 verdient festgehalten zu werden. Der alte Kaiser war im Dom aufgebahrt. Bei aller Verehrung, die der alte Herr genoß, waren die mit der Aufbahrung beauftragten Behörden doch nicht auf diesen Grad der Liebe und Anhänglichkeit der Bevölkerung gefaßt. Hört man die Schilderung von Augenzeugen der damaligen Vorgänge, so können sich selbst Menschen, die noch im Kaiserreich groß geworden sind, schwer eine Vorstellung davon machen, wie stark die Bande waren, die sich um den alten Kaiser und sein Volk schlangen. Nach 1890 hat das Volk seinen Kaiser leider nicht mehr verstanden, und die Kanzler der Nach-Bismarck-Zeit waren nicht imstande, das Verständnis für den Kaiser und für das Wesen der Monarchie überhaupt zu erhalten oder gar neu zu stärken. Als aber Kaiser Wilhelm I. die Augen schloß, da war das Verhältnis von ihm zu seinem Volk noch erfüllt von natürlicher Selbstverständlichkeit. Das kam in den Tagen der Aufbahrung deutlich zum Ausdruck. Die Menge drückte die Absperrung durch und flutete in den Lustgarten hinein. Um ein Unglück zu verhüten, das notwendig entstehen mußte, wenn die Menge nicht zum Stillstand kam, vielmehr weitere Massen nachdrängten, wurde die zunächst liegende Kompanie alarmiert. Es war die 9. Kompanie des Alexander-Regiments. Der Hauptmann war im Augenblick der Alarmierung abwesend, die Kompanie wurde von dem blutjungen Leutnant von Seeckt geführt. Er sieht sofort, daß gegenüber der kopflos gewordenen Masse mit Güte nichts mehr zu machen ist. Da läßt er das Bajonett aufpflanzen und geht mit der Truppe vorwärts. So scharf die Maßnahme erscheint, so notwendig war sie, weil sonst die Folgen nicht abzusehen waren. Das Vorgehen hat auch völlig unblutigen Erfolg und zeigt deutlich zwei Eigenschaften: Entschlossenheit und Verantwortungsfreude. Die Entschlossenheit konnte man füglich erwarten, wenngleich es nicht alltäglich ist, gegen Menschen, die nichts Böses wollen, mit der blanken Waffe plötzlich vorzugehen. Es ist fast wie ein symbolischer Vorgang. Seeckt hat es später unter Einsatz seiner vollen Autorität zu verhindern gewußt, daß die Waffe gebraucht wurde gegen Menschen, die dem Soldaten innerlich nahe standen. Aber er hat sich auch niemals gescheut, die Waffe selbst gegen Angehörige des eigenen Volkes zu gebrauchen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gab. Mögen die Vorgänge von 1888 und nach 1918 in der inneren Motivation wahrhaftig grundverschieden genug sein, die Entschlossenheit des 22jährigen Leutnants und des Generals an verantwortlicher Stelle war die gleiche geblieben. Zudem gehörte 1888 bereits recht viel Verantwortungsfreudigkeit zu einem solchen Verhalten. Die Verhandlungen über den Heeresetat waren von Mal zu Mal bei der fortschreitenden Entartung des Parlaments schwieriger geworden. Man beantwortete das nicht, indem man rücksichtslos sich durchzusetzen versuchte, sondern es begann jenes unselige Streben, möglichst nirgends von seiten der Wehrmacht in der Öffentlichkeit anzustoßen, ein Bestreben, das dann im Laufe der Zeit zu einer fast unüberwindlichen Angewohnheit geworden war. Der junge Leutnant von Seeckt war mitten in der Hauptstadt des Reiches keineswegs darüber ununterrichtet, daß man Kopf und Kragen riskierte, wenn man als Offizier irgend etwas tat, was der politischen parlamentarischen Öffentlichkeit nicht paßte. Wenn er hier im Lustgarten im März 1888 entschlossen tat, was er für richtig hielt, so zeigte sich hier schon der ganze Seeckt, wie er sich später bewährte.
1890 ist der erst vierundzwanzigjährige Leutnant tief betroffen durch Bismarcks Entlassung. Gefühlsmäßig setzte früh bei ihm, den sicherlich hierin der Vater leitete, eine ausgesprochene Bismarckverehrung ein. Der Tod des Fürsten läßt ihn ehrlich trauern. Seeckt ist ganz offenbar noch in seinem letzten Lebensjahrzehnt in politischen Dingen nicht ohne Beeinflussung durch seine Bewunderung für Bismarck gewesen.
Soweit sich feststellen läßt, hat Seeckt mit Bismarck nur ein einziges persönliches Zusammentreffen gehabt Mitgeteilt von Herrn Dr. v. Tirpitz, dem Sohn des Großadmirals v. Tirpitz, nach einer Unterredung vom 11. Dezember 1936, wenige Tage vor dem Tode des Generalobersten v. Seeckt.. Der siebzigjährige Generaloberst von Seeckt kam auf diese Begegnung zu sprechen, als er gefragt wurde, ob nicht äußerlich die eindrucksvolle Erscheinung Bismarcks eine gewisse Ähnlichkeit mit der Hindenburgs gehabt hätte. Seeckt erzählte darauf:
»Das alles Beherrschende in der Bismarckschen Erscheinung war das gewaltige Auge, das den Beschauer sofort in seinem Bann hielt. Das war bei Hindenburg anders. Ich hatte einmal als ganz junger Offizier Gelegenheit gehabt, Bismarck unmittelbar und menschlich nahe zu sehen. Ich war beim Tobe des alten Kaisers zur Totenwache im Sterbezimmer kommandiert. Draußen hatte ich noch einen Augenblick zu warten und sah unter den abgelegten Kleidungsstücken einen Kürassierhelm und -mantel. Sofort dachte ich mir: Bismarck; und ich hielt mich in der Nähe des Kürassierhelms auf, um den großen Mann aus nächster Nähe zu sehen. Bald darauf tat sich die Tür des Sterbezimmers auf und Bismarck erschien: bewegt, voll des eben Erlebten. Er sah mich, vergaß ganz, daß er einen unbekannten jungen Offizier vor sich hatte, und sagte völlig unerwartet zu mir: ›Merkwürdig, wie ähnlich der alte Herr auf dem Totenbett seiner Schwester, der Kaiserin von Rußland, geworden ist.‹ Er wurde sich dann der Situation bewußt und fuhr fort, während ihm in den Mantel geholfen wurde: ›Daß Sie heute Totenwache haben, ist ein großer Augenblick für Sie, der wird Ihr Leben begleiten.‹«

Als Fahnenjunker im Kaiser-Alexander-Gardegrenadier-Rgt. Nr. 1

Als junger Offizier 1887
Im Jahre 1892 wandte sich Hans von Seeckt eines Tages an seinen Freund, den »Doktor«, mit der Bitte, ob er ihm nicht ein Pferd, das unter der Dame ginge, leihen könnte. Der Leutnant von Kemnitz wußte, daß Seeckt keine sehr mitteilsame Persönlichkeit war, und fragte ihn nicht weiter nach den Gründen. Kemnitz hat ihn selbst einmal ernst und gleichzeitig mit einem vergnügten Schmunzeln die wandelnde Diskretion genannt. In diesem Falle klärte sich allerdings sehr bald der Grund auf, zu welchem Zweck Seeckt das Pferd haben wollte. Er brauchte es nämlich, um gelegentlich mit einer jungen Dame zu reiten, mit der er sich dann im November 1892 verlobte. Es war Dorothee Fabian, Ururenkelin Schleiermachers und Urenkelin von Ernst Moritz Arndt Ein seltsamer Zufall wollte es, daß Beziehungen zwischen E. M. Arndt und Seeckts Voreltern bestanden. Arndt verkehrte mit den Ururgroßeltern und hat 1797 ein Gedicht zur Hochzeit der Urgroßeltern gemacht.. Es ist Hans von Seeckt nicht ganz leicht gemacht worden, sich die Lebensgefährtin, an der er mit unveränderter und immer wieder bewiesener Liebe bis zu seinem letzten Atemzuge hing, zu erringen. In der Brautzeit schreibt er der Schwester, daß er um sein Lebensglück habe kämpfen müssen. Es mag dann sein, daß er es empfunden hat, daß die Ehe kinderlos blieb. Er hat einmal einen bezeichnenden Ausspruch über das Fehlen eigener Kinder getan: »Hätte ich das alte Familiengut Nepzin, so würde ich traurig sein, daß ich keinen Sohn habe. Hätte ich einen Sohn, wäre ich traurig, daß ich Nepzin nicht habe. Also ist es besser so.« Übrigens war nicht nur Frau von Seeckt, sondern gerade auch Seeckt selbst ungewöhnlich kinderlieb. Kinder konnten diesen zurückhaltenden, äußerlich kühlen Mann geradezu beherrschen, terrorisieren, ja ihn im Augenblick zu einem völligen Stimmungsumschwung bringen. Bei einer Übung mehrere Jahre nach dem Kriege stand er auf dem Torgauer Exerzierplatz und war mit Recht dienstlich verärgert und ausgesprochen gereizt. Auf einmal näherte sich ihm ein Mädchen von etwa fünf Jahren und überreichte ihm mit zweifelsfrei ungewaschenen Händen einen kleinen Blumenstrauß. Worauf Seeckt das Kind bis zur Abfahrt unmittelbar in seiner Nähe duldete und wegen oder infolge der Nähe dieses Kindes fröhlich und fast zu Scherzen aufgelegt blieb. Der kleine Blumenstrauß blieb auch auf der Rückfahrt in seiner Hand. Andererseits mag die Kinderlosigkeit ausgesprochen zu einer Vertiefung des Verhältnisses der beiden Lebensgefährten geführt haben. Es ist hier freilich nicht der Ort, diese unendlich vielgestaltigen und zarten Beziehungen zweier zweifellos ungewöhnlichen Menschen zueinander klarzulegen auch nur versuchen zu wollen. Seeckt selbst hat einmal in einer ungemein ritterlichen Art hierzu das Wort ergriffen. An seinem eigenen 60. Geburtstag hat er selbst eine Tischrede auf seine Frau gehalten, die vielleicht das schönste Bekenntnis über das echte innere Glück dieser Ehe gewesen ist. »Was ich geworden bin, verdanke ich zum großen Teil ihr, meinem guten Lebenskameraden. Sie hat es oft noch schwerer gehabt, als Sie – zu seinen um ihn herum sitzenden Adjutanten gewandt – meine Herren.«

Hochzeit Hans von Seeckts mit Dorothee Fabian am 3. Juni 1893 in Berlin vor dem Hause Lichtensteinallee 2 a
Der Winter 1892 zu 1893 wird nicht einfach. Als Adjutant heißt es, zum erstenmal Mobilmachungsarbeiten durchzuführen. Jeder, der noch in der alten Armee gestanden hat, weiß, daß diese Mobilmachungsarbeiten mit einer wohl kaum zu übertreffenden Genauigkeit bearbeitet wurden. Der Ablauf der Mobilmachungen von 1870 und ganz besonders von 1914 zeigte eine Gewissenhaftigkeit in dieser Arbeit, die ihresgleichen kaum hat. Der Generalstabschef des III. Korps mag sich 1913 seiner eigenen Mühen als Bataillonsadjutant erinnert haben, wenn er einige Fehler in den ihm vorgelegten Mobilmachungsarbeiten mit einer bei ihm sonst ungewöhnlichen Schärfe tadelte und sehr schnell abstellte. Zu diesen Mobilmachungsarbeiten kam im Winter 1892/93 die Vorbereitung zur Kriegsakademie. Es fiel in der Vorkriegszeit gelegentlich auf, daß der Prozentsatz, den die Garde zur Kriegsakademie stellte, stets verhältnismäßig hoch war. Man war deshalb dazu übergegangen, die Aufnahmeprüfung so zu machen, daß die Arbeiten für den Beurteilenden anonym blieben. Dies Verfahren zeigte das peinliche Bestreben in der alten Armee nach Gerechtigkeit. Es änderte aber an den Ergebnissen nichts. Die Dinge lagen einfach so, daß mancherlei Umstände den Berliner Offizieren die Vorbereitung etwas leichter machten als dem Offizier in einer weltfernen kleinen Grenzgarnison. Außerdem wurden die jungen Gardeoffiziere in der Vorbereitung wie ja überhaupt in ihrem ganzen Dienst recht scharf herangenommen. War Seeckt schon auf diese Weise dienstlich erheblich mehr in Anspruch genommen, als es einem Bräutigam lieb sein mochte, so kam noch etwas anderes hinzu, diese Zeit nicht leicht zu machen. Im Januar erkrankte die Braut schwer. Die innere Erregung über die zeitweise drohende Lebensgefahr durchzittert den sonst äußerlich so unbeweglichen Menschen. Man soll und darf nachträglich nicht darüber lächeln, wenn er versucht, die bange Sorge im Augenblick der ersten Besserung und Entspannung sogar in Verse zu fassen. Sie verraten keinen genialen Dichter, diese Verse, wirklich nicht. Aber sie verraten in einem Menschen, der hart genug sein konnte, ein weiches Herz und einen tiefen Glauben an seinen Gott.
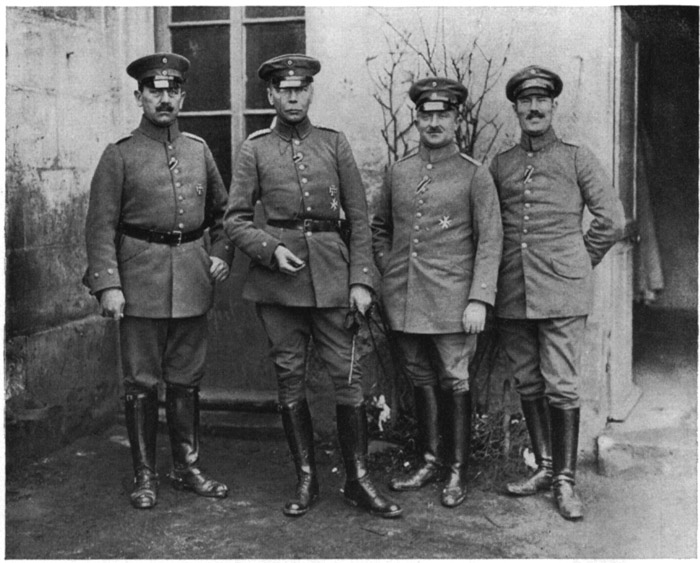
Der Generalstab des III. Armeekorps in Ange Gardien 12.12.1914

Der Chef des Stabes, zur Seite seines komm. Generals v. Lochow verläßt im Kraftwagen Pinon
Am 3. Juni 1893 ist die Hochzeit. Die Hochzeitsreise geht nach der Schweiz, und Seeckt erlebt nun seine erste größere Reise über die Grenzen Deutschlands hinaus. Er ist in seinem Leben dann noch sehr viel und weit gereist. Auf manche dieser Reisen wird zurückzukommen sein. In den beiden Jahrzehnten bis zum Kriegsbeginn haben sie ihn 1895 nach Italien, 1896 nach Ostende, Brüssel und Antwerpen, 1898 ganz kurz nach England, 1900 im Frühjahr nach Montecarlo, 1901 nach Abazzia und Venedig, 1902 zum ersten Male nach Paris, 1903 über Paris nach Spanien, 1904 nach Marseille, Neapel, Gibraltar, Algeciras, Marroko und Antwerpen, 1905 nach Ägypten geführt.

General von Kuhl zeichnete die weiteren Operationen in die Karte ein.
Ägypten erregt ihn tief in der Seele. Das Unergründliche reizt ihn: »Ägypten ist ein Rätsel, mögen die Gelehrten noch so viel Hieroglyphen lesen und Totenkammern durchforschen.« Nicht das dem Verstand Verständliche, das aus unergründlicher Rätseltiefe dem Empfinden etwas Gebende spricht ihn an.
1906 geht es über Paris, Marseille nach Algier, 1907 nach Indien, 1909 nach Venedig, 1910 wiederum nach Paris, 1911 in die Schweiz und an die Riviera. Im Spätherbst 1911 folgt noch nach Perugia und Siena der erste lange Rom-Aufenthalt, der die tiefe Liebe zur ewigen Stadt begründete und den zweiten langen Besuch 1927 stark beeinflußte. Es lohnt sich, einige Eindrücke aus Rom, den Briefen an die Mutter entnommen, wiederzugeben:
»... Ein Besuch in der Sixtinischen Kapelle … Wie groß müssen diese beiden Männer gedacht haben, der Künstler und sein Papst, daß sie in ihrer Hauskapelle nur das Große und Schwere des Lebens wiedergaben ohne jedes andere Licht als das der reinen Schönheit. Zu den Mühseligen und Beladenen spricht das alles nicht, nur zu den Ringenden und Kämpfenden, und wie erschütternd wirkt als Schlußstein der Jescnas, der das Prophezeien aufgegeben hat und nun still in das Unergründliche blickt … Ein Wort unter dem vollen Eindruck des Moses Der Moses des Michelangelo in San Pietro in Vincoli.: Nicht der zürnende Hohepriester, sondern der tief traurige große Mann, der sein schwaches armes Volk noch einmal um sich sammelt, der all ihr Irren und Wirren, allen den ewigen Jammer sieht und doch nicht wenden kann, der selbst das Land sah, das er nicht betreten durfte. Die wunderbaren Hände greifen nicht zornig in den Bart – den Gotteszorn faßte der große Mann anders in seinem richtenden Verdammer in der Sistina. Sie fassen – alt und doch nicht greisenhaft – die ganze Person in sich zusammen, halten sich an sich selbst fest. Das linke Bein ist nicht zum Aufspringen gestemmt; es hängt am Sitz und stützt zugleich. Er hält die Tafeln, aber er braucht sie nicht zur Stütze – er stützt sie ja selbst. Über den großen Papst, Herren und Freund, der ihm das Riesenwerk der Sistina anvertraute und ihm sagte: male, was du willst, dem er das Denkmal setzt größer als alle anderen, wächst diese Idee des großen alten Mannes hinaus, der soviel tat für sein Volk und der doch nun so todestraurig über es weg sieht, An manches denke ich, was ich allein weiß und empfinde. Mir ist es, als sei ich noch nie so ergriffen, so traurig gewesen wie unter diesen Mosesaugen …«
Ein gut Stück Welt ist es, das er kennenlernt. Es weitet sich der Blick, der Sinn wird hinausgelenkt auf die großen Zusammenhänge und der Grund dafür gelegt, Menschen, Dinge und Ereignisse weltweit, vielgestaltig und nicht vom begrenzten Standpunkt des nur Berufsmäßigen aus zu sehen.
Im Herbst 1893 beginnt das dreijährige Kommando zur Kriegsakademie. Auch in der Vorkriegszeit gab es Menschen, die mit der Kriegsakademie nicht zufrieden waren. Einerseits hat jede Institution ihre Fehler und wird sie immer haben. Andererseits konnte man aber ruhig feststellen, daß meist die schärfsten Kritiker nicht gerade die leistungsfähigsten Hörer der Akademie waren. Im ganzen genommen war die Kriegsakademie, die immerhin als Lehrer Männer wie Hindenburg und Ludendorff aufwies, ein Institut von einer Erfolgssicherheit wie kaum ein anderes. Sie war in dem Wissen, das sie gab, Vorstufe zum Generalstab. Daß dieser Generalstab gut war, hat der Krieg bewiesen. Also konnte wohl die Kriegsakademie nicht gerade schlecht sein. Die Auslese war von einer Schärfe, wie sie in der Tat kein anderer Beruf je aufzuweisen hat. Man kann vielleicht sagen, daß auf der Kriegsakademie selbst das positive Können stark betont wurde und infolgedessen das generalstabstechnische Wissen oft den Ausschlag gab. Das hat aber keineswegs dazu geführt, die charakterlichen Eigenschaften zu vernachlässigen. Immerhin ist es mehr Sache einer Akademie, das Wissen zu fördern, als den geborenen Führer herauszufinden. Das anzubahnen ist erst Sache der Auslese in der Zeit der Kommandierung zum Generalstab und im Generalstab. Aus diesem nun mehrfach ausgesiebten Kreise wiederum die echte Führernatur herauszusuchen, den Feldherrn zu küren, das kann überhaupt niemals Friedensaufgabe, das wird zuletzt und in entscheidender Weise immer nur die Aufgabe und das Ergebnis des Krieges sein. Man kann wohl ruhig behaupten, daß Kriegsakademie und Generalstab in der Art ihrer Qualifizierung, auch wenn ein leiser Unterschied im Schwergewicht der Beurteilungstendenz da gewesen sein könnte, keine unzulängliche Auslese getroffen haben. Im übrigen waren diese drei Jahre für einen jungen Menschen in einem genußfähigen Alter eigentlich die schönsten, die das militärische Leben bieten konnte. Das einzige, was der zur Kriegsakademie kommandierte Offizier vielleicht entbehrte, war der Kameradenkreis des eigenen Regiments, und auch das war bei dem Leutnant, seit Kaisers Geburtstag 1894 Premier-Leutnant, des Alexander-Regiments nicht der Fall.
Der Sommer 1895 bringt eine kleine Episode. Der Vater macht als Kommandierender General dem alten Grafen Schuwalow in dessen Gouvernements-Sitz, also im Schloß zu Warschau, einen freundnachbarlichen Besuch. Er nimmt außer dem Adjutanten den Sohn mit, was um so näher lag, als dieser ja die Uniform eines Regimentes trug, das den Zarennamen Alexander führte. Man wird von der Familie Schuwalow und von dem russischen Schwesterregiment Friedrich Wilhelm III. gastlich, sehr gastlich, beinahe allzu gastlich aufgenommen. Es gibt große Feste mit allem Glanz, den damals ein russischer Gastgeber zu entfalten vermochte, mit russischem Ballett auf einer Insel im Schloßpark und im ganzen mit sehr, sehr viel alkoholischen Getränken. Neben all dem äußeren Schein steht aber doch die Tatsache, daß der junge Offizier hier eine Reise erlebt, die nicht ganz ohne politischen Beigeschmack ist. Der alte Schuwalow erklärt dem Kommandierenden General von Seeckt, er bleibe preußenfreundlich bis an sein Lebensende. Aber Schuwalow ist nun alt und einflußlos. Genau 20 Jahre später, mitten im Kriege gegen Rußland, schreibt Hans v. Seeckt in einem Briefe: »... Eigentlich standen wir uns schon damals schlecht und taten nur so, als ob wir uns liebten. Der alte Graf Schuwalow meinte es persönlich ehrlich, unpersönlich so russisch wie möglich, was ja sein Recht war …«
Der Abschluß der Kriegsakademie ist recht günstig. Es ist nicht so, daß Seeckt zu den ganz großen Kanonen seines Jahrgangs, wie etwa Groener oder Tappen aus seinem Hörsaal, gehört. Aber er zählt in die Zahl der Besten mit bedingungsloser Qualifikation zum Generalstab. Wer solche Friedensqualifikation erreichte, durfte schon für sich in Anspruch nehmen, etwas zu können. Es ist dabei eigenartig, daß Seeckts Beurteilung in den drei Jahren nicht ganz gleichmäßig ist. Im ersten Jahr schwimmt er etwas mit dem Strom, im zweiten Jahr hat er augenscheinlich einen Zusammenstoß mit einem der ausschlaggebenden Lehrer, und im dritten Jahr, als es darauf ankommt, tritt er ganz deutlich in die Reihe der Besten ein. Der kleine Zusammenstoß im zweiten Jahr wäre fast nicht der Erwähnung wert, wenn er nicht etwas Charakteristisches enthielte. Seeckts ausgeprägtes Selbstbewußtsein hatte bei diesem Lehrer nicht nur kein Verständnis und keine Anerkennung, sondern sogar Tadel gefunden. Ganz gewiß besaß Seeckt ein sehr starkes Maß von Selbstbewußtsein, aber man wird sich daran nachher in den Jahren 1919–1926 erinnern und darauf zurückkommen müssen. Ohne dieses Selbstbewußtsein hätte er in jenen Jahren die Armee wohl kaum gerettet. Man kann sogar ruhig zugeben, daß Seeckt niemals ganz frei von Eitelkeit gewesen ist Seeckt hat einmal selbst gesagt, daß »Eitelkeit, Schönheitssinn und Kavalierinstinkt« sehr wichtige Faktoren bei ihm seien.. Es ist jene Eitelkeit, die weitaus die meisten großen Männer als kleine Schwäche und Kehrseite ihrer Kraft und ihrer großen Eigenschaften mit sich herumtragen. Ein ganz bestimmtes Maß von Eitelkeit ist nicht, wie der Spießbürger oft meint, ein Zeichen einer kleinen Seele. Es ist nur ein Zeichen, daß auch ganz große Männer ihre Menschlichkeiten haben und keine Halbgötter sind. Es ist nun sehr bezeichnend für die absolute Objektivität der Beurteilung, daß es dem Premier-Leutnant von Seeckt in keiner Weise geschadet hat, wenn sich einmal ein Vorgesetzter über sein Selbstbewußtsein ärgerte. Vielmehr wird dies Selbstbewußtsein schließlich als starker Charakterzug sogar zum Vorteil angerechnet In dem Erinnerungsbuch Generaloberst von Seeckt, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften, heißt es in der kurzen Lebensbeschreibung: »Im Juli 1896 wurde er nach Schlug der Übungsreise der Akademie bis zum 20. September 1896 auf eigenen Wunsch zur Dienstleistung zum Ulanen-Regiment Prinz August von Württemberg (pos.) Nr. 10 kommandiert.« Das könnte so aussehen, als wenn Seeckt ein Versetzungskommando beantragt hätte. Tatsächlich lagen die Dinge anders. Er hatte im Sommer 1895 die Reise nach Italien gemacht. Infolgedessen mußte er das vorgeschriebene Kavallerie-Kommando im nächsten Jahr nach Schluß der Kriegsakademie nachholen. Merkwürdigerweise hat sich Seeckt schon 1896, als das Kommando eben heraus war, schriftlich gegen die irrige Auslegung wehren müssen..
Der Winter 1896/97 ist noch einmal eine fröhliche Zwischenzeit vor der Strenge der Kommandozeit zum Generalstab. Er geht mit seiner jungen Frau bei Hofe aus und läßt sie all den Glanz der Hofgesellschaft einmal mitgenießen. Dann aber folgt im Frühjahr 1897 das Kommando zum Generalstab und zwar zur 2. Abteilung, also einer der wichtigsten des Generalstabes, der Aufmarsch-Abteilung. Gleichzeitig mußte er die Uniform wechseln und wurde zum Garde-Grenadier-Regiment Nr. 5 versetzt. Es ist verständlich, daß Seeckt die liebgewordene Alexander-Uniform, die schon der Vater getragen hatte, nur ungern ablegte. Allein auch zu dem neuen Regiment stand er bald in freundlichen Beziehungen. Der Generalstab nahm allerdings den ganzen Menschen. Viel Zeit für ein eigenes persönliches Leben ist im Generalstab niemals gewesen. Wenn der Generalstabsoffizier selbst am Heiligabend erst zu später Stunde heim kam, so war das nur ein typisches Kennzeichen der Arbeitsart in dieser Dienststelle. Dabei wurden hier nicht durch Leerlauf, wie das sonst gelegentlich vorkommen mag, Stunden vergeudet und Leistung nur durch Vielgeschäftigkeit vorgetäuscht, sondern in straffer Disziplin wirklich gearbeitet. Die Notwendigkeit der Pflichterfüllung bis zum Äußersten der Leistung, die die Aufgabe des Generalstabes von jedem einzelnen erzwang, und damit die Gefahr der Überbeanspruchung der Kräfte, des Raubbaus an Nerven sind ein Dilemma, das mit der immer größer werdenden Armee entstand, und niemals ganz zu lösen gewesen ist. Wie dem auch sei, wer dieser Beanspruchung jahrelang standhielt, mußte schon ein hohes Maß von Können, einen sehr widerstandsfähigen Körper und unverwüstliche Nerven haben. Freilich kann der Wille die physische Stärke ersetzen oder doch stark ergänzen. Auch Seeckt gehörte, wie Prinz Eugen, Friedrich der Große, zu den namhaften Soldaten, die eigentlich nicht gerade über einen besonders robusten Körper verfügten. Die unverwüstlichen Nerven hat er sich allerdings bis an sein Lebensende erhalten.
Daß dies der Fall war, ist durch manche kleine Episode bewiesen. Nach dem Kriege, als doch schon mancherlei auf die Nerven eingestürmt war und das Jahr 1919 körperlich Seeckt besonders zugesetzt hatte, wohnte er einem der ersten größeren Artillerie-Scharfschießen in Döberitz bei. Er stand innerhalb einer leichten Feldhaubitz-Batterie etwa zwei Meter seitwärts-rückwärts eines Geschützes. Munition und Material waren damals nicht durchweg einwandfrei. Ein Rohrzerspringer riß das Rohr etwa so auf, als wenn man eine Banane durch einen Schlag von beiden Seiten in den Längsrippen aufbaucht. Alles, was den Weg dabei nach außen fand, Geschoßteile, Geschützteile, verbranntes, verbrennendes und unverbranntes Pulver, dazu ein dicker schwarzgrauer Rauch hüllten uns Der Herausgeber war dabei. und die Geschützbedienung ein. Seeckt hatte vorher in seiner gewohnten, etwas lässigen Haltung, auf den Degen gestützt, das Kinn etwas vorgestreckt, unbeweglich das Schießen beobachtet. Als sich der Rauch verzog, die meisten von uns geschwärzte Gesichter, Hände und Uniformen hatten, stand Seeckt genau so wie vorher da, ohne daß er auch nur den Kopf bewegt hätte, geschweige denn die Hand oder einen Fuß. Die Geschützbedienung war durcheinandergekollert. Die im Schreck aller noch nicht überwundene Stille unterbrach plötzlich Seeckts ruhiger Tonfall, so etwa, als wenn er sich nach dem Befinden der Dame des Hauses erkundigte, mit den freundlich teilnehmenden Worten: »Ist jemand verletzt?« Als sich herausgestellt hatte, daß dies erstaunlicherweise nicht der Fall war, nahm er aus seiner Tasche einen größeren Geldschein, reichte ihn vergnügt dem etwas verdutzten Geschützführer und ging dann langsam fort, offensichtlich, um die Batterie nicht weiter in ihren vorgeschriebenen Feststellungen durch seine Anwesenheit zu stören. Über den Vorfall selbst hat er an dem ganzen Tag nicht ein Wort mehr gesprochen.
Die Leistungen während der Kommandozeit zum Generalstab fanden am 25. März 1899 ihre Belohnung durch die Versetzung in den Generalstab, also in jene Gemeinschaft, deren Ansehen in der ganzen Welt seit Moltkes Zeiten beinahe legendär geworden war und trotz oder gerade durch den Weltkrieg, schließlich durch Seeckts eigene Leistung nach dem Kriege dieses Ansehen niemals verloren hat. Wenn der Oberleutnant von Seeckt bisher eigentlich nicht aus dem Rahmen eines recht guten Offiziers herausgetreten war, so zeigte die Versetzung zum ersten Male eine kleine Ungewöhnlichkeit. Es war im allgemeinen Brauch, nur Hauptleute in den Generalstab zu versetzen. Hauptmann konnte er aber nach den bestehenden Bestimmungen infolge seines sehr jungen Dienstalters noch nicht werden. Es trat also der Fall ein, daß ein Oberleutnant in den Generalstab versetzt wurde und dessen Uniform trug. Einzig ist der Fall nicht gewesen, aber immerhin doch selten. Was sich dann daran schloß, war nun wiederum etwas Ungewöhnliches. Während sonst die jungen Generalstabsoffiziere noch einige Zeit im Großen Generalstab blieben, wurde Seeckt bereits im Juli 1899 als 2. Generalstabsoffizier ( I b) in den Generalstab des XVII. Armeekorps nach Danzig versetzt. Jetzt half es allerdings nichts, in dieser Stellung konnte der Generalstabsoffizier nicht mehr Oberleutnant sein. Es ergab sich also die etwas eigenartige Notwendigkeit, Seeckt zum Hauptmann im Generalstab ohne Patent zu befördern. Dieser Fall ist allerdings eine sehr große Seltenheit und zeigt erneut an, wie man bereits anfing, seine Persönlichkeit zu bewerten.
Seeckt hat stets sehr gern an seine Zeit in Danzig, in der er übrigens seinen späteren Oberbefehlshaber, den General von Mackensen, als Kommandeur der Leibhusaren-Brigade kennenlernte, zurückgedacht. Aber er hat sich anfangs nicht leicht mit der ihm ungewohnten Umwelt abgefunden. Der junge Gardeoffizier hatte immerhin eineinhalb Jahrzehnte Berlin genossen, und zwar wirklich genossen, und kam nun in eine Stadt, die man mit Recht einmal eine große Kleinstadt genannt hat. Hinzu kam die Residenzpflicht der Offiziere. Man durfte nicht draußen auf der schönen halben Allee, als solche entstanden aus den Angriffsmaßnahmen eines napoleonischen Generals im Angriff auf Danzig, wohnen; erst recht nicht in Langfuhr oder gar Zoppot. Man mußte also innerhalb der Stadt eine recht schöne, aber doch wenig schön gelegene Wohnung an der Sandgrube Straßenname in Danzig. nehmen. Nach und nach hat sich auch Seeckt nicht den Schönheiten dieser einzigartigen Stadt verschließen können, die Eichendorff zum Greifen deutlich besungen hat:
»Träumerisch der Mond drauf scheinet,
Dem die Stadt gar wohl gefällt,
Als läg zauberhaft versteinet
Drunten eine Märchenwelt.«
Wer je an einem verschneiten Winterabend vom Krantor kommend durch die Jopen- oder Frauengasse zum Langen Markt herübergegangen ist, wird sich, wenn er nicht eine völlig kalte Natur war, diesem Märchenzauber der alten urdeutschen Stadt nicht haben entziehen können. Dazu kam die herrliche Umgebung: alte Buchenwälder, hohe Hügelküste und die See. Aber es hat, wie gesagt, eine Zeit gedauert, bis auch Seeckt dem Zauber dieser Stadt erlag. Anfangs war er rein örtlich mit dem Wechsel recht wenig zufrieden.
Der Kommandierende General war damals eine der markantesten Persönlichkeiten im Heer, der auch weit in Zivilkreisen bekannt gewordene General der Infanterie von Lentze. Er gehörte zu jenen ausgesprochenen Originalen, an denen die Armee in der Tat niemals Mangel gehabt hat. Lentze war alles andere, nur nicht gerade ein gewandter Hofmann. Er war aus der Schule des Generalstabs hervorgegangen, konnte außerordentlich viel, beherrschte aber, wie das sehr oft bei Generalstabsoffizieren festzustellen ist, in ungewöhnlicher Weise auch die Einzelheiten des Truppendienstes. Er ist der Truppe sicher oft recht unbequem gewesen. Freilich war seine äußere Schale so rauh, daß es nach Seeckts Begriffen gelegentlich die Grenze des Erträglichen gestreift haben mag. Seeckt hat dennoch seinen Kommandierenden General außerordentlich geschätzt und verehrt. Er hat ihm die Treue bis über das Grab hinaus gehalten. Aber es wäre falsch zu verschweigen, daß er unter dem zu starken Mangel an Formen der Lebenshaltung dieses Mannes gelitten hat. Seeckt hat sich in Briefen ganz unumwunden über das rauhe Benehmen seines Kommandierenden Generals klagend und sogar etwas spöttisch, aber immer gutmütig spottend ausgesprochen. Der oft zitierte Vers:
»Gott behüt mich vor der Grenze,
Gottlieb Häseler, August Lentze«
tat beiden Kommandierenden Generälen unrecht, ganz besonders dem überaus wohlwollenden Häseler. Aber auch Lentze tat er unrecht. Das Wesen Lentzes schildert Seeckt in der »Täglichen Rundschau«, als der Neunzigjährige in Wernigerode starb:
»... Moltkes Hand hob einst den jungen Offizier aus der Zahl seiner Altersgenossen heraus. Unter Goebens Führung erwarb er sich Kriegserfahrung und Anerkennung. Bis zum Generalmajor hielt der Generalstab ihn in seinen Diensten fest … General von Lentze ist ein glänzender Beweis, wie im alten Preußenheer ein Mann, dem keine Protektion, kein Name zur Seite stand, der wahrlich nicht die Gabe hatte, sich vor Menschen angenehm zu machen, gestützt nur auf eigene Tüchtigkeit, den Weg zur Höhe finden konnte.
Seinem westpreußischen Korps drückte er den scharfen Stempel seiner Persönlichkeit auf und, wenn kriegsmäßig heißt, nicht den Krieg nachahmen, sondern sich für ihn vorbereiten, so hob er seine Truppe zu einem seltenen Grad kriegsmäßiger Ausbildung …
... Ein langes erfahrungsreiches Leben hatte ihn nicht zugänglicher gemacht; je älter er wurde, um so mehr schloß er sich ab, um so schwerer wurde es, ihm nahe zu kommen. Wem er aber sein Vertrauen und seine Wertschätzung geschenkt, an dem hielt er unverbrüchlich fest. Die Härte seines Urteils wurde gemildert durch die Überzeugung, die sich jedem vorurteilslosen Beobachter aufdrängte, daß sie aus dem Eifer für die Sache, nie persönlichen Gründen entsprang … Für seine Person vorbildlich bedürfnislos und einfach in seinen Lebensgewohnheiten ließ er der Jugend gern ihren Frohsinn … Nur der Dienst durfte dabei nicht leiden und nicht das Ansehen des Offiziers … Eine große Anzahl meist schlecht erfundener und das Wesen nicht treffender Anekdoten spannen sich um die Person und den Namen des in der Armee allbekannten Generals. Ihre Zahl bewies, wie sehr er das Mittelmaß überragte, wie er im besten Sinne ein Sonderling, ein Original war, wenn man mit diesen Worten einen Mann bezeichnet, der etwas Besonderes ist und die Quellen seines Wesens in sich selbst trägt. Oberflächliche Beurteiler sehen in ihm nur den bärbeißig tuenden, alternden General, der freilich auf höfische Sitten wenig Wert legte; sie sahen nicht die hinter der Außenseite liegende menschliche Güte, nicht das feste, starke Preußenherz, das in seiner Brust schlug …«
Von dem ersten Zusammentreffen Seeckts mit Lentze bei der Meldung wird immer wieder eine Anekdote überliefert. Danach soll Lentze den neuen I b mit den Worten angesprochen haben: »Mein Gott, Herr von Seeckt, Sie tragen ja ein Monokel!« Seeckt soll darauf erwidert haben: »Daran werden sich Euer Exzellenz sehr schnell gewöhnen.« Diese Anekdote ist unter allen Umständen falsch und wird von jedem, der Seeckt und Lentze kannte, für einwandfrei unmöglich gehalten. Einmal war ein Kommandierender General vom Format eines Lentze nicht dazu geschaffen, eine solche Antwort stumm hinzunehmen, andererseits widerspricht es Seeckts ganzem Wesen, die in einer derartigen Antwort enthaltene Taktlosigkeit und Disziplinlosigkeit aufzubringen. Seeckt ist ein Meister der scharf geschliffenen witzigen Bemerkung gewesen. Er hat diese Gabe gelegentlich auch dann angewandt, wenn er sie besser ungenutzt gelassen hätte. Aber Taktlosigkeit und Disziplinlosigkeit, diese beiden sind ausgerechnet zwei Züge, die Seeckt auch nicht einmal von ferne jemals gestreift haben.
Es ist eigentümlich, daß Seeckt eine Persönlichkeit ist, der sich bisher die Anekdote kaum bemächtigt hat, der sie sogar deutlich ferngeblieben ist. Die ganz wenigen Seeckt-Anekdoten sind entweder vollständig wahr, also eigentlich keine Anekdoten, oder sie stimmen wie jene eben erzählte Anekdote allzu offensichtlich nicht. Seeckt eignete sich offenbar nicht zum Objekt der Anekdote. Das ist vielleicht bezeichnend für ihn. Er war selbst eine so scharf umrissene, so in sich selbst abgeschlossene Persönlichkeit, daß er gewissermaßen die für die Anekdoten notwendige Typisierung einfach nicht mehr zuließ.
Die Zeiten als I b waren für den jungen Generalstabsoffizier nicht ganz einfach. Er mußte längere Zeit den I a vertreten und damit doppelte Arbeit auf sich nehmen. Es gelang ihm, die nicht leicht zu erreichende Anerkennung seines Kommandierenden Generals zu erringen. Lentze nannte den Hauptmann von Seeckt »eine Nummer«, was bei diesem lobkargen, besonders hohe Anforderungen stellenden Mann viel sagen wollte Nach Aufzeichnungen des Generalfeldmarschalls v. Mackensen.. Im Juli 1907 bedankt sich Lentze beim Vater Seeckt für die Glückwünsche zum 75. Geburtstag. In diesem Brief schreibt er: »... Ihr Herr Sohn, aus gutem Holz geschnitzt, hat es mir leicht gemacht, ihm ein Förderer zu sein, denn in ihm sind Wissen, Pflichttreue und Charakter glücklich vereinigt. Ich habe ihn gern als Mitarbeiter gehabt und denke, daß er seinen Lauf machen wird …« Das war gewiß aus der Feder eines Lentze ein hohes Lob. Es zeigt aber auch, wie zurückhaltend, gemessen, den einzelnen Ausdruck abwägend, jede Übertreibung meidend, diese alten Soldaten zu urteilen gewohnt waren. 1915 gratuliert Lentze zum Pour le mérite und zum Generalmajor, ebenfalls in seiner etwas herben Art, und doch so natürlich im Lob und in der Anerkennung.
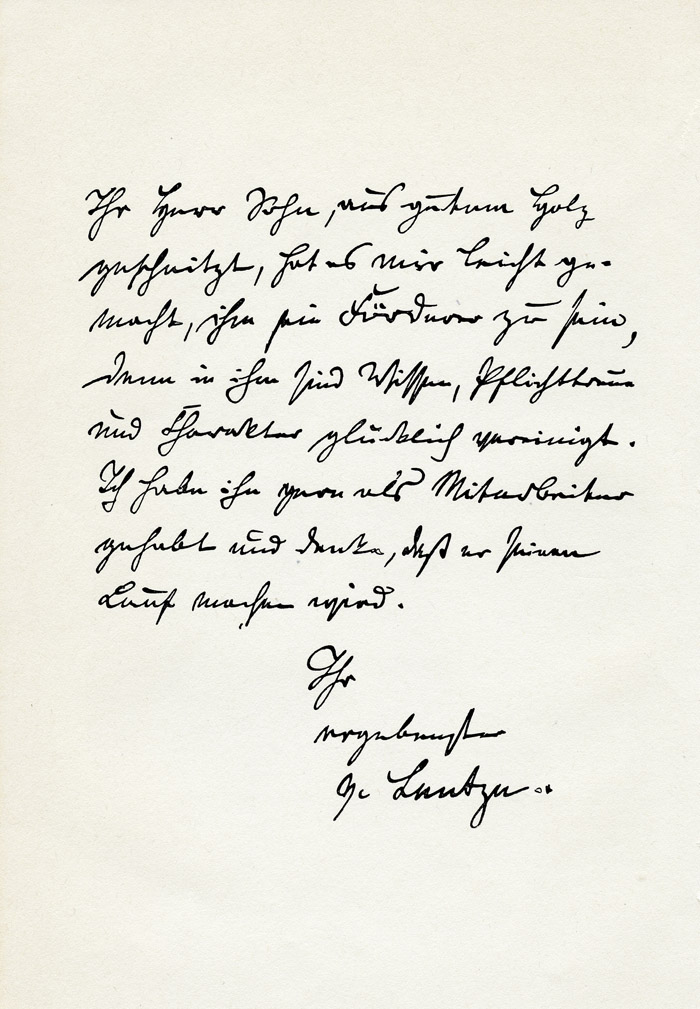
Beurteilung Hans von Seeckts von General von Lentze
In das Jahr 1900 fielen die Arbeiten der Mobilmachung für die China-Expedition, wozu auch das XVII. Korps durch Teilarbeit mit herangezogen wurde. Auf diese Weise kam Seeckt zu der Dekoration mit der Denkmünze für Verdienst um die China-Expedition. Es ist die erste Beziehung, die der Zufall zwischen ihm und diesem Lande knüpfte. Der Sommer 1901 bringt das Kaisermanöver in der Gegend von Dirschau, für die Generalstabsoffiziere viel Arbeit, für den nunmehr beinahe siebzigjährigen Lentze den Abschluß seiner Laufbahn. Sein Nachfolger wird General der Infanterie von Braunschweig, in seinem Äußeren und in seinen Formen ungefähr das Gegenteil seines Vorgängers.
1902 wird Seeckt als Kompanie-Chef nach Düsseldorf versetzt. Den Aufenthalt in der lebensprühenden schönen Stadt hat er selbst später als eine der frohesten Zeiten seines Lebens bezeichnet. Viel mag dazu beigetragen haben, daß er und seine Frau die Fröhlichkeit des rheinischen Lebens in vollen Zügen genossen. Wenn schon in Berlin Verkehr mit namhaften Künstlern gepflogen wurde, so nahm man hier mancherlei Beziehungen zum Düsseldorfer Malkasten auf. Aber bei aller Lebensfreude ist dies ganz zweifellos nicht das Charakteristische für jene Zeit gewesen. Das war vielmehr der Inhalt seiner Tätigkeit als Kompanie-Chef. Seeckt hat während seiner ganzen Dienstzeit es immer und immer wieder ausgesprochen, daß der Kompanie-Chef so ziemlich die wesentlichste Stelle in der Organisation des Heeres ist, und daß es für die Entwicklung jedes Offiziers darauf ankomme, wie er diese Stelle ausfüllen wird. Seeckt hat seiner alten Kompanie die Treue bis zuletzt bewahrt, und sie hat sie ihm bewahrt. Deutlich spricht davon die Trauer der alten Kompanie-Angehörigen bei seinem Tode. Man hat um diese ureigene Kameradschaft des alten Heeres nicht viel Worte gemacht, und Seeckt war so gar nicht der Mann dazu, nach Volksgunst zu haschen. Dazu war er äußerlich doch zu steif und zu kühl. Wie aber ihr Hauptmann von Seeckt innerlich zu ihr stand, das hat die ganze Kompanie gewußt und hat es auch behalten.
Die Frontzeit läßt die Möglichkeit zu einem normalen Urlaub zu, der 1903 zu einer Spanienreise ausgenutzt wird. Über diese Reise sind Berichte vorhanden: »... Wenn man aus seinem Schlafwagen am Morgen heraussieht, ist man in Kastilien; wenn man es nicht an dem untrinkbaren Kaffee gemerkt hat, daß man in Spanien ist, so belehrt einen die Gegend darüber bald. Kein Baum, kein Strauch, zunächst kein Ort; der Spanier ist entschieden zu stolz, um sich zu zeigen. Endlich eine Station: ›Dieses ist die Aloe, setzt man sich drauf, so tut es weh‹, will sagen, das ist der Garten der Estacion. Weiter geht es mit Würde und langsamer Gravität, den hier auch der schnellste Schnellzug annimmt … Einmal ragt dann ein Schloß empor, so schön, so stolz, verfallen und doch fast noch erhalten, wie es eben nur in Spanien sein kann, und in ihm hauste dann einmal Johanna die Wahnsinnige oder gar Isabella die Katholische, noch immer Spaniens größte Königin. Madrid: ein Bahnhof von der internationalen Pracht von Landsberg a. d. Warthe. Ein keuchender Maulesel schleppt mich den Berg hinan, auf dem das stolzeste Schloß liegt und über die Öde schaut, vorbei am Palais der Prinzessin Eboli nach der Puerta del Sol, die trotz ihres stolzen Namens den Spittelmarkt an Schönheit nicht erreicht, an Leben erst recht nicht … Wirklich sehenswert ist die herrliche Gemäldesammlung und die Waffensammlung … Die Wachparade ist etwas in dem Stil: Umwandelnd des Theaters Rund, mit langsam abgemeßnen Schritten verschwindet sie im Hintergrund. Abends die Tänzerinnen im Romea, was ein Theater ist und den Ton auf der zweiten Silbe hat, waren lustiger und flinker, dafür von geringerer Würde … Toledo – ein krankes Männlein im prunkenden Harnisch … Dort ist eine Kriegsschule … Die jungen zukünftigen Conquistadoren bewohnen den herrlichen Alcazar, den einst die maurischen Herrscher begannen, die christlichen vollendeten. Spaniens schönste Kirche ragt über der Stadt, die – selten in diesem Land – von einem Fluß mit richtigem Wasser umspült wird. Toledo ist vollkommen ein Traum, ein stehengebliebenes Stück Mittelalter, das allerechteste Spanien, halb Orient, halb Gotik … Escorial: Am Ruheplatz der Toten, da pflegt es still zu sein, – eine ganz eigene bedrückende Stille, als ob der kleine wandernde Reisende sich seines Maßes bewußt würde, hier, wo der Geist des zweiten Philipp versteinerte, hier liegen sie in gleichen Särgen neben- und übereinander von Karl V. bis zu Alfons XII., alle diese reyos catolicos; für drei ist nur noch Platz, ich glaube nicht, daß sie ihn noch beanspruchen werden. Am Altar knien die beiden größten, Karl und Philipp … auch Schillers Don Carlos … nicht weit vom Grabe der Elisabeth von Valois – lies deinen Schiller gefälligst, wenn es ihn auf der Divisions-Bibliothek gibt. Sevilla: Lärmen, Il Barbiere, Figaro, Don Juan, Blumen, Gesang, Tanz, Fächer und Mantilla, Hitze, Gestank, Moskitos und Wein. Der Guadalquivir fließt wirklich dort. Granada: Ich schweige und träume von Myrten-Hainen und rauschenden Wassern, von Blüten und tanzenden Zigeunerinnen, von afrikanischem Licht, das durch die Märchenhallen der Alhambra flutet; – geh hin und siehe! Stiergefecht in Madrid: ein roher, gemeiner, witzloser Unfug, nicht einmal Sport, aber tout Madrid zum Zusehen und toute Madrid erst recht …«
Leider bringt es der Entwicklungsgang des Generalstabsoffiziers so mit sich, daß er die Kompanie niemals sehr lange behalten kann. Immerhin hat Seeckt sie noch verhältnismäßig lange gehabt. Im Sommer 1904 wird er als Generalstabsoffizier zur 4. Division nach Bromberg versetzt. Er nimmt damit zum erstenmal im Entwicklungsgang des Generalstabsoffiziers eine selbständige Stellung ein. In die Bromberger Zeit fällt ein kleiner Zwischenfall. Seeckt wurde kriegsgerichtlich mit Festungshaft bestraft, die auf dem Gnadenweg in einen Tag Stubenarrest umgewandelt wurde, verbüßt an einem Karfreitag in der Haft der eigenen Häuslichkeit, dargestellt durch eine geräumige Villa mit einem annähernd sieben Morgen großen Park. Seeckt hat die Tatsache, daß er vorbestraft sei, manches Mal scherzend später betont. Der Grund zu dieser Strafe war, daß er eine Duellforderung als Kartellträger überbracht hatte.
Der Herbst 1906 führt ihn nach Algier. Den Höhepunkt dieser Reise bildet eine elftägige Fahrt in die Wüste. Man reist unter dem Segen des Marabu von Temazin oder wie der Mann sonst heißen mochte. Das hatte den Vorteil, daß man kein Trinkgeld zu geben brauchte, dafür mußte man aber zum Dank die Männer küssen. Seeckt meinte, ein Bakschisch zu geben wäre ihm denn doch lieber gewesen. In Biskra las er zufällig in der Kölnischen Zeitung seine Beförderung zum Major, der noch in den letzten Tagen des Jahres 1906 die Versetzung in den großen Generalstab folgte. Das Jahr 1907 brachte drei bedeutungsvolle Ereignisse. Die große Chefreise unter Moltke, an der auch der Kronprinz teilnahm, im Elsaß, eine kurze Reise nach England und schließlich im November 1907 die Reise nach Indien, von der Seeckt und seine Frau erst im Mai 1908 zurückkamen. Über die beiden Reisen sind Aufzeichnungen vorhanden. Die Skizze über die englischen Eindrücke ist sogar bald darauf ohne Wissen Seeckts in der Schlesischen Zeitung veröffentlicht und dürfte somit die erste, wenn auch unfreiwillige literarische Arbeit Seeckts sein.
»... Ich möchte von meinem Besuch in England nur von den Menschen, nicht von den sozialen und politischen Dingen erzählen. Wir Engländer und Deutsche kennen uns viel zu wenig. Wir wissen nicht, wie ähnlich wir einander sind, und es geht uns wie nahen Verwandten, die Fremden gegenüber freundlich und höflich sind, die es aber für ein gutes Vorrecht halten, sich untereinander unangenehme Dinge zu sagen. Unterschiede zwischen uns und ihnen gibt es viele …, aber wir sind im Denken und Fühlen einander ähnlich. – Man muß den Engländer genau sehen, bevor man über ihn urteilt. Leicht macht er es uns nicht, hindurchzudringen durch den Panzer, den die allmächtige Herrscherin ›Sitte‹ um ihn gelegt hat … Die Mode ist überall eine strenge Herrscherin, aber so allmächtig wie hier herrscht sie wohl nirgends. Ein unumstößliches Gesetz ist dieses: ›Man tut dies‹, und wenn in einem Jahr die Damen das eine Ende der Boa über die linke Schulter schlagen, so schlägt keine Engländerin es über die rechte. Ich führe Kleinliches an, wie es der Augenblick bot; ich weiß wohl, man könnte diese Beispiele von der Starrheit der Sitte in ernsten Fragen vervielfachen. Ich behaupte aber, wer von dem Äußeren auf das Innere schließt, der irrt sich. Es ist, als ob gerade das äußere Gebundensein den Engländer innerlich frei mache. Die Selbstverständlichkeit aller Formen des Außenlebens überheben ihn der Notwendigkeit, seine Gedanken auf dieselben zu richten … und dadurch erst wirklich frei zur Entfaltung seiner Eigenart zu werden … Ich fand in England nur Räume, in denen ich die Frauenhände spürte, die sie für sich und die ihren, aber auch für Fremde und Gäste ordneten und schmückten, und diese Hände waren immer schlank und feingliedrig und weiß, aber sie glichen sich nie.
Und nun hinaus aus London, der großen Gleichmacherin, der großen Fabrik von Massengefühlen und Massenmoden, hinein in das grüne Land. Hier fällt mit schwarzem Rock und Hut auch manche Steifheit der Form, die uns den Menschen oft fast verbergen wollte. Es ist keine Verachtung der Sitte, die hier zutage tritt, nur eine Beruhigung, wie überall die Natur sie mit sich bringt. Die Sicherheit bleibt und das eigentlich Bezeichnende: die wunderbare Selbstbeherrschung. Sie ist für mich das Ideal der männlichen Erziehung. Der Engländer hat sich immer ›in der Hand‹ und beherrscht sich äußerlich wie innerlich. Hierzu findet er die große Schule im Sport. Man braucht sie nicht zu überschätzen, aber man darf sie auch nicht zu gering anschlagen. Es ist nicht nur eine Schule des Körpers, sondern auch des Charakters. Glieder und Muskeln werden dem Willen untertan gemacht, sie gehorchen bald leicht und mühelos, und das gibt die Sicherheit und die Herrschaft nach außen. Wichtiger aber ist die Stählung des Willens, der gewöhnt wird, seine ganze Kraft an die Lösung der selbstgewählten Aufgabe zu setzen. Man soll sich vor Vergleichen hüten, und in der rückhaltlosen Anerkennung fremder Vorzüge liegt noch nicht der Wunsch nach Nachahmung im eigenen Lande. Alles Eigenartige eines Volkes wurzelt so tief in seiner Entwicklung, daß es, losgelöst vom Heimatboden und auf anderen Acker übertragen, nie gleiche Frucht bringen kann. Wir in Deutschland brauchen auch den Sport nicht in dem Maße wie die Engländer, weil wir etwas anderes, Deutsches an seiner Stelle haben – die Erziehung und den Drill im Heer … Über die englischen Auswüchse in diesem Interesse an den Spielen lächelt auch der einsichtige, ich möchte sagen, geschmackvolle Engländer selbst: ›Wie können Sie nur englische Zeitungen lesen, in denen Sie auf drei Seiten von vier nur Kricketnachrichten finden?‹ frug mich eine Engländerin, deren Auge eben noch geleuchtet hatte, als sie von den tagelangen Ritten hinter den Hunden erzählt hatte. Bei einer Unterhaltung über Erziehung sagte mir ein Engländer: ›Wenn meine beiden Söhne, die jetzt in Eton lernen, 18 und 19 Jahr alt sein werden, ziehe ich nach Deutschland und lasse mich dort naturalisieren‹, und auf meine Frage nach dem Grund dieses auffallenden Planes sagte er: ›Sie sollen in Deutschland dienen, dann haben sie die englische Kindererziehung und die deutsche soldatische Schule durchgemacht; besser vorgebildet kann ich sie nicht ins Leben schicken …‹
... Man kann sich keinen eindrucksvolleren Sport für das Auge denken als Polo … Es ist die Krone aller Spiele mit der Kugel. Sie ist des Glückes Ebenbild, sie will im Augenblick erhascht sein. Wer zögert, hat sie verloren, sie rollt dem zu, der Herz und Auge hat, zuzugreifen. Aber auch der beste Spieler tut einmal einen Fehlschlag, ohne seine Schuld, sein Pferd folgt einen Augenblick nicht der führenden Hand, ein tückischer Grasbusch lenkt den Ball ab. Und doch hat auch hier auf die Dauer meistens der Tüchtige Glück. Wir sahen ein besonders interessantes Spiel: House of Lords gegen House of Commons, vertreten durch je vier Mitglieder, unter denen der älteste Polospieler Englands, ein 65jähriger Herzog, war. Während der Pause ließ sich alles auf dem Rasenplatz vor dem Klubhaus an unzähligen kleinen Tischen zu Tee und Erdbeeren nieder – nun war es wieder das Bild einer großen gardenparty auf einem vornehmen Landsitz.
Den Abend verbringen wir am besten beim Diner im Carlton-Hotel. Die Tyrannei, die der freie Engländer sich im Restaurant auferlegen läßt, hat mich immer wieder belustigt. Direktoren und Kellner haben durchaus das Gebaren strenger Obrigkeit, die das Publikum in Ordnung hält, etwa wie bei uns die Zoll- und Postbeamten. Die scheue Ehrfurcht, die sich mancher Menschen, die sonst gar nicht zu ihr neigen, beim Anblick eines Hotelportiers oder eines Oberkellners bemächtigt, ist ja überall die gleiche. Werden die Herren einmal gar zu groß, dann spreche man hier nur ruhig deutsch mit ihnen – das verstehen sie alle, aber es muß ein kräftiges Deutsch sein, das sie an die Heimat erinnert. Ich habe nie einen englischen Kellner in Deutschland getroffen. – Die Strenge der Bedienung paßt sonst gut zu der Strenge der Zeiteinteilung. Vor 7 Uhr keine Möglichkeit, ein dinner zu erhalten, 10 Minuten vor ½9 Uhr Schluß, d. h. du gehst, oder … 1 Uhr wird das Licht abgedreht und wäre der ganze Saal noch voll Menschen …
Wir stehn draußen und können die kurze Strecke bis zum Hotel in den sonntäglich stillen Straßen gut zu Fuß gehn, trotz Frack und Abendtoilette. Hier haben wir nicht zu befürchten, daß uns wie in Paris tadelnd ein Droschkenkutscher zuruft: ›Mais cependant ce n'est pas le carnaval.‹«
Die Eindrücke der indischen Reise sind uns in Briefen erhalten:
»An Bord des Lloyd-Dampfers Yorck im Ionischen Meer, 10.11. 1907 … Die Gesellschaft ist die gewöhnliche; deutsche Kaufleute, die nach dem Osten zurückgehen, zum Teil mit neuen Frauen, Engländer, die mit ihren Bordspielen beschäftigt sind, sehr nette Holländer, fünf junge Seeoffiziere, ein deutscher und ein belgischer Attaché, die nach Peking zur Gesandtschaft gehen. Im ganzen herrscht ein behaglicher Ton … In Genua erhielt ich noch den Empfehlungsbrief an Lord Kitchener.
23.11. Fahrt von Kolombo nach Kandy. Nachmittags zum Botanischen Garten von Peradenya. Was man dort an Palmen und Orchideen sieht, ist unbeschreiblich … Abends zum Tempel, der einen Zahn des Buddha enthält. Es war gerade ein Opfer, geopfert wurden nur weiße und gelbe Blüten, die einen betäubenden Duft verbreiteten. Die Tempelschätze sind ungeheuer reichhaltig. Ein Buddhabildnis aus einem Bergkristall geschnitten und die Sanskrit-Bibliothek sind sehr interessant. Dazu das Wirbeln der Tempeltrommeln, das Drängen der bettelnden Menschen, die gelb gekleideten Priester, ein sehr verwirrtes Bild … Was Bedienung heißt, das wissen wir Europäer gar nicht. Wünsche von den Augen lesen, ist bei diesen lustigen Singalesen mit ihrer drolligen Kammfrisur keine Redensart mehr. Man denkt, und das Gewünschte ist da … Das Volk in Ceylon ist überall liebenswürdig und vergnügt und stets mit Waschen und Baden beschäftigt …
Bombay, den 12. XII. In Haidarabad hatten wir es wundervoll: Golkonda, das sagenhafte, eine Ruine muselmännischer Paläste und Festungsbauten; Gazellen grasten in den Trümmern … Der Nizam stellte uns einen riesengroßen, mit prunkvollen, grünroten Decken geschmückten Elefanten zum Ritt durch seine dämmernde, erleuchtete Stadt. Seine Soldaten gefielen mir gut; alles voll Entgegenkommen und Liebenswürdigkeit. In Bombay sind wir in dem schönsten und schönst gelegenen Hotel, was ich kenne. Wunderbarer Blick über die Bucht von unseren Fenstern aus. Sehr heiß am Tage, aber herrlich morgens und abends. Gestern ein großes Fest bei einem reichen Eingeborenen mitgemacht: Frack; höchst amüsant und prunkvoll. Einladung durch den deutschen Konsul. Vorgestern großer Empfang beim Gouverneur, ein herrliches Fest in dem feenhaft erleuchteten Garten. Der größte Prunk mit vor dem Thron aufmarschierter Ehrenwache, Defiliercour … Heute früh machten wir eine schöne Fahrt zum Begräbnisplatz der Parsen, die ihre Toten von Geiern zerreißen lassen. So schrecklich das klingt, so würdevoll ist alles eingerichtet. Die fünf weißen Türme des Schweigens in Bäumen versteckt und in herrlichen Gärten gelegen. Auf den Zinnen harren die Vögel. Wir sahen keine Bestattung, was mir Dodos wegen lieb war, obwohl man natürlich von dem eigentlichen Vorgang nichts sehen würde …
Udaipur, 16. XII. … Die Summe von herrlichen Moscheen ist ungeheuer. Entstanden aus den Erinnerungen an das Zelt und den Palmenwald sind sie immer ein Hymnus auf Licht und Sonne. Die großen Sultane ruhen in einem Meer von Licht, das durch das Spitzengewebe der Wände, Türen und Fenster leuchtet … Die Nacht auf dem Bahnhof verbracht, in den hier vielfach bereit gehaltenen Fremdenzimmern mit Ausgang nach dem Perron …
Ajmere, 22.XII. Unser Gastgeber war nicht anwesend, sondern zwei Tagereisen entfernt in seinem Jagdlager. So konnte man leicht der Versuchung widerstehen, ihn aufzusuchen. Es war bestens für uns gesorgt. Das Schloß ist märchenhaft, aus jahrhundertlangem Bauen entstanden, also nicht einheitlich und dadurch besonders merkwürdig. Ein großer See umgibt es mit kleinen palastgeschmückten Inseln, prachtvolle Tiger hält der hiesige Maharadscha in Käfigen, 60 Elefanten … Am nächsten Tag Fahrt nach Amber, der früheren Hauptstadt. Es ging durch zahllose Ruinen von Palästen und Tempeln bis zu einem alten Festungstor. Hier harrte unser der vom Maharadscha gesandte Elefant, ganz bemalt, mit großer Decke und mit zwei Schild und Speer tragenden Begleitern. Er trug uns hinauf zum Palast …
Delhi – das Rom Asiens. Die eigentliche Stadt hat eine Ausdehnung von über 20 Kilometer, da ein König nach dem anderen seit 1500 v. Chr. eine neue Stadt baute. Jetzt ist natürlich das meiste ein Trümmerhaufen mit einzelnen hervorragenden Ruinen … Die umwallte Stadt ist nicht sehr groß … Überall italienischer Mosaik, damals von Italienern gemacht. Heute war einer mit Reparaturen beschäftigt … Heute nachmittag holte uns der Kommandeur des hier stehenden Regiments, Pr. of Wales Lancers, Colonel Pirie und Frau, in einer Coach zur Spazierfahrt ab. Ein großes Vergnügen, die vier prächtigen Braunen … Militärisch ist es hier interessant. Dicht bei uns liegt ein zerschossenes Tor und die Reste von Batterien. Hier haben vor 50 Jahren bei dem großen Aufstand die Engländer gestürmt und dabei 186 Offiziere und 3000 Mann von 7000 verloren …
Lahore, 26. XII. Wir kamen im Hotel gerade noch unter. Wir mußten froh darüber sein, denn ein großer Teil der Gäste liegt in Zelten, ein kaltes Vergnügen. Es strömt zu Weihnacht aus den benachbarten Orten hier alles zusammen. Ein ganz anderes Leben wie bisher; elegant, echt indisch und doch nicht native. Besuch beim Gouverneur, der wie seine Kollegen fast königliche Ehren genießt. Einschreiben, Karten für die Umgebung, Nationalhymne beim Erscheinen usw. … Der Gouverneur hat das Recht – er allein – in einer Equipage mit sechs Kamelen zu fahren, die ihm das hier stehende, militärische Kamelreiterkorps stellen muß. Es sieht amüsant aus, die Tiere mit roten Decken und Leopardenfellen …
Sialkot, 30. XII. Ich freue mich, daß wir hier in Ruhe, unter den denkbar angenehmsten Verhältnissen, bei General Mahon wohnen. Ich ritt heute früh mit dem General spazieren. Vor mir lag nun zum erstenmal, himmelhoch und in blendender Weiße, der Himalaya. Er steigt schroff aus der flachen Ebene auf und wirkt so überwältigend. Wenige Kilometer vor der Stadt ist die Grenze von Kaschmir. Ich sah die Truppen bei der Übung, für mich hochinteressant …
Peshawar, 7. 1. 08. Am 1. war große Parade: ein schottisches Regiment, ein indisches Infanterie-Regiment, ein englisches Ulanen-, zwei indische Kavallerie-Regimenter und eine Batterie. Ein buntes, sehr schönes Bild … Dann eine höchst interessante Fahrt den Bergen entgegen über den Indus, die alte Grenze Indiens, die hier schon Alexander der Große und nach ihm so viele Eroberer überschritten … Merkwürdiges, noch nie gesehenes Volk, Afghanen, Perser und Tibetaner, alle die verschiedenen Stämme der Grenze, wilde Erscheinungen, darunter viel mongolische Gesichter … Die Gouverneur-Familie ist ganz reizend; er ist seit 35 Jahren in Indien und ein großer Kunstkenner und -freund. Nun möchte er gern hier ein Grenzmuseum errichten, hat aber schon das Beste an das British Museum in Lahore gegeben. Es handelt sich um die Überreste einer mongolisch-buddhistischen Kunst, beeinflußt von griechischer Kunst. Ein völlig unaufgeklärter Vorgang, aber zweifellos; ich sah einen Buddha in seiner bekannten, sitzenden Haltung mit vollkommen griechischem Profil, ein Relief, das einen Bacchuszug darstellte, Gewandstatuen, die nichts mit indischen Modellen zu tun haben. Es freute ihn, daß ich seinen Liebhabereien Verständnis entgegenbrachte. Lady Deane, wie eine Rheinländerin fröhlich und natürlich, alles elegant, aber nicht großartig, daher behaglich. Nach Tisch Musik. Die Menschen sind hier unglaublich liebenswürdig gegen uns, eins ergibt das andere, wir könnten hier 14 Tage bleiben und jeden Tag etwas vorhaben. Militärisch kann ich sehen, was ich will … Ich habe sehr viel Gutes gesehen, es wird hier hart gearbeitet, und die Grenze ergibt einen dauernden Kriegszustand. Natürlich interessieren mich die hiesigen, indischen Regimenter, bei denen nur die Hälfte der Offiziere englisch sind, am meisten. Die Kavallerie-Regimenter sind zweifellos ganz ausgezeichnet, alles Naturreiter mit Liebe zum Pferde, das ihr Eigentum ist, verwegene Gestalten und dabei sehr gute Haltung, guter Anzug. Die Infanterie scheint mir nicht ganz so gut, aber doch besser, wie ich erwartete; ich sah aber nicht genug, sie sollen ausgezeichnete Schützen sein. Eingeborene Artillerie gibt es nicht, die englische ist sehr gut, aber unvorteilhaft formiert. Pferdematerial ausgezeichnet, entspricht durchaus dem bei uns … Heute waren wir nun an der afghanischen Grenze im Khaiber-Paß. Er ist nur zwei Tage in der Woche offen. Der Karawanenverkehr war fabelhaft. Wenn ich sage 500 Kamele, so ist das nicht übertrieben. Eine Riesensendung Gewehre für den Emir von Afghanistan ging durch, die Bezeichnung stand auf jeder Kiste. Dann Züge von Frauen, unter langen blauen Schleiern. Nie gesehenes Volk, einige mit Zöpfen und Glas im Haar … Alles wird bewacht von einem besonderen Grenzkorps, den Khaiber Rifles, die aus den umwohnenden Stämmen geschaffen sind, die für sehr wild, aber augenblicklich für zuverlässig gelten und jedenfalls den hier sehr gefürchteten Räuberstamm der Afridis gründlich hassen. Es hängt hier alles so ziemlich von dem Political Agent und Kommandeur dieser Grenztruppen, einem Colonel Roos-Keppel ab, den ich auch kennenlernte, eine von den Naturen, denen England seine Weltstellung verdankt. Die Eingeborenen lieben ihn, er spricht alle Sprachen der Grenze – so regiert er mit vier anderen Offizieren das ganze Grenzland... Eben bringt Lady Deane selbst Dodo zurück, Viererzug, vier rote Lakaien, echt indisch.
Amritsar, d. 21. 1. … Einen sehr netten Abend hatte ich bei dem englischen Inf.-Regt. ›the Queens‹, einen Namen, den sie von der Gemahlin irgendeines Georg führen, die eine Braganza gewesen sein muß, denn das Regiment führt als Abzeichen ein Lamm mit der Kreuzesfahne, was etwas eigentümlich aussieht. Der Ton im Regiment sehr angenehm, ich saß neben dem liebenswürdigen Kommandeur … Ich fuhr nach Gwalior, der Hauptstadt des zweitgrößten Native Staates. Ich hatte eine Empfehlung an den englischen Residenten, der, selbst abwesend, mich an den Maharadja überwiesen hatte. Also große Aufnahme: Wagen am Bahnhof und Unterbringung in einem kleinen Seitenpalast, der für europäische Gäste eingerichtet ist. Eine Flucht von Zimmern.
Den frühen Morgen benutzte ich, um mir den herrlichen Garten anzusehen und den ganz neuen Prunkpalast des Maharadja von außen, als ich auch schon eingefangen und vor meinen neuen Wirt geführt wurde, der gewünscht hatte, mich bei seinem Morgenspaziergang zu sehen. Ein einundzwanzigjähriger Mann, indisch angezogen, d. h. in blendend weißem Leinen mit kleiner schwarzer Mütze. In Wesen und Sprache ganz englisch. Wir gingen wohl eine Stunde im Garten umher. Er erzählte viel, ist in England gewesen, Chef eines englischen Regiments, frug sehr interessiert nach deutschen militärischen Einrichtungen. ›Ich wollte gerne wirklich englischer Soldat werden und freiwillig mit nach China gehn, aber man erlaubte es mir nicht.‹ Ich sollte eine Woche wenigstens bleiben, ich könne schießen, was ich wolle. Er gilt für den höchstgebildeten der einheimischen Fürsten, ist aber strenggläubiger Hindu. Seine Privatgemächer und namentlich die Wohnung ›Ihrer Hoheit‹ sind natürlich völlig unzugänglich. Er hat nur eine Frau, während seine Kollegen darin anders denken und bis zu 200 haben sollen. Nachdem S. H. mich gnädig entlassen, ging es zu Wagen nach dem alten befestigten Gwalior, das in den 1000 Jahren vor 1858, wo die Engländer es nahmen, so ziemlich alle 10 Jahre einmal bestürmt und belagert wurde. Es liegt hoch aus der Ebene aufragend und enthält sehr gut erhaltene, zum Teil sehr schöne Überreste von Palästen und sehr alten Tempeln. Das merkwürdigste sind die Bekleidungen der Mauern mit bunten Platten, Tiere darstellend: Enten, Elefanten, Tiger. Wo nicht Menschenhand sie zerstörte, sind sie über 600 Jahre alt und leuchten wie neu. Versuche, sie zu ergänzen, scheiterten, die Farben hielten nicht, also wieder eine Technik des Ostens, die verlorengegangen. Der Aufstieg war steil, der Blick über die fruchtbare Ebene wunderbar, dazu endlich wieder Sonne. Am unteren Tor hatte ich den Wagen verlassen und den reich geschmückten Elefanten bestiegen, der klingelnd und von vier Begleitern umgeben mich hinauftrug. Es reitet sich ganz gut auf den gutmütigen Ungetümen, wenn Ihr mich hättet sehen können, wäre aber erst das Vergnügen voll gewesen …
Die Erinnerungen an den Aufstand von 1857 sind hier in Lucknow sehr lebendig. Hier sind Heldentaten vollbracht, die das Herz eines Soldaten rühren müssen, und das Gedächtnis daran wird ernst und würdig aufrechterhalten. An der Stelle, wo der Kommandant fiel, steht eine Tafel mit der Inschrift: ›Hier fiel Sir H. Lawrence, als er seine Pflicht zu tun versuchte.‹ Heute sind die Ruinen, an denen keine Hand zu rühren wagte, von Rosen und blauen Schlingblumen umwuchert …
Benares, 23. 1. … Unendlicher Schmutz; zwischen schwarzen Menschen und weißen, heiligen Kühen muß man sich durchdrängen …
Darjeeling, 1. 2. … Wir erlebten eine Bärenjagd im Jungle der Provinz Chota Nagpur … Für die Jagd waren die Vorbereitungen so großartig und bequem, wie man nur denken kann. Nach dem dinner wurden wir in einem Salonwagen untergebracht, dann an einen Güterzug gehängt … Und dann durch den Jungle, ein tüchtiger Marsch, etwa fünf Kilometer mit dem drolligsten Treibervolk, das man sich denken kann –. Die ganze dortige Gegend ist erst seit wenigen Jahren erforscht, da man ein Kohlenlager entdeckte, der Jungle ist also auch noch ein unverdorbenes Jagdparadies: Tiger, Wölfe, Bären, Panther, Leoparden, Blackbuck hausen hier. Die Stunde, ehe das wilde Geheul der Treiber erscholl, dann die Minuten, bis der Schuß ertönte, waren wirklich aufregend. Und dann die Freude über die Beute! Und wie schmeckte das Picknick mitten im Jungle, natürlich mit cold chicken and dry Champagne! Nachher wurde noch vergeblich auf wilde Vögel getrieben an einem malerischen Flußbett, und dann kam eine sehr komische Episode: wir sollten ›der Bequemlichkeit wegen‹ im Ochsenkarren zur Station fahren. Zunächst war die Unterbringung in dem zweirädrigen Karren schwierig, und dann! Von Weg keine Spur, und die Ochsen rasten nach längerem Zureden mittels eines Stachels über Abhänge und Baumstümpfe, daß man glaubte, alle Glieder fielen ab. Endlich machte das eine Tier sich los und ging durch, bald auch das andere, und dann wurden wir ein Stück von coolies gezogen, bis ich energisch verlangte, auszusteigen und zu gehen …
Kalkutta, 5. 3. … Wir erhielten sofort eine Einladung zum Frühstück von Lord Kitchener. Nur wir, Legationssekretär und Frau von Keller und zwei Adjutanten. Lord K. führte meine Frau und saß nach Tisch eine Stunde mit mir allein –. Er ist eine schlanke, militärische Erscheinung, sehr liebenswürdig gegen mich, frug nach meinen Eindrücken von der Armee, bedauerte, nichts von der deutschen zu kennen, deren Einrichtungen ihm so vielfach als Muster gedient hätten. Dann wurde über Manöveranlagen gesprochen, über die hiesige Eingeborenenkavallerie, Generalstabsarbeiten und dgl. Mit Liebe sprach er von seinen indischen Regimentern und schien alle Offiziere zu kennen, denen ich begegnet war und über die er sehr amüsante, immer wohlwollende Bemerkungen machte. Es war sehr interessant für uns. Heute mittag sind wir zum kleinen Frühstück beim Vizekönig. Die größeren Feste sind verschoben wegen der Trauer um den König von Portugal.
Abends. Das Frühstück verlief sehr nett. Außer dem Hofstaat: zwei Adjutanten vom Dienst, Home Secretary, Military Secretary, nur der erste Minister des Nizam von Haidarabad und wir. Meine Frau also neben S. E., ich neben I. E. und der Tochter. Sie kamen mit Vortritt, kurzer Cercle vor dem Thron, dann zu Tisch. Lady Minto Lord Minto, von 1905–1910 Vizekönig. war sehr freundlich, sprach deutsch ebenso wie die Tochter. Der übliche Bedienungsgang in Rot, Posten der roten Leibwache an den Türen. Nach Tisch Kaffee auf der Veranda, wo mich der Vizekönig neben sich in eine Ecke nahm und eine halbe Stunde plauderte über allerlei indische Verhältnisse, aber nichts von besonderem Interesse. Dann Schluß und Entlassung mit Bedauern, daß wegen der Trauer nichts weiter bei ihnen los sei. Lady Minto war übrigens ganz vornehm einfach und meinte, der Pomp sei eigentlich auf die Dauer entsetzlich, aber man gewöhne sich an das rote Heer um einen. Der Minister des Nizam sprach auch deutsch, hatte in Bonn studiert und zitierte meiner Frau gleich die Inschrift vom Arndtdenkmal: »Der Rhein Deutschlands Strom, nicht Deutschlands Grenze …«
Es wäre noch hinzuzufügen, daß Lord Kitchener in der Unterhaltung das deutsche Generalstabswerk über den Burenkrieg erwähnte und es als die beste Darstellung erklärte, die außerdem ohne Diskrimination sei.
Im Mai 1908 kehrte das Ehepaar Seeckt von seiner Indienreise zurück, und der Dienst im Großen Generalstab verlangte wieder seine Rechte, freilich nur noch für eine Zeit, die nicht mehr ein ganzes Jahr betrug. Im April 1909 wird Seeckt als 1. Generalstabsoffizier zum Generalstab des II. Armeekorps versetzt. Seeckt hatte es früher manchmal durchaus empfunden, der Sohn eines prominenten Vaters zu sein. Die Scherze, die sich schon aus der Ähnlichkeit des Namens mit der Schaumweinbezeichnung Sekt und dem Namen »Söhnlein« einer Sektfirma aufdringlich ergaben, waren nicht recht nach des Sohnes Geschmack. Um so mehr mußte die Versetzung zum II. Korps Seeckts ausgesprochenem Selbstbewußtsein eine Genugtuung sein. Diesem Stabe hatte auch der Vater angehört; der Vater als 1. Adjutant, und sein Sohn als 1. Generalstabsoffizier. Jetzt war er selbst etwas und nicht nur Sohn. Leider hatte ja der Vater diese Versetzung nicht mehr erlebt. Übrigens ging der Sohn nach Stettin, da keine Veranlassung mehr bestand, den Stab wie zu Zeiten des Vaters in Berlin zu belassen. Die Stellung brachte naturgemäß viel Arbeit mit sich, insbesondere da 1911 der Generalstab des II. Korps das Kaisermanöver zu bearbeiten hatte. Sein damaliger Chef, der spätere General von Kraewel, sah sehr bald, daß in seinem I a eine ganz ungewöhnliche Arbeitskraft steckte. Er hob noch nach vielen Jahren Persönliche Mitteilung von General d. Inf. v. Kraewel. die unbedingte Zuverlässigkeit seiner Arbeit hervor und die Tatsache, daß ihn eigentlich nichts überraschte. Meistens hatte er schon alles vorbereitet, ehe die Dinge selbst die Ausführung verlangten. Hier trat zum erstenmal seine Begabung für die Truppenführung, seine Entschlußfestigkeit und Sicherheit in der Disposition so deutlich hervor, daß sie dem Stabschef besondere Anerkennung begründete. Es will dies schon etwas besagen. Vom I a eines Generalkommandos verlangt man an sich viel, der Vorgesetzte erkannte aber, daß dieser I a doch wohl hervorragte. Er nahm im Stab eine besondere Stellung für sich ein, wobei man zugeben muß, daß er sie allerdings auch verlangte, was für die Umgebung nicht immer bequem gewesen sein mag. Es konnte nicht ausbleiben, daß die auszeichnende Leistung ihm jene Qualifikation eintrug, die der Generalstabsoffizier als die Krönung seiner Laufbahn ansehen muß, zum Chef des Generalstabes eines Armeekorps. Mit seinem Chef des Stabes, Oberst v. Kraewel, hat Seeckt eine auf gegenseitiger Wertschätzung beruhende Anhänglichkeit verbunden, die den Tod Seeckts überdauert hat.
Im Februar 1912 wird Seeckt als Bataillons-Kommandeur in das 1. Badische Leib-Grenadier-Regiment Nr. 109 versetzt. Eine schöne, aber recht kurze Zeit dort in der Residenz eines süddeutschen Hofes. Es ist fast so, als ob das Leben noch einmal und in der Tat zum letztenmal alle sonnige Heiterkeit schenken wollte, bevor vom Schicksal mit schwerem Ernst beladene Jahre beginnen.
Die Karlsruher Zeit brachte es mit sich, daß in dem geselligen Verkehr, besonders für Frau von Seeckt, die Musik erheblich wieder in den Vordergrund trat. Freilich der nachdrückliche Ernst der Zeit beginnt recht fühlbar zu werden. Zwar beurteilt man die Frage nach Krieg und Frieden in Karlsruhe optimistisch. Aber Seeckt steht dieser Auffassung, wie er selbst schreibt, zweifelnd gegenüber. »Daß schließlich der Weltfrieden an der Gemütsstimmung eines schwächlichen Mannes, des Zaren, hängt, ist eigentlich etwas beschämend für die Zeit. Ich hoffe, wir sind bereit und – in gewissem Sinne – auch auf der Höhe«, schreibt er im Oktober 1912 der Mutter. Im Herbst meint er, daß man auf dem Balkan wohl den Verständigungswillen Österreichs erkenne. »Gelingt diese Verständigung, dann fällt eigentlich fast jede Kriegsgefahr für das übrige Europa fort. Doch es kann auch anders kommen.« In diesen Sorgen kommt er kurz vor Weihnachten 1912 »etwas unzufrieden von Berlin zurück mit den Mitgesellen und auch mit dem irdischen Meister, den himmlischen zu begreifen habe ich lange aufgegeben und sehe in seiner Unbegreiflichkeit seine Größe. Und dennoch wunderbarer Geist, der du dich unserm endlichen Geist mit Rätseln gürtest, die uns ängstigen, und dennoch bist du die Liebe. Schmerz und Verzweiflung sind die Arme, mit denen du uns an dich ziehst. Du kannst ja nur tun, wofür wir dir danken müssen. Ich danke dir – ohne dich zu begreifen.« Es ist eigenartig, wie leicht es ihm gelingt, vom Ärger des Alltags hinüberzuwechseln in die Betrachtung der großen, alles bewegenden Kräfte. Aber er kehrt dann doch unwillkürlich grollend auch wieder zu den Tagesereignissen zurück. Ende Januar 1913 meint er: »Die Komödie der Heeresverstärkungen ist fast zu arg. Wer regiert eigentlich? Ich glaube, daß das die zur Zeit am schwersten zu beantwortende Frage ist.«

Dorothee von Seeckt geb. Fabian
Nach einem Gemälde von Rudolf Schulte im Hofe
Was die Hoffestlichkeiten anlangt, so behagen sie ihm deshalb hin und wieder nicht, weil sie doch eine allzu kleine Ausgabe des ihm von Berlin her gewohnten Verkehrs sind. Er stellt dies aber fest, ohne den Sinn für die gegebene Situation und vor allen Dingen ohne den Humor zu verlieren. In humoristischer Art schreibt er dann auch der Mutter im Februar 1913 einige Randbemerkungen zur Verlobung der Kaisertochter. »Bei dem letzten Hofkonzert wurde mir ein eingeschriebener Eilbrief aus München gebracht, was alle Welt bis in die höchsten Spitzen lebhaft aufregte. Es war eine ganz geheim zu haltende Bitte des Bayrischen Schweren Reiterregiments, bei dem der Prinz von Braunschweig stand, für den Fall der Verlobung ein Blumenarrangement zu bestellen und zu übersenden … Eigentlich sollte hier die Verlobung nicht stattfinden, sondern nur ein offizielles Wiedersehn, die Veröffentlichung in Berlin … Das junge Paar hat aber eine andere Ansicht gehabt …, daß der Kaiser ganz verzweifelt gesagt hat: ›denn los!‹... « In dem gleichen Brief findet sich übrigens folgende Stelle: »... Als charakteristisch möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Die Großherzogin Luise spricht dem … Oberschloßhauptmann von S … ihr Bedauern aus, daß der sehr beliebte bisherige Kommandant seinen Abschied nähme, worauf S. in bestem Dialekt antwortete: ›Wenn sie uns nur keinen Preußen hintun!‹ Was denn doch der Großherzogin Eine preußische Prinzessin, Tochter Kaiser Wilhelms I. etwas zu viel gewesen sein wird.«
War schon die Kompaniechefzeit ein Beweis, in welch nahes Verhältnis der Generalstäbler Seeckt zur Truppe zu treten vermochte, so beweisen kleine Episoden aus der Karlsruher Zeit dies erneut Mitteilung des General v. Böckmann, damals Leutnant unter Seeckt..
Der neue Bataillons-Kommandeur, Major v. Seeckt, wird auf dem Kasernenhof das Bataillon übernehmen. Er ist ein hier nicht bekannter Mann. Man weiß nur, daß er aus Stettin aus dem Generalstab kommt. Er tritt vor die in Paradeaufstellung mit präsentiertem Gewehr stehende Truppe. Der erste Eindruck: Tadellose Figur, eleganter Anzug, jene Mischung von Eleganz und soldatischer Haltung, die die preußische Garde prägte. Alsdann kurze Ansprache, danach Begrüßung der Offiziere, wobei jeder einzelne vorgestellt wird. Es ist ein kluges Gesicht und, wie er einmal lächelt, weiß man, woran man ist. Das Lächeln beweist, daß er freundlich und wohlwollend sein kann. Immerhin erwartet man nun doch eine kleine Programmrede. Da kommt die erste Überraschung: »Meine Herren, kennenlernen werden wir uns im Dienst.« Das war alles; oder eigentlich doch nicht alles, denn dann kam ganz kurz aufleuchtend wieder dieses kluge und gütige Lächeln.
Auf dem Exerzierplatz hat eine Gefechtsübung des Bataillons stattgefunden. Die Kompanien sammeln sich zum Parademarsch. Die Kompaniechefs lassen die Tornister ablegen, als bei den Gewehren weggetreten ist. Seeckt: »Meine Herren, wir wollen den Mann auch nicht falsch verwöhnen und verweichlichen. Die Gefechtsübung war so anstrengend nicht, daß die Mannschaften für diese kurze Pause die Tornister ablegen mußten.«
Eines Morgens marschiert das Bataillon ab, ein Leutnant der M.G.K. war zu spät gekommen. Seeckt selbst hatte ihn erwischt. Die Folge ist nach der Übung ein etwas einseitiges Gespräch Seeckts über Pünktlichkeit mit diesem Leutnant im Beisein des Kompaniechefs. Das Gespräch ist deutlich, ein Zweifel bleibt nicht übrig. Alsdann dankt Seeckt dem Hauptmann und behält den Leutnant zurück. Es entsteht eine Pause unangenehmster Erwartungen. Dann meint Seeckt: »Jetzt wollen wir mal als Kameraden miteinander sprechen. Wo habt Ihr Euch denn gestern abend herumgetrieben? Habt Ihr denn auch alles bezahlt?« Das war leider nicht der Fall. »Ihr seid doch verfluchte Bengels! Da – bezahlen Sie, und geben Sie es mir wieder, wenn Sie mal zufällig Geld haben sollten.« Mit diesen Worten schiebt er dem verdutzten Leutnant eine nicht ganz kleine Summe zu.
Es ist Fastnacht. Frau v. Seeckt hatte eingeladen unter dem Motto eines Oktoberfestes in München. Man war etwas gespannt, wie sich der Bataillonskommandeur hierbei aus der Affäre ziehen würde. In einem herrlich gebügelten Drillichanzug mit schirmloser Feldmütze, einem frischen Kommißbrot unter dem Arm, das Monokel im Auge, stand er ernst und wortlos irgendwo da. Allerdings wechselte er im Verlauf des Abends das Kostüm und kam nachher in Eskarpins und rotem Frack. Dieser kleine gesellschaftliche Vorgang erhält noch eine ungemein bezeichnende Note durch eine begleitende Maßnahme Seeckts. Er hatte für den Tag dieses Festes den Burschen aus der Wohnung verbannt und in die Kaserne geschickt. Es lag nahe, zu vermuten, daß es ihm peinlich war, vor dem Burschen in komischer Kleidung aufzutreten. Das war aber keineswegs der wirkliche Grund. Vielmehr hielt es Seeckt nicht für richtig, daß ein im Dienst sonst gebrauchtes Kleidungsstück, nämlich der Drillichanzug, vor dem Soldaten durch die Verwendung als Kostüm herabgewürdigt werden könnte. Selbst in diesem Zusammenhange verließ ihn die peinliche Genauigkeit militärischen Empfindens nicht ganz, und die hier an sich wohl überflüssige Hemmung wurde nicht vollständig überwunden.
Der 4. April 1913 bringt die Beförderung zum Oberstleutnant und die Ernennung zum Chef des Stabes des III. A.K. Damit hatte er die am meisten auszeichnende Stelle erreicht, die außerhalb der Generalität in der Armee zu erreichen war. Zudem nahm ja naturgemäß das III. Korps insofern eine Sonderstellung ein, als es seinen Sitz neben dem Garde-Korps in Berlin, einen Teil seiner Truppen in unmittelbarer Nähe von Berlin hatte und vor allen Dingen das Armeekorps war, welches das alte brandenburgische Kernland umfaßte. Es lag auf der Hand, daß man sich für dieses Korps nur einen Chef nahm, von dessen Leistung und von dessen Persönlichkeitswert man unbedingt überzeugt war.
Seeckt hat die neue Stellung mit stolzer Freude angetreten: »... Mich befriedigt das Gefühl, hier indirekt und ganz im stillen an manchem mitwirken zu können, was ich für gut und bitternötig halte, weit mehr als äußere Ehrungen, Orden und Stellung. Wenn ich vor einiger Zeit eine gewisse Unbefriedigtheit habe durchblicken lassen, so entsprang sie sicherlich nicht einem zu strengen Urteil über andere Menschen, sondern lediglich dem Gefühl, der eigenen Aufgabe, die ich mir ganz allein zu stellen habe, nicht immer genügen zu können. Ich erkenne kein menschliches Urteil darin über mich innerlich an; denn keins kann höher und strenger sein als mein eigenes, auch Deines – der Mutter – nicht; und das ist doch noch das einzige fast, an dem mir gelegen ist. Das mag sehr hochmütig sein; aber man soll sich auch nicht bemühen, immer den Stolz und das Selbstgefühl zu brechen, sondern im Gegenteil beide zu stärken, wo man kann …«
Es gibt auch aus dieser Zeit keine Vorgänge, die Seeckt zwingend etwa über das Niveau der anderen Chefs der Stäbe in der Armee hinaushöben. Vielleicht war dazu überhaupt die Zeit als Chef, bis 1914 die große weltgeschichtliche Spannung eintrat, einfach zu kurz. Es mag aber angebracht sein, einige Einzelheiten dieser Chefzeit zu erwähnen, weil sie, freilich ohne mehr als beinahe zufällige Stichproben zu sein, die Art kennzeichnen, in der Seeckt solche Dinge anpackte.
Sehr eingehend muß ihn die Frage der Ausbildung der Offiziere des Beurlaubtenstandes beschäftigt haben. Der Nutzen einer theoretischen Ausbildung steht für ihn außer Zweifel. »Während die praktische Ausbildung Sache der Truppe bleiben muß, kann ein Teil der theoretischen Ausbildung wohl von Bezirkskommandos geleitet werden.« Da Seeckt sich niemals Illusionen hingab, so war das zweifellos ein Vorschlag, der nicht allein darauf abzielte, irgend etwas nur so zu tun. Deshalb fährt er fort, daß der Erfolg hauptsächlich eine Frage der Persönlichkeit sei, um sofort etwas hinzuzufügen, was ganz seiner Art entspricht: »Wird die Sache ängstlich angefaßt, dann ist nichts Wesentliches zu erreichen.« Seeckt macht dann einen Vorschlag, der für die damalige Zeit wohl als neu anzusehen ist. Er empfiehlt jährlich am Sitz des Generalkommandos einen vierzehntägigen Ausbildungskursus für Reserveoffiziere, derart, daß jeder Reserveoffizier etwa alle drei Jahre einen solchen Kursus mitmacht. Lehrer sollen besonders geeignete aktive Offiziere, in erster Linie Generalstabsoffiziere, Lehrer an der Kriegsakademie und den Kriegsschulen sein. Seeckt warnt davor, die Reserveoffiziere bei der Heranziehung zu diesen Kursen in den Konflikt zwischen Dienstpflicht und zivilberuflichen Interessen zu bringen. Der strebsame Mann in seinem Zivilberuf wird im allgemeinen auch der tüchtige Offizier sein. Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, daß er dann wörtlich fortfährt, »energisch muß das K. M. dafür eintreten, daß von den Zivilbehörden keine Schwierigkeiten gemacht werden, es wäre auch durch die Öffentlichkeit mehr auf die Notwendigkeit der gesteigerten Ausbildung der Offiziere des Beurlaubtenstandes hinzuweisen«. Man sieht, mit welchen Schwierigkeiten man zu rechnen hatte.
Sehr viel zu schaffen machte den militärischen Kommandobehörden damals schon die sozialdemokratische Beeinflussung der Soldaten. Es handelte sich als Anlaß um die Frage des Verbots einer größeren Brauerei in Spandau. In dem entstehenden Schriftwechsel wurde mit der üblichen Gewissenhaftigkeit das juristische Für und Wider, die Frage der Agitatoreneigenschaft des Saalbesitzers und vieles mehr sehr objektiv erörtert. Dem Chef des Stabes des III. Korps sind diese sorgsamen Untersuchungen eigentlich ganz Nebensache. Er kommt sehr schnell von dem Einzelvorgang ab und fängt an, beinahe aus dem Zusammenhang herausgehend, die Frage aufzuwerfen, nicht ob man dies oder jenes Lokal verbieten solle, sondern wie man denn überhaupt dem Einfluß sozialdemokratischer Agitation vorbeugen wolle. Er ist hierbei in der Kürze der Zeit auch nicht über die Aufstellung des Problems nennenswert hinausgekommen. Daß er aber überhaupt, wenn auch nur in Randbemerkungen, diese Grundfrage aufwarf und sich Gedanken darüber machte, ob Maßnahmen der Armee allein hier heilsam sein könnten oder ob nicht vielmehr der Staat von sich aus eine Abwehr nun endlich einleiten müsse: Das alles zeigt, wie er den Kernpunkt des Ganzen immer auch dann erfaßte, wenn der Anstoß vielleicht von einem verhältnismäßig nebensächlichen Vorgang wie dem eines Lokalverbotes herkam.
Ein anderer Vorgang verdient vielleicht Erwähnung, weil er für den Menschen Seeckt sehr deutlich spricht. Im Herbst 1913 beschwert sich auf etwas ungewöhnliche Weise ein Divisionskommandeur über den Kommandierenden General unmittelbar bei Sr. Majestät. Der Entwurf zum Bericht an den Kaiser ist von Seeckts Hand verfasst. Hier tritt allerdings zwischen den Zeilen sein ganzes Wesen hervor. Es ist eine stolze Art, mit der der Chef im vollen Bewußtsein der hohen Stellung seines Kommandierenden Generals Rechte und Pflichten für diesen gegenüber dem Souverän uneingeschränkt in Anspruch nimmt und, wie der Verlauf der Angelegenheit zeigt, durchaus auch in Anspruch nehmen darf. Bei aller Wahrung der Normen trugen diese Offiziere der alten Armee ein berechtigtes Selbstbewußtsein in sich, das ihrem König gegenüber keineswegs versagte. Vom Byzantinismus war jedenfalls, wie das Schriftstück zeigt, Hans von Seeckt recht weit entfernt.
Eine Bemerkung Seeckts über Sport vom Juni 1914 mag deshalb wiedergegeben werden, weil sie zeigt, daß weder die Armee noch Seeckt in dieser Beziehung sich vor dem Kriege modernen Bestrebungen verschloß: »... Heute und morgen herrscht der Sport. Es sind Offizier- und Mannschaftswettkämpfe, und der Kaiser kommt an beiden Tagen. Da das Korps stark beteiligt ist, muß ich dabei sein. Wir, d. h. die Armee, haben uns überraschend schnell in die neue Sache gefunden, und wir können nun unsere Offiziere und voran einen preußischen Prinzen Gemeint ist der im Kriege als Flieger gefallene Sohn des Prinzen Friedrich Leopold. im leichten Trikot im Wettlauf sehen. Es ist nur das Ungewohnte; denn eigentlich sollte man zufrieden sein, daß nicht mehr die Anwesenheit eines Pferdes den Sport legitimiert und Laufen und Schwimmen, Fechten und Schießen für so anständig gilt wie Retten. Es ist nur eben neu, aber die Frische und Begeiterung, mit der unsere jungen Herren an die Sache herangehen, hat etwas Wohltuendes. Daß von mir keine persönlichen Leistungen mehr verlangt werden, ist mir aber recht lieb …«
Für die Manöver 1913 war dem III. Korps die Aufgabe gestellt, die eine Partei das französische Vormarschverfahren anwenden zu lassen. Es handelte sich also darum, daß eine Partei durch Vorschieben selbständiger Detachements bereits einen Vorsprung in der Entfaltung anstrebte. Das Ergebnis, das in dem Erfahrungsbericht an das Kriegsministerium Ende Oktober niedergelegt wurde, ist so, daß es auch der heutigen durch die Kriegserfahrung beeinflußten Kritik standhalten dürfte. Dies Ergebnis läßt sich in sehr wenige Worte zusammenfassen. Falsch ist es, wenn man eine Regel aufstellt und diese in jedem Falle anwendet. Man soll für Infanterie und Artillerie mit allen Mitteln nach dem Vorsprung frühzeitiger Entfaltung streben. Es kommt aber sehr viel weniger darauf an, wie man es macht, sondern darauf, wer es macht. Mit einer geradezu erfrischenden Deutlichkeit geht aus dem Bericht hervor, daß eigentlich alles auf die Auswahl der Persönlichkeit ankommt. Die für viele so wichtige Frage, ob es gefährlich sei, wenn bei der Einleitung der Kämpfe die vorgeschobenen Detachements oder auch nur die Anfänge der Vorhuten vielleicht zu einem Ausweichen nach rückwärts kommen müßten, um nicht zerschlagen zu werden, alle diese Fragen sind für Seeckt weniger Fragen der taktischen Regel als der Persönlichkeit. Man muß doch angesichts eines sehr bemerkbar gewordenen Teiles der Nachkriegsliteratur sich fragen, ob man der alten Armee wirklich den Vorwurf mangelnder Psychologie machen durfte, wenn Korpschefs so nachdrücklich psychologische Momente in ihren Stellungnahmen in den Vordergrund stellten.
Es scheint, daß auf der Wende von 1913/14 an Seeckt die Frage herangetreten ist, ob er nach der Türkei gehen wollte. Jedenfalls hat er diese Frage gesprächsweise in vertrautem Kreise erörtert. Vielleicht war es auch nur ein Wunschgedanke, der im Gespräch seinen Ausdruck fand. Dort unten war Krieg gewesen, und irgend etwas in Seeckt mag dorthin zum Kampf, zur Tat ihn gedrängt haben. Als er darüber gesprächsweise sich äußerte, ahnte er noch nicht, daß ein halbes Jahr später die Not des eigenen Volkes und der ganze furchtbare Ernst eines Weltbrandes ihn auf das Schlachtfeld rufen würden.
Fast fünf Jahrzehnte der Entwicklung, der Schulung und der Friedensbewährung sind vorüber. Der Krieg wird nunmehr Taten und Leistung mit der vollen Kraft, die der Mann zu geben hat, verlangen. An dieser Stelle mag ein ganz kurzer Überblick doppelter Art als Abschluß der Friedenszeit angebracht sein: einmal die Umwelt, in der Seeckt stand, also die alte Armee betreffend, und zum anderen seine Persönlichkeit für diesen Zeitpunkt abschließend betrachtend.
Für die Umwelt, aus der und in der er geworden und gewachsen ist, hätte Seeckt ganz sicher Erinnerungsworte gefunden Seeckt hat eine skizzierende Stoffgliederung seiner Lebenserinnerungen hinterlassen. Darin waren Abschnitte über das alte Heer und seine Einrichtungen ausdrücklich enthalten.. Unmittelbar nach dem Zusammenbruch hat sich eine Flut von Vorwürfen über die alte Armee von der Leistung des Generalstabes bis hinunter zu den letzten Ausbildungsfehlern des Unteroffiziers auf dem Kasernenhof ergossen, wie sie kaum ihresgleichen wiederfindet. Man hat in Preußen nach 1806 sachlich, sehr sachlich sogar geprüft. Aber man hat sich sofort auch der ausschlaggebenden und bleibenden Werte des Erbes Friedrichs des Großen erinnert. Die französische Armee hat nach 1871 in ihrem Lande gewiß Kritik genug gefunden, aber niemals ist man so weit gegangen, alles zu verurteilen und die Armee herabzuwürdigen. Nun war es bei uns nach 1918 nicht so, daß etwa nur derjenige die Armee schärfster und gehässigster Kritik unterzog, der außen stand und Laie war. Vielmehr konnte es sich mancher vom Fach nicht versagen, niederziehende Kritik zu üben, obwohl eigentlich die Unterlagen noch fehlen mochten. Man sprach von einem Testament des Grafen Schlieffen, von dem man nur sehr symbolisch sprechen konnte; man sprach von einem Schlieffenplan, den es in Wahrheit für 1914 nicht nur nicht gab, sondern gar nicht geben konnte. Wenn man die Summe einer in der Geschichte aller Heere beispiellos dastehenden Kritik von der Führungsart bis zum psychologischen Moment, von technischen Dingen bis zur politischen Begabung der Generäle, deren Sache es eigentlich kaum war, Politik zu machen, zusammenfaßt, dann bleibt an der alten Armee so ziemlich kein gutes Haar. Diese Ansicht hat Seeckt allerdings nie geteilt, und er hatte recht, wenn er solche Auffassung ablehnte. Ganz gewiß gab es, wie in jeder von Menschen aufgebauten Organisation, auch im alten deutschen Heer Fehler. Man hätte sie aber nicht unterstreichen, sondern es nach einem Heldenkampf von 4½ Jahren bewundern sollen, daß es so wenige waren. Man vergaß völlig, daß diese Armee in der Vorkriegszeit mehr und mehr zu einem Widerspruch mit der Umwelt kam und allein dadurch für alle unsere Zukunft ein ausschlaggebendes geschichtliches Verdienst für sich erwarb, daß sie im Gegensatz zur Umwelt sich ihre Wesensart nahezu unangetastet bewahrt hatte. Hätte sie das nicht gekonnt, dann fehlten nach dem Kriege die Voraussetzungen, um überhaupt auf der ethischen Grundlage echten inneren Soldatentums wieder aufbauen zu können. Man muß sich einmal in die Zeiten nach 1848 zurückversetzen. Die Armee hatte noch Reste aus der Zeit der Befreiungskriege und aus der danach folgenden wirtschaftlichen Depression, an denen sie schwer trug und die sich hemmend auswirkten. Als der Träger der Krone diese Hemmungen beseitigen will, kommt es zum Staatskonflikt mit den beginnenden parlamentarischen Kräften, wobei es ganz gleich ist, welche Kreise es sind, die in die Opposition gingen. Nach 1871 wirkt sich nun aber die gesamte Agitation absolut wirtschaftlich eingestellter Kräfte so aus, daß man nicht nur die Armee, wie das in allen Ländern mehr oder minder üblich war, zum Objekt des inneren politischen Machtkampfes macht, sondern wesentliche Teile der Nation beginnen sich abzukehren von den Grundbegriffen des Wehrwillens und der Wehrfähigkeit. Man soll es der Armee nicht zum Vorwurf machen, wenn sie neben der Aufgabe der soldatischen Erziehung des Volkes eine politische oder weltanschauliche Erziehung, die immer nur mittelbar ihre Aufgabe ist, unmittelbar nicht zu leisten vermochte. Man soll vielmehr anerkennen, daß die Armee sich im Grunde in stillem, aber zähem Kampf ihre Wesensart erhielt. Daß sie dabei immer mehr sich von der Entwicklung des Volkes, das den Weg zu einem ungesunden sterbenskranken Parlamentarismus nahm, entfernte, war ein Glück, war ein Verdienst, hatte aber immerhin zur Folge, daß die innere Einheit zwischen Armee und Volk, wie wir sie heute endlich wieder haben, mehr und mehr gelockert wurde. Und wenn sie schließlich 1914 noch nicht gesprengt war, so ist das allein ein Verdienst der Armee und damit des Offizierkorps. Wie die Dinge liefen, ist an einem kleinen, aber kennzeichnenden Beispiel deutlich zu erkennen. Ursprünglich unterstand der Chef des Generalstabes dem Kriegsminister Die Angabe bei Dreitschke »Deutsche Geschichte; 3. Buch«, der Generalstab sei 1821 vom Kriegsministerium getrennt, trifft nicht zu.. Auch der Generalfeldmarschall von Moltke, der Sieger von Königgrätz und Sedan, hatte zunächst keinen Anlaß gesehen, seine Unterstellung unter den Kriegsminister zu ändern. Selbstverständlich milderte die ungeheure Autorität Moltkes diesen Zustand. Waldersee jedoch leitete die unabhängige Immediatstellung des Chefs des Generalstabes ein. Das ist an sich, wie man offen sagen muß, ein Fehler, der erst nach dem Umbruch von 1933 wieder beseitigt werden konnte. Die Einheit zwischen militärischer und politischer Führung wird damit durch Ausschaltung des Bindegliedes zerrissen mit dem Erfolg, daß militärische und politische Führung sich im ganzen Weltkrieg unheimlich fremd blieben. Und dennoch hatte diese Maßnahme ihren inneren Grund und war damals als Notbehelf vielleicht sogar berechtigt. Die Stellung des preußischen Kriegsministers, der im Reichstag sozusagen als Staatssekretär des Krieges auftreten mußte, war eine schier unmögliche. Einmal unterstand er dem obersten Kriegsherrn und war als Soldat an dessen Befehl gebunden, andererseits konnte er die parlamentarischen, immer mächtiger werdenden Fesseln nicht abstreifen, und schließlich stand er in einem ganz bestimmten Verhältnis zum Reichskanzler und preußischen Ministerpräsidenten, der die Politik des Kabinetts verantwortlich bestimmte. Je mehr nun der Parlamentarismus um sich griff, desto näher lag es, wenigstens das Organ der Führung, den Generalstab, von diesen unheilvollen Einflüssen zu befreien. Wie notwendig man diese Befreiung ansah, geht übrigens daraus hervor, daß Seeckt in seinen Briefen später einmal die Unterstellung des Generalstabschefs unter den Kriegsminister für absurd hält. So stark war im Laufe der Zeit das Bewußtsein geschwunden, daß es sich nur um einen Notbehelf in einer innerpolitisch gefährdeten Lage gehandelt hatte. Als man ihm gegenüber 1915 einmal eine Rückkehr zum Zustand wie zu Moltkes Zeiten erörterte, fand Seeckt solchen Vorschlag lediglich amüsant. Es mag dies nur ein Beispiel sein. Die Beispiele, in denen die Armee sich gegen die innere Entwicklung unseres Volkes stemmte, ließen sich häufen. Der Soldat predigte noch den Einsatz der Person und des Lebens des Einzelnen für die Gesamtheit. Ihm galt Opfersinn noch nicht als Dummheit. Der Soldat lehnte einen übertriebenen Individualismus ab bei gleichzeitiger Kultivierung des Persönlichkeitswertes. Die Armee hat sich gegen das Eindringen jüdischen Blutes gewehrt. Mag das Offizierkorps dem Wohlstand der Gesamtnation folgend natürlich auch nicht von dem materiellen Umschwung unberührt geblieben sein, so blieb dennoch das Ideal preußisch einfacher Lebensführung ihm erhalten.
Wenn die Armee sich mehr und mehr abschloß, so war das Pflicht und Recht. Sie tat das nur genau so weit, als die Umwelt sie nicht verstehen wollte. Freilich war das Heer ein absolutistischer Rest in einem vom Konstitutionalismus zum Parlamentarismus hinüberwechselnden Staat. Das mag ein Anachronismus und sonst angreifbar gewesen sein. Für Volk und Armee war und bleibt es ein Glück, daß es so war.
Kurzum, es soll beim Abschluß der Friedenszeit in der Lebenserinnerung eines bedeutenden Offiziers wohl angebracht sein, den Wert der alten Armee rückblickend zu betonen. Es ist eine etwas magere Aushilfe, wenn man immer wieder darauf hinweist, daß ein oder mehrere Ausländer diese Armee von 1914 als die beste der Welt bezeichnet haben. Es wäre sehr viel richtiger, wenn wir selbst von uns aus nicht vergessen wollten, daß diese alte Armee in der Tat ewig Vorbild bleibt. Jedenfalls hat das feindliche Ausland diese Auffassung auch dann noch gehabt, als das deutsche Volk seine Waffen fünf Minuten zu früh an die Wand stellte. Es gibt überhaupt keine größere Ehrung für das alte Heer als den Versailler Vertrag. Von der militärischen Leistungsfähigkeit unserer Heeresorganisation mußten diejenigen bis zum äußersten überzeugt sein, die ihre Vernichtungsbestimmungen allerdings so abfaßten, daß nach ihrer Meinung von dieser bewunderungswürdigen Organisation auch nicht mehr der kleinste Rest übrig bleiben konnte, der vielleicht den Anfang neuen Lebens zu bilden vermochte. Wenn sich der Feind darüber täuschte, so hatte das mehrere Gründe. Einer dieser Gründe war Seeckt. Davon später!

Hans von Seeckt als Oberleutnant
Und nun zu einem letzten Wort über Seeckt selbst an der Grenze seines Lebens zwischen Frieden und Krieg. Es konnte nicht nur, nein, es mußte eigentlich wundernehmen, daß Seeckt, ein Mann von so einzigartigem Format, auf der Höhe seines Lebens, bis fast zu seinem fünfzigsten Lebensjahr, also die ganze Vorkriegszeit, in keiner Weise aus dem Rahmen seiner Umwelt besonders hervortritt. Gewiß schon das letzte Friedensjahrzehnt zeigt ihn als einen Generalstabsoffizier von vorzüglichen Qualitäten, der die verantwortungsreichste Stelle auf der Stufenleiter des Generalstabes schließlich bei Kriegsbeginn gerade eingenommen hat. Aber dieses Ziel hebt ihn doch noch immer nicht hinaus aus der Reihe derer, die das auch erreichten und diese Stelle ebenso vorzüglich wie er ausfüllten. Freilich ist er bei den Generalstabsreisen bereits aufgefallen und so günstig beurteilt, daß er 1914 zu denen rechnete, die für die Auswahl als Armeechefs in Betracht kamen Mitteilung des Generalleutnants v. Tieschowitz.. Es ist jedoch noch nichts, aber auch gar nichts da, was ihm etwa eine geniale Note verleiht. Rückblickend ist dies den Menschen, die ihm in der Vorkriegszeit näher standen, durchaus nicht unerklärlich. Seeckt ist niemals ein Mann des intellektuellen Kalküls, ist sehr klug, aber nie ein genialer Verstandesmensch gewesen. Die Wirklichkeit und das Tatsächliche waren seine Lebensform. Nicht der Verstand, sondern der Wille, nicht die Spekulation, sondern der Charakter waren das ihm von der Natur vorzüglich verliehene Gut. Im ganzen: voilà un homme. Seeckt war ganz einfach ein Mann des Handelns und der Tat. Das Gebiet der Tat ist nicht der Friede, sondern ist der Krieg. So mußte es kommen, daß seine Größe sich überhaupt erst im Kriege und erst recht in diesem unfriedlichen Frieden, der dem Kriege folgte, entwickeln konnte. Es wäre ein Widerspruch im Charakter gewesen, wenn der Seeckt von Gorlice oder der Seeckt als Chef der Heeresleitung sich deutlich erkennbar schon in den Vorkriegszeiten abgezeichnet hätte.
Ich Der Herausgeber. stand einst vor einem Bilde Seeckts, das ihn jünger darstellt, als wir es im allgemeinen gewöhnt sind, und das mir insofern fremd war. Das Bild, das in uns lebt, ist doch im wesentlichen das Bild des älteren Seeckt, auf dessen Gesicht die Spuren schwerer Verantwortung zu lesen sind. Wir vergessen, daß er einst ein froher unbeschwerter Mensch war, der lange jung geblieben ist. Damals hatte das Gesicht noch etwas leicht Beschwingtes, Scharmantes, Harmloses. Auch er wächst erst in seine Größe hinein. Naturen wie Seeckt werden nicht in jungen Jahren fertig, warten vielleicht, zwar innerlich drängend, aber äußerlich gelassen auf die Stunde der Berufung durch das Schicksal. Später kamen auch äußerlich die Spuren, die echte Größe dem Menschenantlitz einprägt. Man spürt, daß ihm die Entschlüsse nicht leicht wurden. Er hat mit ihnen gerungen und im Innersten um sein Tun gekämpft. Das aber haben die meisten wirklich Großen getan. Ein schneller Entschluß und ein leichter Entschluß sind nicht das gleiche.
Noch ist er 1914, am Wendepunkt in Deutschlands Geschichte, der zwar ernste und doch innerlich so lebensfrohe, der innerlich und äußerlich, man muß es wiederholen, weil es so kennzeichnend ist, scharmante Mensch, der kluge Kopf, aber auch der mit einer ungeheuren Selbstverständlichkeit noch unbeschwert seinen Lebensweg Dahinziehende. Die bewußte Tat, die über die eigene Person in das Große hinein wachsende Verantwortung, das alles kommt erst.
Vielleicht ist es die etwas unpoetische, ein klein wenig nüchterne und dennoch in ihrer Auswirkung riesenhaft urwüchsige und als Urkraft bewundernswerte Selbstverständlichkeit, mit der ein ganzes Volk in den Krieg zieht, die sich, fast ein gelebtes Paradoxon, in diesem Typus des Generalstabschefs mit dem Einglas am Bande verkörperte.

Als Generalstabsoffizier im Kaisermanöver 1901 bei Danzig