
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
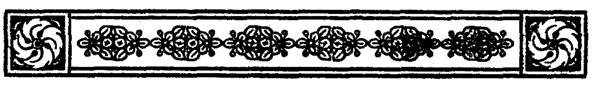
Der Kanarienvogel also allein war bei den Studien, die zwei Exstudenten waren nun vollkommene Bauern.
Das Bauernleben ist ein ganz einförmiges Leben, und so habe ich über die bäuerlichen Beschäftigungen des Alois und Joseph wenig zu erzählen; vom Kanarienvogel auch nichts, da er in Innsbruck drunten fleißig studierte und sang. Aber von dem Seelenleben der zwei Exstudenten will ich etwas erzählen.
Der Vater war mit den zweien wie natürlich immer mürrisch und schroff, es reuten ihn seine umsonst hinausgeworfenen 300 Gulden, es ärgerte ihn der Spott der Großkircher und Spategger und die Durchkreuzung seiner schönen Pläne.
Nur die sanfte Mutter hatte allen Verdruß bald wieder vergessen, beide waren ihr wieder die lieben Söhne, der Alois wurde gar wieder ihr Liebling, denn er bereute seine Fehltritte bitter und wurde wieder der alte fromme Alois. Er ging sehr fleißig in die Kirche und alle acht Tage zur Kommunion, und es war etwa nicht Heuchelei, sondern wahrer Ernst. Diese Frömmigkeit des Sohnes entzückte die Mutter.
Joseph war ein Halbwilder, er sprach wenig und hielt sich gerne in den Wäldern und bei den Kühen auf. In Großkirchen sah man ihn wenig, er teilte immer des Vaters harte Beschäftigung.
Im Walde droben kam es ihm so traulich, so stille vor, und da konnte er seinen Träumereien nachhängen. Er träumte sich aber in seiner Zukunft nicht als Bauer, nicht mit dem Spaten in der Hand, sondern er baute sich schöne, goldene Luftschlösser. Den Schlüssel dazu konnte er freilich nicht finden.
Gesellschaft liebte er nicht, denn wer sollte zu ihm passen? Die andern Bauernburschen gingen in seine Träume ja nicht ein, sie fanden ihr Leben in Großkirchen zu schön; es gibt ja nur ein Großkirchen. – Und des Schusters Michele, auch ein Exstudent, setzte seine Gedanken über die Schuhflickerei auch nicht mehr hinaus, er war bereits ein eingefleischter Schuhflicker. Somit hatte Joseph keinen Kameraden.
Ein Plätzchen liebte Joseph besonders. Es war dies die unterirdische Totenkapelle in Großkirchen. Dort war Josephs zweite Mutter, der er auch immer seine Leiden klagte; und wenn der Feierabend herangerückt war und die Mutter daheim noch nicht gekocht hatte, steckte Joseph allein in dieser Kapelle.
Die Frömmigkeit erhielt hier immer ein Lichtlein angezündet. Joseph konnte der Mutter Gottes in ihr freundlich lächelndes Antlitz sehen, und das Kindlein auf ihren Armen lächelte nicht minder hold zu Joseph herab. Hier bat er nun oft und lange seine zweite Mutter, sie möchte ihn doch auf den rechten Weg führen; wo er jetzt stehe, das sei nicht der rechte, das sage ihm sein Herz. Da war es immer, als nickte die Mutter bejahend ihm zu.
Und wenn es dann in der Pfarre Ave-Maria geläutet hatte, da nahm er das Glockenseil in der Kapelle und gab das Zeichen zum Rosenkranze in der Totengruft; die alte Mesnerin hatte ihm den Mesnerdienst in der Totengruft abgetreten, weil Joseph so pünktlich war und eine gar so liebliche, helle Stimme zum Vorbeten hatte. Der Dienst trug freilich dem Joseph nicht mehr ein als den Lohn, den der Himmel gab, doch Joseph war mit diesem schon auch zufrieden. Ja, er gab manchmal sogar noch seine eigenen paar Kreuzer her, die er sich irgendwo zufällig verdient hatte, oder bettelte Geld zusammen, um den Altar seiner Mutter besonders an ihren Festtagen, bei dem Abendrosenkranze glänzend beleuchten zu können. Seit Joseph Totengruftmesner war, schaute das Altärchen gar reinlich und nett her, man kam nun lieber zu diesem Rosenkranze, und manche Hand steckte ihm im Dunkeln, wenn er nach Hause ging, Geld zur Verzierung des Altars zu.
Der Pfarrmesner ließ den Joseph frei hantieren und meinte, der Bursche habe Geschmack.
Die alte Mesnerin liebte den Joseph gar sehr, weil er die Mutter Gottes in der Totengruft so ehrte; diese war auch ihr ans Herz gewachsen. Sie erzählte dem Joseph von diesem Wunderbilde oft gar wundersame Geschichten. Sie hatte viele selbst erlebt, da sie schon mehr als 70 Jahre täglich die Stufen in die Gruft hinabgestiegen war.
Da dieses Bild so viele Wunder wirkt, so erzählte die Mesnerin, habe man es einmal in die Pfarrkirche hinauf versetzt, weil man glaubte, die Stelle in dieser feuchten, dunkeln Gruft sei für das Gnadenbild zu unwürdig. Es sei gerade im Winter gewesen.
In der Frühe sei das Bild in der Pfarrkirche fort und wieder an seiner alten Stelle gewesen. Noch zweimal habe man probiert und sie übersetzt. Das drittemal sei ein neuer Schnee eingefallen, und da habe man im Schnee von der Türe der Pfarrkirche bis hinab in die Totengruft kleine Fußtrittchen gesehen; es seien dies die Fußtritte von der Mutter Gottes gewesen, die wieder in der Nacht an ihre alte Stelle gewandert war. Seit dieser Zeit habe man sie da belassen.
Unter allen Votivtafeln, die dort aufgehängt waren, gefielen dem Joseph vorzüglich zwei. Auf der einen war eine Mühle vorgestellt, zu welcher das Wasser auf hohen Rinnen zugeführt wurde. Mitten in dem Wasser rann ein Knäblein, schon daran, mit dem Wasserstrom auf das zermalmende Mühlrad hinabzustürzen. Da ergreift ein Engel des Knäbleins Hand und zieht es heraus; oben herab schaut im Strahlenglanze mild das Bild der Totengruft-Muttergottes. Eine Mutter neben der Mühle fleht zu ihr hinauf. Joseph kannte den, der so gerettet wurde, ganz gut, er war nun ein Mann geworden und war Müller in Großkirchen.
Das andere Votivbild stellte einen wilden Meeressturm vor; ein Schiff von den schäumenden Wogen erfaßt, ist zersplittert, eine Menge von Untersinkenden und Leichen ist sichtbar, nur sieben Männer sitzen wohlbehalten auf einem Mastbaum und rudern einer herrlichen Stadt zu. Es ist dies Scutari am Bosporus. – Oben leuchtet als Meeresstern die Totengruft-Muttergottes ihren Landsleuten aus weiter Ferne entgegen; sie haben ihr gerufen, nun ist sie schon da und rettet sie mit wunderbarer Hand, und nur sie allein auf dem ganzen Schiffe sind noch am Leben. Diese sieben Männer waren Großkircher. Sie setzten, als sie glücklich heimkamen, aus Dankbarkeit dieses Denkmal. Die alte Mesnerin sagte, sie sei damals 14 Jahre alt gewesen und habe alle diese gekannt; einer wäre erst vor sechs Jahren gestorben. Joseph hatte ihn auch noch gekannt. Diese zwei Bilder kamen dem Joseph als sprechende Zeugen vor, daß die Totengruft-Muttergottes das Vertrauen zu ihr lohne. Und er war ja auch in einem Meere der Bitterkeit, sie sollte doch ihrem treuen Mesnerknaben auch helfen.
Die alte Mesnerin behauptete einmal, daß Joseph noch recht glücklich werden würde, sie aber hoffe durch die Totengruft-Muttergottes das nächste Jahr den Himmel, sie habe nun genug gelebt, und dann werde sie auch für den Joseph Fürbitterin sein!
Die Zeit, wo die Studenten in die Vakanz kamen, nahte; für Joseph und Alois eine Zeit, der sie mit Wehmut entgegenblickten. Der glückliche Kanarienvogel, er hat eine Vakanzzeit, wie kann er sich darauf freuen! Und für sie blüht eine solche Zeit nicht mehr.
Und dennoch hoffte es Alois. Er hatte sich hinter den Großkircher Kooperator gesteckt, der das brave Bürschchen außerordentlich lieb hatte und ihm gerne wieder zum Studieren verholfen hätte. Der Kooperator steckte sich hinter den Prälaten von Stams, bei dem er auch etwas galt, und dieser wurde für das nächste Jahr Studienrektor. Er sagte ihm, daß in Großkirchen ein Bube wäre, der einmal studiert hätte und wegen Nachlässigkeit verjagt worden sei. Jetzt aber sei er ein Muster der Jünglinge, ein wahrer heiliger Aloisius. Es wäre das Bürschchen für einen Bauern schade. Und lange lag er dem Prälaten in den Ohren, bis er endlich dem Alois die Wiederaufnahme zusagte.
Da wurden nun die Bücher wieder hergenommen und im geheimen durchstudiert, und wo nur Alois ein Lückchen erwischte, schraubte er sich von der Arbeit los und hin zu den Büchern; die Mutter mußte es vor dem Vater vertuschen helfen, denn er wollte vom Studieren nichts mehr hören.
Ach der glückliche Alois, dachte sich Joseph, er beneidete ihn. Der Nuiterbauer schmähte aber gewaltig über den faulen Alois, der nicht aus der Stube zu bringen wäre.
Endlich rückte das Schutzengelfest heran, die Kühe kehrten von den Alpen heim, und da mußte denn doch einmal daran gedacht werden, für den Alois auch Studentenkleider zu richten, denn seinen alten Studentenrock hatten die Schaben zerfressen, er hing das ganze Jahr im Kasten, weil der Vater keinen der Exstudenten im Rocke sehen wollte.
Wie aber nun bei dem Nuiterbauer die Sache einleiten? Er hatte den Geldbeutel, und zum Ankauf des Tuches braucht man Geld.
Da wurde ihm der Kooperator über den Hals gehetzt, der einmal wie zufällig ins Nuiterhaus kam.
Was machen die Studenten? fragte der Kooperator.
Der Nuiterbauer seufzte tief auf und sagte: Was machen sie, die nichtsnutzigen Schlingel? Der Alois hängt immer an der Schürze der Mutter und will noch den Herrn spielen, statt zu arbeiten. Und der Joseph – arbeitet wohl – aber zu einem Bauer ist er auch nichts, ich merke, daß er immer ein gar betrübtes Gesicht macht, wenn er wieder anbeißen muß.
Hätten sie sich besser aufgeführt, so wäre es nicht so, ich hätte jetzt eine große Freude, und die Buben wären Herren wie der Hans.
Ihr sehet die Sache zu schwarz, sagte der Kooperator, die Buben sind jetzt schon recht, und wer hat in seinem Leben nicht dumme Streiche gemacht? Seht, ich war in den Studentenjahren auch ein Flegel.
Der Nuiterbauer schüttelte ungläubig den Kopf; aus einem Flegel, sagte er, wird kein Kooperator.
Meint Ihr, fuhr der Kooperator lächelnd fort: Ihr irrt Euch gröblich. Ich war auch zweimal auf dem Sprunge, gejagt zu werden, und dennoch bin ich jetzt Kooperator in Großkirchen.
Wenn nun so z. B. der Alois wieder aufgenommen würde, ließet Ihr ihn ziehen?
Der Nuiterbauer: Ha ha ha, einen erstickten Studenten nach einem Jahre aufnehmen, das geschieht nie und nimmer.
Kooperator: Wenn ich aber die Aufnahme schon im Sacke hätte?
Nuiterbauer: Sie haben mich wohl heute zum besten, doch Sie wissen nicht, daß das Studieren meiner Buben einmal mein ganzes Sinnen und Trachten war.
Kooperator: Ich scherze nicht. Es ist Wahrheit.
Nuiterbauer: Daraus wird nichts, den Esel führt man nur einmal über das Eis. Ich gebe für den Alois und Joseph keinen Pfennig mehr aus, ich habe noch andere Kinder.
Da gab der Kooperator das Zeichen zum gemeinsamen Sturmangriff auf den Nuiterbauer. Das Weiblein bat, Alois stürzte sich vor dem Vater auf die Knie, der Kooperator ließ auch sein wirksames Geschoß los; da hätte ein Stein weich werden müssen.
Nun, so sei es in Gottes Namen, sprach nach langem Widerstreben der Nuiterbauer, er mag gehen; aber weißt du, Lois, sprach er zu Alois gewendet, es ist dies der letzte Versuch; haltest du nicht Stich, so hast du an mir keinen Vater mehr; du kennst mich, ich halte Wort.
Als diese Unterhandlung zu Hause vorging, war Joseph im Walde droben; erst abends erfuhr er, daß Alois wieder nach Innsbruck dürfe. Bei der Mutter Gottes drunten in der Totengruft machte er seinen Schmerzen Luft und sagte zu seiner zweiten Mutter: Siehe, allen blühen Rosen, nur mir blühet keine. Mutter der schönen Liebe und der heiligen Hoffnung, laß auch mir eine erblühen.
Fast hätte Joseph an jenem Abende vergessen, zum Abendessen zu kommen.
Fort, fort muß ich, sprach eines Tages Joseph zu sich selbst, es leidet mich nicht mehr allein zu Hause. Soll ich allein so ein geschundener Bauer werden?
Aber wohin und was anfangen? Zur Malerei oder Uhrmacherei hätte ich große Lust, aber herrje, hier in Großkirchen kann ich keinen andern Malermeister haben als den langen Fuchspasser, und dieser kann auch nichts anderes, als ein paar viereckige, ungeschlachte Figuren auf die Totenkreuze hinaufpatzen, und das Uhrmacherle von Großkirchen sollte man eigentlich den Uhrenverderber heißen. In Großkirchen ist also nichts anzufangen.
In München, hat unser Organist erzählt, gäbe es Maler, und in Wien seien die besten Uhrmacher. Die Malerei wäre freilich eine schöne Kunst, da könnte ich Bauernhäuser und der Mutter eine schöne Tafel malen; aber der Zeichenlehrer, dem ich meine Neigung zur Zeichnerei entdeckte, sagte, alle Maler, selbst die größten Künstler seien nur Hungerleider, und Hungerleider möchte ich auch keiner werden. Also Uhrmacher! – Und lernen muß ich es in Wien, dann bin ich kein Pfuscher, dann werde ich in Großkirchen Meister werden, und der gescheite Uhrendoktor von Großkirchen wird bald bekannt sein, Land auf und ab, dann werde ich Geld haben und werde zum Vater sagen: Da habt Ihr 300 Gulden, und wenn Ihr Geld braucht, kommt nur zu mir.
Also nach Wien! Der Nachbar Pumpel war schon in Wien, er lernte dort das Tischlerhandwerk. Man müsse, sagte er, vier Jahre lernen, dann brauche man kein Lehrgeld zu bezahlen.
So schwärmte Joseph; sein Beschluß war zur Reife geworden; nun nur noch die Mutter für den Plan gewonnen, gibt sie mir ihren Segen und Jawort, dann ziehe ich mit Alois fort nach Innsbruck und dann nach Wien.
Als Joseph der Mutter seinen Plan entdeckte, da erschrak sie über das Wort Wien. Wien, sagte sie, ist ja gar weit, weit fort, da würde ich dann dich nimmer sehen, denn ich sterbe so bald. Doch Joseph lag ihr so lange in den Ohren, bis sie endlich dazu ja sagte und ihm noch versprach, ihr Eier- und Hennengeld, das ist drei Kronentaler, als Reisegeld zu geben. Was die Mutter noch zum Jasagen bewog, war der Zusatz Josephs, daß, wenn er anders irgendwo Aufnahme ins Gymnasium erhalte, er studieren werde.
An dem Sonntage vor Michaeli kam der Nuiterbauer von der Zehnermesse nach Hause. Joseph, sagte er, den Hut weglegend, du kommst nun auch aus dem Hause, und zwar morgen schon.
Ich? fragte Joseph verblüfft.
Nuiterbauer: Ja du! Ich habe beim Gerber heute gefragt, ob er dich für sein Handwerk nicht brauchen könne, denn du taugest gar nichts zum Bauernwesen. Er sagte, er brauche eben einen Stampfbuben in die Lohmühle. Ein Jahr müßtest du dort bleiben, dann würdest du Gerberlehrling und in drei Jahren Geselle. Du hättest starke Knochen, wie sie für einen Rotgerber erforderlich sind. Du hast dort die ganze Verpflegung, und morgen mußt du einstehen.
Joseph: Ich Stampfbube, Gerberlehrling, Geselle, Gerber werden, morgen? Ja, dazu werde ich wohl auch einwilligen müssen, denn werden soll ja ich es?
Nuiterbauer: Warum sollst du etwas dagegen haben? Es ist dies ein schönes, einträgliches Handwerk. Du darfst es dir für eine Ehre anrechnen, daß der Gerber vor so vielen dich auswählt.
Joseph: Ich bedanke mich recht schön für die Ehre, in der Lohmühle im Winter einzugefrieren, dann stinkende Häute abzukratzen, mich mit Tierbälgen herumzubalgen und immer von Lohstaub einpulverisiert zu werden. Die Gerber kommen mir vor wie Schinder.
Ich werde Uhrmacher werden, ich gehe nach Wien, und nach einigen Jahren werdet Ihr staunen, wenn Ihr höret, daß Euer Joseph der erste Uhrmacher im Oberlande ist.
Nuiterbauer: Ho, ho, langsam! Das geht hoch hinaus! Ei, ei, du der erste Uhrmacher im Oberlande?
Joseph: Ja, morgen gehe ich; – das ist mein fester Entschluß.
Nuiterbauer: Meinetwegen kannst du Hofuhrenmacher beim Kaiser werden, ich wünsche es dir, aber wenn dir ernst ist, so wisse, daß ich zu deiner Großuhrmacherei in Wien keinen Kreuzer beisteure. Sehe zu, ob du deine Uhr jemals zum Gange bringst.
Joseph: Dafür lasset mich sorgen. Das habe ich mir ganz gut ausstudiert, als ich allein im Walde droben war.
Nuiterbauer: Und hast damit das Holzhacken vergessen, du bist ein Extrakopf, ein Schwärmer, aus dem nichts werden wird.
Des Vaters Spott reizte den Joseph; nachmittags war er schon beim Landgerichte und verlangte einen Paß nach den österreichischen Staaten, namentlich nach Wien. Der Paß wurde ihm gegeben.
Die Mutter steckte ihm wirklich abends ihr ganzes Eier- und Hennengeld, bestehend in drei Kronentalern, zu. – Des Josephs auf zwei Jahre in Pension gewesener Rock wurde auch aus dem Kasten herausgesucht, abgestaubt und ausgebessert, denn in Wien konnte er mit der Lodenjoppe doch nicht auftreten, da dort sogar der Straßenkehrer Rock und Zylinder trägt.
Also morgen wird abmarschiert, sagte Joseph nach dem Abendessen zum Vater, den Paß habe ich.
Diese Entschlossenheit Josephs hatte der Nuiterbauer nicht erwartet. Er meinte, daß das, was er vormittags sagte, ein Schreckschuß des pfiffigen Exstudenten gewesen sei, um den Vater mürbe zu machen.
Aber, sagte jetzt der Nuiterbauer, wie wirst du, ein Bube von 14 Jahren, ohne Geld einen solchen Weg machen und in einer solchen Stadt dich durchbringen können; das ist ein törichtes Unternehmen! Bleibe hier, das Essen und die Kleidung wirst du haben, bist noch dazu in der Heimat, und obgleich ich dich diese zwei Jahre hart gehalten habe, so tat ich es nur zum Scheine, ich hatte dich dennoch gerne.
Bauer, sprach Joseph, werde ich nie. Ich gehe! Morgen, morgen!
Nuiterbauer: So gehe und verbrenne dir deinen Gelbschnabel, du wirst gerne wiederkommen, vielleicht schon in acht Tagen und wirst um deine Heimat wieder froh sein; aber, wie gesagt, du bekommst dazu von mir keinen Pfennig Reisegeld; koche dir deine Suppe selbst aus!
Joseph: Aber Ihr seid mir deswegen doch etwa nicht böse und gebt mir Euren Segen mit.
Nuiterbauer: Nun den sollst du haben, aber auch nicht mehr. Böse bin ich dir deswegen nicht, aber ich beklage dich als einen dummen Jungen.
Mit diesem hatte die Unterhandlung ein Ende. Joseph war froh, daß der Vater ihm wenigstens nicht zürne.
Ein erstickter Student von Großkirchen, der mit Alois davongejagt worden war, bekam auch wieder Lust zum Studieren, da er aber in Innsbruck das Consilium bekommen hatte, so richtete er sein Augenmerk nach Salzburg und im Falle nach Judenburg, welche Gymnasien damals im Rufe standen, alles verjagte Studentenvolk ohne weiteres aufzunehmen. Judenburg gar war als Asyl aller exkludierten und dimittierten Studenten aus der ganzen Monarchie bekannt.
Barnabas, so hieß dieser Großkircher Exstudent, war ein Bruder Liederlich, hatte aber ein ziemlich gutes Redehaus und einen ewig grünen Humor, ja gerade wenn es ihm ganz bunt erging, scherzte er am meisten. Er zählte 16 Jahre, war also um zwei Jahre älter als Joseph.
Mit diesem wollte Joseph die Reise gemeinschaftlich bis nach Salzburg machen. In Innsbruck sollte Joseph ihn abholen. Der Abschied Josephs vom Vater war ziemlich kurz, denn seinem Vorsatze getreu gab der Nuiterbauer keinen Vierer zur Reise her; der Abschied von der Mutter war tränenreich.
Von Innsbruck weg war dem Joseph natürlich alles unbekannt, schon die Sprache der Unterländer verstand er nur halb.
Als die zwei Wanderburschen in Schwaz waren, wo es eben zu Mittag läutete und Hunger und Durst sich einstellte, bekannte Barnabas, daß er keinen Knopf Geld habe, und bat, Joseph möge ihm drei Gulden leihen, in Salzburg wäre eine Schwester von ihm, die werde es ihm ersetzen.
Der gutmütige Joseph tat es und schmälerte so sein ohnedies spärlich besetztes Beutelein.
Barnabas hatte sein Reisegeld von zu Hause, d. h. sechs bare Gulden, in Innsbruck verklopft, es hatte dort für ihn zu viel freie Zeit und zu viele Wirtshäuser gegeben, und er lebte gerne auf studentischem Großfuße, wenn er anders Geld im Sacke wußte.
Die Reiseabenteuer der beiden waren simpel; denn wer wird sich um die zwei Bürschlein scheren. Wegen der Geringfügigkeit ihrer Kassa beschlossen sie schon am ersten Tage, die ganze Nacht hindurch zu gehen; der Mondschein sollte ihr Führer sein. Aber der treulose Patron ließ sie aufsitzen. Sie hatten sich in Schwaz zu lange verhalten, und als sie nach Rothholz kamen, war es finstere Nacht. Zu ihrem Unglücke schlugen sie dort den Schloßweg ein, der sie, wie man ihnen gesagt hatte, bequemer nach Straß führe.
Die Schloßallee war abgegangen, man stand am Eingange einer Au.
Lustig vorwärts! rief Barnabas aus, doch auf einmal lag der tapfere Wegweiser in einem schlammigen Sumpfe und zappelte wie ein ins Trockene geratener Fisch, so daß dem Joseph der Schlamm ins Gesicht spritzte, und bald war auch er in den Morast hineingeplumpst.
Das Bad, sprach Barnabas, ist gar kühl und sauber, es schadet uns nicht. – Erst nach langer Mühe arbeiteten sich die beiden wieder heraus aus dem Sumpfe.
Dort sehe ich ein Licht durch die Zweige schimmern, sagte Barnabas, dort muß Straß sein, gehen wir darauf los! Und nachdem sie noch etliche Male in die Patsche gekommen waren, gelangten sie endlich nach Straß. Im Wirtshause staunte man freilich über die zwei mit Kot bedeckten Ankömmlinge, aber da gab's doch guten Wein und Kalbsbraten.
Joseph zog sein Beutelein und warf einen harten Kronentaler zur Bezahlung auf den Tisch, er meinte, die Leute werden dreinschauen, wenn er so mit dem Gelde klingle.
Auf jetzt! sagte Barnabas, es ist 10 Uhr, der Mond muß kommen, daß er uns die Straße beleuchte; doch von der Straße lassen wir nimmer; ein zweites solches Bad bekäme uns vielleicht schlecht.
Nun wurde aufgebrochen; die beiden fühlten ihre Füße so leicht, daß sie meinten, in einer Tour nach Salzburg laufen zu können.
Über der Zillerbrücke in der Nähe vom Schlosse Kropfsberg stand ein einzelnes Wirtshaus an einen Berg gelehnt, dessen Eingeweide die Bergknappen durchwühlen und das Steingerölle ans Tageslicht schieben. Vor diesem Wirtshause machten unsere zwei jungen Helden halt und beratschlagten sich, ob sie nicht dennoch hier über Nacht sich einquartieren sollten. Es war im Wirtshause noch Licht.
Das wäre feige für Studenten, sagte endlich Barnabas. Vorwärts! Siehst du, der Mond winkt uns freundlich, der alte Schalk sagt, er wolle unser Reisekamerad sein.
Und wirklich ging es vorwärts.
Sie mochten etwa 200 Schritte vom Wirtshause weg gemacht haben, da rumpelte es auf einmal in dem Steingerölle ob der Straße. Beide sehen etwas sich regen; es ist eine dunkle hohe Gestalt. Ein Geist, rief Joseph, dem die Haare zu Berge standen, ein Räuber, behauptete Barnabas. Laufen wir vorwärts! rief Joseph. Nein, rückwärts zum Wirtshause, erwiderte Barnabas; und wirklich lief Barnabas wie ein aufgeschrecktes Reh dem Wirtshause zu, Joseph ihm nach; denn der schwarze Schatten machte entsetzliche Sprünge über das Steingerölle herab; Joseph meinte, es säße ihm der Geist schon am Nacken, und Barnabas glaubte schon des Mörders Messer im Leibe zu fühlen.
Doch fatal! Die Türe des Wirtshauses war schon fest verrammelt und auch das Licht schon ausgelöscht, und unsere beiden Helden nahmen sich nicht mehr Zeit zu klopfen und um Hilfe zu rufen, der Geist, der Räuber war zu nahe, und hin ging es im gestreckten Galopp durch die Aue nach Straß; der Schatten kam immer näher, und die zwei beflügelten ihre Schritte noch mehr, so daß selbst die auf der Weide befindlichen Rosse scheu in die Au hineinrannten. Wie gerne wäre Joseph auf dem Rücken eines derselben gesessen. Er bereute seine Sünden und empfahl seine Seele Gott und lief und lief.
Endlich waren sie beim ersten Hause in Straß, der Schatten war in der Aue zurückgeblieben. Halb tot stürzten die Studentlein in das noch offene Wirtshaus.
Wer dieser verfolgende Schatten gewesen, konnte Joseph bis auf den heutigen Tag nicht enträtseln; aber wahrscheinlich hatte einer der Gäste im Wirtshause zu Straß den kleinen Prahlhans mit seinem Kronentaler beobachtet und ihre Reden gehört. Und so wird er ihnen vorausgegangen sein, in der Hoffnung, mit diesen zwei Bürschlein bald fertig zu sein und sie um ihr Silber leichter zu machen. Was da war, könnte ich nicht behaupten, doch der Wirt meinte auch so, da unter seinen Gästen ein Dörcher gewesen sei, der früher auf den Heuboden schlafen gegangen sei. Man fand ihn wirklich nicht mehr auf dem Heu, und er kehrte auch nicht wieder.
Die Folge dieses Reiseabenteuers war, daß Barnabas und Joseph ihren Entschluß, zur Nachtzeit zu reisen, von nun an aufgaben. Sie blieben in Straß und quartierten sich die übrigen Tage schon frühzeitig ein. Da das Geld auch immer minder wurde, so nahm man mit einem Quartiere in einem Heustadl und der gebettelten Bauernkost vorlieb.
Am vierten Tage wanderten sie wohlbehalten durch das lange Felsentor in die uralte Stadt Salzburg hinein. Joseph hatte noch zwei Gulden im Sacke und Barnabas ein Halbguldenstück, denn er hatte sich in Reichenhall eine für einen flotten Studenten notwendige Porzellanpfeife gekauft.
Sie fragten nach einem billigen Wirtshause und gerieten in das »Gasthaus zum Tiger«. Damals konnte man in Salzburg noch um drei Kreuzer eine dicke Hauswurst bekommen, die Maß Bier kostete auch nicht mehr als fünf Kreuzer, und das Schlafgeld wurde für die zwei auch nur zu sechs Kreuzer berechnet. Da lebten sie also in Saus und Braus und ließen den steinernen Krug in die Runde gehen.
Am andern Tage lautete es freilich anders. Barnabas war am Orte seiner Bestimmung und Joseph hatte noch nicht einmal ein Drittel seines Marsches zurückgelegt, und der bedenklich gewordene Beutel auch noch dazu! Des Barnabas Schwester wollte von der Schuld ihres Bruders auch nichts wissen, das gehe sie nichts an, sagte sie, er habe von der Mutter sechs Gulden zur Reise bekommen, die sie geschickt habe. Somit konnte Joseph seine drei Gulden auch in den Kamin schreiben, was ihn tief kränkte.
In Salzburg auf dem Mönchsberge war eine Großkircherin Nonne, ihr sollte Joseph einen Gruß von ihrer Schwester bringen.
Er begab sich daher hinauf zum Kloster, ging aber früher hinein in die uralte Klosterkirche. Es war ihm recht elend ums Herz; er, der 14jährige Knabe, allein unter lauter unbekannten Gesichtern, fühlte das, was man Heimweh nennt. Er dachte an die Mutter Gottes in der Totengruft in Großkirchen, auch hier sah es fast aus wie in einer Totengruft; Joseph betete recht ernstlich und klagte dem lieben Herrgott sein Leid.
Endlich stand er getröstet auf; er ließ sich im Kloster bei Schwester Ehrentraud aus Großkirchen melden; er wurde durch die dunklen Klostergänge geführt und endlich in ein düsteres, gewölbtes Zimmer hineingeschoben; da sollte er warten.
Ein großes, enges Eisengitter, mit einem grünen Vorhang dicht verhängt, teilte das Zimmer in zwei Hälften; in dem äußern Teile stand Joseph. In dieser düstern Abgeschlossenheit wurde ihm fast unheimlich zumute, fast kam er sich wie ein Gefangener vor.
Nein, dachte er sich, in diesem finsteren Gebäude möchte ich mich nicht durch mein ganzes Leben einmauern lassen; und eingemauert sind hier diese Nonnen für ihr ganzes Leben. – Aber dafür wissen sie von der ganzen üblen Welt nichts, und ihr Sprung von diesem freiwilligen Gefängnisse geht auch dann dafür in den Himmel; und dann können sie ihr ganzes Leben mit dem lieben Herrgott unter einem Dache wohnen. So überlegte bei sich Joseph, die schwarzen, altersgrauen Wände anschauend.
Da widerhallten in den langen Gängen Fußtritte, eine Türe knarrt in den Angeln, der grüne Vorhang an dem Eisengitter wird an einer Schnur angezogen, und zwei Nonnen erscheinen innerhalb des Gitters; eine winkt den Joseph zu sich heran, die andere setzt sich schweigend in einen großen Lehnstuhl; sie trägt ein goldenes Kreuz angehängt.
Der schwarze Anzug der Nonnen paßte zur traurigen Umgebung.
Ich bin Schwester Ehrentraud, sprach flüsternd die Nonne, welche den Joseph hinzugewunken hatte; jene dort ist meine ehrwürdige Äbtissin; was führt Euch zu mir?
Joseph: Nichts anders, als recht starke Grüße habe ich Ihnen auszurichten von Ihrer Schwester Wallburg in Großkirchen.
Nonne: Lebt sie noch? Ich habe lange von ihr nichts mehr gehört. Sie muß alt sein?
Joseph: Meeralt ist sie und lebt wie eine zähe Kröte mitten in Steinen, ihre Zunge jedoch geht noch prächtig, sie weiß immer etwas zu erzählen.
Nonne: Wieviel Kinderlein hat sie?
Joseph: Das wären mir schöne Kinderlein, das jüngste zählt schon 24 Jahre und ist einen Kopf höher als die Mutter; der älteste Sohn ist auch schon bald unter dem alten Eisen.
Ehrentraud: Ja, ja, so vergehen die Jahre; als ich von der Heimat weg ins Kloster ging, war meine Schwester noch ledig, und ich zählte 19 Jahre; jetzt aber stehe ich schon fast mit beiden Füßen im Grabe.
Joseph (etwas leiser): Was horcht denn die krumme Alte dort auf alle Worte, muß sie alles wissen?
Ehrentraud: Ich habe ja gesagt, daß sie die ehrwürdige Äbtissin ist, die muß alles wissen.
Joseph: Sogar, was wir von Großkirchen schwätzen?
Ehrentraud: Freilich! alles!
Joseph: Hätte ich doch nicht geglaubt, daß die Weibsbilder auch im Kloster noch so neugierig sind.
Ehrentraud gab nun dem Gespräche eine andere Wendung. Wie kommt denn Ihr nach Salzburg, fragte sie, was habt Ihr für ein Geschäft?
Joseph: Jetzt habe ich eigentlich gar keines. Einmal war ich Student, da hat mich ein böser Stern davongetragen, und zwei Jahre habe ich seitdem als Bauer geackert und geschunden. Das verdroß mich wieder, und so bin ich denn auf dem Wege zur Kaiserstadt, um Uhrmacher zu werden.
Ehrentraud: Ja, da braucht es, wie ich von den Weltkindern höre, Geld; habt Ihr solches?
Joseph: Freilich habe ich wenig oder keines, aber die Muttergottes in der Totengruft zu Großkirchen wird mir schon helfen, so hat die alte Mesnerin gesagt.
Ehrentraud: Hättet Ihr nicht mehr Lust zu studieren?
Joseph: Ich hätte sie wohl, aber ich bin für das Studieren schon verlesen, da ist Chrisam und Taufe verloren.
Ehrentraud: Und wie mir scheint, hättet Ihr Talent und gäbet einen prächtigen Frühmesser ab.
Wie Ehrentraud dies sagte, klopfte es an der Türe des Sprechzimmers, und herein trat ein Mann, ebenso schwarz gekleidet wie die Klosterfrauen.
Sogleich erhoben sich die zwei Nonnen und verbeugten sich in tiefster Ehrfurcht vor dem Ankömmling. Ehrentraud ließ den Joseph allein stehen.
Der schaut aus akkurat wie ein alter Ratsherr, denkt sich Joseph und macht in Gedanken seine Glossen.
Da kratzfüßeln und bücken sich die Nonnen vor diesem alten Mann, als ob er Bischof wäre; wer ist etwa dieser Mann, so brummte Joseph bei sich selbst.
Endlich kehrte die Schwester Ehrentraud zu Joseph und sagte: Gehet hin zu diesem Herrn und bittet um die Aufnahme ins Gymnasium, das ist der Studienpräfekt von hier. Ich habe schon die Sache bei ihm angebracht.
Studienpräfekt, wieder Studieren, das war dem Joseph wie ein Strahl vom Himmel, und er war so plötzlich, daß Joseph bald das Konzept verloren hätte.
Er ging nun hin zum Präfekten, der dem Benediktinerorden von St. Peter angehörte, und bat inständig um die Aufnahme ins Gymnasium.
Bist du wohl kein Lump? fragte der Pater.
Ich glaube nicht, sagte Joseph, ein bißchen einmal gewesen.
Hast du das Zeugnis bei dir, fragte der Präfekt weiter?
O ja, sagte Joseph und holte sich sein Zeugnis aus der ersten Klasse von der Tasche heraus, anderes hatte er keines.
Hm, brummte der Präfekt, als er das Zeugnis angesehen hatte. Ein bißchen Lump war er, das sagt das Zeugnis. Wo warst du die letzten zwei Jahre?
Zu Hause beim Vater in Großkirchen, antwortete Joseph.
Du wirst wohl alles Lateinische vergessen haben? lautete die weitere Frage. Nonne? (Nicht wahr?) setzte er hinzu.
Minime, (keineswegs) sagte Joseph auf gut lateinisch.
Schwester Ehrentraud, welche die lateinische Frage des Präfekten an Joseph nicht verstand und gemeint hatte, der Präfekt habe dem Joseph gesagt, er solle eine Nonne werden, wandte sich an den Präfekten und sagte in ihrer Einfalt: Eine Nonne wird der Landsmann doch nicht werden können, aber ein Studentlein, deswegen bitte ich für den Landsmann um Aufnahme.
Der Präfekt und Joseph fingen über den komischen Einwurf der einfältigen Laienschwester zu lächeln an.
Nun wir wollen probieren, sagte der in gute Laune versetzte Pater Präfekt, komme Er morgen um 12 Uhr mittags zu mir; so sprach er zu Joseph gewendet.
Und die beiden Klosterfrauen und Joseph dankten dem Pater Präfekten für seine Güte.
Ein Stein war dem Joseph vom Herzen, als er das Sprechzimmer verließ, er eilte hinab in die Klosterkirche, und dort vor einem Muttergottesbilde dankte er erst recht für das Glück, daß er nun wieder studieren könne; die alte Mesnerin hatte also recht, daß man die Totengruft-Muttergottes nicht umsonst anflehe. Kaum hat er seinen Fuß in die Stadt Salzburg gesetzt, ist er schon seinem heißersehnten Ziele nahe; die erste fremde Person, die ihm zugeführt wird, ist jene, die ihm die rettende Hand bieten kann, der Studienpräfekt, und dazu noch zwei kräftige Fürbitterinnen, die Klosterfrauen. Ist das Zufall? Nein, dachte Joseph, das ist eine andere milde, kräftige Hand, die das alles so schön zusammengeführt hat; o, ich kenne sie, das ist die Hand der Mutter Gottes. Danke dir, schöne Himmelsmutter. Ich werde dich dafür in der Vakanz täglich in der Großkircher Totengruft besuchen und wieder den Abendrosenkranz vorbeten.
Wie auf Flügeln eilte Joseph den Nonnsberg hinab, den Barnabas aufzusuchen, um ihm zu erzählen, daß er nun kein Exstudent, kein Uhrmacherlehrling mehr, sondern wirklicher Student sei.
Um 12 Uhr erschien Joseph beim Pater Präfekt, er wurde noch weiter examiniert, dann als Student zweiter Klasse eingeschrieben. Auch Barnabas erhielt nach langem Bitten die Aufnahme.
Nun wurde ein Quartier bestellt und sich ansässig gemacht.
Und Joseph hatte nicht alles vergessen, er wurde das erstemal im Latein unter 77 Schülern der 37., das zweitemal der 13., das drittemal schon der 5.
Der Präfekt sagte dann vom Fortgehen zu Joseph nichts mehr. Nur wenn Joseph später hier und da ein kleines Schelmstücklein ausführte, sagte der Präfekt dann immer: Hüte dich, du weißt schon, daß du mir ohnedies ein wenig verdächtig bist. Du hast dich eingeschmuggelt, ich weiß selbst nicht wie.
Student war nun Joseph, aber einen andern tüchtigen Haken hatte es; das Geld war zu Ende und von Luft kann der Student nicht leben; was blieb also dem Joseph übrig als das Herz guter Leute? Aber das Bettelgeschäft verstand nun Joseph nicht mehr, er hatte eine große Scheu, irgendwo in einem Hause einzusprechen; er war viel schüchterner geworden. Und Salzburg war ihm zu landfremd, es kam ihm vor, als wären ganz andere Leute wie in Tirol, Leute voll Komplimente und süßer Rede, doch ohne Herz. Joseph tat da zwar den guten Salzburgern gewaltig unrecht, er sah es auch später ein, aber er getraute sich einmal nicht, irgendwo anzuklopfen.
Da winkte ihm das Klösterlein auf dem Mönchsberge gar so freundlich herab, Joseph erinnerte sich, einmal gehört zu haben, daß Frater Gaudenz Portner in Salzburg geworden sei; diesen Frater Gaudenz kannte Joseph ganz gut. Er war sieben Jahre in Großkirchen gewesen, alle Großkircher hatten ihn gerne, denn immer lächelte er und gab niemand ein böses Wörtchen.
Ich will ihn aufsuchen, dachte Joseph, vielleicht weiß er in meiner Magenfrage einen Rat, wenigstens das Stück Brot der Armen wird er mir nicht verweigern.
Joseph steigt die Stufen des Klösterchens hinan, und zu seiner freudigen Überraschung öffnet Frater Gaudenz ihm die Klosterpforte.
Ah, der Joseph des Nuiterbauern, ruft erstaunt Frater Gaudenz, das freut mich, daß du mich besuchst. Wie kommst du daher?
Frater Gaudenz holte ein Krüglein Bier und ein großes Stück Hausbrot, das Joseph gierig verzehrte. Dabei erzählte er, wie und warum er nach Salzburg gekommen sei und wie schlecht es ihm jetzt ergehe.
Gehe zum Guardian, sagte Frater Gaudenz, und bitte ihn um die Kost, einen Tag wenigstens wird er dir geben; ich werde schon auch ein Wort einlegen.
Joseph ging dann zum Guardian und brachte seine Bitte vor.
Der Guardian, ein kleines, streng dreinsehendes Männchen, durchmusterte des Joseph vorgewiesenes Zeugnis, und als er den Sitteneinser und das veraltete Zeugnis sah, wurde sein Gesichtsausdruck noch strenger.
Ich habe sonst die Tiroler gerne, sagte der Guardian, bin selbst ein Tiroler, aber wie ich sehe, bist du ein Lump, ein Vagabund, und Vagabunden gebe ich nichts; damit punktum!
Bei diesen Worten war es, als hätte man dem Joseph zuerst Feuer, dann aber wieder kaltes Wasser ins Gesicht gegossen, er nahm stillschweigend sein Zeugnis, und kaum war er zur Zelle des Guardians heraus, fing er an, bitterlich zu weinen; mit Tränen übergossen kam er zu Frater Gaudenz.
Was hast du denn, ist's schlecht abgelaufen? fragte Frater Gaudenz.
Ja freilich, sagte Joseph. Der Guardian sagte, ich sei ein Lump, ein Vagabund, und Vagabunden gäbe er nichts. Nicht wahr, Frater Gaudenz, Vagabund bin ich keiner?
Frater Gaudenz: Nimm es dem Guardian nicht übel, er ist schon oft betrogen worden, es gibt hier viele Studenten, welche Vagabunden sind. Der Guardian ist sonst ein recht guter Mann; etwas rasch zwar, aber gleich wieder gut; du hättest nicht davonlaufen sollen.
Nun deswegen darfst du nicht gleich desperat werden. Verhungern lasse ich dich wenigstens nicht. Komm alle Tage um 12 Uhr hierher zur Armensuppe, ist freilich für einen Studenten etwas hart, unter die Armen sich so hineinzumengen, und ist die Suppe auch aus Fisolen, Erbsen, Bohnen und anderen Brocken zusammengesetzt, so schützt sie doch vor dem Verhungern; ein Stück Brot gebe ich dir allemal noch extra; das erlaubt mir als Frater die Ordensvorschrift, und erübrigen die andern Koststudenten etwas von ihrem Mittagstische, so sollst du es auch haben. Somit war Joseph wenigstens vor dem Verhungern gerettet.
Alle Tage nun fand er sich mittags mit reisenden Handwerksburschen, alten Weiblein, Krüppeln, Bettlern und Vagabunden an der Table d'hote zum roten Kreuz im Klösterlein ein und schöpfte sich mit einem hölzernen Löffel das warme Ding in den Magen hinab, welches man Suppe hieß, und den Magen verschloß ein Stück schwarzes Brot.
Was den Joseph am meisten verdroß, war die unsaubere Gesellschaft, welche leiblich und geistig arg verkommen war, und die Neckereien von seiten dieses Auswurfes der Menschheit, denn die Armut hat unter ihren Lumpen oft arge Bosheit versteckt. Auch wurde sein Rock immer aus Bosheit mit Suppe bekleckst, so daß Joseph oft beim Brunnen eine halbe Stunde die Flecken auszuwaschen hatte.
Doch auch die harten Zeiten vergehen, und so ging auch für Joseph das erste Semester vorüber, und er erhielt ein gutes Zeugnis; dafür erhielt er auch die Begünstigung vom Guardian, in dem Studentenstübchen separat essen zu dürfen; ja am Sonntage konnte er sogar mit den Studenten essen.
Daß Joseph von der unsauberen Gesellschaft fortkam, war ihm am liebsten.
Josephs erster Brief von Salzburg an seine Mutter lautete so:
Liebe Mutter!
Ihr werdet mich bereits in Wien vermuten, wie ich hinter dem Uhrmachertische hocke und an Rädchen putze und bürste; jedoch dem ist nicht so, ich bin in Salzburg stecken geblieben. Ich bin jetzt wieder Student. Das Ding ging so zu: Ich kam zu Salzburg hinauf in das Kloster Nonnsberg, um die Schwester der alten Wallburg zu besuchen. Da kam gerade der Präfekt daher, und die Klosterfrauen baten ihn um meine Aufnahme als Student, und da könnt Ihr Euch, teure Mutter, meine Freude denken, es ging, ich wurde aufgenommen.
Das hat die Totengruft-Muttergottes gemacht, das ist offenbar so; darum, liebe Mutter, müsset Ihr statt meiner in der Totengruft einen Besuch und den Dank abstatten und ihr sagen, ich lasse sie einstweilen recht schön grüßen, ich werde dann in der Vakanz schon selbst kommen, meine Schuldigkeit zu tun.
Mein Leben ist freilich ein bißchen bitter, denn mein Mittag ist eine schlechte Klostersuppe an der Pforte des guten Frater Gaudenz; aber dennoch geht es in der Schule gut.
Schauet, daß Ihr für mich das Quartiergeld von 16 Gulden für das halbe Jahr zusammenbringt und mir schicken könnet, damit ich ehrlich dastehe; wenn Ihr etwas hinzulegen könntet, so wird es mir willkommen sein; denn ich habe oft Hunger und keinen Kreuzer Geld, um ein Stückchen Brot zu kaufen, und mein Rock und die Stiefel fangen auch schon an, maßleidig zu werden und nach Hilfe zu schreien.
Saget dies dem Vater; nach dem ersten Semester werde ich ihm das Zeugnis schicken, damit er sieht, daß der Joseph denn doch etwas werden könne, obgleich er kein Stampfbube geworden ist. Vielleicht wird das Herz des Vaters wieder weicher und vergißt er seinen Vorsatz, mir keinen Vierer mehr zu geben. Danket mit mir Gott und betet für mich. Noch tausend Dank für alles Gute, liebe Mutter, lebet wohl und grüßet mir alle recht stark.
Euer Euch zärtlich liebender Sohn
Joseph.
Mit diesem Briefe kam eines schönen Tages der Postbote in das Haus des Nuiterbauern und sagte, 26 Kreuzer wären dafür zu bezahlen, der Brief käme weit her.
Mit welcher Neugierde und Angst Josephs Mutter über den Brief herfiel, kann man sich leicht vorstellen; als sie ihn öffnete, pochte ihr Herz mächtig.
Aus Salzburg, fragte sie sich, ist er vielleicht dort im Spitale, was wird sein, wohl kein Unglück? Und wie ihr Auge die Zeilen durchfliegt, da erheitert sich ihr Gesicht immer mehr. Gott sei Lob, rief sie, der Joseph ist gesund, ist in Salzburg, ist Student. – Gleich ziehe ich mich an und gehe hinab in die Totengruft, der Muttergottes zu danken. Seht, da steht es so geschrieben!
Der Nuiterbauer, der eben auf der Ofenbank liegend, sein Mittagspfeifchen schmauchte, tat gar nicht, als ob der angekommene Brief seine Neugierde erregt hätte, er rührte sich nicht von der Stelle; dennoch beobachtete er genau den Eindruck, den das Lesen des Briefes auf sein Weib machen würde, und als diese die obigen Worte ausrief, da richtete auch er sich auf und sagte:
Ei, Weib, sei nicht so töricht und glaube diese Sachen, schreiben kann man, was man will, und ich glaube es in Ewigkeit nicht, daß Joseph Student ist; er wird halt Geld brauchen und durch diesen Kniff uns in den Sack steigen wollen. Ich schicke nichts.
Ungläubiger Thomas, sagte die Nuiterbäurin, schreibt er ja, daß er dir das Zeugnis schicken werde. Für so schlecht halte ich meine Buben nicht, daß sie lügen!
Nuiterbauer: Bevor ich es nicht schwarz auf weiß habe, glaube ich es nicht, das Zeugnis muß kommen, dann gehe ich erst zum Dekan und laß mir das lateinische Ding gehörig explizieren; denn auch mit dem Zeugnisse könnte er mir ein X für ein U vormachen, da ich nicht lateinisch verstehe.
Und wirklich ließ sich der Nuiterbauer nicht bewegen, dem Joseph auch nur einen Kreuzer zu schicken, er glaubte nicht; es mußte daher die Mutter suchen, für Joseph ein Geld aufzubringen, das ihm sofort geschickt wurde.
Das Mißtrauen des Vaters verdroß den Joseph nicht wenig, und kaum hatte er das Zeugnis vom ersten Semester in der Hand, so wanderte es mittels Post nach Großkirchen.
Erst als der Dekan dem Nuiterbauer versichert hatte, daß das Zeugnis gut und in bester Ordnung ausgestellt sei, glaubte endlich auch er, und nun tat sich seine Hand auch wieder für Joseph auf, so gut sie es konnte.
Als die Vakanz wieder da war, kehrten von der Fremde drei brave Studenten in das Nuiterhaus ein, und nichts fehlte mehr dort, was die Nuiterfamilie für jetzt hätte noch glücklicher machen können.
