
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
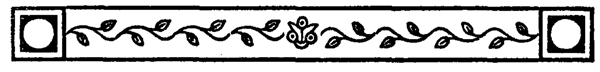
Im dritten Studienjahre des Alois und zweiten des Joseph wanderten vom Nuiterhause die Studenten, drei Mann hoch, aus; denn nun kam auch der Kanarienvogel Hans dazu (so nannten die Brüder den Hans). Ihn verloren die Großkircher sehr ungerne, denn wer sollte jetzt seine Diskantsolos in der Pfarrkirche herabsingen, die andern Sänger hatten ja Stimmchen so schwach und zart, daß es in einer so großen Kirche nur ein Mäusepfeifen hieß. Hans' helle, reine, starke Stimme aber klingelte die Töne in die weiten geräumigen Hallen hinaus, als ob ein Silberglöcklein geläutet würde, bald forte bald piano, und es drang hinab tief in aller Herzen und durchfuhr alle Nerven so süß und wonnig, daß man glaubte, in himmlischen Räumen zu schweben. Und wer wird nun bei den »guldigen« Ämtern vor Weihnachten bei den Hirtenliedern die Stimme der Mutter Gottes übernehmen? O wie rührend war es, als er mit dem Bariton, der den hl. Joseph machte, zu Bethlehem um Herberge bat. Welch herrliches Duett:
Ach habet Erbarmen
Mit Fremden, Armen,
Ein Plätzchen klein
Fürs Knäbelein!
Als die drei an das bekannte Talerplätzchen kamen, hatte der Kanarienvogel den schwersten Beutel. Das gestrickte Beutelchen war mit Zwanzigern gespickt; die Großkircher hatten es gefüllt, als Hans zu ihnen Abschied zu nehmen gekommen war. Zudem war Hans ein Sparetanus erster Klasse; er verstand es, die Pfennige zu klieben, so sagt man in Großkirchen von jenen, die im Geldausgeben zäh sind.
Wegen der Kosttage tat sich in Innsbruck der Kanarienvogel noch leichter als selbst Joseph. Des Hans sanfte Stimme und manierliches Wesen bestach.
Als er erst gar einmal in der Servitenkirche und der Pfarrei ein Solo herabgeklingelt hatte, da bekam er bei den PP. Serviten die ganze Kost, und diese war herrlich.
In der Pfarre gab es aber allmonatlich Geld; der Herr Chorregent konnte den Hans besonders gut leiden und verwendete ihn überall, wo es Geld gab.
Das Studium gab dem Kanarienvogel auch nicht viel zu schaffen, er studierte spielend und tat sich nicht zu weh, und doch kam er ordentlich fort.
Das Sonderbare bei den drei Studentenbrüdern war, daß der Kanarienvogel nicht mit den zwei ältern tat, er hatte sein eigenes Quartier und seinen eigenen Säckel, er wußte schon warum.
Die andern hätten ihn gewiß immer um Geld angepumpt, da ihr Beutel fortwährend die Schwindsucht hatte, auf ein Wiedergeben hätte der Kanarienvogel warten können; doch was er tat, war dieses, daß er so manches Überbleibsel von dem Mittagessen, das die Sänger unter sich austeilen konnten, den Brüdern brachte; aber Geld bekamen sie keinen Knopf.
Ein Ereignis brachte das Studium des Joseph ins Stocken. Es war im Spätherbste, wo die Soldaten in der Umgebung Innsbrucks immer große Manöver hielten, da erwachte auch in Joseph die Schießlust.
Joseph hatte einen Freund, den Sohn eines Doktors, der zwar nicht viel Talent, aber mehr Geld im Sacke hatte als Joseph. Des Doktors Söhnlein war an Joseph sehr anhängig, weil er ihm manchmal die Aufgaben machen half und sogar in der Schule ihm mittels geheimer Telegraphie manche Auskunft gab.
Die zwei verabredeten sich nun, auch ein großes Manöver ausführen zu wollen. Der junge Doktor kaufte ein Pfund Sprengpulver; als Kanone wurde eine s. v. Klistierspritze des Vaters hergenommen, ein Zündloch wurde hineingebohrt und etwas von ihrer Länge abgenommen; es gab eine herrliche Kanone ab.
Man ging auf die Wiltauer Felder hinaus, um das Ding zu probieren. Joseph machte den Lader und Feuerwerker, der Doktor kommandierte allemal »Feuer«, so stark er konnte.
Das Feuer gehorchte freilich nicht augenblicklich, denn statt der Lunte legten sie brennenden Zunder auf das Zündloch. Die Kanone knallte tüchtig, wenn sie auch nicht gezogen und aus der Berliner Kanonengießerei war.
Endlich hatten sie das Schießen satt, das Ding ging ihnen zu langsam. Man wollte das noch vorrätige Pulver sonst verpuffen; es war noch mehr als die Hälfte.
Da wurde zuerst ein kleiner Speiteufel gemacht; lange brauchte es, bis er abbrannte; der Doktor hatte zur Erhöhung des Vergnügens noch Papier darauf gelegt, damit der Spuk um so ärger würde.
Nun war auch der Speiteufel ausgebrannt, das Papier glühte noch.
Wie wäre es, sagte der Doktor, wenn ich nun das ganze Pulver auf das brennende Papier schüttete?
Wie wäre es, sagte Joseph, wir hätten dann den ganzen Plunder im Gesichte.
Joseph bückte sich und wollte eben das brennende Papier auslöschen, damit etwa der junge Doktor nicht seinen dummen Streich ausführe.
Und während Joseph das brennende Papier in der Hand hielt, schüttete der Doktor das Pulver darüber hinab.
Putsch, machte es, und im Augenblicke sind beide in ein Feuer- und Rauchmeer gehüllt, beide brennen lichterloh und haben nun vollauf zu tun, den Brand am Leibe zu löschen. Rock, Gilet und Kappe werden schnell weggeworfen, man zerstampft die Flamme mit den Füßen und eilt dann zu einem Brunnen, der zum Glück nicht weit von der Putschstätte entfernt war.
Im ersten Schrecken hatte jeder nur an sich gedacht.
Als nun der Brand gelöscht war, standen die zwei voreinander da und fingen an, sich zu beaugapfeln.
Ha, lachte der Doktor, du schaust aus wie ein Mohr so schwarz, und deine Haare und Augenbrauen sind mit Putzen und Stängel weggesengt.
Meinst etwa du, sagte Joseph, du habest etwa noch dein Milchgesicht? Du siehst auch aus wie ein Kohlenbrenner; bist aber du ein Gimpel, da hast du es, habe ich es nicht vorher gesagt.
Geschehen ist geschehen, sagte der Doktor, ich hätte nicht geglaubt, daß das Pulver so schnell zünde, der Speiteufel wollte gar nicht losgehen, und hier ging es so leicht.
Waschen wir uns ab! sprach Joseph, so können wir nicht nach Hause gehen.
Sie rieben ihr Angesicht mit Wasser tüchtig ab, aber sie blieben dennoch schwarz wie ehevor. Sie suchten nun ihre verbrannten Kleider zusammen, um nach Hause gehen zu können.
Was sagen wir nun zu Hause? fragte Joseph den Doktor. Wegen meinen Eltern ist es mir so ziemlich einerlei, aber dein Vater ist ein strenger Mann, er wird dich ins Examen nehmen.
Der Doktor war in der Lügenschule besser bewandert als Joseph, er hatte sich schon oft herausgelogen, denn der Stock tut weh, das wußte Joseph auch.
Der Doktor sprach nach kurzem Bedenken: Jetzt habe ich es. Wir sagen, wir seien mitsammen spazieren gegangen, da wären auf dem Felde zwei Kotlackler Buben gewesen, sie seien vor uns davongelaufen; auf einmal sei vor uns Pulver aufgeflogen, das hätten die Kotlackler Buben, welche die Studenten hassen, uns gelegt.
Gut ausgedacht ist's, sagte Joseph, aber nicht wahr, und nimmt mich dann dein Vater ins Examen und soll ich dieses sagen, so werde ich rot und fange zu stottern an, und am Ende kommt die Wahrheit halt doch an den Tag.
Aber, sagte der Doktor, bist du ein Esel! So mußt du sagen, und damit Punktum, und tust du es nicht, so sind wir geschiedene Leute.
Es war halb 4 Uhr abends, als sie den Innrain hereingingen; immer hatten sie wegen ihren Mohrengesichtern zu lachen. Doch auf einmal geht die Musik bei dem Doktor aus einem andern Tone: er fing jämmerlich zu heulen an.
Was hast denn, fragte Joseph.
Es brennt mich fürchterlich in den Händen und dem Gesichte.
Und ich sehe fast nichts mehr, sagte Joseph, und doch kann es noch nicht Nacht sein.
Der Doktor war bei seines Vaters Wohnung und fiel ab, Joseph hatte noch eine Strecke weit zu gehen. Mit genauer Not fand er noch seine Wohnung, so finster kam es ihm vor. Auch bei ihm begann das schmerzliche Brennen.
Ach, Mutter Gottes, wie schaust denn du aus! jammerte Trude, als Joseph so zugerichtet daherkam.
Joseph legte sich zu Bette; er wurde endlich ganz blind.
Da kam der alte Doktor und nahm den Joseph ins Examen. Joseph weinte und gestand alles haarklein.
Mit diesem Burschen ist es desperat, meinte der Doktor, er wird blind bleiben, das Augenlicht ist kaput, ja wahrscheinlich wird er ins Gras beißen müssen!
Ins Gras beißen, blind bleiben? wiederholte sich Joseph. Ach, mein Gott, das wohl etwa nicht, verwünschtes Pulver, verwünschte Klistierspritze.
Des Doktors verschriebenes Öl half wenig, mit Joseph wurde es immer schlechter.
Du mußt beichten, sagte Trude zu Joseph, es heißt einrücken, Bürschlein, und du bist schlimm gewesen, hast mir nie gefolgt, und ich meinte es so gut mir dir, ich werde dir den Kooperator holen, den Frey, er hat schon vielen die Eisen abgerissen, er versteht das Ding. Du mußt aber auch ihm sagen, daß du mich Trude geheißen.
Beichten, sterben, die Eisen abreißen? fragte Joseph weinerlich. Nein, nein, beichten tue ich nicht, sonst muß ich sterben.
Also nicht beichten! rief Trude erstaunt und erschreckt aus, willst du also ungebeichtet sterben und in die Hölle fahren, verstockter junger Mensch?
Joseph: Ich fahre nicht in die Hölle und ich will nicht sterben, ich will nicht; ich bin noch so jung und sollte sterben; das geht nicht, es kann nicht gehen!
Trude: Es geht, ich sage es dir, es geht, beichte!
Joseph: Aber ums Himmels willen, was soll ich beichten! Ich war ja erst am Sonntage zur Beichte und habe dem Kapuziner alles gesagt, haarklein, sogar, daß ich die Trude erzürnt und geneckt habe. Und seitdem habe ich Sie, Fräulein Gertrud, gewiß nicht mehr geneckt, oder können Sie das sagen? Und daß ich mich mit Pulver verbrannte, war gewiß nicht mein Wille, und zu einer Sünde gehört die freie Einwilligung, so sagt der Katechismus, eingewilligt habe ich nicht, und dem Doktor habe ich auch die Wahrheit gesagt.
O du verstockter Bube, jammerte Trude, erzverstockt bist du. Was ist nun anzufangen? Beichten will er nicht, also muß ich doch schauen, ihn zu retten.
Der Doktor ist aber auch ein Esel, versteht von der edlen Heilkunst gar nichts; verschreibt er ihm Öl, bloßes Baumöl, so viel hätte eine alte Köchin auch gewußt.
Ja, die alten guten Zeiten kehren nimmer, wo man statt zu den studierten Herren zu erfahrenen, alten Leuten ging und um Hausmittel fragte.
Ich weiß, was ich tue. Ich kenne einen alten Apotheker, zu ihm will ich gehen, er weiß gewiß ein Mittel; er hat schon vielen geholfen.
Und wirklich kehrte Trude nach einer Stunde mit einer Salbe zurück und bepflasterte des Joseph ganzes Gesicht damit.
Joseph hätte gerne das Pflaster zu den vier Winden gewünscht, denn es zog anfangs entsetzlich, so daß es ihn laut wimmern machte; aber Trude hatte strenge verboten, es zu lüften, sonst werde er ohne Pardon sterben. Joseph mußte das Pflaster die ganze Nacht sitzen lassen. O, wie war ihm diese Nacht entsetzlich lange. Er sah schon den dürrknochigen Tod zur Türe hereinlugen und sah hinab in die Flammen der Hölle, und doch war es stockfinster.
In der Frühe nahm Trude das Pflaster ab, und ihre Brille aufsetzend schaute sie das wunde Gesicht Josephs an.
Gut, sehr gut, sagte sie, das Fleisch schaut schön her, nichts Wildes ist mehr daran. Es ist Hoffnung!
Wie süß klangen dem Joseph diese Worte der Alten, er hätte ihr gerne dafür die Hände küssen mögen; Trude schien jetzt eine goldene Trude, ein Engel vom Himmel zu sein.
Vierzehn Tage war nun Joseph dagelegen, die Wunden begannen zu vernarben; aber über seinen Augen schwebte noch immer ägyptische Finsternis. Das wird wohl so bleiben, und er wird die schöne Welt nicht mehr sehen, er wird ein unglücklicher Blinder bleiben! Welche Last für ihn und andere! Doch lebte er noch, und Leben ist doch besser als Sterben!
Es war am fünfzehnten Tage nachmittags, da meinte Joseph, zwei lichtere Stellen zu sehen, die immer am nämlichen Platze blieben; nur wenn jemand im Zimmer auf und ab ging, trat vor diese etwas Dunkles. Die lichten Stellen waren offenbar die Fenster. Also alles Augenlicht hatte Joseph dennoch nicht verloren; das Auge mußte noch Leben haben, vielleicht fällt noch von ihm der dunkle Schleier.
Am sechzehnten Tage in der Frühe wusch sich Joseph mit frischem Wasser die Schuppen aus den Augen; die lichten Stellen waren viel lichter, er sieht die deutlichen Umrisse der Fenster. Joseph strengte seine Augennerven noch mehr an, jetzt erkennt er das ihm gegenüberliegende Bild der Mutter Gottes, die er in seinem Unglücke so oft und dringend um Hilfe angerufen hatte; jetzt erkennt er seinen Studiertisch, sieht seine Bücher, und nach und nach tritt alles deutlicher hervor. Fräulein Gertrud! Fräulein Gertrud! rief Joseph aus vollem Halse.
Trude meinte, Joseph sei etwa gar am Sterben, weil er ein solches Geschrei erhebe, sie eilte herbei. Um Gotteswillen, was ist geschehen? rief sie; brauchst du einen Geistlichen, den Doktor?
O ich sehe wieder, Fräulein Gertrud, ich sehe! Gott und seiner lieben Mutter, der heiligen Jungfrau Maria, sei tausendmal Dank gesagt! Welche Freude, welche Wonne, welches Glück, wieder zu sehen!
Jawohl, sagte Trude, hat die Mutter Gottes dir geholfen, die Pfarrmuttergottes; das ist ja ihr Bild, das du an der Wand siehst. Ja, sie ist der beste Doktor, ich habe sie aber auch für dich viel tribuliert; du kannst dann selbst zu ihr in die Pfarre hinabgehen und ihr danken.
Aber strenge deine Augen zuerst nicht zu viel an, es könnte dir schaden; ich werde noch die heilsame Salbe aufzulegen fortfahren, sie kräftigt die Nerven und zieht die bösen Säfte ab.
Und nolens volens mußte Joseph seine Augen sich wieder verpappen lassen, und er hätte doch so gerne das schöne Tageslicht gesehen, dessen er so lange entbehrte.
Dieser Tag war für Joseph ein Jubeltag, in einem fort schwätzte er. Und Trude kochte ihm zu Mittag gar köstliche Butterknödelein. Joseph wollte nun selbst essen, früher hatte ihm immer Trude das Essen mit dem Löffel in den Mund gegeben wie einem kleinen Kinde. Joseph war voll Appetit und aß alle Knödelein samt der Suppe aus der Schüssel. So gut hatte es ihm lange nicht mehr geschmeckt; er durfte nun hoffen, wieder vollkommen das Augenlicht zu erhalten.
Als Joseph die Butterknödelein verzehrte, kam ihm vor, daß er manchmal auf etwas geriet, was einen sonderbaren Geschmack hatte, Leber oder Fleisch war es nicht, Speck auch nicht. Er schlang es mit den Knödelchen hinunter, und was bekümmerte ihn das, was es war. Es waren Fliegen, welche der alten Trude in die Schüssel hineingeflogen waren, ohne daß sie es gemerkt hatte.
Alois, welcher gerade zu Hause war, hatte es wohl gesehen, wie der blinde Joseph voll Appetit die Fliegen hinunterschluckte, aber weil der Mensch gerne boshaft ist, so war es auch Alois und sagte nichts, wohl aber, als des Topfes Inhalt von Joseph geleert war. Das konnte Joseph seinem Bruder fast gar nicht verzeihen; er war ihm nun aufsässig und Alois ihm.
Fünf Wochen war Joseph zu Hause geblieben, endlich war er vollkommen geheilt, er sah wie ehedem, aber in seinem Gesichte hatte er eine ganz neue zarte Haut bekommen.
Natürlich war Joseph im Studieren zurückgeblieben, und er durfte auch nicht seine Augen zu sehr anstrengen; er schlug sich jedoch in den Studien leidlich durch.
Der Dank bei der Pfarrmuttergottes wurde richtig abgestattet; Joseph blickte mit seinen geheilten Augen voll Liebe zu der Helferin der Christen auf.
Der Nikolaustag kam und mit ihm eine neue Neckerei des Alois.
Alois hatte dem Instruktor eine Rute mit goldenen Äpfeln eingelegt, sie sollte für den Joseph bestimmt sein. Das verdroß den Joseph gewaltig, um so mehr, da er seit dem Schießputsche um vieles empfindlicher geworden war. Was den Joseph noch mehr ärgerte, war, daß Alois statt zu ihm zu dem Instruktor half und immer alles schergte.
Joseph hatte einmal von dem Instruktor Hausarrest bekommen, weil er mehr Fehler in der Aufgabe hatte, als er hätte machen dürfen. Waren über zwei Fehler, so gab es immer eine Strafe. Und doch ist das Böckemachen eine Sache, die einem Studenten so leicht, ja oft bei dem besten Willen passieren kann.
Da Joseph meinte, sein Bestes getan zu haben, so hielt er die Strafe für ungerecht, und da noch dazu auf dem Berg Isel eine gar so gute Schlittenbahn war, so konnte Joseph sich unmöglich entschließen, das langweilige Zimmer zu hüten, das er fünf lange Wochen gehütet hatte.
Er ging hinauf zur Schlittenbahn. Abends wußte der Instruktor schon diesen Bannbruch. Da lautete die weitere Strafe: sechsmal das Argument schriftlich analysieren, und wo nicht, die Strafe mit der Nikolausrute des Alois.
Als der Instruktor des Alois Rute nannte, stieg dem Joseph der Ärger auf; er beschloß, das Analysieren stehen zu lassen, denn die Analyse hätte ihn fast die ganze Nacht gekostet.
Um 9 Uhr ging Joseph schlafen; er rührte keine Feder an.
Joseph, sagte Alois, was tust du? Machst du keine Analyse?
Nein, war die feste Antwort des Joseph; du hättest sie für deine brüderliche Liebe verdient. Weiter ließ sich Joseph in den Diskurs nicht ein, er wollte Ruhe haben.
Am andern Tage um 6 Uhr früh kam der kleine untersetzte Instruktor. Joseph war soeben aus dem Bette gekrochen.
Die Analyse, fragte barsch der Instruktor, ist sie fertig?
Nein, sprach Joseph, ich schlief; einer ungerechten Strafe unterziehe ich mich nicht.
Nun wohlan denn, die Rute, sprach der Magister; er hielt sie schon unter dem Rocke bereit, sie sollte auf Josephs Schädel und Rücken tanzen.
Einen Studenten schlägt man nicht, sagte Joseph, in seiner Würde beleidigt; Wissenschaft und Rute vertragen sich schlecht.
Doch Josephs Räsonieren ließ der Magister nicht gelten, er wollte auf Joseph einhauen. Joseph ergriff in Wut versetzt die Rute und riß sie auseinander; da nahm der Magister seine Fäuste und arbeitete den Joseph zu Boden, und als der dicke Koloß auf Joseph lag und mit seinen Fäusten wacker auf ihn hämmerte, wurde es dem Joseph gar zu arg, sein Geduld- und Respektfaden zerriß, und er biß seinem Meister in die Waden, so daß dieser schnell abließ und nach seinen Waden griff. Joseph hatte nun Luft.
Schurke, sagte der Magister, du hast mich gebissen wie ein Hund.
Wie konnte ich anders, erwiderte Joseph, Sie hätten mich ja beinahe erwürgt, erdrückt und zu Tode geschlagen und behandelt wie einen Hund, was bleibt dem armen Hündlein anders übrig, als zu wehren und zu beißen.
Daß dieses zu grob gewesen sei, sah der Magister wohl auch ein, aber der Zorn hatte ihn übernommen, darum leitete er bei Joseph ein.
Setze dich jetzt her zur Instruktion, sagte er ziemlich ruhig.
Nein Herr, erwiderte Joseph, nun habe ich es satt an euch zwei Alliierten. Ich trete von dem beständigen Kriegsschauplatze ab; gegen zwei vermag ich nichts.
Instruktor: Willst du dich nicht hersetzen?
Joseph (resolut): Nein! Schläge halte ich doch noch lieber von meinem Vater aus, und wenn es sich um das Erwürgen handelt, sterbe ich doch lieber in meiner Heimat.
Instruktor: Gut, dann magst du dir die bösen Folgen selbst zuschreiben. Die Aufgabe ist nicht korrigiert, und ohne Korrektum von mir wird der Professor sie nicht annehmen.
Joseph: Ist mir gleichviel.
Als der Professor die Hausaufgaben vom Donnerstag einsammelte, sah er Josephs Aufgabe ohne Korrektum des Instruktors.
Professor: Warum ist die Aufgabe nicht korrigiert?
Joseph: Weil ich den Instruktor nicht mehr mag und er mich auch nicht.
Professor: Warum?
Joseph: Ja warum? Der Instruktor hat geglaubt, ich sei ein Ochse und hat mich wie einen Ochsen zu Boden geworfen und derb abgeprügelt. Ich war dem Ersticken nahe, da er mit seiner ganzen Schwere auf mir lag. Ich wußte mir nicht zu helfen, und so habe ich ihn mit meinen Zähnen in die Waden gezwickt, bis er mich ausließ. Das ist die Ursache unseres Haders.
Als vom Wadenzwicken die Rede ging, brach wieder das Gelächter los; auch Joseph lachte. Da selbst Joseph lachte, wurde der Professor zornig und sagte:
Nicht einmal eine Reue zeigt der Bursche, der Instruktor soll um 11 Uhr zu mir kommen.
Diesen Vormittag war Joseph zum letztenmal im Gymnasium gewesen. Er fürchtete die Strafe des Herrn Professors. Der Instruktor, Alois und das Krankenlager hatten ihm das Studieren vollends verleidet. Durch kein Zureden des Instruktors und des Alois war er mehr zur Rückkehr zu bewegen, obgleich ihm der Instruktor Straflosigkeit erwirkt und die Schuld auf sich gewälzt hatte.
Es mußte dem Nuiterbauer geschrieben werden, daß er den Joseph abhole.
Am Thomastage um 12 Uhr mittags wanderte Joseph mit seinem Vater nach so kurzer Studienlaufbahn zur Stadt Innsbruck hinaus; alle Glorie der Studien hatte ein Ende.
Dichte Schneeflocken fielen vom düsteren Himmel, so düster und traurig schaute es auch in Josephs Herzen aus; er wanderte schweigend neben seinem Vater hin, der auch tief gebeugt war und keine Silbe sprach; des Vaters schönste Hoffnungen waren mit einem Schlage vernichtet.
In Zirl in der Post wurde zum letztenmal eingekehrt und Mittag gehalten. Joseph rührte keinen Bissen und keinen Tropfen an; es ging dann wieder im Schneegestöber weiter.
Eben schlug es in der Pfarrkirche zu Großkirchen 4 Uhr früh, da trat Joseph mit seinem Vater in seine Heimat.
Nun begann für Joseph eine Zeit der Marter. Die schwersten Bauernarbeiten mußte er verrichten, und wie immer er es auch anstellte, war bei dem Vater doch alles nicht recht.
Ja, ja, sagte dann der Nuiterbauer, der Herr ist zu zart, zu schwächlich, der erstickte Student ist zu nichts zu brauchen, verdient sich kaum das Essen, das Gewandl schon gar nicht.
Die schlechtesten und härtesten Arbeiten trafen immer den Joseph, und er durfte auch nicht den Mund zur Klage öffnen, sonst hieß es gleich: »Selbst ton, Schadenhohn«. Hättest können bequem in der Stube hocken und den Herrn spielen, hättest von Nässe, Kälte, Hitze und Schweiß nichts verspürt, Studentlein ziehe, ziehe, trage, spute dich!
Doch eine Seele hatte mit Joseph inniges Mitleid; eine Seele, welche ihre Kinder alle gerne hat, es war dies die Mutter. Sie tröstete immer Joseph, und in ihre Seele schüttete er seine geheimen Leiden aus.
Noch ein großes Kreuz kam über den Nuiterbauer. Hans schrieb ihm, daß auch der Alois nicht parieren wolle, er sei in liederliche Kameradschaft geraten, studiere nichts, rauche Tabak und gehe ins Wirtshaus. Ja sogar jene 8 Gulden, die ihm der Vater zum Ankaufe des notwendigen lateinischen Lexikons geschickt habe, seien in Rauch und Bier aufgegangen. Alois habe schlechte Noten, ja vielleicht gar den Abschied vom Gymnasium zu fürchten. Und Joseph hatte nun den Unmut des Vaters doppelt zu fühlen.
Daß solche Dinge dem Nuiterbauer ins Herz griffen, kann man sich denken; auch dem Joseph tat es weh, seinen Vater so betrübt zu sehen, er hätte jetzt ganz anders getan, aber für ihn war seine Reue zu spät. Er schrieb dem Alois im Namen der Mutter einen rührenden Brief, er solle es doch ihm nicht nachmachen, der Vater würde sich zu Tode kränken; aber auch für Alois war es zu spät, das zweite Semester war geschlossen, er kam nach Hause mit zwei zweiten Klassen, Sitten Einser und Fleiß minder, man gab ihm die Weisung, daß er als armer Student nicht mehr ans Gymnasium zurückkehren könne, was man auf lateinisch das Consilium abeundi heißt.
Der Nuiterbauer hatte also zwei Exstudenten; nur der Kanarienvogel hatte brav gesungen und sein lateinisches Liedchen auf schöne Noten gesetzt. Er war allein noch der Trost des Vaters und die Hoffnung der Mutter.
Alois mußte nun auch wie Joseph statt des Rockes die Bauernjacke anziehen, seine glatt gescheitelten Haare mußten unter der unbarmherzigen Scheers des Vaters weichen, es wurde ihm statt des Spazierstockes die Mistgabel in die Hand gegeben, und niemand in Großkirchen hätte die zwei einstigen Studenten mehr erkannt, nur spottweise nannte man sie noch Studenten, und die liederlichen Studenten des Nuiterbauern waren lange in aller Mund zu Großkirchen. Weder Joseph noch Alois ließen sich bei dem Dechant mehr sehen. Nur der Kanarienvogel ließ in der Vakanz wieder, zur Freude aller von Großkirchen, in der Pfarrkirche sein altes Liedchen hören, und seine Stimme war noch viel schöner geworden. Wenn Hans in der Kirche sang, zerfloß die Mutter in Tränen. Die Mutter hatte also ihr Schmalz nur für den Kanarienvogel aufgespart, er bekam die fetten Brocken, und Joseph und Alois mußten sich den Mund abwischen und zusehen. Hans allein ging das nächste Jahr wieder zu den Studien.
