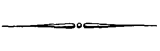|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
»Im Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion«, so hieß das schöne Lied, das man in Berlin auf allen Straßen hörte, dessen tiefe Bedeutung mir erst klar werden sollte, als uns Regierungs-Baumeister Solf einlud, ein soeben für Friedrich Dernburg von ihm vollendetes Landhaus im Grunewald zu besichtigen. Ohne daß wir ahnten, was sich hier in aller Stille entwickelt hatte, sahen wir staunend den Grunewald, den ich früher so oft zu Fuß durchwanderte, plötzlich für Koloniezwecke nutzbar gemacht, in Bauparzellen und Straßen eingeteilt. Hier also spielte sich die Grunewalder Holzauktion ab! So schnell fanden wir Gefallen an dem noch ganz idyllischen Platz, dem hohen Waldbestand, daß es nur der Frage: ob noch Bauplätze unverkauft, und der bejahenden Antwort Solfs bedurfte, um mir zwei Parzellen zu sichern, die ich am nächsten Mittag bereits mein Eigen nannte. Und ebenso schnell, als der Kauf abgeschlossen ward, zeichnete Solf die Pläne zu unserem Landhaus, die er uns ein paar Tage später in den Zug warf, der uns nach Bremen entführte zu erneuter Ozeanfahrt. Noch war nichts abgesprochen, und schon sollten wir 1890 im Oktober einziehen – wie Solf versicherte. Davon war natürlich keine Rede, denn welcher Eigentümer wäre jemals rechtzeitig in sein Haus gezogen?
Ein furchtbarer Sturm im Kanal hielt uns bis Southampton 9 Stunden zurück, ein Sturm, der uns, wie der Kapitän meinte, draußen noch viel schlimmer zugesetzt haben würde. Die Ruhe vor Southampton tat uns wohl, man erholte sich ein wenig und hoffte, das Schlimmste überstanden zu haben. Aber kaum waren wir vor den Needles, als der Sturm mit doppelter Gewalt aufs neue losbrach und bis an die amerikanische Küste standhielt. Der englische Lotse, der an den Needles das Schiff wieder verlassen sollte, konnte nicht abgesetzt werden; er mußte mit nach New York, weinte wie ein Kind und benahm sich wie ein elender Schwächling. Diese Fahrt dauerte volle zehn Tage. Ein Bekannter meines Mannes, H. v. St., der zur Botschaft nach Washington ging, gesellte sich zu uns. (In Washington, der schönen weiten Gartenstadt mit ihrem milden Klima, hatte mich unser liebenswürdiger Botschafter, Freiherr von Thielmann, und seine liebe Gattin, dem allgemein verehrten Präsidenten Cleveland im Weißen Hause zugeführt, einem Mann, dem ich noch oft begegnete.) H. v. St., mein Mann und ich lagerten fast während der ganzen Reise im kleinen Rauchzimmer auf Deck und nährten uns vegetarisch von Früchten und Hafersuppe. Dort hatten wir Luft, auch wenn ich die ewigen weißgekrönten Wellenberge gar nicht mehr zu sehen verlangte. Diesmal waren wir zufällig Augenzeugen als man nachts eine arme Verstorbene ins Meer versenkte. Sturm und hoher Seegang begleiteten das schreckliche Schauspiel, das traurige Finale eines Menschenlebens.
Das Gefühl der Benommenheit, des Unbehagens, wird man, auch ohne seekrank zu sein, auf den schlechten Überfahrten nicht los, die wahrlich nichts vom Vergnügen, das sich viele darunter vorstellen mögen, an sich haben und auch der Gesundheit nicht zuträglich sein können. Am schlechtesten vertrug ich das lange Nichtstun; ich flickte »Flaggen«, eine Beschäftigung, die ich den Steuermännern gerne abnahm, sonst fand sich wenig Tätigkeit für mich; die überschüssige Kraft durfte ich in Southampton, auf meine dringende Bitte hin, als Briefträger in den Dienst des Schiffes stellen, indem ich die Postbeutel heraustragen half. – Auf dieser Lahnfahrt gab es nicht einmal ein Konzert, auf einer anderen wieder ein recht wackliges. Unter den Mitwirkenden, die sich beim starken Rollen des Schiffes ans Klavier oder einen festgeschraubten Stuhl anklammern mußten, befanden sich Teresa Carreño, mein ausgezeichneter Freund, Prof. Reinhold Hermann, mein langjähriger Begleiter der Liederabende und Konzerttourneen hüben und drüben, meine Schwester und ich. Die liebe Teresa Carreño lag neben uns in der Kabine immer seekrank, immer seelenvergnügt. Wenn wir abends an ihrem Lager saßen, lachten wir uns krank über die drolligsten Geschichten aus ihrer Opern-, Kapellmeister- und Impresariokarriere, die sie zum besten gab. Ein junger riesengroßer Kanadier, den wir nur unter dem Namen »Boy« kannten, war das Schreckgespenst des ganzen Schiffes. Er fiel die Treppen ebensogut hinauf als hinunter; ging außerhalb der Schiffsgeländer spazieren, rutschte die Geländer entlang, verschwand – man hätte darauf schwören können – im Ozean und kam auf der anderen Schiffsseite plötzlich wieder; man erschrak, wo man ging, stand und hinsah über den so reizend angenehmen »Boy«! – Trotz des elenden Wetters, auf das der Kapitän, wie er uns versicherte, »abonniert« habe, wurden alle Vorkehrungen zum Konzert getroffen und das Programm von Prof. Hermann ungefähr folgendermaßen notiert: 1. Schiffskapelle – she must, 2. Mad. Carreño – if she holds out, 3. Mad. Lehmann – if she will be able, 4. Reinhold Hermann – if sea permitting, 5. Marie Lehmann – if she can usw. Als wir zwei Tage vor dem Konzert bei ruhiger See im Salon abends zum Skat zusammensaßen, fielen Riezl, Hermann und ich plötzlich mit einem furchtbaren Krach von den Stühlen, und alles, was nicht niet- und nagelfest, zerbrach in tausend Scherben. Kreidebleich lagen wir eine Weile am Boden, immer einen neuen Stoß erwartend, befürchtend. Wir rollten nun noch ganze 24 Stunden furchtbar, aber der Stoß wiederholte sich nicht. Der Kapitän meinte, wir könnten zwischen zwei Grundwellen geraten sein, das käme vor, aber das beruhigte weder uns noch das Schiff. Vor dem Konzert steckten wir den unnützen Boy in Teresas Reformkleider. Als »Mädchen aus der Fremde« wurde er jungfräulich ausgestopft und angemalt, wogegen er sich männlich wehrte, und mußte dann mit dem Teller für die Seemannskasse absammeln gehen. – Schon vorher hatten wir uns einen ähnlichen Scherz erlaubt. Der Heldentenor unserer Kompagnie war mit auf dem Schiff und machte einer schönen Amerikanerin stark den Hof. Der Sänger war eines Abends nicht zu sehen, lag krank – wie man hörte – in der Kabine. Der Kanadierboy wurde kostümiert von uns allen an die Kabinentür geleitet. Die schöne Angebetete mußte Einlaß begehren, indem sie frug, ob sie »den Kranken« besuchen dürfe? Auf sein freundliches »herein« wurde das verkleidete Subjekt hineingedrängt in die dunkle Kabine, die sich sofort wieder schloß. Wir lauschten atemlos. Nach wenigen Sekunden erscholl ein Schrei, fürchterliches Gelächter, und die verkleidete Angebetete flog aus der Tür des kühnen Sängers, den wir ob des gelungenen Scherzes gründlich auslachten.
Große Gastspiele hielten uns bis Mitte Mai in Boston und Chicago in dem wundervollen Auditoriumtheater, dessen Bühne immer einem eingerahmten Bilde glich, keine Proszeniumlogen, sondern nur breite mattgoldene Seitenwände aufwies, die immer zu der prachtvollen Akustik mit beitrugen.
Entgegen allem Bitten und Drängen wollte ich im nächsten Winter gründlich ausruhen und nicht hinübergehen, kam aber erst los, als ich fest versprach, die Saison 91-92 wieder mitsingen zu wollen. Noch ehe ich abreiste, hatte ich mit Stanton und Seidl eine lange Konferenz über unser Repertoire, das meines Erachtens zu viel – ja fast ausschließlich – Wagner brachte, das den Stockholdern sowohl als dem Publikum auf die Dauer über werden mußte. Ich riet, auch italienische Opern zu geben, was freilich seinen Haken hatte, da man von unseren deutschen Sängern darin keine Vollkommenheit erwarten durfte und Amerika in dieser Beziehung das Höchste kennen gelernt. Man hielt mir die großen Wagneropern als am zugkräftigsten vor, und ich mußte meinen Warnungsruf als gescheitert betrachten; nur daß die Zukunft sie schließlich eines Besseren belehrte.
Unerträgliches Herzklopfen, viele durchgewachte Nächte mahnten mich um so dringender an den ersten Lucia-Abend in Berlin, als ich, in Boston nach der Götterdämmerung, einen Arzt kommen lassen mußte, der mir gegen Kältegefühl im Kopf und Schlaflosigkeit ein Pulver mitbrachte, auf das ich einschlief und mich auch bald wieder erholte. Der Arzt sagte nur das eine Wort: overworked! – Sobald ich in Europa über 5000 Fuß hoch lebte, war ich nicht imstande, mich zu erwärmen, und brauchte viele Wochen, mich an die Höhenluft zu gewöhnen. Auf sehr hohen Gipfeln befiel mich meist ein Gefühl der vollständigen Auflösung, ein Gefühl von Nirwana im Anblick der großen Naturwunder. Zustände, die mich peinigten, andern peinlich waren und mir unerklärlich blieben, weil sie sich ja auch wieder verloren.
An die geträumte Ruhe war übrigens nicht zu denken; unser Haus, das im Rohbau fertig, machte uns viel Laufereien, und sobald man mich in Europa wußte, regnete es allenthalben Gastspiel- und Konzertanträge.
In meiner Kontraktbruchsangelegenheit wandte ich mich an Seine Majestät Kaiser Wilhelm II., unterbreitete ihm den Sachverhalt, schrieb, daß wenn Hülsen damals nicht so krank gewesen und bald darauf gestorben wäre, es niemals zu einem derartigen Boykott gekommen wäre, und bat Seine Majestät, sich gnädigst meiner Sache annehmen zu wollen. Der Brief mußte durch Graf Hochberg begutachtet und an Seine Majestät den Kaiser abgegeben werden, und zu diesem Zwecke brachte ich ihn selber aufs Bureau. Ich hörte nichts mehr davon.
Nun war mein erstes Wiederauftreten in Berlin mit dem philharmonischen Orchester und Hans von Bülow für den Oktober 1890 vereinbart worden. Daß es Meister Bülow war, machte mir ehrliche Freude, und wie es schien, auch ihm. Wie peinlich korrekt, wie ernst er es mit der Kunst nahm, mag man daraus ersehen, daß er noch am Morgen des Konzertes, nach zwei Proben, zu mir gestürmt kam, um mich zu fragen: ob ich diesen oder jenen Akkord im Rezitativ der Rachearie auf das Wort oder nach demselben gebracht wünschte; allerdings sehr wichtige Fragen für zwei Musiker unseres Schlages. Noch wiederholten wir dasselbe Programm in Hamburg, und dann verschwand Hans von Bülow bald für immer unsern Blicken; nicht meinem Gedenken, nicht meiner Verehrung.
Gleich darauf trat Gustav Mahler als Direktor der Nationaloper in Budapest in mein Künstlerleben. Ein Neuer mit starkem Willen und Verständnis. Er hatte mir brieflich mitgeteilt, daß meine Honoraransprüche zwar über sein Budget gingen, daß er mein Gastspiel aber als durchaus notwendig erachte, um seinen Mitgliedern ein künstlerisches Vorbild zu geben, nach dem sie ringen sollten. Es war eine reizende Zeit, die wir dort im kleinen Kreise Auserlesener verlebten. Mahler, in seiner ganzen gläubigen Frische, seinem Ziele zusteuernd; die großartige ungarische Tragödin, Marie Jassay, eine Art Ristori, und doch die geborene Einfachheit und Natürlichkeit, die immer studierte, studierte, studierte, Graf Albert Apponyi, Professor Michalowich, unsere lieben Bayreuther Kunstfreunde und meine kleine Nichte. Überall fanden wir uns zusammen. Alle Rollen sang ich italienisch, und nur die Recha (Jüdin) – da man mir die Wahl gelassen – französisch, ohne eine Ahnung zu haben, daß Perotti den Juden italienisch singen würde. Alles andere sang ungarisch dazu, und man kann sich nun einen Begriff machen von dem kosmopolitischen Sprachenwirrwarr dieser Opernaufführungen, in denen jeder Fremde, der ohne Souffleur sang, Not hatte, seiner Sprache treu zu bleiben. Im Don Juan nahm der damals noch feurige, junge Mahler das kleine Männerterzett des ersten Aktes im schnellsten Allegro weil alla breve vorgeschrieben steht, das hier ja kein beschleunigtes, sondern nur ein beruhigtes Tempo anzeigt. Denselben Fehler machte Mahler im Maskenterzett ohne alla breve-Vorzeichnung, doch legte ich hier sofort mein Veto ein, und nie mehr – glaube ich – fiel er in seinen Allegrowahn darin zurück. Als ich es mit Bülow besprach, war er entsetzt und sagte genau über das alla breve, was ich bereits niederschrieb.
Noch sehe ich Mahler vor unserem Ofen knien und ein Medikament für Hedwig H. nach einem großmütterlichen Rezept in einem Blechlöffel brauen, wozu er alles mitbrachte. Bei Frau Jassay wurden ihm gewöhnlich die fehlenden Rockknöpfe angenäht, die er – weiß der Himmel wo – losgeworden war. Spazieren rasten und sprangen wir oft über Stock und Stein mit ihm in der herrlichen Umgebung Budapests und amüsierten uns köstlich. Ich war Mahler eine Freundin, habe ihn lieb behalten, habe sein großes Talent, seine ungeheuere Arbeitskraft und seine Rechtlichkeit der Kunst gegenüber geehrt und ihm in allen Lebenssituationen die Stange gehalten, seiner großen oft mißverstandenen und verkannten Eigenschaften halber. Selbst seine nervösen Zustände, die manchmal unberechtigt solche trafen, die nicht Schritt halten konnten mit seinem Talent, seinem eisernen Streben und Fleiß habe ich Verständnis entgegengebracht, weil auch ich früher glaubte, daß es nur des starken Willens bedürfe, um zu vollbringen, was man selbst zu vollbringen imstande gewesen, d. h. über seine Kraft zu streben. Daß dem nicht so ist, ich weiß es längst. Wir waren gute Freunde, selbst dann, wenn wir entgegengesetzter Meinung waren, was bei seinen neuesten Dekorations-Schöpfungen sehr oft der Fall war. Ich war wohl die erste, die von ihm selber erfuhr, daß er seine Stellung aufzugeben gezwungen würde; und das gerade an dem Tage, als ich seinem langgehegten Wunsch nachzukommen vorhatte, mich einige Monate der Wiener Hofoper einzureihen, um dort die Armida und beide Iphigenien zu geben. (Auch ein alter Wunsch von Wilhelm Jahn!) Unser schöner Traum sollte sich nicht erfüllen. –
Was ihn von Wien forttrieb, ist komplizierter Natur. Mahler hatte weder Dispositions- noch Rechentalent. Jedes Jahr mußte ich ihm mein Gastspiel versprechen, nie aber konnte er eine bestimmte Zeit angeben, und was z. B. für den März verabredet, wurde oft auf April oder Mai verschoben, um dann wieder im Februar stattzufinden. Immer war er Idealist, kannte keine Zeit und keine Ruhe, nicht für sich und nicht für andere. Daß er allen privaten Nebeninteressen eines Hoftheaters schroff abweisend gegenüberstand und sich hohe Feinde damit schuf, ist natürlich. Daß er in seiner impulsiven Art, nur immer Schönes suchend, es oft auch durch Mittel zu finden glaubte, die andere ihm aufoktroyierten, die er später als verfehlt anerkennen mußte, und dabei nicht an Sparen dachte, wer könnte es ihm verargen? Es war nicht sein Säckel, den er füllte, und nie dachte er an sich. Über manches mußte man ihn als praktischer Freund belehren und allen Ernstes auf sein Recht und seine Zukunft hinweisen. Mahler war ein nervöser Fanatiker der Kunst, sah aus wie ein Teufel, war liebenswürdig wie ein Kind, seinen Schwestern, Frau und Kindern ein rührender Beschützer und Vater; eine immense Kraft – und – sicher seit langen Jahren schon ein innerlich kranker Mann. Mit ungeheurer Energie packte er an, was er zu vollenden sich vornahm, Energie, die bei Begegnung einer kongenialen Kraft zu schönstem harmonischem Zusammenwirken verschmolz, ja, sich nicht selten unterordnete. Immer war es eine Feier, mit ihm zusammen am Werk zu sein. Für ihn tat es mir weh, daß er über den Ozean mußte, um – da er nicht bleiben konnte – drüben zu erreichen, was so viele erreichen wollen, seine Unabhängigkeit vom Müssen für seine alten Tage, seine Familie und nicht zum letzten für sein eigenes Schaffen. – Er hatte Wien sehr viel gegeben, wenn es hier und da auch in häßlicher Hülle geschah, wie z. B. im Don Juan, den er selbst, mir gegenüber, als total verfehlt bezeichnete, und auch im Figaro, der eine Prachtvorstellung hätte sein können, wenn der dekorative Teil, und auch manche Kostüme, nicht gegen alle Natürlichkeit und Grazie Front gemacht hätten. Die Krone aller seiner Einstudierungen war die Iphigenie in Aulis, die in jeder Beziehung abgeklärt und im Geiste harmonisch das Schönste bot, was ich mir von klassischer Kunst zu denken vermag. Hier war das Höchste erreicht und wahrscheinlich nur darum, weil ein einfaches Zelttuch den Schauplatz der großen Tragödie umschloß, nichts Störendes in die Kunst des Künstlers Mahler und der Künstler-Sänger griff, die unter jedem unnötigen oder ungeschickten Dekorationskram nur leiden und nicht mehr zu wirken vermögen, weil der äußerliche Bombast jedes feine Gefühl erstickt und abwürgt.
In Mahlers sinfonischen Kompositionen fiel mir sofort die Einfachheit der Melodien als die Wirkung auf, die er allerdings mit einem immensen Apparat in Szene zu setzen wußte. Es schoß mir damals gleichsam durch den Kopf, ob nicht gerade er es sein könnte, der auch bezüglich des Apparates einfache Wege wieder einzuschlagen gewillt wäre, und stellte ihm die Frage, die er höhnisch lachend beantwortete: »Wo denken Sie hin? Meine Sinfonien wird man in 100 Jahren in Riesenhallen aufführen, die 20 000 bis 30 000 Menschen fassen und zu großen Volksfesten werden.« Dazu schwieg ich; mußte aber unwillkürlich denken, daß, je mehr Intimität man der Musik nimmt, je mehr sie des wahren Genius wird entbehren können. Wie auch das Theater, dessen Bühne und Zuschauerraum über ein gewisses Maß hinaus geht, nicht mehr Kunst für den Künstler noch Kunstfreudigen sein kann; daß dann der Zirkus beginnt, worin die Schauspieler in toten Masken spielen, weil man individuelles Mienenspiel, Augen und Physiognomien nicht mehr zu unterscheiden, kein Wort mehr zu verstehen vermag. Und so geht im großen Orchester jedes individuelle Instrumentale verloren, wie die Individualität des einzelnen Bildes in einer Riesenausstellung von tausend und abertausend Bildern sich verliert und eins das andere tötet. Es ist die heutige Zeit, die im Automobil den Spaziergänger, der sich an jedem Grashalm, jeder Blüte, jedem Lebewesen freut und stunden- ja sein Lebelang dabei verweilen möchte, über die Achsel ansieht, weil dieser seinem Körper die gesunde Lebensbewegung zuführt, in Wald und Feldern seinen Gott anbetet. In unserer Zeit der Automobile und Luftschiffe entschwinden alle Feinheiten der Musik dem Ohre, alle einzelnen Herrlichkeiten der Natur dem Auge, dem Herzen, und fremd steht darum die alte Zeit der neuen gegenüber, die eben ihres individuellen Wertes halber eine so viel schönere war, ist und ewig sein wird.
Wieder und zum letztenmal sah ich Mahler 1910 in München, als er seine VIII. Sinfonie dirigierte; Riezl und ich waren extra dazu hingefahren. Mahler war sehr gealtert, ich erschrak förmlich. Sein Werk, das mit 1000 Mitwirkenden besetzt war, klang wie aus einem Instrument, aus einer Kehle. Der zweite Teil der Sinfonie, der vom zweiten Faustteil gebildet, berührte mich schmerzlich. War er's, seine Musik, sein Anblick, eine Todesahnung, Goethes Worte, Erinnerungen an Schumann, meine Jugend, ich weiß es nicht; weiß nur, daß ich während des ganzen zweiten Teiles, in Rührung zerfließend, mich nicht zu fassen vermochte. Als ich am andern Morgen zu ihm ging, ihn zu begrüßen, ihn umringt von so vielen Menschen traf, war er die Liebenswürdigkeit selbst, holte Riezl, die mich unten erwartete, persönlich herauf und wollte uns nicht wieder fortlassen. Und dann sein furchtbares Geschick, seine entsetzliche Krankheit – der Tod! So schmerzlich ergreifend, trostlos.
Gar viele Lichtbilder ziehen beim Aufschlagen meines Tagebuches an mir vorüber, bei denen ich gerne länger verweile. Dennoch heißt es weiterblättern, wenn ich zum Ziel gelangen will, das auch diesem Buche gesteckt ist. Paris, von engeren Erinnerungen umrahmt, kann ich nicht vorbeiziehen lassen, ohne Charles Lamoureux zu erwähnen. Kein großer, wohl aber ein ernst zu nehmender Musiker, besonders ernst für Paris, das ihm viel zu danken hat, wo sich so viele aufspielen und aufblähen, die keine Berechtigung dazu haben. Dem stand Lamoureux fern; er machte Musik aus dem Grunde seines Gefühls heraus und verachtete Publikum, Presse und Nichtskönnerei gründlich. Er berief mich zu drei Sonntagskonzerten im Februar 1891, welche im Cirque d'été stattfanden, weil Paris keinen Saal für Orchesterkonzerte besaß, auch heute nicht besitzt. Im Cirque d'été roch es wie im Cirque d'hiver und jedem andern Zirkus, und nur Lamoureux' Reinlichkeitsgefühl und Fürsorge allein ermöglichten den Aufenthalt.
Amalie Materna hatte kurz vor mir Wagner deutsch gesungen, mußte aber noch »undeutlich aussprechen«. Ich sang, bis auf eine Arie, alles deutsch, sprach sehr deutlich aus und war überzeugt, daß es niemand eingefallen wäre, irgend etwas dagegen einzuwenden, da die Konzerte nur vom Pariser Elitepublikum besucht wurden. Immerhin gestattete Lamoureux nicht, daß ich die »Träume« Wagners wiederholte: » Ne faites pas des concessions à ce public«, sagte er aus Vorsicht, es könne irgendein Ungezogener sich gegen Wagner auflehnen. Er belehrte mich, daß es allein die Pariser Verleger nationaler Werke seien, die den Einzug Wagners bisher vereitelt, den Chauvinismus der Franzosen geschürt hatten, um sich vor Verlusten zu sichern. Vom Repertoire der großen Oper und deren Vorstellungen sagte er nur: » c'est honteux!« – Eines Abends war ich bei ihm mit seinem Schwiegersohn Chevillard, Chabriard und mehreren anderen Musikern zusammen, und sang ihnen den ersten Akt Tristan. Ich höre Lamoureux noch schreien: » Ah, c'est du fer, du fer!« Solche Kraftleistungen durften sich die französischen Sängerinnen allerdings nicht zutrauen. Nachdem sie sich wie wahnsinnig gebärdeten, frug Lamoureux, der mein Erstaunen sah: » Qu'en dites-vous, madame Lehmann?« worauf ich nur mit »Dalldorf« erwidern konnte, ihnen Dalldorf als Berliner Irrenanstalt und sie alle dafür reif erklärte. Aber selbst das »Narrenhaus« bändigte nicht den wundervollen Enthusiasmus der so temperamentvollen Musiker dieser Rasse, denn jetzt ging's erst recht los. In den beiden nächsten Konzerten sang ich jedesmal eine klassische deutsche Arie und mit Paul Kalisch das ungestrichene Tristan-Duett, das ¾ Stunden währt, aber trotzdem mit ungeheuerem Beifall aufgenommen wurde. Damals konnte nur Lamoureux sich so etwas erlauben, der die Pariser pünktlich zu sein zwang, die Türen schließen und während der Vorträge niemand herein ließ, was damals unerhört gefunden wurde. Er hatte sich ein prachtvolles Orchester zusammengestellt, das er mit unnachsichtlicher Strenge meisterte, und von keinem Orchester habe ich je die Zauberflötenouverture so märchenhaft schön gehört als von diesem. Ebenso unnachsichtig kämpfte er mit den schlechten Gewohnheiten und der Oberflächlichkeit des französischen Publikums sowohl als der Künstler. Kämpfe, die er dahin zusammenfaßte:
» Je vous assure, madame Lehmann, il faut être fou comme moi de la musique, pour faire des concerts à Paris!« Aber seine Kämpfe kommen uns heute noch zugute, denn man hat auch in Paris den Respekt vor deutscher Musik und deutschem Ernst kennen gelernt. Oft noch sang ich in Lamoureux-Konzerten, die mein Urteil über seinen Wert nur bekräftigen und ihm mein dankbares Erinnern sicherten.
Außer Sarah Bernhardt, die ich persönlich aus Amerika kannte, und die mir immer erneute Bewunderung abrang, konnte mir nur noch die Umgebung im reichsten Maße ersetzen, was der Stadt an Ruhe und Ernst verlustig ging. Schminke und raffinierter Putz, der up to date an Wahnsinn immer zunahm, das späte Nachtleben, alles das verdarb mir den Geschmack an dem so wundervollen Paris, und heute begreife ich, daß Wagner nur hier sein Pariser Bacchanal schreiben konnte, das ein getreues Abbild allen Sinneskitzels gibt, in welchem die Pariser Lebewelt aufgeht.
In Berlin war ich zufällig dem den Königlichen Theatern beigestellten Rechtsanwalt, Dr. Bischof, begegnet, der mir gratulierte. »Wozu?« – »Sie sind frei!« – »Wieso?« – »Ja wissen Sie's denn nicht? Der Kaiser hat auf ihren Brief geschrieben: die Strafe finde er zu hart. Ich wundere mich, daß man es Ihnen nicht mitgeteilt?« – Nein; man ließ mich auch noch lange warten, bis ich endlich – um mich von der Wahrheit zu überzeugen – persönlich bei Graf Hochberg anfragte. Ich war wirklich frei! – Was mußte der Kaiser denken, daß mein Dank ausblieb, wenn die Verfügung schon so lange erfolgt war? Wie es sich damit verhielt, erfuhr ich nie und glaube auch nicht, daß man es mir je offiziell anzeigte.
Jahn holte mich sofort zu siebenmaligem Gastspiel nach Wien, und dann zogen wir Ende März in unser Grunewald-Heim, dem ich trotz Niemanns Prophezeihung, ich würde es nicht vier Wochen darin aushalten, seit 22 Jahren treu geblieben bin und wo ich mich in meiner Umgebung sehr glücklich fühlte.
Der geforbene – nunmehr selige – Engel-Kroll suchte mich gleich nach meinem Kontraktbruch auf, um mich für seine Sommeroper zu gewinnen, und redete mir zu wie einem kranken Schimmel; er wollte, falls ich verspräche bei ihm zu singen, mich frei machen. Ich erwiderte ihm nur, er möge es erst versuchen, dann wollten wir das Weitere sehen. »Ich weiß schon,« antwortete er darauf, »ich werd' Sie frei machen, und Sie werden nischt singen bei mir!« Widersprechen wollte ich dem nicht; und so fiel die Sache ins Wasser, und der alte Engel starb ohne seinen Wunsch erfüllt zu sehen. »Bei mir machen's die grienen Bäume«, pflegte er zu sagen, wenn ihm jemand über die schlechte Bezahlung klagte. »Bei mir kann singen de Patti, wenn's Wetter schlecht is, geht keine Katz hinein; und wenn's Wetter schön is, kann singen de Frl. Quitsch-Quatsch aus Posemuchel, die auf der Terz trillert, und es is ausverkauft. Glauben Se mir, bei mir machen's die grienen Bäume!«
Nun hatte sein Sohn das Erbe übernommen, Patti und viele andere waren dort als Gäste gefeiert, und da das junge Engelpaar mich versicherte, daß sie auf ihrem »Nudelbrett« alles geben könnten, kam wirklich ein neunmaliges Gastspiel zustande, an dem Paul Kalisch, meine Schwester und d'Andrade teilnahmen. Das von dem alten Landpartienbrauch in der Berliner Umgegend herrührende: »Hier können Familien Kaffee kochen«, verwandelte mein Mann in »hier können Familien Opern singen«. Paul Kalischs Witz florierte denn auch während des Gastspiels, denn es boten sich neben allem Ernst der oft ausgezeichneten Vorstellungen von Fidelio, Norma, Jüdin, Don Juan und Lucrezia auch manche komische Szenen, wenn man hinter die Kulissen sah. Aber auch vor dem Theater gab's zu lachen, selbst wenn einem das Weinen näher lag.
Der junge Engel, Krollscher Erbe, frug nicht nach nationaler Trauer in seinem Geschäft, die uns wahrlich nahe genug ging. Denn heute handelte es sich um keinen Geringeren als den großen Schweiger Moltke, den man zur letzten Ruhe brachte. An diesem Tage fuhren wir in Hausanzügen nach Kroll, die Oper Norma zu singen, wurden aber des Trauerzuges halber, der um den Königsplatz ging, in dem gesperrten Tiergarten von keiner Seite mit dem Wagen durchgelassen. Paul Kalisch stieg schließlich aus, um mit dem berittenen Schutzmann zu verhandeln, der aber nicht mit sich handeln ließ und unserer Weiterfahrt sich aufs bestimmteste widersetzte. Wir sollten aussteigen und zu Fuß gehen. Kalisch bedeutete dem »Berittenen«, daß das unmöglich sei: »Die Damen sind geschminkt, meine Frau hat ein kurzes weiß und rotes Federkleid an, denn sie singt die Papagena, und wenn sie so durchs Militär durch muß, gibt's einen Heidenskandal.« Das sah der geprellte Berittene auch ein, und seinem Kommando öffneten sich sowohl die Soldatenreihen als die Pforten des Musentempels von »Krolls Etablissement«. –