
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Bayreuth, 7. Februar 1875.
Allerbestes Kind!
Marie hat mir ebenso schön aus Köln, wie Sie aus Berlin geschrieben. –
Fräulein Lammert hat aber noch geschwiegen. Wollten Sie sie wohl zu einer guten Antwort veranlassen – und zwar unter allen Umständen? Ich muß Ordnung halten.
Schönsten Gruß an Mama, aber auch an Marie! Gott weiß, was Ihr mir alle noch machen müßt, denn Ihr seid sehr gut!
Herzlich der Ihrige
Onkel Richard Wagner.
Bayreuth, 11. Mai 1875.
Allerliebstes Lehmännerchen!
Schönen Dank für die Ermahnung in betreff des Frl. Grossi; leider habe ich ihr soeben erst schreiben können; ich war ja wieder in Wien! Übrigens bin ich doch neuerdings auf den Gedanken gekommen, der Grossi auch die Gutrune zu übergeben; sie hat fast gar nichts zu »singen«, braucht nur lieblich zu sein, ein bescheidenes Gebärdenspiel zu haben, so daß ihre Aufgabe, mit der einen der Rheintöchter – nur im 3. Akte der Götterdämmerung – zusammengehalten, völlig verschwindet.
Ihre Partien sind Ihnen nun heute alle gehörig zugeschickt worden. Pardon! Frln. Lammert wohnt immer noch so weit? und Sie so nah? –
Schönste Grüße der Mama, meiner alten, guten Löwin. –
Auf baldiges Wiedersehen!
Herzlichst
Euer ergebener
Richard Wagner.
Datum unbestimmt.
Liebste Lilli!
Jetzt nur noch kurz die Berichtigung der Abänderung, welche infolge Ihres etwas verspäteten Eintreffens nötig ward. An dem ganzen Probenplan darf ich nicht rütteln, weil sonst alles auseinanderfallen könnte. Sie sind also (mit Frln. Lammert) erst am 2. Juni frei; somit verlegen wir notgedrungen den Beginn der Proben auf den 3. Juni Nachmittag, fahren aber nun (für das Rheingold) täglich fort, lassen demnach die zwei folgenden Frei-Sonntage für die abgegangenen zwei Wochentage mildtätig eintreten. Demnach:
| Rheingold: | 1. Szene | 3., 4., 5. Juni |
| 2., 3. Szene | 6., 7., 8. Juni | |
| 4. Szene | 9., 10., 11. Juni | |
| Walküre | 12. Juni |
und so (hoffe ich!) ungestört weiter.
Ich bitte Sie nun, mir in der Einhaltung dieser Anordnung getreulich beizustehen! Das Musikfest werden Sie zu meinem großen Bedauern wohl aufgeben müssen. Auch Vogl ist in diesem Falle! –
Im übrigen seid Ihr alle schl–, ich wollte sagen gute Menschen! Über die Sieglinde werde ich mich dieser Tage zu entscheiden haben.
Zum Hülsen-Jubiläum werde ich jedenfalls meinen Beitrag senden. Ich habe diesen vortrefflichen Mann wirklich sehr schätzen gelernt!
Hier noch etwas »Herrliches«! Herzliche Grüße an Rhein-Töchter und Mutter!
Ihr sehr getreuer
Richard Wagner.
Bayreuth, 1. Juni 1875.
Geehrtes, liebes Kind!
An Fräulein Grossi hatte ich zur rechten Zeit nach Prag geschrieben; seitdem, da ich keine Antwort von ihr erhielt, habe ich mich, wegen Übernahme der »Gutrune« durch sie, an Sie, Freundin, gewendet.
Da ich noch einen Sopran für eine der »Walküren« – Gerhilde – gebrauchte, und ich nicht gern erst noch eine fremde Sängerin hierfür aufsuchen möchte, weil doch eben Frln. Grossi für Freia und Gutrune schon am Anfang und Ende dableiben muß, so habe ich auch diese Parte an Sie für Frln. Grosst abgehen lassen. Nun gebe Gott, daß diese meine Annahmen in betreff der Leistungsfähigkeit der Dame nicht allzusehr auf Sand gebaut seien? Ich weiß von ihr und ihrem guten Willen noch nichts als durch Sie, liebes Kind. Lassen Sie sich nur doch nun einmal hierüber vernehmen!
Vielleicht haben Sie dieselbe durch Ihr freundschaftlich großartiges Vorbild, in betreff der Abweisung jeder finanziellen Schadloshaltung, etwas abgeschreckt? Das können enthusiastische Seelen wie die Ihrigen zustande bringen; die mir so fern stehende junge Dame dürfte aber am Ende darüber mißmutig werden, wenn ihr ihre Mitwirkung auch noch besondere Ausgaben verursachte. In diesem Fall, liebstes Kind, bitte ich Sie doch recht sehr, zur rechten Zeit etwa einzuschreiten und durch Zusicherungen in meinem Namen die junge Dame vor dem möglichen Schwanken zu bewahren.
Was macht Marie? Ist sie endlich einmal bei Ihnen? Empfehlen Sie mich Fräulein Lammert bestens und embrassieren Sie (wie ich es tat) diesmal für mich Ihre Mama!
Auf gutes Wiedersehen am Werke!
Ihr
Richard Wagner.
Bayreuth, 3. Juni 1875.
Es bleibt dabei. Sie sind ein ausgezeichnetes Kind, an dem ich großes Wohlgefallen habe! Da Sie Marien so nahe wie nur irgend möglich verwandt, gilt ihr eigentlich ganz dasselbe! –
Glauben Sie mir, solcher tüchtiger Freundschaft bedarf ich. Ich schicke Euch auch meine Medaille!
Herzlich grüßt
Ihr
Richard Wagner.
Bayreuth, 26. September 1875.
Liebe Freundin!
Hier ein Brief Reichenbergs, der mir eine Walküre empfiehlt. Sie wissen, daß Sie von mir auch zur Walkürenmeisterin gemacht worden sind, und bitte Sie daher, Reichenbergs Anerbieten in Betracht zu ziehen sowie demgemäß mit ihm (in meinem »Auftrage«) zu verkehren. Was hören Sie von der Wild in Köln?
Ich hab' viel Ärger gehabt seit der großen Freude unserer Proben. Nun, es war ja in allen Zeitungen zu lesen, und ich hätte wohl erwartet, daß von seiten der Gäste unseres Hauses etwas gegen jene Unflätereien geschehen wäre. Indes das scheint man nicht so ernst zu nehmen! Gut! –
Grüßen Sie Mama und Schwesterchen! Ihr wäret und bleibet die Besten! – Sagen Sie aber noch Fräulein Lammert, wie sehr ich unseren voreiligen Abschied bedauere. Meine Frau grüßt Sie alle herzlichst!
Ihr guter, kleiner
Richard Wagner.
Wien, 26. November 1875, Hotel Imperial.
Liebe Freundin!
Tausend Dank voran!
Frl. Amman läßt sich nicht sehen, und kein Mensch hier kennt sie. Hätte ich nur die Partie der Sigrune zurück, da ich – unter der Ungewißheit – Frl. Siegstädt (ganz vortrefflich) hier dafür gewonnen habe.
Grimmgerde fällt mir noch schwer, da Jauner seine einzige Altistin (Frl. Treusel – sehr gut) mir bis Ende August nicht ablassen zu dürfen glaubt. Ja – könnte sich unsere Lammert Gottes verdoppeln! –
So steht es! Damit Sie nur etwas von mir wissen! 15. Dezember hoffe ich nach Bayreuth zurückzugehen. – Weib und Kinder habe ich mit hier! –
Schönste Grüße gegenseitig!
Bei elender Laune
Ihr stets neu verpflichteter
Richard Wagner.
Bayreuth, 4. Januar 1876.
Ach, liebes, gutes Kind!
Sie sind wirklich die einzige, die ich »da draußen« als Menschen kenne! Auf keinen ist Verlaß. Wären Sie nur überall! – So schreibe ich vor zwei Wochen an Eckert, in mehreren Angelegenheiten, auch was unser Orchester betrifft. Gut! Was das eine betrifft, läßt er mir durch Wieprecht antworten. Das war ganz gescheidt! Nun aber vermeidet er mir zu schreiben, warum? Weil er mir eine Notiz über die Tristan-Angelegenheit geben müßte, welche – natürlich – allen Not und Scham macht. Ich hab' von Anfang herein – und zwar ohne allen Ärger! – auf den Tristan in Berlin nicht gerechnet. Es ist zu sonderbar zu glauben, daß man für dieses Werk, auch nur in betreff der Anfangsgründe, ohne mich sich behelfen zu können glauben kann! Nun aber kommen immer Gerüchte zu mir. Das neueste, ich würde im Januar in Berlin erwartet, »um mit Hülsen, Niemann, Betz, Fricke und Voggenhuber über die ›Besetzung‹ des Tristan zu konferieren«. Da ich gar nichts sonst erfahre, wäre mir dies alles gleichgültig. Nun kommt aber der Fall, daß ich in einer Prozeßsache gegen den Musikhändler Fürstner, welche ich nicht leicht nehme, sehr wahrscheinlich bald einmal nach Berlin kommen muß. Ist nun irgend etwas mit dem »Tristan« vor, so wünschte ich natürlich gern, die beiden Angelegenheiten kombinieren zu können. Somit würde mir eine ganz klare und aufrichtige Darlegung des Standes dieser letzteren Angelegenheit sehr willkommen sein. Ich bitte nun Sie darum!
Was ist's mit der »Bayreuther Soiree oder Matinee«? Ich möchte das nicht wehren, wiewohl ich jede Einladung für Bayreuth, d. h. für das Zustandekommen von Bayreuth ein Konzert u. dergl. zu geben, abgewiesen habe, da ich, wenn ich die Aufführungen mit Bestimmtheit ankündige, nicht noch für die »Ermöglichung« derselben agitieren kann. Es haben sich große Widerwärtigkeiten und Erschwerungen eingestellt, und wir leiden sehr darunter. Doch an der Sache selbst lasse ich keinen Zweifel mehr aufkommen. – Gelegentlich melde ich Ihnen zur weiteren Verbreitung, daß Scaria nicht (wie er unverschämterweise in den Wiener Blättern hat angeben lassen) für 3 Monate 2000 fl., sondern für Monat August allein 7500 Mark und sonst für jeden Tag im Juli 250 Mark verlangt hat; worauf ich natürlich um unserer übrigen Kollegen willen, auf seine Mitwirkung verzichtet habe. (Dies so eine kleine Verdrießlichkeit nebenbei! –)
Wie dumm ist es mir auch in Wien mit der Amman gegangen. Bis in die letzten Tage meines dortigen Aufenthaltes, während welchem ich endlich die Siegstädt geworben hatte, läßt sie nichts von sich hören; am Tage vor meiner Abreise meldet sie sich mit ihrer Adresse. Ich hatte keine Zeit mehr und habe nun auch ihren Brief – mit Adresse! – verloren.
Seitdem schreibt mir nun aber die Siegstädt wieder ab, die Partie scheint ihr nicht recht gewesen zu sein. Nun bereue ich wieder die Amman. Wo mag diese stecken?
Eine Altistin für die Fr. v. Müller habe ich auch noch nicht; aber Fr. v. Müller schreibt und gratuliert mir fortgesetzt als »Walküre«.
Solcher Unsinn kommt immerfort vor! So! nun habe ich Ihnen, meiner Regisseurin und Komplottistin, alles gemeldet. Bleiben Sie mir gut! Geben Sie Marie und der guten Lammert von mir einen herzhaften Kuß und gedenken Sie in treuer Liebe
Ihres geplagten aber guten
Richard Wagner.
Bayreuth, 11. Februar 1876.
Allervortrefflichstes Kind!
Ich hab' zwar kürzlich schon einmal mit einem Schweden zu tun gehabt, der war aber einäugig und Jude. Nun versuchen wir es einmal mit einem echten »alten Schweden«! (Stockhausen??) – gefällt mir nicht ganz! –
War er noch gar nicht auf dem Theater, so ist's allerdings mit dem »Hagen« etwas viel gewagt. Nun möge er sich die Sache nur etwas ansehen. Die letzte Woche im Februar bringe ich in Berlin zu, da wollen wir denn sehen, was die kleine Salome ausgebrütet hat! – Übrigens bin ich mit Scaria noch nicht ganz auseinander: eine gerichtliche Aufforderung, hier seine »Honorare« mit Beschlag zu belegen, hat mir die sonderbare Erklärung seines Benehmens gegeben, welches weniger von Roheit und Unverschämtheit, als von – Not herrührte. Dazu empfiehlt man mir noch einen Kögel in Köln, welcher sich auf Ihre Schwester Marie beruft. Ich habe ihn auch nach Berlin zitiert. –
Mit Fräulein Amman ist's in Ordnung. Richter ist sehr für sie eingenommen. An einer Altistin für Frl. v. Fischer fehlt es noch! –
Nun, Kind, jetzt sehe ich Sie bald wieder. Ich habe soeben auch an Hülsen geschrieben. Jetzt muß ich alles abmachen, um mir die Monate vor unseren Proben frei zu erhalten.
Schönsten Gruß an Mama, – auch an Onkel Betz!
Es lebe der Leipziger Platz!
Von Herzen Ihr
Richard Wagner,
(nebst Frau!)
(Auf der gedruckten Einladung an die Sänger vom 9. April 1876.)
Liebste Freundin!
Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das Folgende nicht schon einmal geschickt habe. Tut nichts! Falls mit dem Zöglinge der Liebe noch etwas wird, benützen Sie für ihn das beigefügte Exemplar!
Bayreuth, 16. April 1876.
Liebste Lilli!
(Folgt die gedruckte Aufforderung vom 9. April 1876.)
Ganz gehorsamster
R. W.
Nachdem Sie diese schönen Sachen gelesen haben, die Sie eigentlich gar nichts angehen, und die ich Ihnen nur der Kuriosität willen mitteile, – habe ich Ihnen noch einen Brief von Frau Klara Stockhausen, den ich gestern abend erhielt, vorzulegen, um Sie ersehen zu lassen, in welche Konfusionen ich immer gerate. Gott, ich ersehe, daß alle Frauenzimmer in den himmlischen jungen Schweden verliebt sind, aber seine problematische Aquisition (ich konnte noch gar nicht dahinterkommen, ob er den Donner ordentlich herausbringt) scheint sich durch allerhand Schwierigkeiten noch bedenklicher zu machen. Ich hab' wirklich keine Zeit, mit der von Frau Stockhausen gewünschten Umständlichkeit mich um Euren Sangino zu bemühen. Frau Stockhausen fand ich es geraten, gar nicht zu antworten; es ist so einfach! Dagegen, machen Sie es möglich, so bringen Sie den himmlischen Elmblad mit, und macht er's schön, so singt er den Donner, – wenn nicht, so muß ich mir zu helfen wissen.
Also viele schöne, ja – wenn man will – zärtliche Grüße an Sie und Mama von
Ihrem stets dankbaren
Richard Wagner
Komponist.
Bayreuth, 26. April 1876.
Liebe Lilli!
Ihr macht mir da schließlich noch eine hübsche Not! An Herrn v. Hülsen habe ich mich so eindringlich gewendet, daß ich wohl annehme, er werde mir helfen; denn das mußte ich ihm erklären, daß wenn mein Probeplan – namentlich im Betreff des Rheingoldes – nicht eingehalten werden könne, ich die diesjährigen Aufführungen geradeswegs abmelden müßte. Im Betreff des Frln. Brandt hätte ich auch von Euch allen etwas mehr Billigkeit gewünscht. Daß sie in ihrer künstlerischen Leistung über jeder anderen stehen würde, ist mir denn doch im Vergleich mit den mir bekannt gewordenen anderen aufgegangen. Das Unempfehlende ihrer Gesichtsbildung kommt doch nur außer der Bühne und für die in nächster Nähe mit ihr Beschäftigten in Betracht: auf der Bühne und namentlich in meinem Theater verschwindet es gänzlich, und ihre schlanke Gestalt würde da einzig, und zwar vorteilhaft wirken. Einem Künstler wie Niemann kann man aber wohl zumuten, daß in der dramatischen Erregung sich ihm die ganze Umgebung verkläre und das Gemeine, Reale ihm nicht zum Bewußtsein komme: ihm muß es darauf ankommen, wie das Ganze, er selbst mit, erscheine, nicht wie es, vom Zauber der dramatischen Szene entkleidet, wirklich ist. Garrick und Kean nahmen statt eines Kindes einen Bierkrug in den Arm und rissen den nächststehenden Zuschauer zum Entsetzen hin, als der Vater das Kind in den Fluß werfen zu wollen schien. –
Kurz, über diese unbedingte Abwehr des Frln. Brandt bin ich nicht eben erbaut und wird mir dies meine Not sehr erschweren. –
Es ist schön, daß Sie im Mai wieder Ensembleproben bei sich halten wollen; ich bitte Sie, zu Euch 3 Walküren dann jedenfalls auch meine Nichte Johanna Jachmann mit »hinzuzuziehen«; sie hat definitiv die »Schwertleite« übernommen und werden ihr die Übungen mit Ihnen Dreien sehr nützlich sein. –
Einen Kummer muß ich Ihnen denn doch nun auch machen. Es fällt mir schwer aufs Herz, daß Sie nicht darauf geraten, daß ich Herrn Herrlich doch unmöglich als Froh behalten kann. Muß ich Ihnen das nun sagen, daß unser armer Freund doch wohl lächerlich sein würde? Es tut mir wehe! Vermitteln Sie das aber nun doch, so gut Sie können, und sehr wert wäre es mir, wenn Herrlich, wie es ja ursprünglich auch nur gemeint war, mir als Mannenführer sich wahrhaft nützlich erwiese.
Donner ist gänzlich Ihre Sache! Und nun gebe Gott seinen Segen zu Herrn von Hülsens Entschluß!
Herzliche Grüße aus sehr bedrücktem Herzen von
Ihrem
R. Wagner.
Haben Sie eine Idee, wo sich die Weckerlin aufhält und ob sie für – oder unter uns noch möglich ist?
Sehr hübsch auch, daß ich Ihre Mitwirkung beim Rheinischen Musikfest Anfang Juni höre!!! Ei! Ei!
Bayreuth, 11. Mai 1876.
Beste Freundin!
Unser Herrlich macht es mir schwer: er hätte zu der Brücke, welche ich ihm aus reinem Wohlwollen und um keine Kränkungen zu hinterlassen, baute, eine bessere, vielleicht sogar bescheidenere Miene machen sollen! Im Grunde habe ich mit meiner letzten, sehr ausführlichen Explikation an ihn, nichts erfunden, obwohl er mich verhöhnt, als hätte ich das getan. Die Sache verhielt sich wirklich genau so, wie ich sie ihm auseinandergesetzt habe; nur ist es wahr, daß ich eine Zeitlang die Wichtigkeit des Froh aus den Augen verlor und mir meine alte Intention erst wieder selbst aufging, als ich erkennen mußte, daß es Unger die ungemeine Schwierigkeit mit dem ersten Akte des Siegfried (bei der hier so großen Befangenheit) für sich zu gewinnen, außerordentlich erleichtert, wenn er gerade als »Froh«, mit den wenigen, aber glänzenden Stellen, sogleich die Aufmerksamkeit auf seine, jetzt so stattliche Stimme lenkt. An Sie, liebste Lilli, schrieb ich in der Eile hierüber ein wenig kurz, und Sie haben es wahrscheinlich scharf ausgerichtet. –
Freund Herrlich, den ich, weil er mir von Ihnen und Ihrer Mutter zugeführt war, nicht gekränkt lassen wollte, und um den ich jetzt längere Briefe geschrieben habe, als ich sie jetzt oft in den wichtigsten Fällen zustande bringe, möge mir nun die Sache etwas leicht machen! Er möge nicht kommen, oder er möge kommen; im letzteren Falle steht ihm eine Aufenthaltsentschädigung natürlich zur Verfügung. Entbehren kann ich ihn, – soviel sage ich Ihnen im Vertrauen! –
Nun aber auf Seele und Gewissen: Wie steht es mit Elmblad Donner? Elmblad müßte jedenfalls auch einen Mannen übernehmen. – Kann ich sicher auf ihn rechnen, so habe ich Luft, Niering auch für den Hunding fahren zu lassen, welchen ich hierfür nur beibehalte, weil ich nicht weiß, ob ich durch den Schweden für den Donner gesichert bin.
Also!!!
Schönste Grüße! Bei uns versteht sich alles leicht, und nur gewisse Pimpler machen oft schrecklich viel Geschreibe nötig!
Allemal Ihr ergebener
Richard Wagner.
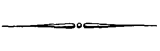
Überschriftennummerierung im Buch unklar. Re.
Von einem Glorienschein umgeben, steht die erste große Zeit Bayreuths, die die Jahre 1875-1876 umspannt, vor meinem geistigen Auge. Nichts davon konnte in den langen Jahren verblassen; allen neueren Errungenschaften auf dem Operngebiet entgegen hielt die Wirkung Stand, und damit allein wäre schon der Beweis ihrer außergewöhnlichen Kraft erbracht, wenn sie dessen noch bedürfte. Obwohl das Unternehmen allein Richard Wagners Idee gewesen, er die Tat allein anregte, das Werk allein leitete, so waren doch gar viele verschieden geartete Kräfte notwendig, es zur Gesamtaufführung zu bringen, und nur den vereinten Kräften ist das großartige Gelingen zuzuschreiben, das ein einzelner nie und nimmer zur Vollendung gebracht haben würde. Vereint waren geistige Kräfte in Ausführenden und sonstig Beteiligten. Das Band der Zusammengehörigkeit machte sie stark, stachelte sie zur Entfaltung ihrer höchsten künstlerischen Potenz und ließ ihre Wünsche darin gipfeln, die damals musikalisch und geistig gleich schwierigen, fast unerhörten Aufgaben ihrem Meister zu Dank, sich selbst zur Freude zu gestalten. Wagner galt der individuelle Geist der einzelnen Künstler, ohne deren mehr oder minder hohen Genius er niemals mächtige Wirkungen erreichen konnte, ja – es sei ihm zur höchsten Ehre seines klaren, künstlerischen Verständnisses angerechnet – auch nicht erreichen wollte, alles. Er wußte, was er der Bühnenkunst in ihrem vollsten Umfang schuldig war, was er von seinen Künstlern verlangen, von denjenigen erhalten mußte, die geistig Anteil an seinem Werke nahmen, ihm gerade dadurch ein besonderes individuelles Leben einhauchten, das nun erst vollständig alle diejenigen Gefühle im Zuhörer auszulösen vermochte, die man doch mit einer noch so herrlichen Partitur, Drahtpuppen oder einigen Dekorationen allein wahrhaftig nicht auszulösen vermag.
So wurde und blieb vieles einzig in seiner Art im Jahre 1876 und konnte nicht wieder erstehen. Wagner in seiner vollen Schaffenskraft; der herrliche Rahmen, der uns gleichmäßig fesselte und befreite; die einzelnen künstlerischen Leistungen, wie man sie nie wieder hören und sehen wird, die geradezu elektrisierend wirkten; der Klang dieses, nur aus großen Künstlern zusammengestellten Orchesters; das Kunstwerk; die eigenen Empfindungen, die uns beseelten, uns hinrissen zu dem großen Genie. Alles vereinigte sich zu einem unermeßlichen Ganzen, das uns bis zur Frenesie ausfüllte. Es war ein einziger großer Zauber, der noch heute im Erinnern seine bestrickende Kraft ausübt, ja, der aller kleinlichen, menschlichen Schlacken entblößt, in geradezu klassischer Verklärtheit auf mich wirkt.
Wagner war für alle seine Künstler die Güte und Nachsicht selber. Für mich war er es ganz besonders. Sein durchgeistigtes Auge ruhte oft liebreich auf mir und forschend, als wolle es mein Inneres durchdringen. Man quälte ihn aber unaufhörlich mit kleinlichen Dingen, und brauste er dann einmal tüchtig auf, so durfte man sich nicht verwundern. Nur wenige erkannten die immense Arbeit dieses Mannes! Selbst wenn er über Leichen gegangen wäre, um sein Ziel zu erreichen, wer hätte es ihm verdenken sollen? Aber auch das tat Wagner nicht. Er bemühte sich redlich und oft mit unendlicher Geduld, einem jeden sein Recht zu verschaffen und alles, selbst das Unangenehmste, mit großem Geschick zum guten Ende zu führen. Nichts habe ich von seinem »Undank« je erfahren und niemals andern gegenüber etwas davon wahrgenommen. Er mußte doch an sich selber glauben, um Bayreuth zu schaffen, mußte Opfer verlangen von denen, die Opfer bringen konnten. Es gingen Sorgen genug an seiner Seite, von denen wir nichts ahnten. Seinen weiten Sinn in enge Verhältnisse zu sperren, gelang ihm nicht. Wohl wußten wir schon damals, daß die Gelder für die enormen Kosten erst durch Einnahmen aufgebracht werden sollten, die aber versagten. Wie schlimm es im Hause selbst aussah zu der damaligen Zeit, erfuhr ich erst 20 Jahre später durch Frau Cosima.
Aus den Briefen an seine Künstler werden die unendlichen Vorarbeiten klar, deren es bedurfte, die Aufgabe ins Rollen zu bringen. Nur wer jemals dem Werden eines derartigen Unternehmens in der Nähe zugesehen oder selbst daran beteiligt gewesen, kann sich einen Begriff von den nie endenden Sorgen und Arbeiten machen, die es bis zum letzten Augenblicke mit sich führt. Ja, wer da pünktlich zu arbeiten versteht, zu ordnen gewöhnt ist und den praktischen Blick besitzt, alles sofort am rechten Ende anzufassen, der könnte in kürzester Zeit Wunder vollbringen, wenn er nur Gleichgesinnten, zu Pflichten Gleicherzogenen begegnete. Mit den Unpraktischen und Pflichtlosen aber zu arbeiten, vertausendfacht die Mühen, denen nicht selten ideale Unternehmen gänzlich zum Opfer fallen. Daß Wagner nicht oft völlig den Mut verlor, war zu bewundern; es stellte sich ihm genug entgegen, dessen sein guter Humor und seine Tatkraft aber gottlob immer wieder Herr wurden. So gut ich konnte, half ich und erledigte umgehend alles, was er mir zu erledigen auftrug. Sobald aber Dritte in Frage kamen, blieb trotz aller Mahnbriefe das meiste unerledigt. Es war oft zum Verzweifeln.
Da saßen wir Ende Juni 1875 wieder in der »Sonne« in Bayreuth. Diesmal nicht allein. Alsbald füllten sich Gasthäuser sowohl als Stadt mit Künstlern, und im toten Städtchen begann ein ungewohntes Leben. Bis auf Niemann und Betz, die oben am Theater in einer Privatvilla Unterkunft und Ruhe gesucht, wohnten Amalie Friedrich-Materna, Scaria mit Familie, Hill, v. Reichenberg, fast alle Walküren und wir in der lieben »Sonne«; nur wenige waren im »Reichsadler« oder in Privathäusern untergebracht.
Mama und ich bewohnten ein großes Vorderzimmer, meine Schwester und Frl. Lammert ein nach dem Garten gelegenes. Wir waren die ersten, die zu den Proben kamen, und nicht lange dauerte es, so sangen wir in Wahnfried Wagner unsere Rheintöchter-Terzetten auswendig, fehlerlos – wie es sich gehörte – mit unendlicher Lust und Liebe vor.
Die edelste Erinnerung möchte ich den Augenblick nennen, als wir Wagner während unseres Gesanges die dicken Tränen übers Gesicht rollen sahen und Frau Cosima laut schluchzen hörten. Auch meine Mutter weinte still vor sich hin; was mag sie in dem Augenblick alles bewegt haben!
Und wir drei, obwohl nicht wenig stolz, waren tief ergriffen. Von nun an mußten wir allmorgen- und abendlich den Sang ertönen lassen. Unser größter Triumph lag darin, daß wir die einzigen waren, die ihre Rollen fix und fertig konnten; durch unsere große Sicherheit imponierten wir Wagner und allen übrigen. Als wir sie Liszt zum ersten Male vorsangen und wir an die so schwierigen Passagen in der Götterdämmerung gelangten, lachte Liszt und schüttelte den Kopf. Er traute seinen Ohren nicht, daß das getroffen werden konnte! Wie oft mußten wir's ihm wiederholen; und jeden Abend auch das Rheingold, zu dem sich nun auch Hill-Alberich gesellte.
Die meisten lernten in Bayreuth erst ihre Rollen. Anton Seidl, Felix Mottl, Franz Fischer, Zumpe, Zimmer, lauter kapellmeisternde Anfänger, probierten mit den Künstlern an allen Ecken und Enden. Niemann und Betz hatten sich Franz Mannstaedt von Berlin mitgebracht. Josef Rubinstein begleitete uns bei Wagner, kurz jeder studierte mit einem andern. Aus jedem Hotelzimmer tönten Nibelungenklänge, auf allen Straßen Zurufe und Pfiffe, Nibelungen-Signale, wo man ging und stand, die auch unsre Hunde kannten und laut bellend beantworteten.
Bei Wagner kamen wir täglich und allabendlich zusammen; Abende, die nichts Fremdes störte; hier gehörte der Meister den Künstlern allein, und nur Liszt nebst den nächsten Bayreuther Freunden waren diesem Kreise zugesellt. Gura sang viel Löwe'sche Balladen, die Wagner ganz besonders liebte. Hier war es auch, wo er mir Löwes Ballade »Walpurgisnacht« vorsang, deren Bedeutung er besonders hervorhob und Jos. Rubinstein aufstehen hieß, um sie selbst zu begleiten, weil dieser den Geist des Gedichtes resp. der Komposition nicht richtig erfaßte. Wagner sprach mir seine Verwunderung aus, daß die Ballade nie gesungen würde, die doch mächtig sei, und legte sie mir besonders ans Herz. Jahrelang trug ich mich mit dem Gedanken daran herum, vergaß aber den Titel und suchte, ohne zu finden. Da erhielt ich eines Tages Löwe'sche Balladen von Herrn Grunow aus Stettin zugeschickt, unter denen mir die »Walpurgisnacht« gleich einer Erlösung entgegenblitzte. Gott sei Dank, rief ich aus! Seitdem habe ich sie so viel gesungen mit dem Gedanken an Wagner, dem ich sie leider nicht mehr habe vorführen dürfen!
Wagner liebte und verehrte Mozart. Wie oft mußte ich ihm Arien aus dem Figaro Vorsingen, die er stets mit Bewunderung für Mozart besprach. Für Frau Cosima sang ich dafür einigemale Liszts Mignon, noch ehe dieser in Bayreuth erschien. Als ich eines Tages wieder »auf Begehren« dabei war, sah ich Wagner eintreten, der bis zu Ende hörte. Dann schritt er, den Kopf nach hinten geworfen – eine Haltung, die ihm das Ansehen von sehr starkem Selbstbewußtsein gab – ziemlich steif, einen Pack Noten unterm Arm, durch den Salon und wandte sich, ehe er ihn wieder verließ, an Frau Cosima: »Sieh mal an,« sagte er, »ich wußte gar nicht, daß Dein Vater so hübsche Lieder geschrieben hat; ich dachte, er hätte sich nur um den Fingersatz beim Klavierspiel verdient gemacht! Übrigens erinnert mich das Gedicht mit den blühenden Zitronen immer an einen Leichenbitter!« Und dabei imitierte er die Geste des Zitronen tragenden Leichenbitters. Frau Cosima mußte lächelnd hinnehmen, das weder ihr noch uns zu hören angenehm war. Aber man mußte ihn entschuldigen, denn auch ihm wurde es nicht immer leicht gemacht, wenn man ihn, den 62 jährigen, zu »erziehen« versuchte, wenn er z. B. das Messer nicht englisch genug beim Essen führte, wobei manches Diner ein schnelles, unerwartetes Ende nahm. Meist aber war er sehr gemütlich und scherzte viel mit den Kindern, von denen die ältesten Töchter eben aus der Pension gekommen waren. Sobald eine oder die andere auf der Bildfläche erschien, frug er sie ein bißchen sarkastisch, wie die Lampe, die Tasse, das Buch usw. auf französisch hieße, und neckte sie, weil ihm das Französisch-parlieren im eigenen Hause absolut unangenehm war. Die Antipathie dafür ging so weit, daß er 76 im eigenen Hause ein förmliches Verbot darüber erließ und seinen Gästen gegenüber den Wunsch aussprach, es möge nur deutsch in Wahnfried gesprochen werden. Im ersten Probejahr ließ es sich auch noch umgehen, obwohl Frau Cosima das Französische als Muttersprache, Liszt als Umgangssprache, zu sprechen gewöhnt waren und sich nicht gerne deutsch unterhielten.
Es ist merkwürdig, wie verhältnismäßig fremd mir Liszt geblieben ist. Wir waren doch nun allabendlich beisammen, im Jahre 76 fast noch mehr; immer war er lieb und gütig, belobte uns so viel, und dennoch bin ich ihm niemals näher getreten. Es mag wohl daher kommen, daß er in Wahnfried entweder von der eigenen Familie in Anspruch genommen ward, oder auch, 76 besonders, sich fast ausschließlich mit denjenigen Besuchern Wahnfrieds abgeben mußte, die als Patrone dem Unternehmen Gelder zuführten, ihn bestürmten, ihm keinen freien Augenblick mehr gönnten. Vielleicht lag es auch an den vielen schönen jungen und alten Frauen, die sich an seine Fersen hefteten, ihn in die Kirche brachten und aus der Kirche holten, die sich gleich Schönheitspflästerchen neben ihm ausnahmen, und die dem großen Manne so notwendig schienen wie Luft und Sonne! Er wars gewöhnt! Wars gewöhnt von seinen Schülern, von den tausend Hilfsbedürftigen, die seinen Beistand erbaten, und denen er mit seinem gütigen Herzen wissentlich half und wohl auch unwissentlich, indem sie seinen Namen als Lehrer mißbrauchten. Diesen vielgequälten Mann nun auch noch zu belästigen, ihn auf der Straße oder im Theater anzufallen, wie so viele andere es taten, versagte ich meinem Wunsche und beschränkte mich darauf, ihn bei gegebenen Gelegenheiten zu sprechen, die sich mir täglich in Wahnfried boten, wo wir uns beim allabendlichen Stelldichein oder bei intimeren Künstlerdiners zusammenfanden.
Mit welchen Gefühlen Wagner seiner Dankesschuld Liszt gegenüber gedachte, erfuhren wir nach den ersten Aufführungen, als wir im engsten Künstlerkreise zum Diner in Wahnfried versammelt waren und Wagner auf Liszt einen Toast ausbrachte. Unendlich warm und herzlich sprach er und beleuchtete die unermüdlichen Opfer, die ihm Liszt gebracht, und wie er ihm von ganzem Herzen dankbar sein müsse für all die Freundschaft, die er ihm unbeirrt und treu gehalten habe. Wagners Worte und Liszts Antwort rührten uns gleichmäßig. Es war der erste Einblick, den ich von Wagners Seite in die große gütige Menschenseele Liszts tat und dieser sagte mir genug, um allen törichten Redensarten von Wagners Undank ein für allemal die Spitze abzubrechen. Die Wirkung auf die Anwesenden war so stark, daß wir selbst eine Kollegin umarmten, die es weder um die Sache noch um uns verdient hatte, die wir nun in Gnaden wieder aufnahmen und alles Vorgefallene vergessen sein ließen.
Nicht immer gings so rührend zu; wir hatten allen Grund lustig zu sein. Bayreuth gehörte 75 noch den Künstlern allein, und diese stellten es einfach auf den Kopf. Doch nein! Sie machten es eigentlich zu ihrer Spielstube, und die kleinbürgerlichen Bayreuther standen auf dem Kopf. Betz und Niemann, die oben in der Villa wohnten, bekam man wenig zu sehen. Nur wenn wir bei Betz Kaffee tranken, sah man Niemann-Siegmund auf dem Parterrefenster mit den Beinen baumelnd, seine Rolle lernend, sitzen. Mannstaedt begleitete ihn am Klavier, Niemann schlug sich den Takt, wiederholte tausendmal jede Phrase und schimpfte sich selber, wenn er fehlte. Nach getaner Arbeit wurde es in der »Sonne« lebhaft. Scaria, dessen Äffchen immer am Fenstergesims herumlief, der seine kleine Frau, wenn sie ihn ärgerte, auf den Ofen setzte, von wo sie allein nicht mehr herunter konnte; Eilers-Fasolt, Gura und andere Herren führten, in Leintücher gewickelt, vor dem Hotel wilde Kriegstänze auf. Amalie Materna setzte sich in den leeren Hotel-Omnibus, der immer abgespannt vor dem Hause hielt; ich und meine Schwester schwangen uns auf den Bock, die Peitsche in der Hand, Friedrich und Scaria zogen ihn durch die Straßen; und das alles am hellen Mittag. Jeden Abend brachten wir uns Ständchen; alle Morgen waren sämtliche Stiefel und Schuhe vor den Türen verwechselt, und so ging's fort und fort. Partien und Picknicke nach dem »Rollwenzel«, den Jean Paul berühmt gemacht, oder nach Phantasie, oder auch ins neue Theater hinauf, in dem man eben auf Wasser gestoßen war und wo darum die ganze Bühneneinrichtung geändert werden mußte; kurz es war ideal toll, wie wohl nie etwas wieder sein wird.
Eines Abends führten wir Künstler sogar Schillers »Handschuh« auf. Proben und Vorbereitungen hatten uns tagelang in Anspruch genommen. Gura las das Gedicht. Scaria war König Franz. Er hatte fleischfarbene Trikots, kurze weiße Tarlatanröckchen an und war dekolletiert; wie eine Ballettänzerin sah er aus. Darüber fielen gleich einem Skapulier hinten und vorne je ein buntbemaltes Bauernrouleau, und eine schwarze Papierkrone, mit Gold und gelben Rüben besteckt, zierten den Kopf. Fräulein »Kunigunde« mimte ein junger langer Tenor, dem Mama aus einem Kaffeesack ein ganz enges Schleppkleid genäht und mit Gold besetzt hatte. Friedrich war »das Tigertier«, von Reichenberg »der Löwe«. »Das doppelt geöffnete Tor« spie zwar keine »zwei Leoparden hervor«, sondern Balletmeister Fricke setzte ganz behutsam zwei kleine, sechs Wochen alte Miezekatzen auf die Bühne, und in großen Lettern stand an der Rampe angeschrieben: »die Tiere dürfen nicht gefüttert werden«. Für König Franz war ein winziges Kinderleibstühlchen entlehnt worden, in das der dicke Scaria absolut nicht hineinkommen konnte. Wir drei Rheintöchter »die Damen im schönsten Kranz« waren so häßlich wie möglich zurecht gemacht. Es wurde furchtbar gelacht und zuletzt getanzt. Wagner war natürlich auch »geladen« und so vergnügt, so übermütig, daß er trotz Cosimas Anwesenheit direkt auf dem Kopfe stand und mit seiner lieben alten Freundin Marie, meiner Mutter, immer aufs neue anstieß und sein Glas leerte. So reihten sich Scherz auf Scherz aneinander, wenn wir des Ernstes und der Proben ledig waren.
Auch unbeschäftigt machten wir alle Proben mit, sahen, hörten und lernten. Außer in München, wo bereits Rheingold und Walküre aufgeführt waren, hatte man ja doch nur Bruchstücke kennen gelernt. Der Neugier, des Staunens, Kritisierens war kein Ende, aber auch keines der Aufregungen. Musik und Stoff setzten uns gleichmäßig in Extase, erfüllten uns mit Ehrfurcht einerseits und muteten uns anderseits wieder fremd und unverständlich an, bis man sich endlich des ganzen Gewebes klar geworden war. Man verstand sofort, wenn Wagner eine Szene vorspielte. Was viele der Sänger nicht begriffen, nicht singen noch spielen konnten, lernten sie schnell durch Wagners persönliche Korrektur richtig begreifen.
Zwei Szenen sind mir darum besonders unverwischbar eingegraben. Die damalige Sieglinde war Frl. Scheffsky aus München, die, wie man meinte, dem König angenehm wäre. Sie war groß, kräftig und hatte eine starke Stimme, besaß aber weder Poesie noch Geist, um auch nur das geringste auszudrücken, was sie übrigens nicht einmal empfand, geschweige denn technisch hätte wiedergeben können. In der 1. Szene, wo Sieglinde, von Schmerz und Abscheu gegen ihr seelisch häusliches Elend überwältigt, Siegmund zurückzurufen hat, versagte sie ganz. Diese Sieglinde hatte weder von der Größe des Schmerzes, noch von der inneren Gewalt ihrer Sehnsucht und ihres Schicksals auch nur die geringste Ahnung. Wagner war sehr unzufrieden und spielte ihr die Szene vor. Sieglinde steht vor dem breiten Steintisch wie festgebannt, Siegmund wendet sich mit den Worten: »fort wend' ich Fuß und Schritt« vom Herd, um hinauszustürmen. Da kämpft etwas unbezwinglich in Sieglindens Brust; ihr Gesicht malt den furchtbaren Schmerz; die Angst, daß dieser, den sie nicht kennt, von dem sie aber fühlt, daß er zu ihr gehört, sie wieder allein lassen wird in ihrem Elend, bringt sie zu dem Aufschrei: »So bleibe hier!« dabei hat sie Gesicht und Körper nur eine kleine Wendung gegeben, ihm scheinbar nachzueilen, da nimmt sie auch schon wieder die vorige Stellung ein, und mit den Worten: »wo Unheil im Hause wohnt!« stützt sie sich nach hinten mit beiden Händen fest von beiden Seiten des Körpers auf den Tisch, wo sie im Schmerz fast zusammengebrochen, den Kopf nach hinten geworfen, die Augen geschlossen, stehen bleibt, bis sie Hundings Schritt aufschreckt, den sie erst mit Aug und Ohr allein, dann mit ängstlicher Belebung des Körpers verfolgt, bis sie ihm die Tür zu öffnen geht. Das spielte Wagner mit seiner schlechten Figur so unendlich ergreifend im Ausdruck! Noch niemals hat eine Sieglinde ihn auch nur annähernd zu erreichen gewußt.
Die zweite Szene betrifft abermals Sieglinde im dritten Akt der Walküre, wenn Brünhild ihr verkündet: »Ein Wälsung wächst Dir im Schoß.« Sieglinde, die soeben noch kniend vor Brünhild diese heftig angefleht hat, ihr den Tod zu geben, springt in namenlosem Schreck empor und bleibt fast erstarrt einen Augenblick nur stehen. Plötzlich fängt ihr Gesicht an, sich zu verklären, indem ihren Körper ein höchstes Glücksgefühl durchströmt, und nun fleht sie ebenso energisch um die eigene Rettung sowie die ihres Kindes, wie vorher um den Tod. Wagner drückte diese Wandlung für den Zuschauer sowohl als für die Sängerin mit meisterhafter Klarheit aus. Wer nicht ganz talentlos war, mußte – falls er es nicht fühlte oder von selbst so machen konnte – es nach einigem Studium doch wenigstens nachzumachen versuchen. Aber es gab noch viel Ärger, und Wagner war zuletzt ganz außer sich. Noch in den letzten Proben ging er mich an, ob es nicht besser wäre, wenn ich die Sieglinde sänge? Wer aber hätte schnell die Helmwiege gelernt? Es war zu spät, und ich bat Wagner, es dabei bewenden zu lassen. Als der König am 6. August zu den Generalproben kam, mußte er wohl merken, wie schlecht es um die Sieglinde stand, denn er frug Wagner, warum man Fräulein S. mit der Sieglinde betraut habe? Wagner antwortete: »Weil wir meinten, Ew. Majestät interessierten sich besonders für die Dame.« »O nein,« gab der König zur Antwort, »gar nicht. Ich lasse sie manchmal in meinem Wintergarten hinter Bäumen und Blumen Lieder singen, das ist aber alles!« Da mir Wagner das selbst erzählte, ist es authentisch. Anekdote vielleicht, daß Fräulein S. sich in eben diesem Wintergarten in die Fluten des kleinen Sees stürzte, um Hilfe schrie, und als der König erschien, sich an ihn zu klammern wünschte. Der König soll ihr zugerufen haben: »Rühren Sie mich nicht an!«; habe darauf dem Bedienten geklingelt und diesem befohlen, der Dame behilflich zu sein. – Ursprünglich war Frau Vogel, dann Frau von Voggenhuber für die Sieglinde ausersehen, die aber beide, gleichzeitig leidend, absagen mußten.
Je mehr wir begriffen, um so größer war die Anziehungskraft; man lebte nur noch in Exaltation, löste sich auf in Enthusiasmus für das Werk. Und wie wir im Werk, so ging Wagner auf in seiner Arbeit. Und jeder Abend versammelte nach des Tages Mühen die Künstler in seinem Hause, wozu auch das ganze Orchester, Kapellmeister und Chor ein- für allemal geladen waren. In dem noch jungen schönen Garten erging man sich Arm in Arm mit Wagner selbst; wie oft stürmte ich mit ihm darin herum, wobei er mir von seinen Bayreuther Plänen sprach, daß er nicht nur den Ring, sondern auch Werke andrer großer Meister zu geben beabsichtige; insbesondere Fidelio und Don Juan. – Große Büffetts mit kalten Speisen und Bier waren im Garten aufgeschlagen, die, wie mir von bestunterrichteter Seite gesagt wurde, 25 000 Mark allein verschlangen. Hier geschah's einmal, daß Frau Jaide, unsere großartige Waltraute und sagenhafte Wala, mit einem Teller voll Brödchen neben Niemann stand, der Frau Jaide sehr gut kannte und mit ihr von einem Teller aß. Das wurde von Frau Cosima übel vermerkt, die sich Niemann gegenüber darüber aufhielt, worauf dieser Wahnfried den Rücken kehrte oder sogar abreiste. Er mußte zurückgeholt werden, und seitdem noch mancher andere, der sich der Tyrannei Wahnfrieds nicht zu fügen gewillt war.
Sobald es dunkel wurde oder regnete, zog man sich in die Salons zurück, wo viel und göttlich musiziert wurde. Wilhelmy spielte oft allein, von Levi begleitet, oder auch Quartette mit Mahr, Toms und Grützmacher ganz herrlich. Einmal sang das Ehepaar Vogl das Liebesduett aus Tristan. Gegen die Bücherregale gewendet lauschte ich atemlos. Beide Sänger begannen leise, kaum vernehmbar; steigerten ihr Geflüster zur tönenden Woge, um dann wieder langsam zurückzuebben. Ich hörte es zum ersten Male und konnte mich, als es geendet, in die Wirklichkeit nicht mehr zurückfinden.
Eines Abends, im ganz kleinen Kreise, las uns Wagner aus dem Buch: »Mein Leben« vor, das damals, erst in 100 Exemplaren gedruckt, nur in die Hände solcher Freunde kam, die ihr Ehrenwort verpfändeten, nichts daraus verlauten zu lassen. Es sollte das Erbe Siegfrieds sein. Seitdem sind fast 40 Jahre verflossen. Das Buch hat nun das Licht der Welt in hunderttausend Exemplaren erblickt, aber auch mit manchen Auslassungen. Nur meiner Mutter zulieb las er an jenem Abend uns die Stelle vor vom »Othello« in Magdeburg, wo er dirigiert und die Panik entstanden war, weil das Publikum anstatt »weiter« »Feuer« verstanden hatte. Dann eine Szene aus Königsberg – oder war es Riga? – wo Wagners Gläubiger ihn eines Abends spät noch sehr bedrängten, seine Wohnung umzingelten, dann eindrangen, und er selber auf irgendeine Art daraus entfliehen oder sich durchs Nachbarhaus retten mußte. Diese beiden Szenen, auf die wir uns sehr wohl besinnen, fehlen nunmehr in dem soeben erschienenen Buche ganz, was um so lebhafter zu bedauern ist, als für Mina Planer gerade in dieser Erzählung sich wohl eine Entschuldigung finden ließe für ihre Flucht aus den so traurigen pekuniären Verhältnissen, die für die arme, vielleicht zu bürgerlich denkende, ordnungsliebende Frau erdrückend gewesen sein müssen.
Im kleinsten Kreise hatten wir natürlich am meisten von Wagner. Als Bayreuth im Jahre 76 seine Tore nicht nur den Künstlern, sondern auch den Kunstliebhabern, d. h. dem Publikum öffnete, verteilte Wagner seine Kräfte, die Intimität ging verloren. Ganz gegen seinen Willen war sein Haus der Sammelort der Aristokratie, der Patronatsherren geworden. Nach den ermüdenden Proben fühlten wir Künstler uns geniert, formvolle Konversation zu machen mit Leuten, die uns fremd waren, oder auf künstlerisch verständnislose Fragen zu antworten. Es war nichts Ganzes mehr, nichts Intimes, es regierte nicht mehr das Innere, nur noch das Äußere: die Neugier hauptsächlich. Wahnfried konnte natürlich nicht verschlossen bleiben; die Klugheit erforderte, auf alle diejenigen Rücksicht zu nehmen, die das Unternehmen fördern halfen, und Frau Cosima unterzog sich diesen Verpflichtungen in aufopfernder Weise. Auch war es ihre Welt, in der sie sich heimisch fühlte. Wagner war mehr Künstler als irgendeiner und fühlte sich ebensowenig wohlgelaunt wie wir in dem fast ausschließlich aristokratischen Kreise, in der seinem und unserem Denken und Empfinden so grundverschiedenen Atmosphäre. Auf die Dauer war der Zwang, zu dem diese Abende sich allmählich gestalteten, höchst unbehaglich. Obwohl ich den ganzen eleganten Kreis gut kannte und manch eine mir liebe Persönlichkeit denselben zierte, waren wir doch zu abgespannt, um auf die Dauer Vergnügen daran zu finden, und blieben schließlich fort. Es war uns lieber, in Phantasie oder Eremitage allein herumzulaufen und zu denken, was wir zu denken für wichtiger hielten. Manchmal stand ich unten an den Wasserkünsten, meine Schwester oben versteckt oder auch umgekehrt; eine sang unten, die andere markierte das Echo oben, ohne daß jemand ahnte, daß das Echo »auch Lehmann« hieß. Professor Doepler d. Ä., hielt uns Vorträge über die kokette Natur oder auch über seine Kunst, kurz, wir fanden es herrlicher da draußen als im Zwange der Gesellschaft, wo wir entbehrlich zu sein glaubten.
Wir waren aber kaum drei Abende fortgeblieben, als das jüngste Gericht in Gestalt von Wagner über uns hereinbrach. Auf seine inquisitorische Frage, warum wir fortgeblieben? mußte ich ihm sagen, daß wir uns für überflüssig gehalten, wie das fünfte Rad am Wagen vorkamen. Wagner geriet außer sich, ich glaubte, er würde wahnsinnig. Er beschwor mich, nur das nicht zu denken; er müsse seine Künstler um sich haben, er wolle schon sorgen, daß wir uns die Ersten und nicht die Letzten fühlen sollten. Hatte ich geglaubt, Wagner würde unser Fortbleiben gar nicht gewahr werden, so hatte ich mich also gründlich geirrt. Es tat mir furchtbar leid, ihm und wahrscheinlich auch Frau Cosima eine ärgerliche Szene bereitet zu haben, denn obwohl leidend, kam sie am Nachmittag sich zu entschuldigen: sie habe sich bei den schweren Pflichten, die ihr oblagen, nicht um uns kümmern können. Das wußte ich und hatte nicht daran gedacht, daß sie uns unterhalten sollte. Ich mußte ihr das feste Versprechen geben, immer zu kommen, und nichts trübte mehr die wahnfriedliche Harmonie.
Liszt entzückte uns viele Abende, er spielte wundervoll. Ein Wunder ging mit ihm vor, sobald er sich ans Klavier setzte. Wie ein Schleier zog's fort von seinem Gesicht, um dem Zuschauer ein ganz anderes Bild zu enthüllen, das geistige innere Bild des Künstlers, des großen Menschen. So spielte er seine Rhapsodien und schuf Tongemälde, worin sich seine Heimat, sein Herz und sein elegantes Wesen spiegelten. Um ihn standen alle schönen Frauen, die er umspann, die ihn fesselten, denen er Kußhände, Lächeln, Nachsicht und Liebe in Tönen zuwarf, mit denen er spielte wie mit Kindern, die ihn doch nicht verstanden. Der damals bildschönen jungen Gräfin Dönhoff, geb. Camporeale, nachmaligen Fürstin Bülow, apostrophierte er – wenn diese am untersten Ende des Flügels seiner Cis-Moll-Rhapsodie lauschte – im Fis-Dur-Satz, mit den viergestrichenen Dis- und Cis-Pointen, unnachahmlich seine huldigende Bewunderung. Alle kokettierten mit ihm und – soll ich's sagen? – auch er mit allen; aber es war lieb und gütig von dem alten Manne, es hatte nichts Unangenehmes an sich. Sein Spiel verklärte sein Äußeres, in welchem sich nun sein Innerstes wiederspiegelte.
Manchmal saß ich mit Friedrich Nietzsche in irgendeiner stillen Ecke, wo er mir von dem großen Wissen Wagners erzählte, mir die Quellen nannte, aus denen er geschöpft, sich begeistert in der Verherrlichung Wagners erging, trotzdem er ruhig und leise zu mir sprach. Damals wußte er noch nichts vom »bösen, alten Zauberer«: Wagner. Aber auch ich wußte leider damals noch nicht viel von Nietzsche, und das bedauere ich heute mehr, als ich sagen kann.
Als wir am 3. Juni 1876 in Bayreuth angekommen waren, sahen wir zum erstenmal unsre Schwimmaschinen. Allmächtiger! Eine schwere dreieckige Maschine, eine gewiß 20 Fuß hohe Eisenstange, an deren Ende ein schräges Gittergestell saß; und da hinein sollten wir und darin singen! Eben hatte ich mir durch zu langes, anstrengendes Posieren für ein Ölbild arge Schwindelanfälle zugezogen, war gar nicht wohl und weigerte mich ernstlich, den Apparat zu erklimmen. Auf Zureden des alten Maschinendirektors Carl Brandt und des Ballettmeisters Fricke, stieg Riezl todesmutig auf einer Leiter hinauf, ließ sich am Gürtel anschnallen und fing nun an – von unten dirigiert – herumzufahren. Ich durfte mich doch nicht so beschämen lassen, stieg also ebenfalls auf. Es gefiel mir bald sehr gut, ich bewegte mich zunächst mit den Armen – der ganze Oberkörper war frei, anhalten konnte man sich an nichts – dann auch mit dem Körper; endlich entschloß sich auch Minna Lammert zu der Schwimmprobe, und nun schwammen und sangen wir darauf los, daß es eine Freude war. Wagner knutschte uns dann unter Freudentränen gehörig ab, und auch Brandt war des Dankes voll für unsere Tapferkeit. Mein Wagen wurde von Anton Seidl, Riezl ihrer von Fischer und der Lammert ihrer von Mottl dirigiert; jeder Wagen hatte noch einen Theaterarbeiter, der schob, und einen Extramaschinisten, wurde also von drei Männern bedient. Und doch war es gefährlich genug. Die erste große Szene der Rheintöchter spielte sehr hoch; die Wagen liefen auf einem gewiß 20 Fuß hohen Praktikabel, das auf Holzstützen ruhend immer hin- und herwackelte. Sobald die Szene ihr Ende erreichte, wurden die drei Wagen sehr schnell in verschiedenen Kulissen auf äußerst kleine Holzpodeste geschoben, die nur eben groß genug waren, die Maschine aufzunehmen. Dann wurde das große Praktikabel abgetragen, die Stützen darunter entfernt – von denen einige, schon bevor wir abgeschoben, abgenommen wurden –, und erst als die ganze Verwandlung fertig, Fricka und Wotan schon sangen, hatte man Zeit, an uns arme »Angeschnallte« zu denken. Eine Leiter wurde befestigt, und wir mußten nun, über dem Abgrund schwebend, uns langsam aus dem Gerüst heraushelfen, hinter uns die Leiter heruntersteigen. Erst vom Podest an führte eine gangbare Treppe auf die Bühne und erlöste uns aus aller Gefahr. Eines Abends, als man mich eben auf das Podest abschob, sah ich, wie der junge Brandt von meinem Wagen über das schwindende, sinkende Praktikabel zu Riezls Wagen hinüberrast, weil, wie er uns dann erzählte, der Wagen bei einem Haar, ohne seine Hilfe, in den Abgrund gestürzt wäre. Gut, daß wir die Gefahren nicht alle kannten, wir wären keinen Augenblick mehr ruhig gewesen.

Minna Lammert. Lilli Lehmann. Marie Lehmann. Flosshilde. Woglinde. Wellgunde. in Rheingold.
Ich hatte mir allerlei kecke, gut aussehende Bewegungen auf der Maschine ersonnen, fühlte mich frei, alles zu tun, was ich mit meinem Körper zu tun vorhatte, und konnte meinen Geschwistern, Wellgunde und Floßhilde, eine Menge hübscher Stellungen mit angeben. Wir waren so sicher, daß wir wirklich in unserem Element zu sein glaubten. Da hatte man den schrecklichen Einfall, uns erst in der letzten Probe am Fußgestell einen über Drahtgitter kaschierten Schwanz anzuheften, dessen dauernd zitternde Bewegung sich nicht nur der Maschine, sondern auch uns mitteilte und uns nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Noch immer höre ich Floßhildens Ruf: »Mottl, ich spucke Ihnen auf den Kopf, wenn Sie mich nicht ruhig halten!« Ich war außerstande, meinen Körper so zu wenden und zu drehen, wie ich es mir im Gefühl der Sicherheit ausgearbeitet hatte, und viele der besten kühnsten Wendungen fielen damit ins Wasser. Meine Ruh war hin, ich fand sie nimmermehr, und meinem holden Geschwisterpaar ging's ganz ebenso.
Mit überschlagenen Beinen saß Wagner auf der Bühne, die Partitur auf dem Schoß, wenn ein Orchesterstück gemacht wurde oder das Orchester allein probierte. Er dirigierte vor sich hin, während Hans Richter das Orchester unten leitete. Sie fingen zwar zusammen an, aber Wagner war in seine Partitur so verloren, daß er dem Orchester gar nicht folgte, das oft weit voraus und längst in andere Tempi übergegangen war. Wenn er denn endlich zufällig einmal aufsah, merkte er erst, daß die etwas ganz anderes spielten, als er mit seinem geistigen Ohre hörte. Sehr bemerkenswert bleibt sein Ausspruch entgegen aller metronomischen Taktschlagerei, den er gelegentlich aller melodischen Phrasen einzelner Instrumente den Künstlern öfter wiederholte: »Das gehört Ihnen, machen Sie damit, was Sie wollen.«
Vom Dirigenten sahen die Sänger fast gar nichts. Hinter ihn nagelte man also gegen die Schallwand ein schwarzes Tuch, damit man Hans Richter und seine weißen Hemdärmel fand; denn in Hemdärmeln dirigierte er und fuhr, wenn sich die Gelegenheit gerade bot, auf einem Ochsengespann hinten aufsitzend, bei glühender Hitze zu den Proben ins Theater hinauf. Alles war neu. Die ungeheuere Entfernung des Kapellmeisters von der Bühne und das Fehlen des Souffleurs. Wir Rheintöchter brauchten ihn nicht, aber viele andere brauchten ihn um so mehr. So entstanden hinter jedem Versatzstück, in jeder Kulisse, Souffleure aller Arten. Ich selbst soufflierte Siegmund-Niemann in der Walküre hinterm Herd, wenn er sehr aufgeregt war, und das war er in Bayreuth immer.
Während der Zwischenakte in Nachmittagsproben saßen wir Damen – wie wir Lehmanns vor zwanzig Jahren in Prag einst saßen – und stickten an den Kostümen oder machten Blumen.
Frau Cosima hatte manchen Einfluß auf die Kostüme und manches andere; Wagner und sie waren sehr oft ganz entgegengesetzter Meinung, wie denn Wahnfried nicht selten in zwei Parteien gespalten operierte, was sich besonders dadurch charakterisierte, daß Frau Wagner gerade diejenigen Künstler ostentativ protegierte, die Wagner für das Werk als »nicht wertvoll« bezeichnete. Aber Wagner gab schließlich in Kleinigkeiten nach, um Ruhe zu gewinnen.
Frau Wagner hatte viel Dankbarkeit für Amalie Materna. Sie arrangierte für den 9. Juli 1876, am Vortage von deren Geburtstag, eine reizende Gartenfeier. Jeder der Mitwirkenden mußte der »Mali« eine Rose bringen, die Mali, auf einem Rosensitz thronend, entgegennahm. Zuerst kamen sämtliche Kinder, dann die Künstler und schließlich Wagner mit dem ganzen Orchester. Illumination im Garten, Mondschein von oben, Angermannsches Faßbier, Büfetts und Feuerwerk. Gesänge der Rheintöchter beendeten das heitere Fest. Diesem folgte am 10. Juli abends die eigentliche Geburtstagsfeier in der »Sonne«, zu der kolossale Vorbereitungen getroffen waren. Im Garten hatte man eine kleine Bude als Bühne hergerichtet, mit nuttigen Öllämpchen beleuchtet und mit sämtlichen Leintüchern des Gasthofs und Malis Nachtjacken und Frisiermänteln als Draperie behangen. Das Programm war reichhaltig genug. Aus einem Pianino und der großen Trommel bestand das Orchester, auf denen Mottl und Herm. Levi, je nach Bedarf, die Vortragenden begleiteten. Riezl sang Mansfelder »Schnadahüpfeln« mit Mottls Begleitung. Friedrich, Malis Gatte, deklamierte »Der Radi und die gelbe Ruabn« (von Grünbaum), und ich tanzte mit Ballettmeister Fricke aus Dessau ein » Pas de Bouquet«, das großartig wirkte, uns aber auf den vielen Proben noch tausendmal mehr Spaß verursachte, da die Erregung vor dem Publikum meine Ballettkünste doch einigermaßen beeinträchtigte. Malis Jungfer hatte prachtvolles Goulasch mit Knödeln gekocht, Friedrich ein großes Faß Pilsner direkt kommen lassen. Mehr als 40 Personen nahmen teil daran, außer Wagner, der von den furchtbaren Proben ganz aufgebraucht war. Aber er hatte recht, wenn er sagte: »Wir Künstler sind eine explodierende Bande; ein solcher Abend, ein solches Zusammensein ist für andere vollkommen unverständlich und wird von Unbeteiligten falsch beurteilt. Darum bleiben wir auch am liebsten unter uns.«
Traurig-drollig und heiter zugleich wirkte das Aufkommen der Hundesteuer. Traurig, weil eine Unmenge von Tieren in die Hände gemeiner Abdecker fielen – man begegnete ganzen Karawanen dieser treuesten Menschenfreunde, von denen nur wenige gerettet wurden. Der liebe große Mensch und Tierfreund Wilhelmy hatte den Abdeckern unzählige Hunde teils abgekauft, teils abgejagt, sie unter die Sänger, Chor- und Orchestermitglieder verteilt und alle gezwungen, mindest ein Exemplar aufzunehmen, deren er jeden Tag, zu allen Stunden zu finden wußte. Für Abgekaufte hatte er drei Mark bezahlt; abgerechnet der »abgejagten« muß er ein Vermögen dafür ausgegeben haben. Während der Orchesterprobe waren oft 30-40 Hunde außerhalb dem Theater angebunden, und man kann sich einen Begriff von dem Freudenlärm machen, wenn die Probe zu Ende und jeder seinen Hund wieder abband. Auch ich hatte zu unserem »Petze Lehmann«, der bei jedem Hojotohoruf laut in Ekstase geriet, noch einen »Mime« für drei Mark von Wilhelmy erstanden, den ich aber an Tenor Richter in Nürnberg bald wieder los wurde, obwohl ich mich ungern von ihm trennte, weil das Tier von der ersten Sekunde an mit rührender Liebe an mir hing. Ebenso hatte Mali einen Pintsch, den sie jahrelang auf allen Reisen mit herumschleppte. Als wir einmal mit »Petz« eine Landpartie an den Roten Main machten, schickte Riezl den Hund die ziemlich steilen Ufer hinunter ins Wasser, wo er plötzlich verschwand. Wir gerieten außer uns. Riezl flehte Mottl um Rettung an. Mottl besann sich nicht, stürzte ihm nach ins Wasser und entdeckte Petz endlich nach langem, vergeblichem Suchen an einer Weide hängend, festgebissen. Er brachte den armen Kerl glücklich ans Land, eine Tat, die wir Mottl nie genug danken konnten. Dann verletzte sich Petz beim Sprung aus dem ersten Stock, als er mich auf der Straße Hojotoho rufen hörte, die Pfote; verlor am Mondsee in Scharfling im Kampf um einen Knochen ein Auge und starb, 14jährig, am Fußtritt eines gemeinen Menschen, als ihn das Mädchen unachtsam auf der Straße allein gehen ließ. Sein Temperament bedrohte fortwährend sein Leben und unsere Ruhe, bis sein Tod diesem unerfreulichen Zustand ein Ende bereitete.
Im Jahre 1876 wohnten wir drei Lehmänner bei Apotheker Wiedemann, wo wir ganz ausgezeichnet untergebracht waren; glückliche Menschen, die mehrere Jahre später so unglücklich endeten. Im Jahre 1883 besuchten wir die arme Frau im Irrenhause, sie schien uns nicht zu erkennen, obwohl die Oberwärterin das Gegenteil behauptete; schwieg konsequent und machte ohne Nadel und Faden unermüdlich die Bewegung des Nähens. Ihre Kinder hielt sie für Puppen. Es war gräßlich. Als wir im Begriff waren, das große, schöne Zimmer mit der Oberwärterin zu verlassen, schlängelte sich lächelnd eine zweite »Närrin« bis zur Eingangstür mit uns, um beim Aufsperren sofort hinauszuwischen. Unsre Führerin hatte das Manöver längst bemerkt, die Frau am Arm gepackt und rief ihr ziemlich streng zu: »Nein, Frau Kathi, Sie bleiben da, Sie kommen nicht hinaus!« schob sie zurück und schloß die Türe. Mir tat das Herz noch lange weh; solange ich lebe, werde ich den furchtbaren Eindruck nicht vergessen, den die stille, stumme, einst so glückliche Frau Wiedemann auf mich hervorbrachte.
In der Nacht zum 6. August war der König angekommen; im geschlossenen Wagen fuhr er nach Eremitage. Am 6. abends wohnte er mit Wagner allein in der Fürstenloge der Generalprobe von Rheingold bei und fuhr dann durch die illuminierte Stadt im geschlossenen Wagen, ich glaube sogar mit heruntergelassenen Gardinen, nach Eremitage wieder zurück. Wagner begleitete ihn. Am andern Morgen hatte der König Wagner bereits brieflich gedankt, und abends nach der Walkürenprobe schien er ganz besonders aufgeräumt und enthusiasmiert. Niemann-Siegmund hatte ihn gepackt, und Wagner war nach dem ersten Akt schon auf die Bühne gekommen, um sich am Halse Niemanns auszuweinen. Niemann hatte mit dem Siegmund den Siegmund geschaffen, erschütternd, großartig, wie ihn Wagner gedichtet hat und komponiert. Nie wieder habe ich einen Siegmund, gleich ihn, gehört, gesehen, sie können sich alle – sie mögens mir übel nehmen oder nicht –, alle begraben lassen. Seines Geistes Kraft, die körperliche Macht, sein unerhörter Ausdruck, Gott, war das herrlich! Sein erster Schritt schon weissagte das Verhängnis; die Erzählung! die Todesverkündigung! Unglück, Liebe, Schmerz, Größe, alles stand auf höchster künstlerischer Höhe im Ausdruck; Gesang und Spiel, Aussehen und Beherrschung aller künstlerischer Technik, die sich in seinem Mienenspiel konzentrierten, das alles zusammen gab uns Niemann und nahm alles, alles gefangen. Aus vollstem Herzen, vor aller Welt müssen wir ihm diese Gabe, diesen Siegmund, danken, der einzig war und niemals wiederkommen wird, so wenig wie ein Wagner.
Auch Vogls Loge ist nie wieder erreicht worden; er war der geborene Loge. Schärfe, Hohn, Witz, Neid, seine – übrigens nur für diese eine Rolle passende – outrierte Aussprache, die, scharf und bissig zugleich, nicht nur scharf klang, und seine unglaublich musikalische Sicherheit gaben vereint das Bild des vollendeten Original-Loge. Er erntete den ersten Applaus.
Auch der so charakteristische Alberich Hills, der im Fluch das Höchste an Bitterkeit auszusprechen vermochte, ist mir nur annähernd in Schelper und Haydter-Wien einmal begegnet, obgleich der letzte den höchsten Grad nicht ganz erreichte. Frau Jaides Waltraute, Erda und sagenhafte Wala fanden nie wieder ihresgleichen in den vielen Vorstellungen, die ich je gesehen. Ach, sind mir ihre Ausdrücke, die mächtigen, tief ins Gedächtnis eingegraben! Die Walaszene im Siegfried, von dem damaligen Orchester gespielt, von Betz und Jaide gesungen, gehörte für mich überhaupt zu den größten, nachhaltigsten Eindrücken des 1876 Bayreuths!
Außer Hans Richter, der eine schier unglaubliche Arbeit leistete, mit gleicher Hingabe für Wagner, seine Werke, seine Erfolge, seine Familie, mit immer neuer Lust und Liebe sich an Arbeit nie genugtun konnte, war es wohl Amalie Materna, welche der größten Anstrengung ausgesetzt war. Wenn sie auch die mächtige, für die drei Brünhilden notwendige Stimmkraft besaß, waren ihr doch Worte, Sprache, Stil, die Art des Spiels ganz fremd und stellten fast noch höhere Anforderungen an die Künstlerin als die Musik selbst. Es war nicht ungefährlich, sich monatelang solch geistigen wie physischen Anstrengungen auszusetzen, und als Wunder muß es angesehen werden, daß sie unter der Last der damit verbundenen Aufregungen nicht zusammenbrach. Heute sind sie in Fleisch und Blut übergegangen, diese Brünhilden, durch Gewohnheit und Kenntnisse ein Kinderspiel gegen damals.
Auch wir Rheintöchter taten das Unsere. Wie waren wir übermütig, lachten und scherzten, um dann bei der Weissagung an Siegfried in der Götterdämmerung um so ernster zu sein. Übrigens kann ich nicht umhin, nochmals zu wiederholen, daß ich im Rheingold nach meiner Partie stets sang: »Nur wer der Minne Macht
 entsagt« und niemals »
versagt«, wie ich später immer hören mußte. Darauf machte ich Kapellmeister Levi auch aufmerksam, als er 1884 in München wünschte, ich solle
versagt statt
entsagt singen. Wagner, vor dem ich's doch einige hundert Male gesungen habe, hätte mir es ganz gewiß verbessert, wenn er es anders hätte haben wollen. Auch spricht die Komposition schon dagegen, weil es nicht heißt: »Nur wer der Minne
entsagt« und niemals »
versagt«, wie ich später immer hören mußte. Darauf machte ich Kapellmeister Levi auch aufmerksam, als er 1884 in München wünschte, ich solle
versagt statt
entsagt singen. Wagner, vor dem ich's doch einige hundert Male gesungen habe, hätte mir es ganz gewiß verbessert, wenn er es anders hätte haben wollen. Auch spricht die Komposition schon dagegen, weil es nicht heißt: »Nur wer der Minne
 Macht versagt«, sondern: »Nur wer der Minne Macht
Macht versagt«, sondern: »Nur wer der Minne Macht
 entsagt.« Die Achtelpause
steht vor »entsagt« und nicht vor »Macht«, wie es sonst heißen müßte. Und noch auf einen zweiten Irrtum mache ich hier aufmerksam, daß wir unter Wagner in der Götterdämmerung: »Sag' es Siegfried,
sag' es uns« niemals unisono sangen. Ich möchte wohl wissen, von wem die Änderung stammt. Jedenfalls habe ich auch die Rheintöchter nie wieder so sehr in ihrem Element, so glücklich, heiter, lachend und ernst gehört noch gesehen. Mit welchen Gefühlen waren wir am Werk! Wir taten Wagner zuliebe, was wir konnten, setzten all unsere Kräfte, unser Können ein und brachten vollstes Verständnis mit für sein ungeheueres Schaffen. Unser
Herz legten wir in jedes Wort und Ton, die unsre Hingabe bekundeten.
entsagt.« Die Achtelpause
steht vor »entsagt« und nicht vor »Macht«, wie es sonst heißen müßte. Und noch auf einen zweiten Irrtum mache ich hier aufmerksam, daß wir unter Wagner in der Götterdämmerung: »Sag' es Siegfried,
sag' es uns« niemals unisono sangen. Ich möchte wohl wissen, von wem die Änderung stammt. Jedenfalls habe ich auch die Rheintöchter nie wieder so sehr in ihrem Element, so glücklich, heiter, lachend und ernst gehört noch gesehen. Mit welchen Gefühlen waren wir am Werk! Wir taten Wagner zuliebe, was wir konnten, setzten all unsere Kräfte, unser Können ein und brachten vollstes Verständnis mit für sein ungeheueres Schaffen. Unser
Herz legten wir in jedes Wort und Ton, die unsre Hingabe bekundeten.
Nehmen wir noch Gura als wirklich prachtvollen Gunther hinzu, der an Noblesse, schauspielerischem Wert und stimmlicher Schönheit künstlerisch Unübertreffliches leistete, und Schlossers ausgezeichneten Mime, das geradezu göttliche Orchester, aus dem heraus wir heute noch Wilhelmys zauberhafte Rheingoldklänge zu hören meinen, den ausgezeichneten Chor, so sind wir fertig mit dem Hervorragendsten der damaligen Aufführungen des 1876 Bayreuths. Welch unendliche Liebe für Wagner machte damals möglich, was von den Künstlern kein anderer hätte fordern dürfen.
Als Wagner am 1. August 1875 das Theater betrat – wir hatten lange schon auf ihn gewartet – ertönte, von dem mächtigen Orchester gespielt, das Walhallmotiv, und Betz-Wotan sang mit seiner herrlichen Stimme, seiner großen Gesangskunst:
»Vollendet das ewige Werk:
auf Berges Gipfel
die Götter-Burg.
Prunkvoll prahlt
der prangende Bau!
Wie im Traum ich ihn trug,
wie mein Wille ihn wies,
stark und schön
steht er zur Schau;
hehrer, herrlicher Bau!«
Welch ein ergreifender Augenblick! Wagner hatte übrigens keine Zeit, ergriffen zu sein; er trat ans Orchester vom Parkett aus heran und rief begeistert: »Ich habe meinen Prozeß gewonnen, die Akustik ist ausgezeichnet.« – Allen dankte er, die ihm die Freude zuteil werden ließen, an dem schwierigen Werke mitzuschaffen, und betonte, daß es sich hier um ein Kunstwerk von großer Bedeutung und nicht etwa um banale Schwindeleien handle.
Daß Wagner Scaria aufgeben mußte als Hagen, war wohl für das Unternehmen von großem Schaden, denn er wäre wie kein anderer gewesen. Scarias enormer Ansprüche halber mußte es unterbleiben; es waren ohnehin genug der Kosten. Niemann, Betz, meine Schwester und ich sangen umsonst, und wie gerne hätten wir noch mehr für ihn getan, wenn man damals in der Lage gewesen wäre oder in die Zukunft hätte schauen können. Aber wir vier waren die einzigen Idealisten, alle anderen ließen sich bezahlen.
Unsere Walkürenszenen gingen vortrefflich. Frau Jachmann-Wagner, Wagners berühmte Nichte, die ich von Berlin kannte, wo sie anfangs der 70er Jahre noch als Schauspielerin wirkte, darin aber weniger leistete wie als Sängerin, führte uns an. Wir arbeiteten mit ihr eine Menge Stellungen aus und gestalteten sie so kühn, als es nur eben möglich war. Wir hatten viel gearbeitet, alle wie wir dort waren, und Wagner, der für alle andern mitarbeitete, leistete Ungeheueres; er war oft sehr herunter, sehr leidend. Das physische Leiden verschwand aber in den tausendfachen Nöten, welche das kolossale Unternehmen mit sich brachte, bis endlich die Höhe erklommen war und die Vorstellungen begannen.
Nach der ersten Walküre hatte Wagner uns alle auf der Bühne versammelt. Draußen schrie und tobte das Publikum, wir aber standen im kleinen Kreise um den großen Meister, der nun in glühenden Worten uns mit seinem Dank überschüttete für alle Mühen und fürs Gelingen; er war aufs tiefste ergriffen. Wagner küßte uns, es war uns feierlich zumute. Niemann, der zufällig neben mir stand, überkam auch die Rührung, etwas, was ich nur dies eine Mal an ihm wahrgenommen, und trotzdem wir noch immer – vom Rienzi her – sehr gespannt waren, umarmte er mich ganz impulsiv und küßte mich. Er hätte wohl auch jemand andern in diesem großen Augenblick geküßt, der zufällig neben ihm gestanden hätte. Da, in demselben Moment, öffnet sich die Bühnentür, und Frau Hedwig Niemann-Raabe schreit laut auf: »Aber Albert«, wirft die Türe wieder zu und fort war sie. Die kleine Frau und große Künstlerin war immer schon eifersüchtig auf mich gewesen; auch dann noch, als wir später intim befreundet, uns duzten, sie mir, ich ihr Beweise höchster Freundschaft gegeben hatte. Natürlich lachte ich sie aus, aber sie behauptete nach wie vor: »sie sei trotzdem noch immer eifersüchtig auf mich.« –

Marie Lehmann, Lilli Lehmann Ortlinde, Helmwiege in Walküre.
Obwohl in der »Sonne« bereits eine Halle angebaut war für die erwarteten Besucher, hatten wir Künstler doch immer noch den kleinen Saal für uns, in dem wir uns zum Mittagessen zusammenfanden, und zu dem nur wenig Auserlesene – wie Graf und Gräfin Danckelmann z. B. – Zutritt hatten. Hier ging's noch immer heiter zu, und jedes Diner schloß damit, daß Mottl als Dame verkleidet, in Malis Roben, Hut und Schleier über die Straße ging, um Mohrenköpfe zu holen, die täglich ein anderer zum besten gab. Einige der Walküren machten hie und da Besuche in der Nibelungenkanzlei, und auch ich hatte mich einmal so weit in das hinterste Bayreuth verstiegen. Auf diesen Besuch folgte ein an mich gerichteter Brief Anton Seidls, der von dem damals in Bayreuth herrschenden Ton am besten Zeugnis gibt:
Bayreuth, 20. Juli 1876.
Geehrtes Fräulein!
Sie verzeihen, daß ich Ihre künstlerische Tätigkeit mit etwas Profanem störe, nämlich mit einem Damen-Regenschirm, der bei mir stehen blieb. Im Kaffee-Salon unseres Nibelungenkanzlei-Palais hängt er und starrt uns mit seiner güldenen Kette am Griff und seinem lila-seidenen Futter im Leibe an. Erst kürzlich hörten wir die Mähr von seiner Existenz, da uns berichtet wurde, daß im Tann unseres Kaffee-Salons die blaue Stute der Hengst (mein Regenschirm!) stößt. Wer ist die Walküre, die das vermochte? Oder wäre es Woglinde, Welgunde, Floßhilde, die den zottigen Gesellen verschmähte? Kunde gewänne sich gern Ihr
achtungsvoll ergebener
Anton Seidl.
In der kleinen Restauration, linksseitig vom Wagnertheater, nahmen wir nach langen Abendproben unsere Mahlzeit ein. Sobald wir uns ein bißchen gestärkt und erholt hatten, traten wir auf die Veranda, schoben das Pianino heraus, löschten die »Gas-Zünde«, und nun spielte und sang uns der damals 20jährige Mottl mit seinem großen Talent, seiner reizenden Stimme den ganzen Tristan auswendig vor. In Dunkel gehüllt, ungestört, lauschten wir und verloren uns in Hochgenuß dieser weihevoll berückenden Stunden, von aller Welt – selbst von dem »Ringe« – losgelöst. Der Tristanzauber wirkte übermenschlich.
Im Frühling 76 war der Tristan in Berlin herausgekommen, Wagner studierte ihn dort ein, inmitten seiner Riesenarbeit und den Vorbereitungen zum Ring. Es wurde ihm nicht gedankt. Der Erfolg blieb weit hinter unseren Erwartungen zurück, das Berliner Publikum war noch lange nicht reif dafür, d. h. viel zu wenig vorbereitet, um auch nur annähernd die Größe und Erhabenheit dieser einzigen Musiksprache würdigen zu können. Die Aufführung war teilweise unübertreffbar. Niemann als Tristan wohl das Erhabenste, was je auf dem Gebiet des Musikdramas geleistet wurde. Auch Frau von Voggenhuber leistete Außergewöhnliches für die damalige Zeit. War ihr ja doch alles, was das Tristanwerk betraf, vollständig fremd. Marianne Brandt als Brangäne, Betz als Marke prachtvoll, das Orchester unter Eckert, der das wundervolle Werk großzügig leitete, ausgezeichnet. Nichts fehlte als das volle Verständnis der Zuhörer.
Als der Tristan in Weimar zuerst gegeben wurde, war Richard Wagners Art, Musik und Sprache noch ziemlich neu, den meisten Sängern fremd. Undeutschen wird sie es wohl auch bis zu einem gewissen Grade zeitlebens bleiben. Kein Wunder, daß die damaligen Künstler beim Studium ihrer Rollen fast verrückt wurden. Kein Wunder, daß Schnorr von Carolsfeld, der erste Tristan, darunter – wie behauptet wird – schwer zu leiden hatte, obwohl er selbst nichts davon erzählt, und Ander in Wien sie überhaupt nicht singen konnte. Die Fremdartigkeit der Sprache, der niemals vorher angewandte Wortschwall, der über alles je dagewesene Umfang der Rollen, die übermäßige Anspannung des Gedächtnisses, alles das mußte einen schlimmen Einfluß auf diejenigen Künstler ausüben, die ihren Aufgaben unvorbereitet gegenüberstanden. Kein Wunder, daß auch das Publikum nicht verstand, was ihm erst nach Wagners Tod verständlich wurde. Frau von Voggenhuber hatte sich noch ausgemacht, acht Tage vor und acht Tage nach jeder Tristanaufführung unbeschäftigt zu bleiben, während Vogl und ich 1890 die beiden Rollen in sechs Tagen dreimal in Newyork sangen. Man hatte, ohne uns zu fragen, das Repertoire gemacht, und keiner von uns hatte das Herz, die ausverkauften Vorstellungen abzusagen. So ändern sich Zeiten, Ansichten und Fähigkeiten.
In Berlin fehlte ich in keiner Probe und versäumte keine Vorstellung. Von einer der ersten Orchesterproben erzählte mir ein Musiker, wie man sich über »des Hirten Weise« lustig gemacht habe; er nannte es: »ein nie endendes, langweiliges Englisch-Horn-Solo, das zum einschlafen sei.« Und wie tief packte mich gerade diese »Weise« und griff mir ins Herz, als ich sie zum ersten Male hörte. Mit geschlossenen Augen lauschte ich den zauberhaften Harmonien des 2. Aktes, und erst als Niemann-Tristan den 3. Akt begann, sah ich auch. Es war eine Offenbarung des Gedichtes, des Musikdramas.
Damals in Berlin und auch noch in Bayreuth 1875-76 schien mir die Isolde je zu singen verschlossen. Aber meine inneren Flügel hatten sich bereits gereckt nach ihr; Worte und Musik hatte ich schon in mir verarbeitet, ich stand der großen Aufgabe nicht unvorbereitet gegenüber, als ich sie mir ganz zu eigen machte, mit allen Erinnerungen mächtiger Eindrücke und Vorbilder sie dann endlich wiedergeben durfte. Wieviel lag aber dazwischen! Liebe, Kummer, Enttäuschungen, Krankheit, Tod meiner Lieben, unendliches Leid und wie die Dinge alle heißen, die aus einem einfachen Mädchenherzen eine volle Künstlerseele zu schmieden vermögen. Wenn dieses »werden« dem armen Herzen nur nicht gar so weh täte. Es wird zermartert und zertreten, und wenn es nicht dabei zugrunde geht, nach all dem Leid doch noch etwas zu leisten vermag, so muß es schon etwas Großes sein, das ihm als Entschädigung für das, was es gelitten hat, zuteil werden muß.
Bayreuth beherbergte nun alles, was mit Musik zu tun hatte, was sich dafür interessierte, und was so tat, als verstände es etwas davon, oder als protegiere es die Kunst. Viel liebe und viel unliebe Menschen aller Arten, wie das so üblich ist. Unsere Vormittagsübungen in der »Sonne«, die eigentlich nur Dönhoffs, Graf und Gräfin Danckelmann, Cuno Moltke und Major v. Rabe – einer der wenigen echten Musikverehrer und unser treuer Freund – zuliebe noch stattfanden, mußten wir aufgeben. Man vermied nach Kräften allzu häufige Begegnungen und fand sich im Theater bei Wagner oder allgemeinen Versammlungen ohnehin zusammen. Sogar Hülsen war zum Ring gekommen und sollte Abends vorher mit Wagner in Wahnfried beim Empfang zusammentreffen. Beide Männer waren ein wenig verlegen, über die erste Begegnung fortzukommen, weshalb Hülsen mich bat, ihm behilflich zu sein, was Wagner, wie ich merkte, ebenfalls sehr gelegen kam. Es ging denn auch viel besser, als man fürchtete. Hülsen wollte allerdings vom ganzen Ring nichts wissen, er gedachte nur die Walküre aufzuführen, was ihm, wie allen andern, abgeschlagen wurde. Ob das zu Wagners Besten war, kann ich nicht ermessen; aber ich meine, man hätte dann alsbald auch die andern zum Ring gehörigen Werke gegeben.
Ein strahlender Kreis war vereinigt, das Werk in sich aufzunehmen oder zu bekritteln. Geistig große bedeutende Menschen, Musiker, Maler, Architekten, gekrönte Häupter, Fürsten, Grafen, Lords und Ladies fanden sich allabendlich in Wahnfried zusammen. Wagner ging diese Art von »Hofhalten« gegen sein künstlerisches Gefühl, ihn machte mürbe und unfroh, was Frau Cosima Gelegenheit bot, ihre glänzenden geistigen und gesellschaftlichen Eigenschaften zu entfalten und leuchten zu lassen. Sicher ist es ihr zu danken, daß es ohne allzu große Differenzen bei diesen »Meetings« zwischen Wagner und » le monde»abging. Interessant war's aber schon am meisten für den gänzlich unbeteiligten Zuschauer.
Graf und Gräfin Schleinitz gaben in ihrer Privatwohnung ebenso gemütliche Tees wie in Berlin im Hausministerium, wo man in eleganter Behaglichkeit, von auserlesenen Menschen umgeben, sich stets wohl befand. Nebst dem König von Bayern und den Künstlern war es wohl die Gräfin hauptsächlich, die sich um das Zustandekommen Bayreuths das größte Verdienst erwarb.
Gerade als die große Hungersnot in Bayreuth ausbrach – es war während dem 2. Zyklus – lud uns das Großherzogliche Paar von Mecklenburg-Schwerin zu einer Soiree. Der Großherzog, der mich führte, versicherte mir, daß es in Bayreuth tatsächlich nichts mehr zu essen gäbe, er aber Sorge getroffen habe, daß wir nicht zu hungern brauchten. Außer der Frau Großherzogin Marie war auch ihre Tochter anwesend, die von Schönheit und Liebreiz umflossene Großfürstin Paulowna, sowie mehrere andere zur Familie gehörige Damen und Herren. Das Großherzogliche Paar war erquickend liebenswürdig, wir lachten, scherzten, unterhielten uns prächtig, und als wir schließlich noch »ungebeten« unsere Rheintöchterterzette »losließen«, die uns der allverehrte Alois Schmidt begleitete, war der Dankbarkeit kein Ende. Sehr spät erst empfahlen wir uns nach dem so heiter und glücklich verbrachten Abend, den wir in so auserlesener Gesellschaft genossen, und der uns noch lange in frischem Erinnern verblieb.
Gleich anfangs der schönen Bayreuther Zeit hatten Hill, Betz, Eilers, Mottl und wir drei Rheintöchter gemischte Quartette von Mendelssohn nebst melodisch schönen von Spohr einstudiert, die wir zu unserer persönlichen Freude sangen, sobald wir unter uns waren. Eines Tages war ein Riesenpicknick von Scaria und Friedrich nach Berneck für die Solisten arrangiert, wohin wir mit allem Essen und Trinken, Spielen – ja sogar Eis wurde mitgenommen – in 6 bis 8 Kremsern fuhren. Schon unterwegs wirkte die Heiterkeit der »Impresarii« ansteckend; mich wundert heute noch, daß wir überhaupt in Berneck ankamen. Sobald wir auf dem Lagerplatz ausgepackt hatten, fing es an in Strömen zu gießen, tat aber unserem Frohsinn keinen Eintrag, die Lustigkeit ließ sich durch nichts vermindern. Arm in Arm mit Wotan-Betz, der schützend einen Regenschirm über mich breitete, Mottl und Lammert – die keine Schirme mithatten – hockten unter einer großen Holzbank, Riezl mit mehreren anderen unter dem Tisch, sangen wir mit den Vögeln des Waldes um die Wette unsere Quartette zum Lobe Gottes wie seiner Herrlichkeit. Für des Wetters Unbill entschädigte uns ein wunderbarer Abend, der neue Heiterkeit erweckte, alles Ungemach vergessen ließ.
Bald sollte sich uns eine günstige Gelegenheit bieten, die schön studierten Quartette noch anders zu verwerten. Als König Ludwig während der Generalprobe in Bayreuth weilte, faßten wir den Entschluß, ihm in Gestalt eines Ständchens Verehrung und Dankbarkeit zu erkennen zu geben. Auf unsere Anfrage beim Hofmarschallamt kam der Bescheid, daß S. M. die Huldigung gerne entgegennehmen würde. Nach der Generalprobe vom Siegfried fuhren Betz, Hill, Mottl und wir drei Rheintöchter – noch bevor der König das Theater verlassen hatte – nach Eremitage, d. h. vorläufig bis Rollwenzel, der auf halbem Wege liegt, stiegen dort aus und begaben uns in ein dunkles Zimmer, wo wir bei einem im dunkel gehaltenen Lichtstümpfchen noch schnell mehrere Piecen probierten. Licht durfte von außen nicht gesehen werden, wenn der König vorbeifuhr, und vorbei mußten wir ihn lassen, ehe wir ihm folgen durften. Alles mußte geheimnisvoll, ohne daß der König das Geringste wahrnahm, vor sich gehen. Es mochte wohl 11 Uhr Nachts geworden sein, als wir in Eremitage ankamen; wir warteten auf jemand, der uns in ein Bosquet führte, wo wir von einer spanischen Wand verdeckt, bei kleinen Blendlaternen, zu singen anhuben. Der König ging nicht weit von uns entfernt auf und ab; in seiner Nähe stand ein Tisch mit einer Lampe, an dem er vielleicht seine Abendmahlzeit eingenommen; sonst aber herrschte Totenstille in dem wundervollen Garten, den der Mond hell bestrahlte. Geräuschlos, wie wir gekommen, schlichen wir nun wieder fort. Uns hatte das Herz nicht schlecht geklopft, als ging's zum Schafott. Ich erinnere mich, daß Riezl vor Erregung halb ohnmächtig war. Der König ließ uns aber doch noch herzlich danken und sagen, wie sehr wir ihn erfreut hätten mit unserem schönen Sang. Wie mir Wagner erzählte, hatte der König vor, mich mit einem Orden auszuzeichnen. Da er aber feinfühlig, keine der anderen Künstler kränken mochte, unterblieb die Auszeichnung, und er entschloß sich, meinem Gefühl nach, für eine viel größere: er sandte uns sein großes Bild mit seiner Unterschrift. Nun sehe ich den schönen, merkwürdigen Mann und König immer vor mir und denke dabei der vielen Dinge, die mir Wagner von ihm erzählte, wie er der Welt und den Menschen erst so vertrauensvoll entgegentrat, und wie eben diese Menschen seine Güte, sein Vertrauen auf das schändlichste mißbrauchten. So ward er zu dem menschenscheuen Manne und König, wie wir ihn damals, 1876 in Bayreuth, sahen oder eigentlich mehr ahnten. Denn wenn er im geschlossenen, mit Gardinen versehenen Wagen vorbeiraste oder in der dunklen Fürstenloge des dunklen Theaters saß, konnte man trotz aller Gläser doch nicht von »ihn gesehen haben« sprechen. Nie wieder ward mir das Glück, ihm zu begegnen.
Wie damals in der Generalprobe mir vor König Ludwig das Herz bebte, ebenso bebte es bei den ersten Tönen des Rheingold in der ersten Aufführung. Als es da unten zu klingen und rauschen anfing, und ich plötzlich meine Stimme erschallen lassen sollte, die ersten Töne einer menschlichen Stimme im Zauberreiche des Rheins. Ein glorreicher Augenblick, der mich viel Aufregung und Angst kostete. Über die Aufführungen haben andere geschrieben, die sie vom Standpunkt des Publikums, des Zuschauers oder Hörers beurteilten. Was ich hier von Bayreuth erzählte, ist Intimes, das in mein Leben oder an mein Herz griff.
Mit den ersten Aufführungen war auch der Höhepunkt überschritten; es konnte nichts mehr kommen, das unsere Extase, man konnte dreist sagen: den Paroxismus unserer Nerven mehr noch zu steigern vermocht hätte. Es bedurfte keines einzigen Tones mehr, um uns fühlen zu lassen, daß der Mensch nicht ungestraft unter Palmen wandeln dürfe, der Kunst ungemischte Freude keinem Sterblichen zuteil wird. Letzteres erfuhren wir schon bei dem großen Bankett im Theaterrestaurant, das Wagner nur seinen Künstlern zu Ehren gab, wozu sich Unberufene und Elemente schlimmster Sorte Plätze erschlichen hatten. Es hinterließ keinen guten Eindruck. Toaste waren ausgebracht worden, die Mißstimmungen hinterließen. Die letzten Tage waren nicht mehr schön. Es war zuviel an uns vorübergegangen, zuviel des Großartigen, um allzu Menschlich-Nüchternes ertragen zu können. Man sehnte sich nach Ruhe für das so lange überangespannte Gefühl, und im Genusse der Erinnerung wurde einem erst klar, was man erlebt, genossen hatte. Das, was über unser aller Kräfte ging, lag nun, gleich einem Traume, hinter uns. Wie es Wagner, dem Schöpfer alles dessen, zumute war – ich fühlte tief mit ihm – sagt uns ein lieber Brief, den er mir nach Schluß der Aufführungen schrieb, den ich hier als Schlußstein einfüge zu seinem Andenken, in welchem sich sein großes Herz voll Dankbarkeit offenbart, dem das meine voll herzlichster Dankbarkeit und Liebe entgegenschlug.
(Ohne Datum, nach den Festspielen 1876.)
Oh! Lilli! Lilli! –
Ihr waret das Schönste, und – Du gutes Kind hattest recht – das kommt nie wieder!
Das war der Zauber des Ganzen, meine Rheintöchter! Fidi singt immer ihre Melodien!
»Gebt uns das Reine zurück!« –
Grüß Marie! Sie ist so gut! Gott, waret Ihr Beide gut! – –
Ach, wie schön, wie gut waret Ihr! – Und nun! Nicht einmal das Nachspiel war mir gegönnt! Oh, hätte ich die Lilli dabei gehabt!
Und nun gar Braut! Gratuliere! Adieu, liebes, gutes Kind! Lilli!!
Richard Wagner.
Bayreuth, 7. Sept. 1876.
Oh, mein gutes, liebes Wesen!
Wie hat mich Ihr Brief gerührt!
Von dem Vergangenen habe ich eigentlich keine andere Besinnung als das Bedauern, gerade auch gegen Sie, mich noch nicht so recht dankbar bewiesen zu haben! Sonst ist mir alles dumpf auf der Seele. Als meine Pferde gestern fortgeführt wurden, brach ich in Tränen aus! In 8 Tagen denken wir nun uns nach Italien aufzumachen. So gleich möchte ich doch nicht etwas Ähnliches beginnen; nur der König wollte absolut eine 4. Aufführung, Ende d. M. erzwingen, was natürlich abgeschlagen werden mußte.
Wir werden nächstes Jahr noch vieles zu korrigieren haben; ich hoffe, die meisten werden willig dazu sein, zu meinem Ziele, eine immer korrektere Aufführung herbeizuführen, mitzuwirken. Nur Betz wirft einen Schatten in meine Erinnerung! Der Unglückliche ging so weit, namentlich im Anfang der letzten Aufführung der Walküre, seine Partie geradeswegs zu verspotten. Während ich über die Gründe seines Benehmens immer noch nachsinne, bestätigt man mich immer noch mehr darin, daß er sich geärgert habe, nicht herausgerufen werden zu dürfen! Ich geriet schon einmal auf diesen Verdacht und befrug ihn darum, worauf er mir lächelnd ablehnend erwiderte, »er und Niemann gingen ja überhaupt meistens gar nicht heraus, um sich zu bedanken!« …
Nun ich denke mich darauf vorsehen zu müssen, den Wotan für nächstes Jahr anders zu besetzen, da Betz erklärt hat, nie, unter keinen Umständen je wieder nach Bayreuth kommen zu wollen. – Was halten Sie, Beste, davon? –
Im übrigen mag ich mich jetzt noch nicht zu sehr mit dem Zukünftigen befassen, es lastet mir genug auf der Seele! – Aber, – aber – Sie, liebstes Wesen, und – nehmen wir sie nur gerne mit dazu – die Schwestern, oh, Ihr strahlt hell und wahrhaft verklärt vor mir! Ich vergesse die ungeheure Energie Eurer Todesweissagung an Siegfried nie! –
Und so bewahren uns die Götter das Beste: und so grüße ich Sie, liebe Lilli, von ganzem Herzen, als
Ihr
treu dankbarster Schuldner
Richard Wagner.
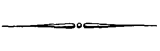

Lilli Lehmann als Fidelio.