
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Immer weiter hinaus, immer höher hinan, immer tiefer hinein in Kunst und Leben, nach Wahrheit und Schönheit zu schürfen! War ich auf meinen ersten beiden großen Reisen ziemlich ziellos in die weite Welt hinausgefahren, so hieß es jetzt, den Blick fest, wenn auch nicht ohne rechts und links zu schauen, auf das nächste Ziel zu richten, das ich mir gesteckt hatte. Das Hauptziel im Auge, brauchte ich es mir doch nicht zu versagen, alle Blumen zu pflücken, die links und rechts an meinem Wege blühten, und alle Früchte zu brechen, die an ihm reiften. Ein reiches Jahr lag wieder vor mir.
Auf dem Wege nach Italien hatte ich in Deutschland und in Österreich noch manches nachzuholen. Von Hamburg ging es über Berlin und Dresden nach Prag und Wien, die ich zum erstenmal sah, von Wien über Pest und Triest, von wo ich einen Ausflug nach Pola unternahm, nach Venedig.
In Berlin hielt ich mich nur so lange auf, wie nötig war, um im alten Museum die antiken Kunstwerke auf ihre Beziehungen zur Landschaft in der Kunst der alten Völker anzusehen. Auf griechischen Vasenbildern und römischen Mosaiken fand ich manches, was mich festhielt. Vor allem wurde ich hier durch einige freilich ungenügende Nachbildungen auf die hellenistischen Odysseelandschaften vom Esquilinischen Hügel in Rom aufmerksam, die die schönsten und wichtigsten aller erhaltenen antiken Landschaftsbilder sind.
Nahezu vierzehn Tage aber blieb ich in Dresden, das bei strahlendem Herbstwetter alle seine unvergleichlichen, damals noch idyllischer als heute dreinblickenden Reize entfaltete. Durch einen besonderen Glücksfall geriet ich hier gleich in einen Kreis namhafter, aus ganz Deutschland zusammengeströmter Vertreter der neueren Kunstgeschichte, die mich veranlaßten, mich auch auf ihrem Gebiete sofort mit zu betätigen. Es waren geradezu entscheidende Tage für meine Einführung in die vergleichende Gemäldekunde. In Dresden fand nämlich gerade die vielbesprochene Holbein-Ausstellung statt, auf der die Darmstädter und die Dresdener Madonna mit der Familie des Bürgermeisters Meyer nebeneinandergestellt waren, um die Streitfrage zu entscheiden, welche von ihnen als das echte Bild Hans Holbeins des Jüngeren anzuerkennen sei. Aber auch eine große Reihe anderer echter und zweifelhafter Bilder des großen oberdeutschen Meisters des 16. Jahrhunderts waren in den schlichten Sälen des alten Akademiegebäudes auf der Brühlschen Terrasse vereinigt. Den Kunstgelehrten ganz Deutschlands gesellten sich einige Vertreter des Auslandes. Eine Reihe der bekanntesten Kunstforscher, wie Alfred Woltmann selbst, der sich durch sein Buch »Hans Holbein und seine Zeit«, das 1866-68 erschienen war, einen Namen gemacht hatte, wie Ed. His-Heusler, der bekannte Baseler Holbein-Kenner, wie Karl Schnaase, der seinerzeit berühmteste deutsche Kunstgeschichtschreiber, wie Moritz Thausing, der noch an seinem grundlegenden Dürerbuch arbeitete, und Wilhelm Bode, der gerade anfing, sich zu dem kenntnis- und einflußreichsten deutschen Kunstgelehrten zu entwickeln, waren schon wieder abgereist. Noch in Dresden aber weilten Julius Meyer, der vielgenannte Verfasser der Geschichte der modernen französischen Malerei, der einige Jahre später Direktor der Berliner Gemäldegalerie wurde, Karl Justi, der noch am zweiten Bande seines großen Werkes über Winckelmann und seine Zeitgenossen arbeitete, Carl von Lützow, der schon damals einflußreiche Herausgeber der Zeitschrift für bildende Kunst, Friedr. Th. Vischer, der berühmte Ästhetiker, dessen Bekanntschaft ich schon in Stuttgart gemacht hatte, Adolf Bayersdorfer, mein Münchener Freund, der sich, wie ich, hier zuerst als Kunstgelehrter unter Kunstgelehrten zeigte, und Bruno Meyer, der scharfzüngige Berliner, der damals als Kunsthistoriker mehr versprach, als er später hielt.
Julius Meyer, dessen Bekanntschaft ich schon in München gemacht und eben in Berlin erneuert hatte, führte mich gleich am ersten Abend im »Italienischen Dörfchen«, dessen untere Terrasse damals unmittelbar an der Elbe lag, in den Kreis des Holbein-Kongresses ein, als dessen geistiger Gastgeber sozusagen Albert von Zahn erschien, der vortragende Rat in der Dresdener Generaldirektion der Sammlungen für Kunst und Wissenschaft, der die »Jahrbücher für Kunstwissenschaft« herausgab. Das liebenswürdig sonnige Wesen des wissenschaftlich und künstlerisch feinfühligen Mannes ließ das traurige freiwillige Ende nicht vorausahnen, das ihm beschieden war.
Mit hervorragenden Männern dieses Kreises besuchte ich nicht nur Tag für Tag die Holbein-Ausstellung, sondern auch wiederholt alle Kunstsammlungen Dresdens. Manche feine Beobachtung meiner Gefährten förderte meine eigene Beobachtungsgabe. Am freundschaftlichsten und meisten verkehrte ich mit Fr. Th. Vischer, Carl von Lützow, Ad. Bayersdorfer und Bruno Meyer. Es waren nicht nur äußerst genußreiche, sondern auch ebenso lehrreiche Tage für mich. Eine bessere Gelegenheit als die Holbein-Ausstellung, Bilder eingehend vergleichen, ihre Malweise untersuchen, Echtes von Unechtem, Älteres von Jüngerem unterscheiden zu lernen, konnte sich ja gar nicht finden. Das Ergebnis der Zusammenstellung der beiden Madonnenbilder konnte für jeden, der seine Augen vergleichend brauchen gelernt hatte oder lernen wollte, nicht zweifelhaft sein. Die maßgebenden Kunstgelehrten, die an dem Holbein-Kongreß teilnahmen, vertraten fast ausnahmslos die Ansicht, daß die Darmstädter Madonna das allein echte Gemälde, das in dünnerer, lockerer und oberflächlicherer Malweise hergestellte Dresdener Bild eine mindestens hundert Jahre jüngere, dem veränderten Zeitgeschmack in der Auseinanderziehung der Verhältnisse angepaßte Nachbildung von fremder Hand sei. Daß das Darmstädter Bild das erste Original sei, wurde auch von den Gegnern unserer Ansicht anerkannt. Aber die Künstler, die mitsprachen, vor allem Julius Hübner, der übrigens kenntnisreiche und in verschiedenen Künsten bewanderte damalige Direktor der Gemäldegalerie, vertraten die Ansicht, daß das Dresdener Bild eine spätere, verbesserte Wiederholung von der eigenen Hand des Meisters sei.
Aus innerster Überzeugung setzte ich meine Namensunterschrift unter die Erklärung der Kunsthistoriker, die dann in den von Zahnschen Jahrbüchern und in der Zeitschrift für bildende Kunst veröffentlicht wurde. A. von Zahn selbst, dem man es kaum verübelt haben würde, wenn er als Vertreter der Generaldirektion der Dresdener Sammlungen für das Dresdener Bild eingetreten wäre, verteidigte unsere Überzeugung, daß Holbein nur das Darmstädter Bild gemalt habe, in seiner Zeitschrift in kaum zu widerlegender Weise; und Adolf Bayersdorfer widmete dem Holbein-Streit im nächsten Jahre eine besondere, natürlich in demselben Sinne gehaltene Schrift, die das Beste und Ausführlichste geblieben ist, was dieser große Kenner, der so selten zur Feder griff, auf dem Gebiete der vergleichenden Bilderkunde geschrieben hat.
In der Holbein-Ausstellung hatte G. Th. Fechner (1801-87), der bekannte Naturforscher, Philosoph und Ästhetiker, der dem Dresdener Bilde gewogen war, ein Album ausgelegt, in dem jeder, der wollte, seine Ansicht aussprechen sollte. Julius Hübner, der ein geschickter Sonettendichter war, hatte es mit einem Sonett zum Preise des Dresdener Bildes eröffnet, in dem er uns andere als arme Blinde bezeichnete. Nicht faul, antwortete ich mit einem Gegensonett:
»Wir auch, wir können vierzehn Zeilen leimen
Und können rasseln mit den Verseketten,
Wer weiß, wenn wir nicht beßre Gründe hätten,
Wir ließen sie, wie Du, erstehn aus Reimen.«
Streitsonette zu schreiben, war ich ja gewohnt. Ein Berichterstatter bezeichnete das meine als gelungener, aber auch als spitziger. Moritz Thausing schrieb elf Jahre später aus Anlaß meiner Ernennung zum Dresdener Galeriedirektor in seinen »Wiener Kunstbriefen« (S. 33) darüber: »Der Effekt war nicht wenig stürmisch, und ein zur Beruhigung der Gemüter niedergesetztes Schiedsgericht verfügte das Herausschneiden und Vertilgen beider Blätter aus dem Journale des Kongresses.« Übrigens haben Julius Hübner, der ein vortrefflicher Mensch war, und ich uns persönlich niemals entzweit.
Die schönen Dresdener Tage gingen nur allzu rasch zu Ende. Einige Ruhetage wurden der Sächsischen Schweiz, dem schroffen, in Schlangenwindungen von der Elbe durchzogenen Berglande gewidmet, das nur, weil sein Name zwecklose Vergleiche herausfordert, als kleinlich verschrien ist. Ich wohnte im »Forsthause« zu Schandau, dem Stammhaus der bekannten Gasthofbesitzerfamilie Sendig. Rudolf Sendig, der sich, damals erst 22jährig, hier zum ersten Male selbständig betätigte, nahm sich kameradschaftlich meiner an, begleitete mich auf Ausflügen und lehrte mich die Reize des wildzerklüfteten Elbsandsteingebirges lieben. Daß er später unter die Schriftsteller gehen und in seinen zwei Bänden »Im Hotel« seine mannigfachen Erlebnisse bei der Führung seiner vornehmen Gasthöfe in verschiedenen Großstädten in frischem Plauderton erzählen werde, ahnte ich damals nicht. Ich bin ihm für die Freundlichkeiten, die er mir in jenen schönen Herbsttagen erwiesen, immer dankbar geblieben.
Von Schandau fuhr ich geradeswegs nach Prag, der alten, so malerisch von der inselreichen Moldau durchströmten, so machtvoll von den schloß- und burggekrönten Höhen des Hradschins überragten Königs- und Kaiserstadt, deren Zauber mich alsbald, wie jeden, der ihr naht, gefangen nahm. Einen Freund und Führer hatte ich in Prag nicht; aber Deutsch zu sprechen weigerte sich damals dort noch keiner, der es konnte. Auf mich selbst angewiesen, gebrauchte ich nur um so unbeirrter meine eigenen Augen, um mir die Wunder der gotischen und barocken Baukunst Prags, das geheimnisvolle Dämmerlicht seines Ghettos und seines romantisch wirkenden Judenfriedhofs und die reizvolle Fülle der altniederländischen Gemälde des Nostitzschen Palastes einzuprägen. Die Aussicht von dem echt italienischen Renaissancepalast des Belvedere enthüllte mir eines der reichsten und schönsten Städtebilder, die ich bis dahin gesehen; und Dürers echt deutsches, wenngleich 1506 in Venedig gemaltes Bild des Rosenkranzfestes im alten Kloster Strahow wirkte gerade, weil es seinen tief durchgeistigten Gesamteindruck einer Fülle sorgfältigst beobachteter Einzelheiten entsprießen läßt, ganz im Sinne meiner Anschauungsweise auf mich ein. Nie wieder habe ich Prag so genossen wie damals.
Dann aber Wien! Daß es nur eine Kaiserstadt, nur ein Wien gebe, war mir schon hundertmal ins Ohr geklungen. Ich betrat es mit den höchsten Erwartungen, und ich genoß es in vollen Zügen; aber ich habe einige Mühe, mich heute, wo mir das neue Wien mit den Prachtbauten seiner Ringstraße vorschwebt, wenn ich der Kaiserstadt an der schönen blauen Donau denke, in das Wien, das mich damals entzückte, zurückzuversetzen. An der Donau, die im Stadtbild Wiens keine Rolle spielt, lag es damals freilich noch weniger als heute. Sein innerer Kern mit dem einzigen Stephansdom war damals so köstlich wie heute; die alten ehrwürdigen Paläste der inneren Stadt standen so fest und fürstlich in dem Häusermeere wie in unseren Tagen; das »kaiserlich königliche« Lustschloß Belvedere, das noch die Hauptgemäldegalerie Wiens beherbergte, überragte die südöstlichen Stadtbezirke so einladend, wie noch immer; im alten Prater, der einen Mittelpunkt des Fremdenverkehrs bildete, war es noch lauschiger und gemütlicher als heute. Aber der größte Teil des ehemaligen Festungsgebietes zwischen der inneren Stadt und den südlichen und westlichen Vorstädten lag noch brach. Von den Neubauten des Ringes, die Wien seit 1872 zu einer, wenn auch in stilistischer Beziehung allzu geschichtlich zersplitterten, so doch festlich großartig zusammengeschlossenen Prachtstadt machten, standen nur erst das neue Opernhaus und das Österreichische Museum am Stadtpark vollendet da; die Votivkirche am Schottenring war noch im Bau; aber die Hofburg hatte noch weder ihren prächtigen, nach einem alten Kupferstich erneuerten konkaven Abschluß am Michaeler Platz noch ihren neuen reichen Spätrenaissanceanbau am Burgring erhalten; und alle die Prachtbauten am Franzens- und Burgring, Schmidts freigotisches Rathaus, Hansens hellenistisches Reichsratsgebäude, Ferstels Hochrenaissancebau der Universität, Semper-Hasenauers festliches Hofburgtheater und die machtvoll neubarocken Museumsbauten dieser Meister mit Zumbuschs Maria-Theresia-Denkmal zwischen ihnen, erhoben sich erst als Entwürfe auf dem Papier; selbst Hansens feine Akademie der bildenden Künste am Schillerplatz war noch nicht zu bauen begonnen. Vorstädte und Stadt waren noch schärfer voneinander geschieden; aber beide waren noch von der altwienerischen, humorvoll gemütlichen deutsch-österreichischen Stimmung umhaucht, die erst nach dem Weltkrieg gründlich in die Brüche ging.
Wien lernte ich wieder unter der liebenswürdigsten und sachverständigsten Führung kennen. Carl von Lützow, dem ich in Dresden nähergetreten war, nahm sich in seinem Hause und außerhalb desselben aufs gastlichste und fürsorglichste meiner an. Mit offenen Armen aber empfing mich Wilhelm Gurlitt, mein lieber alter Göttinger Studienfreund, der, im Begriff, sich zu einem angesehenen Archäologen zu entwickeln, eine Hauslehrerstelle bei vornehmer Familie in Mödling bei Wien angenommen, sich gleichzeitig aber auch als Dozent der Archäologie an der Wiener Universität habilitiert hatte; fast täglich kam er von Mödling herein. Er schwärmte für Wien, weihte mich in alle seine stillen Reize ein, durchwanderte aber auch alle seine Kunststätten mit mir. Er und Lützow führten mich bei den berühmtesten Kunstgelehrten Wiens, bei Eitelberger von Edelberg, dem Vater des Wiener Kunstgeschichtsunterrichts, im Österreichischen Museum, beim Freiherrn von Sacken im Münz- und Antikenkabinett und bei Moritz Thausing in der Handzeichnungensammlung der Albertina ein. Überall öffneten sich mir unter der besten Leitung die Schätze der Sammlungen. Thausing, dem sein tragisches Ende sowenig an der Stirn geschrieben stand wie A. von Zahn in Dresden, tat das seine, mich in das Studium alter Zeichnungen einzuführen. Mit besonderer Liebenswürdigkeit und norddeutscher Gastlichkeit nahm auch der Wiener, nachmals Berliner Professor der Archäologie Alexander Conze (1831-1914), eine der vornehmsten Erscheinungen der deutschen Gelehrtenwelt, bei dem Gurlitt mich eingeführt hatte, mich in seinem Hause auf. Nächst Brunn habe ich ihn am meisten als Vorbild verehrt.
Mächtig zogen mich natürlich auch die Wiener Theater, zog mich vor allem das Burgtheater an, das damals noch in seinen engen alten Räumen mit dem feuergefährlichen Zugänge hauste. Ich erinnere mich, in ihm unter anderem Hebbels »Nibelungen« und Schillers »Don Carlos«, aber auch Bauernfelds anmutiges Lustspiel »Der kategorische Imperativ« in vortrefflichen Aufführungen gesehen zu haben. Das Burgtheater hatte schon damals den Ruf, die Musterbühne der deutschen Schauspielkunst zu sein. Natürlich fiel es mir nicht ein, ihm diesen Ruf streitig zu machen; aber ich meinte doch, so viel besser als in unserem Hamburger Thaliatheater, dessen Charlotte Wolter ich hier in ihrem Glanze wiedersah, werde hier doch nicht gespielt. Unvergeßlich ist mir aus der Vorstellung jenes Bauernfeldschen Lustspiels, daß bei den Worten »Deutsch müssen wir werden, da wir es leider noch nicht sind«, die der Dichter einer seiner Gestalten in den Mund legt, ein Beifallssturm durchs Haus brauste. Ich habe mich in Wien nie wieder so heimisch gefühlt wie damals.
Nicht minder mächtig als in die Theater trieb es mich auch in die herrliche, im farbigsten Herbstlaubschmuck prangende waldige Höhenumrahmung Wiens hinaus. An der Seite lieber Freunde habe ich manche schöne Wanderstunde im Freien verlebt. Vor allem aber unternahm ich einen dreitägigen Ausflug nach Ofen und Pest. Zu meinen landschaftlichen Erlebnissen gehörte die Donaufahrt von Wien bis Pest, zu meinen künstlerischen Erlebnissen der Besuch der Esterhazy-Galerie. Ein Stück ungarischen Volkslebens aber enthüllte mir mein Besuch Ofens, das damals noch keine feste Brücke mit Pest verband. Ein buntes Leben entfaltete sich auf dem »Blocksberg« und dem »Burgberg«, in den Bädern und an den Rebenabhängen Ofens, an denen ich zum ersten Male Trauben in Fässern mit den Füßen keltern sah!
Von Wien fuhr ich dann geradeswegs nach Triest. Wie köstlich der Übergang über den bereits mit Schnee bedeckten Semmering! Wie groß die Fahrt durch die Steiermärker und Krainer Alpen! Wie rauh der Karst, von dem eine eisige Bora hinter uns her zum Adriatischen Meere hinabfegte! Es war schon dunkel, als unser Zug die große Schleife bei Nabresina hinabbrauste. Die blaue Adria sah ich erst am nächsten Morgen, als ich aus meinem Zimmer in der alten, jetzt längst verschwundenen Locanda grande über die kleine städtische Gartenanlage unter meinem Fenster auf den mit Dampfschiffen gefüllten Hafen hinausblickte. Außer dem stimmungsvollen Dom, der im Mittelalter aus drei frühchristlichen Gebäuden, einer Basilika, einem Baptisterium und einer Kuppelkirche, zusammengeschweißt worden, ziehen nur zwei Stellen in Triest den sinnigen Wanderer an: das 1833 errichtete Ehrengrab Winckelmanns im Terrassengarten der Altertumssammlung, zu der ich gleich morgens meine Schritte lenkte, und das draußen auf kleinem Bergvorsprung am blauen Meer gelegene weiße Schloß Miramar, zu dem ich nachmittags in leichtem Wagen hinausfuhr. Beide Orte sind landschaftlich überaus reizvoll; noch fesselnder als ihre äußeren Reize aber sind die geschichtlichen Erinnerungen, die sie heiligen, und der tragische Hauch, der sie umweht.
»Der eine dieser Orte«, so schrieb ich damals, »ist das Schloß Miramar, der einstige Lieblingsaufenthalt seines Erbauers, des unglücklichen Kaisers Maximilian von Mexiko. Hier nahm er die Kaiserwürde an; hier schiffte er sich ein; hier wurde die Leiche des hochherzigen Hingerichteten gelandet. Drinnen im Schlosse liegt noch alles, wie er es bei seiner Abreise gelassen. Der alte Diener, der mich umherführte, konnte sich der Tränen kaum enthalten, als er mir den Arbeitssessel zeigte, auf dem der Fürst zu sitzen pflegte, die Feder, mit der er geschrieben, die Stickereien, die Triester Damen ihm gewidmet hatten. Der heftige Sturm, der gerade über das Schloß hinbrauste, erhöhte die Melancholie des Eindrucks. Das Meer war eine weiße Schaumfläche, die Pinien bogen sich wie Rohre, die Rohre des Weihers aber lagen platt auf der Erde. Ein Heulen zog wie Wehklagen durch die Luft. Das Schicksal Maximilians war tragisch im vollsten Sinne des Wortes. Er starb nicht ohne poetische Schuld; doch ›sein Verbrechen war ein guter Wahn‹.
»Der zweite jener Orte ist das Ehrengrab Winckelmanns. In demselben Gasthause, in dem ich diese Zeilen schreibe, ist der größte Altertumsforscher, dessen Hauptwerk mit dem Geiste der alten Griechen zugleich den Geist der deutschen Wissenschaft und der deutschen Sprache in Europa zur Geltung gebracht, schnöder Habgier zum Opfer gefallen. Das Zimmer, in dem er ermordet worden, kann oder will man mir nicht zeigen. Wenn ich mich umsehe in den Ecken des altertümlichen Zimmers, in dem ich sitze, so ist es mir, als sei es eben dieses gewesen. Unwillkürlich untersuche ich die tiefen, mit Vorhängen bedeckten Nischen, ehe ich zu Bette gehe. Winckelmanns Ehrengrab liegt auf der Höhe neben der Kathedrale. Daß es des großen Mannes nicht würdig sei, kann man nicht behaupten. Der Aufbau mit dem Marmorsarkophag öffnet sich, von Akazien und Lorbeeren beschattet, auf den Hafen und das weite dunkelblaue Meer. Alte römische Denkmäler, meist Leichensteine, und andere Grabmonumente sind in dem Garten ausgestellt, der das Mal umgibt. Es sind zwar nur schlechte römische Arbeiten; aber der Geist Winckelmanns verstand es, auch aus den Bruchstücken der Nachahmerarbeiten die Kraft und Schönheit ursprünglicher Kunst ahnend heraufzubeschwören. Was würde er aus der griechischen Kunstgeschichte gemacht haben, wenn er die Denkmäler vor Augen gehabt hätte, die unserer heutigen Anschauung offen stehen!«
Winckelmann im Herzen, schiffte ich mich nach der altrömischen Ruinenstadt Pola ein, die zugleich die altösterreichische Kriegshafenstadt war. Es war mein erster Besuch eines antiken Ruinenfeldes. Am Morgen des 15. Oktober begab ich mich an Bord des Lloyddampfers »Barone Burger«. Wegen des immer noch heftigen Borasturmes aber, der mit verdoppelter Wut über die Bucht dahinraste, war an die Abfahrt nicht zu denken. Sogar die größeren, nach Ägypten und Konstantinopel bestimmten Dampfer waren liegengeblieben. Weit vom Schiffe durfte man sich aber nicht entfernen, weil der Kapitän versicherte, das Wetter könnte sich jede Viertelstunde ändern, und dann führe er sofort ab. So wurden wir volle vierundzwanzig Stunden hingehalten, einer der ungemütlichsten Tage, die ich verlebt habe. Abends begab ich mich jedoch an Bord.
Am folgenden Morgen wehte es freilich immer noch recht stark; aber die Berge waren klar, und sogar die ferne Alpenkette trat wie weiße Wolken am nordwestlichen Horizont des Meeres in weitem Halbkreise hervor. Als die Sonne aufging, verließen wir den Hafen. Südwärts steuernd, kamen wir bald in ruhigeres Wasser, wie denn die Bora in voller Heftigkeit nur die Triester Bucht heimsucht. Gegen Mittag wurde es sogar still und heiß. Die Küsten Istriens, an denen wir entlang dampften, sind felsig und hügelig, an vielen Stellen aber auch mit silbergrünen Ölwäldern bedeckt, die ich zum ersten Male sich reizvoll dem blauen Meere anschmiegen sah. Im Hintergrunde traten hohe Berge hervor: besonders scharf der Monte Maggiore bei Fiume. Überaus malerisch lehnen die friedlichen Küstenstädte, in denen wir anlegten, sich an Hügel und Felsen an, oft auf schmalen Landzungen ins Meer hinausgebaut, von altem Kirchturm und auch wohl von Burgruinen überragt: Capo d'Istria, Pirano, Umago, Parenzo, Rovigno bilden die Glanzstellen des lieblichen Panoramas.
Gegen Sonnenuntergang waren wir in Pola, das so selbstsicher im Grunde seines fast kreisrunden Golfes daliegt. Als Hauptbau Polas überragt noch heute das alte Amphitheater, das sich in drei Arkadengeschossen dem Abhang einer felsigen Anhöhe anschmiegt, schon weither vom Meere aus sichtbar, die ganze Gegend. Erwartungsvoll betrat ich es. Die Stufenreihen des Inneren sind zerstört. Durch die hohen Bogenöffnungen sieht man hinaus aufs Meer. Sonne, Mond und Sterne scheinen hinein. In der blutgetränkten Arena wachsen Thymian und große, duftende Blumen, und der istrische Schafhirt weidet seine wollige Herde an dem Abhang, an dem sich die Sitzreihen der Nordseite hinaufzogen. Vortrefflich erhalten ist der zierlich römisch-korinthische Augustustempel; von seinem Zwillingstempel, der angeblich der Diana geweiht war, sieht man nur noch die Rückwand; das übrige ist ins Rathaus verbaut. Stramm und schlicht aber steht der Triumphbogen des Sergius da. Amphitheater, Tempel, Triumphbogen! Alle Hauptbestandteile einer Provinzialstadt des römischen Kaiserreichs beieinander! Siegesrausch, Götterdienst – und »Brot und Schauspiele« fürs Volk! Wie festumrissen ragt die Welt von damals noch in die unsere herein!
Nun noch ein Tag in Triest und dann zu Schiff nach Venedig, der lichten Dogenstadt, die ich, rot und golden, von türkisfarbenen Wellen umrauscht und durchzogen, wie oft schon im Geiste vor mir aufleuchten gesehen. Jetzt sollte das Traumgesicht sonnenhelle Wirklichkeit werden. Daß ich alter Seefahrer den geweihten Boden des uns Deutschen damals innig befreundeten jungen Königreichs vom Meer aus betreten mußte, war selbstverständlich. Im Frührot des 20. Oktober entstieg die ewig junge Meereskönigin in festlich leuchtendem Gewande vor meinen geblendeten Blicken den schimmernden Wassern der Lagune. Rechts der Lido! Links San Giorgio Maggiore! Nun aber, näher und klarer im helleren Morgenlicht: rechts der Palazzo Ducale, dessen mächtige Oberwand über den feinen Spitzbogenarkaden erst im Spiegelbild der See seinen vollen Einklang gewann! Links der feingegliederte, in weißem Marmor schimmernde Säulenbau der alten Bibliothek! Geradeaus die Piazetta mit den beiden alten Granitsäulen, von denen die zur Linken den heiligen Theodor, den Schutzheiligen Venedigs, die zur Rechten das Wahrzeichen der Lagunenstadt, den mächtigen Flügellöwen des heiligen Markus trägt; dahinter, hochragend, der Markusturm und neben ihm die blendende Halbkuppel der byzantinischen Markuskirche! In keiner Stadt ist man, noch ehe man sie betritt, so mitten in ihrem Herzen, wie in Venedig, wenn man sich ihm zu Wasser naht.
Auf den Wasserstraßen der Märchenstadt glitt ich in den nächsten acht Tagen von einer ihrer Kunstherrlichkeiten zur anderen. Mir ein Dauerboot mit nettem, mitteilsamem Schiffer zuzulegen, war ich von Helgoland und Kiel her gewohnt, und ich blieb dieser Gewohnheit in allen Hafenstädten Italiens treu, sobald ich den richtigen Mann gefunden hatte, der mich nicht nur in die See hinaus, sondern auch zu allen Stätten volkstümlichen Lebens geleitete und mir in harmlos fröhlicher, südlich lebendiger Unterhaltung selbst ein Stück der Volksseele seines Landes offenbarte. Namentlich in Städten, in denen ich keine Anknüpfungspunkte an gleichstrebende Gefährten fand, war mir solche Kameradschaft einfacher Leute aus dem Volke ein wirkliches Bedürfnis. War es kein Schiffer mit einem Boote, so war es ein Kutscher mit einem Wägelchen. Daß zu Fuß zu gehen in Italien weder Mode noch gesund sei, hatte man mir schon nördlich der Alpen eingeredet. Kostspielig war es nicht einmal; eine Gondel in Venedig kostete damals für den ganzen Tag 5 Lire. Mein erster venezianischer Gondeliere hieß Giovanni; schmuck und gesprächig war er, und ich wurde durch ihn, anmutig und unterhaltend, gleich in die Landessprache und in das italienische Volksempfinden eingeführt.
Wie eigenartig mutete es mich an, in einer großen Stadt zu weilen, in der es keine Pferde gab, in der kein Staub aufwallte und kein Wagengerassel die träumerische Stille störte! Versuchte ich zu Fuße zu gehen, so verlief ich mich in dem Gewirre der engen Gassen, verfehlte auch wohl die nächste Verbindungsbrücke und rannte mich in einer Sackgasse fest. Reuig kehrte ich immer wieder in meine Gondel und zu meinem Gondoliere zurück. Wie sang doch Goethe in Venedig?
Diese Gondel vergleich' ich der sanft einschaukelnden Wiege,
Und das Kästchen darauf scheint ein geräumiger Sarg.
Recht so, zwischen der Wieg' und dem Sarg wir schwanken und schweben
Auf dem großen Kanal sorglos durchs Leben dahin!
Schon die Gondeln selbst, die allen Fahrzeugen und Schiffen der Welt zum Trotz ihre elegante antike Form gerettet haben, erscheinen dem nordischen Küstenanwohner, der im Verkehr mit Booten groß geworden ist, wie Fahrzeuge aus einem fernen Wunderlande; und auch die Art, wie der gewandte schlanke Schiffer, hinter dem Verdeckhäuschen stehend, mit einem einzigen Ruder die Gondel behend und sicher durch alle Hindernisse hindurchführt, erscheint ihm wie ein Kunststück, das nur ein feiner angelegter Menschenschlag fertigbringt.
Und wahrlich! eine ganz neue, aber auch ganz köstliche Empfindung war es, auf dem grünen Wasser der Kanäle unter den alten Marmorpalästen dahinzugleiten, die ihre Säulen und Balkone, ihre Bogen und Loggien, ja noch ihre Marmorstufen, die zum Kanal hinabführen, in den klaren Fluten spiegeln!
Mit welcher stillen, warmen Herzensfreude ich einen der berühmten, mir längst aus Abbildungen und Beschreibungen bekannten Paläste nach dem andern vor mir auftauchen, die ganze reiche Baugeschichte der Dogenstadt vom romanischen ehemaligen Kaufhaus der Deutschen bis zu dem zierlich spätgotischen Cà d'oro, vom gotischen Palazzo Foscari bis zu dem frischen Frührenaissance-Palazzo Vendramin Calergi, zu den klaren Hochrenaissancebauten des Palazzo Grimani und des Palazzo Corner und zu den üppigen Spätrenaissancepalästen Rezzonico und Pesaro an mir vorübergleiten sah, kann ich nicht schildern. Sie alle liegen am Canale grande und sind doch nur einige unter ihresgleichen.
Man mag Venedig bis zu seinen äußersten Grenzen durchfahren, überall findet man baukünstlerisch durchgebildete Kirchen und Häuser, überall an plastischen Bildwerken und Gemälden reiche Kirchen, überall malerische Ecken und Durchblicke. Vielleicht ist keine Stadt in allen ihren Teilen so künstlerisch durchgebildet wie Venedig, und trotzdem ist vielleicht in keiner Stadt der eigentliche Mittelpunkt des städtischen Lebens zugleich in solchem Maße der Brennpunkt ihrer baukünstlerischen Pracht, wie dies in Venedig der Fall ist. Wie sich rings um den Markusplatz, den die strahlende alte Kuppelkirche des heiligen Markus beherrscht, zu beiden Seiten der Piazetta mit ihrem Dogenpalast und Sansovinos herrlichem Säulenbau der alten großen Bibliothek, dem jetzigen Königspalast, bis hinab zur Riva degli Schiavoni mit ihrer schön gegliederten Schauseite des Strafgefängnisses Prachtbau an Prachtbau reiht, ohne eine nicht künstlerisch gestaltete Wand als Lücke zu lassen, das hat in der Welt seinesgleichen nicht; und wie hier von den Baustilen fünf verschiedener Jahrhunderte jeder sein Höchstes in einer ureigen venezianischen Weise geleistet hat, die die verschiedenen geschichtlichen Stile einheitlich umfaßt, das läßt uns ahnen, wie viele Jahrhunderte lang Venedig eine Herrin der Erde gewesen ist. Wie herrlich aber auch Palladios hohe Säulenkirchen, die von den Inseln wie Geisterbauten herüberwinken, und Longhenas Santa Maria della Salute am Eingang des großen Kanals! Wie üppig und in sich geschlossen auch hier die nachklassische weiße Marmorpracht über den grünen Wellen!
Wasser und Luft sind die einzigen Elemente, die den venezianischen Baukünstlern zu Hilfe kamen. Dem Gesamteindruck fast aller anderen großen Städte Italiens, Neapels wie Roms, Genuas wie Florenz', verleihen plastische Bergformen und üppiger Baumwuchs Halt und Gliederung. In Venedig wirkt alles nur mit dem Wasser zusammen, aber auch alles zugleich durch das Mittel der feuchten Seeluft, die über den Wassern schwebt und den Sonnenstrahlen eine eigentümliche Brechung, der Beleuchtung eine milde, farbige Kraft verleiht, die alles zusammenhält und malerisch verschweben läßt.
Daß diese malerische Kraft der lichtgetränkten venezianischen Luft das ihre dazu beigetragen hat, der venezianischen Malerei ihren malerischen Zusammenschluß und jenen koloristischen Schmelz zu verleihen, der ihrer üppigen, durch die Pracht der in Venedig landenden orientalischen Teppiche geschürten Farbenglut weichen Einklang verleiht, wurde mir bei meinen Gondelfahrten von Tag zu Tag klarer. Von Tag zu Tag aber überzeugte ich mich, indem ich eine der Kunststätten, die die Hauptschöpfungen der venezianischen Malerei bergen, nach der andern besuchte, auch von neuem, daß trotz aller Pracht der Bauten und der plastischen Bildwerke Venedigs die Malerei die eigentliche Kunst der Meereskönigin ist, daß gerade in Venedig die italienische Malerei sich ihrer eigensten Fähigkeiten bewußt geworden ist. Wie viele Meisterwerke der venezianischen Malerei auch über die Alpen und übers Meer verschleppt, ihrer Heimat untreu geworden sind, noch immer kann man die Malerei kaum einer anderen Stadt, von Florenz etwa abgesehen, in solchem Maße nur an den Stätten ihrer Entstehung kennen und verstehen lernen wie die Venedigs. Wie viele Bilder venezianischer Meister hatte ich nicht schon in anderen Sammlungen kennengelernt; aber erst hier, in den Kirchen, den Palästen und den Sammlungen Venedigs trat mir die Entwickelung der venezianischen Malerei von Giovanni Bellini zu Giorgione und Palma Vecchio, von diesen zu Tizian und weiter zu Paolo Veronese, zu Tintoretto und zu Tiepolo in ihrem organischen Zusammenhang und zugleich in einer Reihe ihrer Hauptwerke klar und überzeugend, erwärmend und begeisternd vor Augen.
Ach, wie gern wäre ich wochenlang, mondelang in Venedig geblieben. Aber meine Aufgaben und mein Herz drängten mich nach der ewigen Stadt am Tiberstrom. Bologna, das reiche, das gelehrte, das künstlerische, dessen Malerschule namentlich im 15. und im 17. Jahrhundert geblüht hatte, wurde mitgenommen, weil es auf dem Wege lag und fürs Rom des 17. Jahrhunderts vorbereitete. Ravenna aber, die verzauberte frühchristlich-östliche Prinzessin, die unweit des Meeres und ihres breitkronigen Pinienwaldes in halber Vergessenheit träumt, gehörte, weil es in seinen großen, leuchtenden Wand- und Kuppelmosaiken Musterbeispiele der Ausläufer der griechisch-römischen Malerei birgt, schon unmittelbar ins Bereich meiner Sonderaufgaben; und hier tat sich mir wirklich eine neue Welt auf, eine Welt, die wir uns freilich damals, so mächtig ihre ernste, großzügig rhythmische Linien- und Farbenkunst uns auch in ihren Bann zog, noch nicht so nahekommen ließen, wie wir es heute tun. Heute wirkt, an sich merkwürdig genug, aber freilich aus unserer jüngsten Kunstentwicklung heraus erklärlich genug, diese byzantinische oder spätgriechische Kunst moderner auf uns als die Kunst Rafaels und Tizians, Holbeins und Poussins. Es ist Raumkunst und Ausdruckskunst zugleich.
Von Bologna und Ravenna ging es zunächst in herrlicher Fahrt über die Berge und durch die Täler der Apenninen nach Florenz, in das es mich natürlich mit tausend Fäden zog. Aber freilich: ich reiste ja eigentlich noch als Archäologe, nicht als Vertreter der christlichen Kunstgeschichte. Alle meine nächsten Aufgaben winkten mir in Rom, in Neapel, in Pompeji und in Griechenland. Ich durfte mich auch in Florenz dieses Mal noch nicht so lange aufhalten, wie ich gemocht hätte. Aber ich hätte mir Gewalt antun müssen, wenn ich über meiner selbstgewählten nächsten Arbeit die erquickenden und erlösenden Wunder der jüngeren Kunstgeschichte beiseite gelassen hätte; und da die bergumkränzte, von Brunellescos stolzer Domkuppel herrschend zusammengehaltene Arnostadt trotz allem und allem die eigentliche Kunsthauptstadt Italiens war, so versteht es sich von selbst, daß ich ihr schon jetzt einige Weihewochen widmete.
In Florenz, das ich fiebernden Herzens betrat, fand ich wieder gebildete Deutsche, die sich meiner annahmen. Mein rechter Vetter Ferdinand Weber, zugleich ein rechter Vetter des Malers Fritz von Uhde, betätigte sich damals als junger Kaufmann in Florenz. Kunstsinnig genug veranlagt, begleitete er mich nicht nur oft auf meinen Studienpfaden, sondern auch in der Regel auf meinen Wanderungen in der feierlich schönen Umgebung von Florenz. Abends war ich wiederholt in einer deutschen, hier aber auch zum ersten Male in einer italienischen Familie zu Gaste, bei der ich die ansprechende südliche Geselligkeit kennenlernte, die sich erst nach dem abendlichen Mittagessen im schönen eigenen Heim des Gastgebers bei einer Tasse Tee und einem Glase guten Landweins in geistreicher Unterhaltung genugtut. Manchen Abend verbrachte ich aber auch in Gesellschaft des jungen Kunstgelehrten Hans Semper, des späteren Professors der Kunstgeschichte an der Innsbrucker Universität, der damals an seiner Schrift über Donatello arbeitete, die seine Hauptschrift geblieben ist. Er war ein Sohn des großen Baumeisters und Schriftstellers Gottfried Semper; und auf seiner wie auf der feinen Begabung Robert Vischers, des Sohnes Friedrich Theodors, lastete etwas von der Größe ihrer Väter. Hans Sempers Bekanntschaft war mir in Florenz um so wertvoller, als er mich in den immergrünen Wunderhain der Bildnerei der florentinischen Frührenaissance einführte. In die Bildwerke der Hochrenaissance bedurfte ich keiner Einführung mehr.
An künstlerischen Erlebnissen war mein Aufenthalt in Florenz natürlich überreich. Jedes Bild der Uffizien, des Palazzo Pitti und der Akademie tat es mir an. Dürer gewann ich in seiner Anbetung der Könige, die sich in der Tribuna der Uffizien neben den größten Meisterwerken der Italiener siegreich behauptet, noch lieber, als ich ihn schon gehabt hatte. Von Rafael, dessen Sixtinische Madonna alles übertraf, was ich in den florentinischen Sammlungen von ihm sah, kann ich nicht dasselbe sagen. Cimabue und Giotto aber, Fra Angelico von Fiesole, Fra Bartolommeo und selbst Andrea del Sarto traten erst hier, was ich auch anderwärts von ihnen gesehen haben mochte, als greifbare künstlerische Persönlichkeiten in meinen Gesichtskreis. Alles das berührte mich tief, aber ziemlich gleichmäßig. Meine beiden künstlerischen Haupterlebnisse, vor denen alles andere erblich, waren Masaccio und Michelangelo. Masaccios Fresken in der Brancaccikapelle der Carminekirche, die man verkennt, wenn man sie nur als bahnbrechende Schöpfungen des italienischen »Realismus« des 15. Jahrhunderts nennt, waren mir in ihrer vollen Vereinigung von schlichter Wahrheit und herber Schönheit eine Offenbarung, wie sie es seinen Zeitgenossen gewesen waren; über alle seine Nachfahren hinüber hatten auch die großen »Idealisten« Michelangelo und Rafael ihm die Hand gereicht. Mich mit den Masaccio-Fragen der Kunstgeschichte zu beschäftigen, war mir erst nach einem späteren Besuch der Arnostadt vergönnt; aber alles, was mich dazu trieb, erlebte ich schon jetzt vor den Bildern der Brancaccikapelle.
Gewaltiger noch als meine Begegnung mit Masaccio aber erschütterte mich jetzt in Florenz meine Bekanntschaft mit Michelangelo, von dessen eigener Hand ich bisher, außer den beiden tiefempfundenen Gefesselten des Louvre, noch nichts gesehen hatte. In seiner ganzen eigenartig wuchtigen Größe trat er mir erst jetzt, erst in seiner Vaterstadt entgegen. Sein David, der jugendliche Marmorriese mit der Schleuder in der gesenkten Rechten, dem Stein, mit dem er zielt, in der erhobenen Linken stand in seiner vollen leiblichen und geistigen Spannung damals noch an seinem alten Platze am Haupteingang des Palazzo della Signoria; Michelangelos Grabmäler der Medici in deren Kapelle bei San Lorenzo aber strahlten dort wie heute in ihrer durch und durch beseelten und bewegten Marmorpracht: an der Wand zur Rechten das gewaltige Grabmal des jüngeren Giuliano de' Medici; unbedeckt erhobenen Hauptes, mit dem Feldherrnstabe auf den Knien, thront er, scharf zur Seite blickend, über dem Sarkophagdeckel, auf dem zu seinen Füßen die dämonischen Gestalten der traumbewegten Nacht und des tatkräftig erwachenden Tages sich an das Flachrund schmiegen; gegenüber an der Wand zur Linken das nicht minder packende Grabmal Lorenzos de' Medici des Jüngeren, der behelmten Hauptes, das Kinn mit der Linken stützend, sinnend über den in aller Ruhe lebhaft bewegten Leibern des Morgens und des Abends thront; in der Mitte der Schlußwand die machtvolle, von unendlicher ahnungsvoller Trauer bewegte Muttergottes zwischen den Heiligen Cosmas und Damianus. Was in der unaussprechlichen Größe und Kraft dieser drei Wände, in denen Bau- und Bildkunst unauflöslich ineinander gewoben sind, von des Meisters Hand unvollendet geblieben, wirkt zum Eindruck des menschlichen Wirkens einer von übermenschlicher Schaffenskraft erfüllten Seele bestrickend mit. In der Mediceerkapelle Michelangelos sang es in mir:
Welch Zauberdämmerlicht in der Kapelle,
In der auf lichten Marmorsarkophagen
Der Mediceerfürsten Bilder ragen:
Ein Dämmerlicht, durchflammt von Geisteshelle!
Gab ihnen Anspruch auf die heilige Schwelle,
Was Gutes sie vollbracht in ihren Tagen?
Wie, oder strahlen sie, aus Stein geschlagen,
Nur kunstverklärt so hell von dieser Stelle?
Was die Geschichte von dem Paar verkündigt,
Ist nimmer fromm, ist nimmer edel freilich;
Doch ihre Schönheit macht die Herzen pochen.
Wieviel sie vor Jahrhunderten gesündigt, –
Die Kunst, die Seligmacherin, spricht heilig;
Und heilig hat sie diese längst gesprochen.
Es ist kein Weib zu liebendem Umfangen,
Die Nacht, die er aus Marmor ausgehauen;
Es ist kein Ideal holdseliger Frauen
Mit Lilienarmen und mit Rosenwangen.
Es ist auch keine Nacht, die Glutverlangen
In uns erregt, so weich und mild zu schauen:
Es ist die Nacht voll stiller dunkler Grauen,
Geheimnisvoll und tief, voll Lust und Bangen.
Was solche Nacht an göttlichen Gedanken
Und Welterlöserträumen birgt im Schoße,
Gelang es hier, im Marmor auszuprägen.
So fallen vor der Kunst die irdischen Schranken,
So weiß der Künstler die Natur, die große,
Besiegt zu Füßen größrer Kunst zu legen.
Zwischen Florenz und Rom hielt ich mich in einigen Hauptstätten der seelenvollen altumbrischen Kunst auf. Urbino lernte ich erst später kennen, aber Cortona, Perugia, Assisi und Foligno wurden schon auf dieser Reise besucht. Die feine landschaftliche Stimmung über den graugrünen, mit Ölwäldern bedeckten Bergen, die glückselige Ruhe in den auf weichen Höhen thronenden Städten und der Hauch zarter Sinnigkeit und frommer Hingabe, der die umbrischen Gemälde des 15. Jahrhunderts durchweht, wirkte mit der sinnigen Freundlichkeit und der natürlichen Liebenswürdigkeit, die den Bewohnern dieses gesegneten Landstriches aus den Augen strahlt und in ihrem Verkehr mit den Fremden hervortritt, bestrickend zusammen. Die Erinnerung an meine umbrischen Tage zittert in verklärtem Einklang von Kunst, Natur und Menschen in mir nach. Die mild lächelnde »perugineske« Kunst Pietro Peruginos trat mir im Leben hier auf Schritt und Tritt entgegen.
Nirgends in der Welt bin ich so »peruginesk« behandelt worden wie in Perugia. »Schon daß man nach ausgezeichneter Wohnung, trefflicher Kost und freundlicher Bedienung«, so schrieb ich damals, »hinterher über die Billigkeit der Gasthausrechnung erstaunt, ist eine Seltenheit in Italien; ein volles Rätsel aber ist der Lohndiener und Fremdenführer Giovanni Scalchi, der seit fünfzehn Jahren eine Berühmtheit von Perugia ist, von allen Reisehandbüchern empfohlen wird und von Dichtern wie Alfred Tennyson, dem Laureatus Englands, besungen worden ist. Er besitzt ein dickes Album mit vielen hundert empfehlenden Abschiedsgrüßen in allen Sprachen der Welt, in Versen und in Prosa. Natürlich wurde meine Neugier aufs höchste gespannt, dieses Wunder von einem Lohndiener kennenzulernen. Ich fragte daher den mich in meinem Gasthofe bedienenden Kellner, einen ältlichen, aber sehr angenehmen Menschen mit eben jenem peruginesken Wesen, wo dieser Giovanni Scalchi zu treffen sei, und erhielt mit verbindlichem, ebenfalls perugineskem Lächeln zur Antwort, er selbst, der vermeintliche Kellner, sei der Scalchi. Da war ich natürlich gefangen; und obgleich ich sonst niemals einen Führer nehme, bestellte ich ihn für den anderen Tag. Ich habe es nicht bereut: nicht nur daß ich alle Kunstwerke Perugias schnell und gründlich sah, ich erhielt auch manche Belehrung, hatte den ganzen Tag einen sinnigen und liebenswürdigen Begleiter und, was das Merkwürdigste war, kam im ganzen noch billiger davon, als wenn ich keinen Führer gehabt hätte. Für seine eigenen Dienste forderte Giovanni Scalchi nichts, sondern überließ es mir, sie zu bewerten, fügte aber hinzu, er wisse doch, daß ein junger deutscher Gelehrter kein reisender Engländer sei. Mit gegenseitigen Dankesversicherungen schieden wir voneinander.«
Von den übrigen Städten Umbriens sprach mir vor allem Assisi warm zum Herzen, die Stadt des heiligen Franziskus, die ich schon in Perugia vom ferneblauen Bergabhang weißleuchtend herüberschimmern gesehen. Assisi und der heilige Franziskus! Ein Hauch der seligen Mystik des weltfremden und doch so weltfreundlichen Apostels der Armut, dessen Übernatur von innigster Naturliebe, dessen Verstiegenheit von tatkräftigster Menschenliebe getragen wurde, liegt über dieser stillen Bergstadt und allen Kunstschöpfungen, die sie in ihren Mauern birgt. Die Heimat des gotischsten aller »gotischen Menschen« ist auch die Heimat der ältesten gotischen Kirche Italiens; und die Wände und Deckengewölbe dieser Kirche tragen die Kunst der größten vorgotischen und gotischen Maler Europas, Cimabues und Giottos, der tief empfindenden Meister, die das, was sie wollten, vollgültig auszudrücken verstanden, und über das, was sie noch nicht konnten, anmutig hinwegtäuschten; denn daran, daß sie noch nicht alles gekonnt hätten, was ihre Nachfahren gewollt und gekonnt haben, halte ich gegen jene Andersmeinenden fest, die der Ansicht sind, die Kunst jeder Zeit hätte alles gekonnt, wenn sie gewollt hätte. Man sieht ja, wie Giotto vergebens z. B. mit der Perspektive ringt. Seine Kunst ist deshalb in ihrer Art nicht minder klassisch. Gerade in seinem Ringen mit der Natur, dem sich die anschaulichste Ausdruckskraft des Erzählens gesellt, bleibt er uns der gotische Maler reinsten Geblüts, der uns mit emporzieht in das Reich seines Glaubens, seiner Liebe und seiner Hoffnung.
Ohne Ravenna, Toskana und Umbrien bliebe Rom ein Buch mit sieben Siegeln. In tiefes Sinnen versunken, fuhr ich nun wirklich im lieblich-malerischen Tibertal zwischen den Bergen der Latiner und der Sabiner hindurch der ewigen Stadt entgegen. Die ersten Weihen der Priesterschaft italienischer Kunst hatte ich ja bereits empfangen, als ich am 20. November 1871, zitternde Ungeduld im Herzen, vom Fenster des Bahnzuges aus Michelangelos schön und großartig gewölbte Peterskuppel über den Hügeln auftauchen sah, hinter denen die ewige Stadt selbst sich noch verbarg.
Wie ernüchternd bald darauf das Bahnhofsgewühl, das überall das gleiche ist; wie öde die Abendmahlzeit zwischen Engländern an der langen Gasthofstafel, wie sie damals noch üblich war! Lange duldete es mich nicht. Ich trat eine heimliche, stille erste Wanderung an: den erleuchteten Korso entlang, an dessen Ende sich noch nicht das neue Nationaldenkmal Italiens erhob, am Palazzo Venezia vorüber, die gebogene Gasse hindurch, an den beiden Kolossen der Dioskuren vorüber zum Kapitol hinauf, auf dessen von den drei Palästen Michelangelos eingefaßtem Hauptplatz ich beim Laternenlicht unter dem ehernen Reiterbild Mark Aurels stand. Sein verkleinertes Abbild im Gartensaal meiner Großeltern hatte es mir von klein auf vertraut gemacht. In stummer Andacht schaute ich jetzt zu ihm und den matt schimmernden, ihre großen Verhältnisse aber nur um so machtvoller offenbarenden Palästen seiner Umgebung empor; und mit wunderbar gemischten Gefühlen schlich ich zu meinem Gasthof zurück, den ich schon am nächsten Tage mit einer behaglichen, ruhig gelegenen, echt römischen Zweizimmerwohnung an der Via San Giuseppe a Capo le Case vertauschte.
Froh empfind' ich mich nun auf klassischem Boden begeistert,
Vor- und Mitwelt spricht lauter und reizender mir.
(Goethe.)
Rom gehört nicht zu den Städten, die ihren unerschöpflichen Reichtum dem Ankömmling gleich am ersten Tage zur Schau stellen. Wie Rom nicht in einem Tage erbaut worden, so wächst es auch erst allmählich auf uns herein. Wenn man in Venedig auf dem Markusplatz und der Piazzetta gestanden und von der Piazzetta aus den Blick auf den Eingang des Canale grande und die drüben leuchtenden Inseln genossen, so kann man sagen, man habe die Lagunenstadt gesehen. Rom hat eine Reihe solcher Hauptstätten, die nach und nach aufgesucht und jede in ihrer Eigenart verstanden sein wollen, ehe man sagen kann, man habe einen Eindruck von der ewigen Stadt empfangen. Daß ich diese Stätten aufsuchte, ehe ich mich in den Strom meiner besonderen Aufgaben stürzte, versteht sich von selbst. Zum Kapitol rief mich überdies die Pflicht, mir Zutrittserlaubnisse zu verschaffen und mich vorzustellen, gleich am Morgen nach meiner Ankunft wieder hinauf; denn gleich hinter dem Prachtplatz Michelangelos erhob sich auf den Grundmauern des einstigen Haupttempels Roms, des alten Jupitertempels, der Palast der deutschen Botschaft; und hinter diesem lag, damals noch in alten, unscheinbaren, aber aussichtsreichen Baulichkeiten und Gärten, das Deutsche Archäologische Institut, das den Ausgangs- und Mittelpunkt meiner Studien bilden sollte. Wie stolz war ich, mich als Deutscher hier in der alten, hochragenden Mitte Roms zu Hause fühlen zu dürfen! Wie schönheitstrunken stand ich auf der Piazza del Campidoglio, in deren großzügig gestalteten Palästen, die sie an drei Seiten schließen, die Hochrenaissance die ersten Schritte zum Barock tut. Wie entzückt schaute ich, wo die Aussicht sich öffnete, auf die von nahen Höhen umrahmte Weltstadt hinab!
Die Kulturschichten der Jahrtausende liegen in Rom offensichtlich zutage. Ihre steinernen Zeugen ragen oft nah aneinander in das Licht der Gegenwart herein. Die unteren Schichten sind, wo sie vom Staub der Zeiten zugedeckt waren, durch die Spatenwissenschaft wieder bloßgelegt; ihre Säulen und Mauern stehen, wiederaufgerichtet, in handgreiflicher Wirklichkeit wieder da.
Einige Tage vergingen, ehe ich die Brennpunkte der künstlerischen Gestaltung der verschiedenen Zeitalter kennengelernt hatte. Soll ich schildern, wie mir zumute war, als ich zum ersten Male zwischen den hohen Einzelsäulen und Säulengruppen einstiger Heiligtümer und den beredten Trümmern von Basiliken, Tempeln und Palästen des Forum Romanum zum Titusbogen leicht hinan, von diesem wieder in die leise Talsenkung hinabschritt, in der die gewaltigste Ruine des Altertums, das ovalrunde Amphitheater der Flavier, das viel genannte Kolosseum, in seiner ganzen majestätischen Höhe und Breite, in der ganzen Wucht seiner doch so einladend in drei Reihen halbsäulenumrahmter Rundbogen aufgelösten Mauermassen wie aus dem Boden gewachsen daliegt? Soll ich von dem Konstantinsbogen und dem Bogen des Septimius Severus reden, die sich in üppigerer Zeit üppiger entfaltet haben als der vornehm schlichtere Titusbogen? Soll ich das sich südlich anschließende Ruinengebirge der römischen Kaiserpaläste auf dem Palatin feiern, in die ihre damals noch gut erhaltenen Wandgemälde mich noch sooft zurückriefen? Tief innerlich empfand ich den wunderbaren Einklang der melancholischen, malerischen Einsamkeit dieser in sich zusammenhängenden römischen Trümmerwelt mit der hohen Schönheit mancher ihrer wieder freigelegten Einzelteile und mit den Erinnerungen an eine gewaltige, reichfarbige, vom feierlichsten und berauschendsten oder wildesten und grausamsten Leben erfüllten Vergangenheit, die noch inniger, als man meinen sollte, mit unserer Gegenwart verknüpft ist. Im Geiste suchte ich mir diese Trümmerwelt, die damals kaum die Hälfte ihres heutigen Umfangs und ihrer heutigen Tiefe einnahm, wieder aufzubauen und zu beleben. Wie fremd und winzig stand ich in der Mitte der römischen Weltherrschaft da, deren Klammern mich packten. Ob diese Weltherrschaft der Welt zum Segen gereicht hat? Damals hielten wir ihre Nachwehen für uns für überwunden, heute spüren wir sie wieder am eigenen Leibe.
Weiter! von einer Schicht zur anderen, von einer Schönheitsstätte zur nächsten! Stillbeglückt stand ich auf dem feinen, mit hübschem Obelisken geschmückten Pantheonplatze, der nicht zu groß und nicht zu klein ist, dem Formenadel des Pantheons, des besterhaltenen antiken Tempels der Tiberstadt, Geltung zu verschaffen: wie feierliche Musik drang der Rhythmus der hohen, von acht edlen korinthischen Säulen getragenen Giebelvorhalle des kreisrunden Tempels auf mich ein, der, zur Zeit Hadrians von einem späthellenistischen Baumeister errichtet, noch immer der folgerichtigste und schönste Rundbau der Welt ist. Sein Äußeres war freilich damals noch durch die Seitentürme des großen Barockmeisters Lorenzo Bernini entstellt; und ich lächelte zufrieden, als ich sie als »Eselsohren« Berninis verspotten hörte. Der Innenraum aber, dessen Säulen- und Nischenrund durch eine eigenartig geschnittene Öffnung in seinem Flachkuppeldach ruhig und einheitlich beleuchtet wird, erfüllte mich mit der sprachlosen Andacht, die er in jedem Empfänglichen auslöst.
Von der Piazza della Rotonda führten mich wenige Minuten zur Piazza della Minerva, dem ebenfalls mit einem altägyptischen Obelisken geschmückten Platze, an dem über den Grundmauern eines alten Minervatempels sich das einzige gotische, aber freilich so ganz italienisch, also so wenig im nordischen Sinne echt gotische Gotteshaus Roms, die Kirche Santa Maria sopra Minerva, erhebt, aus deren ruhiger Spitzbogendunkelheit ich tief ergriffen Michelangelos lichte, nackte Marmorreckengestalt des stehenden, kreuztragenden Heilands hervorleuchten sah. Im übrigen empfand ich auch hier, daß die gotische Baukunst in Rom eigentlich nichts zu suchen hatte.
Vollrömisch aber empfing mich die große, weite Piazza del Popolo, die, am äußersten Nordrande Roms gelegen, ehe die Eisenbahn ins Herz der Stadt führte, der erste von aufdringlichen Kutschern, Führern und Händlern wimmelnde Platz war, den der nordische Reisende betrat. Echt römisch steht gleich links beim Eintritt durch die Porta del Popolo die feine Kirche Santa Maria del Popolo, die schönste Frührenaissancekirche Roms, in ihrer ganzen jungfräulichen Anmut da; echt römisch erhebt sich auf der Mitte des Platzes der hohe Obelisk, der in grauer Vorzeit vor dem Sonnentempel in Heliopolis Wache hielt; echt römisch, von großartig städtebaulicher Wirkung, laufen von der Südseite des Platzes drei fächerförmig auseinanderstrahlende Straßen aus, deren mittlere, der berühmte, nach den Pferderennen des Karnevals benannte Korso, an dessen innerem Ende sich heute das Nationaldenkmal erhebt, zu beiden Seiten ihres Anfanges von den gleichmäßig mit korinthischen Säulenvorhallen geschmückten Rundkirchen der wundertätigen Maria und der Maria vom heiligen Berge eingefaßt wird. Am echtesten römisch aber schließt die Ostseite des Platzes der immergrüne Abhang des Monte Pincio mit seinem schattigen Treppenaufgang zu den hochgelegenen, von Pinien und Zypressen, Lorbeeren und Myrten rauschenden Gartenanlagen, in denen nachmittags die vornehme Welt Roms, um zu sehen und gesehen zu werden, zu Wagen, zu Pferde und zu Fuß hin und her flutet. Geblendet von all dem Glanze, schlich ich bescheiden durch das Gewühl, zwiefach geblendet aber stand ich auf der Vorderterrasse des Parks, von der sich der umfassendste Blick über die dächer- und kuppelreiche Stadt bis zu Michelangelos alles beherrschender, unbegreiflich großsinniger Peterskuppel öffnet.
Michelangelos Peterskuppel! Wer nur zwei Stätten Roms betreten dürfte, müßte neben dem Ruinengelände des altrömischen Roms die Piazza di San Pietro mit der gewaltigen Peterskirche, dem Mittelpunkt der katholischen Christenheit, wählen. Auch hier wieder in der Mitte des Platzes, dem Auge Halt und Maß gewährend, der altägyptische Obelisk; zu beiden Seiten des Platzes aber die in breitem Oval angelegten herrlichen Säulenhallen Berninis, die mit ihrer gewollten Verkürzung den Platz, über den man leicht ansteigend der Peterskirche naht, noch größer erscheinen läßt, als er ist. In feierlich gehobener Stimmung durchschritt ich ihn zum erstenmal und betrat das Innere der größten Kirche der Erde, an der die größten italienischen Baumeister von Bramante und Rafael bis zu Michelangelo, zu Maderna und Bernini ihre besten Kräfte erprobt haben. Madernas frühbarocke gewaltige Vorhallenvorderseite mißfiel mir damals. Ein Glück nur, daß Berninis Türme, die auf ihren Flanken lasten sollten, noch vor ihrer Vollendung wieder abgebrochen worden! Freudig überrascht aber sah ich, als ich die Kirche umwandelte, an ihrer Rückseite sich die mächtigen und doch so reinen Formen und Verhältnisse entfalten, die Michelangelo dem ganzen Äußeren zugedacht hatte, und staunend blickte ich im Inneren, dessen Größe ich weniger seelisch als leiblich an dem Schwindel empfand, der mich in ihm befiel, an Bramantes vier großen Kuppelpfeilern und zu dem steinernen Himmel der Kuppel Michelangelos empor, die sich von innen und von außen gleich überwältigend und gleich herrlich umrissen wölbt.
Von diesen großartigen römischen Eindrücken, die sich nun doch schon zu einer Art Gesamtbild zusammenschlossen, war ich vorläufig wenigstens so weit befriedigt, daß ich die innere Ruhe fand, mich meinen Sonderausgaben zu widmen, die mir freilich sofort eine Reihe der wichtigsten anderen Kunststätten Roms erschlossen. In die köstlichen frühchristlichen Kirchen Roms von der Rundkirche Santa Costanza und der Langkirche Santa Pudenziana bis zu der einschiffigen kleinen Kirche der Heiligen Cosmas und Damianus und der großen, von zwei Reihen ionischer Säulen getragenen Prachtbasilika Santa Maria Maggiore zogen mich schon ihre schimmernden spätrömischen Riesenmosaiken, die mir, noch immer halbhellenistisch, wichtige Aufschlüsse gewährten. In die Kaiserpaläste des Palatins und manche altrömische, unter die Erde gesunkene Hallen und Gemächer, in die unterirdische frühchristliche Gräberwelt der Katakomben und zu manchen oberirdischen Gräbern vornehmer alter Römer und Römerinnen lockten mich die in ihnen erhaltenen alten Wandgemälde verschiedener Entwicklungsstufen; in allen römischen Altertumssammlungen aber, vor allem denen des Vatikans, gab es nicht nur antike Gemälde, auch Landschaftsgemälde und kleinere Mosaiken jeder Art, sondern auch flachbildnerische Marmorwerke genug, die, wenn sie nicht geradezu als Landschaftsdarstellungen anzusprechen waren, doch deutlich genug von den besonderen Beziehungen der antiken Künstler zu ihrer landschaftlichen Umgebung zeugten; und wie freute ich mich, wenn ich an allen diesen Kunststätten bei häufig wiederholter Einkehr nach Vollendung meiner besonderen Untersuchungen mich der Betrachtung der reinen Menschenschönheit hingeben durfte, die mir hier aus hundert und aber hundert edelster Marmorgestalten entgegenstrahlte. Der Laokoon, der Hermes und der Apoll vom Belvedere, die Venus vom Kapitol, die Ariadne, der Diskuswerfer, der Speerträger und der »Apoxyomenos« des Vatikans, der schlanke Jüngling, der sich mit dem Schaber vom Öl und dem Staube der Nacktspiele reinigt! Wozu sie aufzählen? In Gipsabgüssen hatte ich ja längst ihre Bekanntschaft gemacht. Neues lehrten sie mich kaum; aber freilich, ein ganz anderer Genuß war es, den strahlenden, aus Marmor gehauenen Urbildern als den trockenen Gipsen ihrer Abgüsse gegenüberzustehen.
Den Mittelpunkt meiner ergänzenden Bücherstudien und Aussprachen mit Fachgenossen bildete, wie gesagt, das Deutsche Archäologische Institut auf dem Kapitol, das eigentlich ein Weltinstitut war. Sein erster »Sekretär«, wie seine Leiter genannt wurden, war damals der treffliche Wilhelm Henzen (1816-89), der mit unserem Theodor Mommsen und dem großen Italiener Giovanni Battista de Rossi der Hauptschöpfer des großen Weltkodex lateinischer Inschriften war. Aus Bremen gebürtig, war Henzen Hanseat wie ich; und ich verdanke seinem Wohlwollen manche Förderung. Zweiter Sekretär des Instituts aber war Wolfgang Helbig, der liebenswürdige Dresdener Archäologe, der, mit einer russischen Principessa von feinster Geistes- und Herzensbildung verheiratet, eine überaus glückliche Stellung im römischen Wissenschafts- und Gesellschaftsleben einnahm. Wissenschaftlich hatte Helbig in seinen Untersuchungen über die antike Malerei der vom Vesuv verschütteten kampanischen Städte, von deren Wandgemälden er, soweit sie bis dahin ausgegraben worden, ein vollständiges, erläuterndes Verzeichnis herausgegeben hatte, die Grundlage geschaffen, auf der ich weiterbauen konnte. Auf seine Unterstützung, die er mir in reichem Maße zuteil werden ließ, war ich also vor allem angewiesen; und die Abende in seinem gastlichen Hause, in dem seine musikalisch hochbegabte Gattin, die eine Schülerin Liszts gewesen war, in jeder Hinsicht spendend und belebend waltete, bildeten die Grundlage der übrigens nicht zahlreichen römischen Familienbeziehungen, die sich mir auftaten. Frau Helbig war nicht nur eine eigenartige Persönlichkeit, sondern auch eine besondere Erscheinung. Über ihre ungewöhnliche Leibesfülle fielen glatte Gewänder herab, aus denen ein ungemein liebenswürdiger, kindlicher und zugleich geistvoller Kopf mit kurzgeschnittenem Haar hervorblickte. Ihr schlanker blonder Gatte war in ganz Rom schon wegen seiner Vortragsführungen geschätzt, die sich schließlich in einen zweibändigen gedruckten Führer verwandelten; durch alle römischen Antikensammlungen führte er Freunde und Fremde; aber er blieb auch, als er 1888 sein Amt niederlegte und sich mit den Seinen in die herrlich gelegene Villa Lante zurückzog, eine Stütze des deutsch-römischen Lebens.
Von den übrigen deutschen Gelehrten, die damals auf dem Kapitol hausten, nenne ich zunächst Heinrich Nissen, den berühmten Kenner altrömischen Städtebaus, der damals noch Professor in Marburg war, und Adolf Klügmann, der damals noch an seinem Buche über die Amazonen arbeitete. Näher bekannt und teilweise befreundet wurde ich mit einer Reihe mir im Alter näherstehender Philologen und Archäologen, um die das gemeinsame Ziel und die gleiche römische Luft unsichtbare Bande wob. Otto Lüders, der damals noch an seiner Schrift über die dionysischen Künstler schrieb, später aber in die Konsulatslaufbahn überging, war eine überaus frische, liebenswürdige und vertrauenerweckende Persönlichkeit. Adolf Trendelenburg, den seine Schrift über die Gegenstücke in der pompejanischen Malerei mir näherbrachte, wurde Gymnasialdirektor in Berlin, Viktor Gardthausen, der gelehrte Verfasser der griechischen Paläographie und eines feinen Buches über das augusteische Zeitalter, wurde Universitätsprofessor und Bibliothekar in Leipzig, Rudolf Hirzel erhielt einen Lehrstuhl der griechischen Philologie in Jena, Ludwig von Sybel, der Verfasser einer groß angelegten und durchdachten Weltgeschichte der Kunst, einen solchen in Marburg. Am nächsten befreundet wurde ich mit Gustav Hirschfeld, dem späteren Königsberger Professor, dessen Name neben dem Georg Treus eng mit den ruhmreichen deutschen Ausgrabungen in Olympia verknüpft ist.
Ich brauche diese Namen nur zu nennen, um auf die Fülle mannigfaltiger Anregungen zu deuten, die mir der freundschaftliche Verkehr mit allen diesen älteren und jüngeren deutschen Philologen und Archäologen eintrug. Teils trafen wir uns in den Sitzungen des Archäologischen Instituts, zu denen ich von Anfang an eingeladen wurde, teils an den geselligen Archäologenabenden, an denen ich selten fehlte, teils aber auch auf gemeinsamen Ausflügen in die herrliche und immer lehrreiche Umgebung Roms und in verabredeten Zusammenkünften in verschiedenen Osterien, in denen der römische Wein die Zungen löste.
Von den freien deutschen Schriftstellern, die sich damals, um römische Kunst und römisches Leben kennenzulernen, in der ewigen Stadt aufhielten, trat nur einer mir so nahe, daß wir Freundschaft fürs Leben schlossen. Dieser eine war Gustav Floerke (1840-1916) aus Rostock, der später eine Zeitlang Professor der Kunstgeschichte an der Weimarer Kunstakademie war. In München hatte er dem Dichterkreise der Krokodile angehört; Paul Heyse hatte mich ihm empfohlen. Ich denke in herzlichster Gesinnung, aber nicht ohne Wehmut an ihn zurück. Er war eine Persönlichkeit von außergewöhnlich einnehmender, jung und alt bestrickender Außenseite, vielseitigem und tiefgehendem Wissen, geistvoller Unterhaltungsgabe, aber etwas unstetem, durch nicht nur seelische Räusche allzuoft benommenem Wesen. Er verstand es, sich ebenso rasch Gegner wie Freunde zu machen, und war nicht vorausbestimmt, in bürgerlichem Frieden ein behagliches Alter zu genießen. Als wir uns kennenlernten, hatte er, außer seiner Doktorarbeit über die vier Parochialkirchen Rostocks, nur erst die flott gesehenen und geschriebenen Kriegserinnerungen »Von unseren Truppen im Felde« veröffentlicht. Von seinen späteren Arbeiten hatten seine kapresischen Dorfgeschichten »Die Insel der Sirenen« den größten Erfolg. Nachdem er Weimar, wo ich ihn und seine schöne, altem Adel entsprossene Gattin noch einmal mit der meinen besucht habe, 1879 verlassen, lebte er unstet bald in Florenz, bald in Zürich, bald in München. Engste Freundschaft verband ihn mit Arnold Böcklin, in dessen ihm nahverwandtes Wesen keiner tiefer eingedrungen ist als er. Aber erst nach seinem Tode veröffentlichte Floerkes trefflicher Sohn Hans seines Vaters tiefgründige und sprudelnde Skizzen »Zehn Jahre mit Böcklin«. Gustav Floerke ist aufs engste mit meinen Erinnerungen an jenen inhaltreichen römischen Winter verwoben. Ich möchte fast sagen, ohne ihn wäre Rom mir nicht Rom gewesen.
Wie ich, war Floerke der Ansicht, daß der Kunstgelehrte sich vor allem im Verkehr mit Künstlern weiterzubilden habe; und wohl zunächst durch ihn wurde ich mit einem Kreise junger deutscher Künstler bekannt, der, durch einige der genannten Archäologen bereichert, den eigentlichen Mittelpunkt nicht zwar meines Lernens, aber meines Lebens und Schwärmens in Rom bildete.
Deutsche Künstler in Rom! Es ist oder war ein eigenes Kapitel. Die Zeit der nazarenischen und klassizistischen römisch-neudeutschen Kunst, in der Meister wie Koch, Carstens, Cornelius, Overbeck, Veit, Schnorr und ihre Schüler Rom zu einem Mittelpunkt frischen, im damaligen Sinne fortschrittlichen Strebens der deutschen Kunst gemacht hatten, war endgültig vorüber. Die Nachfahren jener Meister, die noch in Rom ansässig waren, wurden selbst in Deutschland kaum mehr genannt. Die jüngeren deutschen Künstler, die sich meist nur vorübergehend, weil es nun einmal dazu gehörte, in Rom aufhielten, schwuren meist schon zur Fahne Karl Pilotys oder Ferd. Pauwels, die die angeblich realistisch-koloristische Richtung des Antwerpeners Gallait und des Franzosen Paul Delaroche in Deutschland verbreiteten. Darüber hinausgehend, schwärmte man bereits für Feuerbach und für Böcklin, aber auch noch für Genelli und M. von Schwind, ließ auch Ludwig Richter gelten und versprach sich große Dinge von Anton von Werner, den man wegen seiner Abbildungen zu Viktor von Scheffels damals die ganze Jugend begeisterndem »Trompeter von Säckingen« so verehrte, daß man einige Jahre später seine Berufung zum Berliner Akademiedirektor als Fortschritt begrüßte, ohne zu bedenken, daß Werner kein Maler, sondern auch in seinen großen Gemälden nur Illustrator war. Von den französischen Freilichtmalern, von Manet und Monet, die einen abermaligen Umschwung brachten, aber war in unserem römischen Kreise noch keine Rede.
Berühmt ist keiner der jungen Künstler geworden, mit denen Floerke, einige der genannten jungen Archäologen und ich uns damals in Rom an alter Kunst und jungem Wein berauschten, die Reize der weiten, großzügigen Campagnalandschaft mit ihren malerisch-elegischen Ruinen und ihren anheimelnden, köstlichen Bianco asciuto schenkenden Osterien, ihren Büffel- und Schafherden, ihren Hirten und ihren Hunden auskosteten, dann in der Stadt die Hauptmahlzeit in der echt römischen Trattoria del Gabbione einnahmen, die wir uns ängstlich bemühten, Baedeker zu verheimlichen, abends aber von einer Weinschenke in die andere wanderten und uns über alle Fragen des Wissens und Glaubens, der Kunst und des Lebens stritten und einigten und wieder stritten.
Ad. Thomas (1834-87), der Dresdener Schüler Ludwig Richters, ein gutherziger und humorvoller Verwachsener, der wohl der Älteste unseres Kreises war, war wenigstens in der Dresdener Galerie bereits mit einer 1866 in München gemalten Gebirgslandschaft vertreten; Hugo Harrer (1836-76), der als Schüler Pilotys in München und Oswald Achenbachs in Düsseldorf zu den damals Modernsten dieses Kreises gehörte, fand für seine netten italienischen Landschaften ohne großzügige Fernen bei den Fremden, die Rom besuchten, angenehmen Absatz; Franz Ruben (geb. 1842), dessen Vater und Lehrer Christian Ruben (1805-75) damals Akademiedirektor in Wien war, zog bald darauf ganz nach Venedig, dessen Reize er in ansprechenden Bildern und Wasserfarbenblättern verherrlichte.
Als Bildhauer gehörte namentlich Fritz Schulze zu unserem Kreise, ein feiner, kleiner, blondbärtiger Holsteiner mit regelmäßigen Zügen und hellblauen Augen, dem eine leichte Art, gut getroffene Büsten oder Reliefs in Marmor zu meißeln, manchen Zuspruch reisender Deutscher verschaffte. Seine »Schwarzen Bilder«, zu denen Floerke den Text schrieb, sind ein harmlos hübsches Buch. Relief-Profilköpfe modellierte er aus Freundschaft von Floerke, Krohn und mir. Den meinen ließ mein Vater ihn in Marmor ausführen. Fritz Schulze war ein sinniger, liebenswürdiger Mensch, der sich, glaube ich, mit keinem entzweit hätte, übrigens auch geistig manchem etwas zu geben hatte.
Die Mehrzahl der jungen deutschen Künstler unseres Kreises ist heute vergessen; aber die Künstler dieser Art sind, wie ich später bestätigt fand, oft die angenehmsten Gesellschafter und wissen auch über ihre Kunst so treffend zu sprechen, daß man sich wundert, nie wieder etwas von ihren Leistungen zu hören. Einen Maler, mit dem namentlich Floerke und ich täglich zusammen waren, aber habe ich nicht vergessen, sondern nenne ihn absichtlich zuletzt, weil ich in jeder Hinsicht am meisten von ihm gehabt habe. Er hieß Hieronymus Christian Krohn, war Hamburger wie ich und so ziemlich gleichaltrig mit mir. Er war Schüler Ferd. Pauwels in Weimar gewesen, hatte aber von allen Malern dieses Kreises wohl die selbständigste Begabung. Einerseits geriet er, unabhängig von Manet, den er nicht kannte, auf die Bahnen des Freilichts, das in der Luft lag. Anderseits hatte er eine hervorragende raumkünstlerische Begabung. Einige Bilder seiner Hand, die ich besitze, werden zu meiner Überraschung von modern empfindenden Künstlern immer wieder bewundert. Ein schweres Leiden, das ihn während der letzten zwanzig Jahre seines Lebens arbeitsunfähig machte, hatte ihn schon früh an der vollen Entfaltung seiner Kräfte verhindert. Damals aber war der große schlanke, junge Mann mit dem graublonden Bürstenkopf und den klugen und wohlwollenden großen, grauen Augen noch im Vollbesitz seiner Kraft. Das Beste wohl, was er geschaffen, sind seine wunderbar genauen Nachbildungen antiker Wandgemälde, die er für mich ausführte. Ich komme darauf zurück. Wir schlossen uns eng aneinander an. Offenen Sinnes für alles Große, Gute und Echte in der Kunst und im Leben, ist er mir in mehr als einer Hinsicht viel gewesen und weit über die Zeit unseres gemeinsamen Aufenthalts in Rom, in Neapel und Pompeji hinaus nahe verbunden geblieben. Ohne Krohns Kameradschaft und Mitarbeit hätte ich die Aufgaben, die ich mir gestellt hatte, nicht erfüllen gekonnt.
Von den älteren deutschen Künstlern, die, ohne zu unserem »Korps«, wie ich es nennen möchte, zu gehören, damals in Rom wirkten, werden eigentlich nur zwei, ein Bildhauer und ein Maler, in der Kunstgeschichte genannt, und diese waren auch die einzigen, die wir, namentlich Floerke, Krohn und ich, in ihren Werkstätten besuchten, um ihnen zu huldigen. Der Bildhauer war der Schwabe Joseph Kopf (1827-1903), der viele klassizistisch-anmutige Bildwerke für den württembergischen Hof und eine Reihe tüchtiger Büsten von Fürsten, Gelehrten und Künstlern, wie z. B. die Büsten Kaiser Wilhelms I. und der Kaiserin Augusta für die Berliner Nationalgalerie, geschaffen hatte. Der stattliche Vierziger mit schon leicht ergrauendem Haupthaar ließ sich gern in lehrreiche Gespräche über Kunst verwickeln. Der Maler war der Dresdener Heinrich Franz-Dreber(1822-75), der Schüler Ludwig Richters gewesen war, dessen Stil figürlicher Landschaftsmalerei er, von brauner zu lichterer Tönung fortschreitend, selbständig weiterentwickelt hatte. Seine breiten, in edlen Liniengefügen von weichen Laubwäldern durchwobenen Landschaften, die von biblischen oder mythologischen, bekleideten oder nackten Figuren nicht nur belebt, sondern auch zusammengehalten werden, sind neuerdings durch Sonderausstellungen wieder zu Ehren gekommen. Wir weilten damals gern in der Werkstatt des feinen, freundlichen Mannes mit dem rötlichbraunen Künstlerhaar und den ein klein wenig mißtrauisch aus zarten Zügen hervorblickenden hellen Augen.
In Rom traf ich gelegentlich auf der Straße oder im Caffè Greco, dem Stelldichein des älteren deutschrömischen Künstlergeschlechts, aber auch meinen alten Bekannten Anselm Feuerbach wieder, und hier in Rom schnitt er mich nicht wie damals in München. Ich erinnere mich, einen Abend in langer, anregender Unterhaltung mit ihm im Caffè Greco zusammengesessen zu haben. Andächtig lauschte ich den Gedankengängen des verehrten Meisters, in dessen Schöpfungen Natur und Stil, reine Formen und satte Farbenharmonien so innig und so großzügig verschmolzen sind wie in den Werken keines anderen deutschen Meisters. Wohl merkt man seinen Typen die Herkunft von seinem Pariser Lehrer Couture an; aber seine künstlerische Tiefe und Harmonie hat er aus seinem eigensten Selbst geschöpft. Daß dramatisch bewegtes Leben darzustellen nicht seine Sache war, wurde zur Tragik seines Lebens; aber ruhiges Dasein künstlerisch lebendig zu machen, hat kein Deutscher, außer Hans von Marées, so verstanden wie er. Venedig war seine künstlerische Heimat. In Rom war er nicht so zu Hause, wie er glaubte.
Der anerkannte Sammelpunkt des deutschen Künstlerlebens in Rom bildete der Deutsche Künstlerverein, der damals seinen Sitz in dem herrlichen alten Palaste Poli über der berühmten Fontana Trevi hatte. Der Prachtbrunnen, der das reine Quellwasser der Aqua Vergine sprudelnd und schäumend mitten in die Stadt hereinführt, nimmt die Südwand des Palastes ein. Der breite, krause, von Tritonen und Nereiden belebte, von der marmornen Riesengestalt des kühn bewegten Meergottes beherrscht Triumphbogen-, Nischen- und Felsblockbau Nicola Salvis ist bekanntlich eine Hauptschöpfung des römischen Spätbarocks, zu dem auch die prunkvolle, von dem jüngeren Martino Lunghi vollendete Schauseite der schräg gegenübergelegenen Kirche San Vincenzo ed Anastasio hinüberleitet. Der kleine, abgelegene Platz wird durch die machtvolle Kirchenfassade und den noch machtvolleren, Tag und Nacht in unzähligen Kaskaden und Springstrahlen rauschenden Wandbrunnen beinahe zusammengedrückt. Aber um so wuchtiger wirkt er auf den Beschauer. Dem Barock ist alles erlaubt. Uns deutschen Forschern und Künstlern jener Tage bildete dieser große kleine Platz ein uns besonders geweihtes, jedem von uns heiliges Fleckchen Roms; und der Vorschrift der deutschen Künstlersage, daß man, wenn man sicher sein wolle, zur ewigen Stadt zurückzukehren, beim Abschied um Mitternacht einen Kupfersoldo über den Rücken hinweg in das Wasserbecken der Fontana Trevi werfen müsse, kam jeder von uns, auch wenn es sich nur um einen größeren Ausflug handelte, willigst nach.
Der Deutsche Künstlerverein herrschte damals, wie gesagt, in einem der Geschosse des Palazzo Poli. Sein Vorsitzender war der gelehrte und kenntnisreiche, aber auch gesellschaftlich gewandte und liebenswürdige Maler Otto Donner von Richter aus Frankfurt (1828-1911), dessen eigene Malweise zwischen der seiner Lehrer Schwind, Delaroche, Couture und abermals Schwind vergebens einen festen Halt suchte. Seine Untersuchungen über die Technik der antiken Malerei aber, die, wenn sie auch nicht das letzte Wort in dieser schwierigen Frage bedeuteten, doch fördernd in sie eingriffen, stellten ihn auf einen Boden mit uns Archäologen, die damals im Deutschen Künstlerverein eine keineswegs bescheidene Rolle neben den Malern und Bildhauern spielten.
Während der ersten drei Monate meines Aufenthalts in Rom war der Verein die Hauptstätte der Abendgeselligkeit des Freundeskreises, dem ich angehörte. Floerke dichtete geistreiche kleine Festspiele für willkommene Gelegenheiten. In einem solchen trat ich als Walter von der Vogelweide auf, in einem anderen erschien ich als Herold. Einige von uns gehörten auch dem Vorstande an. Später zogen wir uns wegen lächerlicher Meinungsverschiedenheiten aus dem Verein zurück, schlossen uns infolgedessen aber nur um so fester zusammen. Mein Leben in Rom erfuhr, wenn wir nun auch abends in römischen Osterien anstatt im Deutschen Künstlerverein zusammenkamen, dadurch keine Veränderung.
Der römische Wein wirkt Wunder. Frisch und arbeitslustig erwachten wir jeden Morgen nach unseren nächtlichen Symposien. Lern- und schaffensfreudig ging ich jeden Morgen an mein Tagewerk, das mich auf weiten Wanderungen über alle sieben Hügel und durch alle häuserreichen Täler der ewigen Stadt, aber auf belebten Landstraßen auch weit hinaus führten zu den stillen, im klassisch zerschnittenen Gelände der Campagna zerstreuten Stätten, an denen sich echte Wandgemälde und unter ihnen fast immer auch wirkliche Landschaftsbilder der alten Römerzeit erhalten haben. Notizbuch auf Notizbuch wurde gefüllt. Gerade hier hieß es mit einem gewissen Recht: »Denn was du schwarz auf weiß besitzest, kannst du getrost nach Hause tragen.«
Die Hauptstätten Roms, an denen sich wirkliche antike Landschaftsfresken, zu denen es nicht nur den Archäologen, sondern auch jeden Unbefangenen hinzieht, erhalten haben, wurden natürlich mit Spannung zuerst besucht. Wie anheimelnd weit draußen in der vom Tiber durchströmten Campagna, bei Prima Porta, nördlich der Stadt, der Gartensaal der Villa Livias, dessen vier Wände durch die Kunst des Malers in ein Gartendickicht von Lorbeeren, Palmen und Blütenbüschen verwandelt ist, in dem Pfauen einherstolzieren, Tauben und Zeisige sich in den Ästen wiegen! Wie vornehm die Wandfresken in dem Hause der Livia auf dem Palatin: in dem Speisezimmer die großen, mit Heiligtümern ausgestatteten Landschaften; im Empfangszimmer außer dem großen mythologischen Gemälde der von Argos bewachten, von Hermes befreiten Jo, das als Nachbildung eines Gemäldes des alten griechischen Malers Nikias gelten kann, die römischen Straßenbilder mit ihren in mehreren Stockwerken emporgetürmten, mit Balkonen und Fenstern versehenen Häusern und der gelbe, mit braunen Schatten und weißlichen Lichtern ausgestattete Landschaftsfries, in dem sich das ganze bunte Leben der italienischen Seeküsten und Villengelände jener Tage widerspiegelt! Wie kann man den alten Großstädtern die Sehnsucht nach der Natur nachfühlen, die sie sich durch ihre Maler in ihre Häuser versetzen ließen!
Das eigentliche Heiligtum der antiken Malerei aber war damals das Zimmer der vatikanischen Bibliothek, in dem die besten der aus ihren ursprünglichen Wänden losgebrochenen und hier nebeneinander gehängten antiken Wandgemälde vereinigt worden. Das schönste Figurenbild dieser Sammlung ist das feine stille Gemälde der sogenannten aldobrandinischen Hochzeit, das die Entkleidung der Braut durch ihre Mädchen, den sittsam an der Schwelle sitzenden Bräutigam und das glückspendende Opfer in reinen, schlichten Linien und Farben, von wunderbar keuscher Sinnlichkeit durchweht, darstellt.
Die schönsten Landschaften dieses Saales, ja weitaus die bedeutendsten antiken Gemälde dieser Art, die überhaupt auf uns gekommen, aber waren und sind die sieben großen Odysseelandschaften, die 1848 auf dem esquilinischen Hügel, wo sie den langen Wandelgang eines vornehmen Hauses schmückten, wieder ausgegraben worden sind. Schon als genaue Verbildlichungen der aufeinander folgenden Homerischen Schilderungen des Lästrygonenabenteuers des Odysseus, des Aufenthalts des göttlichen Dulders bei der Zauberin Kirke und seines Besuches in der Unterwelt sind sie einzig in ihrer Art. Sie sind natürlich nur ein Teil der Odysseebilder, die den Gang geschmückt haben. Durch gemalte hochrote Pilaster mit goldgelben Kapitellen wird die Reihe in Bildfelder eingeteilt, die aber nicht durchweg mit den landschaftlichen Bildeinheiten zusammenfallen, die sich wandelbildartig hinter den Pfeilern herziehen. Durch die perspektivische Darstellung der Pfeiler erkennt man, daß das auch durch die Darstellung eines festen Palastbaues ausgezeichnete Mittelstück das Bild ist, das Odysseus im Palasthof der Kirke darstellt. Neue Aufschlüsse über die Fortschritte, die die späthellenistische Malerei in der Darstellung von Luft und Licht um etwa 100 vor Christo gemacht hatte, gibt namentlich das Unterweltsbild, das in seiner malerischen, zugleich impressionistischen und expressionistischen Breite so modern wirkt wie kein anderes aus dem Altertum erhaltenes Gemälde. Mächtig wölbt sich in seiner Mitte das riesige Felsentor, das den Eingang in das Reich der Schatten bildet. Mit voll geschwelltem Segel naht links über blauem Meer unter duftigem Himmelshorizont das Schiff des Odysseus. Rechts, innerhalb des Felsentors, fällt ein breiter Lichtstrahl in das unterweltliche Dunkel und erhellt das schilfumsprossene Gestade des Acheron, an dem ungezählte Totenschatten das Widderopfer des Odysseus umdrängen.
Gleich als ich zum ersten Male vor diesen Bildern stand, war mir klar, daß es meine erste und vornehmste Aufgabe sei, gerade sie als Prachtwerk in einwandfreien Farbensteindrucken zu veröffentlichen. Der erste Schritt hierzu mußte sein, mir genaue, Pinselstrich für Pinselstrich wiedergebende Deckfarbenkopien nach ihnen zu verschaffen. Sie anzufertigen, erklärte sich zu meiner Freude mein Freund Krohn sofort bereit. Es waren schöne Monate, in denen ich, nachdem wir uns die Erlaubnis dazu verschafft, die Bilder eines nach dem anderen, natürlich in stark verkleinertem Maßstabe, auf dem Papier in Deckfarben neu erstehen sah. Nachdem Gustav Hirschfeld auch die Genauigkeit der Wiedergabe der griechischen Inschriften über den Hauptfiguren festgestellt hatte, legte ich die Kopien, sie zugleich erläuternd, dem archäologischen Institut in einer seiner feierlichen Sitzungen vor. Die Kopien Krohns fanden allgemeinen Beifall. Mir trug mein Vortrag über die Bilder die Ernennung zum korrespondierenden Mitglied des Institutes ein. Die Ausführung in Farbendrucken wurde der ersten damaligen Firma für künstlerische Steindrucke, W. Loeillot in Berlin, übertragen. Den Verlag übernahm Brunns Vetter, der Buchhändler Theodor Ackermann in München. Die mühsame Ausführung aber zog sich jahrelang hin. Das Werk erschien, freundlich begrüßt, erst 1876.
Während Krohn in der vatikanischen Bibliothek malte, durchwanderte ich – wie oft! – alle Stätten des großen päpstlichen Palastes, die der christlichen Kunst geweiht waren. Ich hätte mir selbst und meinem Berufe untreu werden müssen, wenn ich nur die Kunstschöpfungen des antik heidnischen, nicht auch die des neuzeitlich christlichen Roms in mich aufnehmen gewollt hätte. Die vatikanische Gemäldegalerie, die Stanzen und die Loggien Rafaels, die Sixtinische Kapelle mit ihren florentinischen und umbrischen Wandgemälden des 15. Jahrhunderts und ihren gewaltigeren Wand- und Deckenbildern Michelangelos! Ich hätte ein Herz von Stein haben müssen, wenn ich mich in der Nähe dieser Wunder der Renaissancekunst auf die dürftigen erhaltenen Reste der antiken Malerei versteift hätte! Und unversehens fielen mir auch auf meinen Streifzügen im Dienste meiner Sonderaufgaben oft genug die köstlichsten Perlen der neueren römischen Malerei und Bildhauerei zu Füßen, an deren Glanz ich mich um so unbefangener sonnen durfte, als es dieses Mal vor ihnen noch weniger als vor jenen antiken Marmorbildwerken meine Aufgabe war, sie zu zergliedern und ihnen ihre kunstgeschichtliche Stellung nachzurechnen. Alle diese Schätze waren ja freilich ursprünglich bodenfremd in Rom. Waren sogar die besten »Antiken«, deren Marmorgestalten die langen, langen Säle des Vatikans und des Laterans, die vornehm verteilten Zimmer des kapitolinischen Museums und die köstlich hingelagerten Räume und Terrassen der Villa Albani schmückten, um nur diese zu nennen, griechischer Herkunft oder doch Nachbildungen oder Nachahmungen griechischer Vorbilder, so ist erst recht die ganze reiche Renaissancekunst Roms zwar italienisches und echt italienisches, aber doch eben nicht römisches, sondern florentinisches, urbinatisches oder oberitalienisches Gewächs; und doch ist es die Kunst der römischen Päpste und der römischen Großen, die teils die großen Meister selbst, teils ihre Schöpfungen nach Rom verpflanzten; und da eben nur das päpstliche Rom damals imstande war, all die großen Meister und alle die herrlichen Werke in seinen Mauern zu sammeln, so entwickelte sich schließlich doch etwas wie eine römische Kunst der Renaissance, die ein kräftiger Hauch feierlicher Größe durchweht.
Was ich vor Michelangelos Moses in San Pietro in Vincoli empfand? Ich sprach es später in einem meiner Sonette an Michelangelo aus:
»Einsame Steige, die zum Gipfel führen,
Warst du dein Leben lang gewohnt zu gehen;
Die Winde, die um Felsenstirnen wehen,
Sie wehten, deines Geistes Glut zu schüren.
Wenn meine Stirn nun Alpenwinde rühren,
Wenn meine Augen Gletscherwände sehen,
So mein' ich, Meister, erst dich zu verstehen
Und deiner Größe Geisteswucht zu spüren.
Im Hochgebirg auf schwarzer Wetterwolke
Erscheint dein Moses, hehr und majestätisch.
Ein Held, wie nur dein Geist ihn konnt' ersinnen.
Mit Donnerstimme spricht er zu dem Volke
Und zeugt, halb urteilsprechend, halb prophetisch,
Von Geistesallmacht über Lustbeginnen.«
Welches Einzelgemälde der Hochrenaissancezeit ich für das schönste Bild Roms hielt? Die Frage ist verfänglich; und doch zweifelte ich damals keinen Augenblick daran, daß es kein schöneres Bild am Tiberstrande gebe als Tizians »Himmlische und irdische Liebe« in der Galerie Borghese. In einer glühenden, tief gestimmten Prachtlandschaft sondergleichen sitzen auf dem Brunnenrande, der einem altrömischen Marmorsarkophag gleicht, eine reich bekleidete und eine nackte Frau einander gegenüber. Zwischen ihnen beugt sich Amor, dessen Rechte im Wasser spielt, über den Rand. Die venusgleiche Nackte neigt sich über den Brunnen leicht zu der ruhig dasitzenden bekleideten Schönen hinüber. Sie scheint ihr zuzureden. Es ist wie ein Traum. Ums Himmelswillen keine Deutung, keine Schulweisheit! Einen solchen Einklang von landschaftlicher und menschlicher Schönheit hat es nie gegeben. Nur schauen! Nur empfinden! Nur sich wiegen auf den Wogen der Schönheit!
Die Wand- und Deckengemälde der römischen Renaissance aber, die mich am meisten ergriffen, befanden sich im Vatikan. Rafaels Stanza della Signatura schien mir und scheint mir wohl noch heute in ihrem festen, vollschönen Gleichgewicht von ordnendem Raumgefühl, von leiblicher Schönheit und geistiger Bedeutsamkeit der Formen und Farben, von organischem Leben und mathematischer Selbstverständlichkeit unerreicht und unübertrefflich zu sein. Der Meister stand nur eine kurze Zeit zwischen seinen peruginesken Anfängen und seinem michelangelesken Ausklang auf dieser nur ihm eigenen, aus seinem innersten Wesen emporgewachsenen Höhe. Auch in der Gestaltung dramatischen Lebens in der Stanza d'Eliodoro war er noch ganz er selbst. In dem dann folgenden gestaltenreichen Zimmer des Borgobrandes, in dem Rafael nur wenig eigenhändig mehr gemalt, machen sich auch in der Linienführung schon Anfänge barocken Empfindens bemerkbar. Die kalt bewegten Fresken des Konstantinssaales, die ich abscheulich fand, zeigen, wie weit schon die meisten Schüler des Meisters sich von seinem Eigenempfinden entfernten, um mit dem Michelangelos in vergeblichen Wettbewerb zu treten.
Wie unnachahmlich das eigenwillige Selbstempfinden der gewaltigen Bewegungskunst Michelangelos, die den Barockstil einleitete, seiner Natur nach sein mußte, offenbarten mir seine unendlich großen Deckengemälde und sein überkühnes Riesenwandbild des Jüngsten Gerichtes in der Sixtinischen Kapelle. Das Jüngste Gericht war damals freilich mit all seinem unorganisch Hineingemalten eigentlich nur noch eine Ruine; aber die Gemälde der Decke und der Übergangsteile zwischen ihr und der Wand, die Propheten und Sibyllen, die Bilder der Schöpfungsgeschichte, die herrlichen Atlantenpaare und sinnbildlichen Deckenjünglinge, in denen man schon damals die baukünstlerischen Kräfte des Stützens, Tragens, Haltens, Bindens und Krönens verleiblicht sah, strahlten in einer Wucht und Schönheit, einer Größe und einem Tiefsinn zugleich, dem nichts auf Erden gleichzukommen schien.
Ich verließ Rom mit der Überzeugung, daß Michelangelo die größte künstlerische Persönlichkeit der Welt sei, das heißt: der romanischen Welt. Daß in der germanischen Welt Rembrandt neben ihm stehe, empfand ich schon damals; beide stehen fest auf dem Boden der Natur, heben sie aber, halb unbewußt, durch den ihnen angeborenen künstlerischen Willen, der eine in den Formen, der andere in den Farben, über ihre irdische Bedingtheit hinaus in das Reich geistigen Schauens empor.
Aber was wüßte auch der empfänglichste Schönheitssucher von Rom, wenn er auch alle seine Schätze aller Künste und aller Zeiten in sich aufgenommen hätte und gefühllos an den Reizen seiner näheren und ferneren landschaftlichen Umgebung vorübergegangen wäre? Kunst und Natur sind nirgends so aufeinander angewiesen wie in Italien, kaum irgendwo so miteinander verwachsen wie in Rom. Das beginnt schon gleich vor den Toren der Stadt, in den köstlichen immergrünen und aussichtsreichen Villen der römischen Großen, deren Gärten sich den fremden Besuchern meist gastfrei öffnen, und in der weiten, öden und doch so inhaltreichen und doch so linienschönen Campagna, die sich, von den langen Bogenstellungen der altrömischen Wasserleitungen durchzogen, von einzelnen üppig ausgebildeten Pinien und Zypressen durchragt, von dem Albanergebirge mit seinen scharfen vulkanischen Formen im nahen Süden, von den ferneren blauen Sabinerbergen im Osten begrenzt, träumerisch und gedankenschwer hinstreckt. Im Nordwesten taucht der Monte Soracte auf, den Horaz besungen; und sanfte blaue Hügelketten verdecken im Südwesten den Blick aufs Meer.
In elegischer Stimmung, von großen Erinnerungen und dem Atem des Vergänglichen umschauert, wandert es sich auf den Landstraßen, die in die Ferne führen, am wunderbarsten. Wie oft sind meine Freunde und ich zur Sonnenuntergangszeit namentlich auf der ernsten, feierlichen, zu beiden Seiten von den Riesengräbern, die die alten Römer ihren Teuren gewidmet, eingefaßten alten Via Appia gewandert, die geradeswegs auf das Albanergebirge zu führt! Und wie oft auch zog es uns an Feiertagen in das herrliche Albanergebirge selbst hinauf, dessen edle Bergformen, stille Kraterseen, fröhliche Ortschaften und freundliche Menschen uns immer vertrauter wurden und doch immer neu erschienen. Den Kern des Albanergebirges bildete für mich das schlichte, aber freundliche, grün umwoben an Felsen geschmiegte Gasthaus de Sanctis am Nemisee, auf dessen Terrasse einer der schönsten Ausblicke Italiens vor uns liegt. Zur Rechten sieht man über dem baumreichen Abhang das alte Kastell aufragen. Zur Linken sucht das Auge über den unten liegenden, von steilen Wänden umfaßten See hinweg das ferne Meer. Vorn in der Mitte über dem See aber ragt die oft gemalte mächtige Zypresse, die dem Bilde Halt und Zusammenschluß verleiht. Ach, dieses Bild! Es war genau das große Bild, mit dem Louis Gurlitt vor fünfundzwanzig Jahren mein elterliches Landhaus geschmückt hatte. Heute hängt es mir täglich in meinem Arbeitszimmer vor Augen. Seit meinem zwölften Lebensjahre war es mein eigen gewesen.
Ausflüge in die weitere Ferne erlaubte ich mir in diesem Winter nur, wenn es galt, an entlegeneren Orten antike Wandgemälde oder Mosaiken aufzusuchen; und auf den Ausflügen dieser Art, die ich bald mit meinen archäologischen Freunden, bald allein unternahm, war mein Naturerlebnis in der Regel noch stärker als das Bewußtsein, meiner wissenschaftlichen Pflicht genügt zu haben.
Köstlich war ein mehrtägiger Ausflug nach den etruskischen Grabstätten, den ich mit Gustav Hirschfeld und Viktor Gardthausen unternahm, um die alten, eine ganze Entwicklungsgeschichte widerspiegelnden Wandgemälde ihrer Grabkammern kennenzulernen. Erst wurden die Ruinen und Gräber des alten Veji besucht, dann fuhren wir ins Herz des alten Etruriens zu den Grabgemächern Caeres und Tarquiniis. Corneto war das Standquartier, von dem wir ausgingen. Natur und alte Kunst verweben sich unauflöslich auch in meinen Erinnerungen an diese Fahrt, die zu den lehrreichsten gehört, die ich gemacht habe.
Noch inhaltreicher und herrlicher aber war der in weit höherem Maße der Natur als der Kunst geweihte Ausflug, den ich mit den Künstlern unserer engen Tafelrunde unter der Führung Krohns, Rubens und Thomas' ins Sabinergebirge unternahm. Palestrina, das antike Praeneste, war unser erstes Reiseziel. Hier hatte ich noch im Dienste meiner Aufgaben zu tun. Hier galt es, im Palazzo Barberini das große Fußbodenmosaik aus dem ersten christlichen Jahrhundert mit seiner riesigen, alle wirklichen und erträumten Wunder des Niltals darstellenden ägyptischen Landschaft wissenschaftlich einzuheimsen. Dann ging es weiter hinaus und hinan, mitten in die kunstfreie Natur hinein. Teils zu Fuß, teils zu Pferde erreichten wir über Genzano und durch die Waldwildnis des großartig malerischen Gariglianotales die mittelalterliche Bergstadt Olevano, wo wir in der allen Deutschrömern teuren Casa Balbi einen Künstlerabend nach unserem Herzen verbrachten. Am anderen Morgen brachen wir nach dem hoch auf einsamem Felsengrat thronenden Dorfe Bellegra oder Civitella auf, dem von Ludwig Richter in einer seiner frühen Landschaften der Dresdener Galerie verherrlichten Bergneste, das, wie diese ganze Gegend, dem römisch-deutschen Kunstempfinden des ersten Drittels des 19. Jahrhunderts heilig war. Ludwig Richter schildert in seiner Selbstbiographie sein Bild und damit den Ort mit den Worten: »Abendglanz liegt auf dem Wohnort der von ihrer Mühsal heimkehrenden Landleute, vergoldet das alte Tor und küßt das Heiligenbild daran mit dem Kusse des Friedens.« Der Weg nach Civitella führte uns durch den berühmten Eichenhain Serpentara, in dem zur Zeit Kochs, Richters und Prellers, die ihn verewigt haben, berühmte deutsche Künstlerfeste abgehalten wurden. Goldene Erinnerungen rauschten durch die Kronen der alten, knorrigen, immergrünen Eichen.
Von der aussichtsreichen Höhe Civitellas ging es weiter durchs wilde Gebirge nach Subiaco, wo übernachtet wurde, von Subiaco durch einsame Bergwildnis über Stock und Stein auf schmalem Steige nach Gerano, von hier aber auf guter, von allem Zauber frischer Höhennatur umwehter Straße nach Tivoli, dem Glanzpunkt des Sabinergebirges, dessen wunderbarer zierlicher Säulenrundtempel über dem steilen, vielfach zersplitterten, brausenden Wasserfall schon seit dem 17. Jahrhundert ein Lieblingsvorwurf der Landschaftsmaler und -stecher gewesen ist. Vor Dunkelwerden besuchten wir noch die Villa d'Este mit ihrem einzig üppigen Terrassenpark, dessen hochragende Zypressen für die gewaltigsten Italiens gelten. Am nächsten Tage wanderten wir dann über die köstliche, an Blicken auf die Wasserfälle und in die Campagna überreiche Via delle Cascatelle zur Villa Hadrians hinab, dieser großartigsten, lehrreichsten und malerischsten ländlichen Trümmerstätte des kaiserlichen Roms, deren mächtig aufragende Mauerruinen, von üppigem Pflanzenwuchs durchwoben, von der Natur in ihre Arme zurückgeholt und in einen unvergleichlich einzigartigen Park verwandelt worden sind. Meine Freunde verließen mich hier. Stundenlang aber unterhielt ich mich hier noch mit den Geistern einer prächtigen Vorwelt, deren Schatten durch Pinien, Zypressen und altes Gemäuer huschten.
Allein unternahm ich in der letzten Woche vor Weihnachten, nachdem ich bereits allen Resten hellenisch-römischer Malerei, die sich in Rom und seiner nächsten Umgebung befanden, nachgegangen war, den für meine wissenschaftlichen Untersuchungen weitaus wichtigsten aber auch landschaftlich weitaus großartigsten Ausflug: meine erste Reise nach Neapel und Pompeji, wo sich ja die große Mehrzahl aller wiederausgegrabenen griechisch-römischen Wandgemälde, unter ihnen auch weitaus die meisten antiken Landschaftsbilder, teils noch an ihren eigenen Wänden in Pompeji und Herkulaneum, teils in den weiten Räumen des Museo nazionale erhalten hatten, in die sie, losgebrochen, übertragen worden waren. Im kommenden Sommer wollte ich mich ihnen ganz hingeben. Einen vorläufigen Eindruck von ihnen zu gewinnen, aber war jetzt schon unerläßlich.
Neapel berauschte mich:
»Siehe Neapel und stirb, nein, siehe Neapel und lebe!«
begannen die Elegien und Oden aus Neapel, die ich, nachdem ich sie fünf Jahre – Horaz verlangte ihrer bekanntlich neun – in mir herumgetragen, erst 1877 veröffentlichte. Ich darf sagen, daß ich in der inhaltreichen Woche, die ich jetzt in der alten Parthenope, mit der ich »großgriechischen« Boden betrat, verweilen durfte, meiner Wissenschaft »mit Fleiß und Eifer« gedient habe. Aber ich müßte lügen, wenn ich nicht gestehen wollte, daß mein Herz noch mehr als von den Banden meiner geliebten Wissenschaft von dem Zauber umstrickt worden sei, den Natur und Leben hier freudig und verschwenderisch ausstrahlten. Bekanntschaften mit meinesgleichen habe ich hier nicht angeknüpft; besucht habe ich mit einem Empfehlungsbrief von Helbig nur Giuseppe Fiorelli (1823-1896), den berühmten Generaldirektor der Ausgrabungen und Museen Pompejis und Neapels, der mir die nötigen Studien- und Kopienerlaubnisse erteilte, sich erklärlicherweise im übrigen aber nicht um mich bekümmerte. Auf mich selbst angewiesen, stürzte ich mich der großen Natur der von dem rauchenden Gipfel des Vesuvs beherrschten, weich und verführerisch hingegossenen blauen Meerbucht und des feurig pulsierenden Neapler Volkslebens in die Arme, in dem ich nur die guten, naiven und fröhlichen Seiten sah.
Natürlich nahm ich auch in Neapel gleich wieder ein Segelboot mit schmuckem Schiffer an, mit dem ich jede freie Stunde ins Meer hinausfuhr. Wie immer, suchte ich mir das Boot nach dem Schiffer aus, der mir gefiel. Giuseppe Canone, wie er diesmal hieß, hat bei diesem und bei späteren Besuchen Neapels, auch dem mit meinen Eltern und Schwestern und, sieben Jahre später, dem mit meiner jungen Frau, eine solche Rolle in meinem neapolitanischen Erleben gespielt, daß ich einen Augenblick bei ihm verweilen muß. Natürlich war er hübsch; aber er war auch fromm und fröhlich und, damals im Begriffe, sich zu verheiraten, von einer Reinheit sittlichen Empfindens, die in Neapel nicht häufig sein soll. Meinen Schwestern und meiner Frau gefiel er nicht minder als mir. Er war ein Stück der Natur Neapels für mich; und ich kann mich Neapels nicht erinnern, ohne an Giuseppe Canone zu denken. Nur bei meinem letzten Besuch Neapels im Jahre 1912 fragte ich vergebens nach ihm. War er gestorben, oder hatte er sich als wohlhabender Mann von seinem Berufe zurückgezogen? Zu allen schaumumbrandeten Felsenklippen, zu allen unter Oliven- und Zitronenbäumen versteckten Osterien, in denen der Südwein rein und reichlich quoll, zu allen Stätten fröhlichen Volkslebens, an denen getanzt und gesungen wurde, glitten wir über die blauen Wellen dahin. Daß Neapel mir nur seine guten Seiten offenbarte, verdanke ich ihm. Am Weihnachtsabend war ich wieder in Rom.
Im neuen Jahr aber, als schon frühe Frühlingslüfte die sieben Hügel Roms lau und duftig umwehten, unternahm ich, abermals allein, meinen Odysseelandschaften zuliebe noch einen eigenartigen, an Naturschönheiten überaus reichen Abstecher in eine wenig besuchte Gegend Italiens. Italienische Archäologen hatten behauptet, Homer habe das Lästrygonenabenteuer seiner Odyssee, das auf zweien meiner Bilder so anschaulich geschildert war, nach Terracina, der in der Mitte zwischen Rom und Neapel an der Via Appia auf dem steil ansteigenden Vorgebirge und am Meeresstrande unter ihm hingestreckten Bischofsstadt, verlegt. Mich reizte es, festzustellen, ob auch der Maler meiner Bilder, auf deren gelbe Einzelfelsen am blauen Meergestade jene Gelehrte sich beriefen, diese Küste im Auge gehabt habe. Die Eisenbahn nach Terracina war damals noch nicht gebaut. Von Velletri am Albanergebirge mußte ich im Postwagen auf der alten Via Appia unter den Volskerbergen her durch die Pontinischen Sümpfe fahren. Man warnte mich, wegen der Malaria unterwegs einzuschlafen. Es ist großenteils derselbe Weg, den der alte römische Dichter Horaz einmal gemacht und in der fünften seiner Satiren in lateinischen Hexametern anschaulich beschrieben hat. Die Einsamkeit der Pontinischen Sümpfe, in denen breitgestirnte Büffelherden weiden, hatte fast etwas Beängstigendes. Der Schneekamm des Volskergebirges blickte fast drohend hernieder. Von Terracina, dem Anxur der alten Römer, leuchtet zunächst die Oberstadt herüber.
»Fernher winkt von der felsigen Höh' das strahlende Anxur« sang auch Horaz.
Terracina fesselte mich einige sonnige Tage lang. Der einzeln ragende gelbe Fels liegt wirklich am Strande. Die alte Stadt lag wirklich droben auf schimmernder Höhe. Allerdings fehlt der enge Eingang in eine kreisrunde Bucht, die bei Homer das Entscheidende ist. Aber allzu wörtlich ist so etwas nicht zu nehmen. Daß die Erklärer des Homer und mit ihnen der Maler der Wandbilder vom Esquilin in der Tat an Terracina gedacht, erscheint um so weniger unwahrscheinlich, als auf das Lästrygonenabenteuer in der Odyssee das Kirkeabenteuer folgt, das schon die Namensüberlieferung an das nahe Kirke-Kap (Capo Circeo) verlegt.
Nach dem Monte Circeo stand nun auch mein Sinn. Ich mietete in Terracina eine sechsruderige Barke und fuhr hinüber. Eine köstliche Seefahrt! eine schwierige Landung ohne Weg und Steg am steil abfallenden, reich mit südlichem Pflanzenwuchs bedeckten Berge! Eine ziemlich anstrengende Besteigung des höchsten Gipfels, von dem aus man zugleich im Süden den Vesuv, im Norden bei klarem Wetter, wie ich es erlebt, die Peterskuppel ragen sieht! Dazu im vergrößerten Halbkreis das offene Meer und landeinwärts das nahe Volsker- und das entferntere Albanergebirge. Das mitgebrachte Frühstück wurde unten in den Dünen verzehrt. Im Abendrot landeten wir wieder in Terracina.
Auf der Rückfahrt nach Rom besuchte ich zunächst noch Ninfa, »das mittelalterliche Pompeji«, wie Gregorius es getauft hat, die spätromanische, mit ihren Kirchen und Wohnhäusern in die Pontinischen Sümpfe versunkene Stadt, in deren verlassenen Straßen Gräser und Blumen sprießen, an deren halb versunkenen Mauern das Schilf säuselt, um deren Trümmer, soweit sie aus dem Sumpfe hervorragen, rankender Efeu seine immergrüne Hülle flicht.
Droben von der Höhe der Volskerberge aber winkten Norma, die alte, immer noch in ihrer Ringmauer versteckte Feste Norba, und Cori, das mit seinem wohlerhaltenen Herkulestempel weithinblickende alte Cora, das beansprucht, eine Gründung des Dardanus, des Stammvaters der Trojaner und der Römer, also uralt klassischer Boden zu sein. Norma und Cori wollte ich sehen. Die Luft des Volskergebirges wollte ich geatmet haben. Auf steilem Zickzackwege mit köstlichen Rückblicken auf die Ebene, die Pontinischen Sümpfe, die Dünen, das kirkeische Vorgebirge und das blaue Meer fuhr ich nach Norma hinauf. Auf schmalem, holperigem, aussichtsreichem Saumpfad ritt ich dem ragenden Säulentempel von Cori entgegen, der einer der besterhaltenen heidnischen Tempel Italiens und zugleich ein lehrreiches Beispiel der Anwendung griechischer Einzelformen auf italische Grundgestaltung ist. Die Wirkung ist leicht und stattlich. Ich erkannte, daß auch ein Gebäude stilvoll wirken kann, das von geschichtlicher Stileinheit und Stilreinheit weit entfernt ist.
Am Abend dieses Tages war ich wieder in Rom und wurde im Freundeskreise des Gabbione stürmisch begrüßt.
In den nächsten Wochen wurde noch stramm gearbeitet. Aber meine römischen Tage, die nichts weniger als »Schlendertage« im Sinne Hermann Allmers' waren, neigten sich ihrem Ende zu. Nur noch einmal vor meiner Abreise nach Griechenland, zu dem für den Archäologen auch das unteritalische »Großgriechenland« gehört, leuchteten sie hell und freundlich auf.
Meine Eltern hatten sich mit meinen beiden damals noch unverheirateten kunstsinnigen Schwestern Marie und Luise aufgemacht, Italien kennenzulernen und Rom und Neapel unter meiner Führung zu besuchen. Als junges Ehepaar auf der Hochzeitsreise hatten sich auch mein Vetter Theodor Möller vom Kupferhammer und seine schöne junge Frau angeschlossen. Hamburg und Bielefeld folgten mir nach Italien. Es waren schöne, inhaltreiche Wochen, in denen wir in Rom von einer Herrlichkeit zur anderen zogen. Mir war es willkommen, nachdem ich meine nächsten eigenen Untersuchungen vollendet hatte, alles noch einmal an mir vorüberziehen zu lassen, an manchen geheiligten Stätten länger und aufmerksamer zu verweilen und durch meine Führereigenschaft gezwungen zu sein, mir von der Bedeutung und dem Wesen manches Kunstwerkes vollere Rechenschaft zu geben, als mir bisher vergönnt gewesen war. Meine besten römischen Freunde, namentlich Floerke, Krohn, Trendelenburg, Hirschfeld, der Bildhauer Fritz Schulze und der Maler Hugo Harrer, schlossen sich uns abwechselnd an, wie die Gelegenheit es mit sich brachte. Daß die sprudelnden Wasser der Fontana Trevi, an der wir uns natürlich zum Abschied von Rom, Wehmut im Herzen, alle einfanden, gerade im Mondschein glänzten und glitzerten, erhöhte die Stimmung des Abschiedsabends.
Bald nach der Mitte des April vertauschten meine Verwandten und ich Rom mit Neapel, wo ein prächtiger Gasthof an der Chiaja, der Uferstraße, die nur der schmale, üppige, palmenreiche Parkstreifen der »Villa reale« vom rauschenden Meeresstrande trennt, in seine weichen Arme nahm. Daß unser Aufenthalt in Neapel mit einer Katastrophe enden würde, ahnten wir nicht. Schon hatten wir alle Herrlichkeiten Neapels und Pompejis so gründlich, wie es für kunstliebende Laien angebracht war, durchwandert, schon hatten wir einige Hauptausflüge in die wundervolle Umgebung unternommen, zwei Tage hatten wir sogar zu einer Dampfschiffahrt nach Ischia verwandt und waren fast täglich wenigstens ein Stündchen mit Giuseppe, der sich in seinem natürlichen Anstand vortrefflich zum Familienschiffer eignete, auf dem blauen Golf herum gesegelt, als am 24. April die Besteigung des Vesuvs auf unsere Tagesordnung gesetzt wurde. Zwar rauchte der Berg stärker als gewöhnlich. Die pinienförmige Rauchwolke über seinem Gipfel schwoll mächtiger an als bisher. Das Rollen und Grollen im Innern des Berges war lauter, als ich es bis dahin vernommen hatte. Schon floß ein leichter Lavastrom von seinem Kegel herab. Aber die Führer erklärten, der Besteigung, die sich allerdings nicht bis zum Krater ausdehnen könnte, sondern an dem Lavastrom haltmachen müsse, stünde nichts entgegen. Sie hätten schon bei stärkeren Ausbrüchen mit Fremden den Berg bestiegen. Die Drahtseilbahn gab es damals noch nicht.
Wir fuhren im Wagen in herrlichen, aussichtsreichen Windungen hinauf, so weit es tunlich war, und klommen dann an der Hand unserer Führer bis zum Rande des glühenden Lavastroms empor. Kaum aber waren wir hier angelangt, als der Ausbruch anfing, bedrohlich zu werden. Das Brüllen und Toben wurde immer stärker; die Flammenblitze, die aus dem Innern hervorschossen, wurden immer häufiger, die Rauchwolke wurde immer dichter; die mächtigen Steine, die aus dem Krater emporgeschleudert wurden und in unserer Nähe einschlugen, machten ein längeres Verweilen auf der Höhe unmöglich. Wir kehrten mit dem befriedigenden Eindruck nach Neapel zurück, einem gewaltigen Naturschauspiel, einem gewaltigeren, als es den meisten Besuchern Neapels beschieden wird, beigewohnt zu haben.
Alles, was wir gesehen, war jedoch nur ein schwaches Vorspiel von dem, was in den nächsten Tagen folgte, die, wie allen Forschern bekannt, einen der gewaltigsten Vesuvausbrüche der Geschichte sahen. In Neapel hörten wir nur den Donner des Ausbruchs, sahen wir nur nachts den Himmel vom Flammenschein gerötet, spürten wir nur den Aschenregen, der leicht und langsam, kaum sichtbar herabfallend, den Boden und selbst das glatte Meer, zuerst mit einer dünnen, dann mit allmählich dicker werdender Aschenschicht bedeckte. Aber die schrecklichsten Gerüchte, die die schreckliche Wahrheit noch übertrafen, drangen zu uns. Eine kurze fachmännische Schilderung dieses Vesuvausbruchs von 1872, die ich einem bekannten Werke entlehne, möge hier Platz finden: »Bereits seit Monaten hatte der Lavaausfluß gedauert. Am 24. April ergoß sich ein Lavastrom von der Südseite des Kegels herab. Am 26. morgens riß der Kegel in seiner ganzen Länge von der Spitze bis zum Atrio mit weit klaffender Spalte auf, der nun eine ungeheure Lavamasse entquoll. Zu gleicher Zeit schleuderten beide Gipfelkrater unter heftigen Detonationen zahllose glühende Wurfmassen bis zur Höhe von 1300 Metern empor. Hierbei kamen etwa 30 Zuschauer um. Die Hauptmasse der Lava drang nordwestlich zwischen die Orte Massa und San Sebastiano vor und zerstörte sie teilweise.« Wie mit dem Messer abgeschnitten sah ich später die übriggebliebenen Hälften der beiden Orte zu beiden Seiten des schwarzen, erkalteten Stromes ragen.
Am 27. April nahmen der Aschenregen und der Ausbruchdonner zu. Eine schwarze Rauchwolke hüllte die Stadt in abendliche Schatten. Viele Fremde verließen Neapel. Die Züge nach Rom waren überfüllt. Man mußte Plätze vorausbestellen, wenn man mitfahren wollte. Meine Eltern, Schwestern und Verwandten erhielten Plätze zum 28. abends. Ich begleitete sie zum Bahnhof und kehrte dann allein in den Aschenregen zurück, um mit dem nächsten Schiff nach Sizilien, meinem nächsten Reiseziel, abzufahren.
»Ein höchst ungemütlicher Tag«, schrieb ich am 29. April. »Der Aschenregen fällt dichter als je auf Neapel herab. Zugleich weht ein heftiger Sciroccosturm. Ich benutzte den Morgen, eine kurze Schilderung des bisherigen Verlaufs des Vesuvausbruchs für den ›Hamburgischen Correspondenten‹ zu schreiben. Meine Koffer sind gepackt. Um halb sieben Uhr abends sollte das Dampfboot ›Cariddi‹ nach Palermo abfahren. Ich gehe schon um vier Uhr unter dick niederfallenden Rapilli, die Sehen und Atmen erschweren, und unaufhörlichem Donnern des Vesuvs an Bord. Als aber die Stunde der Abfahrt gekommen war, verschob der Kapitän des Sturmes wegen, wie er sagte, die Abreise auf den nächsten Tag 12 Uhr mittags. Der wahre Grund war die verspätete Einschiffung des Zirkus Ciniselli, der mitfahren wollte. Um halb acht Uhr ging ich wieder ans Land. Der Aschen- und Rapilli-Staub war fürchterlich. Blitze zuckten unaufhörlich durch die Luft. Das heftige Rollen und Grollen ließ keinen Augenblick nach. Trotzdem wanderte ich noch einige Stunden in den matt erleuchteten Straßen der Stadt umher, um zu beobachten, wie sich das Volk unter dem Eindruck der Schrecken benahm. Hier und da erschien alles außer Rand und Band. Im ganzen aber verhielten die Menschenwogen, die sich auf den Straßen drängten, sich ruhig. Um halb zehn Uhr langte ich unerwartet wieder in meinem Gasthof an.« Eine fürchterliche Nacht folgte. »Selbst in meinem geschlossenen Schlafzimmer war meine weiße Bettdecke am anderen Morgen mit einer grauen Aschenschicht bedeckt. Mehrmals verspürte ich Erdstöße; schließlich entlud sich ein heftiges Gewitter, das, wie es schien, der Vesuvwolke entstammte, über Neapel. Der strömende Regen verwandelte draußen die Asche in schwarzen Schlamm.«
Am Morgen des 30. April schien an der Chiaja, da die Vesuvwolke nach Süden wogte, die Sonne wieder. Um elf Uhr ging ich wieder an Bord. Um zwölf Uhr setzte die ›Cariddi‹ sich in Bewegung. Wie herrlich die Ausfahrt mit dem grollenden Vesuv im Rücken, an dem großartig lächelnden Capri vorüber! Schon um fünf Uhr früh war ich am nächsten Morgen auf Deck. Leuchtend erhob die Sonne sich aus dem Meer und vergoldete mit ihren Strahlen die Felsengebirge Siziliens. Um sieben Uhr ankerten wir im Hafen von Palermo. Wie blühend breitet die prächtige Stadt sich in der Fläche zwischen dem Monte Pellegrino zur Rechten, dem Monte Grifone zur Linken aus! Klassischere Umrisse als der Monte Pellegrino hat kein Berg der Welt.
Goethe meinte, ohne Sizilien gebe Italien kein Bild in der Seele. Ich konnte die Schönheiten der begnadeten Insel, auf der Reise nach Griechenland begriffen, nur erst im Fluge in mich aufnehmen. Den Besuch der abgelegenen großartigen altgriechischen Tempelstätten in Girgenti, Segesta und Selinunt mußte ich mir auf eine andere Gelegenheit versparen. Für meine Zwecke hatte ich nur die Mosaiken der altchristlichen und frühmittelalterlichen Kirchen von Palermo, Monreale und Cefalù zu untersuchen, auf deren Glanz großenteils der festliche Eindruck beruht, den die sizilianische Kunst der Normannenzeit hinterläßt. Im wesentlichen byzantinischen Stils, wollen sie als nach dem Westen vorgeschobene Ausläufer der griechischen Kunst des Mittelalters gewürdigt sein, in dem immer noch die echte altgriechische Kunst leise nachklingt.
Hauptsächlich besuchte ich dann nur noch Messina, Syrakus, Catania und Taormina. Ohne den Blick von dem hochgelegenen altrömischen Theater in Taormina auf das in langer, schön gezogener Schleppenlinie höher als die Zugspitze unmittelbar aus dem Meer emporsteigende Schneehaupt des Ätna und auf das in weitem Bogen von der reich bebauten Küste begrenzte blaue Mittelmeer hat man wirklich kein volles Bild Italiens in der Seele. Wer hier nicht gestanden, hier nicht zu Füßen des Ätna die Sonne dem Meer enttauchen gesehen, ahnt in der Tat nicht, welche Landschaftswunder die Erde birgt.
Nach Griechenland schiffte ich mich in der ersten Maiwoche 1872 in Messina auf dem prächtigen Dampfer »Moeris« der französischen Messageries maritimes ein. Der Strudel zwischen der Skylla und der Charybdis lag schon hinter uns, konnte uns also nichts mehr anhaben. Tausend klassische Erinnerungen an griechische Dichtungen und Sagen, die hier nicht nur alle Küsten, sondern auch alle purpurnen Wogen des ewigen Meeres umschweben, zogen mir durch den Sinn. Dreißig Stunden später umschifften wir das Kap Matapan. Am nächsten Morgen fuhren wir in weitem Abstand zwischen Ägina und Sunion, der Insel und dem Vorgebirge, auf dessen Höhen die dorischen Tempelsäulen stehen, hindurch, an Salamis vorüber, der vor dem Marmorrücken des Pentelikon ragenden Akropolis von Athen entgegen in den Piräushafen hinein. So! Da lag es nun vor mir, das Land der Griechen, das ich so lange mit der Seele gesucht, dem zuliebe ich mir schon als Schuljunge heimlich die griechische Grammatik gekauft hatte, da lag es nun wirklich in hellem Sonnenglanze vor mir!
»Wie scharf geschnitten und linienschön
Vor uns die zackigen attischen Höhn
Am Morgenhimmel erglühen!
Schon winkt uns Athens Akropolis,
Indes zur Linken um Salamis
Weiß brandende Wellen sprühen.
Rings leuchtet purpurn des Morgens Glut.
Um Salamis schwillt es, rot wie Blut,
O Salamis, lorbeergekröntes!
Zweitausend Jahre und mehr sind's her.
Da schwoll hier von Perserblute das Meer
Und rings von Waffen erdröhnt' es.
O Tag von Salamis, Tag des Ruhms!
Geburtstag der Freiheit, des Menschentums,
Der Schönheit, an Wahrheit entzündet!
Zerstört lag Athen von der Perser Hand.
Die Sieger von Salamis stiegen ans Land.
Ein neues Athen ward gegründet.«
Die Ankunft im Piräus ist laut und lästig. Zudringliches, nichts weniger als altgriechisch dreinblickendes Gesindel umringt den Fremden, ihn einem Gasthof zuzuführen oder wenigstens mit seinem Gepäck zum Bahnhof zu begleiten. Aber auf der Eisenbahn in Athen anzukommen, schien mir unmöglich. Drüben hielt ein sauberes Gefährt, dessen Führer schon eher dem Hermes des Praxiteles glich. Schnell einigte ich mich mit ihm. Äschylos und Sophokles, Phidias und Praxiteles, Platon und Aristoteles im Herzen, fuhr ich im offenen Wagen hinauf. Näher und näher kam die Akropolis. Schon erkannte man die Säulen des Parthenon, schon den Lykabettos, dessen kahler Kegel mitten in der Stadt emporsteigt, und rechts vor der Stadt den langgestreckten Rücken des honigreichen Hymettos und links die Ägaleosberge, die die Bucht von Eleusis von der Bucht von Salamis trennen. Nun zur Stadt hinein! am Theseustempel, dem besterhaltenen, noch jungfräulich herben dorischen Säulentempel Athens vorüber, unter der Akropolis her zum Schloßplatz, an dem mich ein sauberer Gasthof aufnahm.
Wie ein junger Gott kam ich mir vor, als ich durch die edlen Säulenhallen der Propyläen zur Akropolis emporstieg, unter den gelblich warmen Marmorsäulen des Parthenon stand, in dessen Wunderbau sich alle Kraft des dorischen Stils mit attischer Anmut paart, den göttlichen Säulenjungfrauen des ionischen Erechtheions ins reine Antlitz blickte und im Abendlicht von der Terrasse des feinen kleinen Nike-Tempels über die attische Ebene und das lichtblaue, von scharf umrissenen Inseln durchragte griechische Meer hinausschaute.
Das Griechenland von damals war noch lange nicht das Griechenland von heute, aber auch das alte Hellas der achäischen Helden, der delphischen Orakel und der olympischen Spiele war damals vor unseren Augen noch lange nicht so handgreiflich wiedererstanden wie in unseren Tagen. Noch hatten Schliemanns Ausgrabungen in Mykenä, die französischen Ausgrabungen in Delphi, die deutschen in Olympia nicht begonnen; noch hatte die Spatenkunst sich im hellenischen Kleinasien weder Magnesias noch Milets noch Prienes angenommen. In Troja hatte Schliemann, dem die zünftige Archäologie damals noch nicht glaubte, erst 1871 den ersten Spatenstich getan; und erst in demselben Jahre hatten Curtius und Adler in Pergamon, der hellenistischen Attalidenhauptstadt, die ersten Untersuchungen des späteren Ausgrabungsgeländes vorgenommen. Der Besuch aller dieser Glanzstätten altgriechischer Kunst kam damals für mich gar nicht in Frage; und für meine Untersuchungen über die griechische Malerei gab es, außer in der reichen Sammlung altattischer Vasen im Museum zu Athen, die mich tagelang fesselte, kaum etwas zu suchen. Ich hatte also Zeit, die volle Schönheit und Feinheit der in Athen erhaltenen Reste der alten Baukunst, die glücklicherweise nicht versetzbar waren, und der alten Bildhauerei, deren allerbeste allerdings großenteils bereits in die Museen der nordischen Hauptstadt gewandert waren, in mich aufzunehmen; und ich hatte das Glück, alles unter der Leitung oder doch in der Gesellschaft gleichgesinnter Forscher und Kenner nur um so bewußter zu genießen. Die bekanntesten griechischen Archäologen jener Tage, wie Soteriu, der gelehrte Beirat des Kultusministeriums, wie Kumanudis, der berühmte Inschriftenkenner, wie Eustratiadis, der Erechtheionforscher, der damals Ephorus der griechischen Altertümer war, und wie Rhusopulos, der später durch seine »Archäologischen Briefe« bekanntgewordene Gelehrte, der zugleich etwas Antiquitätenhandel trieb, nahmen sich meiner freundlich an. Joannes Paläologos führte mich zur Ausgrabungsstätte der attischen Lekythen, jener auf weißem Grunde mit rührenden farbigen Darstellungen griechischer Gräberschmückung bemalten Vasen, die, den teuren Toten mit ins Grab gelegt, zu den feinsten erhaltenen Urkunden hellenischer Sitten und hellenischer Kleinkunst gehören. Ich durfte den Ausgrabungen zusehen und ein paar der schönsten, frisch dem Erdboden entnommenen Gefäße mitnehmen.
Auch in Athen heimische Deutsche wie der Buchhändler Wilberg, der deutscher Konsul in Athen, und wie der Botaniker Heldreich, der Professor an der dortigen Universität war, halfen mir, wo sie konnten; und vielfach begleiteten mich der feinsinnige Leipziger Philosophieprofessor Max Heinze und seine liebenswürdige Gattin, deren Bekanntschaft ich schon auf der Dampfschiffahrt von Neapel nach Palermo gemacht hatte.
Meine täglichen Begleiter und Gesellschafter aber waren zwei Deutsche, ohne deren Freundschaft mir manches entgangen wäre. Der eine von ihnen war Otto Lüders, der frische Archäologe und spätere Konsul, dessen Bekanntschaft ich schon in Rom gemacht hatte. Er war schon einige Wochen vor mir in Athen angekommen. Lüders war ein ebenso kenntnisreicher wie gemütvoller, ebenso sinniger wie jugendfrischer Gelehrter von weltmännischem Schliff. Ich hätte keinen angenehmeren und lieberen Führer und Gefährten in Athen haben können als ihn. Der andere war der junge Hofprediger des Königs Georg, Pastor Gosrau, der im Schlosse wohnte, aber, da er unverheiratet war, sich gern mehr oder weniger gleichalterigen gebildeten Deutschen anschloß. Seiner Belehrung verdanke ich manchen Einblick in höfische Verhältnisse und seiner Vermittlung manche Vergünstigung beim Besuche verschiedener Anstalten und Veranstaltungen.
Eines Abends fand zu Ehren der Anwesenheit der Königin von Württemberg eine Beleuchtung der Akropolis mit bengalischen Flammen statt. Der König Georg übernahm selbst die Führung der geladenen Gesellschaft, der Heinzes und ich uns, ohne bei Hofe vorgestellt zu sein, in einiger Entfernung anschließen durften. Es ist leicht, sich über solche »theatralische« Beleuchtung klassischer Stätten der Kunst lustig zu machen; einem für alles Menschliche und Außermenschliche empfänglichen Sinn aber wird es schwer, sich dem Zauber solcher Licht- und Farbenwirkungen zu entziehen. Ich gestehe, es als Genuß empfunden zu haben, den Parthenon, das Erechtheion, die Propyläen und den Theseustempel in dunkler Nacht in rotem, blauem und grünem Licht erstrahlen zu sehen. Warum sollte unsere Einbildungskraft nicht auch dankbar alles mitnehmen, was ihr hilft, uns, wenn auch nur für kurze Augenblicke, der Erdenwirklichkeit zu entheben?
Der Vermittlung Gosraus verdankte ich es auch, daß der König uns zu einer Fahrt nach Ägina seine Segeljacht zur Verfügung stellte und der Ministerpräsident Bulgaris mich der Gastfreiheit des Verwalters seiner Güter auf der klassischen Insel empfahl. Außer Gosrau und mir nahmen auch Heldreichs und Heinzes an der Fahrt teil. Es war einer der stimmungsvollsten Ausflüge meiner ganzen Reise. An einem heißen Maimittag lag der königliche Schoner »Aura« im Piräus für uns bereit. Da es anfangs windstill war, konnten wir erst um 9 Uhr abends langsam zum Hafen hinausgleiten. O der köstlichen lauen Mondscheinnacht auf dem Ägäischen Meere! Wie breit und voll glitzerten die Strahlen der jungfräulichen Gestirne in den leicht gekräuselten, stahlblauen Wellen! Wie geisterhaft verschwammen die kühnen Bergumrisse des Festlandes und der Inseln, bis sie sich vollends unseren Blicken entzogen! Am anderen Morgen hofften wir uns im Hafen von Ägina zu befinden. Aber die Strömung hatte uns abgetrieben. Bei Sonnenaufgang sahen wir uns an der entgegengesetzten Seite der Insel. Langes langsames, aber nicht eben langweiliges, da durch köstliche Aussichten und gute Unterhaltung gewürztes Kreuzen, brachte uns erst um 3 Uhr nachmittags zur Stadt. Hier bestiegen wir die sofort bereitgestellten Pferde, den hoch über der Stadt thronenden, ziemlich gut erhaltenen Tempel zu besuchen, dessen Giebelreliefs, die berühmten »Ägineten« der Münchener Glyptothek, mir längst vertraut waren. Von Furtwänglers weiteren Ausgrabungen und Erläuterungen war damals natürlich noch keine Rede. Es war ein langer, etwas beschwerlicher, aber romantischer Ritt. Die zwanzig dorischen Säulen des äußeren Tempelumganges, die noch aufrecht stehen, grüßten uns lange, ehe wir sie erreichten. Wie ernst in seiner herben Hoheit das Gerüst des alten Heiligtums! Wie wunderbar im Glanze der untergehenden Sonne der Blick über die schimmernde Bucht, über Megara, Salamis und Athen bis zu den attischen Bergen und dem weit vorspringenden Vorgebirge Sunion!
Noch romantischer als der Ritt hinauf war der Ritt hinunter im Mondschein. Erst um 10 Uhr abends trafen wir in der Stadt wieder ein, wo ich, da ich mich noch etwas in Ägina umsehen wollte, bei dem Gutsverwalter des Ministerpräsidenten übernachtete, während meine Gefährten um Mitternacht auf der »Aura« nach dem Piräus zurückkehrten. Die gastliche Abendtafel in dem Bulgarisschen Gutshause ist mir unvergeßlich geblieben. Ein köstliches Fischgericht folgte auf das andere. Nachdem meine Eßlust schon voll befriedigt war, hörte der Gutsverwalter, neben dem ich saß, nicht auf, mich zu nötigen. Schließlich steckte er mir, ohne daß ich mich dessen erwehren durfte, mit seiner Gabel von seinem Teller einen der fettesten Bissen nach dem andern in den Mund. Dazu der geharzte Wein, an den ich noch nicht gewöhnt war! Rein erquicklich ist meine Erinnerung an diesen Abend nicht; aber das Gefühl, volkstümliche griechische Gastfreiheit zu genießen, half mir über alles hinweg.
Mit Heinzes und Gosrau besuchte ich in den nächsten Tagen den Marmorberg Pentelikon, an dem uns der feine warmweiße Stein, dem die köstlichen Säulenbauten Altathens sozusagen bodenwüchsig entsprangen, in offenen Brüchen entgegenschimmerte. Die Mönche des von schönen Silberpappeln beschatteten Klosters Penteli gewährten uns gastliche Aufnahme und suchten uns durch scherzhafte Vorführungen die Zeit zu vertreiben, die uns freilich kostbar genug war.
Mit Lüders und Gosrau unternahm ich an einem anderen Tage die Ausfahrt nach Eleusis, der Stätte des berühmten Demeter- und Triptolemustempels und der heiligsten Weihen des heidnischen Altertums. Die Reste des Tempels und der Propyläen, die man bei dem von Albanesen bewohnten armen Dorfe Lepsina wieder ausgegraben hat, erschienen uns dürftig genug. Aber die attische Landschaft meinte ich in ihrer ganzen plastischen Eigenart nirgends so verstanden zu haben wie auf der Straße zwischen Athen und Eleusis.
Zunächst führt die staubige Landstraße durch das Kephissostal und den Ölwald auf den Gebirgszug des Ägaleos zu. Den uralten Bäumen, deren Oliven jetzt noch grün waren, sagt man nach, daß sie zum Teil noch dieselben seien, die das Öl in die panathenäischen Preisvasen spendeten. Daß sie uralt sind, so alt wie nur wenige Bäume, sieht man schon ihren machtvollen, knorrigen, vielfach zerschlissenen Stämmen an. Hier und da mischen sich auch üppige Feigenbäume mit ihrem dunkleren und frischeren Grün unter das Grüngrau der Ölbäume; und wo die Bäume etwas auseinanderrücken, gedeiht die Rebe am Fuße der Olive, und Weinstock reiht sich an Weinstock im Schatten des Waldes. Die Fruchtbarkeit des Kephissostales wirkt um so überraschender, je kahler die attische Landschaft im ganzen ist. Alles ist dürr und schmachtet; und wo die Straße den Ölwald verläßt, fahren wir in eine braune Stein- und Felsenwüste hinein. Allmählich hebt sich die Straße; und nun werden hinter uns alle Gebirge, die die attische Ebene umkränzen, in voller Ausdehnung sichtbar und in ihrer Mitte am Lykabettos und unter der Akropolis die weiß leuchtende Stadt – und im Süden das immerblaue Meer. Wie eine Oase liegt Athen in der Felsenwüste da; und diese Oase trieft vom eigenen Wein und Öl und vom Honig, der vom Hymettos fließt.
Für uns aber gehört die Kahlheit zur plastischen Eigenart der griechischen Landschaft. Wie nur der nackte Mensch den Bildner entzückt, scheint diese Berglandschaft, wenn sie in der klassischen Zeit Griechenlands auch bewaldeter war als jetzt, aller Pflanzenhülle entkleidet, mehr für das Auge des Bildhauers als des Malers geschaffen. Die tief einschneidenden blauen Meerbuchten, die die einzelnen Formen noch schärfer umziehen, tun das ihre dazu. Vor allem aber sind diese Bergformen, deren geologische Struktur klar zutage liegt, in ihren scharfen, klaren, mannigfach abgestuften und ausgeschnittenen Umrissen und den kräftigen Licht- und Schattenwirkungen ihrer Oberfläche wirklich von hohem plastischen Reize. Und wohnte in dieser plastischen Landschaft nicht ein Volk von plastischer Schönheit? Gewiß, es wundert uns schon angesichts dieser Landschaft nicht, daß den griechischen Künstlern die plastische Bildnerei angeboren war und daß auch ihre Malerei sich, solange das griechische Volk griechisch blieb, in den Grenzen bildnerischer Zeichnung bewegte, um erst, als in der Zeit des Hellenismus überall fremde Einflüsse sich einmischten, zu so malerischer Auffassung zu gelangen, wie sie sich in jenem Unterweltbild der esquilinischen Odysseelandschaften offenbart.
Mit Lüders allein kehrte ich am nächsten Tage noch einmal in den heiligen Ölwald zurück, um dem durch Sophokles' Ödipus geweihten Hügel Kolonos und den Gräbern der großen Archäologen Otfried Müller und Charles Lenormant zu huldigen. Höchstens zu zweien kann man sich der Stimmung hingeben, die an solchen Stätten in uns aufsteigt. Wie schattig und still der Wald! Wie einsam der Hügel mit seinen knorrigen Ölbäumen! Hier nahm die Erde mild das sorgenschwere Haupt des blinden Ödipus auf. Hier begeisterte Sophokles sich für das versöhnliche Schlußstück seiner unheimlichen Ödipustragödien. Hier begann er, begann der unglückliche, seines Augenlichtes beraubte, von seiner Tochter geführte König von Theben:
»Wohin des blinden Greises Kind, Antigone,
In welche Landschaft kamen wir, in welche Stadt?«
Und festlich fröhlich erschallte die Antwort des Chores:
»Zur rosseprangenden Flur, o Freund,
Kamst du, hier zu des Landes bestem Wohnsitz,
Des glanzvollen Kolonos Hain,
Wo hinflatternd die Nachtigall
In helltönenden Lauten klagt
Aus den grünenden Schluchten,
Wo weinfarbiger Efeu rankt
Tief im heiligen Laube des Gottes,
Dem schattigen, früchtebeladenen.
Dem stillen, das kein Sturmwind aufregt.«
Das war echte attische Heimatkunst.
Meine Tage in Athen, ja in Griechenland waren gezählt. Nur noch einen Blick nach Kleinasien hinüber mußte ich tun. Nur Ephesos, die einzige der glänzenden ionischen Städte, in der neuerdings bereits Ausgrabungen stattgefunden hatten, wollte ich sehen. Für meine Untersuchungen hatte ich wenig oder nichts drüben verloren. Ich glaube, es war mir hauptsächlich um die köstliche Seefahrt durchs ionische Inselmeer zu tun. Und köstlich war sie in der Tat. Wie sie eine nach der anderen, von weißen Brandungskränzen umschimmert, auftauchen aus den blauen Wellen, braun und felsig, kühn umrissen, mit hellen Dörfern und Städtchen besetzt, von weißen Segeln wie von Schwänen umzogen. Die letzte, an der wir vorbeifuhren, war das mächtig gelagerte Lesbos, die Heimat des göttlichen Sängers Alkäos und der noch göttlicheren Sängerin Sappho.
»Der Mond ist untergegangen«, begann eine der Sapphischen Oden. Hinter uns im Westen sank er wirklich ins Meer, als wir im dämmerstillen Frühlicht in die tiefeinschneidende, reich begrünte Bucht von Smyrna hineinsteuerten. Das bunte Leben der orientalischen Stadt fesselte mich in Smyrna von neuem. Seit meinem Jugendbesuche in Kairo hatte ich nichts derart gesehen. An der Abendtafel im gastlichen Hause des deutschen Konsuls Lührssen traf ich Karl Humann (1839-96), den nachmals so berühmt gewordenen Baumeister und Archäologen, mit dessen Namen die deutschen Ausgrabungen in Pergamon, denen Berlin seinen gewaltigen Gigantenfries verdankt, unlöslich verknüpft ist. Humann war als Ingenieur nach Kleinasien gekommen. Er hatte damals schon Wegebauten für die türkische Regierung ausgeführt, die ihn abwechselnd in Bergama, eben dem alten Pergamon, und in Smyrna wohnen ließen. Ein Stück des Gigantenfrieses, das in die alte Stadtmauer von Bergama verbaut war, hatte bereits seine Aufmerksamkeit erregt. Im vergangenen Herbst hatte Ernst Curtius ihn mit anderen deutschen Archäologen dort schon besucht. Schon waren die Ausgrabungen, die weite neue Einblicke in die hellenistische Zeit und ihre Kunst eröffneten, in Aussicht genommen. Die Begegnung mit Humann ist mir unvergeßlich. Der große, schlanke, blonde Westfale war eine ungewöhnlich anregende und anziehende Persönlichkeit, an die, wer ihn kannte, wie unser großer Fachgenosse Conze ihm nachrief, »nicht ohne Herzbewegung zurückdenken kann«. Humann erzählte mir lebhaft von den Hoffnungen, die er für die pergamenischen Ausgrabungen hegte. Ich habe damals dort köstlich gesellige und geistig einträgliche Stunden mit ihm verlebt. Die Begegnung mit ihm ist in meiner Rückerinnerung das Hauptbegebnis und -erlebnis jener kleinasiatischen Reise.
Der Besuch des Ruinenfeldes von Ephesos war mir eine Enttäuschung. Von dem Bahnhof Ayasoluk, dessen englischer Wirt uns in seine Obhut nahm, wurde ein vierstündiger Rundritt durch das teilweise bloßgelegte Trümmerfeld unternommen, dessen Mittelpunkt die Stätte des berühmten Tempels der Artemis, der »Diana von Ephesus«, bildet. Aufrecht stand nichts. Die herrliche untere Trommel einer seiner schlanken ionischen Säulen, die mit dem reifen Relief der Rückführung der Alkestis aus der Unterwelt geschmückt ist, hatte ich schon im British Museum in London bewundert. Hier geblieben war nichts diesem Bildwerk Gleichwertiges. Nur vor dem geistigen Auge des Beschauers baute sich der alte, als ein Wunder der Baukunst gefeierte Tempel wieder auf, der nach dem herostratischen Brande im 4. Jahrhundert vor Christo herrlicher, als er gewesen, erstand.
Die Nacht bei dem Bahnhofswirt in Ayasoluk ist mir unvergeßlich. Der großen Hitze wegen legten wir uns im Freien schlafen. Eulengeschrei und Taubengegurr, Schakalgeheul und Hundegebell ließen uns zu ruhigem Schlafe nur wenig kommen. Als ich mich am anderen Morgen auf eine Gartenbank setzte, legte sich mir eine etwa zwei Meter lange, dicke gelbe Schlange aufgerollt zu Füßen und hob ihren Kopf mit den kaltfunkelnden Augen zu mir empor. Entsetzt kletterte ich rückwärts auf den Sitz und sprang, mich zu retten, über das Tier hinweg. Später erfuhr ich, daß es eine zahme Hausschlange war, wie sie in jenen Gegenden überall gehalten werden.
Von Smyrna kehrte ich nicht nach Griechenland, sondern geradeswegs nach Italien zurück. Auf dem schönen österreichischen Lloyddampfer »Massimiliano«, von dessen liebenswürdigem Kapitän Romanovich der Abschied mir schwer wurde, schiffte ich mich nach Brindisi ein. An den Hauptinseln des Ägäischen und Ionischen Meeres legten wir lange genug an, um uns Ausflüge zu Wagen ins Land oder zu Boote um die Küste zu gestatten. Syra hatte ich schon auf der Herfahrt kennengelernt. Auf der Weiterfahrt grüßten wir Naxos, die Insel der Ariadne, Paros, die Muttererde des berühmten Marmors, Milos, die Fundstätte jener Venus von Melos, der ich im Louvre gehuldigt. Mit jeder Insel waren Gedanken oder Erinnerungen besonderer Art verknüpft. Landschaftlich entzückende Wagenfahrten unternahm ich auf Zante, auf Kephalonia und auf Korfu. Am Morgen des 31. Mai 1872 landeten wir in Brindisi.
Die Reise von Brindisi nach Neapel, wohin mich Pflicht und Neigung jetzt zurückriefen, führte mich durch eine Reihe anziehender und denkmälerreicher Städte Unteritaliens. Schließlich schwärmte ich in Caserta in dem herrlichen, mit großartigen Wasserkünsten ausgestatteten Parke des kunstreichen Königsschlosses; und ich fuhr von hier, um ein Stück reichst bebauten Erdbodens nicht nur im Fluge zu durchrasen, in offenem Wagen durch die üppige, an Wein und Früchten reiche Terra di Lavoro nach Neapel zurück, das mir jetzt schon heimatlich vertraut erschien.
In Neapel und Pompeji verbrachte ich nun zwei außerordentlich arbeits- und genußreiche Monate. Für die archäologische Sonderaufgabe, die ich mir gestellt hatte, mußte ich nun alle an den wiederausgegrabenen Wänden erhaltenen, aber auch alle ins große Nationalmuseum von Neapel übergeführten Wandgemälde irgendwie landschaftlichen Inhalts aufsuchen, verzeichnen, beschreiben und einreihen. Natürlich mußte ich mir eine Anzahl charakteristischer Beispiele auch wieder in genauen Deckfarbenblättern nachbilden lassen; und selbstverständlich übertrug ich diese Arbeit wieder meinem römisch-hamburgischen Freunde Hieronymus Christian Krohn, den ich mir zu dem Zwecke für die Monate Juni und Juli nach Neapel und Pompeji einlud.
Die beiden Monate, in denen ich in Gemeinschaft mit dem mitempfindenden Kameraden jetzt alles genoß und manches verarbeitete, was der göttliche Golf von Neapel in seinem weiten Halbkreis barg, gehören zu den schönsten und reichsten meines Lebens. Den Juni über arbeiteten und schwelgten wir in Pompeji, den Juli über in Neapel. Es waren wissenschaftliche Erntemonate, künstlerische Weihemonate, aber auch geistige und leibliche Erfrischungsmonate. Natur und Volksleben spielten ungerufen in unserem Tun und Treiben mit. Die heiße Sommersonnenglut des Südens war hier, durch den Seewind, der jeden Vormittag einsetzte, gemildert, erträglicher als in manchen nördlicher gelegenen Orten Italiens. Wir hatten Muße genug, uns abwechselnd unseren Pflichten und dem Dolce far niente hinzugeben, das der italienische Sommer fordert. Daß ich die Oden und Elegien, die als poetische Frucht dieser Monate 1877 wieder bei Theodor Ackermann in München erschienen, meinem Freunde Krohn widmete, war selbstverständlich.
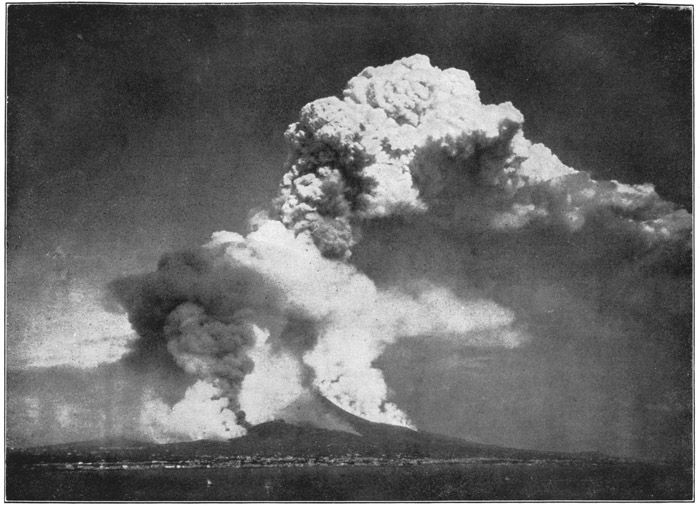
Tafel 11
Der Vesuvausbruch vom 26. April 1872
In Pompeji gab es vor dem Eingang zu den Ruinen damals nur zwei Gasthöfe: den zum Diomedes und den zur Sonne. Im »Diomede« wohnten, obgleich auch er nichts weniger als Luxushotel war, die Engländer und die verwöhnteren Deutschen. Der »Sole« war damals die äußerlich bescheidene, aber innerlich treffliche Herberge der Künstler und Gelehrten. Selbstverständlich wohnten wir im »Sole«, dessen damals noch junger, mit einer Französin verheirateter Wirt ein Muster von Ehrlichkeit und Fürsorge war. Für 4 Lire täglich erhielt man außer seinem Zimmer mit einer Kerze ein erstes Frühstück mit Eiern, um halb 1 Uhr ein vollständiges Gabelfrühstück, um 7 Uhr aber ein Pranzo, das aus sechs Gängen mit den erlesensten Gerichten bestand; dazu Wein zu beiden Mahlzeiten und nach ihnen, soviel man wollte oder konnte. Wenn unsereiner heute daran denkt, muß er wehmütig lächeln.
Die Ausgrabungsstätte, die angesichts des rauchenden Berggipfels so rätselhaft sonnig und versonnen daliegt, hat seit jener Zeit den doppelten Umfang angenommen; aber die inneren Hauptteile der alten Stadt und eine Reihe ihrer schönsten Straßen und Häuser waren schon damals aufgedeckt; und unvergleichlich köstlich war es, das Ruinenfeld, mit dem Erlaubnisschein versehen, der Künstlern und Archäologen erteilt wurde, ohne Führer den ganzen Tag, solange es geöffnet war, nach allen Richtungen zu durchstreifen, stundenlang in seiner grauen und farbigen Pracht zu verweilen, wo es einem gefiel, die verschwiegensten und malerischsten seiner Winkel aufzusuchen und überall das wissenschaftliche Forschen und künstlerische Genießen als untrennbare Einheit zu empfinden. Und dann abends die weinseligen Stunden angeregtester Aussprache im Kreise der Künstler und Gelehrten des »Sole«. Außer Deutschen waren hauptsächlich Franzosen und Dänen vertreten. Die Franzosen schlossen sich auf Ausflügen uns freilich nicht an, verkehrten abends aber in voller Kameradschaft mit uns. Die Tage, die Wochen eilten im Fluge dahin.
Auf Ausflügen nach Castellammare und Sorrento am Golfe, nach La Cava, dem frischen, waldigen Bergnest auf der Höhe, und nach dem immer noch grollenden, in seiner Gipfelgestalt völlig veränderten Vesuv, auf dem die Zerstörungen besichtigt wurden, die sein letzter Ausbruch in Massa und San Sebastiano angerichtet hatten, begleiteten uns, außer Landsleuten, immer auch die Dänen und Norweger, die im »Sole« wohnten. Den Abschluß unserer Tage von Pompeji aber bildete ein dreitägiger Ausflug nach Salerno, Paestum und Amalfi. Paestum ist in manchen Beziehungen die großartigste und stimmungsvollste aller reingriechischen Tempelstätten. Die gute Erhaltung ihrer drei Haupttempel, die die Kraft des älteren dorischen Stils in ihrer ganzen Wucht und Blüte zeigen, ihre wohl abgemessene, von allen Zwischenbauten freie Lage zueinander und die tiefe ländliche Stille und Einsamkeit des flachen Geländes zwischen dem Meere und den Bergen, auf dem sie liegen, wirken zu einem Eindruck zusammen, der Schauer der Andacht auslöst. Amalfi aber ist, unabhängig von dem baukünstlerischen Zauber, den sein »lombardisch-normannischer« Dom ausübt, eines der landschaftlich köstlichsten Fleckchen dieser Erde, die es gibt. Eingebettet in seiner von Orangen, Zitronen, Oliven und Johannisbrotbäumen umwucherten Felsenwildnis am stillen tiefblauen Meer, wirkt es wie ein abgelegener Zufluchtsort aus allen Wirrnissen und Qualen des Erdendaseins. Je unerreichbarer uns heute die Zufluchtsstätten dieser Art geworden sind, desto wärmer wird uns ums Herz, wenn wir uns in sie zurückträumen.
Etwas anders als in Pompeji, aber nicht minder köstlich gestalteten sich die vier Wochen, die ich mit Krohn dann noch in Neapel verlebte. Ich hatte eine hübsche Wohnung draußen vor der eigentlichen Stadt am Posilip gemietet. Jenseits der Bucht lag gerade vor uns der Vesuv. Links dehnte sich die große, lärmende Stadt, rechts die Bucht mit ihren Inseln. Gerade unter uns ragten die dunklen Ruinen des niemals vollendeten Barockpalastes der Donna Anna aus den Wellen.
Unser regelmäßiges Tagewerk begann um 8 Uhr morgens mit einem erfrischenden Seebad. Um 9 Uhr stand der zierliche Kutscher Nunzio mit seiner Carrozzella vor der Tür, die uns ans Museum brachte, in dem ich meine Aufzeichnungen machte und Krohn für mich malte. Das zweite Frühstück, das in einem benachbarten Speisehause eingenommen wurde, unterbrach unsere Arbeit nur eine halbe Stunde. Um 3 Uhr, wenn das Museum geschlossen wurde, wanderten wir zu dem berühmten Boothafen von Santa Lucia hinunter, wo Giuseppe, unser getreuer Schiffer, mit seinem jüngeren Bruder und Gehilfen Giovanni uns ein für allemal in seiner Segelbarke erwartete. Auf Umwegen zu Stätten lustigen Volkslebens oder stiller, heißer Natureinsamkeit segelten wir wieder zum Posilip hinaus.
Die letzte Stunde vor Dunkelwerden benutzte Krohn, ein Bildnis von mir zu malen. Ich stand auf dem Balkon mit dem Vesuv jenseits des Golfes im Rücken; Krohn saß vor der geöffneten Tür im Zimmer. Es reizte ihn, wie er sagte, das freie Spiel der Luft und des Lichtes, die mich umflossen, festzuhalten. Von Manets »plein air« wußten wir damals noch nichts. Zwar hatte der französische Begründer des Impressionismus damals schon sein »Frühstück im Grase« und seine »Olympia« gemalt, deren geringe Abschattung ihnen das Eigengepräge verlieh, das damals noch verhöhnt wurde. Das volle, sonnige Freilicht hatte Manet erst 1870 im Garten seines Freundes de Nittis verwertet. Aber die gleichen Bestrebungen liegen, wenn die Zeit reif für sie ist, in der Luft. Wie von unsichtbaren Keimen werden sie von Land zu Land getragen. Maßgebende Künstler pflegen noch heute, wenn sie das Bild bei mir sehen, ihr Erstaunen darüber zu äußern, daß ein deutscher Maler das 1872 gemalt habe.
Wenn das rötliche Abendlicht herabsank, dessen erste Strahlen Krohn auf dem Bilde noch verwertete, legte er den Pinsel beiseite. Um 8 Uhr setzten wir uns am Scoglio di Frisio zum lecker bereiteten Mahle; und oft genug fuhren wir, wenn wir Giuseppe dabehalten hatten, noch zu nächtlichen See- und Strandfahrten wieder hinaus. Es war ein schönes, üppiges, aber auch von reinem geistigen Streben durchglühtes Leben.
Komm, mein Freund, selbst unter Neapels Sonne,
Wo das Herzblut heiß in den Adern hämmert,
Macht der Purpur feurigen Weins die Pulse
Kräftiger schlagen.
Doch des Gasthofs marmor- und glasgeschmückten
Hohen Prunksaal lassen wir den Inglesi,
Und ein Wirtshaus suchen wir, nah dem Meere
Unter Zitronen.
Sieh! hier sitzt sich's traulich im Blätterschatten,
Sieh! schon holt uns Gläser die schöne Wirtin,
Und der Wirt bringt schmunzelnd die größte Flasche
Funkelnden Rotweins.
Freilich, Freund, auch unter Neapels Sonne
Starrt das Alltagsleben von Schmutz und Elend;
Nur der Wein quillt volleren Stroms und tröstet
Leichter den Armen.
Ohne Wein auch sehn mit dem Künstlerauge
Manche Schönheit wir, die der Welt verborgen;
Und im Bild grüßt freundlich uns, was im Leben
Jammert und wehklagt.
Aber deshalb küßten die Musen weihend
Ja die Stirn den Künstlern und den Poeten,
Daß vom Alltagsleben sie ihre Brüder
Hülfen erlösen.
Sieh! der Wirt bringt eben die zweite Flasche,
Drum verzeih', wenn nicht ich nach neuster Mode
Von der Kunst denk'! Schiebe die Schuld dem Wein zu,
Der mich begeistert.
Aber sei's drum! Ohne Begeistrungsflammen
Welkt die Kunst hin, wie die verfrühte Rose:
Hoch die Kunst, die höher als Rebenpurpur
Schlagen das Herz macht!
Bis zum Anfang des Monats August hielt Neapel, hielt der Posilip, hielt der Scoglio di Frisio uns fest. Den Abschluß meines Zusammenlebens mit Krohn bildete ein Besuch Capris, der göttlichen Insel der Sirenen. Krohn hatte schon den vorhergehenden Sommer dort zugebracht, kannte jeden Schiffer, jeden Eseltreiber, jeden Weinwirt und alle ihre hübschen, zierlichen Töchter, die ihn »Occhio di gatto« (Katzenauge) getauft hatten. Voll jugendlichen Übermuts traten wir in der Frühe des 3. August vom Posilip aus die Fahrt an. Natürlich fuhren wir nicht wie die »Reisenden« mit dem Dampfschiff, sondern mit Giuseppes Barke hinüber. Vincenzo und Agostino Muselli, die netten Wirtssöhne vom Scoglio di Frisio, begleiteten uns und nahmen für uns alle das Frühstück für die Tagesfahrt mit. Auch der Geiger und der Sänger unserer alten Trattorie wurden mitgenommen. Es war eine lustige Fahrt bei günstigem Winde, der unser Segel leicht und luftig schwellte. Von der »großen Marine«, an der wir auf Capri landeten, ritten wir mitsamt, die Musiker voran, zu dem berühmten, von einer Palme überragten Künstlergasthof Pagano hinauf, der eine Stufe höher stand als der »Sole« in Pompeji, auch 6 statt 4 Lire für den Tag nahm, trotzdem aber von den Künstlern und Gelehrten der ganzen Welt besucht wurde.
Capri ist eine verführerische Fee, die uns mit weichem, duftendem Atem anhaucht, uns alle Früchte des Meeres und der Gärten in den Schoß schüttet und uns mit schelmischem Geplauder roter Lippen so umstrickt, daß wir alle geschichtlichen Erinnerungen, die auch hier im Hintergrunde lauern, alle Wissenschaften, die uns in ihrem Banne festhielten, ja alle Kunstwerke der Welt, die uns sonst entzückten, der Vergessenheit weihen, um wenigstens einmal einige Tage lang nichts als irdische Lebewesen zu sein und uns als Teil der großen, frischen und doch so lieblich lächelnden Natur zu fühlen, die sich hier vor unseren Augen entfaltet. Die beiden »Marinen«, wo die Schiffer und ihre Boote sich sonnen, Anacapri, zu dessen luftiger Höhe uns viele, viele steile Stufen emporführen, der Arco naturale unten im Meer, der mich an das schon in meiner Jugend eingestürzte »Mörmers Gatt« der roten Felseninsel meiner Heimat erinnert, vor allem, vielleicht vor allem die Blaue Grotte, die die Meerflut in blaues bengalisches Licht verwandelt! Es ist alles nichts und ist doch alles alles. Ausruhn, atmen, leben, lieben! Als ich Capri verließ, wo Krohn zurückblieb, wußte ich, daß meine Reise sich ihrem Ende nahte, daß ich vom schönen, inhaltsreichen Süden Abschied nehmen mußte.
Von Neapel nach Genua fuhr ich natürlich wieder zu Schiff. Unterwegs blieb das schöne Dampfboot in Livorno lange genug liegen, um mir einen Abstecher nach Pisa zu gestatten, das, eine frühe, noch vorgotische Kunstwelt für sich, mich mit tiefer Sehnsucht erfüllte, mich ihm ein anderes Mal länger und liebevoller zu widmen.
Nun noch einige Tage in Genua, dem »superben«, in Mailand und einigen anderen Städten Oberitaliens! Ich habe sie alle dieses Mal nur im Vorbeigehen ehrfürchtig begrüßt, um mich später, besser zu ihrer Würdigung vorbereitet, in sie zu vertiefen. Und dann über die Alpen zurück! Die Fahrt über die Alpen mußte ich mir so eindrucksvoll wie möglich gestalten. In Colico, am oberen Ende des wunderreichen, in voller Sommerschönheit strahlenden Comosees, mietete ich mir einen Wagen, um, unterwegs in Sondrio und in Bormio übernachtend, übers Stilfser Joch, auf dem die hohe Alpennatur sich mir zum ersten Male erschloß, nach Trafoi und am vierten Tage von hier nach Meran zu fahren. Nach allem Schönen und Großen, das ich gesehen, wirkte dieser Alpenübergang unter dem in Schnee und Eis gehüllten Ortler her überwältigend auf mich ein. Wie hoch erhaben lag diese Welt in ihrer ruhigen, klaren Majestät über allem Können und Wissen, allem Schaffen und Genießen, allem Wollen und Sollen der tief unter ihr in der Ebene hastenden und rastenden Menschheit. Die Fahrt erschien mir fast wie eine Krönung des Aufbaus meiner Reise.
Und nun sprach alles wieder Deutsch um mich herum. Ich war daheim.