
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++

Diese Tiere kommen mir jetzt noch manchmal im Traum. Ich fahre oft plötzlich aus dem Schlaf auf, denn es träumt mir, die streitsüchtigen, neidischen Burschen kämpften um die Ehre, auf meinem Kopf zu schlafen.
Und doch waren es gute Hunde für ihren Beruf und sie haben vielleicht, im ganzen genommen, geleistet, was keinen andern Hunden der Welt möglich gewesen wäre. Sie bekommen meistens mehr Schläge und Flüche als freundliche Behandlung und gute Worte. Sie leben in den Polarländern, wo für alle Bewohner der Hunger der regelmäßige Zustand ist, und bei Mensch und Tier Macht vor Recht geht. Kein Wunder dann, daß es kaum möglich ist, einen Eskimohund zur Ehrlichkeit zu gewöhnen. Er bleibt, so nützlich er ist, ein Dieb von der Kindheit bis ins Greisenalter. Das hat mich schließlich bewogen, soweit möglich, die Eskimohunde abzuschaffen und mir Gespanne von Neufundländer- und Bernhardinerhunden heranzuziehen.
Der reine Eskimohund ist nicht unschön. Sein strammer, gut mit Pelz bedeckter Körper, die spitzen, aufmerksamen Ohren, die fuchsartige Schnauze, die guten Beine und die festen, harten Füße, der buschige Schwanz, auf den er sehr stolz ist, die glänzenden Augen – all das sichert ihm eine angesehene Stellung unter den Hunden. Die Farbe wechselt vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Schwarz. Ich hatte zwei solche weiße Hunde, bei denen man nicht ein farbiges Härchen finden konnte. Die Indianer nannten sie deshalb Kuna und Pa-qua-sha-kun, d. h. Schnee und Mehl. Ziemlich selten sind die mausgrauen Hunde, die für besonders gescheit gelten. Ein Eskimohund kann 60 bis 130 Pfund ziehen.
Während meinem ersten Winter war ich im Gebiet der Hudson-Bai-Gesellschaft, einer der größten Pelzhandelsgesellschaften der Welt, der glückliche oder unglückliche Besitzer von zwölf solchen Hunden. In dem Indianerdorf, wo wir wohnten, waren aber Hunderte, und alle pflegten dreimal in der Nacht, besonders während des Winters, ein ganz entsetzliches Geheul anzufangen. Um 9 Uhr, wenn die Menschen alle in ihren Häuschen oder Wigwams waren und im ganzen Dorf nächtliche Stille herrschte, begann plötzlich ein Hund wie ein Wolf zu heulen. Es klang wie ein langgedehntes »O« in die kalte Nacht hinaus. Das konnte man sich gefallen lassen. Aber bald stimmten alle anderen Hunde in das klägliche Geheul ein; und alle Töne, die ein Hund überhaupt hervorbringen kann, von dem tiefen Baß der alten bis zu dem komischen Kläffen der ganz jungen, bildeten den ohrenzerreißendsten Lärm, den jemals ein Sterblicher gehört hat.
Am Anfang fuhren wir dabei fast aus der Haut. Ich stürzte hinaus mit der nächst besten Waffe, die ich fand, aber das Heulen, Brüllen, Quiksen, Kläffen, Bellen und was es noch von unbeschreiblichen Tönen gibt, hörte nicht auf, ich mochte nun nach den Bestien schlagen, ihnen ein Tintenfaß oder was ich gerade erwischte, an den Kopf schmeißen oder ihnen einen Weißfisch vorwerfen. Doch plötzlich war's wie mit einem Schlage still, um dann gegen Mitternacht und gegen 3 Uhr nocheinmal anzufangen. Andere Leute sagten mir, man gewöhne sich an den Lärm, und so war's auch; nach ein paar Wochen schliefen wir friedlich weiter, wenn auch die Bestien gerade unter unseren Fenstern wie besessen heulten.
Leider konnte ich den Eskimohunden weder durch Güte noch durch Strenge das Stehlen abgewöhnen. Sie fraßen alles Eßbare und vieles, was sonst nicht für eßbar gilt. Sie konnten ihre Fischmahlzeit verlassen, um ein Paar Mokassins aus Hirschfell von einem Wäscheseil herunterzureißen und gierig zu verschlingen. Ein Lederhemd war ihnen ein Leckerbissen und wenn sie die Peitsche eines strengen Treibers erwischten, so fraßen sie schnell die drei Meter lange Schnur, wenn sie auch aus geflochtenen Lederriemen mit hineingedrehtem Schrot bestand. Wenn man auf der Reise Halt machte und die Indianer nicht scharf aufpaßten, fraßen die Hunde oft die Riemen und das Geschirr ihrer neben ihnen liegenden Kameraden.
Meiner lieben Frau und mir entleideten die Weißfische, wenn sie ein halbes Jahr lang 21 mal in der Woche die Hauptspeise bildeten, während wir in der anderen Hälfte zur Abwechslung daneben nur etwas Wildbret aus der Gegend, z. B. wilde Katze, Moschusratte, Kaninchen, Biber, Hirsch, Schneevögel und dgl. hatten und vielleicht ein klein wenig Mehl, das oft nach Erdöl schmeckte.
Als ich nun einmal die Ansiedlung am Roten Fluß, der von Süden her in den Winnipeg-See fließt, besuchen wollte, sagte meine Frau: »Kauf doch ein Schaf von einem Ansiedler und bring's im Boot mit. Wir haben ja einen eingezäunten Hof und im Sommer gibt's Gras. Wenn's dann kalt wird, schlachtet man das Schaf und läßt das Fleisch gefrieren, dann hält's lange und wir hätten doch auch einmal eine kleine Abwechslung.«
Gesagt, getan. Ich kaufte ein schönes, großes Schaf. Mein Indianer machte ihm einen Platz im Boot zurecht und abends, wenn wir anlegten, mähte ich am Ufer Gras für mein Tier. Zu Hause angekommen, brachte ich es in den Hof. Der Zaun bestand aus Tannenstämmen, die ungefähr 30 Zentimeter im Durchmesser hatten und drei Meter hoch waren. Sie waren fest und dicht nebeneinander eingerammt und noch durch starke Querbalken verbunden. Und doch gelang es meinen Eskimohunden in einer Nacht einzudringen und meinen armen Hammel, den ich mit solcher Mühe 640 Kilometer weit hergebracht hatte, aufzufressen.
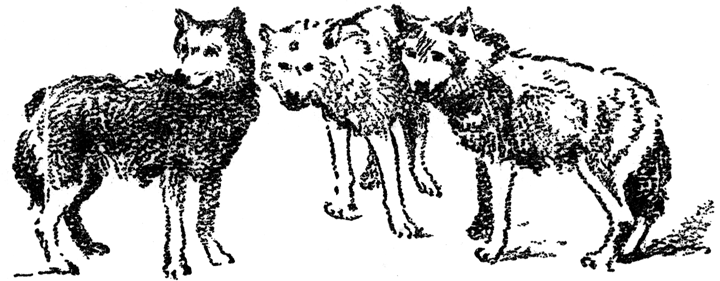
Am folgenden Tag hielten sie sich immer in vorsichtiger Entfernung von mir. Sie ließen mich bis auf 50 Meter herankommen, aber dann schien's, als wollten sie sagen: »Bleib mir zehn Schritt vom Leib«. Sie wußten wohl, daß sie Prügel verdient hatten, und dachten, sie wollten meinen Zorn etwas verrauchen lassen. Sie einen Tag später noch zu strafen, hätte keinen Sinn gehabt, denn sie hätten nicht mehr gewußt, warum sie die Prügel bekamen.
Nun dachte ich, ich wollte es mit Schweinen versuchen. Als ich im folgenden Jahr wieder an den Roten Fluß ging, kaufte ich ein paar nette Ferkelchen und brachte sie glücklich heim. Ich hatte jetzt ein Blockhaus, denn wir waren so glücklich, zwei gute Kühe zu besitzen, die darin untergebracht waren. Hier machte ich auch einen Schweinestall mit einer Tür aus fünf Zentimeter dicken Tannenbrettern. So mußten die Schweinchen doch sicher sein. Lange geschah ihnen nichts, wenn ich auch ein paarmal bemerkte, daß die Hunde große Späne von der Tür abgerissen hatten; auch sah man jeden Morgen die deutlichen Fußspuren der Hunde um den Stall. Sie wollten scheint's die Schweinchen wenigstens riechen.
Eines Morgens, als ich nach meinen Ferkelchen sehen wollte, begegnete mir ein Indianer, der in der ruhigen kaltblütigen Art, die diesem Volk eigen ist, zu mir sagte: »Du brauchst dir keine Mühe mehr zu machen und Martin braucht die Ferkel nicht mehr zu füttern.«
Ich eilte zum Stall. Martin, mein treuer Knecht, stand vor dem Stall, in dem nicht mehr viel von den Schweinchen zu sehen war. In einer Ecke standen aufgeregt und mit blutigen Köpfen ein paar von den Hunden. Martin hatte sie noch beim Mahl erwischt und eingesperrt.
Die Hunde hatten mit ihren Zähnen die Planken durchgebissen. Sie hatten jedenfalls abwechselnd gearbeitet und unter einigen Schmerzen, denn manche von den abgebissenen Spänen waren blutig. Sie hatten eine dunkle, stürmische Nacht für ihren Angriff gewählt; denn in jener Nacht hatte der Wind so fürchterlich geheult, daß wir und die ganz in der Nähe wohnenden Indianer nichts von dem Lärm gehört hatten.
Ärgerlich wandte ich mich ab. »Soll ich die Hunde strafen?« fragte Martin. »Du kannst tun, was du willst,« antwortete ich, »aber das Strafen hilft nichts. Ihre Natur ist nun einmal so und ich will sehen, daß ich möglichst bald andere Hunde bekomme, die keine solchen Untugenden haben.«
Ich gab den Versuch die Rasse zu heben oder zu bessern auf, wenn ich auch immer einzelne Eskimohunde hatte, denen ich trauen konnte, solange sie eingespannt oder fest an einen Baum oder Pfosten gebunden waren.