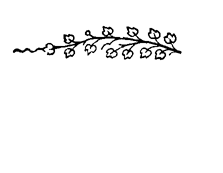|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
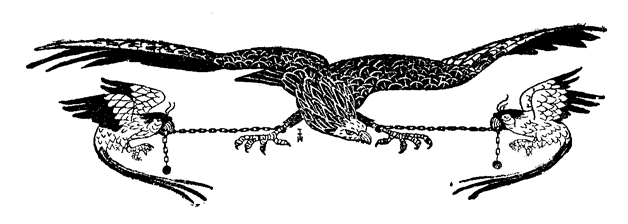
Mitten in dem lachenden Thal, das sich zwischen der Garonne und der Baïse in weichen Biegungen von Agen nach Nerac hinschlängelt, überrascht das Schloß Ayguenoire, wo Blaise de Montluc einen Teil seiner Kommentare schrieb und wo er begraben liegt, den Vorübergehenden durch sein unheimliches Aussehen.
Auf dem höchsten der Roquefort-d'Agen benachbarten Hügel erheben sich die Türme des Schlosses und von der Landstraße aus sieht man noch die in den Stein geschmiedeten Eisenringe, an denen der gefürchtete Hauptmann die gefangenen Hugenotten aufhängen ließ. Noch finstrer ist die andre Seite, die auf einen Fichtenwald hinausgeht, einen kleinen tiefdüstern Fichtenwald mit wild ineinander verschlungenem Gezweig. Halb verschimmeltes Moos bedeckt den immer feuchten Boden, der von schmalen rieselnden Wasserfäden durchzogen wird. Weiterhin vereinigen sich diese in dem schwarzen Moor, von dem das Schloß seinen Namen hat. Auf dieser Seite des Gebäudes erhebt sich das Grabmonument Montlucs, ein einfaches Rechteck von Stein mit dem Bilde des Hauptmanns. Die Arme über dem Degengriff gekreuzt, liegt er auf dem Rücken, sein Hund hat sich ihm zu Füßen hingestreckt. Ein Schleier von grünlichem Schimmel hüllt den Sockel und das Steinbild ein.
Schaulustige Reisende kommen nicht häufig nach Ayguenoire – dieses herrliche Stück Land an der Garonne ist dem Touristen unbekannt geblieben – und den wenigen, die es aufsuchen, macht es den Eindruck einer lebendig gewordenen Vision aus der Vergangenheit. Seit der Zeit jener heldenhaften Kämpfe ist der alte Bau unverändert geblieben. Hat man eine Weile vor diesen starren, von der Zeit verschonten Steinmassen dagestanden und sich in seine Träume vertieft, so begreift man nicht, daß hier wirklich Menschen wohnen, modern gekleidete Menschen. Und doch ist Ayguenoire bewohnt. Um die Mittagsstunde kann man seine Bewohner in dem alten Ahnensaal um den Tisch versammelt sehen: – eine ältliche Dame, – durch die Gicht an ihren hohen Lehnstuhl gefesselt, – eine brünette junge Frau, immer noch schön, aber blaß und leidend, als ob sie in dieser Einsamkeit verwelkte und hinsiechte und ein großer, kräftiger, bartloser Bursche mit dem schwarzen Haar und dem Teint des Spaniers. Langsam nehmen die drei ihr Mahl ein, ohne dabei zu reden.
Und die Mauern von Ayguenoire, die in den Zeiten, wo Montluc seine wilden Kämpfe gegen den sagenhaften Baron des Adrets führte, Zeugen so mancher schrecklichen That waren, haben doch vielleicht noch keine so furchtbare Tragödie gesehen, wie dieses Familiendrama, das sich seit fünf Jahren Tag für Tag zwischen den drei schweigsamen Tischgästen abspielt.
Die alte Dame ist die Witwe des Marquis de Seyssac. Ehemals war sie als eine der Jüngsten mit unter der leichtsinnigen Schar gewesen, die Mlle. de Montijo in ihrem Gefolge mit in die Tuilerien brachte. Dort lernte sie den Marquis kennen und verheiratete sich mit ihm. Er gehörte dem alten Adel von Languedoc an. Die Seyssac behaupten von Blaïse de Montluc abzustammen und in der That war Ayguenoire in direkter Erbfolge auf sie gekommen.
Das junge Ehepaar, das zu der näheren Umgebung der Kaiserfamilie gehörte, huldigte den Sitten der Zeit und des Hofes. Die Marquise soll mit unter denen gewesen sein, die am Schluß des Soupers von Compiegne halbnackt frivole Scharaden aufführten.
Sie hatte jedoch einen Sohn, der Viktor genannt wurde, das Kind war ihr im Wege. Sie schickte es deshalb nach Agenais und ließ es dort von einer Amme aufziehen, eine jener kräftigen Bäuerinnen mit rotem Rock und dem um die glatten schwarzen Haare geschlungenen Kopftuch.
Als das Kaiserreich gestürzt wurde, zählte Viktor erst sechs Jahre und hatte seine Eltern noch nicht dreimal gesehen. Der Marquis fiel im Kriege und der Marquise blieb als Zufluchtsort nur die Einsamkeit von Ayguenoire. Sie war vernichtet und betäubt von diesem Zusammenbruch – wie sie alle, die einst in den Tagen der Freude die Scharaden von Compiegne aufgeführt hatten.
Sie klammerte sich an ihre Mutterschaft, wie an den einzigen Vorwand, der ihr noch zum Weiterleben blieb und man muß zugeben, daß sie jetzt, wo sie ihren früheren Leidenschaften hatte entsagen müssen, eine hingebende Mutter wurde. Der kleine Marquis wurde nicht verzogen, er wuchs auf wie es eben kam, unter den blinden Liebkosungen seiner Mutter und der Dienerschaft.
Mit zwanzig Jahren gehörte Seyssac zu dem Schlage junger Leute in der Gascogne, die noch heutzutage nicht selten sind, die ihre Zeit nur mit Kartenspielen, Reiten oder mit Liebeshändeln totzuschlagen wissen.
Paris, wohin seine Mutter ihn schickte, mit Empfehlungen an die Überreste der bonapartistischen Partei, verwirrte seinen Geist völlig. Gezwungen mit bescheidenen Mitteln zu leben, langweilte er sich.
So kam er nach einem Jahr nach Ayguenoire zurück und verlangte, seine Mutter solle ihm eine Frau suchen.
Daran hatte sie auch schon gedacht. Einige Tage nach der Rückkehr ihres Sohnes lud sie ihren Nachbar, Monsieur de Buch, auf das Schloß ein. Dieser, ein Mann von kaum fünfzig Jahren, war in seinem Wesen noch jugendlich und voll Lebenskraft. Er stammte aus guter Familie, die aber, wie fast der ganze Landadel der Gegend, verarmt war. Deshalb war er schon früh ins Ausland gegangen, um mit einem unbedeutenden Kapital in den Weideländern Südamerikas sein Glück zu versuchen. Als er nach fünfzehn Jahren zurückkehrte, besaß er drei Millionen, die er sich durch Viehzucht erworben hatte.
Drüben hatte er sich verheiratet, seine Frau war dort gestorben und er brachte seine kleine, zwölfjährige Tochter mit, um sie im Kloster von Mariä Himmelfahrt in Bordeaux erziehen zu lassen.
Er selbst bezog das alte Haus seiner Familie in Roquefort d'Agen, das er ausbauen und mit allem Luxus einrichten ließ.
Die Wundergeschichte von seinem rasch erworbenen Vermögen hatte sich schnell verbreitet und voller Neugierde zeigte man sich: »Moussu de Buch«, wenn er durch die Dörfer fuhr, begleitet von seinem Diener José, einem jungen Gaucho aus Amerika, der seinen Herrn nicht hatte verlassen wollen.
Schon lange hatte die verwitwete Marquise Seyssac daran gedacht, ihren Sohn mit der kleinen de Buch zu verheiraten. Sie wollte ihn gern in ihrer Nähe behalten und dann war auch eine Mitgift von einer Million in der Gascogne recht selten.
Viktor billigte die Wahl seiner Mutter. Seit seinem Aufenthalt in Paris beherrschte ihn der Wunsch nach Reichtum und Marguerite de Buch, die jetzt das Kloster verließ, war schön, wenn auch fast allzuernst von Wesen und Gesicht.
Während ihres letzten Jahres im Kloster hatte sie den Marquis zwei- bis dreimal gesehen, sie war an den Gedanken gewöhnt, seine Frau zu werden, und als sie Mariä Himmelfahrt verließ, wurde die Hochzeit gefeiert.
Die beiden ersten Jahre ihrer Ehe waren ziemlich glücklich. Nur der plötzliche Tod von Monsieur de Buch warf einen Schatten auf das Familienleben. Ein halbes Jahr nach der Vermählung seiner Tochter starb er an einer Lungenentzündung.
Der junge Marquis liebte seine Gattin. Sie schien ihm die begehrenswerteste unter all den Frauen, die er als ländlicher Don Juan in seinen Armen gehalten. Aber mit der Zeit schwächten sich seine Wünsche ihr gegenüber ab, er begann aufs neue den Schürzen der Mägde und Bäuerinnen nachzulaufen und nahm seine früheren Ausflüge nach Agen, Bordeaux und Toulouse wieder auf.
Marguerite, die sich verlassen und betrogen fühlte, verlangte von ihrer Schwiegermutter Schutz gegen die Untreue ihres Gatten.
Aber die alte Marquise gab ihr lachend zur Antwort: Männer wären nun einmal Männer, sie selbst sei in ihrer Ehe wahrhaftig nicht besser daran gewesen und auch nicht daran gestorben.
Von diesem Tage an kam es zu einem vollständigen Bruch zwischen den beiden Frauen, die sich nie besonders nah gestanden hatten.
Marguerite zog sich soviel wie möglich zurück und nährte in ihrem verdüsterten Sinn den Haß gegen Mutter und Sohn.
In diesem finstern Schlosse von Ayguenoire, das so reich an blutigen Erinnerungen war, schien sich alles gegen sie zu verschwören, alle nahmen Partei für den Marquis. Sein Hang, die unter ihm stehende Gesellschaft aufzusuchen, schmeichelte seinen Leuten und den Bauern. Seit Heinrich IV liebt die Gascogne die großen Herren, die das Volk mit Füßen treten. Und Marguerite war eine Ausländerin, eine Tochter der verhaßten spanischen Rasse. Die unglückliche, junge Frau führte in Ayguenoire das Leben einer Verbannten; sie hatte nur einen Halt, José, den argentinischen Diener, den sie seit dem Tode ihres Vaters zu sich genommen hatte. Sein Anblick erinnerte sie an die heimatlichen Prairien mit ihrem hohen Gras, an die Estanzia in Paisandu, wo sie aufgewachsen war und an den Vater, den sie tief betrauerte. Mit José konnte sie ihre Sprache reden, ihre Muttersprache, in der sie die ersten Laute stammeln gelernt. Und sie wußte, daß er ihr ergeben war, wie ein treuer Hund, der seinen Herrn bewacht; daß er für sie imstande gewesen wäre zu morden, und gern sein Leben für sie hingegeben hätte.
An einem Februarabend, Marguerite de Seyssac war jetzt fünf Jahre verheiratet, war der Marquis wie gewöhnlich abwesend, als die Bedienten, kopflos vor Schrecken, in den großen Saal gestürzt kamen, wo die beiden Damen sich aufhielten. Die alte Marquise schlief in ihrem Lehnstuhl und die junge Frau träumte bei ihrer Handarbeit.
»Madame, um Gottes willen, Madame!« –
»Nun, was giebts denn?«
»Man bringt den gnädigen Herrn. Er ist verwundet. Es ist zu befürchten, daß es schon mit ihm vorbei ist!«
Es verhielt sich in der That so. Viktor von Seyssac wurde aus einer Stirnwunde blutend, sterbend nach Hause gebracht. Marguerite versuchte die näheren Umstände zu erfragen. Aber, man suchte sie zu täuschen. Man sprach ihr von einem Sturz mit dem Pferde, in Bordeaux. – Ja, in Bordeaux war es geschehen, daß er den Todesstoß empfangen hatte – in einem der elendesten, öffentlichen Häuser von Bordeaux, wo er mit Matrosen handgemein geworden war. Zwei Wochen lang wurde das Ereignis von allen Zeitungen der Gegend breitgetreten, die Geschichte drang sogar bis nach Paris. Die junge Witwe mußte den Becher der Schande bis auf die Neige leeren. Einen Augenblick dachte sie daran, unter Josés Schutz nach Amerika zurückzukehren. Aber nein, sie mußte Rache nehmen für ihre zerstörte Jugend, für ihre befleckte Frauenehre, und weil sie Viktor de Seyssac nicht mehr erreichen konnte, beschloß sie sich an seiner Mutter, an der alten Marquise, zu rächen, deren Thränen seit dem Tode ihres Sohnes nicht mehr aufhörten zu fließen.
Noch am Abend des Tages, wo Marguerite erfuhr, daß die traurige Angelegenheit ihren Abschluß erreicht – der Mörder war nicht aufzufinden gewesen und die Untersuchung hatte nur die schmählichen Sitten des Opfers zu Tage gefördert – stieg sie in ihr Zimmer hinauf und schellte nach José.
»Höre, Pepito,« redete sie ihn an, »Du liebst mich, nicht wahr?«
»O, ja, Señora, wie meinen Gott.«
»Nein – nicht wie Gott, Du liebst mich, wie ein Mann das Weib liebt. Antworte nicht,« setzte sie auf eine abwehrende Gebärde des Gaucho hinzu. »Ich weiß es. Du warst schon in mich verliebt, als ich noch ganz klein war, als Du mich reiten lehrtest, am Gitter der Estanzia. Und später, als Papa nach Frankreich zurückkehrte, da bist Du ihm nur meinetwegen gefolgt. Ist das nicht wahr? Als ich im Kloster war, habe ich Dich oft des Sonntags um die Mauern von Mariä Himmelfahrt streifen sehen, weil Du mich durchs Fenster sehen wolltest. Und bei meiner Hochzeit hast Du in der Kirche geweint wie eine Frau.« –
Er hatte sich ihr zu Füßen geworfen:
»Vergebung – vergeben Sie mir,« sagte er, »ich habe nie etwas gethan, Señora, ich habe nichts gethan.«
»Das ist wahr – Du hast nie vergessen, was ich bin und was Du mir schuldig warst. Nun, es ist gut; höre mich an, José. Siehst Du mich? Ich bin immer noch schön – trotz all dem Kummer, den ich erlitten. Schau her.«
Sie schlug das Tuch, das sie noch immer nach Sitte ihres Landes über dem weit ausgeschnittenen Kleide trug, zurück und entblößte ihre Brust, den Ansatz ihres Busens.
»Schön, schön wie die Mutter Christi!« stammelte Pepito mit glühenden Augen.
»Nun denn, ich will Deine Geliebte sein, hörst Du, Deine Maitresse. Du sollst in meinem Bett schlafen, heute Nacht und von jetzt an jede Nacht, bis einer von uns stirbt. Du kannst nicht glauben, daß es wahr ist. Und doch ist es so, Du sollst mich besitzen, Du sollst mein Liebhaber sein – jetzt gleich. – Hast Du mich verstanden?«
Sie riß die letzten Spangen, die das Kleid über der Brust zusammenhielten, auf und beugte sich mit ihrem nackten Busen über Pepito, der vor ihr kniete, indem sie, ihre Augen in die seinen bohrend, wiederholte:
»Deine Geliebte, hörst Du?«
Der Mann sprang auf, halb rasend gemacht und wollte sie erfassen. Sie wich zurück und machte eine Bewegung um ihn aufzuhalten.
»Warte, noch nicht; Du mußt mich erst verdienen. Du mußt mir etwas schwören.«
»Was? was?« stammelte José, der in heißem Begehren aufstöhnte. Und dann fügte er ruhig hinzu:
»Wen soll ich umbringen?«
Marguerite antwortete:
»Niemand – wenigstens jetzt noch nicht. Du sollst mir nur gehorchen, unbedingt alles thun, was ich will und so wie ich es will. Morgen, wenn man zum Frühstück läutet, kommst Du mit mir aus meinem Zimmer, setzt Dich mit uns an den Tisch, zwischen die Marquise und mich.«
»Ja,« antwortete José.
»Ebenso wirst Du mit uns zu Mittag essen und den Abend mit uns im Saal zubringen, und wenn Du Lust bekommst mich auf den Mund zu küssen, sollst Du es vor ihr thun, mich vor ihr auf Deine Kniee nehmen.«
»Ja.«
»Und wenn hier irgend jemand es wagt, Dir zu nahe zu treten, so jage ich ihn fort; und wenn jemand mich verletzt, so wirst Du ihn töten. Willst Du?«
»Ja.«
»Schwörst Du es mir?«
»Bei dem Haupte Christi!«
»Dann ist es gut. Ich bin Dein. Nimm mich hin.«
Der Gaucho stürzte sich auf sie. Und sie ließ es geschehen, daß er sie in rasender Umarmung emporhob und auf das Bett warf, dessen Kissen und Tücher mit dem Wappen derer von Seyssac geschmückt waren. – – –
Jahre sind verflossen seit jener Nacht. Marguerite hat den Kampf nicht aufgegeben. Die Mutter hat zuerst Widerspruch versucht. Pepito hat den Sessel der Gelähmten, an den die Gicht sie festgeschmiedet hat, mit Gewalt neben seinen Platz geschleppt. Sie hat sich den Anschein gegeben nichts zu essen, man hat sie gewähren lassen, und der Hunger hat den Sieg davongetragen.
Jetzt ist sie besiegt und läßt alles über sich ergehen. Tag für Tag erduldet sie die Qual, den Gaucho – stark gemacht durch Marguerites Beistand und durch die Furcht, die er einflößt – den Platz ihres verstorbenen Sohnes einnehmen zu sehen in dem ehrwürdigen alten Schloß, an der gemeinsamen Tafel, – in dem Bett ihrer Schwiegertochter.
Noch manches Mal empört sich ihr verwundeter Stolz und macht ihr Herz beben. Sie sehnt den Tod herbei, der sie von dieser Schmach erlösen soll. Aber der Tod scheint dem abscheulichen Racheakt in die Hände zu arbeiten. Er verschont die Gelähmte.
Und es wird noch lange der ehemalige Kammerdiener von der argentinischen Farm bei jeder Mahlzeit seinen Platz zwischen den beiden Marquisen im Ahnensaal von Ayguenoire einnehmen.