
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wagner wurde wie ein Fürst bestattet. Venedig, München und Bayreuth wetteiferten in eindrucksvollen Kundgebungen, bei denen nicht nur die Behörden und die Kunst und Bühne aus aller Welt vertreten waren, sondern auch ein großer Teil der heimischen Bevölkerung, in Bayreuth die gesamte Einwohnerschaft den bewegtesten Anteil nahm. Und mehr als das: wo früher der Kampf tobte, da war jetzt eine große Stille und ein helles Leuchten. Wagners Sonne stand rein am Himmel, das Gewölk der Mißgunst und des Neides hatte sich verzogen, die Gegner legten die Waffen nieder, ganz Deutschland (mit Ausnahme des Deutschen Reichstages) huldigte dem Unsterblichen.
Cosima wußte nichts davon oder beachtete es nicht. Fünfundzwanzig Stunden hatte sie beim Toten geweilt, dann ließ sie ruhig, aber nicht willenlos, alles mit sich geschehen. Als der Arzt die Einbalsamierung des Leichnames vornahm, mußte sie den Raum verlassen. Auch durfte sie den Toten, der scharfen Gifte wegen, nicht mehr berühren. Um dies zu verhindern, verschloß man das Zimmer von außen, ohne zu bemerken, daß sie ungesehen von einer anderen Seite wieder eingetreten und nun mit eingeschlossen war. Sie erklärte dem bestürzten Arzte, daß sie nichts Verbotenes getan habe: »Ich habe nur mit ihm allein sein wollen.« Vorher schon hatte sie sich ihr langes blondes Haar von den Töchtern abschneiden lassen; nun legte sie es in den Sarg. Sie sprach, außer mit ihren Kindern, nur mit Adolf von Groß und dessen Frau, die aus Bayreuth herbeigeeilt waren. Liszt hatte angefragt, ob er kommen solle und seine Tochter nach Bayreuth geleiten dürfe. Aber Cosima wollte weder ihn noch ihren Schwiegersohn sehen. Beim Verschließen des Sarges half sie selbst mit, den Schlüssel nahm sie um den Hals. Die Fahrt bis Bayreuth und alle Feierlichkeiten wurden von Groß geordnet und überwacht. Cosima empfahl ihm ihre Kinder und bestimmte ihn zum Vormund. An der bayrischen Grenze überreichte der Kabinettssekretär von Bürkel, der Nachfolger Düfflipps, das Beileidschreiben des Königs, das Daniela übernahm. In München hatte sich auch Pöbel unter das Volk gemischt: es gab Leute, die durch die Fenster des Wagens, in dem sich Cosima befand, die Leidende sehen wollten. In Bayreuth wünschte sie den Sarg bis zur Beerdigung in ihrem Zimmer zu haben, was aber nicht gestattet werden konnte. Sie war so abgemagert, daß sie ihre beiden Eheringe verlor, die dann auf dem Fußboden ihres Zimmers gefunden wurden. Am Trauerzuge vom Bahnhofe durch die Stadt nahm sie nicht teil. Sie blieb auch unsichtbar, als die Einsegnung im Garten ihres Hauses vor sich ging. Fast alle Blumenspenden waren draußen zurückgeblieben und wurden später nach dem Festspielhause gebracht. Nur die beiden Kränze des Königs lagen auf dem Sarge: der eine, der schon in München überreicht worden, vom König an den Künstler; der zweite von Ludwig dem teuren Freunde. Es war wohl Cosimas eigener Wunsch gewesen, daß der Geistliche an der Grabstätte alle Beziehungen auf das Wirken und die Größe des Geschiedenen wegließ und vom Verstorbenen nur im Namen der christlichen Gemeinde und der Hinterbliebenen Abschied nahm. Die großen Reden waren schon früher gehalten worden. Einen ergreifenden Abschied von ihrem Herrn nahmen die beiden Hunde, Marke und Froh, die laut klagend die Kinder umschmeichelten und zu trösten suchten. Erst als alle Gäste sich entfernt hatten, verließ Cosima das Haus und stieg zum Sarge in die Gruft, ehe diese geschlossen wurde. Täglich weilte sie nun am Grabe. »Sie lebt«, schrieb Joukowsky am 20. Februar an Liszt, »sie lebt, das ist die Hauptsache; sie schläft ein wenig, sie nimmt täglich ein wenig Milch oder Rotwein; aber sie hat seit acht Tagen nichts gegessen. Sie sieht niemanden als ihre Kinder, mit denen sie ruhig, heiter und sanft verkehrt. Ich glaube, daß sie sich darein gefügt hat zu leben, und das ist mehr, als wir zu hoffen gewagt.«
Schon in Venedig war eine Drahtung Bülows eingetroffen: » Soeur, il faut vivre!« (Schwester, du mußt leben!) Zarter und inniger hätte er nicht sagen können, was sein Herz bewegte und was zu sagen ihn Pflicht dünkte. Was wir heute dabei denken, das hat er freilich noch nicht so meinen können. Er dachte vor allem an die Kinder und an das Gebot für die Mutter, sich dem Leben zu erhalten. Aber es berührt uns doch mächtig, daß die Mahnung an das Leben, das für Cosima noch so große Aufgaben bereit hielt und dem sie noch so vieles abzuringen hatte, zuerst von Bülow kam, der mit ihren künstlerischen Fähigkeiten am besten vertraut war und dem alles Künstlerische so sehr am Herzen lag.
Cosima selbst schien der Kunst Wagners, als wäre diese mit ihm gestorben, zunächst nur geringe Aufmerksamkeit zu schenken. Ihre erste tätige Sorge, als sie ihren Blick wieder nach außen richtete, galt den Briefen ihres Mannes, die weithin zerstreut waren und die jetzt durch das gangbare Sensationsbedürfnis hervorgelockt wurden. Nichts fürchtete sie mehr als Veröffentlichungen, die vielleicht willkommenen Stoff zu Mißverständnissen und Taktlosigkeiten gaben, und einen schwungvollen Handel mit wertvollen Zeugnissen, die ihr dadurch für immer entzogen werden konnten. So ließ sie durch ihre Kinder und durch Joukowsky den eigenen Vater bitten, ihr die an ihn gerichteten Briefe Wagners zu überlassen und alles vorzukehren, daß der ihm gehörige Druck der Wagnerischen Lebenserinnerungen nicht in fremde Hände falle. Ebenso erbat sie von ihm den handschriftlichen Entwurf zum »Jesus von Nazareth«, den er verwahrte. Es war dies der erste bedeutungsvolle Schritt auf dem Wege, den sie fortan mit großer Festigkeit weiterverfolgte: alle Briefe, deren Empfänger sie kannte, trachtete sie wenigstens in Abschriften zurückzugewinnen und scheute dabei keine Geldopfer. Auf diesem Wege ermöglichte sie die kostbaren Briefsammlungen, die im Laufe der Jahre in ihrem Auftrage oder mit ihrer Zustimmung veröffentlicht wurden, wobei sie streng darauf bedacht war, vorläufig alles zu unterdrücken, was Lebende kränken oder allzu Persönliches den Unberufenen preisgeben konnte. Auf diesem Wege ist das Archiv von Wahnfried allmählich zu seiner gegenwärtigen Bedeutung angewachsen.
Im übrigen lebte sie vorerst nur für die Kinder. Als diese sich mit Frau Marie von Groß an der Ostsee aufhielten, schrieb sie einmal an Siegfried: »Mein gesegnetes Kind! … Mit Engelstimmen möcht' ich es Dir, mein Teuerstes, sagen: Sei jeder Deiner Schritte gesegnet! Jedes Wort, jeder Atemzug! … Ach, mein Siegfried! Friede meines Herzens – Sieg der Liebe. Wie möcht' ich Dich anrufen, um meinem Herzen zu genügen, um mir es selber zu sagen, was Du mir bist. Gib meinen Gruß den Kindern, den Guten, Geliebtesten, schlaft süß, mein Segen ist über Euch ausgebreitet, mein ganzes Sein ist in diesem Segen aufgelöst. Nichts bin ich innen als Liebe zu Euch, nichts nach außen als Segen für Euch. O Kinder!, Kinder!« So ist ihr der Jüngste, der Sohn, erst vierzehnjährig, doch schon derjenige, der ihr am nächsten steht, dem sie sich anvertraut, der den Gruß an die anderen weiterzugeben hat. Im täglichen Umgang freilich war ihr die vierundzwanzigjährige Daniela die Nächste, und wenn sie mit der Welt draußen zu verkehren hatte, so war in allen nicht bloß geschäftlichen Angelegenheiten ihre Tochter die Mittlerin. Die zunehmende Schwäche ihrer Augen zwang sie auch immer mehr, das Schreiben zu unterlassen. Sie bediente sich bald nur noch der Hand Danielas, dann Jahrzehnte hindurch Evas, so daß die vielen Briefe, die sie noch hinaussandte und in denen ihr ganzes Herz und ihre ganze Weisheit beredten Ausdruck fand, meist nur ihren eigenhändigen Namenszug, sonst aber die Schrift der Genannten, dann und wann auch einer vertrauten Freundin oder Dienerin aufweisen. Ihrem Vater ließ sie anfänglich nur durch Daniela Nachrichten zukommen, und diese war bemüht, ihr Schweigen, ihre gewollte Einsamkeit zu erklären und zu rechtfertigen. Liszt bedurfte dessen nicht. Er schrieb zurück: »Deine Mutter hat das Genie des Herzens; ihr Verstand steht auf derselben Höhe. Ich verstehe, bewundere und liebe sie aus ganzer Seele.«
Der Vorrang Siegfrieds, als des einzigen männlichen Nachkommen und Haupterben Richard Wagners, mußte aber erst in aller Form gesichert werden. Die Ehe Cosimas mit Hans von Bülow war katholisch geschlossen worden, und sie selbst war sowohl zur Zeit ihrer Vermählung als auch noch zur Zeit der Scheidung Katholikin. Die Gültigkeit ihrer zweiten Ehe war daher nach den strengen Grundsätzen des katholischen Eherechtes und nach der Geltung dieser Grundsätze auch in manchen Staatsgesetzen keineswegs selbstverständlich. Das Amtsgericht Bayreuth, das die Verlassenschaftsabhandlung nach Wagner durchzuführen hatte, verfuhr mit der größten Gewissenhaftigkeit. Die zweite Ehe Cosimas war in der Schweiz geschlossen worden; später hatten Richard und Cosima die bayrische Staatsangehörigkeit erlangt. Früher aber war Wagner Sachse, Cosima Preußin gewesen. Es war also festzustellen, welches staatliche Recht hier maßgebend sei, ob alle förmlichen und sachlichen Voraussetzungen für eine gültige Wiedervermählung sowohl bei Cosima als auch bei ihrem zweiten Gatten gegeben waren, ob ihre erste Ehe, trotz der Scheidung, nicht etwa einer späteren Verheiratung – nach diesem oder jenem Landrecht – entgegenstand. Ein ziemlich verwickelter Fall, den das Gericht in einer mustergültig abgefaßten, auch dem Laien verständlichen Urteilsbegründung einwandfrei löste. Das Urteil ging dahin, daß die Ehe Cosimas mit Richard Wagner zu Recht bestanden habe, daß als einziges Kind aus dieser Ehe Siegfried anzusehen sei, da die noch vor der Scheidung geborenen Töchter Cosimas als Kinder Bülows zu gelten hätten, der gegen seine Vaterschaft niemals Einspruch erhoben hatte, und daß bei dem Umstande, als Wagner ohne Hinterlassung eines letzten Willens gestorben war, Cosima und Siegfried ihn zu gleichen Teilen beerben.
Gemäß diesem Urteile hat auch Bülow, dem es nicht einfiel, etwa hinterher die rechtmäßige Geburt der ihm zugesprochenen Töchter vor der Öffentlichkeit in Zweifel zu ziehen, Eva ausdrücklich als seine Tochter anerkannt. Am 13. Februar 1884 schrieb er an Adolf Groß, der im Auftrage Cosimas mit ihm wegen der rechtlichen Stellung der Töchter verhandelt hatte: »Ich fühle mich fähig, den Todestag des großen Meisters dadurch zu feiern, daß ich seine Tochter Eva als die meinige gelten lassen will. Vor Ablauf dieses ersten Vierteljahres werde ich das in Leipzig bei Frege ruhende Kapital meiner Kinder so weit erhöht haben, daß jedem der drei Geschwister, Daniela, Isolde, Eva, die Summe von 40 000 Mark sofort ausgehändigt werden kann, sobald es nach ihrem Dafürhalten auch vor deren Verehelichung die Umstände erheischen.« Blandine hatte schon anläßlich ihrer Heirat ihren Anteil erhalten. Das Abkommen hinsichtlich Evas wurde später geändert, da diese vor der Welt niemals als Tochter Bülows gegolten hatte. Auch Isolde ist in den mit Wissen und Willen des Hauses Wahnfried veröffentlichten Lebensbeschreibungen, so bei Glasenapp und bei Du Moulin Eckart, als Tochter Wagners genannt. Doch fällt ihre Geburt in die Zeit, in der zwar die Hinwendung Cosimas zu Wagner bereits in jedem Sinne vollzogen, ihre förmliche Trennung von Hans jedoch in keiner Weise angebahnt war. Bülow hielt sich für den Vater oder wollte der Vater sein, und niemals konnte es ihm etwa später beifallen, aus den tragischen Wirren der Münchner Jahre eine »sensationelle Affäre« zu machen. So sollte und durfte auch in aller Zukunft nie mehr an diesen Dingen gerüttelt werden. Da war nichts mehr zu ändern oder anzufechten. Auch handelte es sich äußersten Falles um Vermögensfragen, die aber kaum ins Gewicht fielen. Denn die Kinder waren gewöhnt, sich als eine Familie zu betrachten, und sind von ihrer Mutter und vom Bruder stets gleichmäßig behandelt worden.
Die von Jahr zu Jahr steigenden Einnahmen aus den Werken verbürgten dem Hause für lange Zeit Wohlstand und Ansehen. Aber nicht für immer. Groß, der gewissenhafte Vormund der Kinder, hielt die Einsparung eines angemessenen Vermögens für unbedingt nötig. Wagner hatte im letzten Jahrzehnte seines Lebens die verdiente Entschädigung für seine langen Entbehrungen mit genießerischem Behagen ausgekostet. Nunmehr war Einschränkung geboten, der Haushalt wurde wesentlich vereinfacht. Besonders wichtig aber erschien es der Vormundschaft, die Forderungen des Hauses pünktlich und unnachsichtig einzutreiben. Wagner hatte bei den Abmachungen mit den Verlegern und Vermittlern und bei der Durchführung der geschlossenen Verträge nicht selten Freundschaft und Gefälligkeit walten lassen und war darum manchmal übervorteilt worden. Jetzt wurde alles genau geregelt. Die Verwaltung der Festspiele aber und die Vermögensverwaltung waren streng voneinander getrennt. Die Spiele hatten sich selbst zu erhalten, und alle die bloße Erhaltung übersteigenden Mehreinnahmen hatten nur der Fortsetzung und Ausgestaltung des Unternehmens zu dienen. Die Familie Wagner hat auch in den schlimmsten Zeiten keinen Pfennig aus den Festspieleingängen je für sich verwendet. Groß, der Vorsitzende des Verwaltungsrates und zugleich der Beistand der Familie, hat die beiderseitigen Rechte mit beispielhafter Gewissenhaftigkeit, Umsicht und Tatkraft gewahrt. – Er bestand jetzt auch darauf, daß der »freie« Unterricht Siegfrieds aufzuhören und der Junge das Bayreuther Gymnasium zu besuchen habe.
Über die Zukunft der Festspiele ließ sich einstweilen noch nichts sagen. Die für das Jahr 1883 geplanten Aufführungen konnten jedenfalls stattfinden. Die Künstler waren bereits hierzu verpflichtet, die Teilnahme der Öffentlichkeit war durch den Tod Wagners nur gesteigert. Die Spiele galten diesmal als eine große Trauerfeier. Die künstlerische Oberleitung, im besonderen die Spielleitung, wurde dem Wiener Hofopernsänger Emil Scaria übertragen. Dieser hatte sich nicht nur in Wien als Hans Sachs und als Wotan hervorragend bewährt, sondern auch bei wiederholten Gelegenheiten die Aufmerksamkeit Wagners erregt und hätte schon 1876 mitgewirkt, wenn er nicht, in Verkennung des Bayreuther Geistes, zu hohe Geldforderungen gestellt hätte, die schon mit Rücksicht auf die anderen, bescheideneren Künstler nicht bewilligt werden konnten. Überhaupt hat Scaria, ein so großer Sänger und Künstler er auch war, ziemlich lange gebraucht, bis er die Gedanken Wagners erfaßte und die Art der Bayreuther Kunstübung begriff. Endlich aber ging ihm die rechte Erkenntnis auf, und seine Verkörperung der erhabenen und dabei so schlicht-menschlichen Gestalt des Gurnemanz im »Parsifal« 1882 war des Werkes und des Meisters in hohem Maße würdig. Überhaupt war die ganze sogenannte Wiener Besetzung (Winkelmann in der Titelrolle, die Materna als Kundry, Reichmann als Amfortas) künstlerisch sehr bedeutend und durchdrungen von einem wahren Feuer der Begeisterung. Auch die zweite Besetzung (Gudehus als Parsifal und die Malten als Kundry) wuchs immer mehr in den Geist des Werkes hinein. Nun handelte es sich darum, daß nichts vergessen werde, was Wagner vorgeschrieben und seinen Künstlern beigebracht hatte, daß auch die Wiederholung im Jahre 1883 das Werk in voller Lebendigkeit verwirkliche.
Hier waltete nun wieder die Bayreuther Vorsehung. Der Retter Bayreuths in diesem Jahre war Julius Kniese, der 1882 als Chorführer aus freiem Antriebe an sämtlichen Proben teilgenommen hatte, bewaffnet mit einem Klavierauszug, in den er alle mündlichen Vorschriften des Meisters sorgfältig eintrug. Er tat dies nur aus persönlichem Eifer, um mit dem Stile des Werkes und dem Willen seines Schöpfers völlig vertraut zu werden. Aber nun wußte er auch gründlich Bescheid. 1883 waren der Klavierauszug und noch mehr das lebendige Wissen Knieses der Kitt, der die zerfallenden Teile zusammenhielt. Levi war nur Musiker, nur Orchesterdirigent, und schon erlaubte er sich gegenüber dem Vorjahre manche Eigenmächtigkeit. Scaria hinwiederum war dem Amte eines Spielleiters nicht gewachsen. So bedeutend er selbst als Darsteller war, von den anderen verlangte er doch meist nur das, was den herkömmlichen Bühnengewohnheiten entsprach und eben dadurch nicht selten den Stil des Werkes verneinte. Kniese aber war mit seinem Klavierauszuge hinter allem her. Ungefragt und ungebeten – und ohne Widerspruch zu erfahren – übernahm er in gefährlichen Augenblicken die Probenleitung. Als Levi, um ihm sein Entgegenkommen zu zeigen, ihn einmal um sein Tempo der Chöre bat, erwiderte er in seiner äußerlich schroffen Weise: »Nicht mein Tempo, nicht Ihr Tempo, das Tempo!« So klar lebte in ihm das Bewußtsein des Richtigen und so leidenschaftlich war er von der Überzeugung durchdrungen, daß nur der Wille des Meisters im Festspielhause Geltung haben dürfe.
Der »Parsifal« als Trauerfeier war etwas, was auf die Mitwirkenden starken Eindruck machte. Sie waren alle bereit, ihr Bestes zu geben, und kamen auch bei den Aufführungen immer mehr in die rechte weihevolle Stimmung, in der das Werk seinen ursprünglichen Zauber übte. Bei den Proben aber fehlten der beherrschende Sinn und die gebietende Persönlichkeit des Meisters, sie wurden nach gewohnter Art als lästige Tagesarbeit erledigt, und immer mehr machte sich vor und hinter den Kulissen jener leichte, oberflächliche Sinn bemerkbar, der vom sonstigen Bühnenleben nicht zu trennen ist. Levi stimmte am sorglosesten in diesen Ton ein. Dazu kamen bedenkliche Äußerungen, die den nächstjährigen Festspielen Übles weissagten: »Den Ruhm, unter Wagner zu singen, haben wir nicht mehr, ungemütlich ist der Aufenthalt in Bayreuth, also lassen wir uns besser bezahlen.« – »Damit«, so sagte Kniese, »sind diese Leute wieder ganz auf ihrem alten Komödiantenstandpunkte angekommen, von dem Wagner gerade durch Bayreuth sie abzuziehen dachte.«
Kniese hat sehr unter all dem gelitten und in den Briefen an seine Frau aus seinen Wahrnehmungen und Befürchtungen kein Hehl gemacht. Zu deutlich sah er, daß ein überragender leitender Wille fehlte, ohne den im besten Falle eine gute Opernaufführung, aber niemals das zu erreichen war, was durch das Vorbild des Jahres 1882 mit dem Begriff des »Weihefestspiels« dauernd verknüpft bleiben sollte. Knapp vor dem Ende der Proben schrieb er: »Wie recht hat Frau Wagner, sich ganz auszuschließen und niemand mehr zu sehen. Das Ganze ist von Tag zu Tag gesunken, und nun stehen wir schließlich an dem schrecklichen Ziele der ganz gemeinen Komödienspielerei und unterscheiden uns vom Frankfurter Opernhaus durch ein paar bessere Solisten und einen virtuosen Mechanismus.« Er urteilte so streng wie Cosima im Jahre 1876 und war einer der wenigen, die den Gedanken des Festes, des Außerordentlichen, dem Alltag Entrückten, treu und rein bewahrten. Heckel in Mannheim war gleich ihm ein besonders heftiger Gegner des jüdischen Dirigenten. Aber Kniese hatte persönlich mit Levi zu tun. Seine Gegnerschaft war keine Erwägung, sondern eine Erfahrung. Unablässig verlangte er die Berufung eines Mannes, dem man vertrauen könne und dem sich alles willig unterordnen würde. Da kamen überhaupt nur zwei Männer in Betracht: Liszt und Bülow. Der erste war schon zu müde und zu sehr gealtert, lehnte aber auch die Zusammenarbeit mit Levi, gegen den er eine unverhohlene Abneigung hegte, rundweg ab. Der zweite wurde von Cosima abgelehnt, aus »ganz einfachen« Gründen, die auch Kniese ehrte und anerkannte. Dieser hatte nur die Genugtuung, daß man ihn gewähren ließ, daß er Einfluß auf die Solisten gewann, daß Scaria ihn immer auf der Bühne haben wollte. Zu Levi jedoch trat er in immer größeren Gegensatz.
Als die Aufführungen begannen, war für ihn die schlimmste Zeit vorüber, da er sich nicht für fähig hielt, noch länger mit Levi zu arbeiten. Anderseits erkannte er auch darin den Verfall des Bayreuther Geistes, daß Levi die Abhaltung weiterer Proben, während der Aufführungen, für überflüssig erklärte. Das war eben Opernbrauch: wenn eine Vorstellung einmal »saß«, dann »ging« sie. Die bis zuletzt nicht ruhende Arbeit sollte hingegen das Merkzeichen Bayreuths sein. Mit größter Besorgnis und wachsendem Unmut verfolgte Kniese den Gang der Festspiele.
»Die Darstellenden«, so schrieb er seiner Frau nach der ersten Aufführung, »fühlten sich im allgemeinen freier als voriges Jahr, wo sie Wagner mit seinen scharfen Augen fühlten. Nur ist diese Freiheit keine künstlerische …, sie ist nur der Übergang zur Komödienspielerei, Effekthascherei und Kulissenreißerei.« Einige Tage später meinte er: »Es wird hier doch besser, als es mir anfangs schien, gestern war die dritte Aufführung mit der ersten Besetzung, und Winkelmann und Materna brachten darin so schöne, freie Leistungen, wie ich es ihnen nicht zugetraut hätte. Es lernt eben eine Besetzung von der anderen, nicht aus innerem Bedürfnis, sondern sowohl aus einfachem theatralischem Nachahmungstrieb als auch aus ziemlich richtigem Verständnis für die vielen kleinen Effekte, aus denen für diese Theaterbande eine ganze künstlerische Leistung zusammengesetzt ist. All das wird dann ohne das Dazutun auch nur eines Ausführenden durch die unwiderstehliche Gewalt der Bewegung des Kunstwerkes an sich in ein poetisches Licht gestellt, daß der Zuhörer – selbst ich –, wenn er sich der Bewegung des Werkes hingibt und die Einzelheiten der Darstellenden nicht reflektierend vorüberziehen läßt, wirklich einen Kunstgenuß hat.« Aber wieder einige Tage später fand er, daß nichts besser geworden sei, daß sich immer mehr herausstelle, Levi könne nur das Orchester, nicht das Ganze beherrschen, und Scaria sei ungenügend für die Regie. Was die einzelnen Darsteller betraf, so beobachtete er ein immer stärkeres Hervortreten jener »unglaubwürdigen Natürlichkeit«, die Nietzsche 1876 so peinlich empfunden hatte. »Gestern, in der neunten Aufführung«, so schrieb er seiner Frau, »hat Scaria wieder neue Nuancen gemacht, die außerordentlich komisch sind: z. B. wenn er im letzten Akte Schild und Schwert des Parsifal in seine Hütte trägt, läßt er sich mühsam zitternd am Speer herab und richtet sich langsam an ihm wieder auf u. dgl. mehr.« Und am nächsten Tage: »Eine der interessantesten neuen Nuancen unserer Künstler … muß ich Dir noch Scherzes halber mitteilen: Im zweiten Akt hat die Materna zu singen: ›Ein Sünder sinkt mir in die Arme.‹ Bei dem Worte ›Arme‹ schlägt sie sich aber zweimal klatschend auf ihre starken Schenkel!«

Heinrich von Stein, Karl Friedrich Glasenapp und Hans von Wolzogen.
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Julius Kniese.
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Haus Wahnfried in Bayreuth.
Photo Paul Pretzsch

Grab Richard und Cosima Wagners im Garten des Hauses Wahnfried.
Photo Paul Pretzsch
Kurz, er gewahrte im ganzen wie in Kleinigkeiten eine »immer größere Kluft zwischen dem, was aus des Meisters Augen sah, aus seinem Munde sprach und aus seinem Kunstwerke klang, als er noch lebte, und dem was jetzt auf seiner Bühne vorgeht«. Nicht weniger aber war er von dem Benehmen der Künstler außerhalb der Bühne verstimmt. »Fuchs hat neulich den Amfortas ganz gut gesungen. Da er gelobt wurde, hat sich Reichmann so geärgert, daß er nicht mehr singen wollte.« Kein neuer Fall – und einer, der sich noch manchmal wiederholte. Er wurde auch diesmal, wie immer, beigelegt. Wo aber war der Meister als Befehlshaber? wo war Cosima, die Diplomatin? Mit beweglichen Worten stellte Kniese in einem Brief an Daniela die unbedingte Notwendigkeit dar, »daß ein tief-künstlerischer Wille alle Ausführenden in die Atmosphäre des Werkes banne und darin festhalte«. »Viele meinen, so schlimm sei es nicht. Aber das ist nur die Übertragung der Usancen des Gehenlassens, des Nichtsoschlimmgemeintseins, der liebenswürdigen Beschönigung und Indifferenz, wie sie in dem uns umgebenden allen geläufigen täglichen äußeren Leben, vielleicht um des lieben Friedens, angebracht sind, auf Gebiete, die himmelhoch von dem äußeren Leben entfernt liegen, die gar nichts mit ihm zu tun haben, auf Gebiete, zu denen Gott den Zutritt nur wenigen vergönnt hat, und in denen die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge so unendlich stark gezogen sind, daß die geringste Überschreitung derselben eine Sünde gegen den Hl. Geist wird, für die es keine Vergebung und keine Sühne gibt.« Wie einen tröstenden Wink von oben empfing Kniese die Nachricht, Daniela habe »die Hoffnung geäußert, daß es gar nicht unmöglich wäre, und daß Anzeichen dafür vorhanden wären, daß Frau Wagner wieder tätig mit eingreifen möchte, wenn auch nicht für jetzt, so doch für später«. Das war in seinen Augen das Beste, das einzig Mögliche. Es war aber nur eine Hoffnung. Cosima hatte sich über die Proben berichten lassen, doch jeden persönlichen Verkehr abgelehnt. Nur die Töchter waren zu sprechen. Die Mutter verharrte in ihrer Einsamkeit.
Der Fortgang der Festspiele stand einstweilen nicht in Frage. Mit dem Verleger des »Parsifal«, Schott in Mainz, war von Wagner ein Vertrag abgeschlossen worden, demgemäß nach der 45. Aufführung noch ein Betrag von 20 000 Mark auszuzahlen war. Diese Summe mußte der Familie unter allen Umständen zugute kommen, und so war man entschlossen, im ganzen 45 Aufführungen zustande zu bringen und daher auch im nächsten Jahre weiterzuspielen. Dann erst sollten die entscheidenden Beschlüsse gefaßt werden.
Noch im Dezember 1883 schrieb Liszt an die Fürstin: »Meine Tochter Cosima tut das Mögliche, um Wagner nicht zu überleben. Nach dem, was man mir erzählt – denn ich empfange und verlange keine direkten Nachrichten –, weilt sie trotz aller Abmahnungen täglich einige Stunden am Grabe Wagners.«
Beim »Parsifal« 1884 hätte man eine weitere Auflockerung und Veräußerlichung des Vorbildes erwarten können. Statt dessen gewahrte man Festigung und Verinnerlichung, vor allem Festigung: die richtigen Zeitmaße waren wiederhergestellt; die Chöre, deren Verwahrlosung Kniese schmerzlich empfunden hatte, klappten vorzüglich; jeder einzelne war sichtlich bestrebt, den Willen des Meisters zu befolgen. Aber auch Verinnerlichung: das Erlebnis war größer. Nicht nur weil die Sorgfalt der Ausführung allein schon eine tiefere Wirkung begründete; es war auch ein stärkerer seelischer Antrieb zu spüren. Woher kam das? Die Leitung und die Künstlerschaft waren dieselben wie im Vorjahre; Scaria war für das Spiel, Levi für das Musikalische verantwortlich; nur Kniese – fehlte. Sein Gegensatz zu Levi war immer deutlicher und dadurch störender geworden. Er selbst wäre nur wiedergekommen, wenn es möglich gewesen wäre, Liszt oder Bülow zu gewinnen. Von Levi hatte er genug. Und auch dieser wehrte sich gegen den ihm feindlichen Mitarbeiter. Er hat später einmal ausdrücklich an Kniese geschrieben: »Um mein und meines Stammes tragisches Verhältnis, an das ich nicht auch am Dirigentenpulte in Bayreuth erinnert sein will, wünsche ich nicht mehr, Ihnen in Bayreuth zu begegnen.«
Nun aber schien es auf einmal, als ob alle Mitwirkenden unter höherer Aufsicht stünden; als ob sie fühlten, daß das Auge des Meisters auf ihnen ruhe. Im Festspielhause war ein Verschlag gebaut worden, von dem aus sich ein Teil der Bühne überschauen ließ, ohne daß der darin verborgene von dem Ahnungslosen bemerkt werden konnte. Von diesem geheimen Sitze aus wohnte Cosima den Proben und den Aufführungen bei. In jeder Pause und am Schlusse ließ sie dem Dirigenten ihre Eindrücke und Ausstellungen auf Zetteln und losen Blättern zugehen. Diese Papiere oder doch einen Teil davon – die ursprüngliche Zahl läßt sich nicht feststellen – hat die bayrische Staatsbibliothek aus dem Nachlasse Levis erworben. Wer sie heute liest, der staunt über das Wissen und Können der Frau, die da über einen Fachmusiker wie Levi zu Gericht saß. Wie groß muß erst das Erstaunen Levis gewesen sein, der von diesen Zeugnissen ihrer Berufung zu einem solchen Richteramte völlig überrascht wurde und der auch sofort bemerken mußte, daß Cosima die Partitur im Kopfe hatte und mit dem Ohre die kleinsten Abweichungen von dem rechten Klangbilde wahrnahm; daß sie hörte wie ein Dirigent und die Ursachen einer mangelnden oder mangelhaften Wirkung mit unfehlbarer Sicherheit erkannte.
Wenn sie da und dort mehr Deutlichkeit oder größere Zartheit verlangte, wenn sie schrieb: »ein wenig zu schnell« oder: »nicht geradeswegs zu schnell, aber nahe daran« und ein andermal: »war zu gedehnt, woran wahrscheinlich die Bemerkung über die vorgestrige Probe schuld war«, wenn sie wünschte, es sollte etwas »verklärter« gespielt werden, wenn sie bemerkte, »Streicherläufe nicht immer rein«, »nicht geheimnisvoll genug, etwas platt«, »etwas eindruckslos« u. dgl. m., so konnten diese mehr den Eindruck des Hörers als die Art der Ausführung bezeichnenden Worte schließlich auch von einem mit dem Werke vertrauten musikalischen Laien geprägt werden. In den meisten Fällen aber beschränkte sie sich durchaus nicht auf die Feststellung ihres Eindrucks, bei der sie voraussetzen konnte, daß der Dirigent schon wissen werde, wie er die gewünschte bessere Wirkung zu erzielen habe; sondern sie gab gleich selbst die nötigen Winke und Weisungen.
So rühmt sie zwar das Orchester, tadelt jedoch gleichzeitig, mit dem Hinweis auf bestimmte Takte, ein zu wenig eindrucksvolles Spiel, meint aber: »nicht Tempo-Änderung, sondern feinere und schärfere Akzentuierung der Noten, vornehmlich der Sechzehntel und der Triolen«. Sie findet, »daß Tempo und Vortrag immer richtig wurde, aber es wurde und sollte doch von vornherein bestimmt aufgestellt sein, sprechend und entscheidend«. Sie stellt einmal zufrieden fest, daß das erste Achtel vom vierten Takte des Vorspieles mit »Ehrerbietung« gespielt wurde; »ehrerbietig« seien aber auch die Akkorde der Bläser an genau bezeichneten Stellen zu spielen. Für besonders wichtig erklärt sie, »daß die Motive seitens der Bläser und der Streicher gleichmäßig vorgetragen würden (daß der Wert der Noten nämlich in gleicher Weise beachtet würde). Das Melodische der Themen wird seitens der verschiedenen Instrumente zuweilen verschieden aufgefaßt.« Dann heißt es: »Die Mordente zu erklären fällt etwas schwer, vielleicht liegt alles hier in der Bedeutung der ersten und letzten Note, die erste gut eingestellt, die letzte als zarter Übergang zu der thematischen Note; aber alles unauffällig.« Sie vermerkt, daß die Musik zur Wandeldekoration in der dritten Aufführung schneller war als früher, und meint dazu, das schnellere Tempo sei »nicht absolut unrichtig, aber dann soll es auch festgestellt werden«; und die Dehnung hernach sei zu plötzlich gekommen, nicht allmählich genug. Von besonderer Feinhörigkeit und tiefer Erkenntnis eines mustergültigen Vortrages zeugt ihre Beobachtung, daß eine Stelle ein wenig anders klang, wenn das Orchester allein spielte, und wenn die Sänger mitsangen; »letzteres erschien das Richtigere«. Ebenso zu einer anderen Stelle: »immer ein kleines Schwanken zwischen Tempo der Chöre und des Orchesters, sie finden sich zurecht, aber die Chöre erscheinen nicht gestützt.« Noch einige Beispiele seien angeführt, aus denen hervorgeht, wie sie auf jede Kleinigkeit achtete und den geringsten Abstufungen des Vortrages Bedeutung beilegte: »Womöglich zarter und die Pauken nicht so schwer«, »Eintritt der Flöten zarter!«, »Achtel und Sechzehntel durchwegs melodisch behandeln«, »das letzte Sechzehntel des Crescendo!«, »Übergangsarten und Übergänge, überhaupt das vermittelnde Element, vielleicht noch mehr zu beachten«.
Über diese mehr theoretisch klingenden Forderungen hinaus, die erst von den Ausführenden in die tönende Wirklichkeit übertragen werden müssen, erweist sie zugleich ihren praktischen Sinn und die Schulung, die sie an der Seite ihres Mannes genossen hat, indem sie beispielsweise zum Schlusse einer Probe ausdrücklich bittet: »wenn der Sänger etwas pathetisch Angreifendes zu singen hat, es ihn des Orchesters wegen nicht wiederholen zu lassen, sondern das Orchester allein.« Cosima verlangt »genaueste Korrektheit und unerschütterliche Sicherheit« als Frucht des begeisterten Studiums; um diese zu erzielen und zu bewahren, verlangt sie aber auch, noch während der Aufführungen, für diese und für jene Stelle Einzelproben der Hörner, der Bratschen, der Bässe usw. Sehr wichtig ist es ihr, daß man den Sänger genau verstehe. Darum rühmt sie die »zartfühlende Diskretion in der Begleitung«, wenn dies tatsächlich erreicht worden, und überhaupt spart sie nicht mit Lob und Dank. Sie lobt die Blumenmädchen, sie dankt dem Orchester für »die immer wachsende Vervollkommnung der Leistung« und für »das Anhalten des Eifers und der Wacherhaltung der Begeisterung«; ihre »gewiß häufig ungenügend klar bekundeten Wünsche« sind mit »Divination« »bis auf den geringsten Wink erkannt und erfüllt worden«. Sie bittet auch Levi, er solle einzelnen Instrumentalisten danken, die sich besonders um die »Hebung des Vortrages« verdient gemacht haben. Eine strengere Überwachung, eine wirksamere Hilfe, eine herzlichere Anerkennung konnte dem Dirigenten nicht zuteil werden.
Diese Zettel, die also nur für den Dirigenten bestimmt waren, enthalten aber auch fortlaufende Hinweise auf die mit anderen Bemerkungen versehenen Partituren und Klavierauszüge; und diese waren auch für die Sänger, den Spielleiter und den Chorführer bestimmt. Ein solcher Klavierauszug ist in der Wagner-Gedenkstätte in Bayreuth vorhanden. Er stammt von Glasenapp, der ihn am 31. August 1882 dem Meister überließ mit der Inschrift: »Wir beneiden unseren Klavierauszug um sein glückliches Los!! (Jedem ist's verwehrt!) Gl.« In diesem Auszuge hat Cosima 1884 ihre Eindrücke und Wünsche bei den Proben und der ersten Aufführung ausführlich vermerkt. Sie ließ sich nichts entgehen, sie beachtete das Schauspielerische, das Gesangliche, das Instrumentale, das rein Musikalische, und sie sah es mit einem Blick und von dem Standorte, den Wagner einzunehmen pflegte: zwischen der Bühne und dem Orchester, über dem Ganzen.
Es wird Aufgabe der Wissenschaft sein, die Klavierauszüge, die Cosima in solcher Weise benutzte, und die Notizbücher, in denen sie die von ihr geleiteten Aufführungen mit den nötigen Bemerkungen versah, getreu herauszugeben und uns so eine Bayreuther Dramaturgie zu schenken, die nicht nur für die Opernbühnen von größtem Nutzen wäre, sondern auch die Werke selbst und die Kunst des Meisters in vielem noch besonders erhellen würde. Hier können nur Beispiele gegeben werden. Aber sie müssen gegeben werden, auf die Gefahr hin, daß mancher diese Seite unseres Gegenstandes als zu lehrhaft-trocken empfinde. Denn nur wenn wir eine genügende Vorstellung von der Künstlerschaft Cosimas und von ihrer unermüdlichen Hingebung an ihre künstlerischen Aufgaben gewonnen haben, können wir ihr Wirken in seinem vollen Umfange begreifen und ihrer Persönlichkeit ganz gerecht werden.
In dem erwähnten Auszuge finden wir zunächst die allgemeinen Urteile: »sehr schön«, »sehr gut«, »etwas gedehnt«, »es war etwas zu schnell«, »war etwas verschwommen«, »vier Hörner schön«, »Orchester zu stark«, »nicht recht präzise« u. dgl. m. Urteile, die jeder Musikverständige fällen könnte, die aber hier durch die Persönlichkeit, die hinter den Urteilen steckt, und durch den Zweck der Beurteilung besonderes Gewicht erhalten. Viele Bemerkungen enthalten einen Wunsch, eine Forderung, einen guten Rat, etwa so, wie ein nicht heftiger, kameradschaftlich fühlender Dirigent zu seinem Orchester spricht. Hier sind es aber Aufträge und Ratschläge für den Dirigenten selbst. Auch den Sängern werden Ratschläge erteilt oder sie werden durch Lob und Anerkennung ermuntert. Da der Klavierauszug auch für die zweite Aufführung benutzt wurde, sind viele Bemerkungen, namentlich solche Wünsche, die dann pünktlich befolgt wurden, später wieder durchgestrichen, manchmal mit dem ausdrücklichen Beisatze, daß nun alles richtig und in Ordnung sei. Aber sie sind nur durchgestrichen, nicht etwa ausgelöscht oder unkenntlich gemacht, so daß der in ihnen ausgesprochene Gedanke, die grundsätzliche Forderung immer gewahrt bleibt. Ein solcher durchgestrichener Satz lautet: »Beim Vortrag dieser Figur« (nämlich der zweiten Hälfte des zweiten Taktes vom Gralsthema) »wäre vielleicht alles gewonnen, wenn der ersten Note ihr ganzer Wert immer gegeben würde (durchaus aber kein Schleppen, nur richtiger Wert).« Beim Abzug der Knappen im ersten Aufzuge heißt es: »Fest im Marschtempo, damit der Gang der Knappen sehr rhythmisch sei«; »muß durchaus fester und schneller genommen werden«; »kein ritardando bei den Triolen, wenn sie auch zart sein sollen«. Dies ist durchgestrichen und später darübergeschrieben: »Orchester war viel, viel besser; soll Glocken nicht beachten. Die waren aber auch viel besser.« Den Sängern werden überflüssige oder unpassende Gebärden ausgestellt. So gelten dem Klingsor im zweiten Aufzuge folgende Bemerkungen: »Keine Geste bei ›Herodias‹«; »gut im Gesang und im Vortrag, aber dreimal dieselbe Gebärde.« Kundry wird auch über den richtigen Vortrag belehrt. Zu ihrem ersten Ruf an Parsifal: »Etwas zu gewaltig«; später: »klangvoller«; zu den Worten »Ihr kindischen Buhlen, weichet von ihm«: »nicht stoßen im Ton, noch heftig im Wort«. Wenn dann Parsifal fragt: »Riefest du mich Namenlosen?« – bemerkt Cosima: »auch hier der Akzent sehr richtig, nur vielleicht etwas mehr Ton, ›Namenlosen‹ weich, es muß sehr rührend klingen«. So geht sie jedem Takt, jeder melodischen Wendung nach. Einmal schreibt sie: »Dieses erste Achtel klang hier beinahe wie ein Sechzehntel, nachher« (bei der Wiederholung) »war es gut«. Wir lesen ferner: »›Sein Blick‹ geheimnisvoller, nicht so scharf«; »Parsifal zu häufig zu Kundry tretend«; »enteilender Parsifal gewaltiger«; »Bewegung der Kundry etwas zu spät«. Am Schlusse des Aufzuges aber wird vermerkt: »Parsifal und Kundry über jedes Lob herrlich.« Im dritten Aufzuge erhält Gurnemanz den Rat: »Noch weniger in das Publikum singen, mehr zu Parsifal.« Dabei wird den vielen ausdrucksvollen Orchesterzwischenspielen besondere Beachtung geschenkt. Zu einem Viertel wird geschrieben: »Kein Sechzehntel daraus machen.« Dann: »Rhythmus der Celli genau mit den Violinen.« Zur zweiten Hälfte des ersten Taktes vom Gralsthema: »Mehr piano die zweite Note.« Später: »Diese Achtel nicht unbedeutend, wenn auch immer zart fließend.« »Erste Note der Figur.« Manchmal tadelt sie ein Piano, das »unhörbar« geworden. Aber nicht das Orchester als solches, sondern namentlich seine Verbindung mit dem Gesange ist Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit. Dem Sänger gesteht sie eine gewisse Freiheit und Selbständigkeit zu. Das Orchester hat in vielen Fällen nur zu begleiten. Einmal heißt es: »Hier möchte eine Verständigung mit dem Sänger stattfinden; es schien gestern, als ob er wieder etwas gedrängt würde.« Zum Karfreitagszauber: »Die Oboe sehr schön, könnte vielleicht ( im Verlauf) nicht ganz so leise sein, der Gesang wird dadurch etwas beeinträchtigt. Eine Schattierung.« Hierauf: »Die Linie des crescendo schön allmählich, damit keine Plötzlichkeit entsteht.« Dem Sänger wird auch mancher Wink gegeben: »Zart, nicht leichtfertig im Vortrag«; »war ein wenig rauh«; »schönere Bindung«. Dann aber muß das Orchester bei der Wiederkehr des Hauptmotivs sich sagen lassen: »Im forte ebenso vorgetragen wie im piano (Wert der Noten).«
Es versteht sich von selbst, daß Worte und Aussprache nicht weniger beachtet werden als das rein Gesangliche. Immer dringt sie auf Deutlichkeit und auf Sprachrichtigkeit. Nie darf der Sinn eines Wortes, aber auch nie der klangliche Wert einer Silbe verlorengehen. Der Wortlaut der Dichtung muß streng gewahrt sein. Zum Liebesmahlspruche schreibt sie: »Sehr schön, aber nicht gedenk et, sondern gedenkt.« Dann einmal für Klingsor: »denn, nicht dehn«. Im dritten Aufzuge verbessert sie einen Druckfehler. Es muß heißen: »bar jeder Wehr«, statt »Gefahr«. So ist sie fortwährend Orchesterdirigent, Gesangsmeister, Dramaturg und Philologe in einem. Nach einer der beiden Aufführungen schreibt sie zum zweiten Aufzuge: »Das minder Gute in diesem Akte, leider dem Gedächtnis entfallen, woran es lag.« Auf der letzten Seite lesen wir die »Schlußbemerkung: daß im ganzen das Piano der Instrumente immer etwas unbedeutend, nichtssagend klingt. Es ist, als ob die mangelnde Technik sich mit dem leisen Ton genügte und gar nicht das Gefühlvollere anstrebte. (Dies allgemeinhin.)« Aber diese Bemerkung ist durchgestrichen. Ihr Wink war verstanden, das Piano war gefühlvoller geworden, und blieb doch auch, ihrer Forderung gemäß, vollkommen hörbar.
Bei der dritten Aufführung benützte Cosima einen anderen Klavierauszug, da der erste vollgeschrieben war. Der zweite, den die Nachkommen Julius Knieses als ein kostbares Erbstück bewahren, enthält dessen Eintragungen vom Jahre 1882, also, wie es auf der Rückseite des Titelblattes heißt, die »musikalisch- und szenisch-dramaturgischen Anordnungen des Meisters nach eigenen Unterweisungen während der Probe- und Aufführungszeit«. Kniese hat drei Klavierauszüge mit denselben Eintragungen versehen. Zwei davon sind später verschwunden. Der noch vorliegende enthält außer den Bemerkungen Cosimas vom Jahre 1884 auch solche von anderer Hand, anscheinend von Mottl und von Levi, ist also offenbar im Verlauf der Jahre wiederholt benutzt worden, da er eben die bedeutsamen Anordnungen des Meisters enthielt. Diese zeigen uns, wie lebendig, wie anschaulich Wagner zu seinen Künstlern gesprochen hat. Er läßt sie in die Seele der Dichtung blicken und befähigt sie so, von innen heraus die rechte Darstellung zu finden. Zu Amfortas im ersten Aufzuge sagte er: »Ein König spricht niemals schnell.« Von Kundry: »Sie hat von ihrem Verhältnis zu Amfortas kein Bewußtsein. Dieses kommt ihr nur im zweiten Akt bei den Worten: zeigest du zu Amfortas mir den Weg.« Demgemäß lesen wir im zweiten Aufzuge bei eben diesen Worten: »Hier liegt der Wendepunkt der ganzen Entwicklung. Kundry hat entsetzt zurückzuweichen: kommst du mir mit dem?« Zum Zwiegespräche Klingsors mit Kundry zu Beginn des zweiten Aufzuges bemerkt Wagner: »Klingsor in natürlicher Rede den Effekt aufbauen, wie wenn der Teufel losgehen solle! Kundry wie ein armes Tier, das zur Schlachtbank muß.« Kundrys Worte zu Parsifal: »Die Liebe lerne kennen, die Gamuret umschloß« usw. sind »sanft, ohne Affekt, mit Expansion« zu bringen. Zu Parsifals Worten »Mit diesem Zeichen bann' ich deinen Zauber« wird ausdrücklich bemerkt, unter dem Zeichen sei der Speer gemeint, nicht das Kreuz, das mit ihm zu schlagen ist. Die Erläuterung gilt nicht einem nachdenklichen Leser, sondern vielmehr dem Darsteller, der, sobald er dies weiß, das Kreuz nicht zu früh schlagen und den Speer bei den angeführten Worten gebieterisch emporstrecken wird. Im dritten Aufzug wandte Wagner sein Augenmerk vor allem auf Kundry. Der Schrei, den sie beim Erwachen ausstößt, ist nur ein »Schrei des Erwachens, nicht des Erschreckens über Gurnemanz«. »Kundry ist ohne jede Erinnerung an früher.« Sie »erhebt sich wie eine verschlafene Magd und macht sich ohne Rücksicht auf Gurnemanz, als ob sie ihn alle Tage gesehen hätte, an ihrer Kleidung zu schaffen usw.« Beim stummen Gebete Parsifals vor dem Speere scheint ihr verklärter Blick zu sagen: »das ist der, den du gesucht hast.« Kniese bemerkt hierzu: »Parsifal im Gebet en face. So hat es der Meister selbst gezeigt. Die Profilstellung ist eine eingeschmuggelte Komödiantenpose.« Wer die späteren Vorstellungen gesehen hat, der weiß nichts von einer Profilstellung. Die Eintragung Knieses beweist demnach, daß der »Parsifal« von 1883 tatsächlich durch Abweichungen von der ausdrücklichen Vorschrift entstellt war. Die Vorschriften bezogen sich aber nicht nur auf das Darstellerische. Auch dem Dirigenten gab der Meister praktische Hilfen, so wenn er beim Blumenmädchen-Chor sagte: »Nicht Viertel, sondern Ganze schlagen, um das Tempo zu halten.« Den Sängern gewährte er willig kleine Erleichterungen.
Die Bemerkungen Cosimas sind in diesem Auszuge besonders reich an warmem Lob für die Darsteller. Ihr Einfluß hat bereits sehr stark gewirkt. Auch diesmal betreffen ihre Wünsche und Ausstellungen vor allem einzelne Gebärden und die Übereinstimmung des Gesanges mit dem Orchester. Dieses darf nie zu laut sein und muß immer mit dem Sänger gehen – natürlich vorausgesetzt, daß der Sänger seine Rolle im Sinne des Meisters beherrscht. Zu Klingsors zweimaligem Ausrufe »Furchtbare Not!« bemerkt sie: » nicht sentimental!« Wagner würde hinzugesetzt haben: der Teufel ist nicht sentimental. Eine Hauptsorge Cosimas ist immer wieder das Gralsthema. Das eine Mal heißt es: »letztes Achtel länger«, das andere Mal: »bei dieser Figur ja keine Gleichgültigkeit eintreten lassen (wenn auch immer im Tempo) und ohne auffälligen Akzent Feinheit im Vortrag.« Wenn Gurnemanz den Karfreitagszauber besingt, durch den die entsündigte Natur ihren Unschuldstag erwirbt, muß Kundry bei den Worten »entsündigte Natur« langsam das Haupt heben und zu Parsifal emporblicken. Man weiß, daß dies in allen späteren Aufführungen so gemacht wurde, und es bleibt nur die Frage offen, ob die ausdrucksvolle und vielsagende Gebärde Kundrys von Wagner selbst oder erst von Cosima festgelegt wurde. Im allgemeinen finden wir bei den Vorschriften Cosimas eine Vereinfachung des Gebärdenspiels gegenüber den Vorschriften Wagners. Doch gibt es da keine starren Grundsätze. Aus vielen Bemerkungen Cosimas zu anderen Vorstellungen mit anderen Darstellern geht deutlich hervor, daß stets auch die Eigenart des Sängers und die Ausdrucksmittel, über die er verfügte, in die Form des Ganzen mit einbezogen wurden. Wer je daran zweifeln konnte, daß es unter Cosima keinen Drill gab, daß jede Wiederholung und jede neue Rollenbesetzung auch wieder ein neues inneres Erleben des Darzustellenden zur Voraussetzung hatte, der wird durch die Klavierauszüge und Notizbücher in der rechten Weise belehrt. Dem Kundigen offenbart sich hier das frei Schöpferische, das Cosima in sich trug und, »soweit die vorhandenen Kräfte reichten«, auch von den Mitwirkenden verlangte.
Der Eindruck auf die zahlreichen deutschen und fremden Besucher war denn auch außerordentlich. Besonders aber die bewährten Stammgäste und alten treuen Freunde spürten das Neue und Große in diesen Darbietungen, ohne zu wissen, daß Cosima buchstäblich über jeder Note und über jeder Silbe wachte. Zu den Besuchern zählten diesmal Franz Liszt und – Hans von Bülow. Für die Außenwelt war Cosima noch immer unsichtbar und unzugänglich. Auch ihren Vater hat sie in diesem Jahre noch nicht wieder begrüßt. Nur einmal während einer Probe kam es im Dunkel des Bühnenraumes zu einer zufälligen kurzen Begegnung. Bülow, der unbemerkt bleiben wollte, verkehrte – außer mit Daniela – nur mit Blandine, die ihn schon in Meiningen mit ihrem Gatten und ihrem Söhnchen Manfred besucht hatte. Cosima war – nach einem Worte Liszts – noch immer »eingehüllt in ihre Trauer«.
Aber ihr tätiger Anteil an den Festspielen, für die sie sich nun verantwortlich fühlte, war schon ein Erwachen zu neuem Leben. Die Mahnungen Knieses, die Bitten der Töchter hatten deshalb gefruchtet, weil auch in ihr selbst der Lebensdrang sich regte – und das Leben war, wenn sie den engen Bezirk ihres Hauses verließ, für sie einzig die Kunst Wagners. Daß sie wußte, was Leben sei und daß es auch noch andere Ziele und Aufgaben gebe, hatte sie als Mutter bewiesen. In ihrem tiefsten Schmerze hatte sie nie verlangt, daß auch die Kinder entsagen sollten. Immer hatte sie dafür gesorgt, daß diese in angemessener Freiheit sich entwickeln und betätigen konnten. Sie nahm auch in jeder Weise Anteil an dem Seelenleben und an dem Schicksale ihrer Kinder, und die Verlobung Danielas mit Fritz Brandt, dem Sohne und Nachfolger Karl Brandts, hat sie zuerst freudig erregt, die baldige Lösung dieses Verhältnisses um so heftiger geschmerzt. Das Verschulden lag durchaus auf seiten Brandts. Cosima hatte nicht nur die Enttäuschung ihrer Tochter zu beklagen, sondern auch ihr eigenes Vertrauen zu einem unwürdigen Manne. In dem Widerstreite Knieses und Levis hatte Brandt eine unredliche und verhetzende Rolle gespielt. Daß dies alles Cosima innerlich beschäftigte und oft stark beunruhigte, das war schon die Gesundung, das Erwachen. Die Erde hatte sie wieder.
Die Hausfrau, die Mutter, die Hüterin und Mehrerin des Archivs war also auch die Leiterin der Festspiele geworden. Ohne sie war Bayreuth jetzt nicht mehr zu denken. Sie hatte zu bestimmen, welche Bahn einzuschlagen sei, und kein weiterer Schritt auf der neuen Bahn durfte unternommen werden ohne ihre Führung. Der Verwaltungsrat wünschte die Unterbrechung im nächsten Jahre, aus wohlerwogenen wirtschaftlichen Gründen. Cosima, der alljährliche Festspiele vorschwebten, war unter der Bedingung damit einverstanden, daß im übernächsten Jahre 1886 neben »Parsifal« auch »Tristan und Isolde« gegeben werde. Immer klarer erkannte sie die Sendung, die ihr aufgetragen war: nicht nur die Festspiele zu erhalten, nicht nur dem »Parsifal« sein Sonderrecht im Reiche der Kunst und Bühne für immer zu wahren, sondern auch die übrigen Werke allmählich dem Festspielplane einzufügen.
Wenn sie sich nun vorerst für »Tristan und Isolde« entschied, so trafen da ihre persönliche Neigung und eine sachliche Erwägung zusammen. Sie selbst hatte von diesem Werke den weitaus stärksten Eindruck empfangen. Durch die Dichtung war sie einst in Zürich an Wagner gefesselt worden; die Aufführung des vollendeten Werkes in München war die erste große Kunsttat Wagners gewesen, an der sie persönlich mitbeteiligt war. Die tragische Handlung erschien ihr stets wie ein Sinnbild ihres eigenen Schicksals; Anklänge an die Dichtung kehren in ihrem Tagebuche immer wieder. Mit der Sehnsucht nach einem neuen Erlebnisse des Werkes auf der Bühne verband sich aber auch das Gefühl der Verpflichtung, für eine solche Wiederbelebung zu sorgen. Denn eben dieses Werk war bisher am wenigsten bekannt und verbreitet, und seit München war es noch nie und nirgends so aufgeführt worden, wie es dem Willen des Meisters annähernd entsprochen hätte. Dazu kam die Erwägung, daß es keine szenischen Wunder und nur wenige Darsteller verlangte, daß mit Rücksicht auf die gebotene Sparsamkeit diese Aufführung am ehesten gewagt werden konnte. Der Kostenpunkt und die leichteren und bequemeren Vorbereitungen gaben denn auch beim Verwaltungsrate den Ausschlag. So war Cosima entschlossen, der Welt zu zeigen, daß der Wille des Meisters noch lebendig war. Sie stellte gleichsam von neuem die Meisterfrage, ob auch der Wille des Volkes, der Allgemeinheit ihm entgegenkomme. »Wenn Sie wollen, so haben wir eine Kunst.«
Das Jahr 1886 war vielleicht das bedeutungsvollste in der Geschichte Bayreuths. Der »Ring« 1876 war ein Versuch gewesen. Das Werk hatte sich inzwischen die deutschen Bühnen erobert und weckte allenthalben Begeisterung. Die Wichtigkeit oder Unentbehrlichkeit der Festspiele konnte noch nicht von jedermann begriffen werden. Der »Parsifal« hinwiederum war etwas Einmaliges, nur für sich Bestehendes, das keine Vergleiche zuließ. Dieses Werk und die Festspiele waren allerdings untrennbar verknüpft, aber der Begriff Bayreuth schien damit auch erschöpft zu sein. Die anderen Werke blieben nach wie vor schutzlos dem herkömmlichen Betriebe preisgegeben. Da kam 1886: »Parsifal« und »Tristan und Isolde«!
Zwei ganz verschiedene Aufgaben. Die Verschiedenheit, ja Gegensätzlichkeit tritt uns schon entgegen, wenn wir nur die beiden männlichen Titelrollen ins Auge fassen. Die des Parsifal kann eigentlich kein begabter und verständiger Künstler um ihre ureigene Wirkung bringen; die des Tristan wird immer nur durch die höchste Anspannung persönlicher Willens- und Gestaltungskraft den von ihrem Schöpfer gedachten übergewaltigen Umriß erlangen. Beim Parsifal ist gerade der Umriß zuerst und am sichersten da; es kann sich dann nur noch um die stärkere oder blässere Farbe handeln, womit er ausgefüllt wird. Beim Tristan herrscht die Farbe, das Gefühlsmäßige. Der Parsifal erinnert an kirchliche Wandmalereien; mit der einfachsten, weithin sichtbaren Gebärde ist das Wesentliche getroffen. Die Gestalt des Tristan, dem ersten Blick unter der verwirrenden Fülle schimmernder Töne, klingenden Glanzes verborgen, wird nur durch die feinste Abstufung des Tongewebes, die behutsamste Verteilung von Licht und Schatten allmählich sichtbar. Nicht bloß an den Sänger, der jedes erschütternden Ausdruckes fähig sein muß, auch an den denkenden Künstler werden hier die ungewöhnlichsten Forderungen gestellt. Dazu muß sich ein Orchesterleiter gesellen, der imstande ist, den Reichtum der Musik nicht nur als einen üppigen Faltenwurf, als die prangende Hülle des dramatischen Leibes empfinden zu lassen. Dieser darf niemals musikalisch verdeckt werden; wohl aber gewinnt er seine erhabene Form erst durch die dramatische Sinfonie, die so gern für sich allein betrachtet wird, als hehrste Schöpfung des Musikers Wagner, indessen sie Ton- Dichtung sein will, tönende Seelenbewegung, in der die ganze Handlung beschlossen ist; was davon auf der Bühne zu sehen ist, das ist nur ihr Abbild, ihr Gleichnis. Und doch soll eben dieses Bild uns am stärksten fesseln, doch sollen wir unsere Aufmerksamkeit der Handlung und nicht der Musik zuwenden. Wenn dies – in unserer schwerfälligen Begriffssprache – einen Widerspruch zu bedeuten scheint, wenn Wagner hier, wo die Handlung die einfachste und die Musik die überschwenglichste unter allen seinen Werken ist, seine Theorie von einer neuen dramatisch-musikalischen Form nicht so sehr erfüllt, als vielmehr, nach seinem eigenen Ausspruche, »weit überflügelt« hat, wenn dieses Werk also in jeder Hinsicht eine Ausnahmestellung einnimmt und von der strebsamsten Bühne, die täglich arbeitet und ihre Künstler abwechselnd zu den verschiedenartigsten Zwecken brauchen (oder mißbrauchen) muß, nie völlig bewältigt werden kann – in Bayreuth, wo die Arbeit von zwei Sommern neben dem schon errungenen »Parsifal« nun einzig und allein dieser neuen Eroberung galt, in Bayreuth wenigstens konnte und mußte das einzigartige Gepräge des Werkes rein und groß, unentstellt, hervortreten.
Dort war vor allem eines gegeben, woran Wagner bei der Schöpfung des Werkes noch gar nicht gedacht hatte und was wir heute, fast ebenso wie beim »Parsifal«, als unentbehrlich betrachten möchten zur rechten Darstellung von »Tristan und Isolde«: das unsichtbare Orchester, wenn Wagner von der Entstehung des Werkes sagt: »Mit voller Zuversicht versenkte ich mich hier nur noch in die Tiefen der inneren Seelenvorgänge und gestaltete zaglos aus diesem intimsten Zentrum der Welt ihre äußere Form … Die ganze ergreifende Handlung kommt nur dadurch zum Vorschein, daß die innerste Seele sie fordert, und sie tritt so an das Licht, wie sie von innen aus vorgebildet ist« – so kann dies überhaupt nur verstanden und empfunden werden, indem jede Erinnerung an eine musikalische Vorführung, an eine bewußte Kunstleistung getilgt ist, indem die Musik nicht mehr von einem bestimmten Platze aus zu uns spricht, sondern vielmehr in uns selbst lebt, zum Klingen unserer eigenen Seele wird. Und dies ist in Bayreuth der Fall: wir sehen keine Musik und hören sie darum auch ganz anders; indem das Auge nur der Bühne zugewandt ist, das Ohr jedes Wort des Sängers deutlich vernimmt, die Tonwogen wie ein Luftmeer, das Zuschauer und Darsteller gemeinsam atmen, den Raum erfüllen, tritt das Drama von selbst in seine Rechte. Das enthebt den Orchesterleiter nicht seiner höchsten Verantwortlichkeit. Unsere durch die Musik erregte und in ihr sich verströmende Seele darf niemals durch eine musikalische Unzulänglichkeit gehemmt und ernüchtert werden. Da war denn auch das Jahr 1886 ein unerhörter Glücksfall. Am Dirigentenpulte saß Felix Mottl, der schon in Karlsruhe als Nachfolger Levis bedeutsame Proben seiner außerordentlichen Fähigkeit abgelegt hatte, der aber nun erst, im mystischen Abgrunde des Bayreuther Orchesters, ungesehen und auf dem Zettel nicht genannt, seine Größe offenbarte und seinen Ruhm begründete. Zärtlicher, feuriger, inniger, überschwenglicher ist das Hohelied der Liebe nie erklungen. Aber auch mit welcher Meisterschaft der Abtönung, der Übergänge und des Farbenwechsels und der rhythmischen Gliederung! Und so sehr dies alles reinste Kunst war, reinste tönende Form, waltete doch nirgends bloß musikalisches Belieben. Jedes kleinste Teilchen der Partitur wurde zum Atemzuge der Handlung. Form und Inhalt waren nicht zu trennen. Die Musik war das Drama.
Die Handlung auf der Bühne aber war auch ganz die Musik; eben die Musik, die gleichzeitig erklang, wenn man sich nicht scheut, Lebendiges im Worte zu fassen, die Worte begrifflich zuzuspitzen und so mehr dem Zwange des Denkens als der Unmittelbarkeit des Gefühles zu gehorchen, so kann man sagen: da war nicht eine Handbewegung, nicht ein Augenaufschlag, die zu einer anderen Musik gepaßt hätten. Haltung und Gebärden der Darstellenden versinnlichten in jedem Augenblicke die Seelenregungen, deren Pulsschlag in der Musik hörbar wurde. Die beiden Tristan Heinrich Vogl und Heinrich Gudehus reichten nicht entfernt an Ludwig Schnorr hinan, dessen ursprüngliche Gestaltungsgabe einem seherischen Wissen um die Geheimnisse des Werkes vermählt war. Ein Wink Wagners genügte, um ihn alles sagen zu lassen. Aber auch Schnorr wußte, was Arbeit heißt, und kannte das Ringen mit dem Werke. Der Segen ehrlicher, hingebungsvoller Arbeit hatte sich bei Vogl schon in München bewährt und war noch größer in Bayreuth. Auch Gudehus wuchs über sich hinaus. Beide gaben zwar nie mehr, als sie mit ihrer Stimme und ihrem Äußeren geben konnten, aber sie gaben immer das Richtige. Wagners unaufhörlicher Notschrei nach »korrekten« Aufführungen, die er außerhalb Bayreuths nur so selten finden konnte, war hier endlich erfüllt. Dazu jedoch hatte es einer Anleitung bedurft, die Takt für Takt den Sängern ihre Haltung beizubringen vermochte. Und diese Anleitung war das Werk Cosimas. Ihre Arbeit war der Segen Bayreuths.
Sie gab diesmal nicht nur dem Dirigenten und dem Spielleiter ihre bestimmten Weisungen, sondern sie war selbst der Spielleiter und machte es genau so wie Wagner: sie sang und spielte jedem seine Rolle vor und entfaltete dabei eine so hinreißende Kraft des Ausdrucks und eine so wunderbare Verwandlungsfähigkeit, wie sie durch keine Schulung erreichbar ist, wie nur der geborene Darsteller sie sein eigen nennt. Cosima hatte diese Fähigkeiten noch nirgends erprobt. Man konnte gar nicht sagen, daß sie eine »geborene« Darstellerin sei. Sie hatte nur – und das war ihre größte Verwandlung – den Willen und die Gaben des Meisters angenommen. Sie trat an seine Stelle, und sie war er – wobei die staunende Ehrfurcht vor der sich so außergewöhnlich betätigenden Frau die von ihr geübte Wirkung noch verstärkte.
Mit den Proben zu »Tristan und Isolde« begann ein neuer Abschnitt der Festspiele, der am besten dadurch gekennzeichnet ist, daß man sagt, der Meister selber sei herniedergestiegen und habe Bayreuth nicht mehr verlassen, ehe er nicht alle seine Werke seinem Willen gemäß verwirklicht hatte. Ihm selbst waren seine Textbücher und Partituren immer nur »Entwürfe« gewesen, deren »lebensvolle Verwirklichung« er suchte und ersehnte und naturgemäß da nicht finden konnte, wo man die Einheit seiner Werke nicht begriff, wo man höchstens Bruchstücke, Einzelheiten mit zureichendem Eifer und Verständnis erfaßte und durch die Vernachlässigung der Zwischenglieder, die Nichtachtung des Gesamtbaues, den Entwurf selbst zerstörte. Jetzt, in Bayreuth 1886, war das Ganze gewonnen, weil jeder Teil zu seinem Rechte kam. Jetzt war das Münchner Vorbild von 1865 erneut und übertroffen.
Aber wie einst Schnorr im Mittelpunkt gestanden, so war auch diesmal eine ganz große darstellerische Begabung die Trägerin des Ganzen. Die vollkommene Einheit von Wort und Ton, die unbedingte Verkörperung des Geistigen ward erreicht durch die Isolde der Frau Rosa Sucher. Man darf nicht meinen, der Schwerpunkt sei dadurch verschoben worden. Tristan und Isolde, sie gehören unlöslich zusammen; sie können nur gemeinsam leben und sterben. Aber wenn in der Darstellung ein Unterschied gemacht und einer Hälfte der Vorrang zuerkannt werden soll, so ist zu bedenken, daß Isolde das erste und das letzte Wort im Drama hat. In München war durch den fühlbaren Abstand, der die Leistung der Frau Schnorr von der ihres Mannes trennte, das Drama gleichsam um zwei Auftritte verkürzt gewesen. Durch Frau Sucher trat es zum ersten Male in seinem vollen Umfang in Erscheinung. In keiner anderen Rolle, auch nicht als Sieglinde und als Kundry in Bayreuth, war Frau Sucher so ganz sie selbst und zugleich so ganz die Gestalt des Dramas. So viele treffliche Künstler sich auch im Laufe der Zeiten um die großen, unsterblichen Rollen bemühen, so wertvoll die verschiedenen Begabungen, so berechtigt die verschiedenen Auffassungen sind, so mannigfach das Urteil vom Zeitgeschmack und von äußeren Umständen bestimmt wird, ab und zu ereignet sich das Unbeschreibliche, daß das Urbild und die Wiedergabe nicht zu trennen sind – und daß man sagen muß: das gab es nur dieses eine Mal! Ein solches Ereignis war Frau Sucher als Isolde. Therese Malten, die mit ihr abwechselte, hatte nicht ihre Schönheit, ihre Hoheit, ihre unnachahmliche Gebärdensprache, ihr überströmendes Liebesjauchzen. Sie war herber, schlichter, gebundener. Die Verklärung des Schlusses aber brachte sie vielleicht noch unirdischer, jenseitiger. Jedenfalls erwies diese Doppelbesetzung, daß man zwar auch in Bayreuth, wie überall, die Teile gegeneinander abwägen konnte, daß aber der Gesamteindruck, reich an Unwägbarem und vor allem beruhend auf dem einträchtigen Zusammenwirken der von einem Willen beseelten Mitarbeiter, kaum je eine Abschwächung erlitt.
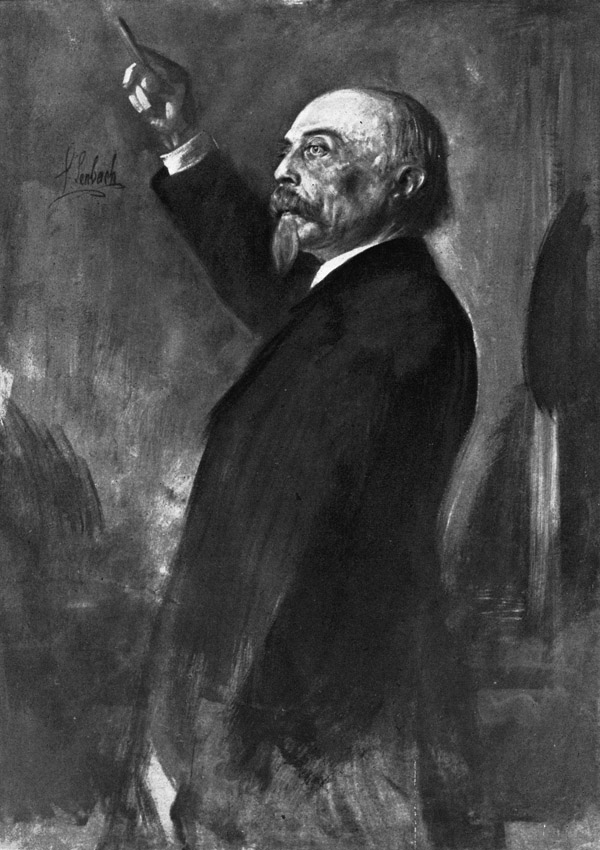
Hans von Bülow.
Nach einem Gemälde von Franz von Lenbach.
Photo F. Bruckmann, München
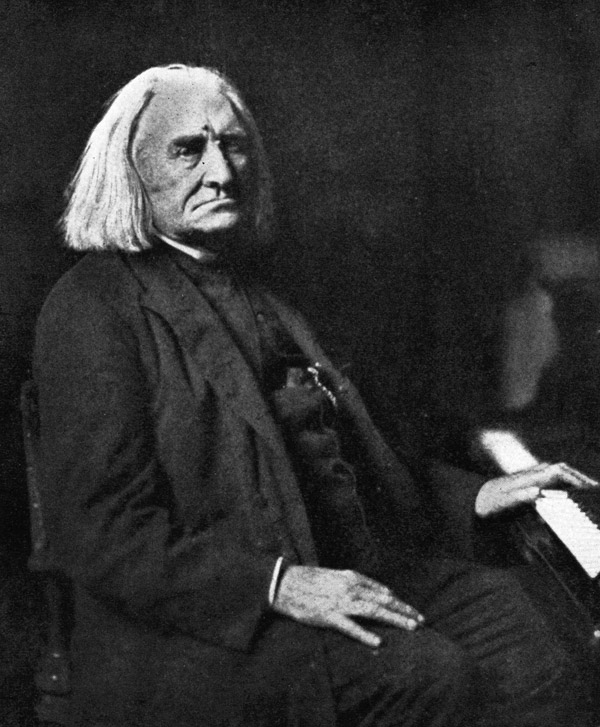
Franz Liszt (1886)

Das Sterbehaus Liszts in Bayreuth.
Städt. Verkehrsamt Bayreuth, Bildstelle. Photo Müller
Die Eintracht aller und die freiwillige Unterordnung jedes einzelnen hielt Cosima für die unentbehrliche Vorbedingung des künstlerischen Gelingens. Für die Brangäne hatte sie ursprünglich Lilli Lehmann ausersehen. Diese aber, die erste Rheintochter von 1876, die Führerin der Blumenmädchen von 1882, sonst ein »Stern« der Opernbühne, bestand darauf, daß sie die Isolde geben müsse. Da dies aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, verzichtete sie lieber auf ihre Mitwirkung. Das war nun etwas, was Cosima kaum verstehen konnte. Von dem, der die Bayreuther Weihen empfangen hatte, setzte sie stets voraus, daß er sich auch seiner » sittlichen Aufgabe« bewußt sei und »ebenso gerne das vielleicht seltenere große Beispiel, als die bedeutende künstlerische Leistung darreichen« werde. Wagner hatte im Jahre 1876 einem ausgezeichneten Künstler, der vermeinte, nur erste Partien annehmen zu dürfen, die Antwort gegeben: »Es gibt in Bayreuth keine ersten und zweiten Partien.« Für Cosima waren die Bayreuther Aufführungen »Taten der Begeisterung«, »von Rivalitäten, von Rollen überhaupt« sollte nicht die Rede sein, da hier »jede Note uns gleich heilig und teuer ist«. Auch von der Lehmann hatte sie erhofft, daß sie ihr Vertrauen rechtfertigen und ihre Überzeugung teilen werde: »daß wir das hiesige Ideal am mächtigsten verwirklichen, wenn wir die künstlerische Leistung mit der zweifach bedeutenden moralischen Tat verbinden«. Gerade die Lehmann hatte sie ausersehen, »dieses Beispiel zu geben« und in dieser Weise ihr »zur Seite zu stehen und eine Stütze zu sein«. Und gewiß würde es auf die künstlerisch und moralisch schwächeren Darsteller beispielgebend gewirkt haben, wenn eine Frau, wie die Lehmann, es für selbstverständlich gehalten hätte, in Bayreuth, zum Vorteil des Ganzen, eine »zweite« Partie zu übernehmen.
So hatte sich Cosima bei ihrer schweren Arbeit, die einzig und allein der Sache galt, auch immer wieder mit Personen über Persönliches auseinanderzusetzen. Schwer aber war die Arbeit vor allem deshalb, weil hier überhaupt erst die rechte Form der Darstellung zu finden war. Wenn Cosima die »sprechendsten« Gebärden forderte, so bedeutete dies in keiner Weise eine Überladung des Spieles mit den gangbaren schauspielerischen Ausdrucksformen. Im Gegenteil: wie beim »Parsifal« die seltene und ruhige Gebärde als das einzig Richtige für den erhabenen Stoff erkannt war, so lehnte Cosima auch bei »Tristan und Isolde«, im Drama der Leidenschaft, den schauspielerischen Realismus ab. Sie wußte, daß für das gesungene Drama und für die vom Orchester getragene Handlung nur eine Darstellungsweise gelten könne, die sich von der des gesprochenen Schauspieles ebenso weit zu entfernen habe wie von den leeren, kindischen Bewegungen der meisten Opernsänger. Dies war ihr besonders beim König Marke gegenwärtig. Hier hatte Levi bei gewissen Stellen, die nur durch das Orchester ausgefüllt sind, das Bedürfnis nach Mimik, die Cosima jedoch ablehnte. »Die Musik«, so schrieb sie ihm, »wiederholt, aber Wiederholungen in der Musik sind Steigerungen, Vertiefungen; die Wiederholung einer Gebärde ist bloß Wiederholung und daher in der Regel abschwächend … Hier liegen meines Erachtens die ungeheuren Schwierigkeiten der Darstellung von Tristan, wo das verzweigteste Seelenleben, durch die Musik kundgegeben, kaum eine entsprechende Gebärde ohne Absurdität zuläßt und wo kaum ein Physiognomiespiel der Gewalt der Töne entspräche … Ich entsinne mich, daß 1865 die erste Szene des zweiten Aktes … an der Unbeweglichkeit der Isolde etwas litt; jede unpassende Mimik sollte eben vermieden werden. Ich glaube, wir haben hier mit Hilfe der Begabung von Frau Sucher diese eine Szene beinahe gut gegeben. Das, was Sie bei Marke vermißten, könnte ohne Gefahr des Lächerlichen nur jemand wie Schnorr bringen … Ich glaube, daß ein gewisser gutgemeinter Realismus das Allerfremdartigste ist, während die Ruhe, welche gleichsam die Hülle scheint, mit welcher die vom Orchester angegebene Gemütsbewegung umschleiert wird, wenigstens unschädlich ist, wenn auch durchaus nicht entsprechend; ich glaube bestimmt, daß, wenn wir alljährlich spielten, wir … diese Probleme würden lösen dürfen, aber wir müssen alles Banal-Konventionelle, Realistische, verbannen und dafür eine erhabene Konvention, den Stil eintreten lassen.«
So dachte sie fortwährend über ihre Arbeit nach, wußte aber auch, daß nur die praktische Erprobung die theoretischen Zweifel besiegen könne, und sah kein besseres Mittel zur Gewinnung des Stiles, als die alljährliche Wiederholung der Festspiele und so die Schaffung einer Hochschule der musikalisch-dramatischen Kunst. Für jetzt war ein Beispiel gegeben, die Frucht tiefsten Wissens und reinsten Willens. Wenn die anderen auch wollten, so hatten sie eine Kunst.
Cosima nahm in keiner Weise ein großes Verdienst für sich in Anspruch. Wie in Bayreuth der unsichtbare Dirigent auf dem Zettel nicht genannt wurde, so war ihr Name auch in keiner sonstigen Bekanntmachung zu finden, und es war den Getreuen strengstens aufgetragen, sie niemals zu nennen. Dafür zollte sie den Künstlern rückhaltlosen Dank. Als Frau Sucher sich bei ihr bedankte, im vollen Bewußtsein dessen, was sie in Bayreuth empfangen hatte, bevor sie selbst soviel geben konnte, da schrieb ihr Cosima am 22. Oktober 1886:
»Alles, was bei Ihrer Darstellung der Isolde unwiderstehlich auf jeden ohne Ausnahme wirkte, trat mir zu meiner tiefsten Rührung bei der Durchlesung Ihrer teuren Zeilen … entgegen, wirklich würde es mir nicht leicht fallen, das zu bezeichnen, was uns alle hier hinriß, und was ich in jeder Begegnung mit Ihnen empfunden habe. Innigkeit und Wärme, so möchte ich sie einfach begrüßen, die holden Wundergaben, denen wir im Leben so selten und in der Kunst kaum mehr begegnen. Wie oft bin ich erschrocken, als mir (freilich unserem Kunstwerk durchaus fernstehende) Künstlerinnen wegen ihres dramatischen Feuers und Pathos über alles gerühmt worden waren, eine Kälte zu empfinden und einen Widerstand in mir, der immer größer wurde, je übertriebener die angestrengte Leistung sich aufbauschte. Bei Ihnen, meine geliebte Freundin, kommt alles im Leben wie in der Kunst wie von selbst. Sie strahlen Schönheit und Wärme aus – und wenn Sie mir sagen, daß Sie hier einiges nicht zu Ihrer Zufriedenheit gemacht hätten, so muß ich darüber lächeln und wollen wir ein langmächtiges Gespräch darüber halten, denn mir wäre es nie eingefallen, daß Sie hier etwas gemacht hätten. Alles tönte aus Ihnen heraus, man »hörte« das Licht, indem man Ihre Schönheit gewahrte. Nun sprechen Sie so rührend zu mir, und ich erkenne wohl, daß alles das, wofür ich Worte vergeblich suche, die Liebe ist, die Ihnen in die Seele gelegt wurde. Haben Sie wirklich in meinem alten Antlitz gelesen, so sagen Sie sich, daß es der Widerschein von dem war, was mir zur Erschütterung meines ganzen Wesens von Ihnen kam … Als Tochter eines Künstlers habe ich den größten Widerwillen gegen das Hineinreden der nichtsleistenden Besserwisserei gehabt. So kann ich Ihnen die Zaghaftigkeit, ja die Scheu nicht beschreiben, mit welcher ich an Bemerkungen über Kunstleistungen, die ich verehre, gehe; und ich würde hier gewiß gänzlich geschwiegen haben, wenn nicht die Liebe der teuren Künstler mich ermutigt und zu völliger Freiheit und Unbefangenheit erhoben hätte. Nun waren wir hier alle glücklich, und ich etwas anderes dazu, vielleicht mehr noch durch diesen wundervollen Zug der Güte gegen mich. Sie, meine geliebte Rosa, geben ihm in Ihren Zeilen einen so rührenden Ausdruck, daß es mich nun nicht läßt, ich muß Sie um etwas bitten, nämlich das bescheidene Zeichen meines Gedenkens und meines Dankes stets an Ihrer seelenvollen Hand zu tragen. Das soll unser Geheimnis sein, und will ich mir einbilden, daß es Ihnen das Glück bringt, von welchem, wenn Sie sich entsinnen, wir am letzten Abend sagten, es sei hienieden nicht außer Bayreuth zu finden. Es geht von mir gesegnet – mit aller Kraft meiner Seele gesegnet, an Sie ab. Mir soll dieses Bindezeichen an Ihrem Finger das Pfand dafür sein, daß wir bald hier vereinigt sind … Schreiben Sie mir nicht, meine geliebte Rosa, denn Sie haben Besseres zu tun, aber gedenken Sie meiner, bleiben Sie mir gut und bewahren Sie das Wissen, daß ich Sie im Herzen trage!«
Das Jahr 1886 war vielleicht das bedeutungsvollste in der Geschichte Bayreuths; und gewiß das bedeutungsvollste im Leben Cosimas. In diesem Jahr ist sie das geworden, was wir heute unter ihrem Namen begreifen; in diesem Jahr hat aber auch das Schicksal deutlich zu ihr gesprochen.
Drei Todesfälle kennzeichnen dieses Schicksalsjahr. Daß Emil Scaria am 22. Juli nach schwerem Verfall aus dem Leben schied, das war kein Unglück für Bayreuth, nur ein Sinnbild. Mit dem Gurnemanz hatte der Künstler sein Wirken gekrönt, durch den treuen Dienst am »Parsifal« 1883 und 1884 sein Leben noch zuletzt geweiht. Damit war es vollendet und war er selbst überflüssig geworden. Eine stärkere Hand und ein höherer Geist walteten jetzt auf dem Festspielhügel und begannen ihr Werk just zur selben Zeit, als Scarias Hand soeben erkaltet und sein Geist erloschen war. In Wehmut und mit Dankbarkeit war seiner zu gedenken.
Aber schon am 13. Juni hatte König Ludwig, nach unheilbarer seelischer Erkrankung, des Thrones verlustig, den Tod in den Wellen des Starnberger Sees gefunden; nicht weit von dort, wo er einst den Bund mit dem Künstler geschlossen. Nicht alle Hoffnungen waren gereift, die dieser Bund geweckt; die Freunde hatten sich allmählich voneinander entfernt; das unbedingte Verständnis hatte Wagner auch beim König nicht gefunden. Aber persönlich war ihm dieser innig treu geblieben, und wohl hatte er nach dem Hinscheiden des Künstlers sagen dürfen: »Ich habe ihn erkannt, ich habe ihn der Welt gerettet.« Er hatte ihn nicht nur persönlich gerettet, und die Welt hatte ihm nicht nur die letzten großen Werke, an denen er gleichsam mitgeschaffen, zu verdanken, er hatte auch Bayreuth ermöglicht, er hatte auch an diesem Werke mitgebaut, ihm hatte der heiße Dank des Meisters 1872, 1876 und 1882 gegolten, und erst vor kurzem – im Herbst 1885 – hatte er in aller Form das »Protektorat«, den Ehrenschutz, über die Festspiele übernommen. Jetzt war Bayreuth ohne seinen Schutz, jetzt beruhte es nur noch auf sich selbst. Das Verhältnis zum Münchner Hoftheater blieb allerdings aufrecht. Doch Cosima sollte nur zu bald merken, daß der erhabene Gönner, der immer alles gebilligt und gefördert hatte, was der Meister wünschte, nicht mehr am Leben war.
Jetzt war nur noch ein liebender Genosse des Meisters vorhanden, der zwar keine Macht nach außen hatte, der aber Wagner schon vor dem König erkannt und zum ersten Male gerettet hatte, und der durch sein »zweites, höheres Leben« untrennbar mit ihm verbunden war: Franz Liszt. Er kam auch diesmal zu den Festspielen, trotz seinem Alter und den mannigfachen Beschwerden, die ihn in der letzten Zeit befallen, trotz einer gefährlichen Erkältung, die er sich auf seinen letzten Reisen zugezogen. Er nahm sogar an den Abendgesellschaften teil, die in Wahnfried, wie zur Zeit Wagners, einen großen Teil der befreundeten Festgäste an den spielfreien Tagen vereinigten. Daß ihn stets Schüler und Bewunderer umdrängten, daß er auch hier nicht für sich leben konnte, trug zur Verschlimmerung seines Zustandes bei. Am 25. Juli war die erste Aufführung des »Tristan«. Im Halbschlummer, nicht mehr wachen Geistes, aber immer noch verbindlich grüßend und dankend, ließ der dem Tode Nahe das wunderbare Tongedicht, aus dem die Seele des verblichenen Freundes am lautesten zu ihm sprach, an sich vorüberrauschen. Das war sein Abschied. Dann befiel ihn eine schwere Lungenentzündung. Nur eine Woche war ihm noch gegönnt, die er im Fieber und oft bewußtlos hinbrachte. Cosima leistete das Unmögliche: den ganzen Tag über war sie im Festspielhause oder hatte sie Besuche zu empfangen, des Nachts war sie beim Vater. Gegen Mitternacht des 31. Juli starb er. Eines seiner letzten deutlich vernehmbaren Worte soll »Tristan« gewesen sein. In der Halle von Wahnfried wurde er aufgebahrt, auf dem städtischen Friedhofe beerdigt. Der Weitgewanderte, der einstige Liebling Europas, in dem kleinen deutschen Winkel ist er zur Ruhe gekommen. Aber dieser Winkel war jetzt auch ein Mittelpunkt der Welt, und nirgends hätte das Leben dieses Großen, dessen Herz bis zum letzten Atemzug für Wagners Kunst geschlagen, einen so sinnvollen Abschluß gefunden, eine solche schöne Vollendung erreicht wie hier in Bayreuth, wo Liszt als Künstler und als Mensch mehr heimisch war als in Rom oder in Weimar, in Paris oder in Pest.
Freilich machten sich sofort Wünsche und Meinungen geltend, daß seine Grabstätte dahin oder dorthin gehöre. Er selbst hatte einmal gesagt, er wolle dort begraben sein, wo ihn der Tod ereilt haben werde. Nun hatte er ihn für immer festgebannt an dem Orte, wo er am liebsten geweilt. Cosima erklärte, daß sie die Leiche Liszts nur in zwei Fällen ausliefern würde: wenn der Großherzog von Weimar den Wunsch hege, die sterbliche Hülle ihres Vaters in der Fürstengruft neben Goethe und Schiller zu bewahren, oder wenn die ungarische Nation durch ihre Vertretung in beiden Häusern beschließen sollte, das Andenken Liszts durch die feierliche Überführung seiner Leiche nach Pest zu ehren. Das stolze Bewußtsein der Tochter von der Größe ihres Vaters spricht aus dieser Erklärung, aber vielleicht auch das Wissen um die Kleinheit und Kleinlichkeit der Menschen. Der Großherzog, der wärmste Förderer Liszts, schätzte ihn doch nicht so hoch ein, daß er ihm einen Platz in der Fürstengruft einräumen wollte; am Ende waren ihm schon Goethe und Schiller keine ganz erwünschte Nachbarschaft für seine hochfürstlichen Ahnen. In Ungarn aber erhob sich eine förmliche Gegnerschaft gegen die »Heimführung« Liszts. Seine Schrift über die Zigeunermusik war ihm von den überzeugten Anhängern einer echt ungarischen Volksmusik, die übrigens später wissenschaftlich Recht bekommen sollten, arg verübelt worden, und einige der maßgebenden Persönlichkeiten hatten keinen Begriff von dem hohen Wesen Liszts: sie hielten ihn für einen eitlen Virtuosen. So wurde seine Ruhe nicht gestört.
Die Aufführungen gingen weiter. Das Festspielhaus ist keine Vergnügungsstätte, die wegen eines Todesfalles geschlossen werden muß. Wohl aber gewannen die Spiele von neuem und in verstärktem Maße die Bedeutung einer Trauerfeier, eines weihevollen Gedenkens. Cosima konnte das Gefühl ihrer Vereinsamung und der großen Verantwortung, mit der sie nun ganz allein für den Ruhm ihres Mannes einzustehen hatte, nur deshalb anscheinend leicht ertragen, weil sie eben mitten in der Arbeit war und weil sie diese mit solcher Inbrunst leistete, daß nichts sie beirren und nichts ihr Pflichtbewußtsein lähmen oder steigern konnte. Niemand war mehr in ihrer Nähe, der noch zu den alten, engsten Freunden gehörte. Aber sie stand auf dem festen Boden der Liebe und Treue, die sie selber hegte. In ihr lebte der Meister fort, durch sie lebte das Wagnersche Kunstwerk, sie war die Meisterin.
Nicht nur die Festspiele gingen weiter, auch das persönliche Dasein forderte nach wie vor sein Recht: die Kinder Cosimas erfüllten das Haus mit ihrer Heiterkeit, die nur gedämpft wurde durch das Scheiden der Ältesten. Seit dem 3. Juli war Daniela mit Henry Thode vermählt. Liszt hatte an der Hochzeit teilgenommen. In den Briefen an die Fürstin nannte er den jungen Gelehrten einen Ausbund von Verdiensten und Tugenden. Der erste Besuch der Neuvermählten, ehe sie ihr Heim in Bonn bezogen, galt Hans von Bülow. So war nun wieder eine Tochter aus dem engen Verbande geschieden, dafür aber wuchsen Isolde und Eva immer mehr zu den treuesten Gehilfinnen der Mutter heran. Wie heilig der Begriff der Ehe im Gemüt Cosimas lebte, das hatte sie in einem Schreiben an Frau von Schleinitz ausgesprochen, in deren Hause in Berlin die Verlobung Danielas vor sich gegangen war. »Noch liegt mir ein Schweres auf dem Herzen«, so schrieb die Mutter, die zur selben Zeit durch eine Erkrankung Siegfrieds recht sorgenvoll in Anspruch genommen war, an die vertraute Freundin, »ein Schweres, welches ich kaum auszusprechen weiß; willst Du für mich bei Daniela warnend eintreten? Sie hat Liebe gewonnen, möchte sie dieselbe zu wahren wissen durch Güte, Herzlichkeit und Einfachheit. Daß man einzig Glück säend, Glück erntend ist, das möchte ihr vielleicht in der Lage entfallen, in welcher Frauen gern annehmen, nun müsse endlich das Glück leibhaftig da sein. Empfangen, nicht gespendet, ein großer Irrtum, der uns um alles bringt. Möchte sie sich nicht den Anschein der Herzlosigkeit geben und alle Irrlichter von Herz und Geist vor der Sonne der Güte verschwinden lassen. Eine große Sorge gibt mir das ein. Daniela kennt meine Stimme, daß sie ernst, ja streng zu ihr war, ich habe ihr gutes Herz und ihren edlen Geist nicht oder nur zuzeiten irregeführt. Als Meisterin des Lebens wirst Du am besten wissen, was Du ihr aus diesen Zeilen mitzuteilen hast … In die Ehe hat man einzugehen wie in ein Kloster, mit derselben Umkehr aller Eigenwilligkeiten, wie in dem einen ich Gott mich widme, so hier einem Menschen, also mit Aufgabe meiner selbst, das heißt meines haßbaren Ichs zugunsten des besseren Ichs, das aus der Vereinigung entsteht. Wer die Ehe so auffaßt, kann in ihr glücklich, ja selig werden. Wer aber die Befriedigung der Eigensüchtelei in ihr sucht, wird elender gewiß als in der Einöde. Damit bei ihr das unendlich Anziehende zu dem ewig Fesselnden sich wandle, möchte Daniela der Einfachheit ihr Herz ganz erschließen. Die Liebe eines Menschen – eines guten – hat eine Frau, sobald sie ihrer nicht ernst wehrt, mit Dankbarkeit zu erwidern. Nun gebe Gott, daß das, was ich unter dem Geiste der Musik fasse, zum Allwalten komme und die bösen Dämone bändige. Die Durchführung des Verhältnisses zwischen Mann und Weib in der Ehe ist das Höchste, wozu die Menschheit im kühnsten Ideal sich aufschwang. Wird das heilige Werk durch die Leidenschaft gestört, so ist zu trauern, die Welttragödie spielt sich ab. Wird es gestört durch die Torheiten des Naturells, dann ist es die klägliche Weltkomödie, die unerträgliche, alles Edle zerstörende, die die Teilnahme im einzelnen Fall unendlich erschwert. Danielas Briefe sind so gut, daß ich annehme, meine Gedanken würden sie nicht befremden, doch sende ich sie Dir, Du wirst am besten wissen, wo zu schweigen oder zu reden ist.«
An Henry Thode aber rühmte Cosima die große Liebenswürdigkeit und Leichtigkeit seines Naturells, die Zärtlichkeit und Schmiegsamkeit seines Herzens, und erkannte in seinem Wesen die Vorbedingung für ein friedliches und harmonisches Leben. Sie meinte allerdings auch, daß er »nicht für den Kampf ausgestattet sei«, und sie hat ihm damit, als sie ihn noch zu wenig kannte, einigermaßen unrecht getan. Thode war kein Losgeher und in seiner taktvollen Verbindlichkeit ein ausgesprochener Gegensatz zu Hans von Bülow. Doch er hat, wie Du Moulin Eckart mit Recht bemerkt, »in seinem ganzen Leben eines gezeigt, nämlich daß er für seine Anschauungen nicht bloß leiden, sondern auch mit dem vollen Mute der Überzeugung einzutreten vermochte«. Wie schwer es damals einem Universitätslehrer gemacht wurde, zugleich Wagnerianer zu sein, das hat Heinrich von Stein blutenden Herzens erfahren müssen. Auch Thode fand manche Hindernisse auf seinem Wege, als er nicht nur Vorlesungen über Richard Wagner halten wollte, sondern auch in fast allen seinen Reden und Schriften, die sich doch größtenteils nur auf sein Fach, auf die bildende Kunst bezogen, immer wieder die Lehren des Meisters, die Bayreuther Kunst- und Weltanschauung zur Grundlage oder zum Endpunkte seiner Gedankengänge machte. Er hat sich aber durch keinen Widerspruch, keinen Hohn und kein freundschaftliches Bedauern von seinem Wege abbringen lassen, und wie selbständig er dachte, wie nachdrücklich er das von ihm Erkannte aussprach, wie unerschütterlich er bei seinem Glauben verharrte, wie unerschrocken er für ihn kämpfte, das hat er auch als Fachmann, als Kunstkenner bewiesen, als er Hans Thoma, den belächelten, verspotteten, von der Zunft mißachteten großen deutschen Maler, als solchen entdeckte und der Welt keine Ruhe ließ, bis das Unrecht gutgemacht war. Er erwarb zugleich das Verdienst, daß er Thoma in die Bayreuther Kunst einführte und dem Hause Wahnfried persönlich nahebrachte. Hier war endlich der Maler gewonnen, der als berufener Mitarbeiter in den engsten Bayreuther Kreis eintrat. So hat sich Thode um Bayreuth mannigfach verdient gemacht; in bedeutender Weise vermehrte er den Kreis der Erwählten und Bevorzugten, die in Wort und Schrift die Meisterlehre verkündeten. Auch das Herz der Schwiegermutter hat er ganz gewonnen, und mit rührender Anhänglichkeit wurde er ihr bedingungsloser Verteidiger, wenn sie sich gegen Vorurteil oder Unverständnis zu wehren hatte.
Am zärtlichsten aber schlug ihr Herz für »ihren« Kapellmeister, für Felix Mottl. Mit dieser jungen, unverbrauchten Kraft war nicht nur die Erneuerung der Festspiele in dem von ihr erstrebten Sinne möglich geworden, sondern auch ihr Gemüt wie mit der Jugend selbst in hoffnungsvolle Berührung gekommen. Immer weniger Teilnahme schenkte sie der Welt draußen, immer mehr suchte sie sich damit abzufinden, daß Bayreuth den Weltkindern nichts zu sagen habe. Vielleicht ein Same für die Zukunft! Die Gegenwart erschien ihr eher feindlich, trotz all den Preisliedern, die jetzt auf Wagner gesungen wurden. Es war doch meist nur das große Mißverständnis, dem auch der König verfallen war: die Verherrlichung des Musikers, dessen Kunstgedanke, dessen deutsche Bühne den meisten fremd war. Da kam nun Mottl, ganz im Leben verwurzelt, kein Denker, kein Grübler und keiner, der sich mit Menschheitsglück und innerer Erneuerung plagte; aber ein Genie als Orchesterleiter, ein Vollblutmusiker, ein aufgeweckter Geist, ein herzlieber, prächtiger Mensch, und einer, der jeden Wink Cosimas verstand, der ihr jeden Wunsch erfüllte, der treueste Diener am Werk, fortan ihr unentbehrlicher Helfer. In ihrer ganz persönlichen, weiter nicht zu begründenden und zu erklärenden Vorliebe für diesen Künstler verspürte sie auch eine Art Versöhnung mit der Welt, einen Zusammenhalt zwischen den Alten und den Jungen, der wagnerischen Vergangenheit und einer wagnerianischen Zukunft. Mottl gegenüber fühlte sie als Mutter und als Schwester, wie auch er gebannt war von ihrer Persönlichkeit und in grenzenloser Verehrung an ihr hing. »Ich habe nicht das Gefühl«, so schrieb sie ihm nach den Festspielen, »daß Sie uns hier etwas geleistet haben, sondern, daß Sie hier gewesen sind, und mit diesem Da-Sein wie mit diesem Sein überhaupt verknüpfe ich alles Gute, alles Glückliche, alles Freundliche, welches unsere Spiele in diesem Jahre so wundervoll umgestellt haben. So ist es wohl natürlich, daß der Begriff des Glückes sich für uns mit Ihnen verknüpft hat.«
Alljährliche Festspiele! Wiederholung des »Tristan« im nächsten Jahre! Von dieser Forderung wollte Cosima nicht abgehen. Groß aber hielt die Wiederholung für undurchführbar. Cosima schrieb ihm: »Wir sind etwas nur dadurch, daß wir da sind, und wenn Du mir sagst, daß ein Jahr kurz sei, so erwidere ich Dir, es sei übermäßig lang, wenn Du den moralischen und künstlerischen Schaden betrachtest, den ein solches – Opernjahr bei unseren einzigen Stützen, den Künstlern, anrichtet … Spielen wir im nächsten Jahr, so ist dieses Jahr nicht verloren, was es unwiederbringlich ist, wenn wir auf zwei Jahre vertagen … Mit den Jahren können wir alle, glaube ich, nicht freigebig sein; um Dir das geringfügigste Beispiel anzuführen: wie wenig ich in zwei Jahren sehen werde, ist wohl kaum festzustellen. Glaube es mir, lieber Adolf, die Stimme, welche hier ertönt, ist die Stimme Gottes. Hier ist die einzige Stätte in der Welt, wo sie zu vernehmen ist, wir dürfen sie nicht verstummen lassen, wenn anders wir der Kraft des Segens nicht verlustig werden wollen. Erwäge nun, daß die Alljährlichkeit der Spiele der erhabene einzige Lohn der Mitwirkenden ist, für das, was sie an Seelen- und anderen Kräften hier ausgeben … Du hast neulich unsere persönliche Lage erwähnt und daß diese Schaden litte, wenn wir alljährlich die Spiele wiederholten. Gott, liebster, einziger Adolf, es liegt vielleicht in meiner Bestimmung, daß ich selbst dieses nicht achten darf, und vielleicht auch in meiner Bestimmung, daß ich dieses nicht achten will, und vielleicht ist unser äußerliches Wohl das, was ich daran zu geben habe, um das zu erarbeiten und zu verdienen, was mir das heilige ist.« Groß blieb dennoch unerbittlich. Der »Tristan« hatte wohl einen unvergeßlichen Eindruck auf alle gemacht, die ihn erlebten; aber von einer besonderen Zugkraft des Werkes konnte nicht die Rede sein. Die Welt mußte ja erst darüber belehrt werden, daß Bayreuth etwas anderes biete, als man es bisher gewohnt war, und der »Tristan« war für viele kein überzeugendes Beispiel, da ihnen dieses Werk bisher allzu fremd geblieben war. Die Festspiele des Jahres 1886 waren also keineswegs glänzend besucht. Nur zu Beginn und am Ende der Spielzeit erwies sich genügende Teilnahme; die dazwischenliegenden Vorstellungen, namentlich die des »Tristan«, blieben manchmal erschreckend leer. Wenn demnach Groß einer Wiederholung nicht das Wort reden konnte, so hielt er vollends die Aufnahme eines neuen Werkes in den nächstjährigen Spielplan für unmöglich. Der damit verbundene Aufwand hätte die verfügbaren Gelder vollkommen erschöpft, und bei nicht genügender Einnahme wäre es in der Tat unvermeidlich gewesen, daß die Familie selbst helfend beispringen mußte. Der geschäftliche Leiter der Festspiele, zugleich Vormund und Vertrauensmann der Wagnerschen Erben, konnte diesmal weniger als je den Feuereifer Cosimas mitmachen und gutheißen.
Er konnte dies um so weniger, als er eine Gefahr erkannte, von der Cosima keine Ahnung hatte. Nach dem Tode Ludwigs II. war dessen schwachsinniger Bruder Otto auf den Thron gelangt, der sein Amt nicht selbst ausüben konnte; dieses war vielmehr dem Prinzregenten Luitpolt übertragen. So sehr dieser in jeder Hinsicht nur das Recht und das Rechte wollte, so war doch bei der mannigfachen Verwirrung der amtlichen Verhältnisse, die in München platzgegriffen hatte, den zahlreichen Gegnern Wagners in den hohen Ämtern erwünschte Gelegenheit gegeben, eine Art Rache zu nehmen. Sie fanden willkommenen Beistand bei allen, die dem verderblichen Einflusse des Künstlers eine Schuld an dem Untergange des Königs beimaßen. So wurde denn Groß eines Tages zum Minister Grafen Crailsheim vorgeladen, der im Namen der königlichen Vermögensverwaltung und der Regierung mit ihm über den rechtlichen Fortbestand der seinerzeitigen Abmachungen verhandeln wollte. Groß erriet sofort, was damit bezweckt sei, fühlte sich aber seiner Sache oder vielmehr seiner Person, der Wirkung seines Auftretens, derart sicher, daß er es nicht nur auf sich nahm, die Vorladung einstweilen geheimzuhalten, sondern auch jeden Rechtsbeistand verschmähte. Er allein, bewaffnet mit den in Betracht kommenden Briefen des Königs, trat vor die sieben Exzellenzen hin, die einmütig geltend machten, daß Ludwig das Aufführungsrecht am »Ring« und am »Parsifal« für das Münchner Hoftheater erworben habe, daß daher diese Werke auch in Bayreuth nur mit Zustimmung des königlichen Hauses aufgeführt werden dürfen und daß der »Parsifal« keineswegs Bayreuth vorbehalten sei. Groß legte die Zeugnisse vor, nach denen der König auf die von ihm erworbenen Rechte verzichtet und das alleinige Vorrecht Bayreuths in betreff des »Parsifal« anerkannt hatte. Graf Crailsheim, der seiner Sache und seiner Person vorerst nicht minder sicher war als der verwegene Groß, erhob sich von seinem Sitze und erklärte mit feierlichem Nachdrucke, daß der König durch amtlich festgestellten Wahnsinn seiner Handlungsfreiheit beraubt gewesen und die von ihm zur selben Zeit getroffenen Bestimmungen daher null und nichtig seien. Worauf Groß nur noch einmal den entscheidenden Brief des Königs zeigte und einfach sagte: »Dieses Schreiben ist ein Jahr vor der Ernennung seiner Exzellenz zum Minister des königlichen Hauses erfolgt. Wenn also der Inhalt dieses Schreibens null und nichtig ist, so ist auch die Ernennung des Herrn Ministers null und nichtig.« Der lauten Entrüstung des Betroffenen und seiner Amtsgenossen begegnete Groß mit der kurzen Erklärung, daß er unter solchen Umständen nicht weiter verhandeln könne und daß der Fall nunmehr vor das ordentliche Gericht zu bringen sei.
Schon war er auf der Treppe, als Minister Riedel ihn einholte und ihn bat, den Ministerialrat Pfaff aufzusuchen und mit diesem einen neuen, gerechten Vertrag zu entwerfen. Groß ging darauf ein, und die weiteren Verhandlungen mit Riedel und Pfaff führten zum Ziele. Das Ende März 1887 vom Vertreter der Wagnerschen Erben mit den Kuratoren des Königs Otto und der Münchner Hoftheaterintendanz geschlossene Übereinkommen enthält als wichtigste Vereinbarung die Bestimmung, daß alle früheren Abmachungen Richard Wagners mit König Ludwig »als aufgehoben erklärt« werden und daß »die Urheberrechte an allen bisher veröffentlichten Opern und musikalisch-dramatischen Werken, sowie an allen sonstigen musikalischen Werken und Dichtungen Richard Wagners nicht Sr. Majestät dem König Otto oder der k. Hoftheaterintendanz, sondern den Richard Wagnerschen Erben zustehen«. Ganz besonders wurde noch betont, daß die Urheberrechte am »Parsifal« nur den Erben gehören. Groß übernahm jedoch für diese und ihre Rechtsnachfolger die ausdrückliche Verpflichtung, daß sie die allfällige Aufführung des »Parsifal« auf einer anderen Bühne als auf der des Wagner-Theaters in Bayreuth vorerst dem Hof- und Nationaltheater in München einzuräumen und erst nach Ablauf einer bestimmten Frist auch anderen Bühnen zu gestatten hätten. Gewissermaßen als Entschädigung für den »Parsifal« wurden die beiden Jugendwerke »Die Feen« und »Das Liebesverbot«, mit denen allerdings kein großes Geschäft zu machen war, dem Münchner Hoftheater überlassen.
Die Zeit dieser Verhandlungen verbrachte Cosima still und einsam in Bayreuth. Solange es die Witterung zuließ, durchstreifte sie mit ihren beiden Hunden täglich zwei bis vier Stunden die Felder und Wälder der freundlichen Umgebung. »Eine Einkehr in Bauerngehöfte, um den guten Tieren Milch zu verschaffen, bringt mir, außer dem häuslichen Dienst, oft das Einzigste an Menschenstimme. Von überall begrüßt mich das Festspielhaus, dessen Schweigen das meinige entspricht.« Solche und ähnliche kleine Schilderungen und Betrachtungen kehren in den damaligen Briefen häufig wieder. »Abgesehen von dem eigenen Charakter, welchen die Gedanken im Freien annehmen, sind die Begegnungen mit dem Volke mir stets von größtem Wert. Selbst in der jammervollsten Verkommenheit erleichtert es einem das Mitgefühl, welches die Entartung der bürgerlichen Welt einem erstarren macht. Fast immer, wenn der Verkehr mürrisch begonnen, endigt er auf das freundlichste; meine Hunde werden bewundert, ihrer Vorgänger sich entsonnen und welches Beispiel von Ergebung und Größe gibt einem solch ein Kind, welches, mit einem schweren Holzkorb beladen, mir gestern antwortete, es könne nicht ausruhen, weil es nur diese Ladung fertiggebracht und noch mehrere ähnliche zu holen habe! Mit dem Gefühl der Zusammengehörigkeit kehre ich meistens heim. Ein Gefühl, welches ich früher in Gesellschaft vergeblich zu empfinden trachtete.« Das Verschwinden des einen der beiden Hunde, von dem sie glaubte, er sei einem Jäger zum Opfer gefallen, machte den Waldgängen ein Ende.
Dann kam ja auch die rauhe Zeit, in der nur das Haus und die Familie für Leib und Seele die rechte Wärme gaben. Cosima, in deren Gemüt sehr selten eine ungetrübte Heiterkeit herrschte, die beim Gedanken an die Festspiele und im Meinungskampfe mit dem treuen Groß immer wieder von Schwermut befallen wurde, freute sich des Frohmutes ihrer Kinder, welchem, wie sie meinte, »ihnen als Ausgleich einer tiefen Natur und eines ernsten Lebensganges beigestellt wurde«. Zu Weihnachten kam Heinrich von Stein, und wenn nun Stein und Wolzogen lesend und besprechend mit ihr beisammen waren, so hatte sie ein ganz feierliches Gefühl: »Ich glaube, so haben die Kirchen in ihrem Beginne ausgesehen … Gott! wie möchte ich alles von dieser Erde besitzen, alles an Geist, Jugend, Schönheit, Glück, um es dem Glauben darzubringen. Doch soll es mir auch genügen, alles von ihm zu empfangen.« Es war das letzte Beisammensein mit dem edlen Stein.
Zu Beginn des neuen Jahres, als Bayreuth so recht friedlich und behaglich eingeschneit war, wanderte sie wieder mit den beiden Hunden – auch der vermißte war zurückgekehrt – durch den lieben deutschen Winter. Mit dem Gedanken, daß in diesem Jahre nicht gespielt werde, hatte sie sich bereits abgefunden. Sie sah ein, daß Groß recht hatte, und mußte von neuem erkennen, daß nie im Leben alles zu gewinnen ist, daß jeder Gewinn Opfer heischt. Unablässig aber kreisten ihre Gedanken um die Wiederkehr der Festspiele, so wie der Blick der Wandernden immer wieder den Gruß des Festspielhauses empfing. Die Nachricht aus Paris, daß dort der »Lohengrin« geplant sei, erregte in ihr den lebhaften Wunsch, eben dieses Werk in reiner Gestalt in Bayreuth darzustellen. Am meisten aber hing ihr Herz am »Tannhäuser«. Nach dem »Tristan« war er für sie persönlich am bedeutungsvollsten. Er war das Erste, wodurch sie – bruchstückweise – einen bestimmten Eindruck von der Tonsprache Wagners empfangen hatte, und der »Tannhäuser« in Berlin hatte sie mit Hans von Bülow zusammengeführt! Indem sie sich mit dem Werke beschäftigte, verspürte sie auch immer heftiger die außerordentliche Kraft dieser »romantischen Oper«, die freilich in der gangbaren Auffassung und Darbietung, in der sich alles mehr oder weniger leichtfertig um den Pilgerchor, den Einzugsmarsch und das Lied an den Abendstern zu gruppieren hatte, nicht einmal romantisch, sondern nur schlechte Oper war. Im Verkehre mit dem Meister war ihr ferner aufgegangen, daß das Drama »Tannhäuser« durch die Pariser Bearbeitung an Klarheit und Tiefe gewonnen und sich noch weiter vom Herkommen der Oper entfernt hatte, daß aber die richtige und in allen Teilen wirksame Aufführung ein »Problem« war. Denn es ließ sich nicht leugnen, daß der Schöpfer des »Tannhäuser« noch dann und wann in den Opernformen befangen war, daß sein kühnes und leidenschaftliches Werk noch nicht den vollkommenen Ausgleich zwischen Oper und Drama, zwischen Singstück und Handlung zeigte. Das war jedoch im höchsten Maße bei den »Meistersingern« der Fall. Verglich man die beiden Werke, so konnte für den Oberflächlichen gar kein Zweifel bestehen, daß nur das spätere den ganz großen und echten Wagner im Bayreuther Sinne zu bedeuten habe. Cosima, die nie an der Oberfläche haftete, die oft in Tiefen vordrang, in die man ihr nicht leicht folgen konnte, hielt es umgekehrt für eine ihrer wichtigsten Aufgaben, der Welt zu zeigen, wie sehr Wagner schon im »Tannhäuser« der echte Wagner gewesen sei, wie all das, was am »Tannhäuser« beirren konnte – Mangel eines einheitlichen Stiles, aber auch einer gleichmäßig innerlichen, von Ausdruckskraft gesättigten Tonsprache – durchaus verschwinden müsse, wenn die Sache nur einmal richtig angepackt würde, wenn das Drama »Tannhäuser« in Erscheinung träte. Sie fand damit bei ihren Freunden kein williges Verständnis. Groß meinte, daß die Welt, wie sie nun einmal ist, gewiß nicht wegen eines beliebten Repertoirestückes der meisten städtischen Bühnen nach Bayreuth pilgern werde. Und Levi gehörte selbst zu dieser Welt, oder vielmehr zur Operngilde, die für Bayreuth bis heute nicht das rechte Verständnis hat. Cosima erwog nun allerdings auch die Kostenfrage. Die Ausstattung des »Tannhäuser« erforderte einen Mindestaufwand von 60 000 Mark. Trotzdem schrieb Cosima im März 1887: »Der Tannhäuser erfüllt jetzt mein ganzes Sein … Er ist die eigentliche Bayreuther Aufgabe. Sie ist weder in Paris, noch in Wien, viel weniger, begreiflicherweise, in München 1867 gelöst worden, wird es mir Armen hier gelingen? … Glückt es uns, so werden wir etwas Unermeßliches erreicht haben, wie im Tannhäuser selbst der Sieg der Seele über die Sinnenmacht. Glückt es uns nicht, so sind wir wenigstens treu dem Geiste gefolgt, der uns zu führen hat, und wird in dem Versuche selbst, weil er durchaus frei von jeder Redensartlichkeit und Äußerlichkeit ist, etwas Fruchtbares sein.« Die Nachricht aus München, daß die dortigen Einnahmen der Familie aus den Wagnerschen Werken im nächsten Jahre voraussichtlich mehr betragen würden, als der »Tannhäuser« kostete, bestärkte sie vollends in ihrer Absicht. Sie hielt es dabei für natürlich und selbstverständlich, daß die Familie einzutreten habe, solange Bayreuth nicht alles leisten könne. Groß wehrte ab; er zweifelte auch an der Höhe der Münchner Einnahmen.
Cosima beschäftigte sich aber auch mit dem »Lohengrin«. Aus München hatte sie dem Pariser Dirigenten Lamoureux die Bühnenpläne zukommen lassen, und in Karlsruhe, wo sie einer von Mottl geleiteten Aufführung beiwohnte, verhandelte sie persönlich mit dem für sein Vorhaben leidenschaftlich eingenommenen Franzosen. Dabei war sie erstaunt, wie großartig das anspruchsvolle Werk in dem kleinen Theater wirkte. »Chöre und Orchester erstaunlich, alle Tempi richtig, keinerlei Opernfaxen.« Sie hatte künstlerische und menschliche Freude an dem Können Mottls, der ihr namentlich den Ton des Werkes wunderbar zu treffen schien. Es war ihr, »als ob ein Engel Kindern eine Legende erzählt«. Es war – im Kleinen und zum Teil gewiß mit unzureichenden Mitteln – schon mehr Bayreuth als Karlsruhe. Mottl war nun für sie der einzig in Betracht kommende Leiter der künftigen Bayreuther Aufführung.
Der Pariser Aufführung sollten Groß und Levi, wie auch der junge Siegfried beiwohnen. Doch kam es nicht dazu: die politischen Verhältnisse waren dem »Franzosenfeinde« Wagner im Zeitalter der deutschen Reichsherrlichkeit weniger günstig denn je. Es wurde auch diesmal, wie einst beim »Tannhäuser«, mit einem Skandale gedroht und die Aufführung vertagt. Cosima lächelte darüber, nicht am wenigsten auch über die nutzlose Erregung ihrer »in der Presse beschäftigten« Freunde und über die völlige Teilnahmslosigkeit der deutschen Politiker und Regierungsleute.
Inzwischen wirkten Groß und Levi immer mehr auf sie ein und suchten ihr klarzumachen, daß Bayreuth unbedingt etwas Zugkräftiges brauche und daß in diesem Sinne vorerst nur die »Meistersinger« in Betracht kämen. Auch diese erforderten eine große Zahl von Mitwirkenden und einen beträchtlichen Aufwand. Aber dies würde sich lohnen, denn die »Meistersinger« hatten in aller Augen das Gepräge einer Festoper und schienen dem durchschnittlichen Verständnisse wie für Bayreuth geschaffen. Cosima überlegte noch einmal. Alle anderen Werke, meinte sie, haben einmal gelebt. Es ist ihnen ihr Recht widerfahren. Dem »Tannhäuser« noch nicht; nie und nirgends. Muß sie wegen des zu fürchtenden großen Abganges ihrem Wunsch entsagen, nun denn, so wird sie in der Wahl des Werkes nur die Klugheit zu befragen haben. »Gott ist schwer! es heißt ihn tragen nicht durch die reißenden Wellen nur, sondern durch die seichtesten Sümpfe.« Sie gab also nach, sie ließ sich von der Klugheit lenken. Auch den Wunsch, daneben den »Tristan« zu wiederholen, mußte sie im Hinblick auf die gewaltige Arbeit, die die »Meistersinger« verlangten, diesmal aufgeben. Und so widmete sie sich mit ganzer Seele den »Meistersingern«.
Ihre Tochter Blandine hatte in diesem Jahre mit ihren Kindern einige Zeit in Bayreuth verbracht. Die Großmutter spielte gerne mit den Enkeln, wobei sie bemerkte, »daß man diesen viel eher verzieh, als seinen Kindern … Bei ihnen hat man gar kein Begehren mehr, selbst nicht, daß sie gut erzogen oder hübsch seien«. Eine freundliche Genugtuung war es ihr, daß Blandine in der vornehmen Geselligkeit Palermos und an der Seite ihres außerordentlichen Gatten sich wahrhaft wohl fühlte und auch fern von der Mutter und fern von Deutschland »die grandiosen Eigenschaften ihrer Natur sich bewahren und anderen bewähren« konnte. Am 20. Juni starb, viel zu früh, ein schwerer Verlust für das geistige Bayreuth, Heinrich von Stein. Cosima war tief betrübt. Aber weder die heiteren noch die dunklen Bilder, die sie in diesem Sommer umgaben, konnten sie von den »Meistersingern« ablenken. (Es begann vor allem die angestrengteste Suche nach den geeigneten Kräften. Jede kleinste Rolle sollte mustergültig besetzt werden. Walther und Eva machten schwere Sorge. Da half nun – Kniese. Niemals hatte er sich innerlich von Bayreuth entfernt, immer war er mit Cosima in brieflichem Verkehr geblieben. Aus freien Stücken, dann in ihrem Auftrage, gönnte er sich keine Ruhe, von Ort zu Ort eilend, Tag für Tag hörend, prüfend und unterweisend. In ganz Deutschland forschte er nach geeigneten Künstlern, nach hoffnungsvollen neuen Begabungen, machte sie mit den in Betracht kommenden Aufgaben vertraut, schulte sie für seine Freundin und Herrin Cosima, die dann erst die letzte Entscheidung zu treffen, die ihr vorgeführten Künstler anzunehmen oder abzulehnen und die angenommenen in das Innerste ihrer Rollen einzuführen hatte. Knieses Briefe an Cosima sind wahre Muster tiefdringender Betrachtung und knappen Urteils; zugleich die herrlichsten Zeugnisse grenzenloser Treue. Cosima hatte bald das Gefühl, daß sie ohne Kniese nicht alles erreichen und durchführen konnte, was sie erstrebte. Ihrer zähen, aber behutsamen und taktvollen Einwirkung auf Levi gelang es, diesen wenigstens äußerlich zu versöhnen, so daß er keinen Einspruch dagegen erhob, als Kniese wieder die Leitung der Chöre übernahm und auch sonst unermüdlich der Meisterin zur Seite stand. »Was ich bin und habe, Sie wissen, es gehört Ihnen wie der großen Sache, und so gebe Gott seinen Segen!« Mit diesen Worten trat er seinen Dienst an und vermied es hinfort in gewissenhafter Weise, in einen neuen Gegensatz zu Levi zu geraten. Im Verlauf der nun beginnenden Vorarbeiten mit den Sängern kam er der Meisterin immer näher. »Sie ist einfach bewunderungswürdig«, schrieb er seiner Frau: »ihre Energie, ihre Rücksichtslosigkeit, ihre Feinfühligkeit, ihre Offenheit, ihre künstlerisch leidenschaftliche Innigkeit in der Hingabe an die Sache; ihre enorme Kenntnis und Beherrschung der Aufgabe – die echteste Tochter Liszts, die echteste Frau Wagners.« Und sie gab ihm gleichsam seine gute Meinung zurück, indem sie ihm, nach Vollendung der Arbeit, sagte: »wenn man so zusammen Kunst treibt, wie wir es getan, wird man Freund fürs Leben.« Kniese, der noch sieben Jahre in Bayreuth wirken konnte, wurde nie müde, sie zu preisen und ihr dankbar zu sein. »Sie weiß alles«, sagte er voll Bewunderung.
Doch auch mit sich selbst durfte Kniese zufrieden sein. Seine Tätigkeit, »in und an den Solisten die Werke zu Fleisch und Blut zu gestalten«, hielt er mit vollem Recht für gleichwertig mit der Dirigententätigkeit. Was er für Bayreuth geleistet hat, würde vielleicht am besten klar, wenn man alle die großen und bedeutenden Darsteller nennen wollte, die er für Bayreuth entdeckt und denen er mit zur Entfaltung ihrer Gaben verhalfen hat. Einer der Ersten und Berühmtesten, die als Schüler und Zöglinge Knieses und Cosimas gelten können, war Ernest van Dyck, den Lamoureux empfohlen hatte. Da er zwar deutsch sprach, aber bisher nur französisch gesungen hatte, ergaben sich zunächst begründete Zweifel an seiner Eignung für Bayreuth. Seine Aussprache behielt auch immer etwas Fremdartiges; aber sie war von einer Deutlichkeit und Schärfe, die den deutschen Sängern, die mit ihrer Muttersprache auf einem allzu familiären Fuß stehen, in der Regel nicht gegeben ist. Für den Walther wurde er nicht herangezogen; wohl aber für den Parsifal, für den ihn seine Frömmigkeit und seine unwillkürliche menschliche Empfindung des dichterischen Gehaltes vorherzubestimmen schienen.
Bei den »Meistersingern« hatte Cosima auch für die entsprechende Anteilnahme des Chores an der Handlung zu sorgen. Bild und Bühneneinrichtung waren bei den Malern Brückner und beim Maschinendirektor Kranich gut aufgehoben. Ein Spielleiter jedoch, wie seinerzeit Dr. Hallwachs in München, wurde von Cosima schmerzlich entbehrt. Wieder mußte sie alles selbst in die Hand nehmen und sah sich da vor Aufgaben gestellt, mit denen sie eigentlich noch nicht vertraut war. Doch – sie »wußte alles«. So gelang ihr auch die rechte Schulung des Chores. Für das Gesangliche sorgte Kniese, die lebendige Darstellung war ihr Werk. Wagners Beispiel vom Wiener »Tannhäuser« und »Lohengrin« wurde durch sie befolgt und erneuert. Das Grundsätzliche hat sie in den Briefen an Levi wiederholt ausgesprochen, »wenn der Chor keine Handlung auszuüben hat, Ruhe; wenn er in die Handlung eingreift, möglichst individualisiertes Spiel. Die sogenannte Lebendigkeit und Natürlichkeit des Chores, das stereotype Sichansehen, Zeichengeben etc. halte ich vom Übel, als einen groben und unwahren Realismus.« – »Die Inszenierung erfordert noch etwas mehr als die sorgfältige Ausführung der Angaben. Es sind Massen zu beleben, und da gehört Geist und eigene Persönlichkeit dazu. Sie glauben nicht, wie ich mich um diese Inszenierung sorge. Ich kann mir nun einmal nicht helfen; gutes Orchester, gute Chöre hin und her, wenn die Handlung auf der Bühne nicht alles andere vergessen läßt, ist eben die Aufführung verfehlt, und wenn sie sängen und geigten wie die Engel im Himmel!« Zur Handlung gehört aber kein willkürlicher Aufputz, kein Theater um seiner selbst willen. Cosima hatte einen entschiedenen Widerwillen gegen »Popanze, Tableaus und Statisterei«. Nicht »Lebendigkeit«, sondern inneres Leben, das von selbst den überzeugenden Ausdruck findet, nicht vorsätzliche, absichtliche Gebärde, sondern das Einfache und Unwillkürliche, das nie verfehlt sein kann, wenn es dem Leben des Werkes selbst entspringt, das war für sie nicht nur beim Einzeldarsteller, sondern ebenso beim Chore und beim Tanze das einzig Richtige. So schuf sie die Bayreuther »Meistersinger«.
Für alle, die Bayreuth schon kannten, war es eine ausgemachte Sache gewesen, daß dieses Werk, das in jeder noch so verwahrlosten Wiedergabe und mit all seinen rein musikalischen Schönheiten doch nirgends nur als Singoper, sondern überall auch als bewegtes Lustspiel, als dramatisch wirkende musikalische Komödie in Erscheinung trat, nun vollends in Bayreuth, wo dem Worte und der Handlung ihr unumschränktes Recht ward, zu glänzendster Darstellung und zu stärkster Wirkung kommen müsse. Dennoch war man überrascht, überwältigt. In Bayreuth wurden die »Meistersinger« etwas so Lebensvolles, Heiteres, Anheimelndes, Deutsches, wie es bisher noch nirgends Ereignis geworden. Diese Deutlichkeit des Wortes, diese Beweglichkeit des Spieles, dieser freie, persönliche Ausdruck jedes einzelnen, auch im Chore, diese verblüffende Wirklichkeitstreue der Prügelszene im zweiten Aufzuge bei ungeahnter durchsichtiger Klarheit, diese ungezwungene Fröhlichkeit auf der Festwiese, dieses Überquellen und Sich-Ergießen der Tonwogen des Schlusses, dieses mit all seiner funkelnden Pracht wie ein feines durchsichtiges Gewand sich anschmiegende Orchester, dieses für Auge und Ohr vollendete Zusammengehen der frischesten Natürlichkeit und der adeligsten Kunst, diese glänzendste Erprobung und – Überwindung dessen, was die Mißgünstigen, die Verständnislosen den Bayreuther Drill nannten, diese vollendetste Leistung, die bis dahin in Bayreuth erreicht worden, also wohl auch das Vollendetste, das überhaupt auf deutschen Bühnen geboten wurde, war in seiner Art wieder etwas ganz Neues und der Beginn eines neuen Abschnittes in der Geschichte Bayreuths. Was dieses für Aufgaben zu erfüllen habe, daran konnte eigentlich niemand mehr zweifeln. Denn selbst diejenigen, die sich aus der Weihe des »Parsifal« und aus der Erhabenheit des »Tristan« nicht allzuviel machten, weil ihnen diese Kunst zu streng und seelisch zu anspruchsvoll war, diejenigen, denen der Kulturbegriff, den Wagner mit dem Namen Bayreuth verknüpft hatte, fremd oder gleichgültig war, die aber als kunstempfängliche und kunstverständige Genießer auf die Güte der Darbietungen großen Wert legten und denen gewissermaßen das Beste gerade gut genug war, sie mußten von den Bayreuther »Meistersingern« einen besonders starken Eindruck haben und alsbald zur Überzeugung gelangen, daß eine solche Leistung nur dort möglich war, wo sorglich gewählte Kräfte unter der berufensten Leitung monatelang sich hingebend einem Werke widmen und jeder, bis zum letzten Chorsänger, seine Aufgabe unendlich ernst nimmt. Wenn Wagner beim »Lohengrin« in Wien von den Chorsängern verlangt hatte, daß sie alle so singen sollten, wie wenn es lauter Solopartien wären, so spielte nun auch in den Bayreuther »Meistersingern« jeder Mann auf der Festwiese, jeder Lehrbub und jeder Meister, wie wenn er eine große Rolle hätte: in keinem Augenblick vergaß er, was er vorzustellen hatte, in keinem Augenblick verlor er den Zusammenhang mit dem Ganzen; niemals aber drängte er sich vor, niemals störte er durch Wichtigtuerei, durch aufdringliche Theatralik. So war der künstlerische Eindruck auch das Erlebnis sittlicher Kräfte in ihrem wohlgeordneten Zusammenwirken, ihrer dem Ganzen dienenden gemeinsamen Arbeit. Was Bayreuther Kultur sein könnte, eine allgemeine völkische Arbeit im Geiste Richard Wagners, das mochte nun auch der ahnen, der zunächst nur von der Aufführung als solcher hingerissen war.
Will man das Wesen dieser Aufführung in einem Bilde klarmachen, so möchte man sagen, es sei hier alles so abgewogen und ausgeglichen gewesen, es sei eine solche Fülle in der Einheit und eine solche Klarheit in der Fülle zutage getreten, wie in der Partitur der »Meistersinger«. Und das Zauberbuch der Partitur ließ Hans Richter lautwerden, der Bayreuther Ur-Dirigent, wie ihn Wolzogen nannte, der Mann, dem Wagner schon 1876 sein Vertrauen geschenkt hatte, der aber in den »Meistersingern« besonders zu Hause war, der auch mit seinem saftigen, kernig-gemütvollen deutschen Wesen viel mehr von diesem Werke in sich trug als von irgendeinem anderen, und der überdies gelernt hatte, vom Dirigentenpulte aus die Bühne zu beherrschen, und so die wichtigste Aufgabe der Spielleitung, die tadellose Übereinstimmung von Musik und Gebärde, förderte und erleichterte. Vom Jahre 1888 an war er der wichtigste Berater und die verläßlichste Stütze Cosimas, und so lange er in Bayreuth wirkte, gab es nur ihn für die »Meistersinger«. Auch das war ja eine Gabe Cosimas, daß sie stets den richtigen musikalischen Leiter wählte und bei dieser Wahl ebenso verfuhr wie bei der Rollenbesetzung. Im landläufigen Bühnenbetrieb muß jeder alles können; hier waren immer nur wenige für das erkoren, was ihnen aber dann nicht leicht jemand nachmachte.
Der außerordentliche Erfolg der »Meistersinger« ermöglichte deren Wiederholung im nächsten Jahre, zugleich mit der Wiederaufnahme des »Tristan«, so daß das Jahr 1889 gleichsam einen Rückblick auf die bisherige Entwicklung gewährte. Richter und die »Meistersinger«, Mottl und der »Tristan«! Hier traten zwei völlig verschiedene, aber auch vollkommen gleichwertige und eben deshalb gar nicht miteinander zu vergleichende Werke und Leistungen einander gegenüber. Daneben behauptete der »Parsifal« sein angestammtes Recht. Nur schien es hier am wenigsten leicht, die Überlieferung ganz rein zu bewahren. 1888 hatte Levi, der der Erholung bedurfte, sich aber auch in Bayreuth nicht wohlfühlte und immer wieder nach Gründen und Vorwänden suchte, um nicht mehr dorthin zurückzukehren, den »Parsifal« nicht dirigiert. An seine Stelle war Mottl getreten, und so groß dieser als Dirigent war, beim »Parsifal«, der freilich auch die höchste Aufgabe stellt, war er fast unsicher, was sich vielleicht am sinnfälligsten darin ausprägte, daß er, um nur ja der Weihe nichts schuldig zu bleiben, viele Zeitmaße zu langsam nahm. Noch im Halbschlummer und in den Wachträumen ihrer letzten Lebensjahre rief Cosima, deren Gedanken fast nur mehr in der Vergangenheit weilten, manchmal erregt aus: »Schneller, schneller, lieber Mottl!« 1889 war Levi wieder zur Stelle.
Mit den Darstellern der Hauptrollen hatte Bayreuth in diesen beiden Jahren besonderes Glück. Den Sachs verkörperten zunächst Fritz Plank, Eugen Gura und Theodor Reichmann. Jeder gab der Rolle den unvergleichlichen Schimmer seines persönlichen Wesens, ohne darum ihrer vollen Rundung und allseitigen Belichtung etwas schuldig zu bleiben. Der wuchtig-breite, urwüchsige Plank war wohl der innigste und humorvollste, Gura der geistig bedeutendste Sachs, Reichmann verlieh durch seine sonst vielleicht etwas zu »schöne« Erscheinung und seine herrliche Stimme dem Schluß, der uns über alles Bürgerlich-Beengte und Geschichtlich-Bedingte hinweg in ein höheres Reich emporhebt, den hinreißendsten Schwung. Den dreien gesellte dann sich noch Franz Betz, der Sachs von 1868, der Wotan von 1876. Sein vorgerücktes Alter, seine etwas spröden Mittel schufen ihm einen harten Stand, aber der Stil war bei ihm am mustergültigsten durchgebildet, und er verkörperte in sich für die Bayreuther Gemeinde auch eine schon geheiligte Vergangenheit. Cosima war immer bestrebt, die altgetreuen Mitkämpfer um sich zu scharen, und ließ erprobte Darsteller auch dann nicht gern scheiden, wenn sie durch ihr fortschreitendes Alter vielleicht schon nicht mehr ganz auf der einstigen Höhe standen. Sie verstand es aber auch, Künstlern, deren Leistungsfähigkeit und persönliche Eigenart längst offenkundig schienen, gänzlich neue Seiten abzugewinnen; und sie erlebte dabei nicht selten Überraschungen, auf die sie gar nicht gefaßt war.
So hatte sie sich gesträubt, dem trefflichen Gura, der mehr durch seinen Geist als durch seine Mittel wirkte, den König Marke zu überlassen; denn sie war von der Überzeugung durchdrungen, daß für diese Rolle eine besonders hoheitsvolle Erscheinung und eine ebenso mächtige als wohllautende Stimme unerläßlich seien. Als nun aber doch auch Gura dazu gelangte, den Marke in Bayreuth zu singen, wo ja immer, soweit es nur möglich war, für mehrfache Besetzung gesorgt war, da erwies sich die Macht und Hoheit seines Geistes und seiner Darstellungskunst als so bedeutend und wirksam, daß der Marke durch ihn zum ersten Male sein volles inneres Leben gewann.
Fast eine »Sensation«, nicht bloß ein künstlerisches Erlebnis, war der Beckmesser des gewesenen Schauspielers Fritz Friedrichs. Er war der erste Beckmesser im Sinne Wagners: nichts Possenhaftes, Zerrbildartiges hatte dieser durchaus ernst zu nehmende, von seiner Umgebung wohl zu fürchtende, gallige, eitle Patron an sich, der schließlich vor lauter Eitelkeit und Bosheit auch dem unentrinnbaren Schicksal der Lächerlichkeit verfiel.
Und ein schönes, echtes Erlebnis war van Dyck als Parsifal. Wieder hatte man den Eindruck der untrennbaren Zusammengehörigkeit der Rolle und ihres Trägers. Nun war der Parsifal gefunden. Da war nicht nur der Umriß, sondern auch die lebhafte Farbe. Nicht nur treue Erfüllung des Meistergebotes, sondern auch eigene Größe. Den Ausruf »Amfortas!« im zweiten Aufzuge, den dramatischen Angelpunkt des Ganzen, hat man von keinem anderen so gehört, das Drama nie so unmittelbar empfunden.
Cosimas Leben kann jetzt nicht mehr gewürdigt werden, indem wir sie auf Schritt und Tritt begleiten und ihren Umgang, ihre Gespräche, Briefe und Bekenntnisse so genau festzuhalten suchen wie in ihrem früheren Leben, das mit dem Wagners zusammenschmolz. Ihr Tagebuch hat mit dem Tode Wagners aufgehört. Und wie sie nun ihr eigenes Dasein nicht mehr für würdig der Selbstbetrachtung hielt, so hatte sie auch für die Welt keine »private« Bedeutung mehr. Als Gefährtin und Mitarbeiterin Wagners war sie oft persönlich hervorgetreten und hatte sie die Mitmenschen mannigfach erregt und beeinflußt; jetzt stand sie gleichsam außer der Welt. Auch wenn sie häufig den Aufenthalt wechselte, in Karlsruhe oder in München, in Dresden und in Wien Opernaufführungen besuchte, in der rauheren Jahreszeit zu ihrer Erholung mit den Kindern in Bozen oder Meran oder in Cargnacco bei Gardone weilte, wo Henry Thode, nunmehr Universitätsprofessor in Heidelberg, einen traumhaft schönen Besitz erworben hatte (der heute das Eigentum Gabriele d'Annunzios ist), wenn sie dabei in fortwährendem eifrigem Briefwechsel mit ihren Freunden, besonders mit Marie Schleinitz (die nach dem Tode ihres ersten Gatten den Botschafter Grafen Wolkenstein heiratete) sich keineswegs nur mit Kunst und Künstlern befaßte, sondern die Fülle ihres Geistes und Gemütes über alles ausgoß, was sich ihr entgegendrängte oder ihre Aufmerksamkeit erregte, so war dies allerdings ein sehr reiches Leben, aber nur reich nach innen; nach außen bewegte sie nichts und wollte sie nichts bewegen; sie war nur daheim in Monsalvat, in Bayreuth, und nur von dort aus, als Hüterin des geheiligten Erbes, trat sie der Welt heischend, wirkend, aufrüttelnd entgegen. Wollten wir ihren Alltag zum Bilde formen, so hätten wir wohl einen immerwährenden Festtag, ein wahres Leuchten von Güte und Größe, und immer wären wir geborgen an der Hand der besten Führerin durch die Wirrnis des Daseins. Aber dieses Bild bleibt sich gleich durch all die Jahrzehnte, in denen die Meisterin das Geschick Bayreuths in Händen hielt. Taten vollbrachte sie nur im Festspielhause. Jedes neue Werk, das sie für Bayreuth erobert, das sie durch Bayreuth dem deutschen Volke schenkt, ist ein neuer Sieg des Genius, der in ihr verkörpert war. Wenn wir sie so darstellen wollen, wie sie in der Geschichte fortlebt, dann haben wir alles noch so Reizvolle und Beglückende aus ihrem häuslichen und ihrem Weltleben immer nur im Fluge zu streifen; der Fortschritt Bayreuths aber, der Aufschwung der Festspiele, die immer klarere Verwirklichung des Kulturgedankens, aus dem sie entstanden sind – das ist fortan das Leben Cosimas.
Natürlich darf das nicht wörtlich genommen werden. Kein Mensch lebt außer der Welt. Und wo das Leben selbst, die lebendigste Kraft des Volkes und der Einzelmenschen, mit am Werke ist, wie in Bayreuth, da wird auch das Persönliche sehr oft zum lebenweckenden Schicksal. So dürfen wir bei einer noch so kurzen zusammenfassenden Betrachtung der Jahre 1888 und 1889 ein wichtiges Ereignis nicht übergehen. Am 12. Juni 1888 traf Cosima beim Bildhauer Gustav Kietz in Dresden mit Houston Stewart Chamberlain zusammen. Als dieser sich bei ihr mit den Worten einführte, er sei kein Wagnerianer, sondern Bayreuthianer – wir würden lieber Bayreuther sagen –, da hatte er bereits ihr Herz gewonnen; und obwohl sie noch gar nicht wissen konnte, welche Bedeutung der noch junge, unbekannte Schriftsteller dereinst für das ganze deutsche Geistesleben, aber auch für das Leben in Wahnfried erlangen sollte, beschäftigte sie sich in ihren Briefen alsbald sehr lebhaft mit ihrer neuen Bekanntschaft. Sie nennt Chamberlain »eine durchaus originell stolze Persönlichkeit von größtem Werte. Wir haben fünf Stunden miteinander ohne Unterbrechung zugebracht, und keiner von uns war müde.« Und einige Monate später: »Hier hat man es mit einer ganz außerordentlichen Natur zu tun. Wir lieben uns zärtlich und fühlen uns einig, auch wenn wir uns streiten.« Ihrer Tochter Eva schreibt sie: »Er ist ein Aristokrat durch und durch, im schönsten Sinne des Wortes!«
Jeder Verlust ist unersetzlich. Aber man kann für jeden Verlust entschädigt werden. Die Lücke, die Nietzsche und Stein hinterlassen, wurde durch Chamberlain ausgefüllt. Und mit ihm ist etwas Neues, höchst Bedeutungsvolles hinzugekommen: die grundsätzliche und weitschauende Verknüpfung des Gedankens von Bayreuth mit der gesamten völkischen Erneuerung. Daß wir dieser teilhaftig werden konnten, daß das deutsche Volk, trotz allem »Untergang des Abendlandes«, zu seinem ureigensten Wesen zurückgefunden und, seiner nordischen Sendung treu, wieder einmal die Geschichte in die Hand genommen hat – das hat Chamberlain nicht nur gehofft und geglaubt, sondern auch mit herbeigeführt durch seine tiefen Erkenntnisse und seine flammende Beredsamkeit. Anknüpfend an Gobineau, den er aber auch widerlegte und berichtigte, erkannte er die Rassenmischung als eine der stärksten Mächte im Leben der Völker und die Rassenforschung als eine der wichtigsten Voraussetzungen echter Geschichtswissenschaft. Dabei war es ihm viel mehr um die geistigen als um die körperlichen Merkmale der Rassen zu tun, und wie er in seinen »Grundlagen des 19. Jahrhunderts« das Völkerchaos und den Rassenbrei des zerfallenden Römerreiches, den Eintritt der Germanen und der Juden in die Geschichte und den seit nun zwei Jahrtausenden wogenden Kampf in einer Weise geschildert hat, die ihn zu einem unserer größten Lehrer macht, so hat er die erhebendsten Beispiele arischer Gesinnung und nordischer Tatkraft zur lebendigsten Anschauung gebracht in seinen Büchern über Wagner, Kant und Goethe. Wagner hat uns den herrlichsten Schatz an Wahrheit und Weisheit hinterlassen. Diesen Reichtum nutzbar zu machen, ihn gewissermaßen fruchtbringend anzulegen, deutsches Denken und Wollen mit Wagners Hauch zu durchdringen, das war und ist noch heute die vornehmste Aufgabe aller, die zu Wagner gehören. Keiner hat diese Aufgabe als ein so Berufener erfüllt wie Chamberlain; berufen besonders dadurch, daß er ganz auf eigenen Füßen stand, daß er zu Wagner hinkam, nicht von ihm herkam, daß er bis zuletzt in vielen Einzelheiten völlig unabhängig von ihm blieb. Kein Schwärmer, kein Parteimann, sondern ein wahlverwandter Geist, der seine Kenntnisse und seine Urteilskraft in den Dienst des Volkstums stellte und den Deutschen die Wege zeigte, auf denen sie zu sich selbst und so auch zu Wagner gelangen konnten.
Dem Seelenbündnisse, das sehr rasch zwischen Cosima und ihrem neuen Freunde geschlossen wurde, ist durch die Veröffentlichung ihres Briefwechsels ein ergreifendes Denkmal gesetzt worden. Wer diese Briefe liest, in denen beide Teile sich so freimütig und aufgeschlossen geben, wie wir es in keinem anderen Buche finden können, der lernt nicht nur zwei große Persönlichkeiten kennen und lieben, der gewahrt auch, wie mannigfach der allmählich werdende Geschichtsdeuter und Verkünder eines neuen völkischen Glaubens, einer von allen jüdischen Schlacken gereinigten, wahrhaft deutschen Denkweise, von Cosima gelenkt und bereichert wurde, wie er besonders als Mensch unendlich viel von ihr empfangen hat und wie seine hohe Freundin, namentlich auch dann, wenn sie nicht sofort mit ihm einverstanden war, doch stets durch ihn erwärmt wurde und Gefühle für ihn hegte, die etwas Mütterliches an sich hatten. Mottl, Thode und Chamberlain – sonst nicht unmittelbar zusammengehörig –, das waren jetzt gleichsam ihre erwachsenen Söhne, mit denen sie fast alles besprechen konnte, was ihr Herz und Hirn bewegte.
In das Jahr 1889 fällt ein anderes, zunächst unscheinbares Ereignis, dem lebensgeschichtliche Bedeutung zukommt: der leibliche Sohn Cosimas, Siegfried Wagner, hatte das Gymnasium beendet. Es handelte sich nunmehr – nicht um eine Berufswahl, aber doch um die Wahl des Fachstudiums, dem sich der junge Mann widmen sollte. Seine Neigung zur Baukunst ließ den Besuch einer technischen Hochschule als das Nächstliegende erscheinen. Die Mutter aber wünschte, daß auch die musikalische Begabung, die er früh gezeigt hatte, nicht unentwickelt bleiben sollte, und nur, um da nichts zu versäumen, um zu sehen, wie weit diese Begabung reiche, bestimmte sie ihren Sohn, vorerst ein Jahr bei Humperdinck in Frankfurt am Main die Tonkunst zu studieren. Dieser Meister des Kontrapunkts und einer farbigen Instrumentation hat seinem, ihm schon längst persönlich ans Herz gewachsenen Schüler nicht nur die Theorie und Praxis seines Faches sehr rasch und gründlich beigebracht, er hat ihn auch als schaffender Künstler angeregt und beeinflußt. Er selbst schrieb an Cosima, er glaube bestimmt, daß die Musik die Architektur bei ihrem Sohne verdrängen werde. Dieser aber schwankte noch, und seine Mutter wollte ihn nicht beirren. Für das zweite Jahr ging nun Siegfried an die technische Hochschule in Charlottenburg und für das nächste halbe Jahr an die gleichartige Anstalt in Karlsruhe. Was ihn dort hinzog und dann bald die Wendung herbeiführte, das war, wie er selbst erzählt, schon nicht mehr die Architektur, sondern – Felix Mottl. Dessen Vorbild und Unterweisung machten aus Siegfried den Dirigenten und Theatermann, der der Baukunst Lebewohl sagte. Die Entscheidung fiel aber nicht in Karlsruhe, sondern erst nach einem weiteren halben Jahr im Fernen Osten auf der Fahrt von Hongkong nach Kanton. Ein junger Engländer, Clement Harris, der zusammen mit Siegfried in Frankfurt Musik studiert hatte und sein Freund geworden war, lud ihn zu einer Reise nach Indien und China ein. Die Eindrücke, die Siegfried auf dieser Reise gewann, hat er in einem höchst anschaulichen und unterhaltenden Tagebuch festgehalten, das den größten Teil der von ihm veröffentlichten »Erinnerungen« bildet. Gegen Ostern 1892 hörten sie einmal in der Nähe von Singapur »mitten im Gewirr der schreienden Verkäufer, der rollenden Wagen, pfeifenden Schiffe aus einem großen öffentlichen Gebäude einen Chor aus der Johannespassion. Wie Eis rollte es mir durch die Glieder. Wir standen wie gebannt und trauten unseren Sinnen nicht, doch es war richtig, denn als wir näher gingen, merkten wir, daß da oben für … Karfreitag eine Probe abgehalten wurde. Es war einer der Choräle, welche ich von Kniese gehört hatte … Der Eindruck war auf uns beide so überwältigend, die Urklänge der Religion, der felsenbewußte Glaube Bachs drangen so unmittelbar, so beseligend … in uns, daß wir uns gestehen mußten, nie von diesem Genie einen gleich gewaltigen Eindruck gehabt zu haben … Und gewiß war es kein Zufall, daß wir da vorbeikommen mußten! Vielleicht sangen sie es gerade zur selben Zeit in Bayreuth, und Mama hörte zu.« Dieses Erlebnis war von entscheidender Bedeutung. Am Karsamstag 1892 faßte Siegfried, nach langem Erwägen, den unwiderruflichen Entschluß, sich ganz der Musik und der Bühne zu widmen. Und als nach einer stürmischen Nacht der Ostermorgen leuchtete, fühlte er sich wie »erstanden«. Nun hatte seine Mutter den Nachfolger gefunden, den sie wünschte und brauchte, und das Wort Richard Wagners konnte sich erfüllen: »Siegfried wird seines Vaters Namen erben und seine Werke der Welt erhalten.« Als Siegfried von seiner Reise zurückkehrte, fand er bereits Gelegenheit, an der Bayreuther Arbeit teilzunehmen und kleine Dienste als Bühnenassistent zu leisten. Die Proben zum »Tannhäuser« waren in vollem Gange.
Schon 1891 hatte Cosima ihren Lieblingswunsch verwirklichen können. Der »Tannhäuser« in Bayreuth, der nach einer einjährigen Pause, die den wichtigen Vorbereitungen gewidmet war, die »Meistersinger« ablöste, kann wohl als das größte Ereignis gewertet werden, das die Geschichte Bayreuths aufzuweisen hat. Bei allen anderen Werken wurde nur das Aufführungsbild, das schließlich jeder Kenner mehr oder weniger deutlich vor sich sah, voll und rein verwirklicht. Mit dem »Tannhäuser« aber schenkte Cosima auch den sattelfesten Wagnerianern ein Werk, das sie noch nicht kannten, und einen Aufführungsstil, der noch nirgends versucht worden. Das große Publikum stand dem Bayreuther »Tannhäuser« zuerst beinahe hilflos gegenüber; aber es wuchs und erstarkte bei jeder Wiederholung, auch die Darsteller wuchsen, und die durch den anfänglichen Widerspruch teils Gereizten, teils Entmutigten unter ihnen fanden die Ruhe und das Selbstvertrauen wieder. Bei jeder folgenden Aufführung rundete sich diese schwierigste Gesamtleistung in immer höherem Maße. Der »Tannhäuser« wirkte diesmal als Ganzes und als Drama. Ein »Gefallen an lyrischen Details«, worüber Wagner sich so oft geärgert hatte, konnte da gar nicht aufkommen. Wem die Gabe oder der Wille fehlte, das Drama mitzuleben, wer sich im voraus auf dieses Lied oder auf jenen Chor freute, wurde herzlich enttäuscht. »Das klang bei uns zu Hause viel besser«, sagten so manche, in Unkenntnis der Ursachen und Wirkungen. Alles rein Musikalische und bloß Klangliche »klang« natürlich auch in Bayreuth so schön, wie man es nur verlangen durfte. Aber die größeren Wirkungen gingen von Teilen aus, die man sonst wenig beachtete; die stärkste, so ungewohnt und überraschend, daß eben hier der heftigste Widerspruch einsetzte, von der Darstellerin der Elisabeth. Schon ihr Erscheinen zu Beginn des zweiten Aufzuges wirkte als Offenbarung.
Beim Eintritte der Elisabeth in die »teure Halle«, die sie froh begrüßt, sagte sich der Zuschauer unwillkürlich: »Das ist noch ein Kind, aber ein Kind, das zur Heiligen werden kann; zu einer Heiligen, deren Himmelssehnsucht dann ebenso kindlich unbefangen sein wird, wie diese stürmische Freude, mit der sie dem zurückgekehrten Sänger entgegenjubelt.« Das Keusche und Mädchenhafte in der Gestalt der Elisabeth, die sich vor den Augen des Zuschauers vom Kind zur Jungfrau und alsbald auch nicht etwa zur Heldin, sondern eben zur Heiligen entwickelt, das Ahnungslose, Unbewußte, das auch ihrer Heiligkeit untrennbar zugehört, kam sofort zu beredtem Ausdruck. Später, in den erschütternden Augenblicken tiefster Kränkung und höchsten Opfermutes, klang doch immer der Grundton des Kindlichen und des Jungfräulichen als das Ergreifendste mit. Das war keine Primadonna, keine Heroine – es war zum ersten Male Wagners Elisabeth. Und wen ihr Zauber berührt hatte, der fragte auch im bewegten Schlußbilde des zweiten Aufzuges nicht danach, ob sie eine große, siegreiche Stimme hatte – es klang eben doch alles so, wie es mußte und sich gehörte, und demnach viel besser als irgendwo »bei uns zu Hause«.
Das gilt von beiden Darstellerinnen, die damals abwechselten, sofern es sich um das Grundsätzliche, um die Vorschrift, um das von Cosima Gelehrte handelte. Den ganz tiefen, unmittelbaren Eindruck erzielte aber doch nur die eine der beiden. Wenn irgendeine dramatische Gestalt, so bedurfte die der Elisabeth – und vollends in dieser neuartigen, für viele noch befremdlichen »Auffassung« – des innigsten persönlichen Ausdruckes, der vollpulsenden schöpferischen Kraft einer eben dafür geborenen Künstlerin, und dies war 1891 die sogenannte zweite Besetzung, die von Kniese entdeckte junge Norwegerin Elisa Wiborg Die erste Besetzung war Pauline de Ahna, die spätere Gattin von Richard Strauß., die soeben in Schwerin ihr erstes Opernjahr beendet hatte. Schon an zweiter Stelle erschien sie als ein Wagnis. Aber man brauchte für alle Fälle eine Aushilfe. Wie nötig diese Vorsorge war, das zeigte sich am 17. Juli 1891, bei der ersten Aufführung! Eben saß Frl. Wiborg bei ihrem bescheidenen Mittagmahle, so etwa um ein Uhr, da erschien ein Bote der Festspielleitung: die erste Elisabeth war erkrankt, die zweite mußte einspringen; um vier Uhr fing die Aufführung an. »Unmöglich! Ganz unmöglich!« Das ist die einzige Antwort, die die Künstlerin zu geben weiß. Aber wie fein sagt Wolzogen in seinem Rückblick auf dieses Festspieljahr: »In Bayreuth etwas unmöglich? Das ist unmöglich.« Die Meisterin befahl, Mottl und alle Mitwirkenden ermutigten und überredeten. Die kleine, zarte Wiborg betrat die Bühne und sendete ihre lichten, holden Töne in das Haus. Sie tat es mit all der Kunst, die sie schon erworben hatte, mit all der Herzenswärme, die stets in ihr wohnte; aber vielleicht verlieh gerade auch die Befangenheit, die sie überwinden mußte, und das wie von einer Schicksalswendung beschworene Verantwortungsgefühl, das sie nun beherrschte, den letzten und höchsten Zauber, mit dem sie die Empfänglichen sofort gewann und im voraus auch die Macht begreiflich machte, mit der sie dann auf Tannhäuser wirkte.
Die Darsteller der Titelrolle, wiewohl lauter Künstler von unzweifelhafter Begabung und von anerkanntem Ruf, schufen keine so zwingende und überzeugende Gestalt. Es war nicht möglich gewesen, in deutschen Landen den echten und rechten, vorbildlichen Tannhäuser aufzutreiben, und es wird immer ein außerordentlicher Zufall sein, wenn er sich irgendwo finden sollte. Denn diese Rolle in ihrer Leidenschaftlichkeit und ihren Gegensätzen, deren Wucht aber in der dazu geschaffenen Musik noch nicht so stark und hinreißend zum Ausdruck kommt, wie wir es durch den späteren Wagner gewohnt sind, stellt gesanglich und darstellerisch die größten Forderungen, die je gestellt wurden und die fast nie von einem Künstler gleichmäßig erfüllt werden. Dennoch hat in den Tannhäuser-Jahren 1891 und 1892 eigentlich niemand den Mangel eines »tragenden« Hauptdarstellers vermißt. So sehr war das Drama lebendig, so sehr waren auch die »opernmäßigen«, sonst meist für sich »genossenen« Teile zu Mitträgern des Ganzen geworden. Der Einzug der Gäste war jeder Opernschablone entrückt: ein in mittelalterlich-höfischen Schranken gehaltenes, aber buntes, reizvolles, von den feinsten dichterischen Zügen belebtes Bild, zu dem eine reich gegliederte, mannigfach abgestufte, anschaulich kennzeichnende Musik ertönte; der »Marsch« war verschwunden. Desgleichen die »Romanze« an den Abendstern. Da saßen vielleicht manche im Festspielhause, als der dritte Aufzug beginnen sollte, und freuten sich auf ihre Lieblingsmelodie oder fürchteten, daß dieses bekannteste und »rein musikalisch« nicht bedeutsamste Stück der Partitur hier »matt« klingen werde. Aber der Aufzug begann, und atemlos lauschte man den Worten Wolframs und Elisabeths, dann Wolframs allein – hatte er wirklich ein Lied gesungen? – und endlich Tannhäusers und so weiter, bis nach einer Nacht des Grauens und des Elends das Morgenrot der Erlösung tagte.
Dafür, wie alles sich zum Ganzen wob und die musikalischen Einzelheiten nie absolut musikalisch, sondern stets nur als tönende Seele der durch sie ausgedrückten dramatischen Wendung oder Steigerung wirkten, muß vor allem der erste Aufzug als Beispiel angeführt werden. Die Sorge, ob der überschwengliche Tristan-Stil der beiden umgearbeiteten – im Venusberg sich abspielenden – Auftritte mit der viel weniger kühnen zweiten Hälfte desselben Auszuges sich harmonisch zusammenfügen werde, diese begreifliche Sorge war an der Tatsache verloren, daß alle Ungleichheiten des Stiles in der höheren Einheit des Dramas aufgingen und derart die Stilunterschiede selbst nur als ein dramatischer Widerstreit empfunden wurden. Die schwülen und heißen Klänge des Venusberges und die schlichten, trauten Töne des Thüringer Waldtales – das waren zwei Welten; und in dieser Zweiheit lag die dramatische Einheit. Indem die Bayreuther Spielleitung in jedem Augenblicke alles, was Wagner wollte, zum stärksten, unbedingten Ausdruck brachte, bewirkte sie bei der großartigen Anlage des Werkes eine ununterbrochene durchgehende Steigerung. Wie Mottl die Partitur des Venusberges zum Klingen brachte, wie Cosima, die sich die Primaballerina Virginia Zucchi aus Mailand verschrieben hatte, um mit ihr den entfesselten Reigen der Satyrn und Nymphen zu bändigen, die sinnliche Leidenschaft künstlerisch vergeistigte, wie der Taumel des Sinnenrausches den Zuschauer und Zuhörer förmlich überwältigte und ihn doch zur reinen Anschauung befähigte – das war für sich betrachtet das Genialste und auch technisch Großartigste, was da geleistet wurde. Dennoch ging es immer weiter empor, bis zum Jubel der heimkehrenden jüngeren Pilger, einer Schlußwirkung, die um nichts weniger weihevoll war als die des »Parsifal«.
Da Cosima 1892 auch den »Tristan« und die »Meistersinger« wieder in den Spielplan einfügen konnte, durfte sie diesmal besonders zufrieden sein.
Aber sie gönnte sich keine Ruhe, wieder ein Jahr Pause – das heißt: eifrigste Vorarbeit – und 1894 »Lohengrin«! Van Dyck in der Titelrolle – die Amerikanerin Lilian Nordica als Elsa – Mottl am Dirigentenpulte. Mit diesen drei Namen ist zunächst nur ausgesprochen, daß diesmal die Besten und in jeder Hinsicht Berufensten für ihr gemeinsames Werk erkoren waren. Aber wenn man beim »Tannhäuser« als ein strenger Kritiker – Kritik bedeutet Zergliederung, Zerkleinerung – vielleicht sagen durfte, daß die Hauptdarsteller in ihrer Bedeutung hinter dem Gesamteindrucke zurücktraten, so konnte man jetzt nicht etwa behaupten, daß Lohengrin und Elsa durch ihre mustergültige Leistung das übrige in den Schatten gestellt und selbstherrlich über die Gesamtwirkung triumphiert hätten. Im Gegenteile: wenn die Gesamtwirkung, die von Cosima angestrebt wurde, eben nur auf der vollkommenen Ausgeglichenheit aller Teile, auf dem reibungslosen Ineinandergehen der kleinsten Glieder beruhen konnte, und wenn beim »Lohengrin«, der ja auch noch die Bezeichnung »Romantische Oper« trägt, der äußere Glanz, das Blendende und Berauschende wohl mit zur Aufgabe gehörte, wenn aber das Festliche und Prächtige hier nie in Äußerlichkeiten verfallen durfte, sondern stets die Würde und Weihe bewahren mußte, die der Handlung eigen ist, und wenn dies alles im Werke selbst klar enthalten und deutlich vorgebildet war, wenn der Dichter den Zuschauern ein wunderbar treues Bild deutscher Vergangenheit vor Augen stellte und gleichzeitig der Tondichter dem Geschichtlichen und dem Religiösen, dem Vergangenen und dem Allgegenwärtigen, die beredteste Stimme lieh, wenn also hier nicht, wie beim »Tannhäuser«, zwei Welten schroff einander gegenüberzustellen, sondern vielmehr in einer sinnfällig zu gestalten waren: das Eingreifen höherer Mächte in das irdische Geschehen und die innige Verbundenheit menschlicher Empfindungen mit höheren Glaubenswahrheiten, worauf die Doppeltragödie Elsas und Lohengrins beruht – so rechtfertigte die Bayreuther Aufführung, die alle diese Forderungen erfüllte, die Behauptung Chamberlains, der in den »Bayreuther Blättern« in einem Rückblicke auf die ersten zwanzig Jahre der Festspiele schlechthin festzustellen wagte, daß der Bayreuther »Lohengrin« das vollkommenste war, was diese Bühne je geleistet hat, und der es lobte, daß gerade dieses eine Werk in keinem der nächstfolgenden Jahre wiederholt wurde; denn der Meister forderte von seinen Festspielen eine »deutlich zunehmende Vorzüglichkeit«, und das war hier gar nicht denkbar.

Von links nach rechts:
Siegfried Wagner; Biagio Graf Gravina; Blandine Gräfin Gravina, geb. von Bülow; Daniela Thode, geb. von Bülow;
Isolde von Bülow; Eva Wagner; Cosima Wagner (1894).
Photo A. v. Groß. Mit Genehmigung von Frau Winifred Wagner
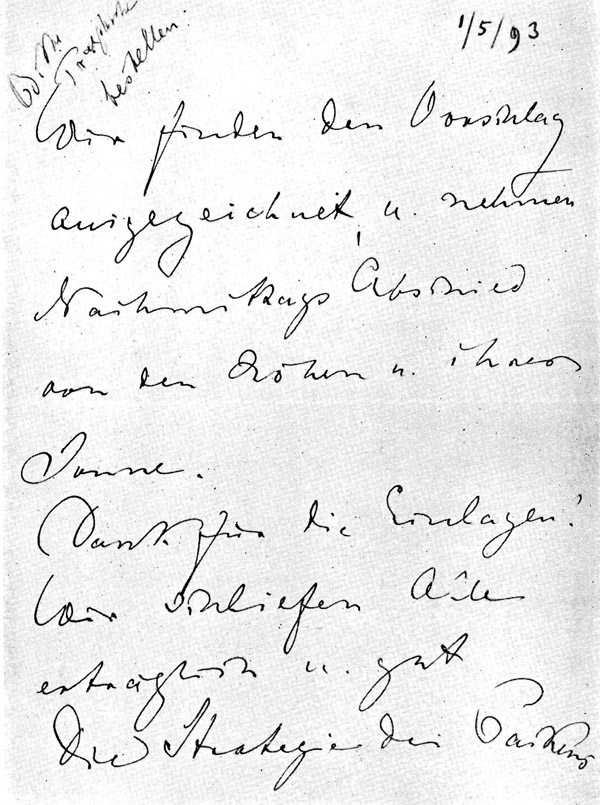
Handschrift Cosima Wagners.
Aus einem Briefe an Houston St. Chamberlain.
Mit Genehmigung von Frau Eva Chamberlain
Wenn aber von einer vollkommenen Darbietung die Rede ist, dann weiß man, wie sehr in diesem Falle der Chor beteiligt war, dem in dramatischer Hinsicht eine noch höhere und schwierigere Aufgabe zugeteilt war, als beim »Tannhäuser« und bei den »Meistersingern«. In keinem anderen Werke ist der Chor, die Vielheit, so wenig Hintergrund oder Rahmen und so ganz Mitspieler, dramatische Person, wie beim »Lohengrin«. Da hat denn Cosima im Vereine mit Kniese ihr Meisterstück geliefert – wenn man bei ihrer nie erlahmenden und nie versagenden Arbeit überhaupt abstufen und abwägen darf. Doch es war in der Natur der Sache gelegen, daß der Wille Cosimas mit dem Chore, dessen Mitglieder nicht lauter von sich eingenommene »Individualitäten« und überdies gewohnt waren, sich einem Chorführer unterzuordnen, gewissermaßen leichteres Spiel hatte, als im harten Ringen mit den manchmal eitlen, in der Regel selbstbewußten und nicht selten eigenwilligen Sangesgrößen. Wie nun die Männer und Frauen sich an den vielfach bewegten und erregten Vorgängen, die von Schrecken und Staunen zur Ergriffenheit und zum begeisterten Jubel führen, unablässig teilnahmen, ohne dabei störend hervorzutreten, immer nur die Wirkung der Einzelauftritte und der Hauptdarsteller bedingend und verstärkend – das war, wenn man nun doch wieder zergliedern, kritisieren will, das am meisten Überraschende, das magisch Fesselnde an dieser unvergeßlichen Darbietung. Dabei hatte Cosima jedes Massenaufgebot und ebenso jeden Massendrill, alles nur an »Aufzüge« und »Evolutionen« Erinnernde, durchaus vermieden.
Van Dycks Gralserzählung war ein Gipfel musikalisch-dramatischer Darstellungskunst. An die geheimnisvolle Herkunft und überirdische Sendung dieses Ritters mußte man glauben. Selbst das leise Fremdartige seiner Aussprache und Tonbildung und seines persönlichen Gehabens unterschied ihn in echt dramatischer Weise von den anderen Personen und trug bei zum romantischen Schimmer des Gralsritters.
Zu dem Vollkommenen zählte aber auch die Ortrud der Marie Brema. Diese Künstlerin war vom Konzertsaal zum Theater, und zwar gleich ins Bayreuther Theater, gekommen. Sie brachte die oft verkannte Hoheit der Friesenfürstin bei aller dämonischen Leidenschaft überwältigend zum Ausdruck. Dieser Ortrud mußte Elsa erliegen. –
Das Jahr 1894 ist ferner dadurch bemerkenswert, daß neben Mottl auch Richard Strauß den »Tannhäuser« dirigierte.
Was blieb nun für Cosima zu tun übrig? Was konnte, nach einer abermaligen Pause, das Jahr 1896 Neues bringen? Darüber war die Meisterin niemals im Zweifel gewesen. Nach zwanzig Jahren mußte der »Ring« wiederkehren. Das Werk, dessen Entstehung mit dem Werden Bayreuths vom Anfang unlöslich verknüpft war und das durch die Gestaltung des deutschen Mythos das völkische Empfinden am stärksten, tiefsten erregt. Durch den »Ring« war die vorgeschichtliche Vergangenheit zur lebendigsten Gegenwart geworden, die Gestalten Wotans, Siegfrieds, Brünnhildens und der ganzen Wagnerschen Götter- und Heldenwelt waren ein unverlierbarer Bestandteil der deutschen Dichtung und zugleich volkstümliche Sinnbilder geworden, die das deutsche Geistesleben zunächst unmerklich, aber sehr nachhaltig beeinflußten. Diese Gestalten konnten durch keine bereits erlangte »Popularität« ihre angestammte Hoheit und ihre ursprüngliche Erhabenheit einbüßen, sie wuchsen stets über den Rahmen des Theaterspieles und eines noch so ernsthaften großstädtischen Vergnügens weit hinaus. Wenn es Darbietungen geben sollte, die nicht nur einen edlen Kunstgenuß, sondern die künstlerische Verklärung der im Volke wirkenden und bauenden Kräfte zum Ziele hatten, dann war der »Ring« in Bayreuth eine nicht länger zu vertagende Notwendigkeit.
Cosima nahm diese Aufgabe so ernst, und sie hatte ja auch so viel zu leisten, wenn sie nicht hinter dieser Aufgabe zurückbleiben sollte, daß sie im Jahre 1896 sogar den »Parsifal« ruhen ließ und nur das vierteilige Werk in viermaliger Aufführung bot. Erst 1897 kam wieder der »Parsifal« dazu, 1899 gab es auch die »Meistersinger«, der »Ring« aber blieb fortan mit dem »Parsifal« das stets wiederkehrende Hauptwerk, dem abwechselnd ein drittes (man kann auch sagen: ein sechstes) hinzugesellt wurde. Dabei entstand allmählich der Brauch, daß nach je einem Ruhejahre – Ruhe in Bayreuth heißt Arbeit – zwei Festspieljahre folgten, die den gleichen Spielplan aufwiesen.
Der »Ring« wurde nicht im ersten Anlauf gewonnen. Aber schon das Jahr 1896 zeigte gegenüber 1876 einen ungeheuren Fortschritt, vor allem im Bühnenbilde. Seit 1889 war die Gasbeleuchtung im Festspielhause durch das elektrische Licht ersetzt und auch sonst das ganze technische Rüstzeug hinter den Kulissen, ober und unter der Bühne, in der modernsten Weise vervollkommnet. Da war es nun möglich, die Natur selbst, Wasser und Feuer, Wolken und Wind, den Morgen- und den Abendhimmel, das Spiel der Sonnenstrahlen im Waldesdunkel, die Schwefeldünste drohenden Gewitters und den Nebel, der aus dem Strome aufsteigt, so märchenhaft schön und so lebendig-wirklich vor die Sinne zu zaubern, daß hier in der Tat, wie es die Dichtung vorschreibt, wie es in der Musik vernehmlich wird, auch die Natur mitspielte. Sie war hier ein Teil des Dramas, und der mütterliche Urgrund, aus dem die Riesen und Zwerge, die Rheintöchter und die Walküren wie Verkörperungen ewiger Naturgewalten emporstiegen, er blieb stets sichtbar und fühlbar. Die Personen aber, die sich von diesem Grunde lösen und die nun die ewigen Gewalten des Menschenherzens veranschaulichen, sie traten mit einer solchen Bestimmtheit vor das Auge des Zuschauers, offenbarten schon in ihrer äußeren Erscheinung solche seelische Kraft, daß alle die fragwürdigen Errungenschaften falsch angebrachter Gelehrsamkeit und wissenschaftlicher Kleinkrämerei – wie 1876 – von einer echt mythischen und wahrhaft volkstümlichen Gestaltungsweise verdrängt und überwunden waren. Der Gestalter war Hans Thoma, der jeder handelnden Person die untrüglichen Merkmale ihres Wesens und ihrer dramatischen Bedeutung schon in Schnitt und Farbe der Gewandung, in der Haartracht, in der Bewaffnung sinnfällig aufprägte; so daß gleichsam auch die Kostüme mitspielten und daß andererseits kein Gelehrter gegen diese einfachen und genialen Lösungen schwierigster Aufgaben irgend etwas einwenden konnte. Auch Arpad Schmidthammer, ein Münchner Maler, der als »Garderobemeister« in Bayreuth wirkte, hatte daran mitgearbeitet. Aber die von ihm allein entworfenen Figuren standen hinter den Meisterwerken Thomas merklich zurück. Auch die Brücknerschen Landschaftsbilder, in denen die alten Hoffmannschen Entwürfe in den Grundzügen verwertet, doch wesentlich verbessert und malerisch gesteigert waren, gaben einen fast zu eintönigen und farblosen Hintergrund für die von Thoma so kraftvoll leuchtend gekleideten Darsteller. Thode, der Freund und Wegbereiter Thomas, bedauerte, daß diesem nicht auch die Gestaltung des Landschaftlichen übertragen worden war. Aber das hätte den Dichter und Träumer Thoma vielleicht zu sehr von seinem ganz persönlich bedingten, eigenartigen Schaffen abgezogen und am Ende nicht den vollen Erfolg verbürgt, da die Bühnenmalerei ihre eigenen Gesetze hat, mit denen Thoma ursprünglich gewiß noch weniger vertraut war als Böcklin. Jedenfalls aber war jetzt zum ersten Male ein großer bildender Künstler zum Mitschaffenden in Bayreuth geworden und war der Eindruck des Malerischen und Bildmäßigen beim »Ring« außerordentlich stark.
In solchem Rahmen bewegten sich die Darsteller nach den Lehren Cosimas. Nicht sofort waren die tauglichsten Vertreter für jede Rolle gefunden. Doch der »Ring« wies im Laufe der Jahre die von Wagner geforderte »deutlich zunehmende Vorzüglichkeit« auf. 1901 trat das Gesamtwerk mit solcher Größe in Erscheinung, daß man hier wieder haltmachen und von der erreichten Vollendung des letzten großen Abschnittes im Wirken der Meisterin sprechen darf.
Von den drei Hauptgestalten des Werkes gaben zwei der Aufführung das Gepräge: Wotan und Brünnhilde. In Anton van Rooy und in Theodor Bertram waren urgermanische Recken gewonnen, deren unerschöpfliche Stimmen, deren loderndes Feuer und deren geniale Künstlerschaft der tragischen Gestalt Wotans zum ersten Male die volle Kraft und die reinste Deutlichkeit verliehen. Auch das Wotanskind der Ellen Gulbranson, die auf keiner anderen Bühne als nur in Bayreuth auftrat, die ganz frei war von Herkommen und Schablone, wirkte mit der größten Unmittelbarkeit: als jauchzendes Naturwesen, als strahlende Heldin, als grenzenlos liebendes und leidendes Weib. 1896 war Lilli Lehmann die erste Brünnhilde gewesen. Cosima, die sie sehr schätzte und ihr Selbstbewußtsein kannte, räumte ihr bei den Proben alle nur erdenkliche Freiheit ein. Sie aber empfand jeden Rat und jede Bitte als eine lästige Bevormundung, und als sie erleben mußte, daß die zweite Besetzung stärkeren Eindruck machte, erklärte sie sich für unfähig, diese »sklavische Unterwerfung« länger mitzumachen. Sie hat später in einem Erinnerungsbuche ihren Mißerfolg dadurch zu verschleiern gesucht, daß sie meinte, die Weltdame und die Künstlerin hätten sich schwer verstanden. Sie ahnte nicht, daß Cosima die größere Künstlerin und sie selbst nur zu sehr in der »Welt« befangen war.
Den Siegfried gab 1896 der kaum noch recht flügge gewordene Alois Burgstaller. Schon mehrere Jahre vorher hatte Cosima einen Lieblingsgedanken und Herzenswunsch ihres Mannes verwirklicht. Am 10. November 1892 war die Bayreuther Stilbildungsschule eröffnet worden. »Weiterarbeiten, wie wir es bis jetzt getan, geht kaum«, hatte Cosima einmal geschrieben. »Die Berühmtheiten kommen aus Gnade und Barmherzigkeit, wollen keine Proben halten, und die Neulinge haben wir zu kurze Zeit bei uns, um ihnen das Gepräge vollständig geben zu können.« Nun sollte diese Vollständigkeit erreicht werden. Für Unbemittelte waren Stipendien vorhanden, wie ja auch die schon 1882 gegründete Stipendienstiftung vielen Würdigen und Bedürftigen den Besuch der Festspiele ermöglichte. Aber die Unterstützung darstellender Künstler, die sich der Bayreuther Arbeit widmen wollten, war mindestens ebenso wichtig. Wie gar vieles Gute, so hatte die Bayreuther Schule im Anfange größeren Zulauf als später, und nach einiger Zeit mußte sie gänzlich gesperrt werden. Jetzt aber kamen sie aus den verschiedenen Weltgegenden des Vaterlandes und der Kunst: halb Fertige und blutige Anfänger, Mißleitete, Verbildete und gänzlich Ungebildete. Kniese, der Leiter der Schule, sonderte die Spreu vom Weizen und senkte diesen in fruchtbares Erdreich. Auch Cosima selbst sah fortwährend nach dem Rechten. Der Schulplan versprach nicht nur eine gründliche musikalische Ausbildung und die nötige gesangliche Schulung. Hand in Hand mit den Gesangsstudien gingen die Übungen im deutlichen und sinngemäßen Sprechen, wozu besonders das Lesen von Theaterstücken mit verteilten Rollen diente. Im Zusammenhange damit sollten die Schüler eine allgemeine künstlerische Bildung erwerben, die auf den Schriften und Werken Wagners fußte. Cosima war aber auch der Meinung, daß der Sänger nie genug für körperliche Haltung und Beweglichkeit sorgen könne. Sie hielt »so gut wie nichts von der Theaterroutine, unendlich viel aber von der Leibesübung. Turnen, Fechten, womöglich Reiten, Tanzen, im Sinne der Ballettexerzitien; die Stellungen in den jeweiligen Situationen ergeben sich dann von selbst«. Also Herrschaft über den Körper – Freiheit der Bewegung! Im letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts erregte das noch Aufsehen und befremdete manchen Jünger der Opernkunst, der geglaubt hatte, daß ihm mit Stimme und Gehör das Nötige gegeben sei.
Zu jenen, die unmittelbar aus der Bayreuther Schule hervorgingen und sich alsbald bei den Festspielen betätigen konnten, zählte Burgstaller. Aus ländlichen Verhältnissen und vom Handwerk kam er auf die Festspielbühne, unberührt von gedankenloser Gewohnheit, nur gelenkt durch Bayreuther Lehre und Beispiel. Aber Umwelt und Erziehung sind nicht alles. Burgstaller war begabt und fleißig, doch keine starke Persönlichkeit. Seine frische, kräftige Stimme, seine schlanke, sehnige Gestalt, sein natürliches Lockenhaar, seine nicht schönen, aber gewinnenden Züge, sein liebenswürdig knabenhaftes Auftreten wirkten echt deutsch: er erinnerte an Holzschnitte von Dürer, an Gemälde von Thoma. So vereinigte sich das gewissenhaft Erlernte mit einer glücklichen Anlage, und man kann wohl sagen, daß der junge Siegfried bis dahin noch nie so glaubhaft und stilgerecht gestaltet worden. Aber für die »Götterdämmerung« langte es doch nicht völlig. Da kam manches doch erst zur Geltung, als die natürliche Befangenheit Burgstallers, dem das Heldische weniger lag als das Jünglinghafte, durch das bewußtere und daher freiere Gehaben erfahrener Bühnenkünstler ersetzt wurde. Von diesen hat Erik Schmedes am stärksten gewirkt.
Ein anderer Zögling der Schule war Hans Breuer, der auch seinen ersten (und zugleich größten) Bühnenerfolg im Festspielhause hatte. Sein Mime war durch viele Jahre unübertroffen. Sollen noch einige genannt werden, die dem »Ring« Cosimas ihren Stempel aufdrückten, so sei an den Loge erinnert, der zuerst von Vogl, dann von Dr. Otto Briesemeister mustergültig verkörpert wurde, an die Fricka, die von Marie Brema und von Louise Reuß-Belce eine königliche Würde empfing, durch die das Verhältnis zu Wotan erst ganz dramatisch wurde, an den Alberich, für den Friedrichs wie geschaffen war, und an die Waltraute, mit der Ernestine Schumann-Heink, die auch die Erda gab, die Sinne und die Herzen im Tiefsten aufwühlte. Wir finden also berühmte und bewährte Kräfte, die ihr Können und ihre Erfahrung, selbstlos dienend und zugleich über sich hinauswachsend, dem Ganzen einfügten, und neben ihnen, durchaus gleichwertig beschäftigt, neue, nur aus der Bayreuther Schule hervorgegangene, mit der landläufigen Bühne noch gar nicht vertraute Darsteller, die dennoch, weil sie eben mit ihren Rollen und deren Geist vertraut waren, den rechten dramatischen Eindruck machten. Der Festspielbesucher empfand im allgemeinen keinen Unterschied zwischen Alt und Jung, Erfahren und Unerfahren, er sah nur die einzelnen Gestalten glaubhaft verwirklicht. Im Grunde war der unvergleichliche Eindruck, den der »Ring« 1901 hervorrief, nicht so sehr das Werk der Darsteller, als vielmehr die Tat Cosimas, die in der Wahl der Künstler und in ihrer Schulung für den einzigen, diesmal zu erfüllenden Zweck das Außerordentlichste geleistet hatte.
Wie nun aber Cosima beim »Ring«, mehr noch als bei den anderen Werken, nicht nur das Deutsche, sondern auch das Germanische erkannte und zu verkörpern suchte, so fiel ihre Wahl, teils unwillkürlich, teils geleitet von ihrer sicheren Erkenntnis, nicht nur auf deutsche, sondern auch auf stammverwandte germanische Künstler. Zu der Schwedin Gulbranson, dem Holländer van Rooy, dem Dänen Schmedes kam noch eine Reihe von Sängern aus Skandinavien, England und Nordamerika, durch deren Erscheinung und Ausdruck der urgermanische Mythos zwingend hervortrat. Es hat damals niemand in Deutschland gegeben, der diese völkische und rassische Übereinstimmung der Darsteller mit ihren Aufgaben überhaupt wahrgenommen oder gar besonders gerühmt hätte. Wenn man der Herkunft der Künstler überhaupt Beachtung schenkte, so wurde höchstens mit Verdruß oder Empörung darauf hingewiesen, daß Cosima sich dem Auslande verschrieben habe; und wenn unter den Ausländern auch noch ein französisch sprechender Flame, wie van Dyck oder Emil Blauwaert (Gurnemanz von 1889), oder eine richtige Französin, wie Louise Grandjean (Venus von 1904), anzutreffen war, wenn gleichzeitig Franzosen, Italiener und Spanier, nicht zu reden von Engländern und Amerikanern, das Festspielhaus bevölkerten, so hieß es wohl in allen Spielarten der Entrüstung und der Schadenfreude, Cosima könne ihre undeutsche Herkunft nicht verleugnen und sie habe das Vermächtnis des deutschesten Künstlers den Fremden ausgeliefert. In Wahrheit ist wohl kaum je so sachlich deutsch und so werkgerecht gearbeitet worden wie von Cosima in Bayreuth, und niemand hatte weniger Recht, ihr das Gegenteil vorzuwerfen, als jene geistige Welt, für die das Internationale ein hehrer Begriff und die Kunst von vornherein den nationalen Schranken entzogen war. Wenn aber die fähigsten oder die eifrigsten Künstler oft nur außerhalb Deutschlands zu finden waren, und wenn das deutsche Publikum eine Zeitlang völlig versagte und Bayreuth in manchen Jahren nur durch den Zuzug Fremder gesichert wurde, so war dies nicht beschämend für Cosima, sondern für das deutsche Volk.
Die Leitung des »Rings« war 1896 drei Dirigenten anvertraut, vorerst Hans Richter, dem Ur-Dirigenten, der die erste und die letzte Darbietung übernommen hatte und damit nach außen hin, für Beginn und Abschluß des Festspielsommers, der Wiedergewinnung des »Rings« das Gepräge einer auf Wagner selbst zurückgehenden festgegründeten Überlieferung gab. Ihm zur Seite traten jetzt Mottl und – Siegfried Wagner! Das war ein ähnliches Wagnis, wie etwa mit Ellen Gulbranson und ein Jahr später mit Anton van Rooy. Wie Bayreuth allen anderen Bühnen überlegen war, so war hier auch die Verantwortung des Dirigenten noch größer. Da saß nun Siegfried, siebenundzwanzig Jahre alt, durch die Stilbildungsschule und deren Übungsabende mit dem Handwerk vertraut, und sollte mit Mottl und Richter in die Schranken treten! »Als ich da in den mystischen Abgrund an das Pult trat, unter mir das Riesenorchester, vor mir das Dunkel der Rheingoldtiefe, da wurde mir schon etwas schwindelig zumute. Gottlob kannte ich die Partitur so gut wie auswendig, so daß mein momentan getrübtes Auge nicht von den Noten abhängig war. Bald wich jede Erregung, ich fühlte etwas von einer segnenden Hand über mir, die mich in diesen entscheidenden Stunden beschützte.« Und wiewohl nun Siegfried, als gelehriger Schüler und angehender Meister, nichts anderes tun konnte als die Partitur in ihrer ungetrübten Reinheit und ihrer leuchtenden Schönheit zum Ertönen zu bringen, und wiewohl er dabei die Vorschriften des Meisters und das Beispiel Richters auf das eifrigste befolgte, so ergab sich doch etwas Merkwürdiges: es wehte gleichsam eine andere Luft als sonst, man war aus dem Mythos zunächst ins Märchen versetzt, dem »Rheingold« haftete etwas von einer tiefsinnigen Komödie an, das Tragische trat daneben zurück, in den beiden ersten Aufzügen des »Siegfried« verschwand es nahezu, so sehr wurde man hier vom Zauber der Waldes umsponnen und von urwüchsiger Jugendfrische mitgerissen. Daneben freilich kam die Leidenschaft der »Walküre«, kam die schaurige Wucht der »Götterdämmerung« erschütternd und beklemmend zum Ausdruck. Aber das Ganze war sozusagen in hellere Farben getaucht. Es wurde auch festgestellt, daß Siegfried an jedem Abend und für jeden Aufzug um einige oder mehrere Minuten weniger Zeit brauchte als Richter, daß er fast alles etwas schneller nahm. Dieses Etwas, das sich auch dort, wo es unmeßbar blieb, dem Gefühle mitteilte, war das »ewig Junge«, war die unverbrauchte Kraft und das frohe Gemüt des Erben von Bayreuth, und ein Teil seiner eigenen Schöpferkraft.
Wie er in seinen Bühnenwerken, nicht dem Vater nacheifernd, sondern die Bahn Humperdincks beschreitend, das Märchen und die deutsche Romantik im Sinne Grimms, Arnims und Fouqués sich ganz persönlich aneignete und wie er da gleichsam mit Ferdinand Raimund wetteiferte und der Welt von heute in der Tat etwas Ähnliches bedeuten könnte, wenn er recht erkannt und verständnisvoll gepflegt würde, so hat er als Dirigent und Spielleiter in Bayreuth nicht so sehr das Antike wie das Deutsche, nicht so sehr das Allmenschliche wie das Heimatliche, nicht so sehr das Geheimnisvolle wie das unmittelbar Wirksame am packendsten gestaltet. Und die Werke sind dadurch vielen nur noch nähergekommen.
Hans Thoma sah das Drama »Siegfried« in Bayreuth und nannte es »die heiterste, sonnenklare Kunst, die man sich denken kann … Statt der so oft für mystisch tief und raffiniert und schwer erklärten Kunst Wagners sehe ich auf einmal ein naiv sonnig klares Kindermärchen, in dem Götter spielen in seliger Lust, in dem alle Gestalten den feierlichen Reigen der Schönheit tanzen.« Damit ist auch am besten gekennzeichnet, wie Siegfried Wagner den »Ring« dirigiert hat.
1897 trat auch Anna von Mildenburg in den Kreis der Bayreuther Darsteller. Sie war die eifrigste und dankbarste Schülerin Cosimas und hat es vierzehn Jahre später zu einer Kundry gebracht, von der man wohl sagen kann, sie sei ebenso die Kundry gewesen, wie schon früher van Dyck der Parsifal, wie einst Scaria und später Richard Mayr der Gurnemanz waren. Durch diese Darstellerin wurde die Tragik der dämonischen Gestalt, der technisch und geistig schwierigsten, die Wagner geschaffen, in das hellste Licht gerückt und im vollen Umfange aufgezeigt, mit einer Gewalt sondergleichen. Frau Bahr-Mildenburg gibt noch heute in Wort und Schrift das von der Meisterin Empfangene an Begabte und Beflissene weiter und wird dabei nicht müde, von Cosima zu erzählen, der sie auch die schönsten Blätter ihres leider vergriffenen Erinnerungsbuches gewidmet hat. Mit keinen besseren Worten als mit den ihren läßt sich die Arbeitsweise der Meisterin und die Wirkung, die von dieser ausging, schildern.
»Auf mich zu kam eine große schlanke Frau, in schwarzem, weich herabfallendem Kleide. Ihr Gang hatte etwas Unkörperliches, Gleitendes, aber dabei doch wieder etwas ganz Unnachgiebiges, Bestimmtes … und das stand ebenso deutlich auch auf dem langen, schmalen blassen Gesicht geschrieben … aus dem mich zwei unendlich gütige Augen grüßten, während es mir aber doch war, als ob sie meine ganze Seele absuchten und abschätzten und sich meines ganzen Wollens bemächtigten.«
»Ich sehe noch die wunderbaren Bewegungen ihres unvergleichlich beredsamen Körpers, ihre Hände, ihre Finger, die alle ihre eigene Sprache, ja förmlich ihr eigenes Leben hatten. Und wie sparsam war sie in den Bewegungen! Mit einer kaum merklichen Wendung des Kopfes, einem Heben und Senken der Augendeckel, einer Biegung des Körpers, mit ihren leise in die Luft tastenden und greifenden Händen drückte sie die stärksten und zartesten Empfindungen aus. Und nie fehlte der Zusammenhang mit den musikalischen Vorgängen, immer wurde durch ihr rhythmisches Gefühl jede ihrer Bewegungen zum Ausdruck des Tones.«
»Was diese große Frau gab, konnte den Künstler durchs ganze Leben geleiten. Unauslöschlich steht in meiner Erinnerung, wie sie Dichtung und Musik in wechselnder Unterordnung miteinander verband, das Maß der Stimme in das entsprechende Verhältnis dazu zu bringen wußte und dadurch die reinsten Wirkungen auslöste. Und in welch rührender Geduld machte sie dem Künstler immer wieder aufs neue klar, worauf es ankommt. Je besser sie sich verstanden fühlte, desto eifriger und begehrlicher wurde sie in ihren Forderungen und Zumutungen und gab sich nicht zufrieden, bevor es ihr nicht gelungen war, dem Künstler alles abzuringen, was ihrer Meinung nach im Bereiche seiner Fähigkeiten liegen mußte; und er fühlte sich dann auf einmal von Kräften gehoben und gesteigert, deren er sich nie früher bewußt gewesen war. Ein gesangliches oder schauspielerisches Markieren war bei den Proben ganz ausgeschlossen. Jedes kleinste Detail mußte gebracht werden, kein willkürliches Atmen wurde zugelassen, und jeder Note, jeder Pause mußte ihr voller Wert und ihre volle Bedeutung gegeben werden. Nur die kraftfordernden hohen Stellen durfte man mit halber Stimme singen, um sich nicht bei den vielen Wiederholungen zu überanstrengen. Immer wieder warnte uns Frau Wagner davor, durch physische Kraftentfaltung die Steigerungen und Akzente herbeiführen zu wollen. ›Im Ausdruck liegt die Kraft, nicht in der Stärke eines Tones‹, sagte sie oft und fügte gleich den Beweis dafür hinzu. Denn was konnte mehr überzeugen, als wenn sie selbst da oben auf der Bühne stand, eine Gestalt um die andere klar und lebensvoll vor uns erstehen ließ und dabei doch nur ganz leise die Singstimme andeutete. Da stürmte sie als Brünnhilde mit Schild und Speer die Felsen hinauf, stampfte als Riese daher und flatterte als Loge herum, schmiedete Siegfrieds Schwert und begrüßte dann wieder als Brünnhilde Sonne und Erde … Sie belud sich mit hölzerner Rüstung, aber ihr Körper schien von der Last des Eisens gebeugt. Und wie konnte sie einen Schleier tragen! Er nahm unter ihren Händen förmlich Leben an, wurde mit zum Verführer, wenn sie sich als Kundry lockend und lechzend über Parsifal beugte, und beim Gang über die Bühne nach der großen Kundry-Erzählung schien nur aus dem Schleier die bewegende Kraft auf sie überzugehen, so schwebend und gleitend erschien ihre Gestalt.«
Das konnten freilich nur wenige nachahmen, und die bloße Nachahmung behielt auch immer etwas Starres und Erzwungenes. Doch Cosima weckte die eigene Mitteilungskraft der Künstler, nicht am wenigsten dadurch, daß sie nie ihre Überlegenheit fühlen ließ. »Diese willensstarke … Frau wußte so liebenswürdig zu herrschen, daß ihre Gebote und Forderungen noch als Auszeichnungen empfunden wurden. Sie hörte jeden geduldig an, machte jede fremde Meinung zur Wichtigkeit und zögerte nicht mit Zustimmung und Nachgiebigkeit, wo ihr Gefühl und Verstand dazu rieten … Ich habe Frau Wagner nie mit erhobener Stimme sprechen oder gar schreien gehört, Kraft und Energie gab sie nur mit den Augen, die sie so wunderbar ruhig und weit auf die Menschen richten konnte, so forschend und horchend, wie wenn sie den Worten allein nicht trauen würde und hinter ihnen erst die Wahrheit suchen wollte. Und wenn sie der auf den Grund gekommen war, so richteten diese Augen in ihrer Abwehr Mauern auf und wurden kalt, hart und teilnahmslos. Oder sie füllten sich mit weichem Schimmer, und im glänzenden warmen Blick bot ihr Herz seinen Willkommengruß. Und dann konnten sie oft so in Heiterkeit und Humor aufflackern, daß ich das Gefühl hatte, als ob sie sich über die ganze Welt lustig machen würde.«
In gleicher Weise schildert Siegmund von Hausegger, der Schwiegersohn Alexander Ritters, der auch einmal zur musikalischen Assistenz in Bayreuth zählte, von seinen Eindrücken bei den Proben: »Cosima zeigt Hagen, wie er den Siegfried töten soll; sie führt den Reigen der Blumenmädchen an, anmutiger und beschwingter als die jüngsten der mitwirkenden Damen … und wenn sie fehlt, ist es mit denselben Mitwirkenden und dem gleichen Bemühen, alles genau nach Vorschrift zu machen, doch nur eine gewöhnliche Theaterprobe.«
Cosima gab aber auch bestimmte Verhaltungsmaßregeln, die besonders demjenigen nützten, der sich damit begnügen mußte, seine Aufgaben äußerlich korrekt zu bewältigen. Doch galten auch für den größten Künstler gewisse unerläßliche Voraussetzungen, ohne die keiner in Bayreuth zugelassen wurde. Da durfte vor allem niemand an eine Mitwirkung denken, der nicht mit den Dichtungen vollkommen vertraut war und nicht die Fähigkeit besaß, sie auch ohne Musik deutlich sprechend, richtig betonend und mit warmem Ausdruck vorzutragen. Demgemäß war beim Singen die Aussprache ebenso wichtig wie die Tonbildung. Nun ist es um die Aussprache bei den deutschen Sängern – im Gegensatze zu den Italienern – im allgemeinen übel bestellt. Der Grund liegt hauptsächlich darin, daß es im Deutschen auf die Schärfe der Mitlaute ankommt und daß sich diese nicht leicht mit dem nach italienischem Muster erlernten Schöngesange vereinen läßt. Im Munde eines Sängers, der von seinen »Vokalisen« her nur mit Selbstlauten umzugehen weiß, wird die deutsche Sprache zu einem unverständlichen Brei. Hier verstand Cosima keinen Spaß. Die Sorgfalt der Sprachgestaltung war eine ihrer strengsten Forderungen. So hatte die oberflächlich urteilende und meist von falschen Voraussetzungen ausgehende Zeitungskritik willkommene Gelegenheit, über die Bayreuther »Konsonantenspuckerei« ihre schalen Witze zu machen. Der Festspielbesucher aber fühlte sich schon dadurch in eine andere Welt versetzt, daß er auf einmal nicht bloß singen, sondern auch deutsch reden hörte und fast jedes Wort, fast jede Silbe mühelos verstand. Dazu gehörten freilich auch das verdeckte Orchester, die Bayreuther Akustik und die von Hey in München gelehrte deutsche Singkunst, die jetzt Kniese in Bayreuth vertrat.
Befanden sich demnach Wort und Ton in Bayreuth in schöner Übereinstimmung, so war aber auch die in der Opernkunst nicht minder vernachlässigte Einheit des Tones und des Wortes mit der Gebärde zu erzielen. Dies erforderte nicht nur besondere Arbeit, sondern auch wieder besondere Leitsätze, ohne die alle Begabung und aller Eifer doch nur zu einem ungenügenden Naturalismus verurteilt blieben. Der Opernsänger neigt dazu, wenn er überhaupt auf eine sinnvolle Gebärdensprache achtet, seine Bewegungen gleichsam denkend und überlegend dem Ausdrucke des Gesungenen anzupassen und daher – zu spät zu kommen. Die Gebärde aber ist das Erste und das Unmittelbarste; »das Wort muß erst den Weg des Verstandes gehen«, wie Siegfried Wagner sagt. Die Worte, die die Seelenregung ausführlich mitteilen und begründen, folgen der Gebärde. Demgemäß ist der betreffende Ausdruck im Wagnerschen Orchester stets vor dem Gesange deutlich gegeben. Indem die Bayreuther Darstellung die Natur selbst zur Richtschnur nahm, wurde sie den Forderungen Wagners gerecht; und indem sie niemals den Zusammenhang mit dem Orchester vernachlässigte, gelangte sie zu vollkommener Natürlichkeit. Doch sei hier nochmals daran erinnert, daß die kleinliche Unruhe und die unablässige Seelenmalerei der naturalistischen Schauspielkunst sich mit den breiten, edlen Linien des dramatischen Gesanges und mit dem nach rein musikalischen Gesetzen gefügten Bau der dramatischen Sinfonie gerade so wenig verknüpfen ließen, wie die Puppenhaftigkeit der seelenlosen Scheingebärde, wie der Unsinn der Opernmimik. In ihrem steten Bemühen, dem Gange und den Bewegungen der Darsteller etwas Tänzerisches, von der Musik Getragenes zu verleihen, das sich doch in keiner Weise vom Leben entfernen durfte, wurde Cosima am meisten gefördert von ihrer darstellerischen Begabung, durch die sie auf die empfänglichen und ihr verwandten Naturen stärker wirkte als durch gelegentliche Versuche, das Unaussprechbare in Worte zu kleiden.
Bei den anderen Werken war durch die geschichtlichen Formen, in die der Stoff gekleidet war, immer noch ein gewisses Maß des Herkömmlichen, Überlieferten und dadurch auch leicht Verständlichen in der Darstellung gefordert und erlaubt. Beim »Ring« war alles ungeschichtlich, zeitlos, nur menschlich, göttlich oder naturhaft-dämonisch, und jeder Zug, der an eine bestimmte Form unserer geschichtlichen Entwicklung anknüpfte, konnte den Gesamteindruck stören. Konnte ihn wenigstens in Bayreuth stören, wo man für die feinsten stilistischen Vorzüge und Mängel allmählich sehr empfänglich und empfindlich geworden war. Wie weit es da Cosima brachte, wie sehr es ihr gelang, die Festspielbesucher mit dem »Ring« in eine andere Welt zu versetzen, die sie doch als ihre Urheimat grüßte, das hat kein Geringerer bezeugt als wiederum Hans Thoma, der freilich auch durch die von ihm entworfenen Gewänder erst die nötige Voraussetzung für die richtigen Gebärden schuf. »Was Frau Wagner«, schrieb er, »für die Ausgestaltung und harmonische Wirkung des großen Werkes getan hat, halte ich für etwas ganz Eigenartiges und Großartiges. Zum ersten Male sah ich Menschen in voller Schönheit der Bewegung auf der Bühne, losgelöst vom Zufall, ganz dem Zwecke dienend. Hierher sollten alle Theaterleiter und Schauspieler wandern, wenn ihnen ernst ist mit ihrer Kunst, wenn sie aus der Kleinlichkeit des naturalistischen Dilettantismus hinaus zu Maß und Rhythmus gelangen wollten. Frau Wagner hat es zustande gebracht, die Schönheit des Menschenkörpers und seiner Bewegungen zum Kunstwerk zu machen, zu ordnen, daß es wie ein feierlicher Tanz anmutet, und wie charaktervoll wird jede Figur durch dieses Maß, wie reich macht diese Einschränkung!« »Die dramatische Kunst muß in Bayreuth lernen; dort sind die Anfänge zur Überwindung des Naturalismus, des Zufalls in der Schauspielkunst gemacht.« – »Heut sah ich zu, wie sie Sänger einstudiert, und das ist nun ganz hinreißend, wie sie das macht, wie sie sich bewegt, wie sie jede Bewegung als eine rhythmische Schönheit auffaßt, und hier zeigt sie sich so vollständig als schaffende Künstlerin, die in dem großen Werk, dessen Seele sie ist, nichts dem Zufall überläßt.« –
Durchblättern wir die Notizbücher, in denen Cosima von 1886 bis in das neue Jahrhundert ihre Beobachtungen und Wünsche, Lob und Tadel niedergelegt hat, so gewinnen wir in dieser Fülle von genauen Spielanweisungen eine fortlaufende Anwendung ihres Strebens und ihrer Grundsätze auf die einzelnen Werke und auf die verschiedenen Darsteller. Wir entnehmen aus diesen Büchern aber auch, daß sie sich buchstäblich um alles kümmerte, um das Technische, um die Beleuchtung, um den Bühnendienst, um die Hausordnung. Wenn in den Ankleidezimmern geraucht wurde, wenn die Künstler in den Pausen Besuche empfingen, wenn der Zuschauerraum schlecht gelüftet war, wenn die Notlampen nicht brannten, wenn nach Beginn der Vorstellung eine Türe zu laut geschlossen wurde, wenn sich irgendeine Störung ergab und ein Verschulden angenommen werden konnte, immer beeilte sie sich, den Sachverhalt festzustellen und das Nötige vorzukehren. Wie Wagner war sie nicht nur Musiker, sondern auch Dramaturg und dramatischer Choreg, »ein Ausnahmefall, den niemand zum Maßstab für eine andere Begabung anlegen darf«, zugleich aber Theaterdirektor im weitesten Sinne, und sozusagen ihr eigener Inspizient oder diensthabender Regisseur, der über Kleinigkeiten wachte, um die sich Wagner nie gekümmert hätte. So groß war ihr Verantwortungsgefühl und so heiß ihr Bemühen, das Festliche jeder Aufführung von allen ernüchternden Zufällen zu befreien. Da sie in der Festspielzeit auch durch ihre gesellschaftlichen Pflichten und in ihrem Haushalt, allerdings unterstützt von ihren Töchtern, ganz besonders in Anspruch genommen war und eigentlich nie zur Ruhe kam, so stehen wir in grenzenloser Bewunderung vor ihrer Unermüdlichkeit und ihrer Ausdauer; wobei wir noch in Rechnung ziehen müssen, daß ihre Sehkraft sehr geschwächt war, daß sie fast alles Schriftliche, das für andere bestimmt war, diktierte, und daß sie überdies noch während ihrer eifrigsten Tätigkeit von einem schweren Gallenleiden befallen wurde, dessen Bekämpfung einen großen Teil ihrer Kraft verbrauchte.
Unentbehrlich war ihr Kniese. Dieser war sozusagen Tag und Nacht nur für Bayreuth tätig. Er bestimmte und überwachte den Dienst der musikalischen Assistenz, er studierte unablässig, auch während der Festspiele, mit den auftretenden und den zum Ersatz bereit gehaltenen Künstlern, er durchreiste nach wie vor in der festspielfreien Zeit die Theaterwelt, Ausschau haltend nach jungen Kräften und nach vielversprechenden Sängern und Darstellern, die, wenn sie gefunden waren, durch ihn brauchbare Diener Bayreuths wurden. Und auch er kümmerte sich um Kleinigkeiten und um vieles, was durchaus nicht zu seinem Amte gehörte und am allerwenigsten durch den einschränkenden Titel »Chordirektor« ausgedrückt war. Auch er fühlte sich mitverantwortlich, aber nicht nur für die Festspiele, sondern vor allem für das Wohlbefinden und den Seelenfrieden der Meisterin. So schrieb er zu Pfingsten 1894 an seine Gattin: »Ich habe Frau Wagner gegenüber über viele Dinge zu schweigen, seit der Wendepunkt in ihrem Gesundheitsverhältnisse eingetreten ist. Eine schlaflose Nacht nach einer auf ihrer Seite fast immer erregten Auseinandersetzung darf ich nicht zu verantworten haben. Sie hat ihre wenigen Kräfte für die allerwichtigsten Sachen nötig, und so verschone ich sie mit Erzählungen von Schurkereien, die von ›intimen‹ Freunden gegen Bayreuth begangen wurden, um sie nicht noch mehr zu verstimmen, und unterdrücke einen Widerspruch in allen weitabliegenden Dingen. Denn es gibt der dringend notwendigen und unerläßlichen Aufregungen noch viele.«
Am 22. April 1905 wurde Kniese in Dresden von einem jähen Tode ereilt. Er verschied in den Armen Dr. Alfred von Barys, des Arztes und Sängers, der in Bayreuth den Siegmund, den Tristan und den Parsifal gegeben hat. Kniese starb zu früh; nur seine Tätigkeit als Chordirektor im engeren Sinne ist durch Hugo Rüdel vollwertig ersetzt worden. Als Lehrer und Erzieher der Darsteller eiferte ihm Karl Müller nach und erwarb den Dank Cosimas und der Künstler. Dem treuen Kurwenal Kniese widmete die Meisterin einen ergreifenden Nachruf in den »Bayreuther Blättern«. In ihrem Büchlein aber vermerkte sie die Eigenschaften, die sie von seinem Nachfolger verlangen müsse. Da schrieb sie, neben anderen schönen Eigenschaften und hohen Tugenden, die schwerwiegenden Worte hin: »Keine Ferien.«
Keine Ferien! Dieses Wort hätte Cosima für sich selbst prägen können. Auch in der festspielfreien Zeit lebte sie nur ihrer Aufgabe und hatte überdies, trotz der rücksichtsvollen Schweigsamkeit Knieses, genug mit all den großen und kleinen Dingen zu tun, die jener in seiner etwas derben Art »Schurkereien« nannte. Eben weil sie nur für Bayreuth lebte, alles zu Bayreuth in Beziehung setzte, konnte ihr auch überall eine Meinung oder ein Streben fühlbar werden, die sich mit ihrer Auffassung nicht vertrugen. Da wirkte es beinahe wie ein Verhängnis, daß der Mitarbeiter, den sie als ein Vermächtnis des Meisters betrachtete, daß Hermann Levi ihr fortwährend Kummer und Ärger bereitete. Hätte er sich damit begnügt, seine Bayreuther Arbeit zu verrichten und in dem geweihten Bezirke, in dem er tätig war, von seinem Judentume keinen Gebrauch zu machen, so hätte Cosima über alle Zweifel, Vorwürfe und leichtfertigen Bemerkungen, die ihr zugetragen wurden, mit ihrer gewohnten gleichmütigen Erhabenheit hinweggehen können. Doch Levi selbst kam immer wieder mit der Frage, ob er als Jude nach Bayreuth gehöre – was ihm in unseren Augen nur zum Lobe gereicht –, und fühlte sich andererseits nicht selten durch den sachlichsten Widerspruch und rein persönliche Gegensätze tief verletzt, weil er dies alles auf sein Judentum bezog und nie die Unbefangenheit aufbrachte, die damals noch bei den Deutschen im Verkehre mit den Juden bis zur Ahnungslosigkeit vorhanden war. In Levi haben wir geradezu ein Musterbeispiel dafür, daß jüdische Intelligenz und jüdische Kunstbegabung, auch wenn sie sich mit Eifer die deutsche Kultur anzueignen suchen und zunächst nichts Arges im Schilde führen, dennoch nie zu dem gelangen, was die notwendige Voraussetzung für ein klares Erkennen und redliches Wollen ist. »Unschuldige Unbefangenheit« nannte es Chamberlain in seiner Einführung zu den Briefen Wagners an Levi in den »Bayreuther Blättern«. Der Jude fühlt sich immer schuldbewußt; er leidet an der Schuld seines Stammes, auch wenn sie ihm gar nicht vorgehalten wird oder im bestimmten Falle keine entscheidende Rolle spielt. Das trübt seine Erkenntnis und vergiftet seine menschlichen Beziehungen. Der in der Münchner Staatsbibliothek vorhandene Briefwechsel Levis mit Cosima wird noch einmal gründlich auszuschöpfen sein. Er zeigt uns das Bild Cosimas von der weiblichsten Seite – Treue und Beharrlichkeit! – und verrät uns andererseits keinen klaren, unverwischbaren Zug im Wesen des zweifellos gebildeten und geistvollen Juden. Je länger wir uns mit ihm befassen, desto mehr zerrinnt er gleichsam unter unseren Händen, und zuletzt haben wir nur das Gefühl teils der bewußten Verneinung, teils einer hoffnungslosen Leere, so daß wir über die Beharrlichkeit Cosimas staunen und ihre Treue kaum verstehen können.
Ein Brief von 1894 beleuchtet das eigenartige Verhältnis. Levi war – aus den angedeuteten Gründen – fast immer uneins mit seiner Umgebung. Er vertrug sich nicht mit dem Stammesgenossen Ernst von Possart, dem Münchner Intendanten, dessen Generalmusikdirektor er war, und er vertrug sich noch viel weniger mit dem deutschen Wiener Felix Mottl, mit dem er sich in die Bayreuther Arbeit zu teilen hatte. Verständlich ist es, daß ihm einer der Musiker, die zur Bayreuther Assistenz gehörten, äußerst unerwünscht war und daß es ihn schwere Überwindung kostete, diesen Mann als seinen (wenn auch untergeordneten) Mitarbeiter zu betrachten: Oskar Merz, der schon von Wagner zum Dienste beim »Parsifal« herangezogen worden war und der als Musikberichterstatter der Neuesten Nachrichten die Münchner Tätigkeit Hermann Levis einer strengen, meist ablehnenden Beurteilung unterzog. In München also war Merz ein ausgesprochener Gegner Levis. Das wollte ihn dieser in Bayreuth entgelten lassen. Er verlangte seine Entfernung. Cosima sträubte sich dagegen und bat Groß, die Sache in Ordnung zu bringen. Dies gelang jedoch nicht. Levi erklärte vielmehr, daß er für immer weichen müsse, wenn Merz bleiben sollte. Darauf schrieb Cosima an Groß: »Wenn Levi darauf besteht, daß Merz entlassen wird, so bitte ich, dieses Merz zu schreiben und auch denjenigen zu melden, welche verwundert sein werden, daß ein im Jahre 1882 Eingesetzter plötzlich nicht mehr fungiert. Und es versteht sich von selbst, daß, wenn die Frage so gestellt wird, zwischen einem musikalischen Assistenten und dem Dirigenten des Parsifal, wir auf Seite des Dirigenten sind. Ich möchte aber Levi seine Handlungsweise zu bedenken geben, da ich überzeugt bin, daß er sich über diese nicht klar ist. Wenn es sich darum handelt, Oskar Merz neu anzustellen, so würde ich begreifen, daß er sein Veto gegen diese Wahl einlegte. Ihn aber entlassen, welcher im Jahre 1882 genommen wurde, liegt eigentlich nicht in unserer Macht und ist ein Akt der Willkür und der Rache. Wenn Levi sagt, es störe ihm die Stimmung, so jemandem zu begegnen, so erwidere ich: Er verkehrt doch jeden Tag mit jemandem wie Possart, der ihn nach seiner eigenen Aussage auf das roheste behandelt … Und daß Merz die Dinge, die er tut, öffentlich begeht, scheint mir ein großer Milderungsgrund zu sein. Levi hat Dir gesagt, man würde ihn für charakterlos halten, wenn er mit Merz zugleich hier mitwirke. Ich erwidere hierauf, daß es ziemlich einerlei ist, was die Menschen von einem sagen oder nicht, und daß es nur darauf ankommt, was man von sich selbst sagt. Dieser Vorwurf der Charakterlosigkeit ist Levi bei ganz anderer Beziehung gemacht worden. Es gibt Menschen, die es nicht verstehen, daß, nachdem er hier zum ersten Dirigenten Bayreuths geworden ist, er noch Umgang pflegt mit Menschen, die als die berüchtigsten Gegner von Bayreuth gelten müssen … Er macht sich daraus nichts, und ich gebe ihm recht. Aber dann muß er konsequent sein und nicht gleichsam sagen, das schändliche Benehmen gegen Bayreuth ist mir einerlei, wenn aber meine Person angegriffen wird, dann stehe ich meinen Mann! Wenn Levi sich das Leben und das Regieren aller guten Fürsten betrachten wird, u. a. auch Kaiser Wilhelm I., so wird er sehen, daß sie niemals Notiz von persönlichen Feindseligkeiten nahmen und daß ihre Verwaltung meistens aus Menschen bestand, die einander nicht ausstehen konnten und doch der Sache gemeinsam dienten. Gib ihm das in seinem Interesse freundlichst zu erwägen und versichere ihm, daß, wenn er wirklich bei Gelegenheit des Parsifal nicht das Böse mit Gutem vergelten kann, wir auf seine Bedingungen eingingen und auf seinen ausdrücklichen Wunsch den nicht von uns Angestellten entließen.«
Wir sehen hier, daß Cosima grundsätzlich niemand preisgab, der vom Meister selbst »eingesetzt« war, daß sie Streitigkeiten unter den Angestellten grundsätzlich nicht an sich herankommen ließ und daß sie von denen, die der gemeinsamen Sache dienten, Selbstlosigkeit verlangte. Die Kunst Bayreuths war ihr untrennbar von seelischer Würde. In diesem Falle gaben beide nach: Levi zog seine Erklärung zurück, Merz aber blieb freiwillig fern. Es war das letzte Jahr, in dem Levi nach Bayreuth kam, wodurch die Bahn für Merz wieder frei wurde.
Bei den wiederholten Verstimmungen, die den regen und freundschaftlichen Verkehr Cosimas mit Levi beeinträchtigten, wurde die Judenfrage freimütig erörtert. Im Festspielbetriebe wollte Cosima nichts von den »Bevorzugten« wissen. Damit waren jene Künstler gemeint, die in München und anderswo stets als erste ans Ziel kamen: Juden und Jüdinnen. Mit Levi machte sie eine Ausnahme, oder vielmehr: er war durch seine Berufung für den »Parsifal« ein Fall für sich, der keinen Vergleich zuließ. Einige Briefstellen mögen uns dies vergegenwärtigen.
»Von so verschiedenen Punkten auch wir ausgehen und so verschiedene Bahnen wir wandeln, wir haben miteinander auszuhalten und müssen uns gegenseitig ertragen … Sie können mich der Kleinherzigkeit beschuldigen, daß ich ein Verhältnis, welches ich als unlösbar betrachte, Ihnen nicht erleichtere … Ebensowenig wie ich mich vom Leben willkürlich scheiden könnte, ebensowenig verstehe ich es, mich von dem Auferlegten eigenwillig zu trennen.«
»Die Eigenschaften, die bei Ihnen mich verletzen, gehören Ihrem Stamme an und alles Gute und Vortreffliche ist Ihr eigen und kann daher nicht hoch genug gerühmt werden. Bei mir ist's umgekehrt: das Gute habe ich ererbt … das Üble hingegen ist ganz mein eigen … Nun seien Sie großherziger gegen mich, als ich es gegen Sie war, und lassen Sie es uns noch einmal miteinander versuchen.«
»Nichts, auch das Gereizteste meinerseits, könnte Sie jemals berechtigen, anzunehmen, daß ich unsere Beziehung anders gestalten möchte, als sie war, ist und mit Gottes Hilfe und Ihrem herzlichen Beistand sein wird … Diejenigen, die das Glück haben, das Christentum zu besitzen, haben es auch für andere.«
Im vertraulichen Briefwechsel mit Mottl und mit Groß aber machte sie gelegentlich ihrem Unwillen Luft. »Diese Überzeugungslosigkeit bei allem!« Levi »ist die wandelnde Lüge unserer Zustände«. Er hat »das jüdische Unwesen in einem Grade, welches den Verkehr recht peinlich macht. Alles wird ihm zum Geschwätz! Sorge und Gram und alles! Verzeih die Stimmung, ich habe aber gerne, wenn ein Mann ein Mann ist«. Doch betonte sie auch Groß gegenüber, daß weder sie noch Levi befugt sei, die Dinge zu ändern. Dann faßte sie Stimmung und Urteil in dem Stoßseufzer zusammen: »Mit diesem Stamm, mein lieber Adolf, bleibt es ein ewiges Elend.« –
Keine Ferien! Die Sorge Cosimas galt auch dem Bestande des Unternehmens. Es mußte alles verhindert werden, was die Stellung Bayreuths durch Irreführung der öffentlichen Meinung gefährden konnte. Eine solche Gefahr drohte von München. Dort war man auf Wagner und die Seinen noch immer nicht gut zu sprechen, und der Erfolg Bayreuths weckte bei jenen, die Kunst und Geschäft nicht voneinander zu trennen wissen, das lebhafte Bedauern, daß der ursprüngliche Plan, das Festspielhaus in München zu errichten, nicht verwirklicht worden war. Hierfür war der Münchner Lokalpatriotismus ein willkommener Bundesgenosse. Noch stärker aber wirkten die »lokalen Interessen«, die den Gelderwerb zum Ziele hatten. Es möge einer unparteiischen Geschichtsschreibung überlassen bleiben, die vielfältigen und nicht leicht durchschaubaren Zusammenhänge aufzudecken, durch die damals die Raffgier des internationalen Judentums mit den anständigsten und ehrlichsten Absichten Gutgesinnter verknüpft wurde. Vom Standpunkte der Geschichte Bayreuths waren die Pläne, die am Ende des Jahrhunderts in München auftauchten, nichts anderes als die geplante Vernichtung der Bayreuther Festspiele, unter kluger Ausnützung des Festspielgedankens. Daß Bayreuth vor den täglich spielenden Opernbühnen nicht zurückzuweichen brauchte, das sah nun jedermann ein. Doch eine Bayreuth ähnliche Bühne in München – das erschien wie das Ei des Kolumbus.
Zuerst wurde die Nachricht verbreitet, das Bayreuther Festspielhaus – der Notbau, mit dem Wagner sich begnügt hatte und der bis heute tadellos gebrauchsfähig ist – sei baufällig und feuergefährlich, mit der Fortsetzung der Festspiele sei daher nicht mehr zu rechnen. Die amtliche Untersuchung ergab alsbald die Unwahrheit dieser Behauptung. Die von der Regierung entsendeten Fachleute stellten sogar fest, daß das Festspielhaus bei einem Brande größere Sicherheit biete als jedes andere bayerische Theater. Inzwischen war bereits die Gründung eines neuen »Festspielhauses« in München in Gang gekommen: des Prinzregententheaters in der Vorstadt Bogenhausen, dessen Errichtung naturgemäß vielen Grundbesitzern und Geschäftsleuten reichen Gewinn brachte. In diesem Theater, für dessen Bauweise Bayreuth als Vorbild diente, sollten vorzugsweise die Werke Wagners im Sommer oder Herbst mit größter Sorgfalt und in glänzender Darbietung aufgeführt werden. Dies hätte allerdings durch die Wagnerschen Erben schlechthin vereitelt werden können. Denn die von der Münchner Generalintendanz erworbenen Aufführungsrechte galten nur für die Hoftheater und für kein anderes, auch wenn dieses von der Intendanz gemietet wurde. Die Erben waren demnach in der Lage, Wagner-Aufführungen im Prinzregententheater zu untersagen. Cosima ging aber nicht so weit. Sie stellte nur gewisse Bedingungen, für die sich Groß in der geschicktesten Art einsetzte. Er machte keinen Schritt ohne ihr Wissen und ihr Einverständnis, während sie nur durch ihn in die Verhandlungen eingriff. Das Haupt und die Seele des Münchner Feldzugsplanes war Ernst von Possart, der Verhandlungsleiter der Geheime Rat von Klug. Dieser rückte immer mehr vom Generalintendanten ab und entsprach damit dem Wunsche des Prinzregenten, der nach dem verstorbenen König das Protektorat über die Bayreuther Festspiele übernommen hatte und der zwar jetzt dem neuen Theater seinen Namen gab, dessen rechtlicher und ritterlicher Sinn es jedoch niemals zugelassen hätte, daß der Wille Ludwigs II. verleugnet oder verfälscht worden wäre und daß die wohlerworbenen Rechte der Wagnerschen Erben vom Münchner Hofe her eine Beeinträchtigung erfahren hätten. Nach halbjährigem zähem Ringen war die Vereinbarung geschlossen, die den Wünschen Cosimas gerecht wurde: Die in Bayreuth zur Mitwirkung aufgeforderten Künstler, zu denen auch der Kapellmeister zu zählen war, durften im selben Jahre nicht an den Aufführungen im Prinzregententheater teilnehmen und dieses durfte – abgesehen vom »Parsifal«, der gänzlich außer Frage blieb – jeweils nur solche Werke bringen, die nicht zum Bayreuther Spielplane desselben Jahres gehörten. In dieser Form hat das Prinzregententheater tatsächlich den Bayreuther Festspielen bis heute nicht geschadet und ist auch ebensowenig in seiner Entwicklung durch Bayreuth gehemmt worden.
Der Münchner Angriff war demnach abgeschlagen, wenn auch die Gegensätze nach beliebter Art noch weiterhin in der Presse zum Ausdrucke kamen und hierbei, wider bessere Kenntnis, der Familie Wagner eine übermäßige Bereicherung durch das »Monopol« der Bayreuther Festspiele vorgehalten wurde. Alle, die einen Nutzen davon haben konnten, forderten, »daß die Werke des größten Meisters der Nation überall zugänglich zu machen« seien. Dies zielte hauptsächlich auf den »Parsifal«, der nach wie vor das Bayreuther Festspiel war. Aber mit dem Ablaufe der durch das Urheberrecht gewährten Schutzfrist mußte er frei werden, sofern nicht bei der bevorstehenden Erneuerung des Urheberrechtes eine gesetzliche Ausnahmebestimmung getroffen wurde. Hier also gab es eine neue Aufgabe. Dies um so mehr, als das Werk im Auslande durch das zunächst nur für Deutschland gültige Urheberrecht keineswegs überall in der gleichen Weise geschützt war. Das machten sich Unternehmer in Holland und in den Vereinigten Staaten zunutze. In Amsterdam wurde nach einer vollständigen Aufführung des »Parsifal« im Konzertsaale auch eine vollständige Bühnenaufführung zustande gebracht, und zwar als geschlossene Vorstellung für einen zu diesem Zweck gegründeten Wagner-Verein. Hier war also, wenn auch in heuchlerischer Weise, der Schein einer gewissen Rücksicht auf den Willen Wagners und auf die Rechte seiner Erben gewahrt. Der New-Yorker Operndirektor Conried jedoch setzte ganz offen die Theateraufführung ins Werk und verpflichtete hierzu den Münchner und Bayreuther Spielleiter Fuchs und die Bayreuther Sänger van Rooy und Burgstaller. Das wäre allerdings fruchtlos gewesen, wenn er keine Partitur gehabt hätte. Aber der Verleger des »Parsifal«, Schott in Mainz, hatte von Siegfried Wagner die Erlaubnis erhalten, eine kleine Studienpartitur für den Handgebrauch zu veröffentlichen. Diese trug wohl den Vermerk, daß sie nicht für Aufführungen verwendet werden dürfe. Doch sie war vorhanden und ermöglichte also dort, wo es keine gesetzlichen Hindernisse gab, ihren freien Gebrauch zu beliebigem Zwecke. Auch Conried wahrte zunächst den Schein und verpflichtete die genannten Künstler nur im allgemeinen zu einem Gastspiele in New York, für das er eine nach europäischen Begriffen märchenhafte Entschädigung bot. Erst nachdem die Verträge unterzeichnet waren, erfuhren die Getäuschten, daß sie nun auch, dem New Yorker Spielplane gemäß, im »Parsifal« mitzuwirken hätten. Für den Fall ihrer Weigerung drohte Conried mit den höchsten Konventionalstrafen, und eine freundschaftliche Einwirkung auf die Künstler von Bayreuth her, daß sie die Verträge rückgängig machen sollten, konnte als Verleitung zum Kontraktbruche ausgelegt und verfolgt werden. Aber Conried hatte noch den schärfsten Pfeil im Köcher. Der musikalische Leiter des »Parsifal« sollte Mottl sein. Dieser ließ sich nun allerdings auch nach New York verpflichten, aber mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß er dort weder eine Probe noch eine Aufführung des »Parsifal« zu leiten habe. Aus diesem Grunde trat auch keine Entfremdung zwischen ihm und der Meisterin ein, während es sich für diese von selbst verstand, daß die anderen Künstler, die Bayreuth untreu geworden, nie mehr dorthin zurückkehren durften. Um so leichter waren sie nun aber für München zu gewinnen, und das von Cosima erhoffte Ausnahmegesetz für den »Parsifal« war durch den Streich Conrieds ein für allemal vereitelt. Denn niemals würde die »öffentliche Meinung« zugeben, daß ein deutsches Meisterwerk der Nation vorenthalten bleiben solle, das die Amerikaner genießen und bewundern durften. Der »Gralsraub« Conrieds war rechtlich unanfechtbar und der Münchner Schriftsteller Georg Michael Conrad, der in der tapfersten Weise dagegen auftrat, mußte sich sogar eine gerichtliche Verurteilung gefallen lassen.
Beinahe noch empfindlicher wurde Cosima dadurch getroffen, daß Mottl gleich nach seiner amerikanischen Reise zum Generalmusikdirektor des Münchner Hoftheaters ernannt wurde. Levi war 1900, sein Nachfolger Hermann Zumpe 1903 gestorben. Also Mottl Generalissimus in der feindlichen Hauptstadt! Gewiß auch der treueste Freund – aber wenn wieder ein Krieg zwischen München und Bayreuth ausbrechen sollte, durch berufliche Rücksichten eng gebunden. Andererseits freilich durch seine Freundschaft und Gesinnung ein Bürge gesicherten Friedens und verständnisvollen Zusammengehens. Das Schmerzliche war, daß nach dem Verluste der Bayreuther Sänger, die nach New York gingen, nun auch der engste Kreis der künstlerischen Oberleitung in Bayreuth gesprengt war, daß Mottl gewissermaßen die Bayreuther Familie verlassen hatte und daß sein großer und anspruchsvoller neuer Wirkungskreis ihn dem Hause Wahnfried allmählich entfremden mußte. Das trotzdem weiterbestehende sehr vertrauensvolle Verhältnis zwischen Mottl und Cosima kommt in ihrem Briefwechsel zum Ausdruck. Cosima hat sich vielleicht nie so frei und froh gegeben, wie im Verkehre mit dem geliebten »Spielmann«, der ihre mütterlichen Ratschläge und besorgten Warnungen stets dankbar entgegennahm. Dieser »Sohn« stand ihr nun nicht mehr zur Seite. –
Die Dahingabe des »Parsifal« an eine geschäftstüchtige Außenwelt hat sie nicht verhindern können. Als 1901 die Verlängerung der dreißigjährigen Schutzfrist im Deutschen Reichstage beraten wurde, gab sich unter den Volksvertretern ein starker Widerwille gegen die Familie Wagner kund, die doch einzig und allein durch die Verlängerung der Schutzfrist bereichert werden könne. Man warf ihr gleichsam vor, daß die Werke Wagners so hohe Einnahmen brachten, und hielt natürlich auch Bayreuth für eine ergiebige Einnahmequelle. Cosima, die sich und die Ihren auf »amerikanische« Art bereichern konnte, wenn sie noch vor Ablauf der Schutzfrist den »Parsifal« nur für fünf Jahre einem geschickten Unternehmer hätte überlassen wollen, erklärte ausdrücklich, daß sie im Gegenteile für sich und ihre Nachkommen auf die Erträgnisse aus der verlängerten Schutzfrist aus allen Werken verzichten wolle, wenn ihr dafür der Schutz des »Parsifal« gewährt werde. Aber dieselben Juristen und Politiker, die ihr Eigennutz vorgeworfen hatten, machten ihr nun sofort begreiflich, daß ein solcher Verzicht unzulässig sei: es handle sich um ein allgemeines Gesetz, nicht um eine Familienangelegenheit. Vergeblich legte Cosima den Mitgliedern des Deutschen Reichstages eine Denkschrift vor, die dann auch in den »Bayreuther Blättern« abgedruckt wurde: ein Muster- und Meisterstück in der knappen und eindringlichen Darlegung aller in Betracht kommenden Umstände, aller maßgebenden Rücksichten. Mit den einfachsten und einleuchtendsten Gründen befürwortete sie die Verlängerung der Schutzfrist im allgemeinen, stellte aber die »Parsifal«-Frage in den Mittelpunkt und bat öffentlich um den Schutz des Bühnenweihfestspieles. Das Schriftstück gipfelte in den Sätzen: »Richard Wagners Wunsch und Wille war es, daß sein Theater einzig auf dem Hügel zu Bayreuth stehe und daß einzig in diesem Hause sein Bühnenweihfestspiel ›Parsifal‹ aufgeführt werde. Dies ist sein Vermächtnis an die deutsche Nation.« Doch die Nation, sofern sie durch den Reichstag vertreten war, wollte von diesem Vermächtnisse nichts wissen. So ging es denn 1913, als die dreißig Jahre nach dem Tode Wagners zu Ende gingen, in der Tat um ein Ausnahmegesetz, um eine Sonderbestimmung für den »Parsifal« als nationales Heiligtum. Aber dieser Zeitpunkt war noch ungünstiger. Wohl gab es eine Bewegung in allen deutschen Gauen, an der die besten Künstler und Schriftsteller teilnahmen und die das Gewissen des deutschen Volkes oder vielmehr seiner verfassungsmäßigen Vertretung aufzurütteln suchte. 18 000 Unterschriften wies die Petition an den Reichstag auf, die ein Sonderrecht für den »Parsifal« verlangte. Doch die Unterzeichneten konnten nicht den Nachweis ihrer Wahl durch soundso viele Steuerträger erbringen; die 18 000 wurden nicht gewogen, sondern nur gezählt und neben den vielen Millionen deutscher Staatsbürger zu wenig befunden. Die abermalige Veröffentlichung jener Denkschrift Cosimas und die zahlreichen Bücher, Hefte, Flugblätter und schönen Aufsätze, die sich mit dem Gegenstande befaßten, hatten schließlich keine andere Wirkung, als daß alles beim alten blieb, daß der »Parsifal« zur vorbestimmten Zeit frei wurde und – daß er, kraft seiner Eigenart und durch den Segen Bayreuths, auch heute noch das Bayreuther Festspiel ist, kaum berührt von den seltenen und mehr oder weniger unzulänglichen opernmäßigen Darbietungen.
Cosima hat nicht lauter Siege erfochten, doch sie hat fast immer recht behalten.
Eine Frau, eine Mutter hat niemals Ferien. In den Jahrzehnten, die hier im Fluge durchmessen wurden, war auch Cosimas häusliches Leben von Freud' und Leid erfüllt, von mancherlei Unruhe bewegt.
In eben der Zeit, in der die Festspiele sich dem Gipfel künstlerischer Vollendung näherten, neigte sich das Leben Hans von Bülows dem Ende zu. Der rastlose Kämpfer war inzwischen, trotz zunehmenden körperlichen Beschwerden geistig unermüdet, zu seinem letzten und höchsten Ruhme gelangt. Mit dem Meininger Orchester hatte er, viele Städte bereisend, ein neues Muster für den orchestralen Vortrag aufgestellt und seinem geliebten Meister Johannes Brahms die Bahn gebrochen. Auch als Klavierspieler gab er bis zuletzt das großartige Beispiel einer edlen und tiefdringenden Vortragskunst, so daß jetzt auch ein jüngeres Geschlecht, das seinen Aufstieg nicht erlebt hatte und von seiner bewegten Vergangenheit, seinen künstlerischen und menschlichen Abenteuern geringe Kenntnis hatte, ihn als ein Vorbild bewunderte, und daß in dieser Bewunderung sich die Bayreuther und die Wagnerianer mit den anderen, die mehr zu Brahms neigten, und mit allen, denen die früheren Ideale Bülows fremd waren, widerspruchslos einigten. Er selbst nannte sich einen »reformatorischen« Musiker und meinte, daß er nur als solcher »Existenzberechtigung« habe. Dabei war sein persönliches Auftreten vielleicht noch schärfer geworden, und es gab immer wieder die merkwürdigsten Zusammenstöße des in seinen Worten und Witzen niemals Vorsichtigen mit Dienststellen, Zunftgenossen und der Öffentlichkeit. Einer dieser Zusammenstöße, der viel von sich reden machte, führte sogar zu seiner Hinausweisung aus der königlichen Oper in Berlin. Kennzeichnend für seine Geisteshaltung und seine Charakterfestigkeit war die Tatsache, daß er Nietzsches Abfall von Wagner tief bedauerte und dessen aufsehenerregende erste Schrift gegen Wagner als »partielle Tollheit« bezeichnete; und ebenso die Tatsache, daß er nicht nur Brahms förderte, sondern auch für den jüngsten Stern am Musikerhimmel, für Richard Strauß, warme Zuneigung hegte, trotz dessen unverkennbarer Anlehnung an Wagner und an – Liszt; er selbst hatte ihn zu seinem Nachfolger in Meiningen vorgeschlagen. Kennzeichnend für ihn war auch seine jugendliche Begeisterung für Bismarck, der er bei verschiedenen Gelegenheiten in mannigfacher Form Ausdruck verlieh. Die wiederholt an ihn gerichteten Anfragen aus Bayreuth, die sich auf die früheren, von ihm geleiteten Aufführungen Wagnerscher Werke bezogen und den Zweck hatten, bei den Festspielen ja nichts zu versäumen, was zur rechten Wagnerschen Überlieferung gehörte, beantwortete er stets mit größter Gewissenhaftigkeit, so daß man ihn beinahe als Mitarbeiter Bayreuths bezeichnen könnte. Außer mit Daniela und Blandine kam er gelegentlich auch mit Blandinens Gatten, mit Isolde und mit Siegfried Wagner zusammen, was ihn mächtig bewegte, jedesmal aber mit den angenehmsten persönlichen Eindrücken verbunden war. Es bleibe unentschieden, ob der in München erwogene Gedanke, ihm dort einen neuen Wirkungskreis zu eröffnen, im Sinne der immer wieder auftauchenden Gegnerschaft gegen Bayreuth oder im Sinne eines Ausgleiches und einer Versöhnung aufzufassen war. Die Neuesten Nachrichten hatten von der Intendanz verlangt, sie solle »den Feldherrn ersten Ranges aus den musikalischen Befreiungskriegen« an seine einstige Arbeitsstätte berufen und so eine »große Epoche« wieder aufleben lassen. Possart sah sich bemüßigt, eine Anfrage an den Künstler zu richten, ob er der Sache nähertreten wolle. Bülow jedoch, der soeben seine dritte amerikanische Reise hinter sich hatte, antwortete: » Bevor ich so unklug gewesen, meinen Rest von Kraft und Gesundheit in Amerika zu ruinieren, wäre meinerseits vielleicht die physische Möglichkeit vorhanden gewesen: eine moralische niemals.«
Das mit der physischen Unmöglichkeit war keine Ausrede. Sein Gesundheitszustand hatte sich immer mehr verschlechtert. Die Kraft, mit der er sonst die schwersten Anfälle überwunden und sich für kurze Zeit immer wieder neu verjüngt hatte, ließ ihn jetzt im Stiche: seine Nerven waren vollkommen zerstört, zu den mit Schwindel und Ohnmachten und mit heftigem Fieber verbundenen schmerzhaften Zuständen aller Art kam auch eine gefährliche Erkrankung der Nieren. Nachdem wiederholte Luftveränderung und verschiedene, zum Teil gewaltsame Heilverfahren erfolglos geblieben waren, hoffte er auf Ägypten. Diese Hoffnung war geweckt durch die wunderbare Wirkung, die die afrikanische Sonne auf Richard Strauß ausgeübt hatte, der von einem höchst bedrohlichen Lungenleiden am Nil genesen war und nach seiner Rückkehr sich dem befreundeten Meister vorstellte. Schon war Bülow gegen alle weiteren Versuche, ihm zu helfen, sehr mißtrauisch geworden. Diesmal aber betrieb er selbst mit einer gewissen Hast seine Abreise. In Triest nahm er von Daniela Abschied, die ihm noch auf das Schiff das Geleite geben konnte. Sie berichtete darüber einer Freundin: »Sein Anblick machte mich hoffnungslos, er sah aus wie ein Sterbender, der Glanz der geliebten Augen war erloschen, sein Geist, seine ganze Natur waren ein Hindämmern. Er konnte kaum mehr stehen oder gehen. Wie ein krankes, müdes, himmlisch geduldiges Kind lehnte er in meinen Armen … Die wenigen Worte, die er sprach, waren Worte des Segens für mich.« Dies war am 2. Februar 1894. Am 7. traf er mit seiner Gattin in Kairo ein. Am nächsten Tage erlitt er im Gasthofe einen Schlaganfall. Einige Stunden später wollte er aus dem Bette springen. Auf die Frage seiner Gattin: »Was willst du?« sagte er: »Ungehinderte Bewegung!« Das waren seine letzten zusammenhängenden, deutlichen Worte. Am 9. wurde er in das deutsche Diakonissenhospital in Kairo gebracht, wo ihm aber nichts mehr Rettung bringen konnte. Am 12. um halb acht Uhr abends, zu eben der Stunde, in der er unzählige Male das Konzertpodium betreten hatte, fast auf den Tag genau elf Jahre nach dem Tode Richard Wagners, schied er aus dem Leben. Die Leiche wurde einbalsamiert und von einem deutschen Schiff auf langer, einsamer Fahrt durch drei Meere nach Hamburg gebracht, wo sie am 22. März eintraf und am 29. den Flammen übergeben wurde.
Diese Totenfahrt aus der Fremde in die Heimat, vom Sterbelager zur Einäscherung, hat später Cosima in ein dichterisches Gleichnis gefaßt:
»Von der milden See mit den bunten Ufern
Wandert das Schiff zu dem wild wogenden Meer.
Wellen umschäumen es, sich hebend und brechend,
Eintönig Geräusch auf der wüsten Öde,
Drüber die Wolkenschicht in schwerer Last,
Unabsehbare Nacht dehnt sich über Himmel und Flut:
Einsam unbeweglich stumm fährt in heil'ger Ruh'
Der rastlose Ungestüme durch des Lebens schauriges Meer:
Da – an Tristans Fels
Hebt die Sinkende sich noch einmal vor dem Untergang:
Überströmt blutig golden Wasser und Himmel,
Erhebt sich und sagt: Ich komme, ich scheide
Und scheuche scheidend das nächtliche Heer,
Banne der Böen dunkle Wut,
Gebe dir Einsamen mein göttlich Geleit!
Erhebe, Ermatteter, dich zu mir,
Und ich singe feierlich dir mein Lied:
›Heil dir, Lauterer, meine Boten, die Strahlen, grüßen dich!
Heil dir, Mutiger, sieh mein Gewand, wie es dich umfängt!
Heil dir, Edelguter, das Himmelsauge saugt dich ein,
Heil dir, Feuriger, die leuchtende Mutter übergibt dich der Glut!‹«
Dreieinhalb Jahre später starb Biagio Gravina, der Schwiegersohn Cosimas, mit Zurücklassung von vier Kindern, von denen heute nur noch Gilbert lebt, der die musikalische Begabung vom Großvater und vom Urgroßvater geerbt hat. Manfred, der Älteste, hat nach dem Kriege als unparteiisch gerechter, aber ausgesprochen deutschfreundlicher Kommissar des Völkerbundes in Danzig Achtung und Liebe erworben. Cosima fuhr selbst, wenige Wochen nach den Festspielen des Jahres 1897, nach Palermo, um ihrer Tochter beizustehen und auch bei den ersten Auseinandersetzungen mit den sizilianischen Behörden wegen des Nachlasses und der Familienrechte anwesend zu sein.
Trotz allem war sie in diesen Jahren am meisten von Hoffnung und Zuversicht erfüllt. Wie die Festspiele, sogar nach ihrem eigenen, stets vorsichtig abwägenden Urteile einen »glänzenden« Verlauf nahmen und wie nun ihr Sohn Siegfried an der Leitung der Festspiele in entscheidender Weise mitbeteiligt war, so ward sie vollends beglückt durch die Entwicklung Siegfrieds als ausübender Musiker und schaffender Tondichter.
Sein Ruf als Dirigent war sehr rasch außerhalb Bayreuths erprobt und gefestigt worden, und seine schöpferischen Versuche wurden nicht nur von seinen Angehörigen mit Aufmerksamkeit verfolgt. 1899 ist das Jahr, in dem er mit seinem ersten Bühnenwerke von sich reden machte. Wie sein Vater, besaß er sowohl die dichterische als auch die musikalische Begabung und verwendete beide nur im Dienste des Dramas: alle seine Opernbücher hat er sich selbst geschrieben, und nur eigene Worte hat er vertont. Dies verführte allerdings dazu, daß ein falscher Maßstab an seine Werke angelegt wurde. Von Freunden und von Gegnern wurde die tondichterische Laufbahn Siegfrieds als ein tragisches Verhängnis dargestellt. Siegfried hat diese Auffassung in seinen »Erinnerungen« mit den liebenswürdigsten und verständigsten Worten abgewehrt. Er hat aber auch in seinen Werken nichts von dem Zwiespalt erkennen lassen, den ihm die Guten und die Bösen, mitleidig oder schadenfroh, andichten wollten. Die Errungenschaften Richard Wagners: das sinfonisch behandelte Orchester, die leitmotivische Verknüpfung der Partitur mit der Handlung und die freie Gestaltung der Singstimmen aus dem Wort und der Sprache hat er natürlich ebensowenig verleugnet, wie alle anderen, sei es bedeutenden oder mittelmäßigen, doch irgendwie zur Geltung gelangten zeitlichen Nachfolger Richard Wagners: er hielt sich nicht für befähigt und für berufen, einen neuen Stil zu schaffen, für den ja auch die geschichtlichen Voraussetzungen fehlten, und er wäre ebensowenig imstande gewesen, seine Erziehung und seine Umwelt zu verleugnen und sich gewaltsam in eine ältere Zeit zurückzuversetzen, die ihm ferner lag, als irgendeinem anderen. Es war ihm weder um einen umstürzlerischen Fortschritt zu tun, noch hätte er je irgend etwas wollen und vollbringen können, was man als Rückständigkeit bezeichnen durfte.
Für ihn wie für die Mehrzahl seiner künstlerisch empfindenden Zeitgenossen gab es nur zwei unverrückbare Grundlagen des Schaffens: das in die Zukunft weisende, die Gegenwart beherrschende Vorbild Richard Wagners in allen Fragen des Stiles und der Technik, und den so unerschöpflichen wie unvergänglichen Quell der Volksdichtung und des Volksliedes. Wer aus diesem Quell schöpfte, der konnte immer Neues finden und erfinden. Die deutsche Volkssage, die vom Mythos bis zum anmutig spielerischen oder drollig unterhaltsamen Märchen führt, von beiden aber sich dadurch unterscheidet, daß sie immer auch an geschichtliche Ereignisse anknüpft und nicht nur Sinnbilder gibt, sondern auch das wirkliche Leben des Volkes in seinen Hauptzügen festhält – die deutsche Volkssage und in engster Verbindung mit ihr der deutsche Volksbrauch, das sind die beiden Stoffgebiete, in denen Siegfried Wagner sich heimisch fühlte und denen er fast alle seine dramatischen Eingebungen verdankte. Es kann hier nicht eingehend erörtert werden, welche eigentümliche und urwüchsige Erfindungsgabe er in seinem Schaffen bewährt hat, welch reiches musikalisches Können er dabei entfaltete, wie feine und tiefe Züge er in seine bunten und reichen Handlungen verwob und wie doch alles stets den treuherzigen Ton seiner liebenswürdigen Persönlichkeit und der gemütvollen deutschen Volkssage bewahrte. Es muß und wird die Zeit kommen, in der jeder gebildete Deutsche weiß, was ihm Siegfried Wagner bedeutet, wie sehr dieser das Verständnis der deutschen Volksseele und des untilgbaren deutschen Wesens so vieler heimatlicher Überlieferungen geweckt und gefördert hat. Seine Kunst ist eine notwendige und fruchtbare Ergänzung der höher und weiter reichenden Kunst Richard Wagners, und sie birgt in sich das Trauliche und Herzliche, manchmal auch das köstlich Schnurrige des Bayreuther Dichters Jean Paul, dessen Vorliebe für die Romantik und den Humor der kleinen Dinge und der nicht großen, aber echten und lieben Menschen. Echt und deutsch, »schlicht und rein«, wie Cosima sagte, war auch Siegfried selbst, und der friedvolle Zauber seines gütigen Wesens, seiner erwärmenden Heiterkeit spricht aus den eigentümlichsten Zügen seiner Werke.
Das war freilich am Ende des vorigen Jahrhunderts kein Empfehlungsbrief. Die Welt, auch die »deutsche«, hatte sich zur Not mit Richard Wagner und mit Bayreuth abgefunden. Es war zu viel von ihr verlangt, wenn sie nun auch die Neigung und die Fähigkeit dazu aufbringen sollte, sich mit einer so unerwarteten und nicht leicht zu fassenden Erscheinung wie Siegfried Wagner auseinanderzusetzen, einer künstlerischen Erscheinung, die zwar dem unbefangenen Sinne leichter verständlich war als die des großen Vaters, die aber allem, was damals die Kunst und den Geist gepachtet hatte, doch noch viel fremder war und eben dadurch auch manchen Freund befangen machte. Und die Art, wie ein Teil der Presse die Erfolge Siegfrieds zu verkleinern suchte, war nicht frei von giftigen Bosheiten und albernen Taktlosigkeiten. So brachte der Aufstieg des Sohnes dem mütterlichen Herzen Freud' und Leid. Doch die Freude überwog. »Der Bärenhäuter« und »Herzog Wildfang« 1899 und 1901 in München, »Der Kobold« 1904, »Bruder Lustig« 1905 und »Sternengebot« 1908 in Hamburg, »Banadietrich« 1910 und »Schwarzschwanenreich« 1918 in Karlsruhe, »Sonnenflammen« 1918 in Darmstadt, aber auch viele Aufführungen in anderen Städten, die den günstigen Eindruck der Uraufführungen bestätigten und zum Teil übertrafen, das waren Feiertage und Festzeiten im Leben Cosimas, der das hohe Glück zuteil wurde, im Alter den Sieg der Jugend miterleben zu können, einer Jugend, die ein Teil von ihr war. Von den Menschen, die ihr teuer sein sollten, verlangte sie nun vor allem, daß sie ihrem Sohne geneigt seien. Diese mütterliche »Einseitigkeit« wird jeder verstehen, der es mitfühlen kann, wie sie besonders in der Zeit, in der auch die Bayreuther Arbeit immer mehr den Händen des Sohnes anvertraut wurde, nur noch mit diesem hoffte und bangte. Niemals aber ließ sie sich von denen überlisten, die eine besondere Schätzung Siegfrieds zur Schau trugen, um dadurch Vorteile in Bayreuth zu erlangen. Niemals hat sie sich bei der Zuteilung der Bayreuther Aufgaben durch unsachliche Erwägungen leiten lassen.
Der Kreis ihrer Lieben erweiterte sich immer mehr. Auch der Tod Gravinas hatte gleichsam ihre Familie vergrößert, da Blandine nach Deutschland zurückkehrte und in Bayreuth Aufenthalt nahm. Zu Weihnachten 1900 heiratete Isolde den Musiker Franz Beidler, der bei der musikalischen Assistenz beschäftigt war. Kniese stellte sein Amt zur Verfügung, da er vermutete, daß Cosima den neuen Schwiegersohn damit betrauen wolle. Sie erklärte jedoch ausdrücklich, daß keine »familiären Umstände« sie dazu bringen könnten, einen so verdienten Mitarbeiter zu entlassen, und daß sie auch das Opfer bringen würde, sich von ihrer Tochter zu trennen, wenn ihr Schwiegersohn sich eine leitende Stellung begründen wollte. In der Tat ging Beidler nach Rußland. Von dort kam er nach Bayreuth zurück, wo er sich als Festspieldirigent bewährte. Doch war es ihm nicht vergönnt, in Bayreuth Wurzel zu schlagen. Die Bayreuther Gesinnung, die Fähigkeit der selbstlosen Einordnung in das Ganze, war bei ihm zu wenig ausgebildet und brachte ihn in einen empfindlichen Gegensatz zu Siegfried Wagner.
Die bedeutungsvollste Ergänzung des Familienkreises war Ende 1908 die Vermählung Eva Wagners mit Chamberlain. Eva, die seit der Heirat Danielas fast alle Briefe für ihre Mutter schrieb und dieser auch sonst unschätzbare Dienste leistete, brauchte sie nicht zu verlassen. Chamberlain siedelte von Wien nach Bayreuth über und wohnte dort zuerst in Wahnfried, bis sein eigenes Haus, nur durch eine Straße getrennt, daneben errichtet war, und Eva konnte, solange nicht ihr Gatte selbst ihre hingebende Pflege in Anspruch nahm, täglich bei der Mutter sein. Diese Nachbarschaft und der vertraute Umgang mit dem Schwiegersohne waren für Cosima mehr als Familienglück. Hatte schon der Briefwechsel mit ihr einen Mann wie Chamberlain auf das fruchtbarste angeregt und bereichert, so lernten sich die beiden nun erst recht innig kennen und lieben, und es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn man die großartige Entwicklung, die Chamberlain in den letzten Jahrzehnten seines Lebens nahm und die aus dem »geistvollen Gelehrten« einen der geistigen Führer des deutschen Volkes machte, mit seiner Zugehörigkeit zum Hause Wahnfried in Verbindung bringt. Chamberlain hatte den Anschauungen Wagners und Cosimas gegenüber die Selbständigkeit seines Urteils oder seiner Gedankenrichtung stets in einer Weise gewahrt, die ihn vorübergehend in einen beinahe unfreundlichen Gegensatz zu Thode brachte, und er hatte auch so manchen mütterlichen Tadel von Cosima empfangen müssen. Von nun an war ihr gegenseitiges Einvernehmen in jeder Hinsicht ungetrübt.
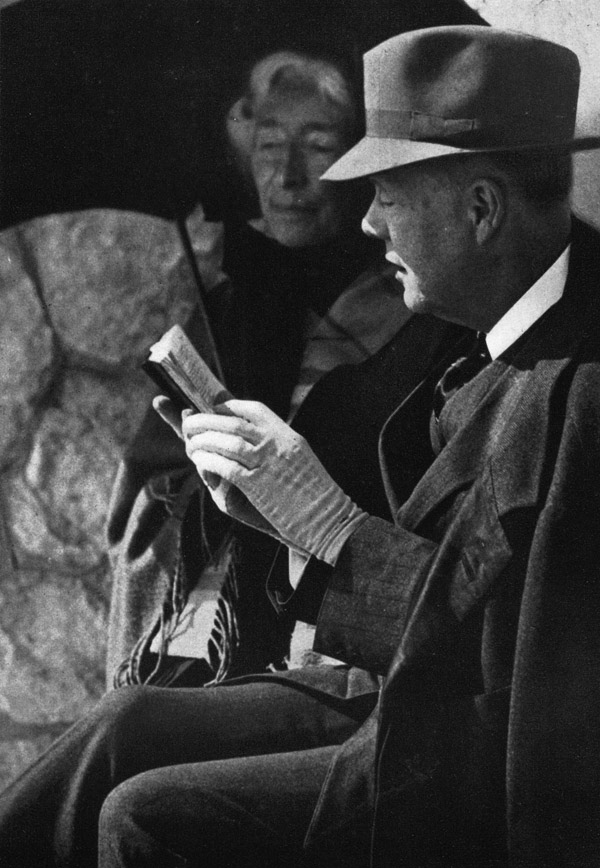
Cosima Wagner und Houston St. Chamberlain (1913).
Photo A. v. Groß

Cosima und Siegfried Wagner (1911).
Photo Hilsdorf
Schon 1893 hatte Chamberlain geschrieben: »Wenn mich etwas von anderen Leuten unterscheidet, die diese außergewöhnlich begabte Frau umgeben, so ist es tatsächlich meine absolute und völlige und unbändige Unabhängigkeit. Sie ist ein Genie – und da beobachte ich, daß alle Männer von Talent, die sich ihr nähern, sich entweder völlig unterwürfig vor ihr beugen oder aus ihrem Einfluß entweichen und ihr Widerstand leisten. Ich bin unfähig sowohl zu dem einen als auch zu dem anderen. Meine ehrfurchtsvolle Zuneigung zu der Witwe des Dichters, der den größten, die je gelebt haben, gleichzustellen ist, und mein Mitgefühl für das arme Menschenkind, deren Augen buchstäblich fast ganz erblindet sind in den Jahren unaufhörlicher Tränen, sind natürlich grenzenlos … Und was ihr Genie betrifft, so begreife ich nicht, wie das Talent des einen Menschen durch das eines anderen in Fesseln geschlagen sein sollte. Für mich ist sie die denkbar stärkste Anregung zum Schaffen und zum Wachwerden des Bewußtseins in mir von meinem eigenen Selbst; aber das ganz ebenso beim Widerspruch, wie bei der Übereinstimmung; unter ihrer Zustimmung wächst einem das Selbstvertrauen, und ihr Widerspruch zwingt einen, nochmals in die Tiefe zu tauchen und neue Beweisgründe zur Stützung seiner Überzeugung heraufzuholen, man wird sich seiner schwachen Stellen bewußt, und mit aller nichtigen billigen Oberflächlichkeit räumt man auf; kurz – anstatt daß die eigene kleine Individualität vernichtet wird, darf sie wachsen, blühen und ihre Wurzel tiefer und stetiger in den festen Grund der Natur senken.«
Das Zusammenleben in Bayreuth hat diese außerordentliche Wirkung der »außergewöhnlich begabten« Frau noch gesteigert. Zur Ehrfurcht, zum Mitgefühle und zu der in Widerspruch und Übereinstimmung gleich stärkenden und nährenden geistigen Anregung kam das traute Verhältnis verwandtschaftlicher Zusammengehörigkeit und eine täglich wachsende persönliche Zuneigung, in der für einen trennenden Gegensatz kein Raum war.
Die vollkommene Einheit Chamberlains und Bayreuths aber war verkörpert in seiner Gattin, der Tochter Richard Wagners. Von niemandem ist Chamberlain so verstanden und geliebt worden, wie von ihr. Die kirchliche Trauung hatte nicht in Bayreuth, sondern in Zürich stattgefunden. Da war es nun sehr ergreifend gewesen, daß der Pfarrer, der von den Lebensumständen des Paares wenig wußte, seine Rede in den Worten gipfeln ließ, daß sie nicht erst auf Gottes Segen zu warten hätten: sie besäßen ihn schon, Gott sei schon in dieser Ehe, und er warte auf die beiden Eheleute.
Einen Monat später schrieb Chamberlain aus Neapel von der Hochzeitsreise an Cosima, daß er und seine Frau Mühe haben, sich vorzustellen, sie hätten nicht von der ersten Stunde an zusammen gelebt.
Von weitem gesehen, nimmt es sich beinahe merkwürdig aus, daß Cosima mit den zunehmenden Jahren ein immer bewegteres Leben führte.
Zu ihrem Gallenleiden kam auch noch eine Erkrankung der Nieren und gesellten sich mancherlei Alterserscheinungen. Ihr kundigster und fürsorglichster ärztlicher Berater war der berühmte Dr. Ernst Schweninger, der Leibarzt Bismarcks, wenn dieser vor der Nachwelt ein besonderes Zeugnis für seine große Kunst nötig hätte, dann dürfte er sich außer auf Bismarck auch auf Cosima berufen, deren Leben er in erstaunlichster Weise verlängerte oder vielmehr: deren innerste Lebenskraft er im Kampfe gegen unablässige Beschwerden und Gebrechen so wunderbar stärkte, daß sie viele weit Gesündere überleben konnte. Zu Beginn des Jahres 1902, bald nachdem Isolde Beidler einen Knaben geboren hatte, verbrachte Cosima, von einer hartnäckigen Venenentzündung befallen, mehrere Wochen in dem von Schweninger geleiteten Krankenhause in Großlichterfelde bei Berlin. Sonst aber riet ihr der Arzt vor allem die Vermeidung rauhen Klimas und den Aufenthalt einmal auf den Bergen, dann im sonnigen Süden. So war sie schon um ihrer Gesundheit willen häufig unterwegs.
Doch in der Zwischenzeit gönnte sie sich erst recht keine Ruhe. Namentlich die Gelegenheiten, einer Aufführung ihres Sohnes beizuwohnen, lockten sie nach allen Windrichtungen. Überdies war sie häufig in Berlin, um die Freundschaft mit der Gräfin Wolkenstein zu pflegen, und besuchte diese auch in Paris, als der Graf dort Botschafter war. Wollte man eine genaue Chronik ihrer größeren und kleineren Reisen anlegen, so würde man an ihren Vater erinnert werden, der nie seßhaft werden konnte, der bis zuletzt eigentlich keinen ständigen Wohnort hatte. Indem wir dies sagen, gewahren wir auch den tiefgreifenden Unterschied: Liszt war heimatlos und besaß nicht einmal im alltäglichsten Sinne ein behagliches Heim. Für Cosima war ihr Haus in Wahnfried das schönste Heim und die echteste Heimat, die ihr beschieden sein konnten. Sie hat sich auch hier am wohlsten gefühlt, ist immer wieder gern hierher zurückgekehrt und hat diese Stätte nur verlassen, wenn es dafür einen zureichenden Grund gab. Aber an solchen Gründen fehlte es nicht. So lange sie sich kräftig genug fühlte und der Arzt es gestattete, flog sie gern aus, um ein Verlangen ihrer Seele oder ihres Geistes zu befriedigen.
Trotzdem finden wir sie alljährlich monatelang in Bayreuth, nicht nur während der Festspielarbeit. Zur Bürgerschaft und zu den Einwohnern stand sie in demselben freundschaftlichen und herzlichen Verhältnisse, wie einst ihr Gatte. Ein Bayreuther, der sie und ihre Mitbürger noch gekannt hat, sollte einmal ihr Leben in der Stadt ausführlich beschreiben. Soweit wir davon Kenntnis haben, gab es vereinzelte Mißstimmungen und Reibungen nur mit den Behörden.
Da machte ihr vor allem die Geistlichkeit zu schaffen. Wie es ihr zu ihrem tiefsten Schmerze im Jahre 1884 nicht gestattet worden war, das Abendmahl unter den Klängen der Gralsfeier zu empfangen, weil der Pfarrer sich streng an seine liturgischen Vorschriften hielt und die Musik zum »Parsifal« doch nur als eine weltliche Musik betrachtete, so konnte sie es auch nicht erreichen, daß die Ehe ihrer Tochter Eva mit Chamberlain, der schon einmal verheiratet gewesen und von seiner ersten Frau offenbar nicht so geschieden war, wie es der Pfarrer wünschte oder die in Bayern geltenden Vorschriften verlangten, in Bayreuth eingesegnet wurde. Dies eben war der Grund, daß die kirchliche Trauung erst in Zürich stattfand. Cosima hat der Bayreuther Kirchenbehörde ihre sehr entschiedenen Einwendungen gegen die Verweigerung der Trauung nicht vorenthalten. Aber mit der ausdrücklichen Versicherung, daß sie keinen Groll hege. »Wie alle menschlichen Satzungen, werden auch die kirchlichen Gesetze mit der Zeit einer Revision unterliegen.«
Ein anderes Gebiet, auf dem es zu Zwistigkeiten kam, war das der Tierliebe. Auch Wagner hatte manchmal Ärger und Mühe gehabt, wenn seine Hunde die strengen Vorschriften der Hofgärtnerei nicht beachten wollten. Aber das waren nur harmlose Kleinigkeiten gewesen gegenüber dem »sensationellen« Falle, der sich eines Tages mit Cosima ereignete. Ihre Freundschaft zu den Tieren erschöpfte sich nicht in gemütvollen Redensarten. Sie war tief durchdrungen von der Einheit alles Lebendigen, und ihre Fähigkeit des Mitgefühles mit allen lebenden Wesen kannte keine Grenzen. Als nun eines Tages ihr Neufundländer erkrankte, veranlaßte sie – bei dem Mangel eines Tierspitales –, daß ihr Hausarzt Dr. Landgraf den Hund ins städtische Krankenhaus brachte und dort operierte. Das Befremden der Bayreuther wollen wir begreifen. Aber unerhört dünkt es uns, daß dieser oder jener mit den niedrigsten Verdächtigungen kam und das Verhalten Cosimas und des ihr untertänigen Arztes in das übelste Licht zu stellen suchte. Nur weil man in Wahnfried die Armen verachte, sei der vornehme Hund in einem Krankenhause, das vorzugsweise den Armen diene, operiert worden, wenn das Haus den Reichen gehörte, würde man ihn nicht dorthin gebracht haben. Auf einmal schienen die Wohltaten, die Cosima seit ihrer Niederlassung in Bayreuth unaufhörlich geübt hatte, vergessen zu sein, und natürlich wurde auch die Forderung erhoben, daß der Arzt seine Stelle verlieren müsse. Der Sturm legte sich bald, wie meistens in solchen Fällen; doch die Verwaltung des Krankenhauses hatte nicht umhin können, das Vorgehen des Arztes zu rügen. Da schrieb Cosima an den Bürgermeister:
»Ich erfahre soeben, daß ein Vorgang, der im Zusammenhang mit meinem Hause steht, eine Mißbilligung seitens der Stadtbehörde erfahren hat. Da diese Mißbilligung nicht mir, welche die eigentliche Schuld trägt, zugedacht worden ist, so fühle ich mich verpflichtet, meine Schuld zu bekennen und bitte um Nachsicht, wenn ich der Bedeutung des Gegenstandes wegen etwas in die Weite mich verlieren muß. Es gibt wohl kaum etwas, das die Menschen schärfer unterscheidet, als das Verhältnis zu den Tieren und ihre Auffassung von diesem Verhältnisse. In meinem Hause möchte ich dieses Verhältnis als ein religiöses bezeichnen. Ich bin von ihm in der Erziehung meiner Kinder ausgegangen, um ihnen in dem spielenden Umgang die Teilnahme und Rücksicht für alle unseres Schutzes bedürftige Wesen zu lehren. Ich erachte die Haustiere als von Gott unserem Schutze übergebene Kreaturen, auf daß wir an ihnen die Heiligkeit des Lebens und den Zusammenhang aller Wesen ehrfürchtig erfassen und verehren, wenn nun ein Haustier erkrankt und verscheidet, so ist es bei uns ein tiefer, ja unaussprechlicher Schmerz. In diesem Schmerze wandte ich mich an die Güte und Großherzigkeit unseres Freundes und Arztes; er empfand mit mir und übersah einen Paragraphen aus Mitgefühl, vielleicht übersah er ihn auch nicht, sondern baute mit mir auf die Teilnahme der Mitbürger. Es traf uns der Kummer um ein treues, schönes Glied unseres Lebens in der Zeit, wo viele Menschen Freude durch unsere Kunst erfuhren und die Stadt durch diese Freude Ehre und Förderung erhielt. Daß wir auf Sympathie Anspruch zu haben glaubten, wird uns wohl nachempfunden werden, das Unrichtige war, daß ich das vergaß, was ich anfangs erwähnte, den essentiellen Unterschied in der Auffassung des Verhältnisses zu den Tieren. Für diesen Fehler bitte ich die Mitbürger herzlich um Nachsicht; ich tue dies um so leichter, als der Vorgang sich ja nie wiederholen kann.«
In diesen Worten offenbart sich eine leise Tragik. Bei aller »Ehre und Förderung«, die die Stadt Bayreuth durch die Bayreuther Kunst gewann, und bei aller aufrichtigen Dankbarkeit, die dafür gezollt wurde, führte Cosima doch ein einsames Leben. Außer ihren Kindern und zwei Schwiegersöhnen gab es nur wenige Menschen auf der Welt, die sie ganz verstanden und denen sie sich rückhaltlos anvertrauen durfte. Auch das gibt uns eine Erklärung dafür, daß sie immer wieder in der Ferne ihre alten Freunde aufsuchte oder neue zu erobern trachtete. Freilich durchkreuzen sich die menschlichen Auffassungen und Bestrebungen in der mannigfachsten Weise – und so hat sich Cosima in der Frage des Tierschutzes und namentlich auch im Abscheu gegen die Vivisektion mit niemand so gut verstanden, wie mit Lilli Lehmann.
1903 starb die älteste Freundin Richard Wagners, Malwida von Meysenbug. 1906 schied Verena Stocker, die noch aus den fernen Triebschener Tagen in die Gegenwart herüberreichte und stets in treuer Verbindung mit Wahnfried geblieben war, aus dem Leben. Cosima näherte sich jetzt ihrem siebzigsten Jahre.
Sie hatte ihr Werk getan. 1901 war den Festspielen als letztes Glied der »Fliegende Holländer« eingefügt worden, in der ursprünglichen einaktigen Form, die nur aus äußeren Gründen, mit Rücksicht auf die mangelhaften Bühneneinrichtungen, die keine genügend raschen Verwandlungen gestatteten, in drei Aufzüge gegliedert worden war. Nun erklang die Partitur in Bayreuth zum ersten Male so, wie sie gedacht war. Auch das Sturmbewegte und Gewitterhafte der dramatischen Ballade war noch nie so elementar in Erscheinung getreten. Wie Bertram und van Roop die Titelrolle sangen, wie Mottl das Letzte aus der Partitur herausholte, wie Siegfried Wagner alles Sichtbare aus dem Geiste der Musik und dem Gehalte der Dichtung hervorgehen ließ, das war wieder eine große Bayreuther Leistung. Der »Holländer« zeigte dieselbe Vollendung wie der »Lohengrin«, und das oft zu leicht befundene kleine Werk blieb in der Gesamtwirkung hinter keinem größeren zurück.
1901 war auch zum ersten Male Dr. Karl Muck am Dirigentenpult erschienen. Dieser hatte schon bei den Nibelungen-Aufführungen Angelo Neumanns mitgewirkt, den erkrankten Bülow in Hamburg vertreten und war Generalmusikdirektor an der königlichen Oper in Berlin, einer der ersten Dirigenten Deutschlands. Nach seinem tiefernsten, jedem äußeren Scheine und jeder oberflächlichen Wirkung abgeneigten Wesen gehörte er von je nach Bayreuth. Dort wurde er der berufenste Nachfolger Levis als Leiter des »Parsifal«. Durch nahezu dreißig Jahre, auch nachdem er einen Wirkungskreis in Amerika angenommen hatte, versah er sein Amt in Bayreuth als der gewissenhafte Hüter der echten, alten Überlieferung.
1904 sorgte Cosima noch einmal für den »Tannhäuser«. An Stelle der Primaballerina trat diesmal die moderne Tanzkünstlerin Isadora Duncan. Der Reigen der Grazien erhielt durch sie ein neues, wahrhaft dichterisches Gepräge.
Die Festspiele von 1906 (»Parsifal«, »Ring« und »Tristan«) waren die letzten, für die Cosima die Verantwortung trug.
Im nächsten Jahre übergab sie die Leitung ihrem Sohne. Dieser war schon über ein Jahrzehnt an ihrer Arbeit beteiligt, wußte in allen Dingen Bescheid und hatte die Bühnengestaltung des »Holländer« bereits selbständig durchgeführt. Als Dirigent stand er nie einem anderen, der in Bayreuth tätig war, hindernd im Wege. Als Beherrscher der Bühne jedoch hatte er keinen neben sich, der ihm gleichgekommen wäre. »Regie und Inszenierung: Siegfried Wagner.« So war fortan regelmäßig auf den Ankündigungen zu lesen, und der Spielleiter Siegfried Wagner ist allmählich eine Berühmtheit geworden, von der man freilich außerhalb Bayreuths wenig Gebrauch machen konnte, denn er hat gleich seiner Mutter nur in und für Bayreuth gelebt und sich anderer Bühnen nur in Ausnahmefällen, wie bei den Aufführungen seiner eigenen Werke, mittätig angenommen. Es gehört zum Planmäßigen und Notwendigen in der Geschichte Bayreuths, daß in dem Augenblicke, als Cosima mit Rücksicht auf ihr Alter nicht mehr an der Spitze der Bayreuther Arbeit stehen konnte, auch schon ihr vollkommen gereifter, aber noch jugendfrischer und tatenfroher Sohn zur Stelle war und daß sie diesem ein in sich geschlossenes Werk übergeben konnte, für dessen Fortsetzung und weitere Ausgestaltung Siegfried nun aus eigener Kraft zu sorgen hatte.
So gebieterisch in Bayreuth der Wille des Meisters alles durchdringt und so sehr dort die treue Erfüllung des Meistergebotes das Grundlegende und das Entscheidende ist, so wenig kann und darf Bayreuth jemals erstarren. Das ungeheure Leben, das in den Schöpfungen Wagners pulst und das auch die Bayreuther Arbeit stets durchdrungen hat, es verbietet jede Selbstgenügsamkeit und jede gedankenlose Wiederholung. Dichtung und Partitur bleiben unantastbar. Aber die Verwirklichung auf der Bühne muß immer neu erarbeitet werden. Der technische Fortschritt, der so vieles erst ermöglicht, was Wagner als eine kühne Forderung hinstellte und doch nur in ungenügender Weise verwirklichen konnte, auch der sich ändernde Zeitgeschmack, nicht im Sinne vergänglicher Modeströmungen, sondern im Sinne des fortflutenden und sich wandelnden Lebens, das nach neuen Ausdrucksformen verlangt, all dies ergibt eine Fülle von Aufgaben für den Verwalter des Kunstgutes von Bayreuth. Die ersten Jahrzehnte dieses Jahrhunderts waren besonders reich an fortschrittlichen oder umstürzlerischen neuen Richtungen auf allen geistigen Gebieten, und es war fast unmöglich, auch nur im engsten Teilgebiete eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen dem Notwendigen und dem willkürlichen, dem Bleibenden und dem nur »Modernen«. Cosima hatte sämtliche Werke ihres Gatten, vom »Holländer« bis zum »Parsifal«, in einer Weise gestaltet, die bis ins Kleinste wagnerisch sein sollte, und eben darum auch fortwährend verbessert und der höchstmöglichen Vollendung immer mehr angenähert wurde. Siegfried hat auch dieses Erbe übernommen, ist auch diesem Vorbilde treu geblieben. Aber er ging weiter, als es Cosima in ihren Jahren tun konnte und bei ihrer ersten und einzigen Aufgabe, eben das Vorbild aufzustellen, tun durfte. Siegfried wandte seinen Blick unbeirrt nach außen, ließ die Brandung der Zeit ruhig an sich herankommen und kannte kein anderes Ziel, als die Werke seines Vaters auch einem neuen Geschlechte wahrhaft lebendig zu erhalten. So änderte und besserte er noch eifriger als seine Mutter, in den Kostümfragen unterstützt von Daniela, nie zufrieden mit sich und dem Errungenen, aber auch niemals abweichend von dem, was er als das teuerste Vermächtnis zu bewahren hatte.
Es ist ihm nicht immer leicht geworden, den Ausgleich zwischen Alt-Bayreuth und einer neuen, im tiefsten Grunde unbayreuthischen und sehr oft auch unverhohlen wagnerfeindlichen Welt zu finden, und er hatte auch manchen Zwiespalt in der eigenen Brust zu überwinden, wenn sein unverbrüchliches Wagnertum und seine natürliche Verbundenheit mit der Umwelt und den Zeitgenossen sich nicht sofort in einem Punkte trafen. Doch er hat alle diese Schwierigkeiten bewältigt und hat bis zuletzt, bis zu seinem vorzeitigen Ende, die Freunde und die Gegner, die ältesten Getreuen und die Jüngsten, die sich Bayreuth zu nähern suchten, mit seinen Taten überrascht und beglückt. Sein Ruhm ist unvergänglich.
Aber die Größe Cosimas bleibt unerreicht, was Wagner wollte, das hat sie verwirklicht. Sie schuf erst die Welt von Bayreuth, in der ihr Sohn wuchs und erstarkte. Ohne sie hätten wir keine Festspiele, ohne diese vielleicht keinen Wagner, dessen Werke allenthalben dem Mißverständnisse und der Entstellung preisgegeben waren.
Wenn Cosima nur in und für Bayreuth lebte, so ist damit der Boden gemeint, von dem sie sich nie verdrängen ließ, und die Sonne, die ihr alles erhellte. Darum sah sie auch mehr als andere. Im Lichte der Wagnerschen Kunst- und Weltanschauung blieb ihr selten etwas verborgen, was der Beachtung wert war. Ihre vielfältige und nach allen Seiten ausstrahlende Begabung hat oft Gelegenheit gefunden, an der geistigen Arbeit des Volkes teilzunehmen. Sie hat dem »Rienzi« die rechte Gestalt für die Opernbühnen gegeben; sie hat sich um die Inszenierung vom Humperdincks »Hänsel und Gretel« angenommen; die deutschen Übersetzungen, die Levi für die »Trojaner« von Berlioz und für Mozartsche Werke verfaßte, hat sie durch ihren feinen und sachkundigen Rat zu fördern gesucht; wo sie hinkam, hat sie auch dem Schauspiele und der Dichtkunst und ebenso den jeweiligen politischen Strömungen ihre Aufmerksamkeit geschenkt. Sie hat sich für die Duse begeistert und mit Ibsen auseinandergesetzt – sie bezeigte »große Teilnahme« für das Schaffen Gerhart Hauptmanns und erwärmte sich für Wilhelm Busch; ihre Briefe an Wilhelm Hertz, den Erneuerer der mittelalterlichen Dichtungen vom Parzival und von Tristan und Isolde, geben Zeugnis von ihrem klaren Sinn für das Echte und Gesunde. In Berlin freute sie sich der Bekanntschaft des Hofpredigers Stöcker, den sie als Volksmann und als Priester würdigte, und benutzte sie den Verkehr mit Kaiser Wilhelm II. – der bald nach seiner Thronbesteigung einmal in Bayreuth gewesen war –, um ihn womöglich auch für die Tierschutzbewegung zu gewinnen. In inniger Verehrung hing sie an der Kaiserin Elisabeth von Österreich, die schon früh eine verstehende Anhängerin Wagners und später eine andächtige Besucherin Bayreuths gewesen ist, und aufrichtige Freundschaft verband sie mit dem Zaren Ferdinand von Bulgarien, der bis heute bei keinem Festspiele fehlt. Es gab wenig Personen von Rang und Bedeutung, die sie nicht zu finden wußte oder von denen sie nicht gesucht wurde. Sie selbst war eine große europäische Gestalt.
Thoma schrieb von ihr: »Die geistige Bedeutendheit der Frau W. überrascht einen jedesmal aufs neue, wenn man mit ihr zusammenkommt.« Sie ist »eine reich begnadete Frau, die, je näher man sie kennenlernt, man um so mehr schätzt, verehrt und liebt. Es läßt sich wohl kaum sagen, wer und wie sie ist, wie reich ihr Geistesleben, ihre Arbeitskraft ist, wie groß ihre Liebenswürdigkeit, wie kindlich heiter sie sein kann … Man weiß gar nicht, was man am meisten bei ihr bewundern soll, bis man sieht, daß dies alles eine Einheit ist: die Einheit einer großen Persönlichkeit.«
Der Leiter der staatlichen Gemäldegalerie in München, Dr. Bayersdorfer, sagte einmal: »Heute war Frau Cosima bei mir, mit etlichen Fürstinnen und Gräfinnen. Sie war die Fürstin, die anderen waren das Gefolge.«
Anna Helmholtz, die Gattin des berühmten Physikers in Berlin, schrieb: »Vorgestern war ein großes und sehr schönes Wagner-Konzert, dessen Proben Cosima ihre Hilfe geliehen hatte, wodurch es ganz anders wurde, als je ein früheres. Sie ist eine wunderbare Frau, mit allen Gaben des bezaubernden Vaters Liszt und dem ihr eigenen großen Ernst des Künstlertums und der Priesterschaft einer großen Lebensaufgabe.« Und dieselbe zu anderer Zeit: »Ich lebe unter dem Zeichen Cosima Wagners … Sie ist nach wie vor für mich die allererste Frau, die ich kenne. Immer hatte sie den geheimnisvollen Zauber – aber jetzt in ihrer abgeklärten Seele, in der Ruhe, der Höhe aller Anschauungen, im Zauber der Rede, die nie banal, allgemein oder unpersönlich ist, und nur Selbstgedachtes in der größten Einfachheit sagt, liegt eine Vornehmheit und Größe, die mich ganz gefangen nimmt. In der Tat eine königliche Frau.«
Auch die Hochburgen der Gelehrsamkeit, die am schwersten einzunehmen waren, öffneten der Siegerin ihre Pforten. Als diese ihr Amt niederlegte, war die Zeit vorbei, in der die Universitätsprofessoren nichts von Richard Wagner wissen wollten. Die Berliner Universität ehrte sich selbst, als sie bei ihrer Jahrhundertfeier im Oktober 1910 der Meisterin das Ehrendoktorat der philosophischen Fakultät verlieh, der – wie es in der lateinischen Urkunde heißt – »um das Vaterland und die Musen Hochverdienten, die nach dem Heimgange ihres Gatten durch mehr als fünfundzwanzig Jahre sein Andenken und seine Kunst so ehrfurchtsvoll gepflegt und bewahrt und sein Vermächtnis mit so treuer Beharrlichkeit verwaltet hat, daß aus dem ganzen Erdkreise die Besucher zusammenströmen zum Heiligtume deutscher Kunst«.