
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Es ist sehr beachtenswert, daß Wagner beim Abschlusse seiner Lebenserinnerungen, zu einer Zeit, als ihm an der Seite Cosimas das reinste und tiefste Glück zuteil geworden, das er je erträumt, und als dieses Glück auch schon längst die bürgerliche Anerkennung gefunden hatte, rückschauend noch immer von dem grenzenlosen Unglück sprechen konnte, das sie sich an jenem 28. November in Berlin wortlos eingestanden. So tief wurzelte jene Stunde in seinem Gemüte und so sehr war das Bewußtsein eines unglücklichen Verhängnisses verstärkt durch den Gedanken an den Dritten, an Hans von Bülow.
Wagner wäre nicht der Mann, dessen Seelengröße wir bewundern, wenn er frei geblieben wäre von einem Schuldgefühle, das durch den nie ersetzten Verlust des verstehenden Freundes und erkorenen Mitarbeiters immer wach erhalten wurde. Im Erstdrucke seiner Erinnerungen, der nur für einen kleinen Kreis von Freunden bestimmt war, findet sich aber noch eine Stelle, die in den bekannten Ausgaben fehlt. Nach der Erwähnung des Unglücks war dort zu lesen: »Unter Tränen und Schluchzen besiegelten wir das Bekenntnis, uns einzig anzugehören.« Wenn dies wörtlich zu nehmen, wenn der Satz nicht durch spätere Empfindungen eingegeben ist, die das traumhafte Bild der Vergangenheit in ein helleres und schärferes Licht rückten, dann konnte das stumme Treugelöbnis, das in Berlin geleistet wurde, doch wieder nichts anderes bedeuten als Entsagung, mit dem Troste der mystischen Vereinigung im »Wunderreiche der Nacht«, im Reiche der Seelen, also wieder – Tristan und Isolde. Denn an eine wirkliche Vereinigung war damals nicht zu denken. Beide waren verheiratet, und ihre Wege führten sie nicht nur im Raume, sondern auch nach Art und Ziel auseinander. Bülows hatten ihr klar umgrenztes Dasein, das ihnen wirtschaftliche Sicherheit und gesellschaftliche Freiheit verbürgte – Wagner war jedes festen materiellen Grundes und sicheren Haltes beraubt, die ungeheuren Werte, die der größte Musiker seiner Zeit und der Dichter der größten deutschen Dramen der Welt zu bieten hatte, wurden nicht erkannt, die Welt verweigerte ihm die geringste Gegenleistung, sein Schaffen war gehemmt, er glaubte zwar noch an sich, aber nicht mehr an seine Zukunft. »Mein Zustand ist sehr unheimlich«, so schrieb er am 8. April an Cornelius; »er schwankt auf einer schmalen Zunge: ein einziger Stoß, und es hat ein Ende, so daß nichts mehr aus mir herauszubringen ist, nichts, nichts mehr! – Ein Licht muß sich zeigen: ein Mensch muß mir erstehen, der jetzt energisch hilft, dann habe ich noch die Kraft, die Hilfe zu vergelten, sonst nicht, das fühle ich!« In demselben Briefe aber flammt doch auch sein Glaube, seine Zuversicht von neuem auf: »Ein gutes wahrhaft hilfreiches Wunder muß mir jetzt begegnen; sonst ist's aus! Ein furchtbares Schweigen scheint mir anzudeuten, daß dieses liebliche Wunder jetzt unterwegs ist!« Und es war unterwegs. Genau vier Wochen nach der Absendung dieses Briefes stand Wagner vor dem Könige und hatte alles: die Sicherstellung seines äußeren Lebens, vollkommene Schaffensruhe, die Möglichkeit vorbildlicher Aufführungen, in denen seine Werke zu leuchtendem Leben erstehen sollten.
Nur eines hatte er nicht: das schöne Haus, das er nun am Starnberger See bewohnte und wo der König in jeder Hinsicht für sein Behagen und seine Bequemlichkeit sorgte, es blieb trotzdem verödet; keine Frau waltete darin, er war in einer sehr geräumigen Wohnung, die zwei Geschosse umfaßte, eigentlich ganz allein, denn auch der Verkehr mit dem Könige, der auf Schloß Berg in der Nähe wohnte, vollzog sich schon vom Anfang mehr schriftlich als persönlich, das scheue, weltflüchtige Wesen Ludwigs trat schon damals hervor, und Wagner, der kurz vorher die warmherzige Gastfreundschaft der Frau Eliza Wille in Mariafeld bei Zürich genossen hatte, fühlte sich einsamer denn je. Die Verlassenheit seines Hausstandes, die Nötigung, mit Dingen, für die er nicht gemacht war, sich noch immer einzig selbst zu befassen, war die erste Enttäuschung, die ihn nun befiel, und lähmte seine Lebensgeister. Als Bülows zögerten, seiner Einladung zu folgen, wandte er sich an Mathilde Maier, die Mainzer Freundin, die er vor zwei Jahren im Hause seines Verlegers Schott kennengelernt und mit der er im vertrautesten Briefwechsel stand. Er forderte sie auf, zu ihm zu kommen und sein Haus zu führen, und in einem Schreiben an ihre Mutter, die diesen Plan aus »elenden kleinbürgerlichen Rücksichten«, wie Wagner es nannte, keineswegs gutheißen konnte, ließ er sogar durchblicken, daß er im Falle des Todes seiner herzleidenden Frau sich um die Hand Mathildens bewerben würde. Da war nichts von dem Überschwang der Empfindung, die ihn einst mit einer anderen Mathilde, mit Frau Wesendonck, verknüpft hatte. Es wäre, wenn sich eine nähere Verbindung ergeben hätte, nur ein recht bürgerliches Dasein mit günstigen äußeren Umständen dabei herausgekommen – Wagner wäre der Adler im Käfig geblieben. Mathilde Maier fühlte dies selbst. Auch sie war nur von Freundschaft, vielleicht von zarter, mädchenhafter Liebe, aber gewiß nicht von einem Sturm der Leidenschaft erfüllt und außerdem sehr klug und besonnen: sie war schwerhörig und sagte sich, daß sie bei zunehmender Ertaubung unmöglich die ebenbürtige Gefährtin eines Tondichters sein könne. Mathilde kam daher nicht, und als eine wahre Erlösung wirkte nun das Eintreffen der Frau von Bülow mit ihren Kindern.
Die Absicht Wagners, Mathilde Maier zu sich zu nehmen, ist der klarste Beweis dafür, daß er nicht an einen längeren gemeinsamen Haushalt mit Bülows dachte. Er wollte diesen nur eine angenehme sommerliche Erholung bieten und sich selbst den Sommer so anregend und erfrischend als möglich gestalten. Dann aber hatte er auch große gemeinsame Pläne mit Hans zu besprechen. Ohne diesen ließ sich das alles gar nicht verwirklichen, was der König mit Wagner vorhatte. Hans mußte von Berlin nach München übersiedeln. Doch es sollte kein leichtfertiger Entschluß sein, es war alles gut zu überlegen und bis ins kleinste vorzubereiten. Das war der Sinn von Wagners Einladung, und es marterte ihn, daß die Freunde seinem Rufe nicht rascher folgten. Mit Eifer hatte er das Obergeschoß seines »großen Bauernhauses« für die Gäste hergerichtet. Ein Gesellschaftszimmer mit Balkon und herrlicher Aussicht, zwei Schlafzimmer, ein Kinderzimmer und ein Dienstmädchenzimmer standen für die Gäste bereit und außerdem ein »himmlisches Klavierzimmer«.
Cosima reiste mit den Kindern voraus und traf am 29. Juni bei Wagner ein. Hans folgte am 6. Juli, in elendem Gesundheitszustande, mit Fieber, das ihn, wie einst in Zürich, gleich nach seiner Ankunft für acht Tage ins Bett warf. Er erhob sich dann zu früh, schonte sich nicht – das war überhaupt nicht seine Gepflogenheit – und erlitt so einen Rückfall nach dem anderen. Aber mit der Willenskraft, die ihm eigen war, brachte er es doch zustande, mit Wagner zum Könige zu fahren und diesem vorzuspielen. Einmal nahm er auch das Mittagessen beim König ein. Dieser war entzückt von seinem Klavierspiel und wurde von seiner Persönlichkeit auf das wärmste eingenommen. Die wichtigste Voraussetzung für die künstlerischen Pläne Wagners war damit erfüllt. Die sommerliche Erholung aber, die wohlverdiente Ruhe vor Beginn einer neuen, unermeßlichen Arbeit, konnte Bülow diesmal nicht finden. Er freilich hätte sich keine Ruhe gegönnt, er wollte beim Tonkünstlerfest in Karlsruhe mitwirken, und auch Liszt wünschte es. Doch Wagner bezeichnete das als Wahnsinn und verhinderte die Abreise Bülows, der mittlerweile nach München in den »Bayerischen Hof« gezogen war, wo er ärztlich behandelt wurde, während nun seine Gattin den Vater nach Karlsruhe zum Musikfest begleitete, von dort kam Liszt nach München und besuchte Wagner in Starnberg. Auch beim König durfte er vorsprechen. Der heimatlos Gewordene – in Rom war er gleichsam nur Gast – staunte über die Fülle der königlichen Gnade, die jetzt über Wagner ausgegossen war. Mit einem ganz kleinen Anflug von Neid, dem einzigen, den wir je bei ihm herausfühlen konnten, schrieb er an die Fürstin von Wagner und dem König: »Er ist in seiner Gunst in wenig Tagen weitergekommen, als ich in Weimar am Ende von zehn Jahren.« Ebendies aber ließ ihn auch erhoffen, daß Bülow an der Seite Wagners und unter den Augen des Königs sein Glück machen werde. Er vor allem riet dem Schwiegersöhne, die Vorschläge Wagners anzunehmen. Es handelte sich dabei um nichts Geringes, und wir wollen gleich hier das Münchner wirken Bülows in großen Zügen vorausnehmen.
Hans wurde zunächst Vorspieler des Königs mit einem »Ehrenbezuge« von zweitausend Gulden. Für diese Summe hatte er nur wenig zu leisten: immer seltener empfand der König, der ein einziges Mal einem öffentlichen Konzerte Bülows beiwohnte, das Bedürfnis, den Vorspieler zu sich zu berufen und sich von ihm, wie es anfänglich gedacht war, in die Welt der großen Meister einführen zu lassen. So blieb Bülow freizügig und konnte nach wie vor Konzertverpflichtungen als Spieler und als Dirigent übernehmen. Die Stelle am Sternschen Konservatorium in Berlin gab er jedoch auf und siedelte mit Weib und Kindern nach München über. Dort hatte er Gelegenheit zu herrlichster Bewährung als Bühnendirigent. Der König wollte nach und nach sämtliche Werke Wagners in der Münchner Hofoper so dargestellt sehen, wie Wagner es wünschte. Als das bedeutungsvollste Ereignis war die Uraufführung von »Tristan und Isolde« mit dem Ehepaare Schnorr aus Dresden in Aussicht genommen. Bülow war es vergönnt, diese Aufführung, wie auch einige Jahre später die der »Meistersinger«, zu leiten. Er hat mit diesen beiden Großtaten seinen Ruhm für alle Zeiten begründet, als das Vorbild und der Lehrmeister all der so oft genannten Stabführer, die in der Musikgeschichte der letzten siebzig Jahre eine wichtige Rolle spielen. Er wurde der Begründer einer Kunstauffassung und einer praktischen Übung im allgemeinen Musikleben, durch die der Dirigent zu einer vorher ungekannten führenden und entscheidenden Stellung gelangt ist. Was früher nur in Weber und in Wagner persönlich verwirklicht war und beide Male an das schöpferische Genie gebunden zu sein schien, das wurde durch Bülow die erklärte Aufgabe eines eigenen Berufsstandes, den es in diesem hohen und ernsten Sinne vorher noch nicht gegeben hatte. So blieb denn auch in München seine Tätigkeit keineswegs auf die Festaufführungen des »Tristan« und der »Meistersinger« beschränkt, sondern er hatte als königlicher Kapellmeister seinen Dienst auch außerhalb des Bereiches der Wagnerschen Kunst zu versehen. Damit war aber sein Wirkungskreis noch nicht begrenzt. Um eine neue, festliche Kunst, wie sie Wagners Geist vorschwebte, ins Leben rufen zu können, bedurfte es einer anderen Schulung der ausübenden Kräfte, als sie bisher üblich war; auch ein neues, von dem rechten Ernst erfülltes und allen fachlichen Anforderungen vollkommen gewachsenes Geschlecht von Sängern und Musikern sollte herangebildet werden, mit der herkömmlichen Schlamperei und mit den veralteten Regeln eines höchst oberflächlichen und einseitigen Musikunterrichtes sollte es ein Ende haben. Der Bericht an den König »über eine in München zu errichtende deutsche Musikschule«, den wir im achten Bande von Wagners Schriften finden, klärt uns über seine tiefgründigen Ansichten und weitgreifenden Absichten auf. Seine Forderungen sind zwar, wie das meiste, was er wollte, bis heute nicht entsprechend verwirklicht. Auch in München konnte nicht im Handumdrehen aus der seit zwanzig Jahren bestehenden königlichen Musikschule etwas gemacht werden, was den Forderungen Wagners vollkommen entsprochen hätte. Aber es gelang doch, daß Hans von Bülow als Leiter bestellt wurde und die Vollmacht erhielt, den Unterricht im Sinne Wagners zu verbessern. Dieser hatte auch seinen Freunden Peter Cornelius und Heinrich Porges aus Wien einen ihnen passenden Wirkungskreis in München verschafft. So war das Musikleben der Stadt in den vier Jahren nach der Berufung Wagners durch diesen und Bülow wesentlich beeinflußt.
Der König hatte aber noch Größeres vor: der Hauptgedanke, der ihn beseelte, war die Vollendung der Nibelungen und ihre festspielmäßige Darbietung in einem eigens dafür erbauten Hause. Noch im Jahre 1864 wurde auf Vorschlag Wagners dessen Dresdner und Züricher Freund, der Baukünstler Gottfried Semper, berufen und vom Könige beauftragt, den Festspielbau am Isarufer in der Nähe des Maximilianeums zu errichten. Dies kostete natürlich nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Um der Ungeduld des Königs zu genügen, sollte einstweilen ein geeignetes Theater in den Münchener Glaspalast eingebaut werden. Aber Wagner war ja noch gar nicht so weit: die Nibelungen ruhten noch immer, und er hat dann, sobald er die nötige Muße fand, vorerst die »Meistersinger« vollendet.
Einstweilen war ihm fast nur Unruhe beschieden. Günstling eines Königs! Schon die Wortbildung hat einen üblen Beigeschmack. Es mag die edelste Freundschaft, der reinste Seelenbund sein, wie bei Ludwig II. und Richard Wagner – die bloße Tatsache, daß ein Mann, den noch niemand kennt, dessen Verdienste den meisten zweifelhaft sind, sich auf einmal in der königlichen Gnade sonnen darf, weckt den Neid aller, die im Schatten stehen und die einen Strahl derselben Gnade für ihre eigennützigen Zwecke brauchen würden. Daß zunächst die einen sich an Wagner heranzudrängen suchten, um durch ihn auch für sich etwas zu erreichen, und die anderen gewissermaßen zwangsläufig gegen ihn arbeiteten, das war der Lauf der Welt und hätte das einzigartige Verhältnis, das zwischen dem Könige und Wagner bestand, nicht sonderlich beeinträchtigt. Doch eben das Beispiellose in dieser Königsfreundschaft mußte auch ruhig Denkende, nüchtern Urteilende, nicht persönlich Getroffene in Furcht und Verwirrung setzen. Hat doch jeder seinen Kreis, jeder seine Bahn und erhofft von einem neuen König, was er für Segen und Fortschritt hält. Da war zunächst ein Künstler, der dem Könige näher stand als alle Minister und Räte. Die bedenkliche Neigung des Königs, die Dinge dieser Welt nur von einem ganz »unmöglichen« Standpunkte aus höchst einseitig zu betrachten, erhielt durch Wagner zweifellos die gefährlichste Nahrung. Ja, wäre der nur ein bescheidener Komponist gewesen, der irgendwie »versorgt« sein wollte und sonst die Welt gehen ließ, wie sie ging! Aber in den Schriften, die der König mit so heißer Ergriffenheit las, die ihn mehr und mehr für den Künstler entflammten, hatte dieser Wagner unaufhörlich der gesamten Öffentlichkeit den Krieg erklärt und neue Zustände verlangt und vorhergesagt, die der Kunst erst ihr volles Recht und die wahre Herrschaft bringen würden. Nun konnte er seine Wünsche verwirklichen, nun war der König bereit, die Mittel, die in Bayern von den letzten Königen, von Ludwig I. und Maximilian II., für die bildenden Künste und die Dichtkunst zur Verfügung gestellt worden waren, zuerst und vor allem der Tonkunst zu widmen, und nicht etwa nur den tonkünstlerischen Zwecken, die jedermann anerkannte, sondern den Hirngespinsten und den abenteuerlichen Ansprüchen des »Zukunftsmusikers«! Man halte sich vor Augen, daß Wagner damals von den wenigsten verstanden war und daß sich just in den Reihen der schaffenden und ausübenden Musiker der schärfste Widerspruch gegen ihn erhob. Man vergegenwärtige sich aber auch, daß er erst seit wenigen Jahren wieder als Staatsbürger geduldet war, daß ihm noch immer das Brandmal des Revolutionärs anhaftete, von dem sogar behauptet wurde, er habe das Dresdner Opernhaus in Brand stecken wollen, und der, wenn er sich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hätte, vermutlich zum Tode verurteilt und zu lebenslänglichem Zuchthause begnadigt worden wäre, wie sein Dresdner Freund August Röckel, der jetzt allerdings aus seiner Haft befreit war und sich in München, also wieder in der Nähe Wagners, aufhielt.
Der bayerische Ministerpräsident von der Pfordten erklärte geradezu, daß er den Verkehr eines solchen Menschen wie Wagner mit dem Könige nicht dulden könne. Wie schwer wurde dadurch die Rolle, die der Kabinettssekretär des Königs, Pfistermeister, zu spielen hatte, derselbe, der Wagner in Wien suchte und von Stuttgart nach München brachte und nun der tägliche Bote zwischen dem König und dem Künstler war! Wenn sein Andenken in der Lebensgeschichte Wagners nicht mit hohen Ehren besteht, so muß man sich doch eben dieser Schwierigkeiten, ja der Unmöglichkeit eines schlichten Beamten, bei solchem Widerstreite allen Seiten genug zu tun, gerechterweise bewußt bleiben. Der Künstler war den Beamten, der Mann des Umsturzes den Bürgern wie den Adeligen, der Ehrgeizling, der für seine ausschweifenden Pläne unerhört viel Geld beanspruchte, dem Finanzminister und allen Steuerträgern, der Protestant den in Bayern herrschenden Katholiken, der freisinnige, ketzerische Schriftsteller auch den strenggläubigen Protestanten, der Großdeutsche oder Alldeutsche, wie wir heute sagen würden, den bayrischen Kleinstaatlern ein Dorn im Auge und – als Günstling des Königs! – ein Block vor den Füßen. Und der sieghafte Wille eines Starken und Kühnen steht den Schwachen und Feigen allimmer und allüberall im Wege. So ging es nur mit rechten Dingen zu, wenn die Berufung Wagners Befremden, Bestürzung, Ärgernis erregte und dieses Ärgernis sich sehr rasch zu einem förmlichen Aufruhr gegen den Fremdling und Eindringling steigerte und verdichtete. Aber wieviel Unrecht ist in dieser Bewegung verübt worden! Wieviel Torheit und Schlechtigkeit kam da an die Oberfläche! Weder die geheiligte Majestät des Königs noch die persönlichen und häuslichen Verhältnisse der sonst Beteiligten blieben von feindseliger Gehässigkeit verschont.
Es hat lange gedauert, bis die geschichtliche Forschung in all die Vorgänge, die sich in den ersten beiden Jahren nach der Berufung Wagners abspielten, einigermaßen Licht brachte. Eduard Stemplinger und Sebastian Röckl waren bemüht, den Verlauf der Ereignisse durch den Wiederabdruck damaliger Zeitungsaufsätze, amtlicher Kundgebungen und vieler Briefe und Urkunden zusammenhängend und widerspruchslos darzustellen. Es ist ihnen nicht völlig gelungen, und namentlich Stemplinger hat in der Art, wie er seine Quellen verwertete, zu sehr Partei gegen Wagner genommen. Ganz klar lassen sich die Dinge erst überschauen, seitdem die Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen dem König und Wagner mit den einschlägigen anderen Zeugnissen die Einzelheiten erhellt und die ausgesuchten Qualen, die zeitweilig über Wagner und über Bülows verhängt waren, in volles Licht gerückt hat. Es wird nunmehr möglich sein, diese Münchner Jahre im Leben Wagners mit der dem Geschichtsschreiber zukommenden Wahrheitsliebe einwandfrei darzustellen. Hier soll nicht einmal der Versuch dazu unternommen werden. Hier, wo uns einzig das Leben Cosimas zu beschäftigen hat, war nur der Hintergrund aufzuzeigen, vor dem sich dieses Leben damals abspielte, ein Leben, das seit den Tagen am Starnberger See nicht mehr zu trennen ist vom Leben Wagners.
Der große Aufruhr setzte erst in München ein. Das Starnberger »Idyll«, wie es freundlich genannt wird, war noch die Ruhe vor dem Sturme. Daß man Wagner jeden Einfluß auf den König zutraute und sozusagen alles von ihm verlangte – einmal wandten sich sogar die Hinterlassenen einer Giftmörderin an ihn –, das störte ihn am wenigsten. Denn er ließ nichts an sich herankommen. Auch als Ferdinand Lassalle, der sich mit der Tochter des bayrischen Gesandten in der Schweiz, Wilhelm von Dönniges, vermählen wollte, an Wagner das Ansinnen stellte, er möge durch den König auf den widerstrebenden Gesandten einwirken, und obwohl sogar Bülow selbst seinem Freunde Lassalle geraten hatte, sich in dieser Sache an Wagner zu wenden, tat dieser nicht mehr, als daß er sich in eine flüchtige Bekanntschaft mit dem jüdischen Sozialisten einließ, ohne dessen Wünschen zu entsprechen. Bei dieser Gelegenheit mißfiel ihm Lassalle gründlich, und er fand auch die Liebesgeschichte, um die er sich kümmern sollte, aus »lauter Eitelkeit und falschem Pathos« zusammengesetzt. Lassalles Leben fand allerdings kurz darauf einen sozusagen heroischen Abschluß. Er forderte den Verlobten Helene von Dönniges' und trug eine tödliche Verwundung davon.
Um diese Zeit war Wagner schon wieder allein, »wie in einem verwünschten Schloß«. In einem Briefe an Eliza Wille, worin Wagner namentlich auch die »übernommenen und zerrütteten Nerven« Bülows und dessen »allerangegriffensten Gesundheitszustand« hervorhob, bemerkte er noch: »Dazu eine tragische Ehe, eine junge, ganz unerhört seltsam begabte Frau, Liszts wunderbares Ebenbild, nur intellektuell über ihm stehend.« Was Wagner, der eine so hohe Meinung von den Geistesgaben Liszts hatte, mit dieser Höherschätzung seiner Tochter meinte, das wird uns verständlich, wenn wir den Brief lesen, den er am 30. September an Hans nach Berlin schrieb. Dort war inzwischen Liszt eingekehrt, worüber sich Wagner für Bülows freute. Aber es verstimmte ihn, daß der ruhelos Umherstreifende eben immer nur zu Besuch kam, daß er sich nicht entschließen konnte, seinen Nächsten ganz anzugehören, daß er stets noch abhängig war von der Fürstin in Rom und auch sonst zu keinem festen Lebensplane gelangen konnte. Damit verglich Wagner die Stetigkeit und Unbeirrbarkeit, also gewissermaßen auch die größere Weisheit seiner Tochter.
Im Hause am Starnberger See waren sie einander zum ersten Male ganz nahe gekommen, und was sie sich in Berlin wortlos eingestanden, das brach jetzt wie ein Feuerstrom aus ihrem Innern. Die ungeheure Spannung, die in ihren Seelen angehäuft war, entlud sich mit der Gewalt eines Naturereignisses. Ungestört von der Außenwelt, wie auf einer Insel der Seligen, fanden sie sich hier in der großen, unerschütterlichen Liebe, die erst sechsundsechzig Jahre später, als Cosima ihre Augen schloß, vollendet war. Kein Aufflackern leicht entzündlicher Leidenschaft, kein sorgloses Abenteuer, kein vergänglicher Roman, sondern die Erkenntnis und Erfüllung eines Lebensgebotes. Für Cosima lag die Zukunft klar vor Augen. Mochte sie ihr zum Verderben gereichen, sie hatte keine Wahl. Und wer so tief fühlt, was er muß, und so genau weiß, was er will, der trotzt den Gewittern des Daseins und gewinnt zuletzt das Ziel.
Diese Größe, diese Unerschütterlichkeit Cosimas hat Wagner noch stärker gepackt, noch mächtiger erschüttert als das Liebesglück, das dem von je zur Entsagung und zur Hoffnungslosigkeit Verurteilten nun mit seiner ganzen Wärme überströmte. Wir sehen das Bild Cosimas vor uns, wie es ihr ganzes späteres Leben täglich neu gezeichnet hat, wir spüren aber auch Wagners beinahe ehrfürchtige Scheu vor ihr, wenn er in seinem Briefe vom 30. September an Bülow schrieb: »Cosimas leidender Zustand« (über den Bülow berichtet hatte) »ängstigt auch mich. Alles, was sie betrifft, ist außerordentlich und ungewöhnlich. Ihr gebührt Freiheit im edelsten Sinne. Sie ist kindlich und tief – die Gesetze ihres Wesens werden sie immer nur auf das Erhabene leiten. Niemand wird ihr auch helfen, wie sie sich selbst! Sie gehört einer besonderen Weltordnung an, die wir aus ihr begreifen werden müssen. – Du wirst in Zukunft günstigere Muße und eigene Freiheit in besserer Genüge haben, um dies zu beachten und Deinen edlen Platz an ihrer Seite zu finden.« Damit kündigte er, ohne von sich aus an den bestehenden Verhältnissen zu rütteln, dem Freunde in vorsichtiger und beinahe rätselhafter Weise die Entschließungen an, die Cosima selbst treffen werde. Freilich, die bange Frage, wie das alles werden sollte, konnte er noch nicht beantworten. Heute tritt uns vieles rein und rund entgegen, was damals auch für die unmittelbar Betroffenen doch noch seltsam verschwommen, ja undurchdringlich bleiben mußte. Wagner hatte nur eine Gewißheit: » Ich bin geliebt und liebe!«
Das ist der Kern des Gedichtes in sieben Stanzen vom 1. Oktober 1864, überschrieben »An Dich!«, dessen Niederschrift die Besucher der Richard-Wagner-Gedenkstätte in Bayreuth kennen.
»Die Sonne meines Lebens sah ich sinken,
schon küßte sie der dunklen Fluten Saum;
den Abendstern schon sah ich mild erblinken,
und Dämmerung fließen durch den Himmelsraum:
aus seinem Lethe letzten Trost zu trinken,
schon schmeichelt' ich dem ernsten Todestraum:
die Nacht im Rücken, vor mir letztes Glühen –
vorüber bald des Tages Not und Mühen! –
Was säumt sie nun? Was will sie nicht entweichen?
Was läßt die Sonne dort nicht untergehn?
Und ihre Glut, statt dämmernd zu verbleichen,
wie muß ich goldner nur sie glänzen sehn?
Wie wachsend weithin ihre Strahlen reichen,
läßt sie im Ost mir neu den Tag erstehn?
Sie weilt, sie glänzt, sie leuchtet in die Ferne,
und Venus wird zum lichten Morgensterne.«
Aber die Erfüllung ist ungewiß. Die scheidende Sonne stand still, doch
»dumpfer Wolken nächtiges Gefieder
umlagert stumm des Sternes milden Glanz.«
Was der Dichter erschaut, was in seinem Innern waltet, das ist für jetzt nur – »Abendwonnepracht«.
»Folgt ihr ein Tag, dann ohne Hehl und Fehlen
soll meiner Sonne sich Dein Stern vermählen.«
Cosima hat die Briefe, die sie mit Wagner tauschte, bis an ihr Ende als den teuersten Schatz behütet und auch dafür gesorgt, daß er nicht auf die Nachwelt kam. Solche Briefe gehören ebensowenig vor die Öffentlichkeit, wie Liebkosungen und Umarmungen, wie Beichte und Gebet. Unter Lebenden ist das selbstverständlich. Mit berühmten Toten nehmen wir es weniger genau und sind manchmal recht ungehalten, wenn uns der Zutritt zum Allerheiligsten auch bei ihnen verwehrt bleibt. Was ein liebendes Herz erleidet, wenn seine Geheimnisse von den selten wohlmeinenden und sehr häufig schadenfrohen Mitmenschen mit plumper Hand ans Licht gezerrt, roh betastet und überlegen bekrittelt werden, das hat fast jeder einmal erfahren; und für tiefere Naturen bedeutet es einen geringen Unterschied, wenn an die Stelle der bloß neugierigen Mitmenschen die wißbegierigen und eifrig forschenden späteren Geschlechter treten, die nun gern die Blätter lesen, die für einen einzigen Menschen bestimmt waren, und Dinge erfahren möchten, die sie nichts angehen und die sie auch niemals gerecht beurteilen können, da ihnen die Kenntnis der näheren Umstände und Ursachen fehlt – abgesehen davon, daß im seelischen Bereiche das Gesetz vom zureichenden Grunde nicht mehr gilt. Was Cosima erleiden mußte, nachdem sie vollbewußt und todesmutig dem Herkommen und der Gesellschaftsordnung das ewig unveräußerliche Recht der Liebe entgegengestellt hatte, das wird aus der folgenden Darstellung wenigstens zu erraten sein. Die bloße Aufzählung der wichtigsten äußeren Ereignisse würde allerdings nicht genügen. Mehr noch als bisher werden die bekanntgewordenen Briefe und Aufzeichnungen der handelnden Personen als Zeugnisse des inneren Geschehens heranzuziehen sein. Mit den Briefen Wagners an den König sind, zu ihrem besseren Verständnisse, auch bedeutsame Stellen aus den gleichzeitigen Tagebüchern des Meisters veröffentlicht worden, und diese Stellen geben im Zusammenhalte mit Wagners Briefen an Bülow ein ergreifendes Bild von den Kämpfen und Widersprüchen, die die drei so eng verbundenen Menschen in der eigenen Brust und untereinander auszutragen hatten. Für Cosima war der Zug des Herzens zur Schicksalsstimme geworden, der zu folgen sie keinen Augenblick zögerte. Ihren Gatten hat sie darüber nicht im Zweifel gelassen; auch ihr Vater scheint bald Mitwisser geworden zu sein. In den Briefen Liszts und Bülows ist aber nichts davon enthalten. Beide Männer pflegten ihre schmerzlichen Erlebnisse in sich zu bergen und vertrauten dem Briefbogen selten etwas an, was von den Dingen, über die sie niemandem ein Recht einräumten, Kunde geben konnte. Bülow, der stets Verschlossene und innerlich Unzugängliche, hat auch seiner zweiten Frau nie etwas über seine erste Ehe und über die Münchner Leidensjahre verraten. Das wenige, doch immerhin sehr Aufschlußreiche, das uns die Aufzeichnungen Wagners an die Hand geben, kann und muß uns genügen. –
Wenn jemals, so war in München eine Lage geschaffen, die man als »unmöglich« bezeichnet. Es ging ja nicht nur um sogenannte Herzensangelegenheiten, nicht nur um Liebe und Ehe, die für sich allein jedem Menschen, der die rechtliche Anerkennung und gesellschaftliche Gutheißung seiner Wahl fordert, in einem solchen Falle genug Leid und Mühe kosten. Sondern alles, was die drei bewegte, jede Hoffnung und Befürchtung, hing aufs engste zusammen mit ihren Lebensplänen, ihrer Lebensaufgabe. Wagner sollte die Nibelungen vollenden, und der König wollte ihm ein Festspielhaus bauen. Bülow war der einzig berufene, unentbehrliche Vollstrecker des Wagnerschen Willens in musikalischer Hinsicht. Für ihn war es das größte Glück, das der ewig Unzufriedene gewinnen konnte, der höchste Lohn und der reichste Ertrag seines nur der Tonkunst gewidmeten Seins: dieser Dienst für Wagner, diese entscheidende Mithilfe bei der Verwirklichung eines unerhörten neuen Zieles. Bülow wäre um seinen Lebensinhalt betrogen gewesen, er hätte nicht mehr gewußt, wofür er noch streben und wirken sollte, wenn er sich von Wagner trennen und damit sozusagen auch der deutschen Tonkunst, wie er sie damals im Sinne trug, untreu werden mußte. Wagner aber wäre trotz der Gunst des Königs ohne Bülow nicht imstande gewesen, seine Pläne zu verwirklichen. Die Gunst des Königs jedoch war in dem Augenblicke gefährdet, wo irgendein peinliches Befassen der Öffentlichkeit mit den rein persönlichen Dingen den Freund des Herrschers in dessen Augen als unwürdig erscheinen ließ.
Das alles wußten und erwogen nicht nur Wagner und Bülow, sondern auch Cosima und Liszt, denen die Hochziele Wagners und die entsprechende Wirksamkeit Bülows ein Gegenstand ihres tiefsten Glaubens und ihrer heißesten Hoffnung waren; für Cosima überdies der Inbegriff dessen, was sie für den geliebten Mann ersehnte. So konnten alle, die hier mitfühlten und mitzureden hatten, doch nur den einen Wunsch hegen: sich noch gedulden zu dürfen, sich so wenig als möglich beirren zu lassen und mit um so »blinderem« Eifer der geistigen Zusammenarbeit, dem gemeinsamen Dienste, treu zu bleiben. Was so oft bei kleinen, armseligen Menschen nur eine Folge ihrer Unentschlossenheit und ihrer Schwäche ist – nicht nur nach außen alles verborgen zu halten, sondern womöglich selbst an den Klippen vorbei zu sehen, denen ihr Lebensschifflein zugetrieben wird –, das war diesen Großen die unerbitterliche Forderung ihres Daseinszweckes und ihrer Sendung; zugleich aber auch eine furchtbare Nötigung zur Selbstbeherrschung und zu innerem Heldentume. Liszt stand den Dingen am fernsten, mehr teilnehmend als beteiligt. Auch Bülow, dessen Ehe niemals das Urbild einer inneren Gemeinschaft verwirklicht und dessen fieberhafte Tätigkeit ihn von je befähigt hatte, zuletzt an sich zu denken, auch er konnte Kopf und Herz immer noch leichter beisammenhalten als Wagner und Cosima. Wir wissen aber auch, wieviel er verlieren mußte, wenn er eines Tages nicht mehr Hand in Hand mit Cosima ging. War er mit sich allein, dachte er einmal nur an sich, dann bangte er um alles, was ihn hielt und hob, stützte und stärkte.
Ihnen beiden nun, Liszt und Bülow, kam eine weit verbreitete und durch das Leben oft bestätigte Auffassung zu Hilfe: sie glaubten vorerst noch nicht an die Unwiderruflichkeit der seelischen Entscheidung, die Cosima getroffen hatte, an die Unvergänglichkeit einer Liebe, die doch auch ein Irrtum oder ein Scheinglück sein konnte. Sie verlangten zum mindesten Bewährung dieser Liebe, Erprobung in allen Mißhelligkeiten störender Einwirkungen und vorübergehender Trennung – wie auch sonst in ähnlichen Fällen Probezeiten und Wartezeiten verhängt werden und wie anderseits die Sagen und Märchen immer wieder nur die Liebe verherrlichen, die die schwersten Prüfungen überstanden hat. Dies war aber weniger ein vorsätzliches Verhalten, als das Naheliegende und Unwillkürliche, das sich am natürlichsten behauptete. Der knappe, unverbrämte Bericht über die nächsten Münchner Jahre entrollt ein Drama, dessen Helden nur so handeln, wie es ihr angeborner Charakter und der Zwang der Stunde vorschreibt, und in dessen verschlungenen Fäden die unbegreifliche Weisheit einer gütigen Vorsehung waltet, bis alles entwirrt und gelöst ist. –
Am 17. Oktober schrieb Bülow an Dr. Gille in Jena: »Mitte November siedle ich mit Weib und Kind (die Kegel lasse ich hier verauktionieren) nach München über, wohin mich der junge, ernste und kunstsinnige und in jeder Weise Bedeutendes versprechende König berufen hat.« Cosima war mit ihrem Vater in Löwenberg und bald darauf in Eisenach zusammengetroffen, von wo sie ihn nach Paris begleitete. Dort wohnten sie in dem Hause seines Schwiegersohnes Ollivier, in denselben Räumen, wo einst Blandine Herrin gewesen, und im selben Hause, dessen oberes Stockwerk die Mutter Liszts, noch immer gesund und geistesfrisch, bewohnte. Von Paris kehrte Liszt nach Rom zurück, Cosima fuhr über München nach Berlin, wo jetzt der Umzug, dessen Kosten der König von Bayern trug, zu bewerkstelligen war. Wagner hatte für seine Freunde eine schöne, nicht teure Wohnung, Luitpoldstraße 15, ausfindig gemacht, in der Bülows bequemer und vornehmer hausen konnten als in Berlin. Ihm selbst war vom König ein stattliches Haus mit »wunderschönem« Garten bei den Propyläen, Briennerstraße 21, zur Verfügung gestellt. Im Garten stand noch ein kleines Wohnhaus und außerdem ein Wirtschaftsgebäude mit einem geräumigen Zimmer, so daß Wagner dem befreundeten Paare für die wärmere Jahreszeit auch eine Art Sommeraufenthalt bieten konnte. Im Winter sollten sich Bülows mit der Luitpoldstraße behelfen. Am 20. November trafen sie in München ein. Kaum waren sie einigermaßen in Ordnung gekommen, so spielte sich ihr Leben in den vorgezeichneten Bahnen ab: als ein nicht mehr wegzudenkender Teil im Leben des Meisters. Die Aufführung des »fliegenden Holländers« im Münchner Hoftheater am 4. Dezember ging noch unter Wagners eigener Leitung vor sich, fortan jedoch sollte nur Hans sich um solche Dinge kümmern. Am meisten aber war Cosima in das Leben Wagners verflochten. Wenn sie die Kinder und ihr Haus betreut hatte, dann ging sie in die Briennerstraße und waltete dort als Hausfrau und als nimmermüde, ungeahnte Fähigkeiten entfaltende vertraute Gehilfin in all den kleinen und großen, lästigen und schwierigen Dingen des äußeren Lebens, die nun an Wagner herankamen.
War er schon in Starnberg arg bedrängt worden, so hatte er sich in München vollends eines gewaltigen und verwirrenden Ansturms der Außenwelt zu erwehren. Da bedurfte er eines geschickten und verläßlichen Mitarbeiters und Stellvertreters, um nicht am Ende verraten, gequält, gedemütigt zu werden oder in verwegenem Machtbewußtsein immer neue Feinde und Gefahren heraufzubeschwören. Mit Wissen und Willen ihres Gatten wurde Cosima dieser Mitarbeiter und Stellvertreter. Sie schrieb für Wagner Briefe, sie empfing für ihn Besuche, sie bewirtete seine Gäste, sie besorgte den ganzen weitwendigen und sich in so viele Einzelheiten zersplitternden Verkehr mit dem Theater und der Öffentlichkeit, mit Musikern und Schriftstellern, mit den Ämtern und Würdenträgern bis hinauf zum König, soweit es sich nicht um rein künstlerische Arbeit oder um ganz persönliche Aussprache handelte. Die ungeheure Menge beschwerlicher Pflichten und zeitraubender Geschäfte, die der wachsende Ruhm und die großen Pläne Wagners mit sich brachten, nahm sie ihm ab oder erleichterte sie ihm. Vor allem auch dadurch, daß sie stets zwischen den unerbittlichen Forderungen des nur nach seinen Zielen Ausblickenden und der Herzensträgheit und der Eigensucht der in seinen Dienst Gezwungenen auf die behutsamste, ja unmerklichste Art zu vermitteln wußte und viel Torheit und Empfindlichkeit, Zudringlichkeit und Anmaßung in ihre Schranken wies, ohne zu verletzen. Hierin bewährte sie in höchstem Maße jene Tugenden, die Wagner mit dem Worte »Intellekt« zusammenfaßte: Wissen, Bildung, Verstand, Klugheit, Menschenkenntnis, Sicherheit des Auftretens, feinsten Takt, vollkommene Beherrschung der gestellten Aufgaben, und darüber hinaus Frauenwürde und weiblichen Zartsinn. Da offenbarte sich auch jene besondere Vornehmheit, für die wir nur ein Wort haben, das zugleich an die halbfranzösische Abstammung der Einzigen erinnert: die große Frau, als die sie später allgemein anerkannt wurde, war nicht minder eine große Dame; ihre Frauenwürde hatte etwas Königliches.
Aber wie sich diese Eigenschaften eben jetzt, in den gefährlichen Münchner Tagen, doch erst so recht entwickeln mußten und zu erproben hatten, wie die volle Harmonie der Persönlichkeit, die später so große Bewunderung erregte, in der zunehmenden Verwirrung der Münchner Ereignisse doch erst erkämpft wurde, so war auch die bloße Tatsache, daß Wagner die Frau eines anderen sozusagen zwischen sich und die Welt stellte oder es ruhig geschehen ließ, daß sie sich diese Rolle aneignete, für die Münchner ein Stein des Anstoßes. Und da naturgemäß sehr viele Zumutungen verschiedenster Art, die an Wagner gestellt wurden, zurückgewiesen werden mußten und Cosima es für ihre Pflicht hielt, überhaupt nichts Überflüssiges oder Unmögliches bis zu Wagner gelangen zu lassen, so war es unvermeidlich, daß ihr in der kürzesten Zeit neben dankbaren Freunden auch unversöhnliche Widersacher erstanden, und wir brauchen uns nicht zu wundern, daß selbst die geschworenen Anhänger Wagners nicht mit allem einverstanden waren, was sie tat oder unterließ, daß beispielsweise der immer etwas ängstliche und mit manchen Scheuklappen versehene Cornelius zeitweilig die »Abhängigkeit« Wagners von Cosima beklagte und ihren »Einfluß« für verderblich hielt. Daß Bülow aus Berlin kam und als waschechter Preuße galt, war seinem Gedeihen in der Münchner Luft nicht eben förderlich. So sahen sich die drei gar bald einer ausgesprochenen Gegnerschaft gegenüber, die zwar zum größten Teile aus Bureaukraten, Spießbürgern und Krämerseelen oder aus »verkannten« und sich zurückgesetzt fühlenden »Künstlern« bestand, einer Gegnerschaft, die keinen klangvollen Namen und keine entschiedene Persönlichkeit aufwies, die aber dadurch nur noch mächtiger wurde: denn sie war das, was man die öffentliche Meinung nennt, und ihr Sprachrohr war die Presse.
Die Münchner Zeitungen (unter denen es einige rühmliche Ausnahmen gab) bemächtigten sich sehr bald und recht geschickt all der sonderbaren Dinge, die sich da im Herzen Münchens abspielten, mit gewissenloser Ausnutzung der liberalen Preßfreiheit, von der auch die Ultramontanen gern Gebrauch machten. Dabei war es hauptsächlich auf die Unschuld des Königs abgesehen und alles darauf angelegt, das Band zwischen ihm und Wagner zu zerreißen. Nach dem ersten geringfügigen Mißverständnis, das zu einer vorübergehenden Verstimmung des Königs führte, war auch schon zu lesen, Wagner sei in Ungnade gefallen, ja, es wurde behauptet, er habe München verlassen. Die Neuesten Nachrichten brachten allerdings am 12. Februar die Erklärung, daß diese Nachrichten völlig unbegründet seien, und am 14. schrieb der König an Wagner: »Elende, kurzsichtige Menschen, die von Ungnade sprechen, die von unserer Liebe keine Ahnung haben, keine haben können – ›Verzeih ihnen, sie wissen nicht, was sie tun‹ –, sie wissen nicht, daß Sie mir alles sind, waren und bis in den Tod sein werden, daß ich Sie liebte, noch ehe ich Sie sah; doch ich weiß, mein Freund kennt mich, sein Glaube an mich wird nie sinken!« Wagner selbst hatte auch nie gezweifelt. Aber die Zeitungsleser waren nun vergiftet, und ein unheilvolles Wort, das einmal in die Menge geschleudert ist, kann nur zu leicht Wurzel schlagen. Der König konnte eines Tages zur Ungnade gezwungen werden.
Doch damit greifen wir den Dingen vor. Einstweilen machte sich nur die »öffentliche Meinung« breit. Am 19. Februar – eine Woche nach der amtlichen Richtigstellung der vermeintlichen Ungnade – erschien in der Allgemeinen Zeitung ein Aufsatz »Richard Wagner und die öffentliche Meinung« von einem ungenannten Verfasser. Es stellte sich bald heraus, daß es der Dichter Oskar von Redwitz war, damals noch ein Liebling der katholischen Kreise. Wie er später der frömmelnden Romantik den Abschied gab und sich in ehrlicher Begeisterung zum neuen Reich bekannte, so hat er sich auch zur achtungsvollen Anerkennung Richard Wagners durchgerungen. In jenem Aufsatz aber erniedrigte er sich zum Werkzeuge der All-Gemeinheit. Zwei Tage später mußte dasselbe Blatt, das schon früher behauptet hatte, daß Wagners »Genossen« ihre Beziehungen zum königlichen Hofe mißbraucht hätten, folgende Zuschrift Hans von Bülows bringen: »Eine Münchner Korrespondenz der Allgemeinen Zeitung beschuldigt die sogenannten Genossen des Herrn Richard Wagner des Mißbrauchs ihrer Beziehungen zum königlichen Hof. Da unter gedachten Genossen ich, der Unterzeichnete, allein die Ehre gehabt habe, in derartige Beziehungen zu treten, so übe ich mein Recht aus und erkläre den anonymen Urheber jener Verdächtigung für einen ehrlosen Verleumder.« Den Aufsatz von Redwitz aber beantwortete Wagner selbst, nachdem er sich mit Bülow und Cornelius über die rechte Form beraten hatte. Seine Entgegnung machte auch einen guten Eindruck, und die Schlußworte von Redwitz, die den »Sturz« Wagners und seiner Freunde begehrt hatten, blieben nach außen ohne Wirkung. Der König hatte schwer unter diesen Vorgängen zu leiden, da seine eigene Mutter besonders feindlich gegen Wagner eingenommen war. Sie setzte geradezu alles in Bewegung, den Künstler von ihrem Sohne loszureißen, so daß dieser sich aus Vorsicht und Klugheit genötigt sah, den persönlichen Verkehr, nach dem Wagner verlangte, noch mehr als sonst zu meiden und sogar als unerwünscht zu bezeichnen. Das veranlaßte Wagner zu der bestimmten Frage, ob er, um der Ruhe seines Gönners willen, München verlassen solle. Darauf erhielt er die Antwort: »Bleiben Sie, bleiben Sie hier, alles wird herrlich wie zuvor … Bis in den Tod Ihr Ludwig.«
Inzwischen waren die Vorbereitungen zu »Tristan und Isolde« in Gang gekommen; nicht im großen Hoftheater, sondern im traulichen Residenztheater. Dort fand am 10. April 1865 um zehn Uhr vormittags die erste Orchesterprobe unter Bülows Leitung statt. Fünf Viertelstunden vorher hatte Cosima ihre dritte Tochter geboren, worüber Bülow an Dr. Gille berichtete: »Ihrer freundlichen Teilnahme gewiß, erlaube ich mir Ihnen mitzuteilen, daß ich Montag, den 10., zum dritten Male Mutter geworden bin, wie die Berliner sagen, wenn sich – Töchter einstellen.« Das Kind wurde Isolde genannt. Nach vollzogener Taufe, an der außer Bülow und Wagner das Ehepaar Schnorr und Frau von Kaulbach teilnahmen, setzte sich Hans an den Flügel, um Schnorr zu einem Marienliede zu begleiten. Während des dritten Absatzes erschien ein Kammerdiener des Königs, der seinen Vorspieler zu sich befahl.
Die Proben, denen sich Bülow mit der ihm eigenen Unermüdlichkeit und Gewissenhaftigkeit widmete und durch die er sich bei den Musikern gehörig in Respekt setzte, fanden aber bis zuletzt nicht nur im Theater statt, sondern wurden auch immer wieder ergänzt und gefördert durch Klavierproben in der Wohnung Wagners. Der Orchesterraum im Residenztheater erwies sich für die nötige Anzahl von Musikern als zu klein, und Bülow verlangte seine Erweiterung. Als ihm darauf erwidert wurde, daß dann wenigstens dreißig Sperrsitze weggeräumt werden müßten, sagte er: »Was liegt daran, ob dreißig Schweinehunde mehr oder weniger hereingehen.« Wer die Welt kennt, wird nicht erstaunt sein, zu erfahren, daß dieser Ausspruch am selben Tage in ganz München verbreitet war und einen Sturm der Entrüstung hervorrief. Bülow mußte sich zu einer beschwichtigenden Erklärung in den Neuesten Nachrichten herbeilassen, wobei er es nicht unterließ, den »höchst unparlamentarischen« und »unglücklichen« Ausdruck, den er gebraucht hatte, zu bedauern, aber auch nachdrücklich betonte, daß er niemals eine Gesamtverunglimpfung des gebildeten Münchner Publikums beabsichtigt habe, sondern natürlich nur jene Theaterbesucher im Sinne haben konnte, »welche verdächtig sind, an den in Wort und Schrift gegen den hochverehrten Meister gesponnenen Verleumdungen und Intrigen teilgenommen zu haben«. Es ist begreiflich, daß die Sache damit nicht erledigt war und daß es auch weiterhin nicht an offenen und versteckten Angriffen, Drohbriefen usw. gegen Bülow fehlte. Trotzdem nahmen die Proben einen so verheißungsvollen, von der lebendigen Teilnahme aller Mitwirkenden geförderten Verlauf, daß Wagner in einem Briefe an Frau Wille rückschauend davon sagen konnte: »Zum erstenmal in meinem Leben war ich hier mit meiner ganzen vollen Kunst wie auf einem Pfühl der Liebe gebettet … wie ein Zaubertraum wuchs das Werk zur ungeahnten Wirklichkeit: die erste Aufführung – ohne Publikum nur für uns – als Generalprobe ausgegeben, glich der Erfüllung des Unmöglichen.«
Diese Hauptprobe fand, nun doch im Hoftheater, vor etwa sechshundert geladenen Gästen am 11. Mai statt. Für den 15. war die förmliche erste Aufführung bestimmt. Sie mußte im letzten Augenblicke wegen Erkrankung der Frau Schnorr abgesagt werden. Am 10. Juni fand sie endlich statt, im Beisein des Königs, mit einem unbeschreiblichen Eindruck auf alle Teilnehmer, besonders aber auf die Künstler selbst und auf ihren geliebten Meister. Nicht wenige auswärtige Besucher waren in der unfreiwilligen Pause zwischen der Hauptprobe und der ersten Aufführung und in der täglichen Erwartung, daß diese demnächst stattfinden müsse, in München geblieben und genossen in dieser Zeit die häufige und stets bezaubernde Gastfreundschaft Wagners und Cosimas in der Briennerstraße. Am 21. Juli – kaum drei Wochen nach der vierten und vorläufig letzten Aufführung des Werkes – wurde Ludwig Schnorr von einem jähen Tode ereilt, im Alter von neunundzwanzig Jahren! Damit war Wagner nicht nur eines persönlichen Freundes und begeisterten Jüngers, sondern auch des »Granitblocks« beraubt, den er – nach seinen eigenen Worten – nun durch eine Menge von »Backsteinen« zu ersetzen hatte, wenn er seinen künstlerischen Gedankenbau verwirklichen wollte. Auch »die schöne Idee« einer deutschen Musikschule erstarb ihm, wie er später sagte, eigentlich schon nach dem Tode dieses unvergleichlichen Darstellers: denn nur auf sein lebendiges Beispiel hätte er vertrauen können. Wagner hat diesen Verlust nie verschmerzt. Es war für ihn das stärkste und aufwühlendste Ereignis in dieser von Liebe und Haß, von Schwärmerei und Verfolgung erregten Zeit. Er wollte mit Bülow am Begräbnisse Schnorrs in Dresden teilnehmen; doch sie kamen zu spät! »Die Leiche hatte bereits einige Stunden vor der bestimmten Zeit der Erde übergeben werden müssen«, wie Wagner uns berichtet. »In heller Julisonne jubelte das bunt geschmückte Dresden in derselben Stunde dem Empfange der zum allgemeinen deutschen Sängerfeste einziehenden Scharen entgegen. Mir sagte der Kutscher, welcher, heftig von mir angetrieben, das Haus des Todes zu erreichen, mit Mühe durch das Gedränge zu gelangen suchte, daß an die zwanzigtausend Sänger zusammengekommen seien. Ja, sagte ich mir: der Sänger ist eben dahin!«
Am 8. August traten Hans und Cosima eine für mehrere Wochen berechnete Reise an, und Wagner folgte der Einladung des Königs, einige Zeit auf dem Hochkopf über dem Walchensee in einer königlichen Jagdhütte zu verbringen. Mit seinem Diener und seinem Hunde traf er am 9. in diesem herrlich gelegenen Zufluchtsorte ein, wo er sich aber nur zwölf Tage aufhielt, die ihm durch Krankheit und schlechtes Wetter verleidet wurden. Auch sein Gemüt fand hier keine Beschwichtigung. In der sonst so wohltätigen Einsamkeit kam ihm die Trennung von Cosima schmerzlich zum Bewußtsein, und er überschaute nun seine Lage, bedachte die Zukunft. Wie ungebrochen seine Schaffenskraft war und daß er halten konnte, was er dem König versprochen hatte, daran war kein Zweifel möglich. Die Nibelungen hatte er zwar noch nicht fortgesetzt, doch die Partitur des ersten Aufzuges von »Siegfried« war soeben vollendet worden, und jetzt begann er mit der Niederschrift des Entwurfes zum »Parsifal«, den der König von ihm erbeten hatte. Wie sollte es aber weitergehen, wenn ihm das Allerwichtigste, das einzig Nötige, die vollkommene Ruhe, die doch auch die Seelenruhe in sich schließt, eben nicht vergönnt war?
Von Cosima hatte er ein in braunes Leder gebundenes Taschenbuch zum Geschenk erhalten, worin er vieles von dem festhielt, was ihn namentlich beim Gedenken an Cosima bewegte. Diese war mit ihrem Manne über Wien nach Budapest gereist, wo sie mit Liszt zusammentrafen, in dessen Gegenwart die Aufführung der »Heiligen Elisabeth« unter Bülows Leitung vor sich gehen sollte. Liszt hatte vor einigen Monaten die niederen Weihen genommen, gleichsam als Antwort auf den Entschluß der Fürstin, sich nicht mehr zu vermählen, aber auch in sinnbildlicher Verwirklichung eines Sehnens, das ihn schon in seinen Jünglingsjahren beherrscht hatte; überdies sollte seine geistliche Würde die von ihm beabsichtigte Erneuerung der katholischen Kirchenmusik ermöglichen und begünstigen – eine Hoffnung, die sich nicht erfüllte. Als »Abbé« war nun Liszt in Ungarn der Gegenstand besonderer Aufmerksamkeit. Nach dem Pester Aufenthalte wurde er nach Gran zum Kardinal Haynald und auf ein Landgut des ihm befreundeten Baron Augusz eingeladen, und wie einst, als er zum ersten Male von seinen madjarischen Landsleuten gefeiert worden, so stand er auch jetzt im Mittelpunkte rauschender Festlichkeiten und jauchzender Begeisterung. Bülows mußten an all dem teilnehmen, und Wagner, der durch Briefe Cosimas von dem Verlauf der Reise unterrichtet war, wußte oder wähnte, daß es hierbei in aller Form darauf abgesehen war, seine Freundin zu zerstreuen, abzulenken, »auf andere Gedanken zu bringen«. In Wien beispielsweise wollte Cosima die Wohnung besichtigen, die Wagner im Vororte Penzing innegehabt hatte. Bülow aber wußte dies zu verhindern und zeigte ihr dafür die glänzenden Läden der inneren Stadt, für die sie in ihrer jetzigen Gemütsverfassung wenig Sinn hatte. In Pest übernahm dann Liszt gewissermaßen das Amt, für Cosimas »Heiterkeit« zu sorgen.
Aus dem braunen Buche entnehmen wir, wie tief Wagner darunter litt. »Welcher Wahnsinn!« »Soll man es glauben?« »Ach, blöde Herzen, blinde Augen!!« Solche Stoßseufzer unterbrechen immer wieder die Aufzeichnungen über sein Befinden, seine Arbeit, über die Bücher, die er liest, über die Eindrücke der großartigen landschaftlichen Umgebung. »Wir dürfen uns nicht wieder trennen, hörst Du? – Dies ist das Eine, und bleiben wir stets zusammen, so wollen wir das übrige kommen sehen.« »Nur Du hast auf mich ein Recht. Niemand sonst weiß etwas von mir.« »O Cosima! Du bist die Seele meines Lebens! Ganz und gar! – Ich sah in das flache Land hinein … dachte mir München ohne Dich. Alles Grab! – Nichts, nichts mehr ohne Dich! Du bist die Seele von allem, was noch in mir lebt.« »Bleibe bei mir, geh nicht wieder. Sag's dem armen Hans offen, daß ohne Dich es mit mir nicht mehr geht. O Himmel, könntest Du ruhig vor der Welt mein Weib sein! Dies stete Kommen und Gehen, wieder Kommen, wieder Fortmüssen, Verfügenlassen über Dich – es ist entsetzlich … Du Ärmste gehst mir auch darüber zugrund.« »Wer erkennt denn den Menschen neben sich? Was wissen unsere liebsten Freunde von uns? … Keiner findet es aus sich heraus, wer der andere ist. – So fürchte ich, werden wir doch zugrunde gehen.« »Gute Nacht! Du bist doch mein Weib – – –« »Da hast Du zehn Tage aus meinem Leben … Dir fern, bin ich Dir immer näher gekommen! … Du bist mein Ein' und alles.« Diese Anrufe und Aufschreie kehren auch in München im braunen Buche wieder. »Alles ist besser als so von Gott verlassen sein, wie ich gestern war! – Was hab' ich da ›geklagt‹! Wie ganz unähnlich war ich da Deinem heiligen Vater, der ja nie klagt!« »Ach! wenn das Zauberwort zu finden wäre, das die Deinigen über Dich vollständig belehrte! Wie bleibt ihr Wissen von Dir halb und lückenhaft. Nun schleppen sie Dich herum. Das demütigt mich tief, daß sie das dürfen! Aber, daß Du Dich eigentlich nicht schleppen ließest, sondern um Dein Leiden, Deine Schwäche zu betäuben, nun gerade Dich glauben machen wolltest, es wäre so auch gut, und dies und jenes habe doch auch sein Recht, und was ich alles weiß, und was man Dir sagt: – dann könnte und kann ich nicht mehr zusehen: dann hat alles keinen Sinn mehr für mich, und meine Liebe erscheint mir selbst als Schwäche! Mir kommst Du dann ganz verloren, völlig untreu vor. – – Ach – an die Arbeit!! – – –« »Auch diese Trennung, mit vielen ihrer Qualen, erlebte ich – vor einem Jahre. Ich werde sie wieder erleben! In einem Jahre wird die Zeit sein, wo Cos alles vergessen haben wird, welche Leiden sie mir jetzt zufügte, welche Qualen der Zerrissenheit sie sich bereitete, wird plötzlich finden, daß es doch gar nicht anders gehe, als einer neuen Bestimmung des Vaters abermals zu folgen – und alles wird wieder so kommen! – Daran müßte man sich also gewöhnen!! –«
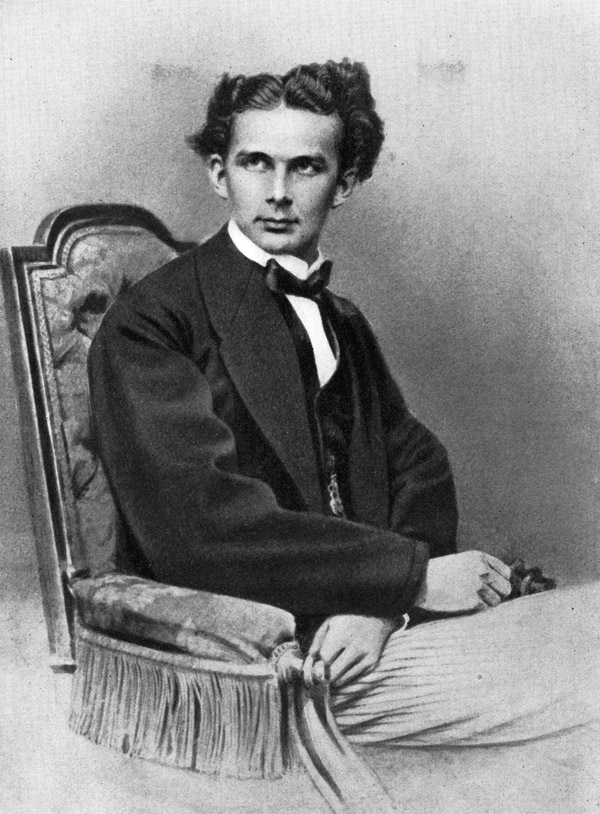
König Ludwig II. von Bayern.
Nach einem aquarellierten Lichtbild im Hause Wahnfried.
Photo F. Bruckmann, München

Wohnhaus Triebschen bei Luzern

Blick von Triebschen auf den Vierwaldstätter See.
Photos Franz Schneider, Luzern
In diesen Tagen aber, in denen er sich so quälte und mit Ungeduld des entscheidenden Schrittes harrte, der Cosima für ihn frei machen sollte – in diesen Tagen schrieb er dem König im Zusammenhange mit der deutschen Musikschule, die ihm fürs erste noch wichtiger war als das Festtheater: »Sterbe ich heute, so ist Hans Bülow der Einzige, dem ich die Aufführung meiner Werke übergeben kann: ja komme ich endlich dazu, mein Testament zu machen, so werde ich ausdrücklich diese Bestimmung hinterlassen, daß nur Er autorisiert sei, meine Werke aufzuführen. Bülow hat alles zum allergrößten Künstler, und dazu Fähigkeiten, die ich selbst nicht besitze: ihm fehlt nur eines: ideale Produktivität. Besäße er diese, so würde er aber mir verloren sein: durch das, was er nicht hat, ist er daher für mich unersetzlich. Ich brauche ihn nicht zu rühmen: seine ganz unvergleichliche Leistung als Dirigent des Tristan hat alles mit Staunen erfüllt. Außer mir versteht keiner so zu dirigieren. Sein Ruhm als ausübender Musiker wird nur von Liszt übertroffen: außerdem hat er keinen Gleichen. Dazu hat Bülow eine vollkommene Gelehrtenbildung … Auf den ersten Blick müssen wir ersehen, daß dieser treue Freund dazu erkoren ist, alles das auszuführen, zu bewachen und zu besorgen, was neben meiner schaffenden Tätigkeit zu wirken ist, was mir aber abgenommen werden muß, wenn ich ohne Störung bei dem einen, beim Schaffen gelassen werden soll.« Die Notwendigkeit der Trennung Cosimas von Bülow, aber auch die untrennbare Zusammengehörigkeit Bülows und Wagners – dieser unlösbare Widerspruch lag wie ein dunkler Schatten neben dem hellen Licht, das sich sonst um Wagner verbreitete.
Um seine Zukunft zu sichern und seine Unternehmungen in jeder Hinsicht zu fördern, war nun auch seine wirtschaftliche Lage vollkommen in Ordnung gebracht worden. Für sein Münchner Dasein war in jeder Hinsicht, durch Wohnung und Jahresgehalt, glänzend gesorgt. Damit er aber auch seine Wiener Verbindlichkeiten endgültig ordnen und alle Schulden tilgen könne, ließ ihm der König durch die Kabinettskasse ein unverzinsliches Darlehen von vierzigtausend Gulden anweisen. Cosima war eben bei ihm, als die Botschaft einlangte, und gewahrte den ungeheuren Eindruck, den dieser neue Beweis der königlichen Liebe und Gnade auf ihn machte. Sie bedauerte nur, daß die frohe Kunde in einer »trockenen Sekretariatsanzeige«, nicht in einem Schreiben des königlichen Freundes ausgesprochen war, und daß die Summe nicht ins Haus kam, sondern daß Wagner genötigt wurde, sie selbst zu beheben. Sie wollte, daß ihm »das Freundesgeschenk auch durch Freundeshand überbracht« werde, und erbot sich, das Geld in seinem Namen abzuholen. Wagner erteilte ihr die nötige Vollmacht, mit der sie am anderen Morgen wie zu einem festlichen Spaziergange, ihr ältestes Töchterchen an der Hand, sich zur Kasse aufmachte. Dabei war sie von der begreiflichen Vorstellung erfüllt, daß die Beamten, in deren Augen der Empfänger der königlichen Gunst doch wohl besonders verehrungswürdig sein mußte, nun auch sie freundlich und hochachtungsvoll empfangen würden. Statt dessen wurde sie nur wortkarg gefragt, wie sie es anfangen werde, die ganze Summe mit sich zu führen, ob sie etwa die Säcke Silbergeldes selbst tragen wolle. Da sie erstaunt bat, ihr Papiergeld zu geben, erklärte man, davon sei nicht genug vorrätig, die Hälfte wenigstens müsse sie in Silber nehmen. Dieser Unfreundlichkeit gegenüber empfand sie zunächst den Trost, daß wenigstens dem Meister eine so demütigende Behandlung erspart geblieben, und übernahm es nun, von dem heiteren Gefühle eines freundschaftlichen Ehrgeizes erfüllt, durch nichts sich abschrecken zu lassen, sondern die Beamten durch ihre Ausdauer zu beschämen. Das Kindermädchen, das sie begleitet hatte, mußte zwei Fiaker holen, die alsbald bei der Kasse vorfuhren, »und mit ruhigem Gleichmut« – es sind die Worte Wagners in einem späteren Briefe an den König – »mit ruhigem Gleichmut half sie selbst die schweren Geldsäcke in die Wagen schaffen, wobei sie endlich bemerkte, daß selbst das barsche Benehmen der Kassenbeamten einer gewissen achtungsvollen Rührung wich, als ob sie unwillkürlich das zarte Motiv der so sonderbar energischen Handlung der edlen Frau begriffen hätten. Wirklich kam diese nun mit ihren beiden Wagen bei mir an, überbrachte mir mühevoll das königliche Geschenk und erklärte mir durch ihre heitere Schilderung, welche Anstrengung es ihr gekostet habe, ihren Vorsatz, das Geschenk nur aus Freundeshand mich empfangen zu lassen, zu Ende zu bringen«. Cosima hatte schon deshalb nicht gezaudert, das Geld unter allen Umständen mitzunehmen, weil sie wußte, daß Wagner am nächsten Tage nach Wien reisen wollte, um dort seine Gläubiger zu befriedigen. Auch sie hat einen Bericht über dieses sonderbare Ereignis für den König verfaßt. Sie schildert da ihre Verlegenheit und sagt, daß sie sich doch zu der merkwürdigen Fracht entschlossen habe, da zufällig kein Fremder anwesend war und da sie sich »auf die Diskretion und ein gewisses Ehrgefühl verließ, welches niemals erlaubt, eine Frau in die Öffentlichkeit zu ziehen«.
Dies war nun freilich ein Irrtum gewesen; die Sache sollte noch sehr bedenkliche Folgen haben. Zunächst erfreute sich Wagner fortdauernd der Gunst des Königs, der ihn sogar für acht Tage zu sich nach Hohenschwangau einlud – und als Wagner am 18. November heimfuhr, begleitete er ihn zur Bahn. Im Wagen vor dem Abschiede beklagte er sich über seine verständnislose Umgebung. Daß diese jedenfalls kein Verständnis für die Freundschaft mit Wagner hatte, das erfuhr dieser, als er wieder in München war. Nicht nur sein Zusammensein mit dem König und die besonders auszeichnende Behandlung, die ihm diesmal zuteil geworden, auch verschiedene Ratschläge, die er dem Herrscher gegeben hatte und die nun in der Form von Aufträgen an die Minister weitergeleitet wurden – dies alles entfachte neuen Widerstand, neue Erbitterung. Die Vorwürfe und Verleumdungen des Winters und des Frühjahrs wiederholten und steigerten sich im Herbst, und in dem verschärften Streite wurde namentlich Pfistermeister von der einen Seite als der vergeblich warnende, von der anderen als der gewissenlos hetzende Hauptgegner Wagners bezeichnet. Der »Volksbote für den Bürger und Landmann« gab am 26. November unverhohlen der Meinung Ausdruck, Wagner und die Seinen hätten es darauf angelegt, Pfistermeister zu beseitigen, damit die »Gelüste auf Ausbeutung der königlichen Kabinettskasse« leichter befriedigt werden können. Die vierzigtausend Gulden, die natürlich kein Geheimnis geblieben waren, wurden Wagner öffentlich vorgehalten, und er wurde auch dessen beschuldigt, daß er dem König »in kaum Jahresfrist« nicht weniger als hundertneunzigtausend Gulden gekostet habe. Die zweite Summe war nun eben das, was der König gemäß dem Voranschlage in einem Jahre für die Kunst auszugeben pflegte; es hatte hier, sei es absichtlich oder unabsichtlich, eine grobe Verwechslung stattgefunden. Diese war allerdings leicht richtigzustellen. Wagner ging aber beträchtlich weiter und verfaßte eine geharnischte Entgegnung, die am 29. November in den Neuesten Nachrichten erschien, nicht von ihm gezeichnet, doch unverkennbar in seinem Sinne geschrieben – man hielt Cosima für die Verfasserin. Am Schlusse dieser Entgegnung wurde geradezu ausgesprochen, »daß mit der Entfernung zweier oder dreier Personen, welche nicht die mindeste Achtung im bayerischen Volke genießen, der König und das bayerische Volk mit einem Male von diesen lästigen Beunruhigungen befreit wären«.
Das war allerdings eine starke Herausforderung. Der Ministerpräsident von der Pfordten, der Kabinettssekretär von Pfistermeister und der Vorstand der Kabinettskasse von Hofmann zweifelten keinen Augenblick, daß sie gemeint seien. Von der Pfordten berichtete am 1. Dezember an den König und ging ohne Umschweife auf sein Ziel los. »Eure Majestät stehen an einem verhängnisvollen Scheidewege und haben zu wählen zwischen der Liebe und Verehrung Ihres treuen Volkes und der Freundschaft Richard Wagners. Dieser Mann, der es wagt zu behaupten, die in Treue erprobten Männer im kgl. Kabinette genössen nicht die mindeste Achtung im bayerischen Volke, ist vielmehr seinerseits verachtet von allen Schichten des Volkes, in denen der Thron seine Stütze suchen muß und finden kann.« Was diesen Worten dann noch folgte, das waren schwerere Beschuldigungen und ungebührlichere Angriffe, als sie Redwitz vor zehn Monaten gewagt hatte. Der König litt mehr darunter als Wagner. Er weilte damals noch in Hohenschwangau und schrieb, daß ihm das Ende dieses Aufenthaltes durch den Aufsatz in den Neuesten Nachrichten, der Wagner mehr geschadet als genützt habe, verbittert worden sei. Wagner erwiderte, daß der einfache Gebrauch der königlichen Macht die Ruhe herstellen könne. Ludwig aber, auf den außer seinen Verwandten auch der Erzbischof von München einwirkte und dem man sogar die Möglichkeit eines Aufstandes vorspiegelte, hatte nicht die Kraft, das erwartete Machtwort auszusprechen. Am 6. Dezember kehrte er nach München zurück, und schon am 7. überbrachte der Kabinettsrat Lutz dem Künstler die Bitte des Königs, er möge Bayern auf sechs Monate verlassen. Auch brieflich beschwor der König am nächsten Tage seinen Freund, diesem Wunsche Folge zu leisten. »Glauben Sie mir, ich mußte so handeln. Meine Liebe zu Ihnen währt ewig … Bewahren Sie mir immer Ihre Freundschaft; mit gutem Gewissen darf ich sagen, ich bin Ihrer würdig.« Die »Verbannung« Wagners wurde schließlich allgemein bekanntgemacht, mit den Worten des Königs: »Ich will meinem teuren Volke zeigen, daß sein Vertrauen, seine Liebe mir über alles geht.«
Zu spät erklärte jetzt die Bayerische Fortschrittspartei, die an der Hetze nie teilgenommen hatte, daß der König über die Stimmung des Volkes gröblich getäuscht worden sei, daß die Anwesenheit Wagners mit den öffentlichen Angelegenheiten des Landes nicht das mindeste gemein habe. Zu spät wandte sich der Abgeordnete Dr. Völk in einer Versammlung in Augsburg gegen die von manchen Blättern beliebte schamlose Zusammenstellung Wagners mit der Tänzerin Lola Montez, deren Beziehungen zu Ludwig I. dessen Abdankung verschuldet hatten. Dieser Vergleich sei eine »grenzenlose Frechheit« und »verdiene Züchtigung und Brandmarkung bei allen, welche nicht bloß von Achtung und Liebe zum König sprechen«. Diese nutzlosen Ehrenrettungen fanden erst Beachtung und Verbreitung, als Wagner den Wunsch des Königs bereits erfüllt hatte. Noch einmal richtete Ludwig schmerzbewegte Abschiedsworte an den Geliebten. »Wir wollen von der Freundschaft nicht lassen, die uns verbindet. Um Ihrer Ruhe willen mußte ich so handeln.« Seinen Wunsch aber nahm er nicht zurück, und am 10. Dezember um ¾ 6 Uhr morgens verabschiedete sich Wagner auf dem Bahnhofe von Cosima und seinen nächsten Freunden. In einem Briefe an seine Braut schrieb Cornelius: »Wagner sah gespenstisch aus; bleiche, verworrene Züge und das schlaffe Haar ganz grau schimmernd … Der Diener Franz und der Hund Pohl reisten mit; als der Waggon hinter den Pfeilern verschwand, war es wie das Zerrinnen einer Vision.« –
Bülow war damals auf einer Konzertreise und konnte Wagner nicht mehr die Hand drücken. Als aber die Neue Preußische Zeitung einen Münchner Bericht über die »demagogischen« und »revolutionären« Umtriebe brachte, durch die Wagner sich selbst das Grab geschaufelt habe, da ließ er sich's nicht nehmen, in derselben Zeitung – er weilte eben in Berlin – sehr bestimmt zu erklären, daß er, der »die Ehre hatte, seit Jahresfrist im vertrautesten täglichen Verkehr mit dem vielgeschmähten Künstler zu stehen, ebensowohl in der Lage sei, als sich berufen und verpflichtet fühle, dieser haltlosen Anklage den allerentschiedensten Widerspruch entgegenzusetzen«. Treffend wies er darauf hin, daß Wagner durch seine Enthaltsamkeit von jeder politischen Kannegießerei vielmehr die Gegnerschaft der gesamten deutschen Demagogie gegen sein Kunstschaffen hervorgerufen hatte und daß anderseits der Kampf in München nicht so sehr um Wagner als vielmehr um die Besetzung der einflußreichen Stellen im Kgl. Kabinette ging und der Name Wagners zu diesem Zwecke von den politischen Parteien – hüben und drüben – mißbraucht wurde. Diese Tatsache kann auch das Verhalten des Königs in unseren Augen einigermaßen rechtfertigen. Er durfte selbst Männer, die ihm persönlich verhaßt waren, nicht ohne weiteres preisgeben, wenn damit einer Partei ein Gefallen erwiesen wurde und das Ansehen der Krone in den daraus entstehenden Wirren bedroht schien. Mit Recht bezeichnete Bülow die Niederlage Wagners nur als etwas vorübergehendes. »Bei meiner demnächst erfolgenden Heimkehr nach München werde ich das Material zusammenstellen, dessen ich zur Verteidigung der schwer gekränkten Ehre meines hochverehrten Freundes und Meisters bedarf.«
Dabei schien er sich keinen Gedanken darüber zu machen, daß auch seine Münchner Stellung durch die Entfernung Wagners zweifelhaft wurde. Aber er war doch von all dem sehr angegriffen. In seinem Briefe an Dr. Gille vom 27. Dezember lesen wir die inhaltsschweren Worte: »Ich mache in einem Jahre immer soviel durch, als für drei Jahre ausreichen würde.«
Wir müssen uns stets vor Augen halten, daß von einer Ungnade des Königs auch diesmal keine Rede sein konnte. Wagner hatte dem König zuliebe seinen Wohnort für ein halbes Jahr verlassen. Sonst blieb alles unverändert. Durch Cosima ließ sich der König fortlaufend über Wagners Befinden und Verweilen unterrichten.
Der Künstler war über Bern und Vevey nach Genf gereist, wo er bis zum Frühjahr bleiben wollte. Er mietete ein Landhaus in der Campagne aux Artichauts, das aber erst wohnlich eingerichtet werden mußte, und unternahm einstweilen einen Ausflug nach Südfrankreich. In Marseille erhielt er die Kunde von dem Tode seiner Gattin. Diese war am 25. Januar 1866 in Dresden gestorben. Noch in den letzten Wochen hatte sie Gelegenheit gehabt, für die Ehre ihres Mannes einzutreten. In Münchner und in Wiener Blättern war das erlogene Gerücht verbreitet worden, Wagner habe sie in seinem Wohlstande schmählich darben lassen. In Wahrheit hatte sie seit ihrer Trennung von ihm, seit Zürich, niemals Not gelitten. In Paris und in Biebrich war der Versuch unternommen worden, das eheliche Zusammenleben wieder aufzunehmen. Aber es ging nicht: Gemütsart, Lebensanschauung, Kunstauffassung waren zu verschieden. Nur in einem bestand nie ein Gegensatz: in der bei allen Kämpfen und Zerwürfnissen doch kaum verminderten gegenseitigen Anteilnahme an dem persönlichen Gedeihen. Wagner hat auch in den schlimmsten Wiener Zeiten nie unterlassen, zuallererst für seine Frau zu sorgen. Er geriet oft nur deshalb in Bedrängnis, weil ihm nach ihrer Sicherstellung ein zu geringes Einkommen verblieb, und er machte nicht selten Schulden, um eine Minderung ihres Einkommens zu verhüten. So konnte denn Minna auf jene gemeinen Angriffe hin öffentlich erklären, daß sie von ihrem Manne eine Unterstützung erhalte, die ihr ein sorgenfreies Dasein gewähre. Sie setzte hinzu: »Es gereicht mir zur besonderen Befriedigung, durch diese meine Erklärung wenigstens eine der vielfachen Verleumdungen, die gegen meinen Mann gemacht werden, zum Schweigen bringen zu können.« Der »Volksbote« ließ sich allerdings nicht beruhigen, sondern behauptete kühn, daß Wagner eben nur durch eine augenblickliche Hilfe diese Erklärung hervorgerufen habe. Erst eine behördliche Zuschrift aus Dresden zwang das Blatt zum Widerruf. Drei Wochen später war Minna ihrem Herzleiden erlegen, der Krankheit, die so viel zu ihrem schwierigen Verhalten beigetragen und die Wagner auch bei ihren bedenklichsten Ausschreitungen und ungerechtesten Vorwürfen nachsichtig und versöhnlich gestimmt hatte.
Er war durch die Nachricht mächtig getroffen und schrieb seinem ehemaligen Dresdner Hausarzt Dr. Pusinelli: »Ich nehme an, daß Eure freundliche Fürsorge der Leiche meiner unglücklichen, armen Frau in meinem Namen dieselbe Ehre erzeigen ließ, die ich ihr erzeigt haben würde, wenn sie glücklich an der Seite des von ihr beglückten Gatten dahingeschieden wäre. Ganz in diesem Sinne bitte ich für ihre Ruhestätte zu sorgen.« Das Leiden Minnas war es auch gewesen, das Wagner immer wieder davon abgehalten hatte, seiner Frau mit ihrem empfindlichen Herzen die Quälereien eines Scheidungsverfahrens zuzumuten. Da sie getrennt waren und einander auf keine Weise im Wege standen, so hielt er es für eine unnötige Grausamkeit, ihr irgendwelche schwere Aufregungen zu bereiten. Nun hatte das Schicksal selbst ihr Band gelöst. Ein Hindernis seiner Vereinigung mit Cosima war gefallen. Aber dieser Gedanke hatte jetzt den geringsten Raum in ihm. Er war nur tief bewegt bei der Rückschau auf die drei Jahrzehnte, in denen sein Dasein mehr oder weniger eng mit dem der Verblichenen verbunden gewesen war. Aus einem stürmischen Liebesbunde, einer höchst unbesonnenen voreiligen Heirat und einer wenig glücklichen jungen Ehe war dann doch eine echte Schicksalsgemeinschaft geworden, die sich in der Pariser Leidenszeit schön bewährt hatte, die sich aber später in dem Maße lockern mußte, als der Wille und der Weg Wagners immer mehr in eine Ferne und Höhe strebten, in die Minna nicht zu folgen vermochte. Wagner hatte die Todesnachricht durch Cosima erhalten, an die Dr. Pusinelli sich wenden mußte, da ihm der Aufenthalt Wagners nicht bekannt war. Cosima wäre am liebsten sofort nach Frankreich gereist, um dem wie Betäubten »in schwerer Stunde« beizustehen. Er aber wollte seine Erschütterung allein niederkämpfen. Erst nachdem er in die »Artichauts« zurückgekehrt und das Haus gegenüber dem Montblanc entsprechend instand gesetzt war, bat er Cosima, ihn zu besuchen.
Inzwischen hatte der Tod Minnas der »öffentlichen Meinung« auch noch weiteren Grund gegeben, sich wieder einmal recht gehässig vernehmen zu lassen. In der von einem Geistlichen geleiteten Augsburger Postzeitung wurde behauptet, Cosima von Bülow habe am Tage der Bestattung Minna Wagners in glänzend weißer Kleidung das Münchner Schauspielhaus besucht und so anscheinend ihrer besonderen Freude Ausdruck gegeben. Hans von Bülow wäre nicht Hans von Bülow gewesen, wenn er das ruhig hingenommen und nicht auch gleich dazu benutzt hätte, diesen Leuten einmal ordentlich die Wahrheit zu sagen. »Da Frau von Bülow«, so schrieb er dem Schriftleiter H. Birle, der ihm eine Berichtigung oder eine Erwiderung freigestellt hatte, »da Frau von Bülow, die Tochter des hochwürdigen Abbé Franz Liszt in Rom, der Öffentlichkeit nicht angehört, da sie weder Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin usw. ist, kurz nicht zu denjenigen Damen zählt, deren Photographie man in den Kunsthandlungen ausstellt und verkauft, so darf ich es mir als eine der impertinentesten Unziemlichkeiten verbitten, wenn ihre Privathandlungen, und als solche gilt ein Theaterbesuch, wäre er auch in der auffallendsten Toilette und selbst am Todestage des nächsten Anverwandten erfolgt, in öffentlichen Zeitschriften kritisiert, lobend oder tadelnd überhaupt erwähnt werden … Trotzdem nun zufälligerweise alle in der Münchner Korrespondenz der Nr. 32 der Postzeitung enthaltenen Behauptungen erlogen sind – denn: erstlich stehen wir in keiner verwandtschaftlichen Beziehung zu meinem hochverehrten Freunde Herrn Richard Wagner, noch standen wir in freundschaftlicher zu seiner verstorbenen Gattin, zweitens hat meine Frau am Bestattungstage der Frau Wagner das Münchner Schauspielhaus nicht besucht, endlich pflegt sie niemals in ›glänzend weißer‹ Kleidung zu erscheinen – so halte ich es ebensosehr unter meiner Würde als auch formell ganz verkehrt, diese ›tatsächliche‹ Berichtigung ›zur Erwiderung‹ auf jenen Artikel der Redaktion der Augsburger Postzeitung einzusenden. Wodurch ich mich beleidigt fühle, wogegen ich protestiere, was ich mit allen mir zu Gebote stehenden Mitteln zu verhüten, oder wenn es geschehen, zu züchtigen suchen werde, das ist die – entschuldigen Ew. Hochwürden den Ausdruck, ich finde keinen anderen – gegen meine Frau verübte ›Polissonnerie‹. Aus diesen Gründen, wie Ew. Hochwürden begreiflich finden werden, bin ich nur in der Lage, deren zweite Proposition zu akzeptieren, daß nämlich ›die Redaktion der Postzeitung ihr Bedauern über die Aufnahme jenes Passus öffentlich erkläre‹.« Dieser gegenständlichen Auseinandersetzung folgte eine allgemeiner gehaltene, sehr nachdrückliche und ebenso geistvolle Verteidigung Wagners, zu der sich Bülow deshalb veranlaßt sah, weil jene beleidigende Auslassung ja doch ihm gegolten habe und er wohl nur in seiner Eigenschaft als Freund, Schüler und »enthusiastischer Verehrer« Wagners zum Gegenstande unliebsamer Aufmerksamkeit geworden sei. Warum, woher, so fragte er, die erbitterte Verfolgungswut gegen diesen Künstler und seine Freunde? Aus einem ganz unseligen Mißverständnis! Niemals sei Wagner den Bayern oder der katholischen Religion gefährlich oder abhold gewesen. Wagners Ansichten und Absichten seien so echt deutsch, antijüdisch und antimaterialistisch, daß sie viel mehr eine begünstigende als eine befehdende Gesinnung von seiten der erleuchteten Katholiken verdienten. Dabei betonte Bülow, daß er, »zur Ausführung von Wagners Kunstideen berufen«, zwar Akatholik, aber durchaus nicht Antikatholik sei, daß er alle seine Kinder katholisch erziehen lasse und daß er, selbst wenn er den katholischen Geist mißverstünde, schon aus schuldiger Pietät gegen seinen Schwiegervater niemals sich irgendwie antikatholisch gebaren könnte. –
Cosima, die am 6. Februar ihre Großmutter in Paris verloren hatte, reiste mit ihrer Tochter Daniela nach Genf. Wagner fuhr ihr bis Lausanne entgegen. Kurz vorher, am 24. Februar, hatte Bülow die Lisztsche »Legende der heiligen Elisabeth« in München höchst erfolgreich aufgeführt, und Wagner hatte es bitter empfunden, daß er nicht mit dabei sein konnte. Schwer darunter leidend, daß er aus München »verbannt« war, sah er Trost und Heil nur darin, daß ihm jetzt, so weit entfernt von den gewohnten Verhältnissen, wenigstens die lang ersehnte vollkommene Ruhe für sein Schaffen gesichert schien. Als Cosima am 7. März bei ihm war, fühlte er sich wieder glücklich, spürte er wieder häusliches Behagen. Cosima jedoch erkannte, daß der Aufenthalt in Genf, wo übrigens die Miete schon am 1. April ablief, nicht das Richtige sei. Sie unternahmen gemeinsam eine Erkundungsfahrt in die französische Schweiz, und außerdem trat Wagner mit einem Vertrauensmanne in Paris in Verbindung, der ihm ein schönes Landgut mit einem Schlößchen ausfindig machen sollte, »etwa bei Avignon und Arles bis nach Perpignan und zu den Pyrenäen oder wo immer, aber nicht in Marseille oder Nimes, sondern lieber in einer jener Städte außerhalb des Verkehrs, wo man so wohlfeil lebt«. Der Pariser Freund – wir kennen nur Wagners Brief, aber nicht den Empfänger – sollte ihm womöglich die Pacht für fünf bis sechs Jahre verschaffen, mit dem Vorbehalte des späteren Ankaufes. Der Preis sei Nebensache. »Die Hauptsache ist, daß ich mich in angenehmer Weise außerhalb der Welt befinde, fern von jeder Berührung mit den schrecklichen Verhältnissen der Vergangenheit. Das ist das einzige Mittel, um meine begonnenen Werke zu retten, die verloren wären, wenn ich noch ein Jahr die bisherigen Aufregungen erdulden müßte.«
Doch das Schicksal hatte es anders gewollt. Weder in Frankreich noch in der französischen Schweiz fand sich das Gesuchte. Am 30. März 1866 unternahmen sie einen Abstecher in die deutsche Schweiz und fuhren am nächsten Tage, am Ostersamstag, von Luzern nach Romanshorn über den Vierwaldstätter See, vorbei an Triebschen. Dieses dem Obristen Am Rhyn gehörige einfache, aber wundervoll gelegene Landhaus – eine gute halbe Stunde von der Stadt – hatte es ihnen sofort angetan. Cosima reiste weiter nach München, Wagner aber blieb in Luzern und besichtigte einige Tage später das Haus, mit dessen Eigentümer er alsbald die Miete abschloß. Die Auflösung seines Münchner Aufenthaltes war bereits entschieden, und der unverhoffte Fund in dieser herrlichen Gegend, die er schon seit langem liebte, bot ihm erwünschte Zuflucht. Gleichzeitig aber hatte sich der König entschlossen, die »Verbannung« allmählich aufzuheben. Er bot dem Freunde vorläufig ein Jagdhaus an und drang mit seiner ganzen schwärmerischen Beredsamkeit auf Cosima ein: »Der Triumph der Feinde war voreilig, geradezu blöde, denn sie kennen nicht die heiligen Mächte, welche die Brust des Begeisterten, Treuen erfüllen. Teure Freundin, ich beschwöre Sie, tun Sie Ihr Möglichstes, um den Geliebten zu bestimmen, meiner Freundesbitte zu willfahren. – Glückselige Sonne, die dem Tage leuchtet, der die zusagende Antwort des Einzigen, des Angebeteten bringen wird.« Aber Wagner sagte nicht zu. Nach kurzem Schwanken wußte er, daß es für ihn keinen Sinn habe, sich in die alte Gefahr zu begeben und neuer Ungewißheit auszusetzen. »Willkommen, Schicksal«, schrieb er an Cosima, »Asyl sei Triebschen.«
Hier sollte ihn »kein Mensch wieder herausbringen«. Er war zwar zunächst allein und hatte ohne die Hilfe Cosimas für die Instandsetzung des Hauses zu sorgen. Ringsum aber blühte der Lenz und leuchtete die Natur. Wenn am Markttage Kahn auf Kahn von Uri, Schwyz und Unterwalden über den glatten See nach Luzern fuhr, jedes Boot von einem strahlenden Silberkreise umwoben, dann war dies »ein wonnevoller Anblick, ganz unsäglich schön. Ein solcher Morgen ist nicht zu teuer mit einem beschwerlichen Wintermonat bezahlt«, schrieb er an Cosima. Auch dem König berichtete er, wie er hier alles habe, »um frei, wohlanständig und unbeengt sich in schönster – Einsamkeit erhalten zu können. Einsam, aber frei, ausgeschieden, aber sorgenlos für das Leben«. Am Ufer hatte er einen Kahn, im Stall ein altes, gutmütiges Pferd, für beides einen vortrefflichen Knecht, und so konnte er das klare, sonnige Wetter zu mannigfachen Ausflügen benutzen. Auch ein großer, schöner Neufundländer belebte seine Einsamkeit. Dieses prachtvolle Tier war ihm – nach dem Tode des noch aus Wien mitgebrachten Hundes Pohl – von Verena Weitmann geschenkt worden, einer Schweizerin, die ihn vor Jahren in Luzern gepflegt, die er dann in sein Haus nach München genommen und die soeben mit seinem Diener Franz die Einrichtung in Genf besorgt hatte. Er fühlte sich geborgen wie schon lange nicht. Der Garten, die Landschaft, das Singen und Schwatzen der Vögel in Busch und Baum erfrischten und entzückten ihn. Immer wieder finden sich reizvolle Gemälde in seinen Briefen an Cosima. So schrieb er einmal: »Herrliche Kühe bedecken rings die Wiesen. Tag und Nacht hörst Du das Geläute. Dies Geläute ist schöner als alles Tönen, das ich kenne. Die Willkür des Klangwechsels, die herrlichen Glocken, der Stolz des Besitzers, sind von unbeschreiblichem Zauber. Ich gebe alle Glocken Roms dafür hin.« Diese Briefstellen sind uns erhalten geblieben, weil Cosima sie dem König mitteilte.
Als der Lenz zur höchsten Blüte gediehen war, traf Cosima mit den Kindern in Triebschen ein. Bülow, der schon im März gern damit einverstanden gewesen war, daß seine Frau auf acht Tage nach Genf ging, »um dem armen großen Einsamen ein wenig Gesellschaft zu leisten«, schickte nun im Mai die Seinen nach Triebschen zum Sommeraufenthalt. Er selbst mußte noch die vom König befohlenen sogenannten Mustervorstellungen Wagnerscher Werke in München abwarten. Wagner war nicht erfreut durch diese Aufführungen, für die »außer Frau Schnorr« die geeigneten Darsteller fehlten und die vor allem szenisch mißglücken mußten. »Lohengrin« – so schrieb er dem König – »namentlich der zweite Akt, ist auf allen Theatern bisher noch schauderhaft falsch und unverständlich gegeben worden. Nur ich – ich ganz einzig würde imstande sein, unmittelbar mitwirkend, jeden Augenblick praktisch eingreifend und anweisend, Sinn und Verstand in diese Darstellung zu bringen. Bülow wird, unter meiner Anleitung, die Werke vollendet gut und richtig dirigieren; ohne meine persönliche Mitwirkung wird er die Musik besser und richtiger als irgendein nur erdenkbar anderer Dirigent aufführen lassen; die szenische Darstellung ist nicht sein Fach, und hiefür erfordert es eine Begabung und Erfahrung, wie ich ganz allein sie besitze. Die Szene wird unter allen Umständen fehlerhaft und gemein bleiben müssen. Die neuen Szenen des Tannhäuser« (die er für Paris geschrieben hatte und jetzt unter allen Umständen beibehalten wollte) »sind geradeswegs vollständig unmöglich, weil ich selbst, und zwar sobald mir die ganzen entsprechenden Mittel zu Gebote gestellt würden, erst die – in Paris gänzlich ungelöste – Aufgabe derselben meiner Kenntnis und Erfahrung als Problem zu stellen hätte. Unter solchen Umständen kenne ich gar kein peinlicheres Gefühl als den Gedanken an diese beabsichtigten Aufführungen, und ich gestehe, daß die Vorstellung davon mein Inneres bitter und quälend bedrückte … Gewiß! selbst diese kümmerlichen Aufführungen müßten mir, im Sinne der Welt, von ›Nutzen‹ sein. Im Sinne der Welt – bekundet sich dadurch des Königs fortgesetzte Liebe zur ›Wagnerischen Musik‹; die Stücke werden, gerade unter den obwaltenden Umständen, von großer mir sehr ›günstiger‹ Wirkung sein: mein Andenken wird neu angeregt, die Teilnahme an meinem unverdienten Lose wird immer lauter werden; die Feinde werden kleinlaut, ängstlich. Vielleicht – ja, alles recht nützlich und vorteilhaft! Aber – Unsre Liebe? Unser Bund? Ludwigs und Richards Einheit – was haben sie mit all diesen Rücksichten, diesen Vorteilen zu tun? Wie klein und nichtig, ein gemeines Günstlingsverhältnis, wären sie, wenn auf diese Weise ihren hohen, erhabenen Zwecken genützt werden könnte!«
Diese Bemerkungen gewähren uns einen tiefen Einblick in die wahre Natur des einzigartigen Freundschaftsbundes, der seelisch über jeden Zweifel erhaben war, geistig aber doch sehr weit von jener »Einheit« entfernt blieb, die Wagner ersehnte. Dem König war es im wesentlichen nur um die »Wagnerische Musik« zu tun. Seine Urteilskraft reichte nur dazu aus, um der besseren musikalischen Ausführung, den geeigneteren Darstellern mit einem gewissen Verständnis den Vorzug zu geben. Aber das Ineinandergreifen und Zusammenwirken der verschiedenen Künste im Wagnerschen Tondrama, die bühnenmäßige Verwirklichung des dichterischen Gedankens war ihm fremd oder ließ ihn gleichgültig. Er konnte sich über die ungünstige Erscheinung eines noch so guten Sängers ereifern und war in dieser Hinsicht sogar viel strenger als Wagner; doch das Bühnenbild und die lückenlose, innerer Notwendigkeit entspringende dramatische Entwicklung im sinnfälligen Geschehen der Darstellung sagte ihm wenig. Wenn er nur »Wagnerische Musik« hören und dabei, im unwirklichen Scheine des Rampenlichtes, die Gestalten der Sage und Geschichte sehen konnte, die er sich ja auch sonst in seinen Schlössern immer wieder von nicht sehr berufenen Künstlern und in nicht sehr geschmackvoller Weise vor Augen stellen ließ. Hier klafft ein unüberbrückbarer Zwiespalt zwischen dem, was Wagner durch die Gunst des Königs erreichen wollte, und dem, womit sein Gönner sich begnügte. Wagner hat ohne Zweifel im Verkehre mit Cosima seiner Enttäuschung Ausdruck gegeben und seine Unzufriedenheit mit den gangbaren Aufführungen immer wieder an Beispielen erläutert. Die hier mitgeteilte Briefstelle berührt uns wie ein knapper Auszug aus den vielen Gesprächen und Betrachtungen, durch die Cosima mit den letzten Absichten des Meisters vertraut und so auch von dem innigsten Wunsche beseelt wurde, ihm das Verständnis zu zeigen, das dem König mangelte, und alles daran zu setzen, um die Erfüllung seiner Absichten dereinst herbeizuführen. Was sie nach dem Tode Wagners in Bayreuth, namentlich auch für »Tannhäuser« und »Lohengrin«, getan hat, das ist nichts anderes als die Vollstreckung eines letzten Willens, der in diesem Brief an den König ausgesprochen war.
Nachdem Cosima mit Hans und ihrem Vater in Amsterdam einer Aufführung der Graner Messe von Liszt und einem zweiten Konzerte Bülows beigewohnt hatte, fuhr sie am 12. Mai nach Luzern. In Romanshorn traf sie mit Wagner zusammen. Über ihren ersten Einzug in ihrem künftigen Heim berichtete sie dem König: »Es ist schon hier, mein teurer Freund. Der einfache, aber große Garten führt zum See, vor uns steht der Rigi in schwerfälliger Pracht, an der Seite der Pilatus wie ein gewaltiger Drache … Bei schönem Wetter ist es hier ganz berauschend, und als ich am ersten Morgen die Kleinen im Garten einrichtete und von oben die Meistersingerklänge zu mir drangen, dachte ich, mein Herz müßte vor Freude springen.« Ja, der große Einsame arbeitete jetzt an den »Meistersingern«! Diese wollte er zuerst vollenden, ehe er sich ausschließlich dem größeren Werke, den Nibelungen, widmete. Es war ein besonders heiteres Geburtsfest, das ihm jetzt bevorstand. Soeben war ein neues, großes Lichtbild vom König gekommen, mit dem Cosima das Geburtstagskind überraschen wollte. Doch es gelang eine noch viel größere Überraschung. Am 22. erschien ein Fremder, dem der Diener vorerst gar nicht öffnen wollte. Der Besucher gab seine Karte ab, und diese nannte – den König! Ludwig selbst, der eine Woche vorher geschrieben hatte, daß er es ohne den »Einzigen«, den »Herrn seines Lebens«, nicht länger ertragen könne, daß er den Geburtstag des Freundes unbedingt mit ihm feiern müsse, Ludwig hatte unbemerkt München verlassen und war mit seinem Flügeladjutanten, dem Fürsten Thurn und Taxis, und einem Reitknecht unerkannt bis nach Triebschen gekommen. Zwei Tage verbrachte er dort und verließ es nach seinen Worten »gestählt durch die Wonnezeit des Beisammenseins, fest entschlossen, das Unkraut mit der Wurzel auszureißen, wunderbar gestärkt und erhoben durch die Liebe und das Vertrauen des Einzigen«.
Aber die Fahrt des Königs konnte nicht geheim bleiben. Sein Besuch in Triebschen veranlaßte neue unerhörte Angriffe gegen Wagner und Bülow, auch gegen die »Brieftaube Madame Dr. Hans de Bülow«. Was da wieder in Zeitungsaufsätzen und öffentlichen Reden verbrochen wurde, das war nicht nur, wie Du Moulin Eckart sagt, »durchaus geeignet, das monarchische Gefühl im Lande zu untergraben«, sondern es war schon ein vollgültiger Beweis dafür, daß dieses Gefühl der Treue und Ergebenheit in weiten Kreisen (und in sogenannten maßgebenden Kreisen) nicht mehr vorhanden war. In der Zeit, als Deutschland sich in zwei Teile spaltete, Preußen den süddeutschen Staaten den Krieg erklärte, Bayern sich an die Seite Österreichs stellte und »mobilisierte«, da war es kein erhebendes Schauspiel, wie die Münchner vor allem ihre persönlichen Streitigkeiten und ihren Parteienzwist auszutragen suchten und dabei Richard Wagner und die »neue Kunst« als Sündenbock benutzten.
»O des unselig unheilvollen Zwistes, der Deutschlands Willen gegen Deutschland wendet!« Diese Worte in einem Drahtgruße des Königs an Wagner, gleich nach der Kriegserklärung, offenbaren uns den Gemütszustand eines jugendlichen Herrschers, der aller Politik und Diplomatie innerlich fernstand, der hoch erhaben war über den Zank und Stank seiner Umgebung und der einen reineren Begriff von »Deutschland« hatte als alle seine Ratgeber und Widersacher. In solchen Augenblicken war er wirklich eins mit dem geliebten Freunde.
Wie es in den nächsten Monaten in München zuging, dafür haben wir empörende Beweise. Da mußte Bülow den Neuen Bayerischen Kurier verklagen, weil dieser ihn beschuldigt hatte, »in dem abgefeimten Wettrennen auf die Kabinettskasse, in der niederträchtigen Weise, wie man den König durch raffinierte Täuschungen zu hintergehen und seinen Namen zu profanieren gesucht, eine elende Rolle gespielt zu haben«, und weil das Blatt auch den »heißen Wunsch« ausgesprochen hatte, »daß endlich einmal die Komplicen des Rich. Wagner, diese gebrandmarkten Auswanderer, entfernt würden«. Da wollte sich ein Namensvetter Bülows aus Mecklenburg in München niederlassen, wurde aber mit Hans verwechselt und mußte es nun erleben, daß der Pöbel seine Fenster einwarf und seine Möbel zertrümmerte; »erst nachdem der Irrtum aufgeklärt worden, sind die Bavaren abgezogen«, schrieb Hans an Joachim Raff. Er schrieb dies schon aus Triebschen, wo nun auch er mit all den Seinen über zwei Monate lang Wagners Asyl teilen konnte.
Die geplanten Mustervorstellungen vertrugen sich nicht mit der politischen Lage, und Bülow hätte auf keinen Fall mehr mitgetan. Immer häufiger wurde seine Frau in die Angriffe und Verdächtigungen mit hineingezogen; nicht nur als »Brieftaube«, sondern auch wegen ihrer persönlichen Beziehungen zu Wagner. Die Welt, die immer bereit ist, den harmlosesten Verkehr eines Mannes mit einer Frau zu beargwöhnen und zu mißdeuten, hatte diesmal den denkbar willkommensten Stoff für ihre Bosheit. Schon die Art, wie Cosima in München eigentlich mehr bei Wagner als bei Bülow »zu Hause« war, hatte bedenkliches Aufsehen erregt. Daß sie nun sogar im Auslande bei Wagner weilte, war vollends geradezu ein Glücksfall für jene, deren Beruf oder Leidenschaft es ist, den Frieden des Nebenmenschen zu stören und seine Ehre zu mindern. Jetzt wurden auch die vierzigtausend Gulden, die Cosima in schwerem Silber hatte nach Hause schleppen müssen, pünktlich wieder aufgewärmt. Und in welcher Weise! Das sei der Liebeslohn gewesen, den Wagner der Frau von Bülow durch den König habe bezahlen lassen! Während so die gemeinsten Triebe genährt wurden, trachteten die »vornehmeren« Politiker auf eine viel »feinere« Weise, Wagner in den Augen des Königs bloßzustellen. Die Dienstleute Bülows wurden gedungen, Briefe des Königs, die Cosima verwahrt hatte, zu stehlen. Wenn schon keine Geheimnisse zu entdecken waren – der Inhalt der Briefe verwehrte tatsächlich jede Mißdeutung oder Verleumdung –, so sollte doch der Anschein erweckt werden, als ob Wagner und seine Freunde die Briefe nicht geheim hielten, sondern selbst leichtfertig verbreiteten. Cosima, von ihrem Manne benachrichtigt, kam für einen Tag nach München, um die nicht gestohlenen Briefe in Sicherheit zu bringen. Sie wurden Frau Schnorr zu treuen Händen übergeben. Auch die entwendeten kamen wieder zum Vorschein und gelangten durch den Flügeladjutanten des Königs, den Fürsten Paul von Thurn und Taxis, an den Empfänger zurück. Aber es war beinahe zuviel auf einmal, was sich da in wenigen Tagen zusammendrängte. Hatte Bülow den Neuen Bayerischen Kurier »wegen fortgesetzter Ehrenkränkung« verklagt, so ließ er nun dem Schriftleiter des »Volksboten«, Dr. Zander, seine Forderung zukommen. Diese wurde jedoch nicht angenommen. Bülow reiste hierauf sofort nach Triebschen, um jedem Gerede scheinheiliger Entrüstung die Spitze abzubrechen. Von Triebschen aus sandte er dem König sein Entlassungsgesuch.
Gleichzeitig legte Wagner einen Entwurf für die Antwort vor. Er machte dem König und dem Fürsten Thurn und Taxis gegenüber kein Hehl aus seiner grenzenlosen Entrüstung über das »absichtlich organisierte Verbrechen« jenes Einbruches bei Bülows und über die ihnen durch die Zeitungsaufsätze widerfahrene »unerhörte Schmach«. Er erklärte, daß er mit Hans stehe und falle, und forderte daher unbedingte Nachsicht gegenüber der nur zu erklärlichen Bitterkeit, die dieser in seinem Gesuch und in seinen öffentlichen Erklärungen zum Ausdruck gebracht hatte. Cosima schrieb dem König einen leidenschaftlichen Brief, mit dem sie ihn anflehte und bestürmte, daß er die Ehre ihres Mannes durch eine entsprechende Beantwortung des Gesuches reinwaschen möge; sonst müßten sie beide das Land verlassen, worin sie nur Gutes gewollt und getan. »Mein hehrster Freund … geben Sie es nicht zu, daß wir verjagt werden … In einer ernsten heiligen Stunde sprachen Sie mir von Ihrem tiefen Erfassen der Nichtigkeit der höchsten Weltgüter gegenüber den Pflichten der Liebe … Im Namen dieser geweihten Stunde sage ich: Schreiben Sie meinem Mann den königlichen Brief! … Ist das gnädige Schreiben möglich, so will ich meinen Mann überreden, daß wir heimkehren – sonst – wie dürften wir in einer Stadt verweilen, in der man uns wie Verbrecher behandeln konnte … Mein königlicher Herr, ich habe drei Kinder, denen ich es schulde, ihnen den ehrenwerten Namen ihres Vaters fleckenlos zu übertragen. Für diese drei Kinder, damit die nicht einst meine Liebe zu dem Freunde schmähen, bitte ich Sie, mein höchster Freund, schreiben Sie den Brief. Ist der Brief möglich, so will ich für dieses Glück alle Erdenprüfungen fröhlich tragen. Ist er nicht möglich, dann scheide ich hiemit von dem gütigen Freund, küsse in Demut und Dank seine königliche Hand, erflehe Gottes Segen auf sein hohes Haupt und entferne mich mit meinem edlen, vielleicht tödlich verwundeten Mann dahin, wo dem Müden, Schuldlosen Ruhe und Achtung geboten wird.«
Der königliche Brief ließ nicht lange auf sich warten. Er entsprach wortwörtlich dem Entwurfe Wagners. »Mein lieber Herr von Bülow! Nachdem ich Sie nunmehr vor eineinhalb Jahren durch meinen Wunsch, Sie in München … tätig zu wissen, vermocht habe, Ihre Stellung in Berlin gegen nur geringe Vorteile, die ich für das Nächste Ihnen bieten konnte, aufzugeben, kann mir nichts schmerzlicher sein, als zu ersehen, daß ich durch meine, auch auf Sie gegründeten Hoffnungen Ihnen bereits früher, am widerwärtigsten aber in der letztvergangenen Zeit … Anfeindungen, endlich Schmähungen und Beschimpfungen Ihrer Ehre zugezogen habe, von denen ich wohl begreifen muß, daß Sie dadurch auf das Äußerste gebracht sind. Da mir Ihr uneigennützigstes, ehrenwertestes Verhalten, ebenso wie dem musikalischen Publikum Münchens Ihre unvergleichlichen künstlerischen Leistungen bekannt geworden; da ich ferner die genaueste Kenntnis des edlen und hochherzigen Charakters Ihrer geehrten Gemahlin, welche dem Freunde ihres Vaters, dem Vorbilde ihres Gatten mit teilnahmsvollster Sorge tröstend zur Seite stand, mir verschaffen konnte, so bleibt mir das Unerklärliche jener … Verunglimpfungen zu erforschen übrig, um, zur klaren Einsicht des schmachvollen Treibens gelangt, mit schonungslosester Strenge gegen die Übeltäter Gerechtigkeit üben zu lassen. Sollte die Versicherung nicht genügend sein, das Erlittene Sie, wenn nicht vergessen, doch aus Rücksicht auf höhere Zwecke mit einiger Milde ertragen zu lassen, und sollte ich demnach nicht, wie es mein herzlicher Wunsch ist, Sie zum Ausharren, zur vorläufigen Beibehaltung Ihrer Stelle bewegen können, so bleibt mir leider nur übrig, außer der vorbehaltenen Gerechtigkeit auch diejenige Anerkennung gegen Sie besonders auszuüben, von der ich für heute durch dieses Schreiben und den innigsten Ausdruck meiner wahrhaften Hochachtung für Sie und Ihre geehrte Gemahlin ein Zeugnis gegeben zu haben wünsche.« Diesen Sätzen Wagners fügte der König aus eigenem die abschließenden Worte hinzu: »Tausend herzliche Grüße aus treuer Freundesseele den teuren Bewohnern des trauten Triebschen. Stets bleibe ich, mein lieber Herr von Bülow, Ihr sehr geneigter Ludwig.«
Eine glänzendere Genugtuung hatte Hans wohl nicht erwarten können. Er erhielt auch die Erlaubnis zur Veröffentlichung des Briefes. Damit aber war den Gegnern eine neue Waffe in die Hand gedrückt. Denn die Blätter hatten es leicht, ihrer Verwunderung darüber Ausdruck zu geben, daß der Brief zugleich mit einem Manifest von Österreich und einer Proklamation des Königs von Sachsen bekanntgemacht wurde, daß das Haupt des größten Mittelstaates, für das man »die Achtung, die Hoffnung und das Vertrauen von Millionen Deutschen in Anspruch nehmen möchte«, in diesen bewegten Tagen keine anderen Sorgen hatte. Dies war nun freilich eine Umkehrung des Tatbestandes. Die Münchner selbst, oder vielmehr die Münchner Zeitungen, hatten die persönlichsten Verhältnisse Wagners und Bülows zum Gegenstande öffentlicher Erörterungen gemacht, statt mit Ernst und Eifer die vaterländischen Dinge zu betreiben.
Hier ist es nötig, das Verhältnis Cosimas zum König näher zu beleuchten. Wir haben gesehen, daß sie nicht etwa nur als »Sekretärin« sachliche Mitteilungen im Auftrage Wagners an den König weitergab; daß sie vielmehr auch aus eigenem Antrieb und mit dem vollen Einsatz ihrer Persönlichkeit einen ebenso herzlichen als freimütigen Gedankenaustausch mit ihm herbeiführte, von dem man fast mit stärkerer Betonung als von den Briefen Wagners behaupten kann: so ist noch nie an einen König geschrieben worden.
Im Sommer 1865 tat Wagner in seinen Briefen zum ersten Male Erwähnung von Cosima. Er nannte sie »seine wunderbare, innig vertraute Freundin, seines Franz Liszt Tochter«, und brachte sie bald in nähere Verbindung mit den Wünschen des Königs. Dieser wollte nämlich das Leben Wagners kennenlernen und hatte ihn dazu angeregt, seine Lebensgeschichte aufzuschreiben. Wagner schrieb sie jedoch nicht selbst, sondern er benutzte seine Tagebücher und sonstigen Aufzeichnungen zum Diktieren. Die Feder führte Cosima, deren Niederschrift er später durchsah und verbesserte. »Bei welcher Beschäftigung traf mich der gestrige Brief?« So lesen wir in einem Schreiben an den König. »Damit Sie nicht zu raten haben, sage ich es: Beim Diktieren meiner Biographie! Freundin Cosima ruht nicht, mich an den Wunsch unseres Königs zu mahnen. Nun werden die günstigen Stunden des Tages damit ausgefüllt, daß ich der Freundin treu erzähle, was sie mir sorgfältig nachschreibt. Sie wundert sich, daß dies alles so fließend vor sich geht, als ob ich es aus einem Buche vorlese. Jetzt, wo ich noch bei den Jugendjahren bin, lacht sie bei meinen Diktaten oft noch laut auf: ein Glück! Bald wird das arme Kind viel zu weinen haben, denn es nahen die Jahre, die mich immer traurigere Erfahrungen kosteten. Wir haben beschlossen, die Diktate bis zu meiner Vereinigung mit Ihnen, lieber Herrlicher, fortzusetzen: von dann ab soll Cosima allein die Biographie fortsetzen, und hoffentlich einst beschließen. Sie kann dies am besten und wird es schön vollbringen.« Der Hinweis auf die Biographie und auf die Freundin, die er schlicht und innig stets nur Cosima nennt, kehrt dann immer wieder, von dem bereits Geschriebenen wurden die einzelnen Abschnitte dem König vorgelegt. Wagner stellte aber auch die unmittelbare Verbindung Cosimas mit dem König her. In jenem Schreiben, worin er die Bedeutung Bülows so eindringlich hervorhob, hieß es weiter: »Seien Sie das leitende Gestirn für den Verein der wenigen Auserwählten, deren Liebe das Schicksal mich und meine Werke anvertraut hat. Ein edles, tiefsinnig erhabenes weibliches Wesen ist diesem Kranze eingeflochten. Wollen Sie wahre, tiefe Aufschlüsse über irgend etwas Unverständliches in meinem Betreff, wenden Sie sich an dieses seltene Wesen, das Ihnen rein wie die Urquelle der Nornen alles zuspiegeln wird.« Wenige Tage später richtete Cosima ihr erstes Schreiben an den König.
Sie hatte also gleichsam die Sendung übernommen, einen Mittler zwischen Wagner und dem König abzugeben, wenn der König einen solchen brauchte oder wenn Wagner durch seine Arbeit, durch Gemütsbewegungen, durch äußere oder innere Umstände an einer genügend raschen oder deutlichen Mitteilung gehindert war. Diesem Amte hat sich Cosima mit heiligem Ernst unterzogen. Sie wurde, wie sie die nächste Vertraute Wagners war, auch die Vertraute des Königs. Es bedeutet wenig, daß sie dem hohen Gönner weibliche Aufmerksamkeiten erwies und ebenso kleine Geschenke und Überraschungen des Königs für den Freund in Empfang nahm. Es bedeutet etwas mehr, daß sie aus freien Stücken den König über die jeweilige Stimmung des Freundes, über seine Beschäftigung und seine Pläne unterrichtete, wodurch sie ganz besonders den Dank und die Liebe des Königs erwarb. Aber es ist von größter Bedeutung, daß sie im Verein mit Wagner einen weitgehenden Einfluß auf den Sinn des Königs zu gewinnen vermochte und sich dabei nicht nur als die vollkommene Mitwisserin Wagners, sondern auch wieder als seine beste Gehilfin, als seine geschickteste Mitarbeiterin bewährte.
Wie feinfühlig und zartsinnig sie den König zu lenken wußte, wie klug sie auf seinen Ton einging und dabei doch nur den Gedanken Wagners überredende Worte lieh, wie ihr weiblicher Takt, ihre diplomatische Geschicklichkeit und ihre ganz persönliche, manchmal etwas geheimnisvolle Art, zu denken und zu sprechen, wahre Meisterwerke der Briefschreibekunst hervorbrachte, denen die geringen Unebenheiten des sprachlichen Ausdrucks, in denen sich die geborene Französin verriet, nur noch einen besonderen Reiz verliehen, davon seien hier nur zwei Proben mitgeteilt.
Nachdem es den Gegnern Wagners gelungen war, seine Entfernung aus München durchzusetzen, faßte der König den schwerwiegenden Entschluß, abzudanken. Dieser »Entschluß« war freilich zunächst nur eine Anfrage beim Meister, ob dieser eine solche Handlung gutheißen würde. Der König litt noch viel schwerer unter der Trennung als sein Freund und wollte sich, fern von der Welt, ungehemmt von irgendwelchen Rücksichten, einzig der Freundschaft weihen. So richtete er am 15. Mai 1866 einen Drahtgruß nach Luzern, der die Worte enthielt: »Wenn es des Teuren Wunsch und Wille ist, so verzichte ich mit Freuden auf die Krone und den öden Glanz, komme zu ihm, um nimmer mich von ihm zu trennen.« Am selben Tage schrieb er auch einen Brief, worin es abermals hieß: »Ich möchte abdanken; auch dieses fiele mir leicht, wenn ich annehmen könnte, daß der Freund es will. Mit Freuden verzichte ich auf die Güter der Erde und folge Ihnen nach.« Hier galt es nun, um das kälteste und nüchternste Wort zu gebrauchen, den Mann zur Vernunft zu bringen und dabei doch – zu eben diesem Zweck – den etwas überspannten Ton anzuschlagen, für den einzig der König empfänglich war. Wagner war so ergriffen und erschüttert, daß er nicht gleich die nötige Fassung gewann. In größter Sorge bat er den König zunächst um ein halbes Jahr Geduld. In dieser Spanne Zeit, die einen großen Wandel bringen könne, müsse mit festem Mute jedes Opfer gebracht werden; und wenn der König keine anderen Rücksichten kenne, so möge er sein Opfer aus Liebe zu Wagner bringen, aus Schonung für den Freund, der Verwicklungen kommen sieht, die er nicht ertragen könnte. Diese Zeilen Wagners haben beinahe etwas Herrisches und sind zugleich ein Beweis seiner wirklichen Erregung. Dann folgte der überraschende Besuch des Königs in Triebschen. Was da gesprochen wurde und ein späterer, sehr ausführlicher gedankenvoller Brief Wagners vermochten den König noch immer nicht zu beschwichtigen. Der Krieg Bayerns und Österreichs mit Preußen, der mit dem Siege Preußens endete, warf den König vollends in eine Stimmung, die Wagner nur mit der größten Anstrengung beschwören konnte. Ludwig befürchtete den Verlust der bayerischen Selbständigkeit und sah sich schon als »Schattenkönig«. Da wollte er lieber gar nicht König sein.
Er hatte diesmal nicht an Wagner, sondern an Cosima geschrieben und diese gebeten, auf jenen entsprechend einzuwirken. »Er möge barmherzig sein, nicht von mir verlangen, diese Höllenqual länger zu ertragen; meine wahre, göttliche Bestimmung ist diese: bei ihm zu bleiben als treuer, liebender Freund, nie ihn zu verlassen … Ich bitte Sie, teilen Sie ihm den Hauptinhalt dieses Briefes mit Ihren Worten mit.« Wie nun Wagner darauf antwortete, das war groß und tief, und diesem Anrufe des wahren Königtums, das die göttlichste Bestimmung sei, konnte ein Herrscher, der noch jung und tatenfroh war, unmöglich widerstehen. Aber nach dem Bilde, das wir aus den Briefen Ludwigs gewinnen, hätte die ernste, beinahe väterliche Mahnung Wagners, der den Gedanken einer Thronentsagung streng zurückwies, vielleicht nicht so stark gewirkt, wenn nicht gleichzeitig Cosima einen Brief geschrieben hätte, der scheinbar völlig auf die Absicht des Königs einging und ihm dennoch klarzumachen wußte, daß ihre Verwirklichung ein Unheil wäre. Auch in diesem Briefe spürt man wirkliche Erregung, doch zugleich das sorgliche Bemühen, den König eben nur dort zu packen, wo er den geringsten Widerstand bot: bei seiner überschwenglichen Vorstellung von der Erhabenheit des Königtums. So schrieb sie: »Könnte ich nur die Tränen, die Wünsche, das Bangen und Sorgen der letzten Zeit Ihnen entsenden, dies wäre die einzige Antwort auf Ihr gestriges Schreiben! Was ich, seitdem Sie Triebschen verlassen, um Sie und mit Ihnen gelitten, kann ich nicht sagen, und mir selbst stand plötzlich in einer angstvollen Nacht der Gedanke und der Wille, den Sie aussprechen, vor der Seele. Ach, ich weiß es, mein teurer Freund, daß mit der Entfernung einiger elender Menschen es nicht getan ist. Ich habe vor München … ein wahres Grauen, und mir sind Sie als Märtyrer der Krone, wie der Freund mir als ein Märtyrer der Kunst erschienen … Wie soll ich Sie nun nicht verstehen, wenn Ihre tiefe, große Seele … mir das sagt, was ich ahnungsvoll weiß. Und doch und doch, mein wunderbarer Freund, ich schaudere vor dem Gedanken zurück und … kann dort nicht weilen, wo Sie so kühn und frei sich bewegen, mir schwindelt der Boden, Seele und Sinne versagen mir. Denn, teuerster Freund, in dieser öden Zeit, wo überall der Glaube nur Schacher ist, habe ich in Wahrheit an das Königtum von Gottes Gnaden geglaubt, es ist für mich eine Religion gewesen. Ja, an Sie einzig habe ich als König geglaubt. Nun stehe ich inmitten eines Erdbebens, muß Ihnen in allem recht geben und kann nicht mitfliegen. Der Freund schreibt. Er ist natürlich viel gefaßter als ich und nahm meine Mitteilung ernst, aber ruhig auf. Er schien darauf vorbereitet, und sein mächtiger Geist befreite ihn von der Sorge und von dem Schrecken, dem ich preisgegeben bin. Er kann sicheren Blickes in die Zukunft schauen und auf die jetzigen Trümmer das Kunstgebäude im Geiste errichten. Ich sehe in dieser Stunde nur noch die Trümmer und wage kaum zu hoffen … So blicke ich denn auf zu Ihnen, großer, teurer Freund, begreife Sie in jeder Faser Ihres Wesens, weiß auch, daß ich an Ihrer Stelle so empfinden würde wie Sie, und wage es dennoch nicht, Ihnen zuzurufen: ›Entbürde Dich der unheilvollen Last‹ … Hegte ich einen Wunsch, so wäre es der, daß als letzter König der teuerste Freund den Thron verließe, daß gütige Engel die Krone gegen Himmel trügen und daß die entgötterte Menschheit in der Gleichheit der vollsten Gemeinheit ihr elendes Leben führte. Doch das sind Träume.« Und eben mit solchen Träumen, und indem sie dem König kaum widersprach, brachte sie ihn im Vereine mit Wagner, aber auf andere Art als dieser, zur Besinnung. Durch den Draht antwortete der König: »Innigen gerührten Dank für die teuren Briefe. Wunderbar gestärkt, fühle Heldenmut in mir, will ertragen.«
Wenn nun der König seinem Berufe treu blieb, so verstand er es doch keineswegs, ihn richtig auszuüben. Wer hätte es leichter gehabt, in der allgemeinen Begeisterung des Volkes einen Rückhalt zu finden, als dieser bezwingend schöne, wahrhaft edle, wie aus einer anderen Welt entsandte Jüngling auf dem Throne! Über Ludwig selbst richtete eine Scheidewand zwischen sich und dem Volke auf, indem er, menschenscheu und allzu empfindlich bei der Begegnung mit dem Gewöhnlichen und Alltäglichen, sich nur ungern zeigte und alle die Gelegenheiten, die so rasch und ungezwungen ein Band zwischen dem Herrscher und den treuen Untertanen schlingen, geradezu ängstlich vermied. Er wollte weder die große Aufmachung der fürstlichen »Repräsentation«, wenn sie nicht durch ein bedeutsames Ereignis oder einen hohen Zweck gerechtfertigt war, und er verstand es ebensowenig, »leutselig« und »gemütlich« zu sein. Er verschwand hinter einer Wolke, und diese war in einen seltsam phantastischen Glanz gehüllt. Da war es Cosima, die ihm für sein Verhalten in der Öffentlichkeit, für seinen Verkehr mit den Menschen nützliche Lehren gab. Freilich, lehrhaft durfte sie nicht auftreten, und von gemeinem Nutzen durfte schon gar nicht die Rede sein. Aber sie fand stets den richtigen Ton.
Besonders heikel war es, wenn der König einen Wunsch des geliebten Freundes erfüllen wollte und dieser selbst Grund hatte, nicht mehr auf der Erfüllung zu bestehen. Das war beispielsweise der Fall, als Ludwig die von Wagner ersehnte Erbauung eines Festspielhauses am Isarufer nach den Plänen Sempers gewaltsam durchdrücken wollte und die feierliche Grundsteinlegung befahl, obwohl die Kosten in keiner Weise gesichert waren und der Voranschlag von den Widersachern dieses Unternehmens als empörende Verschwendung dargestellt wurde. Ludwig war dem Volke bereits stark entfremdet und hatte diesmal die ganze öffentliche Meinung gegen sich. Das Beharren auf dem Bau schien nur möglich, wenn der König der unbedingten Zustimmung in den weitesten Kreisen, zum mindesten aber bei all denen, die für die Kunst etwas übrig hatten, sicher gewesen wäre. In Wirklichkeit drohten nach der Grundsteinlegung arge neue Verwicklungen, unter denen der König und Wagner schwer hätten leiden müssen. Solche Verwicklungen heraufzubeschwören, das wäre dem Künstler um so sinnloser erschienen, als er selbst von je einen ganz anderen Festspielgedanken im Sinne trug. Abseits vom großstädtischen Verkehre und vom Kunstbetriebe, in einer Kleinstadt, einem Winkel, der der Kunst besonders geweiht wurde, dort sah er im Geiste sein Festspielhaus, wie er es später in Bayreuth gefunden hat. In der ersten Münchner Zeit durfte er allerdings glauben, daß so günstige Umstände, wie sie eben durch die Bereitwilligkeit des Königs geschaffen waren, nirgends mehr anzutreffen sein würden. Auch trägt ja München von allen Großstädten selbst heute noch das ruhigste und vornehmste Gepräge. Vor mehr als siebzig Jahren bot es mit seinen schönen Bauten, breiten und bequemen Straßen, in denen kein moderner Verkehr tobte, und mit der so nahe gelegenen freundlichen Isarlandschaft, in der der Sempersche Prachtbau sich erheben sollte, gewiß einen würdigen Rahmen für wahre Festspiele. Doch auch dies nur unter der Voraussetzung eines ungehemmten königlichen Schutzes und einer warmen Anteilnahme der gesamten Bevölkerung. Waren diese Bedingungen nicht gegeben, dann blieb von dem, was Wagner erhofft hatte, eigentlich nichts mehr übrig. So mußte der Künstler auch um der Reinheit seines Gedankens willen, und um künftige Möglichkeiten nicht durch einen kläglich scheiternden Versuch zu vereiteln, dem König bei seinem eigensinnigen Vorhaben in den Arm fallen. Das tat nun wieder für ihn Cosima in der nur ihr eigenen Weise: sie fiel dem König gar nicht in den Arm, sie ergriff nur seine Hand und führte ihn dorthin, wo sie ihn haben wollte; und sie benutzte auch diese Gelegenheit, um ihm seine Herrscherpflichten klarzumachen.
Sie schrieb: »Rat Düfflipp war heute bei mir und besprach die beabsichtigte Grundsteinlegung zum Festbau! So schwer es mir fällt, so unbeschreiblich schmerzlich es mir ist, ich glaube dem hohen Gnädigen sagen zu müssen, daß dieses Jahr bei der herrschenden Stimmung des Landes es mir nicht rätlich erscheint, an ein solches Unternehmen zu gehen. Es ist wahr, teurer, geliebter Herr, nichts könnte Ihrer Regierung einen solchen edlen Glanz verleihen als dieser Bau. Er wird der schönste und bedeutendste sein, den Deutschland, ja Europa von diesem Jahrhundert aufzuweisen haben wird. ›Ein Pendant zum Kölner Dom‹, meinte Kaulbach neulich, ›ein stolzes Merkmal von dem, was die deutsche Kunst vermag.‹ Allein in der Zeit, in welcher wir leben, und vielleicht in Bayern ganz besonders muß der Fürst gleichsam mit seinem Volke ein solches Werk beginnen. Es darf ein so großer Gedanke nicht wie die augenblickliche Laune eines Höchstgestellten aussehen. Dies lähmt im vornherein das Unternehmen und lähmt seine guten Folgen. Noch ist der König, mein Herr und gütigster Freund, nicht verstanden, ungekannt. Sein Volk weiß von ihm nichts als das, was eine Zeitlang elende Diener zu verbreiten für gut befunden haben. Folglich ist kein Glaube an das, was er unternimmt, vorhanden. Oh, entschlösse sich der König, eine Zeitlang der Zurückgezogenheit zu entsagen! Geruht er durch große und anscheinende Teilnahme an dem öffentlichen Treiben seinem Volke sich zu bekunden, dann wäre bald, gar bald der Festbau möglich. Jetzt ist alles dagegen. Aristokratie, Bourgeoisie, Volk. Sie sagen sich jetzt nicht, wie segensreich für die Kunst im allgemeinen, für Gewerbe und Industrie im besonderen ein solcher Bau ist, weil sie sich nichts Günstiges zu sagen vermögen, und sehen bloß in dieser großartigen Absicht eine phantastische Schimäre, durch welche ein weit besser anzuwendendes Kapital vergeudet wird. Ist der König gekannt – gekannt ist in diesem Falle gleich mit geliebt –, dann steht alles anders. Die materiellen Bedingungen sind da, die politischen Konstellationen deuten auf Frieden. Einzig wird noch erfordert die zeitweilige Überwindung von Abneigungen, die leider nur zu erklärlich mir erscheinen. Doch, mein teuerster Herr, es handelt sich hier um etwas Großes, Unvergleichliches. Der Tag, wo der König mit der akklamierenden Liebe seines Volkes den Stein zum Festbau legen würde, würde wohl die Überwindung vergelten, welche die lästige Erfüllung der äußeren Seiten der königlichen Pflichten gekostet hat. Jetzt, wie es steht, muß ich bitten und der Freund bittet mit mir, nicht auf der Grundsteinlegung bestehen zu wollen. Noch ist der König zu vereinsamt. Mein höchster Trost ist, daß er alles in der Hand hat. Ich kenne die Umtriebe der Schändlichen, welche darauf bauen, daß der Herr sich so abschließt, sich freuen, daß er nach und nach seinem Volke immer fremder wird. Ich ahne diese Umtriebe und weiß, wie gefahrdrohend sie sind. Viele, viele Nächte habe ich in Sorge und Kummer darüber verbracht – doch ich weiß ebenso sicher, daß ein fester Entschluß des Königs durch bloßes Sichzeigen dem ein Ende zu machen genügt, daß unser Schiff mit vollen Segeln auf dem beruhigten Meere segeln dürfte. Ich glaube, daß der König jetzt nichts Erhabenes, Großes unternehmen kann, weil kein Glaube herrscht. Gewinnt es mein hoher Freund über sein edles Selbst, den Menschen sich zuzuwenden und trotz ihrer so abstoßenden, erschreckenden Gemeinheit die Sonne des Königtums voll und warm auf sie scheinen zu lassen, dann, o mein teurer Fürst, ist unsere goldene Zeit da.«
Dafür, daß Cosima sich so ganz in den Seelenzustand des Königs zu versetzen und den Puls seines Herzens zu belauschen wußte, wurde sie reich belohnt: wenn Ludwig einen bedeutungsvollen Brief an Wagner gerichtet hatte, dann erkundigte er sich bei ihr, wie der Brief gewirkt habe, was Wagner antworten werde, ob er erfreut oder bestürzt sei, und Cosima wurde dadurch in die Lage versetzt, die Antwort durch ihr eigenes Rückschreiben vorzubereiten oder zu ergänzen. Der Briefwechsel zwischen Wagner und dem König kann gar nicht richtig verstanden werden, wenn man nicht auch die Briefe Cosimas hinzunimmt, die geradezu als Briefe Wagners gelten können und dennoch in jedem Worte den Geist Cosimas verraten. Nichts war dem König verständlicher, nichts wirkte auf ihn beglückender als dieses Zusammengehen, dieses Ineinanderleben des Freundes und der von diesem erkorenen Freundin. Ludwig, der die Liebe zum Weibe nicht kannte, hätte nie etwas Anstößiges oder auch nur Merkwürdiges daran finden können, daß ein Mann und eine Frau in so enger geistiger und räumlicher Verbindung lebten. Darum blieben auch alle öffentlichen und geheimen Anschuldigungen und Verdächtigungen bei ihm völlig wirkungslos. Er selbst verlobte sich arglos mit seiner Base Sophie von Bayern, weil er in ihr die geistesverwandte Freundin zu erkennen glaubte, mit der er sich besser verstand und unbefangener reden konnte als mit irgendeinem Manne; und er entlobte sich mit völligem Schrecken, als er entdecken mußte, daß sein vertrauter Umgang mit Sophie von allen Verwandten, auch von der Braut selbst, als ein Zeichen von »Liebe« gedeutet wurde. Mit der größten Unbefangenheit schrieb er an Cosima, und niemand konnte verständnisinniger auf die wunderlichsten Irrwege dieses großen und unglücklichen Menschen eingehen als der vom zartesten Mitgefühle getragene »Intellekt« Cosimas.
Es ist begreiflich, daß diese im Bewußtsein der überredenden Gewalt, die sie auf so viele Menschen, vom König bis zu den untergeordneten Helfern und Dienern, ausübte, sich auch noch zutraute, den Widerstand der Königinmutter zu brechen. Sie wollte vorerst nur in deren Nähe kommen; sie machte dem König geradezu den Vorschlag, er solle ihr eine bestimmte Rolle bei seiner Mutter, etwa als Vorleserin, zuweisen. Dazu ist es freilich nicht gekommen, und es wäre auch schwer denkbar gewesen, daß die Königin Marie just ein so oft genanntes und so viel gescholtenes Mitglied des engsten Wagner-Kreises an sich herangelassen hätte. Aber der Vorschlag beweist, mit welcher rastlosen Hingebung Cosima dem Meister diente und mit welchem kühnen Eifer, dem es doch niemals an Ehrfurcht mangelte, sie sich für ihre Zwecke auch des Königs bediente.
Welcher Segen von ihr ausging, sobald die Feindseligkeiten schwiegen und ihr Innerstes rein ausschwingen konnte, das offenbart sich wohl am leuchtendsten in den Lebenserinnerungen Wagners. Wenn er diese diktierte, dann war er, nach des Tages Mühen, allein mit Cosima, und angefeuert von ihrem fragenden Blick, sah er sein Leben in einer Klarheit und mit einer Heiterkeit, die ihm sonst, inmitten all der Stürme und Kämpfe, die ihn gleichzeitig umbrandeten, kaum zu Gebote standen. Allein mit Cosima! Nicht im Gedanken an das tragische Verhängnis, das sie gemeinsam zu überwinden hatten – nur im Gefühl ihrer Gemeinsamkeit – und rückschauend auf so viele Abenteuer, Wirrnisse und Niederlagen, die durch die rettende Tat des Königs gegenstandslos geworden waren. Da focht ihn nichts mehr an: nicht die Gegenwart und noch weniger die Vergangenheit, die er vollständig überwunden hatte, mit der er ausgesöhnt war, die er jetzt in einem farbenreichen Bilde zu gestalten vermochte. So entstand, in trautester Zwiesprache, das Buch »Mein Leben«, das uns Wagner so einfach, menschlich und liebenswürdig zeigt, wie ihn wenige kannten. Oft und oft, bis in die letzten Jahre seines Lebens, hat er das Diktat fortgesetzt, hat er in seiner »freien Zeit« diese Feiertagsarbeit wieder aufgenommen, bei der er sich erholte und der Zeiten Unrecht vergaß. Wenn wir das Buch lesen, dann spüren wir die Wärme, mit der ihn Cosima umfing, den Segen, der von ihr ausströmte. –
Um uns das Wesen und die Wirkungen Cosimas zu vergegenwärtigen, wollen wir auch noch einmal Hans von Bülow hören. Als seine Schwester 1862 sich verlobt hatte, sagte er in seinem Glückwunsch: »Die Einheit der Liebe besteht aus mancherlei Vielheiten: nicht bloß die sogenannte Freundschaft, die, wenn sie echt, ihr Wesen doch durch eine ganz entschiedene Liebesempfindung gipfeln und vervollständigen muß, auch das Mitleid, die wörtliche und leider zuweilen recht unedel verwendete Übersetzung des Wortes Sympathie muß mit einströmen, namentlich in der Regel beim Manne, der beschützen und in seiner Art sorgen muß und will – wenn es gilt, ein Lebensband zu knüpfen. – Ich empfinde das in meinem Künstlerdasein oft schmerzlich, daß bei mir ein umgekehrtes Verhältnis obwaltet. Meine Ehe ist von meiner Seite eine gewiß überraschend glückliche – Cosima leistet ein bewundernswertes Kunststück, das Leben mit mir auszuhalten –, aber ich bin eine ins Weibliche hinüberstreifende Natur, meine Frau hat einen starken Geist und bedarf leider so wenig meiner Beschützung, daß sie vielmehr mir dieselbe bietet.« Und einige Jahre später, in den Münchener Wirren und Ärgernissen, schrieb er müd und »zermartert« an Richard Pohl: » Ich kann eigentlich nur noch meine Frau um mich haben und hie und da Wagner, wenn ich recht wohl bin.«
Bülow hat sich damals nicht wohl gefühlt. Der Brief des Königs war für ihn nur eine »theoretische Satisfaktion« gewesen. »Er hat für mich nur den Wert«, so schrieb er an Edmund von Michalovich in München, »mir ein ehrenvolles Scheiden aus der Stadt zu ermöglichen. An einem Orte, wo ich so Unsägliches für mich, für Wagner gelitten, kann ich mit allergeringster Lebenslust selbst nicht weiter verweilen.« Und wenige Tage später an denselben: »Könnte ich die Musik ganz an den Nagel hängen, könnte ich irgendeinen rentablen neuen Beruf anfangen – ich besänne mich keinen Augenblick … Nur im allgemeinen Umsturz finde ich etwas Beruhigung. Preußens und Italiens Siege – das ist meine einzige Hoffnung. Das will sagen: die hieraus zu schöpfende Erquickung ist allein vermögend, mich mein persönliches Elend vergessen zu machen.« Und mehrere Wochen später an Raff: »Die entsetzlichen Erlebnisse in München hatten mich vollkommen zu Boden geschlagen. Erlaube mir, davon zu schweigen. Ich gerate in eine unsinnige Aufregung, sobald ich daran zurückdenke, davon spreche: darüber schreiben ist noch viel qualvoller. Und dann wäre es schwierig, einem anderen die Situation begreiflich zu machen; man müßte eine Broschüre abfassen. Ich habe den erklärlichen Wunsch, zu vergessen, werde also nichts darüber aufzeichnen. Außerdem zwingt mich meine ›Stellung‹ als › ami de Wagner‹, alles das, was auf seinen ›erhabenen Wohltäter‹ Bezug hat, für mich zu behalten. Bei solcher Diskretion würde mein Referat Lücken empfangen, welche für einen Dritten gänzliche Unverständlichkeit zur Folge haben würde … Das einzige Fatale sind die beträchtlichen Geldverluste, die mir die Münchner Episode in meinem Leben zugezogen hat. Aber der Entsagungsentschluß ist ein positiver Erwerb. Ich bin musikmüde, zukunftsmüde, namentlich aber gegenwartsmüde: ich will mich beschränken, obskur werden (das wird schneller gehen als mit der Berühmtheit) und unter einem anderen Himmel möglichst unbehelligt weiterleben … Mein Schwiegervater will hievon nichts wissen; aber da er keine Einsicht in die Verhältnisse hat, ich ihn übrigens nicht inkommodieren werde, so werde ich auch gegen seine Zustimmung mein Vorhaben ausführen.« Endlich wieder an Raff, schon am Ende seines Triebschener Aufenthaltes: »Du hast keine Ahnung von dem, was vorgegangen: kaum mündlich wäre ich imstande, Dir das Greuliche, Unheimliche, was mich getroffen, verständlich zu machen, geschweige brieflich. Behalten wir das einer anderen Zeit vor – wir werden uns ja doch einmal wiedersehen. Einstweilen hatten Deine freundlichen Mitteilungen auch ihre positiv sehr betrübende Seite für mich: diejenigen über Dein eigenes Schicksal. Bei Gott, ich kann mit-leiden, ich habe darin eine nur allzu große Virtuosität.«
In dieser Stimmung genoß er die Natur der Schweiz nur »mit krankhafter Bitterkeit«. Für sich zu musizieren und so technisch auf der Höhe zu bleiben, war ihm in Triebschen unmöglich, da er Wagner bei der Arbeit nicht stören durfte. Die dauerte regelmäßig bis zur nachmittägigen Speisestunde. Dann wurde der Meister erst sichtbar, und nun blieben alle beisammen. Das Wetter war nicht günstig: Kälte, Regen, Sturm machten schon im August den Mangel an Öfen sehr empfindlich. Aber wie vorher in München, so wurde Hans jetzt in Triebschen gestärkt und erhoben durch den Fortschritt der »Meistersinger«. Seine Briefe aus diesen zuerst so bewegten, dann von Überdruß und Erschöpfung beschwerten Tagen enthalten begeisterte Urteile über das neue Werk, dessen Entstehung er genau verfolgen konnte. »Berauschend schön – heiter sprudelnd von Geist in jeder Hinsicht.« »Prachtvoll, unglaublich schön, heiter, witzig!« »Mir will es scheinen, als ob dieses Werk den Gipfelpunkt seines Genies darstellt: es ist unglaublich frisch, plastisch, noch reicher im musikalischen Detail als der Tristan: ich verspreche mir eine zündende Wirkung im nationalsten Sinne davon.« Und an Alexander Ritter: »Alles, was Ideales im deutschen Geiste noch steckt, und Erhaltungswürdiges, das lebt in diesem einzigen Kopfe, dem Deines Onkels. Es wird dieses Werk insbesondere das Höchste darstellen, was man unter nationaler Blüte verstehen kann. Du wirst staunen und starren vor Entzücken.« Endlich an Jessie Laussot: »Ich glaube mich nicht mehr unter dem überwältigenden Eindruck dieser Komposition zu täuschen, wenn ich vermeine, daß er sein klassischstes (entschuldigen Sie die Trivialität des Ausdrucks), deutschestes, reifstes und allgemein zugängliches Kunstwerk zu schaffen im Begriffe ist. Von dem absoluten musikalischen Reichtum, von der Cellini-Arbeit in allen Details können Sie sich keine annähernde Vorahnung bilden. Es ist mir unumstößliches Dogma: W. ist der größte Tondichter, ganz ebenbürtig einem Beethoven, einem Bach – und außerdem noch weit mehr. Er ist die Inkarnation des deutschen Kunstgeistes, sein unvergänglichstes Denkmal, auch wenn die deutsche Sprache, vielleicht die Musik eine ›tote‹ geworden sein würde.«
Diese Begeisterung war aber nur ein Trost, kein Halt. Bülow mußte wieder festen Boden suchen und entschied sich vorerst für das nahe Basel, wo Schwester und Schwager Joachim Raffs, das Ehepaar Dr. Merian, ihn freundlichst aufnahmen und in seiner Absicht bestärkten. Auch die Wohnungsfrage wurde durch sie zweckmäßig geregelt, und »da Wagner in Luzern bleibt, da wir somit ebensowohl in seiner Nähe als direkt an der deutschen Grenze hausen werden, so wird alles ›sehr gut‹ sein«, schrieb Bülow an Raff. Zunächst behalf er sich als Strohwitwer, da sein Hausrat noch in München war. Er wurde nur dann und wann, namentlich bei bemerkenswerten musikalischen Veranstaltungen, an denen er teilnahm, von seiner Frau besucht, dann und wann fuhr auch er nach Triebschen. Seine Lehrtätigkeit in Basel entwickelte sich sehr günstig; auch war diese Stadt ein geeigneter Stützpunkt für Konzertreisen in der Schweiz und durch das westliche Deutschland.
Unterdessen hatte das Triebschener Haus einen neuen Bewohner erhalten. Wagner mußte sich darüber beklagen, daß seine Handschriften aus den Händen der Stecher meist in gänzlich verwahrlostem, schmutzigem Zustande zurückkehrten. Die Partitur der »Meistersinger« wollte er nicht der gleichen Behandlung aussetzen, sondern dem Verleger Schott in Mainz, wie dem Hofopernkapellmeister Heinrich Esser in Wien, der die Herstellung des Klavierauszuges übernommen hatte, nur eine genaue Abschrift liefern. »Hiezu bedarf es«, so schrieb er an Esser, »eines sehr intelligenten, vollkommen musikverständigen Kopisten. Sollte Ihnen unter den zahlreichen jungen oder älteren hilfsbedürftigen Musikern Wiens, welche die nötigen Eigenschaften hiefür besitzen, ein empfehlenswertes Individuum bekannt sein, so würden Sie mich sehr verbinden, wenn Sie mir dasselbe nachwiesen; ich würde diesen Adjutanten dann nämlich zunächst für ein halbes Jahr zu mir in Kost und Gehalt nehmen, damit er (in meiner Wohnung) unter meinen Augen diese schwierige Kopie exakt anfertige.« Esser empfahl ihm einen jungen Mann, namens Hans Richter. Ende Oktober traf dieser in Triebschen ein und versah zunächst nur seinen Dienst als – Abschreiber. Später hatte er auch den Stich der von ihm ins reine geschriebenen Partitur zu prüfen und zu verbessern. Wagner arbeitete noch am dritten Aufzuge, als die Partitur des ersten bereits an Schott geliefert wurde. Da der Meister vom Vormittage bis in die frühen Nachmittagsstunden zu arbeiten pflegte, so war dies auch die Arbeitszeit seines Famulus, den er gegen Abend zu größeren Spaziergängen mitnahm, ohne vorerst mit ihm sehr gesprächig zu sein. Doch das Wesen des jungen Mannes, seine Schlichtheit und Geradheit, gefiel Wagner, und seine außerordentliche musikalische Begabung ließ ihn bald zu etwas Höherem bestimmt erscheinen als zum bloßen Abschreiber und Korrektor. In täglicher Beschäftigung mit dem entstehenden Meisterwerke, im persönlichen Umgange mit dem Meister selbst, entfaltete sich Richter, der sonst vielleicht als ein guter Musiker unter so vielen anderen nur eine Durchschnittslaufbahn vor sich gehabt hätte, zu dem künftigen großen Kapellmeister, der für Wagner nach der Trennung von Bülow der unentbehrlichste musikalische Beistand wurde. Nicht am ersten Tage gewann er die volle Gunst der Triebschener, aber er erwarb sie Schritt für Schritt, und in den ersten Monaten knüpften sich schon die Fäden, die ihn nach dem Tode Wagners besonders eng mit Cosima verbinden sollten. Zu Weihnachten 1866 wurde er in den Familienkreis aufgenommen, und von da an war der Verkehr mit Jean Paul, wie er in Triebschen hieß, höchst gemütlich und vertraulich; namentlich auch die Kinder gewannen Richter sehr lieb. Aus dem halben Jahre, für das er verpflichtet worden war, wurden dreizehn Monate. Im zwölften war die Reinschrift der Partitur vollendet.
Ende 1866 brachte für Wagner eine bedeutende Wendung. Der Ministerpräsident von der Pfordten hatte sich infolge der politischen Ereignisse nicht länger halten können und war durch den von Wagner empfohlenen Fürsten Chlodwig Hohenlohe, einen Bruder des Fürsten Konstantin Hohenlohe in Wien, der die Prinzessin Marie Wittgenstein geheiratet hatte, abgelöst worden. Auch der Kabinettssekretär von Pfistermeier hatte Düfflipp Platz machen müssen. Pfi und Pfo, wie sie in den vertraulichen Briefen des Wagner-Kreises, auch des Königs, genannt wurden – die schärfsten Gegner Wagners –, waren beseitigt, der König brauchte seiner Freundschaft keine Schranken mehr aufzuerlegen. Schon während des Regierungswechsels erhielt Bülow die Ernennung zum außerordentlichen Hofkapellmeister in königlichen Diensten. Sein Groll war allerdings nicht so leicht zu beschwichtigen: er erwog noch längere Zeit die förmliche Niederlassung mit Frau und Kindern in Basel. Um so reger und unbefangener wurde jetzt der briefliche Verkehr des Königs mit Wagner und mit Cosima. Auf ihrer beider Rat hatte er eine Reise in die vom Kriege heimgesuchten fränkischen Landesteile unternommen, hatte sich endlich dem Volke gezeigt und, wie er selbst zugestand, »allenthalben zahlreiche Beweise von aufrichtiger, ungeheuchelter Liebe« empfangen. Ja, in seinem allzu jugendlichen Feuereifer machte er sich nun mit dem Gedanken vertraut, »sein Wohnlager in Nürnberg«, der fränkischen Hauptstadt, »aufzuschlagen und dorthin den Sitz der Regierung zu verlegen«. Dabei schwebte ihm die festliche Einweihung dieses Ereignisses durch die »Meistersinger von Nürnberg« vor Augen. Auch die Musikschule und der Festbau für die Nibelungen traten von neuem in den Vordergrund. Das Weihnachtsfest verbrachte Bülow krank im Bett, in seiner Basler Wohnung. Zu Neujahr war er mit Wagner, Cosima und Richter in Zürich, wo Semper sein Modell für das Festspielhaus – dasselbe, das sich heute im bayerischen Nationalmuseum befindet – soeben fertiggestellt hatte. Am nächsten Tage wurde es dem König übersandt.
Die Briefe Bülows in der nächsten Zeit werfen ein besonderes Licht auf diesen seltenen und seltsamen Mann. Cosima sah wieder Mutterfreuden entgegen. »Morgen reise ich nach Luzern«, schrieb Hans am 16. Februar 1867 an Raff. »Ist's nicht traurig für mich, daß das Ereignis in fremdem Hause vor sich geht? Ist's nicht traurig, daß ich seit einem halben Jahr wie ein alter Garçon vegetiere? Nun – gottlob! – jetzt habe ich mein Schicksal in Händen, es gibt für mich wieder eine individuelle Existenz; daß dieselbe mit den Plänen Rich. Wagners nicht mehr verknüpft ist, tut, da wir so nahe bei Luzern wohnen werden und W. ohne mich nach Monako nicht zurückkehrt, unserem alten Freundschaftsverhältnis keinen Abbruch.« Schon im nächsten Satz jedoch erklärte er, daß er im Herbst nach Amerika gehen wolle. Demnach sah es mit seiner Seßhaftigkeit »nahe bei Luzern« einigermaßen fragwürdig aus. Dann fuhr er fort: »Meine liebe Frau ist übrigens leider gar nicht wohl – so daß ich dem sonst erfreulichen Ereignis nicht ohne Besorgnis entgegensehe.« Am Schlusse des Briefes betonte er nochmals seinen Vorsatz, nicht mehr nach München zu gehen. »Der King of bavaria wird wahrscheinlich sehr zornig über mich sein und mir den Hofkapellmeistertitel entziehen. Ich erwarte es: aber trotzdem ich kein Republikaner bin, würde ich doch nur einem König zu dienen vermögen, der königlich denkt und handelt (nicht bloß künstlerisch empfindet).« Bülow hatte also das Gefühl, daß Ludwig ihm gegenüber nicht königlich gehandelt habe. Dieses Gefühl war ungerecht. Hatte ihm doch der König selbst das »Ausharren« nahegelegt und ihm soeben erneute Genugtuung gegeben.
Am 17. war Bülow in Triebschen. Er kam gerade recht zur Geburt des Kindes. »Sonntag vormittags 10 Uhr«, schrieb er an Draeseke, »ist meine liebe Frau von einem gesunden Mädchen (Nr. 4!) glücklich entbunden worden. Ihr Zustand ist sehr normal, flößt mir bis dato keine Besorgnisse ein, doch reise ich, trotzdem's mir auf den Nägeln brennt, erst dann nach Basel zurück, wenn keine Spur von Gefahr mehr vorhanden.« Das Sonntagskind erhielt in der Taufe die Namen Eva Maria. Taufpatin war die Großmutter Marie d'Agoult. Sie ließ sich durch Emil Merian, den Schwager Bülows, vertreten.
Marie von Bülow, die zweite Frau Hans von Bülows, berichtet über eine »aus zuverlässigem Munde wiederholte Äußerung«: Hans hätte am Bette seiner Frau unter Tränen gesagt: » Je pardonne« (ich verzeihe), worauf sie erwidert hätte: »Il ne faut pas pardonner, il faut comprendre« (du brauchst nicht zu verzeihen, sondern du mußt verstehen). Bülow hatte längst verstanden, und weil er verstanden hatte, verzieh er auch aus tiefstem Herzen.
Bülows Ehe war seit den ersten Münchner Tagen eine Scheinehe. Aber den Schein hat er so peinlich gewahrt, daß niemand wagen konnte, ihm gegenüber nur dem leisesten Zweifel Ausdruck zu geben. In allen seinen Briefen betonte er die Sorge um seine Frau und die Freude, wenn er mit ihr beisammen war. Er war ja auch unendlich besorgt um ihre und um seine Zukunft; er genoß jedes Beisammensein wie ein letztes, wie einen Abschied.
Mit Wagner fühlte er sich noch immer unlöslich verbunden. Durch diesen kamen auch seine Beziehungen zu München in Ordnung. Im Frühjahr wurde er Hofkapellmeister im ordentlichen Dienste und Leiter der zu gründenden Schule, wofür er, noch ehe sie eingerichtet war, schon das Gehalt bezog. Um dieselbe Zeit traf auch Wagner mit dem König zusammen, und für den Sommer waren endlich die »Mustervorstellungen« in Aussicht genommen, denen natürlich Wagner beiwohnen sollte. So war – bis auf den ständigen Aufenthalt Wagners – der alte Zustand wiederhergestellt. Bülows kehrten nach München zurück, und in ihrer Wohnung, jetzt Arcostraße 11, standen zwei Zimmer für Wagner, der sein Haus in der Briennerstraße an den König zurückgegeben hatte, als Absteigequartier zur Verfügung.
Als Cosima nun wieder von Triebschen nach München reiste, richtete sie noch einen Drahtgruß an Wagner oder vielmehr, wie vereinbart, an Verena Weitmann, jetzt verehelichte Stocker: »Es ist bestimmt in Gottes Rat, daß man vom Liebsten, das man hat, muß scheiden. Meisterin.« Zum ersten Male nannte sie sich die Meisterin! Der Meister aber griff, als er diesen Gruß in Händen hatte, zum braunen Buche und schrieb: »So traurig wie jetzt war ich doch wohl noch nie in meinem Leben! … Ich ersehne eine große Krankheit und Tod. Ich mag nicht mehr – will nicht mehr! – hätte es ein Ende! – Heute schied sie. – Was dieses Scheiden sagte! Was hilft alles Wiedersehen? Das Scheiden bleibt! Es ist elend! –«
Der Briefwechsel Cosimas mit dem König war in diesem Jahr besonders lebhaft. Von Triebschen aus berichtete sie ihm über Verbesserungen am Wohngebäude, Verschönerungen im Garten, über die Kinder, über Familienfeste und Ausflüge. Man merkt, wie schwer es ihr fallen mußte, nach München zurückzukehren; man sieht, mit welcher Freude und Seligkeit sie zwischen »Lohengrin« und »Tannhäuser« wieder einige Wochen am See in ihrem wahren Heim verbrachte. Aber auch von den »Meistersingern« berichtete sie dem König, als die Niederschrift bis zur Festwiese gediehen war. »Es ist wie ein tönendes sanftes Strahlen. Man weiß nicht, hört man das Licht oder sieht man den Ton in dieser milden sonnigen Verzückung. Wenn der Vorhang sich schließt (wie beim dritten Akt im ›Lohengrin‹), dann bewegt sich unter Glockengeläute das ganze alte Nürnberg, es ist, als ob die alten Häuser selbst sich feierlich in Zug setzen. Ich glaube, jedem Deutschen muß dabei voll stolzer Freude und schönem Selbstbewußtsein das Herz in der Brust sich heben und beben. Dabei ist die Feinheit des musikalischen Details so zart, daß ich es nur mit den wunderbar zierlichen Arabesken des Sakramentshäuschen in der St.-Sebaldus-Kirche Richtig: in der Lorenzerkirche. vergleichen kann, welches von dem Meister Adam Krafft ruhig sicher getragen wird, wie hier der noch viel größere, musikalisch poetische Reichtum und Schmuck vom Meister Sachs.«
Für den »Lohengrin« im Juni hatte Wagner wieder ein Landhaus am Starnberger See in der Nähe des Schlosses Berg zur Verfügung, wo er auch »bei Nacht und Sturm« einen Besuch des Königs empfing. Mit der Aufführung aber war er nicht zufrieden. Sie fiel so aus, wie er es befürchtet hatte. Was nützte beispielsweise die durch Bülow erreichte musterhafte Gesangsleistung des Chores, wenn die Chorsänger keine Ahnung von ihrer dramatischen Bestimmung hatten und durch müßiges Herumstehen, durch taktmäßige Bewegungen die Wirkung des Gedichtes in manchen Augenblicken geradezu vereitelten. Wagner bekannte dem König, daß er vom ersten Aufzug des Vorhangs an das Gefühl hatte, einer »Marionettenaufführung« beizuwohnen. Daß so etwas als »Mustervorstellung« geboten und sogar mit Jubel aufgenommen werden konnte – auch der König schien zufrieden zu sein –, das war noch schlimmer, als daß die ursprüngliche Besetzung der Titelrolle mit dem alten Dresdner Freunde Tichatschek dem König wegen der vorgerückten Jahre des Sängers mißfiel und im letzten Augenblicke, nach der Hauptprobe, geändert werden mußte. Dies führte allerdings zu einer vorübergehenden schweren Verstimmung des Meisters, der von der Hauptprobe ohnehin genug hatte, seinen Aufenthalt am Starnberger See jäh abbrach und nach Triebschen, das er diesmal sein Monsalvat nannte, zurückkehrte. Pünktlich wurden auch diesmal – und zwar von Wien (!) aus – triumphierende Nachrichten über die Ungnade des Königs verbreitet. Dieser aber war nur tief unglücklich darüber, daß ihn der Freund verlassen; auf die künstlerischen Fragen ging er gar nicht ein, sondern er bat Wagner völlig arglos, den kommenden Tannhäuser-Aufführungen beizuwohnen. Jedoch vergeblich. Schon für den »Lohengrin« hatte sich Wagner vorgenommen, nur einigen Proben, aber keiner Aufführung beizuwohnen. Der peinliche Ausfall der Hauptprobe hatte seinen schwankenden Entschluß gefestigt. Jetzt beim »Tannhäuser« nahm er nicht einmal an den Proben teil. Er wußte, daß »sein getreuer Hans« tapfer für ihn stritt, und fand sich damit ab, daß die Welt, zu der er in diesem Falle auch den König zählen mußte, von ihm eben doch nie etwas anderes verlangte als »Wagnerische Musik«.
Dadurch, daß er nicht in München war, versäumte er den dortigen Besuch Franz Liszts, der im Laufe des Sommers einer Einladung des Großherzogs von Weimar gefolgt war und eine Festaufführung seiner »heiligen Elisabeth« auf der achthundertjährigen Wartburg geleitet hatte. Liszt benutzte diese Fahrt, um Ende September den »Tannhäuser« und den »Lohengrin« in München zu hören und sich dabei von den wundervollen Leistungen seines Schwiegersohnes zu überzeugen. Es war ihm aber auch darum zu tun, seine Tochter wiederzusehen und mit ihr die ernsten Dinge zu besprechen, mit denen sich die Unberufensten so gern beschäftigten und die natürlich längst bis Rom gedrungen waren. Schon war in München, namentlich in den katholischen Kreisen, die Meinung verbreitet, daß der Abbé das Verhalten seiner Tochter aufs strengste mißbillige und von Wagner nichts mehr wissen wolle. Liszt widerlegte diese Meinung auf die einfachste und vornehmste Art, indem er seine Tochter in München, namentlich bei der Feier ihres Namenstages im Hause des befreundeten Malers Wilhelm von Kaulbach, ebenso herzlich als auszeichnend behandelte. Dann fuhr er nach Stuttgart und von dort in Begleitung Richard Pohls nach Basel und nach Luzern. Am frühen Nachmittage des 9. Oktober kam er dort an und wurde von Wagners Hausverwalter Jakob Stocker, dem Gatten der Verena Weitmann, erwartet. Dieser brachte ihn in Wagners Einspänner nach Triebschen. Pohl kam erst abends nach. Einen halben Tag waren Liszt und Wagner allein. Kein Zweifel, daß die Lebensfragen besprochen wurden, die damals an den Grundfesten Wagners und seines ganzen Seins rüttelten. Von einer tieferen Verstimmung der beiden Freunde kann aber nicht die Rede sein, denn am Abend, in Gegenwart Pohls, wurde sehr lebhaft aus den »Meistersingern« musiziert, und Liszt verlieh seinem Entzücken und seiner Begeisterung den unbefangensten Ausdruck. Im Morgengrauen des nächsten Tages verließ er Wagners Asyl. An die Fürstin berichtete er nur, daß der Freund abgemagert und durchfurcht sei, daß aber sein Genius die kühnsten Schwingen entfalte. »Die Meistersinger haben mich zur Bewunderung hingerissen durch ihre unvergleichliche Vollsaftigkeit, Kühnheit, Frische, ihren Reichtum, ihren Schwung und ihre Meisterschaft. Niemand außer Wagner hätte ein solches Werk schaffen können.« Danach blieb Liszt noch acht Tage in München. Er sagte dort: »Ich war bei Wagner; das ist das Beste, was ich getan habe. Es ist mir, als ob ich Napoleon auf St. Helena gesehen hätte.«
Dieses Wort muß recht verstanden werden. Die »Verbannung« Wagners durch den König war aufgehoben. Ludwig beschwor den Freund, nach München zurückzukehren oder doch längere Zeit am Starnberger See oder in einem Jagdhause zu bleiben. Wagner blieb freiwillig fern. Er sah, daß er dort in Wahrheit nicht herrschen, die Welt nicht nach seinem Sinne lenken konnte, wo man ihn allerdings gefühlsmäßig vergötterte. Das Herz des Königs war ihm weit geöffnet, aber verstanden wurde er von ihm nicht viel besser als von den Durchschnittsköpfen, die ihn mit größerer oder geringerer Hochachtung unter die »Opernkomponisten« einreihten. Der König schwärmte wohl für die Dichtungen Wagners und fand durch sie auch den rechten Zugang zur Musik. Doch er begnügte sich mit dem geistigen Bilde, und im Theater mit dem Theatralischen, mit mehr oder weniger glanzvollen Äußerlichkeiten, die von Wagners Eingebungen eben nur den Namen hatten. Das war beklemmender als die hartnäckigste Gegnerschaft. Das ließ Wagner abmagern und zeichnete Furchen in sein Gesicht. Durch den Besuch Liszts, den er in seinem Tagebuche als »gefürchtet, doch erfreulich« bezeichnete, wurde er außerordentlich erfrischt. Er bat den König, Liszt doch auch einzuladen. »Ihnen zuliebe tue ich diese Bitte. Sie werden große, ernste Freude haben … Wir fanden unsere alte Zeit schöner wieder. Er ist ein lieber, großer, einziger Mensch … Mir geht das Herz auf, wenn ich weiß, daß er eine flüchtige Stunde nur das Glück hat, in Ihr Auge zu blicken.« Anderthalb Wochen später bestürmte er den König mit dem Vorschlage, Liszt dauernd an München zu fesseln, ihm dort eine »bedeutende Stelle für die Musik (vor allem für die Kirche)« zu sichern. Er durfte versichern, daß Liszt einem solchen Rufe gern folgen würde. »Welches Glück für ihn, und für uns! Liszt würde allen unseren Unternehmungen, vor allem unserer Schule einen Schwung geben, der mit gar nichts sich vergleichen ließe. München würde geradesweges das europäische Zentrum der Musik werden … Glauben Sie, er besitzt gerade alles das, was ich nicht habe, und ist die einzig erdenkbare Ergänzung meines Wesens! Und dann – unser Ruhm! Ihr Ruhm! Gott, was würde dieser Mensch, mit seinen ungeheuren Gaben, alles beleben! Dann könnte ich ruhig und sorgenlos nur noch schaffen! Oh, bedenken Sie das!« Er meinte auch, daß Liszt seine Stellung und seine Machtbefugnisse selbst zu wählen habe: »Glauben Sie, große Menschen sind nie unverschämt; sie werden nur das verlangen, wodurch sie nützen können.« Am nächsten Tage war die Partitur der »Meistersinger« vollendet. Aber Wagner dachte nicht daran, sich auszuruhen. »Heil! Siegfried!« schrieb er dem König. »Nun werde Brünhilde erweckt. Die Zeit ist da, ihr Schlaf sei gelöst!«
Ludwig, der damals Wagners tiefgründige Aufsätze über »Deutsche Kunst und deutsche Politik« las und dadurch angeleitet wurde, über Verfall und Erneuerung des deutschen Theaters nachzudenken, wandte seine Aufmerksamkeit neben der Oper auch dem Schauspiel zu und glaubte der Sache am besten zu dienen, wenn er einen gefeierten Dichter als Intendanten berief. Wer Wagners Kunstanschauungen und seine Schriften kennt, der wird nicht einen Augenblick zweifeln, daß er davon abriet. »Nur jetzt keine Übereilung«, schrieb er. »Die Ernennung des Unfähigen, grade je glänzender sein Name und je schwerer er wieder zu beseitigen wäre, müßte leicht alles wieder in tödliche Verwirrung bringen. So bitte ich Sie denn recht herzlich und freundlich, zu keiner Anstellung sich bestimmen zu lassen, über welche wir nicht zuvor gemeinschaftlich beraten haben. Fürchten Sie vor allem den modernen poetischen Literaten! Er ist der Allerunfähigste, die uns in betreff des Theaters leitende Idee zu erfassen … Würden wir sofort irgendeinen sehr namhaften Menschen von literarischem oder theatralischem größerem Ruf etwa als artistischen Direktor oder Oberregisseur berufen, so müßte man natürlich glauben, ah! das sei die Sache gewesen, der würde nun plötzlich das Theater zu etwas ganz Himmlischem machen. Seine unausbleiblichen Mißgriffe, seine Erfolglosigkeit fielen auf uns zurück, und wir hätten leicht für immer uns der Autorität begeben.« Kurz vorher hatte Cosima zu derselben Frage Stellung genommen, mit der Bestimmtheit und Unbedenklichkeit, die sie stets auszeichnete und die ein Vorrecht des Weibes ist. Es handelte sich besonders darum, ob Paul Heyse zu berufen war, der gefeierte Erzähler, der eine unerwiderte Liebe zur dramatischen Muse in seinem Herzen nährte und anderseits als begüterter und verwöhnter Mann sich niemals mit einem Amt oder einem Erwerb geplagt hatte. »Ich meine«, schrieb Cosima dem König, »daß es besser ist, wenn wir vorläufig keinen artistischen Direktor bekommen, weil fürs erste kein Mensch gebraucht wird, der sich breit macht mit einem großen Ruf und auch mit großen Prätentionen kommt, sondern daß vorher alle praktischen Fragen geregelt werden müssen.« Für praktisch hielt sie die Wahl des begabten Schriftstellers Hermann von Schmid, der kurze Zeit das Münchner Aktientheater geleitet hatte, »als einfachen Regisseur, das heißt als Menschen, den man kaum kennt und den das Publikum als Person nicht beachtet … Er wird sich unterordnen, bringt keinerlei Ansprüche mit sich, hat eine Praxis durchgemacht und hat durch seine Aufsätze über das Theater bewiesen, daß er etwas davon versteht und Ehrfurcht von den großen Dichtern hegt. Paul Heyse würde natürlich nur als literarischer Berater eintreten wollen. Meine Einwendungen gegen ihn sind folgende: Erstens die jüdische Abstammung – worin ich den hohen Freund untertänigst bitte, kein Kastenvorurteil zu erblicken –, sondern eine tief begründete Furcht vor einer Rasse, die den Deutschen viel Unheil gebracht hat. Zweitens die Unerfahrenheit in Bühnenverhältnissen, drittens die eigene Produktivität. Die Dramen Paul Heyses werden ihm immer vor den Werken Schillers, Goethes, Shakespeares gehen. Viertens die Unfähigkeit und der innere Unwille, sich mit den Kunstanschauungen zu vertrauen, da man sich natürlich für einen ganz anderen Dichter selbst hält. Fünftens die Mühe, die man haben würde, sollte der Versuch nicht zur Zufriedenheit ausfallen, Paul Heyse zu entfernen. Es würde einen förmlichen Eklat geben, die Zeitungen, das ganze verkappte und offene Israel würde sich für ihn aufstellen wie ein Mann. Ich halte es entschieden für besser, wenn die Verhältnisse durch unscheinbare, schlichte, tüchtige und bescheidene Menschen geordnet werden.«
An diesem Beispiel ersehen wir von neuem, wie sehr Cosima an allem Anteil nahm, und daß sie sich für berechtigt halten durfte, den König in allem zu beraten. Dabei bemerken wir, daß sie und Wagner das, was dem König am Herzen lag oder was sie selbst ihm ans Herz legen wollten, als seine und ihre gemeinsame Sache betrachteten und sich der Worte »wir« und »uns« bedienten. Wagner schrieb diese Worte sogar mit großen Anfangsbuchstaben und eignete sich damit den Brauch der Könige an.
Trotz allen Gegensätzen und Meinungsverschiedenheiten, die immer wieder durch die aufrichtigen Beteuerungen einer schrankenlosen Liebe überbrückt wurden, trotz manchen störenden Zwischenfällen, die in der ausführlichen Lebensgeschichte Wagners ihren Platz haben, konnte er sich jetzt einer so reichen Gunst des Königs erfreuen wie im Anfange ihrer Freundschaft. Die neue Musikschule oder vielmehr die Umwandlung der alten unter der neuen Leitung Bülows wurde jetzt auch zur Tatsache – im Oktober 1867 –, und da die »Meistersinger« glücklich vollendet waren, wurde sofort ihre Aufführung im Hof- und Nationaltheater – für den März des nächsten Jahres – verfügt. Um an den Proben teilzunehmen und nach Kräften dahin zu wirken, daß diesmal nicht nur eine »Mustervorstellung«, sondern etwas Rechtes und Würdiges zustande komme, teilte Wagner im Winter seinen Aufenthalt zwischen Triebschen und München. Aus den kurzen, schlagwortartigen Eintragungen im braunen Buche, die unter der Überschrift »Annalen« die wichtigsten Ereignisse und Eindrücke in ihrer Zeitfolge festhalten, geht hervor, daß seine Gemütsstimmung den heftigsten Schwankungen unterworfen war. Mit den »Meistersingern« ging es ja doch nicht sehr rasch vorwärts. Wagner hatte bessere Helfer als je vorher: neben Bülow Hans Richter, der zum Chorleiter an der Münchner Oper berufen worden war und sich auch bei der Einübung der einzelnen Rollen die erstaunlichste und erfolgreichste Mühe gab; dann den Spielleiter Dr. Heinrich Hallwachs, der auf alle Wünsche und Vorschriften geschickt und verständig einging. Die Arbeit zog sich aber in die Länge, aus März wurde Juni. Die Aufführung, die dann zustande kam, war immerhin so hervorragend, daß Wagner noch erheblich später, nach den ersten Bayreuther Festspielen, von ihr sagen konnte, sie sei »das Schönste, was ich in meinem künstlerischen Leben erfahren. Sie war beinahe vollendet«. Freilich hatte er, außer in Bayreuth, noch nie und nirgends so unermüdlich mitgearbeitet. In seiner hinreißenden, unbeschreiblich lebhaften und feurigen Art machte er alle Darsteller mit ihren Aufgaben, denen sie zum Teil noch völlig fremd gegenüberstanden, so innig vertraut, daß damit die bis heute kenntliche und wirksame, echt Wagnerische Überlieferung für die »Meistersinger« geschaffen wurde. Dabei spielte und sang er selbst, als sei er immer nur Sänger und Schauspieler gewesen, und diese schon körperlich anstrengende Tätigkeit, die ihn zeitweilig beglückte, da er in ihr sein angebornes Wesen und seine tiefsten künstlerischen Absichten aussprechen konnte, kostete ihn doch auch einen starken Verbrauch seelischer Kräfte. In ähnlicher Lage befand sich Bülow, der von dem Ehrgeiz beseelt war, diesmal das Höchste zu leisten, das er sich zutrauen durfte, der auch in der Tat seine eigenen Ansprüche und die Erwartungen Wagners herrlich erfüllte, dessen Gemüt und Nerven aber dadurch in eine furchtbare Spannung gerieten. So ergab sich der wahrhaft tragische Sachverhalt, daß gleichzeitig mit der engsten Zusammenarbeit Wagners und Bülows ihr innerer Gegensatz – das Ringen um Cosima – sich drohend verschärfte.
Als Bülow einmal bei einer häuslichen Probe auf dem handschriftlichen Entwurfe der »Meistersinger« ein Lichtbild entdeckte, das Wagner mit dessen Töchterchen Eva darstellte, stürzte er fassungslos aus dem Zimmer. Er kam wieder, die Arbeit nahm ihren Fortgang, er ließ auch nicht die leiseste Ermattung spüren. Aber zwei Monate später trug Wagner in sein Buch ein: »Klavierproben: schwere, dumpfe Empfindung von der tiefen Feindseligkeit und Entfremdung des Hans.« Das Zusammenleben wurde noch dadurch erschwert, daß in dieser Zeit auch die Mutter Bülows nach München gekommen war und bei ihrem Sohne wohnte. Um ihr gegenüber den gebotenen Schein besonders sorgfältig zu wahren, machte Cosima sogar mit ihr einen Besuch in Triebschen, als Wagner wieder einmal dort war, und zeigte ihr den Landsitz des großen Freundes. Wir haben kein klares Bild von der Eigenart Franziska von Bülows; die Berichte über ihr Verhältnis zu Cosima widersprechen einander. Wir wissen nur, daß es nicht ihre Art war, den Dingen, die ihr nahegingen, gelassen zuzusehen, und haben allen Grund, den Besuch der Schwiegermutter als ein neues Verhängnis zu betrachten, das die qualvolle Erregung dieser Tage beinahe unerträglich machte.
Da brachte der 21. Juni einen Triumph, von dem Wagner an Verena Stocker-Weitmann mit Recht schreiben konnte, so etwas sei noch nie und nirgends erlebt worden, und von dem er dem König sagen durfte: »Was nie geschah, nun ward es erlebt, schöner und bedeutungsvoller, als es sich ahnen ließ.« Wagner war seinem erneuten Vorsatz, nur an den Proben teilzunehmen, diesmal untreu geworden. Er selbst meinte, er habe ein Gelübde gebrochen. Heimlich wollte er der ersten Aufführung in der Loge Cosimas beiwohnen. Doch während des Vorspiels wurde er zum König gerufen, an dessen Seite er nun sein Werk – allen sichtbar – anhören mußte. An der Seite des Königs hatte er auch die Huldigungen des Publikums entgegenzunehmen. Als am Schlusse der Jubel begeisterte Formen annahm, trat der König absichtlich zurück, und Wagner allein verneigte sich von der Brüstung der Königsloge, ein Herrscher im Reiche der Kunst, dem ein wirklicher König königliche Ehren erwies. Das war die Krönung des Freundschaftsbundes zwischen »Fürst und Sänger«, das war der gewaltigste Sieg, den Wagner nach den schlimmsten Demütigungen hatte erringen können. An der Tatsache dieses Sieges und der glanzvollen Aufführung konnten auch die unvermeidlichen Rückschläge nichts mehr ändern, die jeder Erfahrene voraussagen mochte und die sich in folgenden Bemerkungen Wagners widerspiegeln: »Verkehr mit Schott. Mit Dresden und Wien wegen Verunstaltungen der Meistersinger. Ohnmacht dagegen. Füge mich. Scheußliche Rezensionen: muß, meiner Bedürfnisse wegen, froh sein, die Meistersinger als gemeinen Theatersukzeß zu retten.«
Aber Sieg und Niederlage, Triumph und Enttäuschung wogen leicht gegenüber der niederdrückenden Wucht, mit der jetzt die Hauptfrage zur Entscheidung drängte. Die gemeinsame Arbeit war beendet. Bülow hatte sein Letztes hergegeben im »Dienste« für Wagner und für die neue Kunst. Von ihm konnte und durfte nichts anderes mehr verlangt werden, als daß er auf Cosima endgültig verzichte. Wenige Tage nach der ersten Aufführung der »Meistersinger« war Wagner wieder in Triebschen, wo er zehn Tage lang eine schwere Erkältung zu überwinden hatte. In der Abgeschiedenheit des Erkrankten und Genesenden fielen die letzten Schleier: eine Täuschung war nicht mehr möglich, wohl aber blieb der Vorwurf, daß er selbst nicht schon früher unbeirrt sein Recht begehrt und damit Cosima befreit habe. Das braune Buch und die Briefe an den König berichten über alles. Zuerst lesen wir: »Eintretende große Klarheit über meinen Zustand und die Lage der Dinge. Tiefste Mutlosigkeit zu irgendwelcher Bewegung: in dem Schicksal meines Verhältnisses zu Cosima und Hans den Grund der Unfähigkeit alles Wollens erkannt.« Später: »Notwendig dünkende Ergebung in das elendeste Schicksal: von Cosima seit unserer vorjährigen Trennung eigentlich vorausgesehen: sie glaubte an mich und mußte an mir somit zweifeln.« Dann ein Brief, worin es heißt: »Frau von Bülow wird dieser Tage München verlassen und vermutlich nicht wieder dorthin zurückkehren. Die Ärzte haben ihr dringend ein milderes Klima angeraten. Sie wird wahrscheinlich nächsten Winter zu ihrem Aufenthalt Italien, vermutlich in der Nähe ihres Vaters oder sonstiger Verwandter, wählen. Es wird sich dann fragen, inwiefern die Münchner Kunstverhältnisse sich hoffnungsvoll genug gestalten, um Bülow selbst zu einer nur so sehr erschwerten Ausdauer daselbst zu bestimmen; natürlich müßte er sich dann im anderen Falle an Ihre Großmut um gnädige Entlassung aus seiner Stellung wenden.« Gleichzeitig im Buche: »Sofort Entschluß zu C.s Fortgang von München gefaßt. Ihre verzögerte Ankunft. Spannung. Sie kommt 20. Juli … Schwierige Mitteilungen über Entschluß … Über die Hauptsache einverstanden.«
Du Moulin weiß von einem in bester Absicht erbrochenen Briefe Cosimas an Wagner, der Bülow plötzlich die Augen geöffnet und ihn zu dem jähen Entschlusse veranlaßt habe, den angebeteten Meister vor die Pistole zu fordern. Ein Freund, dem er sich zur Regelung dieser Angelegenheit anvertrauen mußte, habe ihm gesagt: »Sie können sich mit dem Meister nicht schießen«, und er sei dann weinend zusammengebrochen. Es wäre auch eine ungeheuerliche Vorstellung: Wagner, auf der Höhe seines Schaffens, an der Pforte seines weltbeherrschenden Ruhmes, dem schnöden Zufall eines frevelhaften Glücksspieles preisgegeben, das ihn vor die Möglichkeit stellt, durch die tödliche Waffe des Mannes, den er einmal sein zweites Ich und der sich selbst den Taktstock Wagners nannte, ein sinnloses Ende zu finden oder – diesen Mann mit eigener Hand zu vernichten. Aber Du Moulin sagt uns nicht, wann sich diese romanhafte Wendung vollzogen haben soll, und nennt auch nicht den mahnenden Freund. Marie von Bülow hat die Sachlage richtiger beurteilt. Hans bedurfte keiner Enthüllungen. Die Heftigkeit, mit der er seine Umgebung und seine Gattin oft erschreckte, hätte ohne verräterischen Brief Grund und Anlaß genug gehabt, auch einmal gegen Wagner loszubrechen. Doch Bülow, der nie Zufriedene und stets von Nervenqualen Gefolterte, dem ruhiges Behagen nur ein seltener Traum war und der bei den geringfügigsten Anlässen »außer sich« geraten konnte – Bülow wußte sich Wagner und dem Schicksal gegenüber zu beherrschen, und wenn er auch die Gebote seines Standes mit ritterlichem Stolz ehrte und befolgte, nie vergaß er der höheren Ritterlichkeit, die in solchem Falle die Bedachtnahme auf den Gesellschaftskodex geradezu unmöglich machte. Es war vielleicht nur eine edle Schwäche, die ihn die gleichzeitige vollkommene Trennung von Wagner und Cosima, als das Furchtbarste, was ihn treffen konnte, immer wieder verzögern und hinausschieben ließ. Aus den »Annalen« Wagners geht unwiderleglich hervor, daß dieser selbst im Einverständnis mit Cosima die unaufschiebbare ehrliche Auseinandersetzung herbeiführte.
Nach außen hin war die Sachlage dadurch gekennzeichnet, daß Cosima mit den beiden jüngeren Kindern Isolde und Eva nunmehr in Triebschen weilte. Von einer späteren Rückkehr wollte sie nichts wissen. München war von neuem erregt. Die Widersacher Bülows hatten sich zusammengetan, um ihm das Leben noch einmal so bitter wie möglich zu machen. Ein willkommener Bundesgenosse war ihnen die unglückliche Frau Schnorr, die sich in den Kopf gesetzt hatte, Wagner müsse sie heiraten, und die durch ihre Eifersucht sogar in Geistesstörung verfiel. In diesem Zustande belästigte sie Wagner und den König mit unglaublichen Zumutungen und Behauptungen. Ludwig, der zwar Frau Schnorr in ihre Schranken zurückwies und sie schließlich aus München entfernte, war doch höchst bekümmert und erregt wegen des neuen Klatsches und seiner Folgen. »Sorgen Sie dafür, ich beschwöre Sie«, so schrieb er an Wagner, »daß Frau von Bülow München im Winter nicht verlasse. Dies wäre den Übelgesinnten ja Wasser auf der Mühle.« Aber um diese Zeit, im Sommer, war Cosima schon in Triebschen, und eben der neue drohende Sturm in München war ihr eine Hauptveranlassung gewesen, nicht länger zu zögern und allen diesen vom Lästigen bis zum Unerträglichen reichenden Quertreibereien ein für allemal zu entgehen.
Von Triebschen aus, in diesen »schwermütigen und leidenschaftlichen« Tagen, wie es im braunen Buche heißt, zwischen viel Arbeit und Geschäften, auch Besuchen von Freunden und Verlegern, unternahm Wagner mit Cosima im August einen dreitägigen Ausflug nach Interlaken und im September eine kleine Erholungsreise über den St. Gotthard nach den Borromäischen Inseln und dem von ihm aus früherer Zeit geliebten »wunderbaren« Genua. Die Rückreise nahmen sie über Mailand. Als sie von dort weiterfuhren, wurden sie für volle acht Tage durch die eintretende Überschwemmung zwischen den Bergstürzen und Wasserverheerungen des Tessin unter Umständen und Eindrücken zurückgehalten, die sie glauben ließen, das Ende ihrer Tage sei gekommen. Sie mußten zuerst in Lugano bleiben, kamen dann in Bellinzona nicht weiter, gelangten am 1. Oktober, an dem Tage, an dem sie in Luzern eintreffen wollten, bis Biasca, mußten von da, bei furchtbarem Gewitter, durch Schlamm und Gewässer, beim Schein einer Laterne über eine zerbrochene Brücke, zu Fuß nach Faido. Die fortgesetzte Sintflut machte auch dort ihr Weiterkommen im Wagen unmöglich. Nach drei weiteren »bösen, aber tiefen Tagen«, in denen Cosima einen Brief an Hans richtete, und nachdem sie unter Regenströmen bei gesteigerten Schwierigkeiten abermals einen furchtbaren Marsch bewältigt hatten, konnten sie doch wieder die Post benutzen. Mit einwöchiger Verspätung kehrten sie schließlich heim. »Die unerhörten Anstrengungen, um den bedrohten Orten zu entkommen«, so berichtete Wagner an den König, »wurden von einer leidenden Frau geteilt. Von einer Freundin, deren kummervolle Seelenstimmung zu beheben ich namentlich diesen Ausflug nach Italien, ihrem Geburtsland, ersonnen und unternommen hatte! – Genug! Sie urteilen über den Zustand von Erschöpfung und tiefster Erschütterung, in welcher ich endlich mein schweizerisches Königsasyl wieder erreichte? Am Rande des Unterganges zeigte sich uns, von langen Blitzen erleuchtet, noch einmal das Leben in seinem furchtbaren Ernst. Keine Täuschung hielt da mehr stand. Dem Tode in das Angesicht schauen, heißt die volle Wahrheit erkennen: sein Ewiges retten, heißt jedem Truge den Rücken wenden.« In diesem Briefe vom 14. Oktober lesen wir ferner: »Die Freundin ist vor zwei Tagen mit ihren Kindern noch einmal nach München zurückgereist, um ihre Lage zu ordnen und ihre unabänderlichen Entschlüsse würdevoll auszuführen. Mein Segen hat sie begleitet: ich habe Grund, sie als das reinste Zeugnis für Wahrhaftigkeit und unerschöpfliche Tiefe, das mir das Leben noch zuführte, zu verehren: sie ist das vollkommenste Wesen, das in meine menschliche Erfahrung getreten ist. So gehört sie auch einer anderen Weltordnung an. Ich habe nichts zu tun, als ihr beizustehen: mögen Sie, Erhabener, Gütiger, hierin treu sich mir zur Seite stellen!« Zwei Tage später schrieb Bülow einem seiner besten Freunde, dem Klavierbauer Karl Bechstein in Berlin, wohin auch seine Mutter inzwischen zurückgekehrt war: »Die Gesundheit meiner lieben Frau (bitte – lassen Sie meiner … Mutter wegen nichts davon verlauten) ist sehr schwankend. Ärzte raten Klimaveränderung – München ist für sie zu rauh –, und vermutlich werde ich mich auf längere Zeit von ihr trennen müssen – sie geht entweder zu ihrer Stiefschwester nach Südfrankreich oder nach Italien. Das ist in mehrfacher Hinsicht sehr hart für mich.«
Wieder einige Tage später wandte sich Wagner nochmals an den König, »mit der herzlichen Bitte, den armen und doch so vortrefflichen Hans von Bülow nicht fallen zu lassen … Notwendige Entschlüsse, deren Gründe die oberflächliche Welt nichts angehen, werden vermutlich Bülow bald in die Lage bringen, in der treuesten Ausübung seiner ihm zugeteilten Berufsfunktionen seine einzige Lebensaufgabe, seine einzige Befriedigung noch zu erkennen. Mögen ihm diese in keiner Weise erschwert werden! (Er hat viel, ja Unerhörtes zu ertragen gehabt: seine einzige Zuflucht war eine rastlose Tätigkeit, mit welcher er alle Welt in wahrhaftes Staunen versetzte. Ohne alle Scheu erkläre ich ihn laut für einen der bedeutendsten, ja für den feinfühlendsten Musiker der Gegenwart: seine Wirksamkeit an der Musikschule als wirklicher Musiker kann von keinem übertroffen werden, und sein Einfluß auf die musikalische Bildung wird der segenvollste sein. Als Orchesterdirigent kann ich ihm niemand zur Seite stellen. Ich meine, diese Zeugnisse, die ich vor aller Welt belegen will, sollten von Gewicht sein. Und kaum bedarf es ihrer, denn Bülows ungemeine musikalische Befähigung wird von niemand auch nur in den mindesten Zweifel gezogen. Daß ich, außer Musiker, auch Dramaturg und dramatischer Choreg bin, ist ein Ausnahmsfall, den niemand zum Maßstab für eine andere Begabung anlegen darf. Was ich allein zu leisten vermag, könnte nur ein glücklicher Verein mehrerer leisten. Unter diesen mehreren würde Bülow die eine Stelle vollgültig für sich ausfüllen … Ich fürchte, bald wird Bülow sehr vereinsamt stehen, und er wird gegen Unwürdigkeiten des Schutzes bedürfen. Diesen Schutz spreche ich mit Zuständigkeit von Ihnen, mein erhabener Freund, an! Glücklich, wenn Bülow die Kraft gewinnt, in seiner künstlerischen Tätigkeit sich aufrechtzuerhalten: möge er nicht durch Preisgebung an Feinde und Neider dieser letzten Lebensrettung beraubt werden. Doch ich kenne die Menschen, und ich befürchte alles. Würden Sie, Teuerster, ihm Ihren mächtigen Schutz versagen, so müßte auch ich mich in Trostlosigkeit ergehen und vermutlich zu der Einsicht gelangen, daß auch ich fortan keines Schutzes mehr zu bedürfen hätte! Verstehen Sie gütig und liebevoll dieses letzte inständige Wort der Bitte! Es kommt aus reinem Herzen, und ich weiß, ich leiste Ihnen, und mit Ihnen der Kunst, einen großen Dienst, wenn ich diese Bitte dringend Ihrer gnädigsten Erwägung anempfehle«.
Der Besuch Cosimas in München verlängerte sich wider Absicht und Erwarten. Aus den »Annalen« Wagners, deren Einzelheiten noch von einer gründlichen Forschung zu erhellen sind, geht nur das eine mit Sicherheit hervor, daß die katholische Eheschließung und das katholische Glaubensbekenntnis Cosimas ihrer Trennung von Hans schwere Hindernisse bereiteten und daß hierbei auch auf den strengen Katholizismus Liszts Rücksicht genommen werden mußte. Bülow, der in Liszt seinen Vater verehrte und mit der Ehelichung seiner Tochter gewissermaßen Sohnespflichten auf sich genommen hatte, scheint diese Rücksicht in den Vordergrund gestellt zu haben. Der Wechsel des Glaubensbekenntnisses wurde für unvermeidlich gehalten, war aber ohne Zustimmung Liszts kaum durchführbar, wenn nicht auch die Bande zerreißen sollten, die die Tochter mit dem Vater verknüpften. Cosima wollte selbst nach Rom fahren, was Wagner in »leidenschaftliche Sorge« versetzte. Er wandte sich an ihre Halbschwester, die Gräfin Charnacé, die auch Bülow in seinem Briefe an Bechstein erwähnte, mit der sie alle in freundschaftlichsten Beziehungen standen und die als persönlich Unbeteiligte vielleicht am ehesten einen Ausgleich finden konnte. Er veranlaßte sie, nach München zu reisen und auf Cosima einzuwirken, daß sie die Romfahrt unterlasse. Darüber war nun wieder Cosima »außer sich«, und Wagner selbst, der seine Verwandten in Leipzig besuchen wollte, hielt sich auf dem Wege dahin einen Tag in München auf. Den genauen Verlauf der sich drängenden Begegnungen und Aussprachen kennen wir nicht, auch wissen wir nicht, inwieweit Liszt brieflich unterrichtet war und wie er sich darüber geäußert hat. Die Eintragung Wagners: »Not mit Hans« läßt darauf schließen, daß vor allem Bülow, weit davon entfernt, zur Waffe zu greifen und eine gewaltsame Entscheidung herbeizuführen, immer noch das Bestehende zu retten suchte und die größten Schwierigkeiten machte. Jedenfalls hielt er vor der Welt beinahe krampfhaft daran fest, daß Cosima nicht bei Wagner, sondern bei ihrer Stiefschwester in Südfrankreich oder in Versailles gewesen sei und eben dort auch ihren dauernden Aufenthalt nehmen wolle. Er forderte auch von allen Mitbeteiligten, daß sie diese Täuschung aufrechterhielten. In Wahrheit traf Cosima am 16. November mit Isolde und Eva wieder in Triebschen ein, und sie hat es ohne Wagner nicht mehr verlassen.
Von da an führte sie ein Tagebuch, das ihr Leben an der Seite des erwählten Mannes Schritt für Schritt begleitete, wodurch es auch eine zukünftige unermeßlich reiche Quelle für das Leben Wagners geworden ist. Bisher hat nur Du Moulin Eckart Einsicht nehmen und Teile daraus veröffentlichen dürfen. Wichtige Aussprüche Wagners sind in den »Bayreuther Blättern« abgedruckt. Das Buch beginnt mit einem Worte an die Kinder: »Ihr sollt jede Stunde meines Lebens kennen, damit Ihr mich dereinst erkennen könnt, denn sterbe ich früh, so werden die anderen gar wenig über mich sagen können, sterbe ich alt, so werde ich wohl nur noch zu schweigen wissen. Ihr sollt mir so helfen, meine Pflicht zu erfüllen – ja, meine Kinder, meine Pflicht. Was ich damit meine, werdet Ihr später ersehen. Alles will Euch die Mutter von ihrem gegenwärtigen Leben sagen, denn sie glaubt, daß sie es kann. 1868 ist der äußere Wendepunkt meines Lebens: in diesem Jahre wurde es mir gegönnt, das zu betätigen, was seit fünf Jahren mich beseelt. Diese Betätigung ist nicht nachgesucht, nicht herbeigeführt, das Schicksal hat sie mir auferlegt. Damit Ihr mich versteht, muß ich bis zu der Stunde zurückgreifen, wo ich meinen wahren, innersten Beruf erkannte, wo mein Leben ein wüster, unschöner Traum war, von welchem ich Euch nicht zu erzählen vermag. Denn ich begreife ihn selbst nicht und verwerfe ihn mit der ganzen Kraft meiner jetzt geläuterten Seele. Der Anschein war und blieb ruhig, das Innere war verödet, verwüstet, als das Wesen sich mir offenbarte, durch welches sich mir rasch erhellte, daß ich noch gar nicht gelebt. Eine Wiedergeburt, eine Erlösung, ein Ersterben alles Nichtigen und Schlechten in mir ward mir meine Liebe, und ich schwor mir, sie durch den Tod, durch heiligste Entsagung oder durch gänzliche Hingebung zu besiegeln, das Werk der Liebe zu verdienen, das an mir geschehen ist, wenn ich es jemals entgelten kann. Als die Sterne es fügten, die Ereignisse, die ich anderweitig erfahren mußte, den einzigen Freund, den Schutzgeist meiner Seele, den Offenbarer alles Edlen und Wahren einsam, verlassen, freudlos, freundlos in die Einsamkeit getrieben, rief ich ihm zu: Ich komme zu Dir und will mein höchstes, heiligstes Glück darin finden, Dir das Leben tragen zu helfen. Da trennte ich mich auch von meinen zwei ältesten teuren Kindern. Ich habe es getan und würde es noch jeden Augenblick tun, und doch entbehre ich Euch und denke Eurer Tag und Nacht. Ich liebe Euch alle gleich, in Euren Herzen such' ich das Asyl für mein irdisches Andenken, wenn ich dahin bin, und alles hätte ich Euch aufgeopfert – nur das Leben des Einen nicht. Die Trennung wird vorübergehend sein, und Ihr seid noch so klein, daß Ihr sie nicht empfindet wie die Mutter.«

Cosima Wagner (1870).
Nach einem Gemälde von Franz von Lenbach.
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Erste Seite der Handschrift des »Siegfried-Idylls«.
Photo Paul Pretzsch
Am 27. Dezember deutete sie auch dem König eine große Veränderung in ihrem Leben an. »Es wäre mir unmöglich, dieses Jahr zu schließen und das neue zu beginnen, ohne Ihnen, mein König, den Gruß des Dankes, den Segen der Liebe zu Füßen zu legen. Gleich geheimnisvoll liegt hinter uns das vergangene, vor uns das kommende Jahr – wer wäre so vermessen, so baldige Deutung dem Guten wie dem Schlimmen, das ihn befallen, zu geben? wer so kühn, die Erreichung dieses oder jenes Zieles sich zuzusagen? Über diese Dunkelheit herrscht einzig die Leuchte der Liebe; nach welcher Seite auch die Fackel gewendet wird, das Licht hebt sich empor und steigt gen Himmel – sagt ein indisches Sprichwort. Wie auch die Fackel meines Lebens … geschwungen wird, hoch und rein wird die Flamme der Liebe zu Ihnen, mein freundlicher Herr, schimmern, und erhellte diese Flamme nur noch das eigene Herz! Haben Sie doch ihn geliebt, dem ich mein Leben geweiht, und den Glauben gehegt, der meine Seele verklärt.«
Das neue Jahr weihte Cosima damit ein, daß sie Wagner veranlaßte, in seinen Erinnerungen fortzufahren. Zum Nachschreiben benützte sie die goldene Feder, mit der er »Tristan« und »Siegfried« geschrieben hatte. Mit dieser wollte sie fortan auch ihr Tagebuch führen. Darin wendet sie sich vor allem an die Kinder. »Seid gesegnet, Ihr fernen, Ihr nahen und Du auch, mein unbekanntes, das noch im Schoße ruht. Die Liebe Eurer Mutter, sie ist Euch ein freundliches Leuchten durch das Leben. Verkennt die Mutter nicht, wenn Ihr auch niemals wie sie handeln werdet. Denn das Schicksal hat ihr etwas gefügt, das sich nicht wiederholt.«
Es ist bemerkenswert für die hohe Schätzung, die Cosima bei allen Bekannten genoß, daß der in den Augen der Welt doch sehr gewagte Schritt, den sie unternommen, das Zusammenleben mit dem Einsiedler von Triebschen, sie keineswegs zur Aufgabe ihrer freundschaftlichen Beziehungen nötigte. Nicht weit von Triebschen, am anderen Ufer des Sees, wohnten Graf und Gräfin Bassenheim, die früher in München ein tonangebendes gastliches Haus geführt hatten. Besondere Verhältnisse hatten sie veranlaßt, dem städtischen Treiben Lebewohl zu sagen und sich mit dem Vater der Gräfin, dem Fürsten Oettingen, am Luzerner See niederzulassen. Mit diesem Paare hielten Wagner und Cosima regen Verkehr. Auch die besten Freundinnen der Berliner Zeit standen ihnen unverändert nahe, so die Freiin Marie von Schleinitz, Gemahlin des preußischen Hausministers, die schon in ihrer Mädchenzeit, als Fräulein von Buch, eine warmherzige, innig verstehende Verehrerin des Meisters war, und Frau von Kalergis-Muchanow, der eben jetzt die zweite Auflage des »Judentums in der Musik« gewidmet wurde. Cosima, die noch nicht wußte, wie sich ihre äußere Lage gestalten werde, wurde durch Briefe und Besuche von draußen eher gestört. »Nur von Euch, meine lieben Kinder, will ich noch geliebt und gekannt sein.« Und mit dem Gedanken an die Kinder war der an Hans beinahe untrennbar verbunden. An seinem Geburtstage schrieb sie: »Ich wünsche, daß er denselben in friedlicher, versöhnter Stimmung begehe, kann ich auch nichts dazu beitragen. Es war ein großes Mißverständnis, das uns ehelich verband, das Gefühl, das ich damals vor zwölf Jahren für ihn empfand, ich empfinde es noch, große Teilnahme für sein Schicksal, Freude an seinen Geistes- und Herzensgaben, bei vollständigem Auseinandergehen der Anlagen. Gleich die ersten Jahre meiner Ehe war ich so verzweifelt über die Konfusionen, daß ich sterben wollte. Viele Irrtümer entstanden aus meiner Not, doch ermannte ich mich stets wieder, und Euer Vater hat nichts geahnt von meinem Leiden, und er wird mir, glaube ich, das Zeugnis nicht versagen, daß ich ihm in Leid und Freud beigestanden und daß ich ihm nach Kräften geholfen habe. Niemals würde er mich verloren haben, wenn das Schicksal mir nicht denjenigen zugeführt hätte, für welchen zu leben und zu sterben ich als meinen Beruf erkennen mußte. Nicht einen Vorwurf habe ich Eurem Vater zu machen, wenn auch die letzten Jahre mir schwer wurden über die Maßen. Ich habe es versuchen wollen, meine bisherige Existenz mit meinem neuen Leben zu verbinden, ich habe an die Möglichkeit geglaubt, an eine Verschmelzung der verschiedenartigsten Gefühle. Schmähungen und Kränkungen haben mir bewiesen, daß ich eine Törin sei, und mir blieb nur die Wahl und das Weh.«
Mancherlei Sorge und Furcht beunruhigte sie jetzt. Es war ungewiß, wie der König, der zum Jahreswechsel einen Glückwunsch geschickt hatte, der aber noch nicht wußte, daß Cosima ihren Wohnsitz in Triebschen genommen, über diese neue Lebensform denken würde. Wagner erwog den Gedanken, ob es nicht schicklich sei, auf sein Jahresgehalt zu verzichten. Liszt, der wieder in Deutschland weilte, hüllte sich in Schweigen, und von Marie d'Agoult kamen betrübende Nachrichten: sie war schwer erkrankt und konnte sich nur langsam erholen. Die Gräfin Charnacé schien nun Hans besonders nahe zu stehen: er hatte gegenwärtig keinen anderen Vertrauten als sie; ihr gegenüber sprach er brieflich seine wechselnden Empfindungen aus, ihr offenbarte er die Zerrissenheit seines Gemütes. Es ging nicht nur um sein Los, sondern auch um das seiner Töchter Daniela und Blandine, die jetzt ohne Mutter waren. Im übrigen war es ihm unerträglich, daß er der Welt die Wahrheit verbergen sollte, und er wünschte, daß seine Frau wirklich nach Versailles gehe, um dort den weiteren Gang der Dinge abzuwarten. Wagner aber geriet in höchste Erregung bei dem Gedanken an erneute Trennung. Unmittelbar nach der bezüglichen Eintragung in Cosimas Tagebuch stehen die Worte: »Erhabenste Stimmung um mich und in mir, in meinem Schoße regt sich das Ungeborene, ich segne es. Möge sein Geist klar und mild sein wie dieser strahlende nächtliche Himmel, erhaben und ruhig wie der in seinen schneeigen Mantel gehüllte Berg, möge sein Gemüt tief und friedlich sein wie diese leicht gekräuselten Wellen, möge er als unbeweglich die dunkle Finsternis zu seinen Füßen gelegt betrachten, wie der dunkle Wald zu Füßen des Berges, während die Höhe in Licht sich badet. Mögen es künftige Geschicke zart bescheinen. Möge es der Mutter ewig in Liebe gedenken, die es in Liebe trug.«
Diese liebende Hoffnung beherrschte sie neben der gläubigen Liebe an Wagner. Im übrigen ging das Leben auf Triebschen ruhig seinen Gang. Die Feierstunden des Abends waren vornehmlich der gemeinsamen Vertiefung in große Dichter, auch in die Edda, gewidmet. Mehr noch als durch die erhabenen Gegenstände war Cosima von der Art ergriffen, in der Wagner sie damit bekannt machte. »Mich erfreut vor allem der Anblick seines Gesichts, wenn er mir gegenübersitzt, sein Auge dunkel wird und strahlt und seine klangvolle Stimme mein Herz erschüttert.« Manchmal wird sie von diesem Eindruck seiner Persönlichkeit förmlich überwältigt. »Ich kann gewisse Empfindungen, von seiner Stimme ausgedrückt, nicht hören, ohne daß mein Inneres erbebt, und ich muß ihn dann ansehen, muß in meiner Seele erkennen, wie unwert ich seiner bin, und ihm die Treue schwören, die mit Jubel alle Leiden trägt und nie schwanken kann.« In demselben Sinne schreibt sie: »In den Kot werden sie uns ziehen. Gerne will ich alles erleiden, nur um an seiner Seite zu stehen. Bis in die späteste Nachwelt sollen sie mich verunglimpfen, habe ich nur ihm geholfen, habe ich nur ihm die Hand reichen dürfen und ihm sagen: ich folge dir bis in den Tod. Mein einziges Gebet ist, mit Richard dereinst in derselben Stunde zu sterben. Mein höchster Stolz, alles von mir gewiesen zu haben, um ihm zu leben.«
Immer wieder beschäftigt sie sich auch mit ihrem Verhältnis zu Bülow und überblickt die Jahre ihrer Ehe. Sie erinnert sich dabei an die Geburt ihrer zweiten Tochter: »Wie stumm und dumpf wurde das Kind von seinem Vater empfangen. Einzig war in der Ferne Richard um mich besorgt, und ich wußte es nicht, wie öd, wie leer, wie innerlich zerstört damals mein Leben war. Wie könnte ich es Richard jemals genügend danken, was seine Liebe an mir vollbracht, so elend fühlte ich mich damals. Ich wagte es Hans kaum zu sagen, so unfreundlich nahm er es auf, gleichsam wie eine Störung seines Behagens. Niemand habe ich jemals dies gesagt. Jetzt schreibe ich es auf, nicht um Hans anzuklagen – die Mühsale des Lebens waren für ihn groß, und er hat nicht gewußt, was einer Frau wohl und wehe tat, da ich immer geschwiegen –, sondern weil ich mit Grauen an diese Nacht in Berlin denke und mir die Erfüllung meines Schicksals an mir recht begreiflich wurde.«
Inzwischen war Bülow, der nun wieder seine Mutter bei sich hatte, zur rechten Einsicht in betreff seiner Töchter gekommen. Franziska von Bülow war begreiflicherweise jetzt gegen Cosima eingenommen, und es macht Bülow um so größere Ehre, daß er alle seine Entschließungen selbständig faßte und nur seinem Herzen folgte, dessen Regungen in diesem Falle mit jeder vernünftigen Überlegung zusammenstimmten. Durch ihre Stiefschwester erfuhr Cosima zuerst, daß Hans bereit war, Daniela und Blandine, die ohne Mutter nicht mehr gedeihen konnten, ihr zu überlassen. Am 8. April nahm sie die Kinder in Zürich in Empfang, und gleichzeitig erhielt Wagner, dessen brieflicher Verkehr mit Hans durch die Ereignisse niemals unterbrochen worden war, wenn er sich auch auf künstlerische Dinge und berufliche Angelegenheiten beschränkte, ein Schreiben Bülows, das beinahe wieder die alte Herzlichkeit atmete: »Heut abends siehst Du meine Kinder. Ich habe sie leider – auch war das Wetter scheußlich – nicht auf die Bahn bringen können. Der Abschied von ihnen tat mir weh – so selten ich sie gesehen habe, so sind sie mir doch ungeheuer lieb geworden, weil sich ihr ursprünglich seelenguter Charakter so fortdauernd bewährt. Die Mutter wird, denke ich, mit ihnen zufrieden sein, und ich gönne ihr die Freude von Herzen. Meine Mama verläßt mich nun auch in einigen Tagen … Dann bin ich völlig einsam geworden, d. h. freundeseinsam. Feindeseinsam wäre mir lieber.« Und am Schlusse: »Von ganzem Hirn Dein ergebener –.« Also wollte er das Herz doch nicht mehr so laut mitsprechen lassen. Einige Tage später schrieb er an Jessie Laussot, wobei er auch auf die Schriften Wagners über das Judentum in der Musik und über Eduard Devrient Bezug nahm: »Da ich meine Kinder nach Luzern gesendet habe, wo seit Anfang dieser Monate auch meine Frau von Versailles her eingetroffen ist, um dem sehr einsamen Maëstro (der sich durch seine neuen Broschüren gewissermaßen die Möglichkeit, mit der Welt zu fraternisieren, abgeschnitten hat) Gesellschaft zu leisten, so bin ich jetzt mutterseelenallein und demnach etwas melancholischer als sonst. Ihre gütige Teilnahme für mich möge sich bei dieser Erklärung meiner durchscheinenden Stimmung beruhigen.«
Hieraus entnehmen wir, daß Bülow den angeblichen Aufenthalt seiner Frau in Versailles nicht mehr aufrechthielt. Auch der König war nun über die Sachlage, über die er bis dahin noch im unklaren geblieben war, vollständig unterrichtet. Cosima selbst machte ihm »Mitteilung der ganzen Lage«. Am selben Tage beschloß sie ihr Tagebuch mit den Worten: »Gute Nacht, meine Kinder! Gute Nacht, mein Geliebter! Gute Nacht, armer Hans! Wenn Tränen etwas bei der Gottheit wert sind, so müßt Ihr alle noch beruhigt werden, denn ich habe gar schmerzlich um Euch geweint.« Eben daß sie nun mit allen ihren Kindern vereint war und daß die beiden ältesten Töchter naturgemäß oft vom Vater sprachen und mit Hilfe der Mutter häufig Briefe an ihn richteten, lenkte ihre Gedanken immer wieder auf den Gatten, dem sie zwar wenig gewesen sei – »doch wie schwer fällt es mir, ihm das wenige zu entziehen«.
Um diese Zeit entstand der dritte Aufzug des »Siegfried«, dessen mächtig leidenschaftliche, von jauchzender Begeisterung getragene Musik uns die neuen Kräfte und das selige Empfinden in der Brust des Meisters ahnen läßt. Cosima, die an diesem Aufzug um so ergriffener Anteil nahm, als der Meister hier Themen verwendete, die er in der Starnberger Zeit, in seinem ersten heiligen Liebesglück, erfunden hatte – verfiel in eine schmerzlich erhabene Stimmung, in der sie auch die folgenden Worte schrieb: »Ich erkenne, daß, wenn der Tod mir jetzt nahte, ich mich nicht grämen würde. Daß ich Hans verlassen, dünkt mich grausam. Ich muß mir dann sagen, wenn ich diese Grausamkeit auch empfinde, so ist es deutlich, wie eine Gottheit in mir waltet, die mich bestimmt hat, und daß nicht ich gewollt und gewählt habe. Aber ich verdenke es keinem Menschen, der nicht sieht, wie ich sehe, und nicht den Glauben hat, den ich habe, der mich verdammt. Gern und leicht will ich den Abscheu der Welt ertragen. Hansens Leiden aber benimmt mir jede Freude.«
Am 22. Mai, als Wagner sein 56. Jahr vollendete, erlebte er eine wundervolle Überraschung. Am Morgen weckte ihn die Waldweise Siegfrieds aus dem zweiten Aufzug, auf dem Horn geblasen von Hans Richter, der eigens für einen halben Tag aus München gekommen war. Als Wagner zum Frühstück in das Wohnzimmer trat, das in einen Blumengarten verwandelt war, begrüßten ihn die vier Mädchen, als Friedensboten (aus »Rienzi«) gekleidet, und die beiden Ältesten sprachen altgriechische Gedichte zur Feier des Frühlings. Dann aber kam das Schönste. Cosima, welche wußte, wie sehr Wagner die letzten Quartette Beethovens bewunderte und ihren Vortrag durch das Pariser Streichquartett Morin-Chevillard schätzte und wie schwer er den »Eindruck einer edlen Musikaufführung« in den Triebschener Jahren entbehrte, hatte das genannte Quartett für einen Tag herbeigerufen, damit es ihm die »altgeliebtesten Werke« einmal wieder lebendig vorführe. Er war gerührt und erschüttert. Zufällig kam auch ein Pariser Verehrer, Edmund Schuré, der schon dem »Tristan« und den »Meistersingern« in München beigewohnt hatte, mit seiner jungen Frau, einer deutschen Pfarrerstochter aus dem Elsaß, um seine Geburtstagswünsche darzubringen. Wagner, der sich eigentlich vorgenommen hatte, den Tag nicht festlich zu begehen, verbat sich nun wenigstens bei Tische, daß dieses Tages ausdrücklich gedacht werde, und ließ nur den König leben.
Der freundliche Traum dieses Festes war für Wagner um so wohltätiger, als er eben damals wieder schweres Ungemach in München zu erleiden hatte. Der König hatte die Wiederaufführung des »Tristan« und – die Aufführung des »Rheingold« befohlen. Für den »Tristan« standen diesmal keine so erlauchten Sänger wie 1865 zur Verfügung. Auch fehlte die Mitwirkung Wagners bei den Proben. Dieser lehnte sich daher gegen den Befehl des Königs auf und erwartete von Bülow, daß auch er sich weigern werde, die Leitung zu übernehmen. In dem letzten der bisher bekanntgewordenen Briefe Wagners an Bülow wird die Frage sehr ernstlich berührt. Dabei geht der Briefschreiber nicht an den persönlichen Dingen, die nach Klärung verlangten, vorbei. »Lieber Hans«, so schreibt er, »ich bin entschlossen, Dich zu besuchen. Melde, ob es Dir recht ist. Muß es mir auch sehr zweifelhaft dünken, ob eine Unterredung mit Dir in irgend etwas behilflich sein kann, so hast jedoch nur Du über deren Wünschbarkeit zu entscheiden. – Zu allernächst hättest Du nach meinem Rate nur eines zu tun: Dich auf das bestimmteste zu weigern, den ›Tristan‹ mit der beliebten Besetzung der Hauptrollen zu geben, dagegen Deine Entlassung strikte einzureichen. So würde ich es von jedem Kapellmeister verlangen, sobald es einfach nach dem Ehrenpunkte ginge. Da ich in betreff der Münchner Kunstangelegenheiten völlig als nicht mehr existierend betrachtet sein will, konnte ich auch in diesem Falle nur indirekt den König ersuchen lassen, meinem Werke nicht die zugedachte Schmach anzutun. Mein Wunsch hat keine Beachtung gefunden.« Des weiteren spielte Wagner darauf an, daß Bülow vermutlich ohnehin den Wunsch hege, seine Münchner Stellung zu verlassen, und daß er in diesem Falle »die gerechteste und plausibelste Veranlassung zu einem Bruch erhielte«. Wagner selbst könne beim Könige »nur durch die Motivierung der moralischen Veranlassungen« um die Enthebung Bülows einkommen. »Zu allem bin ich bereit. Jedenfalls, wenn Du mich zu sprechen wünschest, hast Du keinerlei Versuche zu irgendwelcher Überredung zu befürchten. Wir sind alle unglücklich genug, um uns über nichts mehr zu täuschen, da wir uns nicht mehr helfen können. R. W.« Dies war die Antwort auf einen Brief Bülows, worin dieser sich als »sehr unglücklich« bezeichnet hatte.
In einer Nachschrift betonte Wagner noch einmal, daß er an Bülows Stelle »als Kapellmeister in diesem Falle der Verhunzung eines Werkes wie ›Tristan‹ den Taktstock hinwerfen würde«. Bülow war ausnahmsweise anderer Ansicht. Er fand die Hauptdarsteller, das Sängerpaar Heinrich und Therese Vogl, nicht so ungenügend, wie Wagner annahm, und setzte anderseits seine Ehre darein, als musikalischer Leiter das Werk in vollem Glanze erstehen zu lassen.
Abermals hatte Wagner das niederdrückende Gefühl, daß der König bloß nach seiner Musik verlange, ohne die Güte der Darstellung und selbst nur der rein musikalischen Aufführung entsprechend zu würdigen. Um so inniger freute er sich der näheren Bekanntschaft mit dem jungen Philologen Friedrich Nietzsche, den er bei seinem letzten Besuch in Leipzig kennengelernt und schon damals zu einem Besuch in Triebschen aufgefordert hatte. Nun war Nietzsche seit kurzem Universitätsprofessor in Basel und kam zu Pfingsten zum ersten Male nach Triebschen herüber, wo er dann das ganze Jahr hindurch ein oft erscheinender und stets gern gesehener Gast war. Alles, was er sagte und schrieb, sowohl in seinen Briefen an Wagner und an Cosima, wie auch in seinen für den Druck bestimmten Reden und Aufsätzen, alles erschien ihnen so »schön und bedeutend«, und sie spürten auch soviel ehrliche Begeisterung in dem Wesen des jungen Mannes, daß Wagner mit Recht das Gefühl hatte, hier sei ihm endlich nicht aus dem Kreise der Musiker, sondern aus dem der Schriftsteller und Gelehrten ein wahrhaft verstehender Jünger zugewachsen, ein Jünger, der namentlich durch seine über alle philologische Kleinkrämerei weit hinauswachsende Kenntnis und Erkenntnis der Antike sich als Geistesverwandter des Künstlers erwies und dessen Auffassung von der Tragödie und von einer Kultur, die durch sie erst die rechte Weihe erhalte, die kräftigste wissenschaftliche Stütze zu geben versprach. Nietzsches Schwester, Elisabeth Förster, hat uns die Zeugnisse davon überliefert, wie sehr der junge Gelehrte den Verkehr mit Wagner und mit Cosima als eine Bereicherung und als ein Glück empfand.
Als er zum zweiten Male kam und auch in Triebschen übernachtete, wurde am 6. Juni 1869 um vier Uhr morgens ein Sohn geboren. Die aufgehende Sonne und das Frühgeläute der Sonntagsglocken von Luzern weihten den Tag. Cosima hat ihrer Ergriffenheit im Tagebuche Ausdruck gegeben. »Ein Sohn Richards ist der Erbe und einzige Vertreter des Vaters seiner Kinder. Er wird der Schützer und Geleiter sein seiner Schwestern.« Doch es trat vor allem wieder die Gestalt des Meisters in den Mittelpunkt, als eine Woche später die Musik zum Drama »Siegfried« vollendet war. »Jetzt ist unser Kind erst geboren«, meinte Wagner, und wer von diesem zeitlichen Zusammentreffen weiß, der wird den Jubel des Schlußgesanges noch besser verstehen. Nun war es ausgemacht, daß auch der Sohn Siegfried heißen solle.
Auf ihrem Wochenlager hatte Cosima auch einen an Hans zu schreibenden Brief überlegt, worin sie ihm ihr früheres, ihr jetziges und ihr künftiges Verhältnis zu ihm darzulegen suchte. Sie bat Gott, ihr das Richtige einzugeben, und wurde damit belohnt, daß der Brief, nachdem er abgegangen, sofort und in einer Weise beantwortet wurde, die dem Herzen Bülows die größte Ehre macht und die nun alles zum Guten lenkte. Zwei Tage vor der Wiederaufführung des »Tristan« schrieb Hans an seine Frau:
»Liebe Cosima, ich danke Dir, daß Du die Initiative ergriffen hast, und ich werde Dir keinen Grund geben, es zu bedauern. Ich fühle mich zu unglücklich – durch meine eigene Schuld –, um nicht jeden ungerechten Vorwurf vermeiden zu wollen, der Dich kränken könnte. Während der sehr grausamen Trennung, zu der Du Dich für verpflichtet hieltest, erkannte ich alles Unrecht, das auf meiner Seite ist, und ich werde es bei den unvermeidlichen Erörterungen des Gegenstandes mit meiner Mutter und Deinem Vater stets auf das nachdrücklichste unterstreichen. Ich habe Dir sehr schlecht, sehr böse gelohnt für all die Aufopferung, die Du mir in unserem vergangenen Leben so verschwenderisch dargebracht hast. Ich habe Dein Leben vergiftet, und ich habe nur der Vorsehung dafür zu danken, daß sie Dir ein nicht tödliches Gegengift gab im vorletzten Augenblick, ehe Du den Mut zur Fortsetzung Deines Frondienstes verlieren mußtest. Aber leider – seitdem Du mich verlassen hast – fehlt mir mein einziger Halt im Leben, im Lebenskampfe. Dein Geist, Dein Herz, Deine Freundschaft, Deine Geduld, Deine Nachsicht, Dein Verständnis, Deine Ermutigungen, Deine Ratschläge – endlich und vor allem Deine Gegenwart, Dein Blick, Dein Wort – alles das bildete meinen Lebenshalt. Der Verlust dieses höchsten Gutes, dessen ganzen Wert ich erst nach dem Verlust erkannte, ließ mich zusammenbrechen, menschlich und künstlerisch – ich bin ein Schiffbrüchiger. Glaube nicht, daß diese Klage – ich leide genug, um mir auch eine Klage gestatten zu dürfen, um so mehr, als ich niemand anklage als mich selbst –, glaube nicht, daß eine Ironie oder eine Schärfe gegen Dich darin enthalten sei.
Du hast es vorgezogen, Dein Leben und die Schätze Deines Geistes und Herzens einem weit höheren Dasein zu widmen – weit entfernt, Dich darob zu tadeln, billige ich es unter allen Gesichtspunkten, gebe ich Dir vollständig recht. Ich schwöre Dir, der einzige tröstende Gedanke, der bisweilen ein wohltätiger Strahl in meiner inneren Finsternis und meinen äußeren Widerwärtigkeiten gewesen ist, war dieser: wenigstens ist Cosima hienieden glücklich.
Es schien mir notwendig, meinen persönlichen Erklärungen diese einleitenden Worte vorauszuschicken, für die ich den Titel oder vielmehr die Eigenschaft eines absoluten Glaubensbekenntnisses in Anspruch nehme. Nunmehr muß ich (zum letzten Male) um Deine Nachsicht bitten, wenn die folgenden Erklärungen sich weder durch vollkommene Klarheit noch durch korrekte Haltung auszeichnen. Verzeih – ich bin genötigt, mich wie ehemals meiner Geschäftigkeit zu rühmen (der hat aber viel zu tun, dieser Sakristan – sagte Dir einmal Lulu in der Kirche).
Heute und morgen von 9 bis 2 Uhr Orchesterprobe zu ›Tristan‹, von 3 bis 6 Uhr Musikschule – Briefe, Besuche etc., dabei eine körperliche Schwäche, die mich zwingt, jeden zweiten oder dritten ganzen Tag im Bette zu bleiben, ohne irgend etwas zu tun.
Ich habe vor acht Tagen meine Demission gegeben, das ist richtig. Der Grund, den ich vorangestellt habe – ist meine zerrüttete Gesundheit. Alle Welt begreift das, Rubner – ich könnte ihm jetzt noch mehr Grundlagen bieten – hat mir schon vor zwei Monaten ein Zeugnis ausgestellt. Die Intrigen, die Verleumdungen, die Hindernisse, der böse Wille, endlich die kleinen Ärgernisse und die ›dispiaceri‹ sind von Monat zu Monat nur gewachsen. Da in Deiner Abwesenheit (der Ersatz durch meine Mutter – ich habe es nicht nötig, mich darüber zu ergießen), da in Deiner Abwesenheit jedes Gegengewicht fehlte – hat meine moralische und physische Kraft, meine Lust, ein Spiel fortzusetzen, das nicht den geringsten Einsatz wert war, im umgekehrten Verhältnis abgenommen. Die paar Satisfaktionen – die ich vielleicht registrieren kann – bilden keine ernste Entschädigung und sind mir keine Ermutigung zur Fortsetzung. Die Arbeit für den König von Bayern trägt mir 4000 fl. im Jahr (ich habe nie eine Erhöhung meines Gehaltes ins Auge gefaßt) und läßt mich nicht auf meine Kosten kommen. Ich habe die feste Überzeugung gewonnen, daß eine weitere Erfüllung meiner hiesigen Pflichten, ein verharren auf meinem hiesigen Platze – der guten Sache, der Kunst zugleich, gar keinen Nutzen brächte und nicht zuletzt aus diesem Grunde mich im Zeitraume eines Jahres, vielleicht zweier Jahre, vollends zugrunde richten würde. Andererseits, meine Stellung krankt an der Wurzel – ich werde eigentlich nur als der Günstling eines Königs betrachtet, und die Meinung, daß ich mir diese Stellung eines Günstlings durch meine Gefälligkeiten als Ehemann erworben habe, ist sehr verbreitet. Klindworth würde trotz seines Mangels an Ruf und selbst wenn er nur die Hälfte meiner Fähigkeiten, meiner Intelligenz, meiner Begabung besäße – was aber nicht der Fall ist – ich betrachte ihn als mir fast gleichwertig – er würde weit mehr Aussicht haben, hier Gutes zu wirken und sich nützlich zu machen als der gegenwärtige Demissionär. Laß mich noch beifügen, daß die gewaltsame Beschäftigung mit diesem unglücklichen Riesenwerk, dem Tristan – mich buchstäblich kaputt gemacht hat. Die öffentliche Aufführung wird am Sonntag stattfinden, ich übernehme dafür die Verantwortung, es wird keine Entweihung sein – ich schrieb darüber unlängst an Wagner – und sie wird mich zum letzten Male an der Spitze des Orchesters sehen. Mein Münchner Aufenthalt wird dort enden, wo er angefangen hat (mehr circulus fatalis als vitiosus) und wird es mir erleichtern, später die ganze Kette der Ereignisse und meiner Leiden (der Strafe für meine Verfehlungen gegen Dich), die zwischen den Darstellungen desselben Werkes im Abstande von vier Jahren liegt, wie – einen schweren Traum anzusehen.
Jawohl, ohne Vorwurf für den Schöpfer des gewaltigen Werkes, der Tristan hat mir den Gnadenstoß gegeben. Ich habe nicht so starke Nerven wie Du, die lange Jahre hindurch das hoffnungslose Zusammenleben mit einem so übel geborenen aber so schlecht erzogenen Menschen wie ich ertragen konnte und die diese Buße überlebt hat. Der arme Eberle (von Richter empfohlener Korrepetitor) ist während der Proben verrückt geworden – durch das Werk – (dem Publikum sagen wir: durch unmäßigen Biergenuß) – was mich betrifft, der ich bekenne, daß mir bei meiner häufigen Absicht, mir das Leben zu nehmen, stets der nötige Mut gefehlt hat, ich versichere Dir, daß ich der Versuchung nicht hätte widerstehen können, wenn mir jemand ein paar Tropfen Blausäure gereicht hätte!
Die Versuchung ist ausgeblieben und so sehr ich das verwünsche, so kann ich doch nicht umhin, die schreckliche Kraft des Willens zum Leben wahrzunehmen, die in mir vorhanden ist. Aber wie soll ich ihr genugtun, als indem ich eine Stadt verlasse, die seit Deiner Abwesenheit für mich zur Hölle geworden ist, und indem ich, noch weiß ich nicht wo, aber anderswo ein neues Leben beginne?
Diese Trennung von Dir – Du hattest keine andere Wahl, denke stets an den Beginn dieser Zeilen – sie muß vollendet werden. Ich muß mich von allem trennen, was zu Dir und zu Richard Wagner gehört – da mein vergangenes Leben nur diese beiden Leitsterne hatte (ich könnte noch die Person Deines Vaters hinzufügen) – muß mich von Euch sogar in Gedanken trennen, soweit das einem Menschen möglich ist. (Ergib Dich keinem Mißverständnis: ich schlage Dir keineswegs den éclat und die Verdrießlichkeiten einer Scheidung vor. Wenn Dein Vater dieser Meinung ist, wenn er es vorzieht, daß Deine Vereinigung mit dem Leben Richard Wagners diese offizielle Bestätigung erhalte – ich habe dem meinerseits nichts entgegenzuhalten. Aber da ich, wie Du Dir wohl denken kannst, nicht die Lust, nicht die Absicht oder den Wunsch habe, mich wieder zu verheiraten, so habe ich keinen Grund, die Scheidung vorzuschlagen, um dies zu ermöglichen. Andererseits überlasse ich Dir unsere Kinder, überlasse ich ihre Erziehung Deiner Leitung, da ich finde, daß diese die beste ist, die sie erlangen können, und da ich vollkommen Deine Ansicht teile, daß es unmöglich wäre, sie meiner alten Mutter oder irgendeinem Gliede meiner Familie (wenn ich von Familie sprechen könnte) anzuvertrauen – und wenn Dein ausgezeichnetes Herz bereit ist, die Kinder zu erziehen, trotz aller Abneigung und alles gerechten Grolls, die Du gegen ihren Vater hegst – so weiß ich nicht, warum ich Dir nicht meinen Namen lassen soll. Ich finde, daß es klein und der Situation nicht würdig wäre – wenn ich mich zum Ausdrucke einer Empfindlichkeit hinreißen ließe, die gegenüber Deinen aufopferungsvollen Vorschlägen leicht falsch gedeutet werden könnte. Gestatte mir, daß ich diese mit Bestimmtheit einfach und kurz beantworte:
Das Jahrgeld Deines Vaters (sowie das Deiner Mutter) gehört den Kindern. Da Du ihre Erziehung leitest, so müssen Deine 6000 Francs nach Recht und Vernunft für diese Erziehung verwendet werden. Der Genosse Deines gegenwärtigen und künftigen Lebens wird es wohl auf sich nehmen, die Ersparungen, die Du bei dieser Summe machen kannst, entsprechend anzulegen. Dein eigenes Vermögen, das Du in unsere traurige Ehe mitgebracht hast – war es nicht für mich, der sich seiner Armut schämte, der erste Stein des Anstoßes, die erste Verwirrung meines Pflichtgefühls, ja meiner Liebe? Ich kann die Last nicht von mir nehmen, daß ich der finanzielle Vormund der Kinder sein soll mit Hilfe Deines Geldes. Was ich von meiner Seite (im Augenblick) ihnen zusichern kann, das ist nur das kleine Vermächtnis der Tante Frege (5000 Taler – die im Hause Frege selbst placiert sind), das sich, wenn ich Chance habe, bis zu ihrer Großjährigkeit verdoppeln könnte.
Du wirst die Gnade haben – ich bitte Dich innigst darum – es ebenso zu verstehen, daß ich unser ganzes Ameublement nur als Dein persönliches Eigentum betrachten kann. Wenn ich von hier abgehe, und das wird (wie ich hoffe) am 1. August sein, werde ich nur über einige Gegenstände verfügen, die zweifellos mir gehören – wie meine Kleider, Bücher und Musikalien – und das übrige in unserer Wohnung lassen, deren Miete am 1. Oktober abläuft. Durch Vermittlung der Mrazek kannst Du Deine Anordnungen ausführen lassen, einen Teil verkaufen oder nach Triebschen schicken oder endlich die Möbel usw. im Lagerhaus aufbewahren und versichern lassen, die wir nach unserer übereinstimmenden Willensmeinung als Eigentum der Kinder betrachten.
Indem ich München und womöglich Deutschland verlasse, sind meine Zukunftspläne in nichts bestimmt (andererseits würde ich mir nicht die Freiheit nehmen, Dich damit zu langweilen), und ich räume ihnen nur einen sehr untergeordneten Rang ein. Das Wesentliche, das Dringende, ist für mich, davonzukommen – ich wünsche lebhaft, so wenig als möglich von all dem mitzunehmen, was mir die Vergangenheit, das alte Leben zurückrufen könnte, denn nur, wenn ich endgültig und gründlich mit diesem breche, kann ich die Perspektive einer neuen Existenz ins Auge fassen. Nur von einer Sache, einer einzigen, will ich mich nicht losmachen, von der dankbaren Erinnerung an alles, was Du für meine künstlerische Entwicklung getan hast. Ich werde Dir stets danken für die Wohltaten, die Du mir in dieser Hinsicht erwiesen hast.
Gestatte mir, Dich einigermaßen (soweit es notwendig sein sollte) über die Art und Weise, wie ich München verlassen werde, zu beruhigen. Ich werde in der Musikschule bis zum Ende des Schuljahres bleiben – ich werde mir noch die Langweile und die Mühe der Prüfungen auferlegen, wenn meine Beine und mein Kopf es nicht zu hartnäckig verweigern. Die Oper hat während des Juli Ferien. Anfang August (oder vielleicht schon früher) wird Richter mit dem Studium des Rheingold beginnen – ich habe ihm auch die nächste Aufführung der Meistersinger für den 27. dieses Monats überlassen. Sobald das Konservatorium geschlossen ist (im August) gehe ich auf Urlaub. Düfflipp hat mich im Namen des Königs gebeten, mir meine Demission zu überlegen und sie womöglich zurückzunehmen, und bot mir einen unbestimmten Urlaub bis zur Wiederherstellung meiner Gesundheit an. Da dies, diese Wiederherstellung, sich nicht im Zeitraume von zwei Monaten vollziehen kann (ich werde vielleicht ein Jahr brauchen), so werde ich meine Demission definitiv am 1. Oktober geben, indem ich einstweilen den Urlaub annehme, den Seine Majestät mir bewilligen will. Auf diese Art werde ich mit so wenig Lärm als möglich davongehen, ohne die Fenster einzuschlagen. Tu mir nicht das Unrecht an (Richard Wagner, fürchte ich, wird da kein Bedenken tragen) und glaube nicht, daß ich Komödie spiele und daß der Platz, auf dem ich mich eingelebt habe, und das sichere Einkommen meine Meinung ändern und mich in eine der denkbar parodistischesten ›Heimaten‹ zurückführen werden. Trotz der Adressen der Konservatoriumsschüler, der höflichen Briefe von Rheinberger, Wüllner und einiger rührender Beweise der Anhänglichkeit einiger Orchestermitglieder fühle ich mich nicht stark genug, um hier von neuem anzufangen. Ich würde die Stellung eines Klavierprofessors in einer kleinen Stadt tausendmal vorziehen. Mit einem Perfall als Chef etc. kann man nur Handwerk treiben, u. zw. ein Handwerk, bei dem man nach und nach alle seine Fertigkeiten einbüßt. Ich will nicht alles aufzählen, was mir im Laufe des letzten Jahres abhanden gekommen ist. Und nicht eine Freundesseele – doch sei ruhig, ich höre schon auf zu krächzen.
Erinnerst Du Dich, daß ich genau wußte, was sich ereignen wird, nachdem Du mich verlassen hattest? Erinnerst Du Dich, daß ich nur mit Dir nach München zurückkehren wollte? Wahrhaftiger Gott, ich sage Dir das nicht, um Dir einen nachträglichen Vorwurf zu machen. Es war Dir unmöglich, hier zu bleiben – ich verstehe es, ich verstehe es nur zu sehr. Auch will ich nur – um zusammenzufassen – die scheinbare Schroffheit meines Entschlusses, der Tag für Tag seit Deinem Scheiden schmerzlich gereift ist, in Deinen Augen mildern. Meine Aufgabe ging über meine Kräfte, da diese (die moralischen und die physischen) seit einiger Zeit beträchtlich gesunken sind – ich bin in Arbeit untergetaucht, um Vergessen zu finden – umsonst, besonders nachdem die Illusionen vom Nutzen dieser Arbeit (der mir die äußere Genugtuung verschafft und so auch die innere Ruhe gebracht hätte) nacheinander geschwunden sind. – Also ich gehe in den ersten Tagen des August. Ich habe meine 2000 Reichstaler von Bechstein zurückgefordert, mit denen ich ruhig und sorglos ein Jahr lang leben kann. Habe ich bis dahin meine Gesundheit, die Herrschaft über mich selbst wiedererlangt, werde ich schon etwas finden, um mir irgendeine Existenz zu schaffen, bei der ich nicht an irgendeine Abhängigkeit gefesselt bin – ich werde indessen keineswegs vergessen, daß die Stelle, die Wagner mir in München verschafft hat, die Quelle einer anderweitigen Stellung gewesen sein wird – aber dieses Gefühl der Abhängigkeit kann ich einigermaßen hinnehmen. –
So, da hast Du einen Brief, der recht schlecht geschrieben ist, wenig würdig, von der Verfasserin jenes Briefes gelesen zu werden, auf den er die Antwort sein soll, aber im Grunde ist das keine Antwort. Es ist eine Art Testament, geschrieben von einem Hirn und einem Herzen, die recht krank und zur Hälfte zerrüttet sind – gleichwohl enthält es nichts Verrücktes und nichts Unvernünftiges, und ich bitte Dich, es als ein ›Not-Produkt‹ hinzunehmen. Ich bitte Dich gleichzeitig, Dich zum letzten Male mit meinen Gefühlen und mit den von ihnen eingegebenen unabänderlichen Beschlüssen zu befassen und mir deren Ausführung durch Deine Zustimmung und Annahme zu ermöglichen.
Gott schütze und segne die Mutter der Kinder, die so glücklich sind, daß sie sich ihnen auch ferner widmen will.
München, 17. Juni 1869.
Hans von Bülow.«
In diesem Briefe fällt uns eines auf: daß Hans die Scheidung nicht für unvermeidlich hält, daß er daran denkt, Cosima könne auf die Ehe mit Wagner verzichten. Dies hatte seinen besonderen Grund, den er aber nur der Gräfin Charnacé mitteilte. Er war preußischer Staatsangehöriger, und seine Ehe war in Berlin geschlossen; sie konnte daher nur in Berlin und nach preußischem Recht geschieden werden. Die dortigen Gesetze ließen eine einverständliche Scheidung im beiderseitigen gütlichen Einvernehmen nicht zu; das Auseinandergehen war nur möglich beim nachgewiesenen Verschulden eines Teiles. Hiergegen, daß er seine Frau öffentlich beschuldigen und gerichtlich gegen sie vorgehen solle, sträubte sich das innerste Empfinden Bülows. Da war es nun wieder die höhere Weisheit Cosimas, die weder auf seinen Edelmut, noch auf ihren eigenen Ruf schwächliche Rücksicht nahm. Sie hat immer unter den Halbheiten des Lebens gelitten und war, wo es galt, stets unerbittlich gegen sich selbst. Sie forderte demnach die Einleitung des Scheidungsverfahrens. Sie mußte auch dieses Opfer bringen, um ihr Glück festzuhalten und das des Sohnes zu sichern. Aber sie fühlte, daß sie mit dieser Preisgebung ihres Rufes und ihrer Frauenehre am stärksten ihren Gatten traf, von dem sie erst jetzt so recht erfahren hatte, wieviel sie ihm einst war und wie sehr er sie entbehrte. »Ich hoffe«, so redete sie in ihrem Tagebuche zu den Kindern, »daß Ihr es leichter habt als die Mutter. Solch armes, armes Wesen gibt es nicht mehr wie Hans. Er fühlt sich elend, daß ich fort bin, und niemals konnte ich ihn beglücken, ja nur erfreuen.« Sie besprach auch mit Wagner das Eigentümliche und Geheimnisvolle ihrer Verbindung. »Wie schüchtern zugleich und überschwenglich die ersten Annäherungen, wie planlos unsere erste Vereinigung, wie schweigsam wir nur auf Resignation dachten und wie Verhältnisse und Menschen uns zwangen, zu erkennen, daß unsere Liebe ganz echt war und wir beide uns einzig unentbehrlich waren.«
Was Bülow in dieser Zeit innerlich durchmachte, geht aus seinen Briefen hervor. An Pohl: »Nur so viel – ich muß für Freund und Feind in Verschollenheit geraten … habe so viel Freundschaft für mich, mir keinen Vorwurf daraus zu machen, daß ich Dir nicht die zwingenden Gründe meines Entschlusses ausführlich erzähle. Erstlich läßt sich das schriftlich auf verständliche Weise nicht explizieren, ferner versetzt mich jede Rekapitulation in die peinlichste Nervenaufregung, endlich müßtest Du doch zwischen den Zeilen lesen. Meine Position hier beruht auf schiefer Basis … als sei ich ein kleiner Günstling des großen Günstlings.« An Hans von Bronsart: »Meine Frau hat sich von mir getrennt und mit den Kindern dauernd in der Schweiz niedergelassen. Meine Lebenslust, Frische, Elastizität ist seit Monaten in der Abnahme begriffen, und zwar bis zur vollkommensten Nervenschwäche. Die künstlerische ehrenvolle Stellung, welche mir in München durch Wagners Freundschaft vermittelt worden ist, länger zu behaupten – ist eine moralische … Unmöglichkeit geworden. Ich brauche ein Jahr der Ruhe, Einsamkeit, der Vorbereitung zu einer ›neuen‹ Fortexistenz.«
Trotz der abmahnenden Bitten und Beschwörungen Liszts bestand Bülow auf seiner »Demission«, und die förmliche Entlassung wurde ihm schließlich auch bewilligt, unter Fortdauer seines ersten »Ehrenbezuges«. In dem Rundschreiben, mit dem er sich von seinen Schülern verabschiedete, sagte er: »Nächst der dankbaren Ehrfurcht, welche Sie, liebe Kunstjünger, gegen König Ludwig II. von Bayern stets durchdringen möge, finde in Ihrem Herzen auch stets noch die Empfindung der verehrungsvollen Erkenntlichkeit eine Stelle, welche demjenigen Meister, dem größten unter den Lebenden, zu zollen ist, der die Gnade einer königlichen Freundschaft zur Anregung der Gründung dieser Schule zu verwerten gewußt hat.« Der Anstalt machte er auch eine Büste Wagners zum Geschenk.
An Freund Bechstein in Berlin aber schrieb er: »Anfang Oktober Reise nach Florenz, wo ich hoffentlich etwas Ruhe finden werde … Meine Existenz ist über alle Ahnung abscheulich. Wäre nur erst alles geordnet – das Beste wäre, es schenkte mir eine mitleidige Seele das genügende Quantum Blausäure! Gibt's keinen aimablen Apotheker in Berlin? Ich würde ihm meine ganze Bibliothek und was er sonst haben möchte dafür vermachen. Sie kennen ja soviel Leute.« Und in einer Nachschrift: »Daß ich jetzt sehr rein dastehen werde – auch vor der bösen Welt –, tröstet mich wenig darüber, daß ein Hallo gegen den großen Meister unausbleiblich sein wird. Ich kann aber jetzt keine Opfer mehr bringen.«
Der Meister wurde um dieselbe Zeit vor allem durch das Münchner »Rheingold« erregt. Die Sache lag anders als beim »Tristan«. Der war wider Erwarten gut ausgefallen, und Wagner hatte sich hinterher damit abgefunden. Nun aber sollte ein Bruchstück vom »Ring« preisgegeben werden. Hatte Wagner in der bösesten Wiener Zeit alle Anträge auf Verwertung des »Rheingolds« und der »Walküre« rundweg abgelehnt, da er das große vierteilige Werk, den »Ring des Nibelungen«, eben nur als Ganzes und als Einheit in einer Festaufführung darbieten wollte, so konnte er jetzt, da ihn keine wirtschaftliche Notlage zu irgendeinem Zugeständnis drängte, sich um so weniger mit dem Gedanken befreunden, daß das Vorspiel des Werkes allein, ohne Fortsetzung, aufgeführt werden sollte. Freilich war schon die »Walküre« für später in Aussicht genommen. Doch auch diese war ja nur das Vorspiel zur großen Siegfried-Tragödie, die noch nicht vollendet war. Es beweist uns, wie innig Wagner den König liebte und wie sehr ihm daran lag, dessen Wünschen zu willfahren, daß er sich entschließen konnte, der Aufführung des »Rheingolds« nicht zu widersprechen. Er machte nur den Vorbehalt, daß sie ohne seine Mitwirkung zustande zu kommen habe, und sorgte trotzdem dafür, daß sein Geist nicht verleugnet werde, indem er, mit Wissen und Zustimmung Bülows, Hans Richter genauestens in die Partitur einweihte und diesem die Vollmacht erteilte, ihn in München zu vertreten und an seiner Stelle zu dirigieren. Hierzu kam jedoch etwas Neues und Besonderes: der Münchner Intendant Freiherr von Perfall wollte nicht für eine entsprechende Bühnengestaltung sorgen, die besonders schwierigen Aufgaben, die das »Rheingold« in dieser Hinsicht stellt, waren ihm lästig oder gleichgültig; wiewohl ihm erhebliche Mittel zur Verfügung gestellt wurden, sorgte er nicht für eine würdige und sinngemäße künstlerische Ausführung und mißachtete auch die klaren Wünsche und Forderungen Wagners – weder der Maschinist Brandt noch der Spielleiter Hallwachs, die mit Wagners Absichten vollständig vertraut waren, bekamen den geeigneten Wirkungskreis. Richter war es, der auf diesen Übelstand mit Nachdruck hinwies und sogar noch nach der Generalprobe, die in Gegenwart vieler zugereister Freunde, auch Liszts, vor sich gegangen war, seine fernere Mitwirkung wegen der szenischen »Unmöglichkeit« verweigerte. Er wurde entlassen, und da auch der Darsteller des Wotan, Franz Betz, in der nächsten Zeit nicht zur Verfügung stand, hofften alle, daß die Sache erledigt sei. Der König jedoch bestand darauf, daß das Werk zur Aufführung komme, sobald der Sänger wieder zu haben sei. Um nun wenigstens die musikalische Seite der Aufführung zu retten, eilte Wagner nach München und stellte dort die Forderung, daß man Richter von neuem berufe und mit der Leitung betraue. Dazu wollte sich die Intendanz nicht verstehen, und nachdem Levi in Karlsruhe, der zunächst befragt wurde, unter Berufung auf den Meister abgelehnt hatte, wurde der hierfür unfähige Franz Wüllner zum musikalischen Leiter bestellt. Am 22. September fand die Aufführung statt, und alsbald befahl der König die Vorbereitung der »Walküre«.
Wagner war tief dadurch getroffen und hat viel darüber an den König geschrieben. Einmal legte er ihm ganz schroff die Frage vor: »Wollen Sie mein Werk, wie ich es will, oder wollen Sie es nicht so?« – »Aber wir kamen darin überein«, so schrieb Cosima, »daß Richard von den Nibelungen eigentlich lebt. Ihnen verdankt er seine Existenz, deshalb muß man noch Gott danken, daß ein Wesen wie der König einen so sonderbaren Sparren im Kopfe hat und die Dinge durchaus sehen und haben will, freilich ohne jeden großartigen Gedanken damit zu verknüpfen. Richard sagt: ›Umbringen kann er das Werk nicht. Ich kann es allein umbringen, wenn ich mich unterbreche und es nicht vollende. Daß er die Sache jetzt verdirbt, wird den Eindruck nicht vermindern, wenn die Werke einmal in meinem Sinne aufgeführt werden.‹ Ja er fügte bei: ›Den Tannhäuser und Lohengrin ist man mir ja auch noch immer schuldig. Diese ganze Darstellung aber erfordert einen allgemeinen höheren Kulturzustand. Trifft dieser nicht ein, so würden auch die vollkommensten Aufführungen in München nichts nützen.‹«
So wurde immer wieder ein Weg des inneren Ausgleichs mit dem König gesucht. Hatte ihm Wagner doch auch eine von ihm selbst gefertigte Abschrift der Orchesterskizze zum dritten Aufzug des »Siegfried« mit einem herrlichen Widmungsgedicht als Geburtstagsgeschenk überreicht! Und immer wieder beantwortete der König Wagners Briefe in überschwenglicher Weise. Nie aber ging er auf seine Bitten und Vorstellungen näher ein, nie machte er sich seine Gedanken wirklich zu eigen. Auch den Vorschlag der Berufung Liszts im vorigen Jahre hatte er unbeachtet gelassen. Alle Mitarbeiter Wagners verloren ihre Stellungen oder ihren Einfluß. Beim Abgang Bülows beschäftigte sich die Münchner Presse wieder einmal recht unsachlich und feindselig mit dem »Einfluß« Wagners. Doch dieser hatte keine Macht mehr. Düfflipp, der Nachfolger Pfistermeisters, tat, was er konnte, um günstig auf den König einzuwirken. Der aber blieb in seiner Wolke und hatte kein Verständnis für die rechte Verwirklichung seiner eigenen, traumhaften Wünsche.
Liszt war wohl in München bei der Generalprobe des »Rheingold« gewesen, doch er kam nicht nach Luzern. Die räumliche Entfernung, in der er sich von Cosima und Wagner hielt, schien immer mehr zu einer Entfremdung zu werden, die sich in seinem hartnäckigen Schweigen deutlich genug aussprach. So wurde Triebschen der Welt immer mehr entrückt. Aber diese sandte ihre Abgesandten in das Heim des Meisters. Außer Nietzsche, mit dem sich auch die Kinder sehr befreundeten und der eine Menge Besorgungen für das Triebschener Haus übernahm, auch den ersten Druck der Lebenserinnerungen in Basel überwachte, kamen im Laufe des Jahres so manche liebe Gäste aus nah und fern: die Verwandten Wagners aus Leipzig, Richard Pohl, Frau von Muchanow, der russische Musiker Alexander Seroff, mit dem Wagner in Petersburg Freundschaft geschlossen hatte, und ein französisches Paar: Catulle Mendès mit seiner Gattin Judith, der Tochter Theophil Gautiers. Diese brachten auch den Grafen Villiers de l'Isle-Adam mit. Die meisten verbanden die Anhörung des »Rheingolds« in München mit dem Besuch in Triebschen und konnten so einerseits aus berufenstem Munde hören, inwiefern die Münchner Sache eine arg verfehlte war und berechtigte Verstimmung hervorrufen mußte, anderseits aber auch den Bewohnern von Triebschen über ihre Eindrücke berichten.
Grüße aus der Welt erhielt Cosima auch durch den großen Bildnismaler Franz Lenbach, den Wagner in München als Künstler und als Menschen liebgewonnen hatte. Cosima ließ von ihm in München und in Spanien, das er bereiste, wertvollen Hausrat, Stoffe und Kleidungsstücke besorgen und erfreute ihn immer wieder durch vertrauliche Briefe, in denen viele Fragen der Kunst und des Geisteslebens, die sie beide beschäftigten, sehr angeregt besprochen wurden. »Es ist gut, daß Sie Mode geworden sind«, schrieb sie einmal, »denn das ist jetzt die Form der Anerkennung, und zur Zeit, wo ich für unsere Kunst noch etwas in München erhoffte, wünschte ich nur, der König möchte sie zur Mode machen.« Sie sprach dann von Böcklin, den sie in Basel kennenlernte, von Nietzsche und von Italien: »Genua ist mir wie ein goldener Traum in der Erinnerung geblieben, an den sich mir auch der Alp der Tessiner Überschwemmung angehängt hat. Mir ist es, als ob ich resignieren müßte, das Land kennenzulernen, in welchem ich geboren bin, und aus welchem ich gewiß nicht mehr heraus möchte, wenn ich darin wäre.« Sie dankte ihm für wohltuende Teilnahme »in dieser Zeit, in der ich manches zu ertragen und manches zu entbehren habe. Mein Vater ist nun in München, er ist der einzige aus unserer zersprengten Gemeinschaft, welcher das ›Rheingold‹ hören wird« … Wie es ausfallen wird? »Jedenfalls werden die Götter nicht übermenschlich sein.« – »Wenn Sie das Werk hören, denken Sie freundlich an mich, die ich in dem Glauben und der Liebe zu diesen Schöpfungen alle Prüfungen, aber auch allen Trost gefunden habe, und nun fern sein muß.« Sie berichtete von der schwankenden Gesundheit Wagners, aber auch von einem Übel, das sie selbst befallen: ihre Augen seien »so angegriffen«, daß sie »möglichst wenig lesen und schreiben« dürfe. Also Geduld! Geduld! »Eigentlich heißt unser ganzes Leben sich gedulden auf den Tod.« Ihre Abgeschiedenheit kennzeichnete sie mit dem Worte: »Ein hohes Gebirge trennt mich von der Welt.« Nach dem »Rheingold«: »Ich hatte große Besorgnis, daß der Meister die Vollendung seines Riesenwerkes ganz aufgeben würde. Mit Gottes, der Kinder und der Berge Hilfe hoffe ich, daß es zustande kommt.« Dann schrieb sie auch: »Meine jetzige Lage gebietet mir strenge Zurückgezogenheit. Wie ich Ihnen sagte, als ich München verließ: wenn die seltsamen Dinge, denen ich dort ausgesetzt worden bin, nicht auch die intimsten Verhältnisse erschüttert und unheilbare Konflikte hervorgebracht hätten, ich würde sie kaum beachtet haben. Nun habe ich noch die Wendung dieser Lage zu erwarten, welche durchaus friedlich, den Charakteren und dem Lebenslauf angemessen, aber doch entschieden ausfallen muß. Bis alles geordnet ist, muß ich still mit meinen Kinderchen zu leben wissen, deren Pflege und Gedeihen mir eine wirkliche Vergeltung aller Prüfungen ist. So geschieden mich auch die Verhältnisse von meinem früheren Leben haben, so kann doch meine Teilnahme dafür niemals erlöschen, und ich danke Ihnen vom ganzen Herzen für alles Freundliche, was Sie mir in bezug auf Hrn. v. Bülow sagen, und was er im höchsten Grade, nach allen Seiten hin, verdient. Er wird in München nicht bleiben, weil alles dort so erbärmlich ist, daß selbst sein partieller Stellvertreter es nicht aushalten kann und um seine Entlassung eingekommen ist. Doch genug hievon, es war mir ein Bedürfnis, Ihre freundliche Teilnahme für mich mit einem Zeichen innigsten Vertrauens zu erwidern und zu Ihnen von Verhältnissen zu reden, über welche ich unerschütterliches Stillschweigen gegen die Welt beobachte.« Sie hatte es schon früher sehr bedauert, daß der »feurige und schändlich verkannte« junge Gelehrte Julius Braun nicht zum Professor am Polytechnikum in München ernannt wurde, und beklagte nun den allzufrühen Tod dieses hochbegabten edlen Mannes. »Welch ein merkwürdiger Körper ist doch dieses Deutschland! Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den Künsten, selbst in religiösen und politischen Dingen bringt es immer noch die bedeutendsten Kräfte hervor, und alles verkommt, und zu einem wirklichen Leben will es nicht gelingen. An den Fürstenhäusern liegt es sicherlich vor allem; wohl aber auch an den Frauen, welche, so vortrefflich sie innerlich begabt sind, vielleicht zu wenig Gewicht auf die ästhetische Seite des Lebens legen.« In diesem Zusammenhang kam sie auf die Franzosen Gautier-Mendès zu sprechen und lobte nicht nur ihr Auftreten und ihre gesellschaftliche Liebenswürdigkeit, sondern auch ihr Wissen und ihre Gelehrsamkeit – Judith kann sogar Chinesisch! –, aber »wenn die Franzosen noch so gut unterrichtet sind, zuletzt wissen sie doch nichts«. Dagegen hat Paris, wenn es auch »nichts Großartiges in der Kunst hervorbringt«, doch »noch einen lebendigen, auf ununterbrochener Tradition ruhenden Sinn dafür«. In demselben Brief nahm sie auf ihren Gesundheitszustand nach der Geburt des Sohnes Bezug. »Ich bin zwar noch sehr angegriffen – der Arzt sagte mir gestern, daß er sich wundere, daß ich bei so schwachem Pulse nur noch herumgehen könne –, allein ich hoffe auf Genesung, da ich meine, das Schwerste überstanden zu haben.« Dann erzählte sie, daß »Herr Wagner« den dritten Akt »seines ›Siegfried‹« beendigt habe. Zum jähen Tode der blühenden Tochter Paul Heyses bemerkte sie: »Ich zittere, wenn ich so etwas höre! Wie übersteht eine Mutter solches Weh? Aber der Mensch ist so schwach, daß er vieles übersteht.«
Da Lenbach die Absicht hatte, auch nach Paris zu gehen, was Cosima lebhaft befürwortete, so schrieb sie ihm: »wenn Sie hierher kommen, wollen wir Ihnen, Lulu und ich« – mit Lulu ist Daniela gemeint – »französischen Unterricht geben. Ich bin ein sehr guter Lehrer, bin streng und geduldig zugleich! Lulus Klavierlehrer spendet immer alle erdenklichen Lobsprüche meiner Beaufsichtigung!« Die nahende Weihnachtszeit machte die Kinder immer mehr zu Hauptpersonen. Im Tagebuch konnte sie Hans nicht verdrängen. »Seltsam, Hans war eigentlich den Weihnachten abhold, und jetzt, wo ich ihn allein weiß, und diese Feier im voraus mir denke, überfällt mich bei dem Vergleich mit ihm und mir eine unaussprechliche Wehmut.« Das Fest wurde im Beisein Nietzsches begangen. Da gab es den Knecht Rupprecht und ein leibhaftiges Christkind, ein armes Mädchen aus Bamberg; eine Laterna magica, deren Gläser von Judith Mendès gemalte Bilder aus den Wagnerschen Werken trugen, ein Puppenhaus, in dem Cosima selbst »Fresken« gemalt hatte, und einen großen Schlitten. »Es war Lulus letzte Spielzeugbescherung, denn sie wird im Oktober zehn Jahre, da beginnen die ernsten Geschenke und – – – der Beichtvater!« Cosimas Bildnis, das sie bei Lenbach für Wagner bestellt hatte, war noch nicht fertig. Auch Wagner selbst sollte von Lenbach gemalt werden, nur diesem traute sie die Kraft zu, den immer wechselnden und stets erhabenen Ausdruck dieser Züge wahr und dauernd auf die Nachwelt zu bringen. Alles in allem war dieses Weihnachtsfest so feierlich-friedlich, wie sie es beide, Wagner und Cosima, schon lange nicht erlebt und genossen hatten. Ein echter Vorklang der noch schöneren Abende, die später das Leben in Bayreuth verklärten.
Als das Jahr zu Ende ging, schrieb Wagner an den König. Sein Brief klang in die Worte aus: »Es war nun, durch die unerläßliche Nötigung des Schicksals, der Zeitpunkt eingetreten, wo edlen Seelen es ziemt, in schweigsam stiller Gelassenheit die Wendung der Dinge abzuwarten. Erst wenn die Zeit gekommen sein wird, wo selbst den ferner Stehenden klar zu sehen ermöglicht ist, kann der Ernst feierlicher und unverbrüchlicher Entschlüsse verstanden werden, für deren richtige Deutung wir jetzt nur unsere Versicherungen verwenden können, während dann die Tat und der Erfolg sprechen werden. Tod und Leben lagen in der Schale: Ich habe das Bewußtsein, zweimal ein Leben gerettet zu haben, welches jetzt einzig dem Wohle guter Kinder aufgeopfert wird. Doch darf ich Ihnen, dem zart und groß denkend Verständnisvollen, schon jetzt einen Segensgruß zum Neujahr von der aufopferungsvollsten Mutter wie großherzigsten Freundin still und innig zurufen!«
So schlug den beiden das Jahr 1870, das endlich den Dauerzustand bringen sollte, der ihren Bund für immer festigte. In dieses Jahr fielen aber auch die politischen Ereignisse, die damals das ganze deutsche Volk bewegten. Ein böser Zufall wollte es, daß just der Schwager Cosimas, Emil Ollivier, in das Ministerium Napoleons III. eintrat und dort die auswärtige Politik Frankreichs wesentlich beeinflußte. Er bleibt mitverantwortlich für die Zuspitzung der Verhältnisse, die zum Ausbruche des Deutsch-Französischen Krieges führte. Doch was ist Zufall? Und »das Böse bannt, wer's mit Gutem vergilt«. Als Ollivier in der französischen Kammer heftig angegriffen wurde, veranlaßte dies seine Schwägerin, den seit geraumer Zeit ruhenden Briefwechsel mit ihm von neuem aufzunehmen. Sie wollte den Anschein vermeiden, als ob nur seine Erhöhung zum Minister die Wiederannäherung bewirkt habe, und meinte, daß eben die schwierige Lage, in der er sich vorübergehend befand, ein Zeichen der Teilnahme rechtfertige, das nicht mißdeutet werden könne. Ihr Herz aber schlug nur für Deutschland. Richard und Cosima verfolgten mit gespannter Aufmerksamkeit und wachsender Erregung die sich drängenden Ereignisse. Das vatikanische Konzil erregte sie nicht minder als die innerpolitischen Vorgänge in den deutschen Staaten. Gottlob, daß man auch wieder von Deutschland sprechen konnte! Die Haltung des Königs von Bayern, dem sich Wagner damals doch stark entfremdet fühlte, der aber zu seiner größten Befriedigung den gesamtdeutschen Standpunkt einzunehmen schien, selbst auf die Gefahr hin, einem bayrisch-ultramontanen Volkssturme zum Opfer zu fallen, weckte in Triebschen ebensolche Freude wie die einem gemeindeutschen Ziele zustrebende Politik Bismarcks und der Mut Döllingers in den vatikanisch-kirchlichen Fragen.
Nur der Wunsch des Königs, nun auch die »Walküre« in München hören zu wollen, war etwas, was Wagner kaum verwinden konnte. »Wenn ich dich nicht hätte«, sagte er zu Beginn des Jahres zu Cosima, »wüßte ich gar nicht, wofür ich auf der Welt bin. Ich glaube, ich würde wahnsinnig: von der einen Seite nicht anders sein zu können als man ist, und von der anderen der Welt in keiner Weise recht zu sein, das muß einen an sich selbst irre machen … Wenn mich das Kunstfeuer und die Liebe nicht erhielten, ich lebte nicht mehr.« Solche und ähnliche Worte stählten das Gemüt Cosimas, die von der Ungeduld, mit der sie die Scheidung erwartete, und zugleich von der Sorge um Bülow, der inzwischen in Florenz behagliche Verhältnisse und neuen Lebensmut gefunden hatte, immer schmerzlicher ergriffen wurde. Am 8. Jänner, dem Geburtstage Bülows, erwachte sie mit dem grüblerischen Gedanken, ob es nicht doch besser gewesen wäre, wenn sie nur für ihn gelebt hätte. »Ich glaube, nein«, schrieb sie in ihr Tagebuch. »Ich glaube auch fest, daß dies nicht meine Bestimmung war. Meine Hoffnung ist dadurch gestützt, daß Lulu mir zuliebe ihren Vater über alles lieben und sich ihm weihen wird.« Wagner und die Kinder, das war jetzt der Inhalt ihres Lebens – aber der Gedanke an Bülow und an das Unrecht, das sie ihm in den Augen der Welt zufügen mußte, wich nicht aus ihrer Seele. So befiel sie auch immer wieder die düstere Erinnerung an den frühen Tod Daniels und Blandinens, während Wagner vor allem den jähen Hingang Schnorrs fortdauernd beklagte. »Man hat es überlebt, aber man wird ein anderer«, sagte er. »Doch für Schnorr haben wir nun Fidi«, nämlich Siegfried. Als Gattin und als Mutter sah sich Cosima für ihre peinvolle Unruhe immer wieder reichlich entschädigt bis zum seligsten Selbstvergessen. Durfte sie doch auch wahrnehmen, daß die Freunde Wagners sein Glück und seine innere Erneuerung klar erkannten. Heinrich Porges, der aus München zu Besuch kam, versicherte, daß er den Meister noch nie so ruhig und so sicher gesehen wie jetzt, und daß er überzeugt sei, Wagner würde die »Nibelungen« nie wieder aufgenommen haben, wenn nicht der große Umschwung in seiner Seele gekommen wäre. Als sie dies Wagner erzählte, erwiderte er: »Nicht einen Ton hätte ich mehr von mir gegeben, wenn ich dich nicht gefunden hätte. Jetzt habe ich ein Leben.« Ein anderes Mal sagte er: »Nicht nur liebe ich dich, sondern ich lebe dich.«
Dieses neue Leben offenbarte sich in besonderer geistiger Regsamkeit, in unermüdlicher Beschäftigung mit den großen Dichtern und Denkern aller Zeiten und mit eigenen neuen Schaffensplänen. Nur die bevorstehende Aufführung der »Walküre« in München warf einen düsteren Schatten in die Heiterkeit des Zusammenlebens und in die weltabgewandte Schau des Meisters. Der Gedanke der Festspiele, der einzig möglichen Verwirklichung dessen, was er mit dem »Ring« beabsichtigte, war von ihm in dem ahnungsvollen Vorwort zur Herausgabe der Dichtung geradezu mit dem König von Bayern, mit dessen verstehendem Sinn und voranleuchtendem Beispiel, verknüpft worden. Und nun wurden in München beharrlich Anstalten getroffen, die die Umsetzung des Gedankens in die Tat hemmten, erschwerten, vielleicht unmöglich machten. Am 5. März gedachte Cosima des Umstandes, daß Wagner einst als junger, zweiundzwanzigjähriger Mann einen so freundlichen Eindruck von der Stadt Bayreuth empfangen – in seinen Lebenserinnerungen hatte er ihr davon berichtet – und daß er auch später Bayreuth als einen Ort genannt, den er gern für seine Festspiele wählen würde. Das wäre so recht der deutsche Winkel, eine liebliche Einöde abseits von »dem Qualm und dem Industriegeruche unserer städtischen Zivilisation«. Cosima regte Wagner dazu an, im Konversationslexikon nachzuschlagen, um sich näher über Bayreuth zu unterrichten. Und »zu unserer Freude lasen wir darin ein prachtvolles altes Opernhaus angeführt«. Dieses längst außer Gebrauch stehende Opernhaus konnte allenfalls für die Festspiele dienen. Der 5. März 1870 war so gewissermaßen der Geburtstag – oder, wenn man will, der Tag der Empfängnis – der Bayreuther Festspiele.
Die Münchner Angelegenheit nahm eine besondere Wendung, als die Kreise um den König in bester Absicht Bülow zur Leitung der »Walküre« bestimmen wollten und die Beschleunigung des Scheidungsverfahrens forderten, damit der König den Meister wieder zu sich berufen und ohne Vorwurf mit ihm verkehren könne. Bülow lehnte ab; das wäre für ihn Selbstmord. Die »Walküre« blieb trotzdem auf der Tagesordnung, und der Eifer, mit dem eine »würdige« Darbietung betrieben wurde, warf sich auch auf den Walkürenritt, der nicht als Nebelbild, als Gewittersturm vorüberziehen, sondern (auf Wunsch des Königs!) von den Stallknechten des Hofes zirkusmäßig vollführt werden sollte. Wer von der schrankenlosen Heftigkeit Wagners Kenntnis hat, der gewahrt den Einfluß Cosimas auch darin, daß alle die Kränkungen und Widerwärtigkeiten, die namenlosen Enttäuschungen, die dem Künstler damals bereitet waren, keine unheilvollen Stürme entfachten. Nur mit schwermütigem Verzicht gedachte er dessen, was ihm der König zuvor gewesen. Als Cosima ihn bat, sein Tagebuch, das er bis zum Jahre 1868 geführt, fortzusetzen, gab er ihr zur Antwort: »Nein, dies hat aufgehört. Jetzt genieße ich mein Glück. Ich schwöre dir zu, ich wundere mich über nichts mehr, indem ich sehe, daß die alte Kraft durchaus nicht aufgehört hat, die Phantasie, vielleicht mehr als gut, immer geneigt ist, zu schaffen. Wem verdanke ich dies?« Scherzend meinte Cosima: »Dem König von Bayern.« Aber ernsthaft erwiderte er: »Glaub mir, diese Gunst hätte ich ermüdet fallen lassen, hätte ich dich nicht gefunden.« In ihrer Nähe hatte er das Sich-Wundern über Menschen und Dinge verlernt. Ihr Umgang erfrischte und stärkte ihn täglich aufs neue. »So lange ich dein liebes Angesicht sehe, sterbe ich nicht.« Ihr Herz jauchzte bei solchen Worten.
Am 3. Mai, zum »sechsten Jubeltage« seiner Berufung durch den König, sandte ihm Wagner das von wundersamer, treuherziger Beredsamkeit durchpulste Gedicht, womit er den königlichen Sinn zu ändern hoffte: »Noch einmal mögest Du die Stimme hören, die einstens aus Dir selber zu mir sprach …« Doch als auch dieses Mittel versagt hatte und nun auch die Leitung der »Walküre« endgültig an Wüllner übertragen war, da störte dennoch nichts die Feier seines 57. Geburtstages. Cosima, die er einmal, als sie weiß gekleidet war, die weiße Dame, dann wieder Thekla nannte – sie lasen eben gemeinsam Schillers »Wallenstein« – hatte sich allerlei Überraschungen ausgedacht. Aber mitten in den Vorbereitungen, die sie leidenschaftlich betrieb, noch in der Morgenstunde des Geburtstages, schrieb sie in ihr Tagebuch: »Ich tauge nicht mehr für Feste, und bevor noch der Tag beginnt, sitze ich da, schreibe dies und weine. Gott gebe meinen Kindern Freude heute; wer viel gelitten hat, kann nicht mehr recht lachen. Am Festtag besonders erkennt man, wie traurig das Leben ist. Der unbeachtete Fluß der Tage, ihre stille Flucht ist dem wunden Herzen wohl das Beste. Segne Gott alles und gebe mir bald Ruhe.« So litt sie an den Wunden, die sie einem anderen geschlagen hatte.
Aber er, dem sie das Opfer ihrer Ruhe und ihres Friedens gebracht – er und die Kinder sollten alles nur schön und heiter haben. Am Geburtstage wurde er durch den Klang von 45 Militärinstrumenten geweckt, die den Huldigungsmarsch, den er dem Könige gewidmet hatte und der nun den Gefühlen der Seinen für ihn Ausdruck geben sollte, »ganz überraschend gut« vortrugen. Cosima selbst hatte das Tonstück mit der Luzerner Milizmusik in der Kaserne in »vielen mühseligen Proben« einstudiert und dabei das richtige Zeitmaß und den richtigen Ausdruck festgesetzt. Es war gleichsam ihre erste Vorprobe für ihr späteres Wirken in Bayreuth gewesen. Sie hatte auch die Treppe über Nacht in einen »sich wölbenden Blumenwald« verwandelt, und als nun Wagner herabschritt, begrüßten ihn, da und dort im Rosengebüsch wie Bildsäulen aufgestellt, die Kinder, zuunterst die »edle Treue«, der die Gabe verliehen war, jedes Familienfest höchst eindrucksvoll zu gestalten, und die es diesmal mit dem Huldigungsmarsch – Wagner hatte seit bald zwei Jahren keine Musik von sich gehört – besonders gut erraten hatte. Ihm zu Ehren gab dann Daniela den munteren Vöglein, die sie im Oktober zu ihrem Geburtstag erhalten hatte, die Freiheit wieder und sprach dabei unter Tränen ein von Cosima verfaßtes kindliches Gedicht. Eine Bachstelze blieb zurück. Am nächsten Morgen fand man sie tot, vielleicht vor Sehnsucht nach den entflohenen Gespielen. Auf seltsame Weise mischte sich da auch im Kleinen Lust und Schmerz. Wagners Stimmung aber war gehoben, waren doch viele Grüße und Wünsche aus der Ferne ins Haus geflogen, hatte doch der König selbst des Geburtstages gedacht und schon ein paar Tage vorher durch einen Stallknecht ein Roß als Geschenk überbringen lassen. Fidi wurde aufs Pferd gesetzt, das sie Grane nannten, und nahm sich als »Reiter« ganz stolz und freudig aus. Auch Liszt sandte einen Drahtgruß. Wagner bezog alles nur auf Cosima und nannte sie, indem er an die Fürstin Wittgenstein, die Gefährtin und Lenkerin seines Schwiegervaters, dachte, die »Kapellmeisterin seines Lebens«.
Am meisten erfüllt es uns mit Staunen und Bewunderung, daß er in all der Zeit ununterbrochen und in lebhaftester Schaffensfreude an der »Götterdämmerung« arbeitete. An dem Werke, worin er nicht wie sonst sein Schicksal seherisch vorausnahm, sondern die Wirren und Feindseligkeiten, die er in den letzten Jahren erlitten hatte, rückschauend und überwindend gestaltete. Am Vorabende des ersten Geburtsfestes seines Sohnes war der Entwurf zum ersten Aufzuge beendet. Am nächsten Morgen schrieb Cosima in ihr Tagebuch: »Mein Kind, deine Geburt – mein höchstes Glück, hängt mit der tiefsten Kränkung eines anderen zusammen. Das war meines Daseins Schuld! Vergiß dies nie, erkenne darin das Bild des Lebens und büße es ab, wie du kannst. Sei aber gesegnet von mir als die Verwirklichung des süßesten Traumes.« Wagner begann den Tag mit einer zarten Weise auf dem Klavier und sagte nur: »Wie bin ich glücklich.« Auch diesmal hatte Cosima ein Gedicht ersonnen. Sie spielte zunächst auf die Sage von den Rosen und Reben an, die dem Grabe Tristans und Isoldens entsprossen. Mit ihnen sei das Kind erblüht, die Frucht süßtrauriger Minne.
»Die um das Grab von Tristan und Isolden
Sich üppig umschlingend erheben –
Die Rosen so hold, die Reben so golden,
Nun schlingen sie sich um dein Leben.«
Der Wortlaut des Gedichtes nahm auch auf die Verse vom Sonnenuntergang Bezug, die Wagner ihr am 1. Oktober 1864 in Starnberg gewidmet hatte. »Du bist nichts als Seele, Liebe, Geist«, sagte er jetzt zu ihr, indem er die Verständnislosigkeit, auf die er überall gestoßen war, mit dieser nur seine Welt widerspiegelnden Gegenwart verglich. Sie aber schrieb in ihr Tagebuch: »Mir geht es dabei wie Gretchen: Weiß nit, was er an mir findt.«
In dieser Zeit erhielt Wagner einen Brief von Frau Eliza Wille, die er zuletzt bei den »Meistersingern« gesehen hatte und die ihn nun mit Cosima zu sich einlud. Darauf antwortete Wagner am 25. Juni: »Gewiß werden wir kommen, denn Sie sollen die Ersten sein, denen wir uns als Vermählte vorstellen. In diesen Stand zu gelangen, hat es eine große Geduld gekostet: was seit Jahren unerläßlich war, sollte sich erst unter Leiden jeder Art zur Lösung bringen. Seit ich Sie zuletzt in München sah, habe ich mein Asyl nicht mehr verlassen, in das sich seitdem auch diejenige flüchtete, welche zu bezeugen hatte, daß mir wohl zu helfen sei, und das Axiom so manches meiner Freunde, mir sei nicht zu helfen, unrichtig war. Sie wußte, daß mir zu helfen sei, und hat mir geholfen: Sie hat jeder Schmach getrotzt und jede Verdammung auf sich genommen, sie hat mir einen wunderbar schönen und kräftigen Sohn geboren, den ich kühn Siegfried nennen konnte: der gedeiht nun mit meinem Werke und gibt mir ein neues, langes Leben, das endlich einen Sinn gefunden hat. – So behalfen wir uns denn ohne ›Welt‹, der wir uns gänzlich entzogen hatten. Da hat sich denn nun Echtes bewährt, und rührender als der Gewinn neuer Freunde, war uns die Treue alter … Nun aber hören Sie: mögen Sie es gerecht und sinnvoll finden, daß wir Ihrer Einladung erst nachkommen, wenn ich Ihnen die Mutter meines Sohnes auch als meine angetraute Gattin zuführen kann. Dies ist nun endlich nicht mehr fern, und wir hoffen noch vor dem Fallen des Laubes in Mariafeld einzuschreiten. Aber nun bewähren Sie Ihre Freundschaft ganz und kehren Sie mit den vortrefflichen Ihrigen recht, recht bald zuvor noch bei uns auf Triebschen ein.«
Einstweilen erfreuten sie sich an einem Besuche Friedrich Nietzsches, der diesmal seinen Freund und Berufsgenossen Erwin Rohde mitbrachte. Nietzsche las die erste seiner beiden Abhandlungen über das griechische Musikdrama vor, die dann später in sein geniales Erstlingswerk »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« verarbeitet wurden, und machte damit starken Eindruck. Cosima verbreitete sich darüber in einem längeren Schreiben, worin sie auch von der »Schändlichkeit« der Münchner Walküren-Aufführung und von der Hoffnung auf Bayreuth sprach. Sehr stark wirkte Rohdes Persönlichkeit, und in der Tat hat Wagner in ihm einen besonders verstehenden Anhänger gefunden, der ihm auch über Nietzsches späteren Abfall hinaus unbeirrt treu blieb. –
Täglich erwarteten sie nun den Scheidungsspruch, dem die Trauung so rasch als möglich folgen sollte. Schon war das Hochzeitskleid Cosimas fertig. Doch die Zeit des Bangens und Harrens wollte kein Ende nehmen. Der leidigen Münchner Angelegenheit suchte Wagner immer wieder eine erträgliche Seite abzugewinnen. »Du wirst sehen«, sagte er, »die Walküre wird auch zu meinen Gunsten ausfallen. Irgend etwas wird sich finden, was mir und meinem Plane vielleicht günstiger ist, als wenn jetzt ein einziges Schweigen wäre.« Im Hinblick auf den König sagte er: »Man steht zwischen Genius und Dämon. Du gehörst zum Genius, der König zum Dämon. Nur lieben und schaffen, und schaffen nur, weil ich liebe. Du bist die Zentralsonne, um die sich alles dreht. Bist du wieder froh in allem, was du berührst, bin ich froh und glücklich. Aber du kannst nicht hexen – die Außenwelt bleibt, was sie ist – und doch, du hast gehext.« Aus Bangen und Harren wurde immer wieder Hoffen und Zuversicht. Nichts hemmte ihn in seiner Arbeit. Er bezeichnete diese einmal als Luxus – »ich tue sie ja nur, damit du nicht böse wirst«, sagte er scherzend zu Cosima – und als sie ihn in einer Aufwallung fragte, ob die Münchner »Schmach« »ungerächt« bleiben werde, fand er ein Wort der Versöhnung: »Du bist die Schwester des Königs von Bayern, ihr habt euch die Hände gereicht, um mein Leben zu erhalten. Er freilich als törichtes Wesen, du als gutes Weib.« Sie bemerkte dazu in ihrem Tagebuche: »Ich kann die Empfindung des Königs nicht enträtseln. Freilich sagt ein indischer Spruch, daß man dies niemals und nirgends von einem Könige könne.« Das Vertrauen Wagners zu der Klugheit und dem Feinsinne Cosimas gipfelte endlich in der Verfügung, daß alle Briefe aus München zuerst ihr vorgelegt werden sollten. Sie hatte zu entscheiden, was er lesen müsse, und durfte aus eigenem antworten. Er befreite sich dadurch für seine Arbeit, nicht nur am »Ring«, sondern auch an der soeben begonnenen Schrift über Beethoven, und für das Ausdenken verschiedener dramatischer Entwürfe, die alle der geschichtlichen Größe Deutschlands galten: Luthers Hochzeit, Bernhard von Weimar, Friedrich der Große.
Der Gegensatz zwischen Deutsch und Französisch war ihnen namentlich durch den Besuch Hans Richters, der eben aus Paris gekommen, nahegerückt. Über die Pariser Mode, der Cosima als Frau Beachtung schenkte, schrieb sie im Tagebuche: »Es ist das vollendetste Bild einer Mode, mit welcher wir nichts zu tun haben. Aber die Deutschen müssen die Mode mitmachen. Die Pariserin weiß aufs Haar, was sie ist, und zieht sich danach an. Aber die Deutsche schaut zu ihrer Nachbarin, beneidet sie und will's ihr nachmachen. Und dadurch geht die Schönheit fort. Nach den Befreiungskriegen war der Augenblick gewesen, wo der ganzen Nation ein Schwung zu geben war. Allein da haben sie das Wort deutsch gefürchtet, wie die rote Republik.« Sie stand jetzt in einem Gedankenkreise, der sie mit den tapfersten Vorkämpfern wahren Deutschtums im Zeitalter undeutscher »Reaktion«, mit Arndt und Jahn, verband – und sie fand den Widerhall ihrer Gedanken in der Bewegung, die sich gleichzeitig des deutschen Volkes bemächtigte.
»Die Franzosen sind aufgebracht, daß etwas ohne sie geschehen soll«, schrieb sie im Juli, als die französische Einmengung in deutsche Angelegenheiten bedrohliche Formen annahm. Eine Besteigung des Pilatus, die sie trotz ärztlicher Warnung mit Wagner unternommen hatte, um diesem die Freude nicht zu verderben, mußte sie mit einer Erschöpfung bezahlen, die sie sogar dazu nötigte, den Tag auf der Höhe im Bette zu verbringen. Wagner suchte sie zu zerstreuen, indem er ihr aus Tieck und Byron vorlas. Der Verkehr mit erlesenen Geistern war ihnen stets Bedürfnis und Gewohnheit. Doch die Gegenwart heischte ihr Recht und der Ruf der Welt drang in die Einsamkeit. Der Bergführer brachte die Nachricht von dem Ultimatum Napoleons an den König von Preußen. »Ich bin ganz außer mir«, schrieb Cosima, »über die französische Unverschämtheit. Dieses Volk verdient eine unbarmherzige Züchtigung.«
Heimgekehrt empfingen sie den Besuch Klindworths. Auch dieser fand, daß Wagner verjüngt und in seiner Stimmung nicht wiederzuerkennen sei. Über Bülows Befinden in Florenz waren schon vorher immer günstigere Nachrichten eingelaufen. Klindworth konnte nun aus eigener Anschauung berichten, daß Hans zufrieden sei. Auch habe dieser zu Klindworth gesagt: Wenn Wagner noch einen Ton schreibt, so ist das nur Cosima zu verdanken. Durch solche Nachrichten fühlte sie sich ermutigt, ihrem gewesenen Manne einmal ihr ganzes Herz auszuschütten – aber nicht brieflich, sondern durch Klindworth, den sie in ihr Vertrauen zog. Für sich schrieb sie: »Soll mir noch Trost beschieden sein, daß es Hans wirklich gut geht, dann, o Gott, hat es wohl nie eine Glücklichere gegeben als mich.«
Hierzu wäre noch zu bemerken, daß Klindworth durch den Verfall der Bülowschen Ehe eine Zeitlang gegen Cosima eingenommen war. Hans wußte dies und bat ihn eigens: »… wenn Du nach Luzern kommst, in jener unbefangenen weise – mit Berufung auf mich, wozu ich Dich völlig autorisiere – zu verkehren, wie ich's, der ich doch am Ende in diesem einen Punkte der kompetenteste Beurteiler bin, so gern sehen würde. Höchst dankenswert wäre mir aus Deiner Hand jedwede Notiz über das Befinden der Ex-Meinigen.« Als nun Klindworth nicht nur über die durchaus angenehmen Eindrücke seines Besuches berichtet, sondern ihm auch im Namen Cosimas ernste und rührende Mitteilungen gemacht hatte, da schrieb er: »Dein Brief hat mich sehr ergriffen, wie durch seinen Inhalt so durch das große Freundschaftspfand, das ich damit von Deiner Hand empfangen habe. Meinen innigsten Dank für alle Nachrichten. Dank auch, daß Du nicht schroff gewesen gegenüber einer viel verkannten, nicht bloß durch ihren Geist, sondern auch durch ihr opferfähiges Herz bedeutenden Frau. Du siehst, ich hatte in unseren Gesprächen nichts über- noch untertrieben – und ich habe keinen Anspruch darauf, meine ›edle‹ Handlungsweise, sondern nur, meine gerechte Denkart gerühmt zu sehen.«

Richard Wagner (1871).
Nach einer Rötelzeichnung von Franz von Lenbach.
Photo F. Bruckmann, München

Friedrich Nietzsche Anfang der 70er Jahre. M
it Genehmigung des Nietzsche-Archivs, Weimar
Unterdessen hatte das deutsche Schicksal seinen Lauf genommen. Der König von Preußen weigerte sich, den französischen Gesandten zu empfangen, und es kam zur Kriegserklärung. Richard und Cosima standen im Banne der Ereignisse. Der Krieg war schrecklich, das Ende ungewiß – aber in Paris vernahmen sie nichts als Phrasen, die Preußen sahen sie ruhig, fest und geschlossen. Wagner nannte die französischen Politiker – und er mußte damit auch den Schwager Cosimas meinen – ebenso Napoleon III., für den er niemals die seltsame Neigung seines Schwiegervaters geteilt hatte – er nannte sie rundweg eine Gaunerbande, die jetzt den Brand nach Europa werfe und dazu die Marseillaise singen lasse. Cosima war dadurch nicht verletzt, im Gegenteil, sie selbst war so außer sich über die Franzosen, daß sie Wagner schon zu belästigen fürchtete, und es trug nicht zu ihrer Beruhigung bei, daß just zur selben Zeit die französischen Freunde Catulle und Judith Mendès und Graf Villiers, deren längst angekündigten erneuten Besuch sie nun nicht mehr erwartete, in Triebschen eintrafen, als ob hier keine Deutschen wohnten. Villiers hatte sogar vorher ein Theaterstück geschickt, worin er sich über die Preußen lustig machte.
Die Nachricht von der Kriegserklärung empfingen die Gäste allerdings erst in Triebschen. Judith begriff, daß Wagner vom Gedanken der deutschen Einheit hingerissen war, und machte sogleich mit ihm aus, daß die brennenden Fragen, in denen sie nicht übereinstimmen konnten, während ihrer Anwesenheit nicht berührt werden sollten. Aber schwerer noch als Wagner hielt sich Cosima an diese Übereinkunft. Sie betrachtete das Verhalten der » grande nation« als ein Gewebe von Lüge, Unwissenheit, Unverschämtheit und Eitelkeit, und die amtlichen Erklärungen der französischen Regierung waren ihr, nach allem, was sie sonst erfuhr, ein nackter Betrug. Aber sie jubelte mit ihrem Manne darüber, daß Bayern mit Preußen ging. Der bayrische König war ihr wieder ein echter König, rein und groß in wahrhaft königlicher und deutscher Gesinnung. Die unentschiedene Haltung Österreichs verdroß sie. Dafür wandte sich ihr Herz Bismarck zu, und sie schrieb: »Dieser Krieg kann noch einmal zeigen, was an den Deutschen ist.« Sie begegnete sich darin mit dem Glauben Wagners, daß der Krieg ein gutes Ende nehmen und auch für ihn selbst, für seine Zukunftspläne segensreich ausfallen werde. Die Woge der Begeisterung, die durch alle deutschen Gaue bis nach Wien brandete, ergriff sie mächtig, und für deutsche Politiker, die da nicht mitkonnten, hatte sie das Wort »schamlos«, wie sie den Franzosen immer wieder Lüge und Prahlerei vorwarf. Daß der Sohn ihrer Stiefschwester in die französische Marine eintreten mußte, das fand sie begreiflich. Aber der Gedanke an die feindliche Flotte und an die Vorteile, die den Franzosen durch ihre Lage und durch ihre Eisenbahnverbindungen gegeben waren, ängstigte sie manchmal so sehr, daß Wagner ihr vorwarf, sie sei zu wenig »ideal« gesinnt. Falsche Nachrichten, wie sie in keiner Kriegszeit fehlen – die Franzosen haben geflissentlich solche Nachrichten über deutsche Vorkommnisse verbreitet –, erzählten auch von wüsten Erfolgen der Turkos gleich nach Kriegsbeginn und von der Teilnahme österreichischer Freiwilliger an dem französischen Kriegszuge. Wagner konnte sich nicht enthalten, seinen Gästen, mit denen er sonst hauptsächlich musizierte, geradezu ins Gesicht zu sagen, daß er das französische Wesen hasse. Cosima betete mit den Kindern für die Deutschen. Graf Villiers aber ließ sich nicht von der Vorlesung seines Stückes abhalten und erregte damit Empörung, die übrigens auch von dem Ehepaar Mendès geteilt wurde. Cosima fand in diesen Tagen keinen Frieden. »Die Mitrailleusen für unsere Männer, ihren Putz für unsere Frauen. Das ist, was die Franzosen für uns haben.«
Nach dem ersten deutschen Siege aber schrieb sie: »Gesegnet sei Deutschland und das deutsche Heer.« Bei jeder Nachricht sammelte sich ihr Herz zur Andacht. Wagner, voll Wärme für das Auftreten Bismarcks, sagte: »Eines erkenne ich, wer lügt und wer die Wahrheit sagt. Ersteres tun die Franzosen, das letztere die Deutschen. Bismarck ist ein wahrer Deutscher, deshalb hassen ihn die Franzosen.« Die Siegesnachrichten folgten einander, in Paris begann der Aufstand der Kommune. Cosima zupfte mit den Kindern Scharpie und sorgte für Binden und Leinwand – voll Glauben und voll Bangigkeit. Mit Wagner erkannte sie, daß »das Verlangen aller Guten nach dem endlichen Aufblühen des deutschen Wesens den Grund zum Siege über dieses so gefürchtete Frankreich und seine scheinbar unglaubliche Organisation« bilde. Namenlose Schmähbriefe an den Meister, so einer, der von den »Manen Meyerbeers und Mendelssohns« unterzeichnet war, trugen eher zur Erheiterung bei. »Ja, ein holdes Weib, das hat Beethoven nicht gehabt«, sagte Wagner. »Mir armem Alten war es vorbehalten, darum habe ich den unsinnigen Glauben an mich.«
Die französischen Gäste waren gegangen, doch Wagner hielt ihnen brieflich noch manche Strafpredigt. Nicht in leerer Rhetorik, nicht bloß in der Aufwallung patriotischen Gefühls, sondern mit jener Gerechtigkeit und jenem tiefen Blick in die menschlichen Verhältnisse, die ihn zu allen Zeiten bei politischen Umwälzungen auszeichneten. In seinem Briefe vom 12. August fand er Worte, die noch heute unanfechtbare Gültigkeit haben. »Sucht einen echten Staatsmann zu finden!« rief er den Freunden zu. »Nur der geht Euch ab, der könnte Frankreich aus seiner Lage befreien. Ein Staatsmann voll echten Mutes, der der öffentlichen Meinung nicht schmeichelt, die so irregeleitet ist, seitdem sie von unwissenden Journalisten und frivolen Tribünenkomödianten regiert wird. Einen Staatsmann braucht Ihr, der es vor allem verstände, der französischen Nation zu erklären, was die deutsche Nation ist und was sie will: denn diese ist es, die in Unwissenheit und Selbstgefälligkeit verdächtigte, die nun an Eure Pforte pocht, und keineswegs sind es die ›Preußen‹, als welche man uns zu betrachten beliebt, um uns einem tief verachtenden Haß gegenüber anzuprangern.« Schon stand das deutsche Heer vor Paris, und Wagner bemerkte dazu: »Die Freundin, die meine Frau zu nennen mich so glücklich macht, war erstaunt über die Ruhe, die ich ganz zu Beginn dieses Krieges bewahrt habe. Da erklärte ich ihr, in all dem, was sich abspiele, sähe ich ein Gottesurteil, das diesmal durch die Natur der Dinge und der Kräfte gefällt werde; in diesem Sinne sagte ich ihr: Sollten die Deutschen besiegt und vernichtet werden, so würde uns das ein Beweis sein, daß meine auf ihr künftiges Geschick gesetzten Hoffnungen nichtig seien und daß ich da in einen großherzigen Traum befangen gewesen sei. Nichts weiter! In diesem Sinne schreibe ich Euch jetzt: nehmt Euer Los hin, wie es geworfen ist, als ein Gottesurteil, und ergründet den tiefen Sinn dieses Urteils. Ich sehe mich – an Eurer Stelle – auf den Wällen von Paris, und dann sage ich mir: falls diese Riesenhauptstadt in Trümmer sinken soll, … die Wiedergeburt des französischen Volkes hätte ihren Ausgangspunkt, da dies Paris der Abgrund gewesen ist, worin der wahre Geist einer Nation sich verlor, wie er sich immer verloren hat, sobald er sich in eine einzige Stadt einsperrte, so wird er sich auf sich selbst besinnen und seinem Schicksal gemäß entfalten; und von da an wird es Franzosen geben, während es bis nun seit zwei Jahrhunderten bloß Pariser gegeben hat! … Denket an mich, während ich mich an Eure Stelle versetze: saget Euch, Wagner sei an Eurer Stelle, und es wird Euch nichts zustoßen! Das ist unser einziger Wunsch, der meine, wie der meiner teuren Cosima.«
Daß Cosima hier mit Nachdruck als Wagners Frau bezeichnet ist, war nicht nur eine gefühlsmäßige Redewendung des liebenden Gatten. Denn es fehlten nur noch wenige Tage, bis alle Welt der »Frau Wagner« huldigen durften. Am 3. August war der heißersehnte Spruch des königl. preußischen Stadtgerichtes in Berlin nach Triebschen gelangt. Das Band der Ehe Hans von Bülows mit Cosima war getrennt und Cosima gemäß ihrem Wunsche und der mit Hans getroffenen Vereinbarung wegen »böslicher Verlassung« (so will es die Rechtssprache!) als der schuldige Teil erklärt. Den vierten Teil ihres schuldenfreien Vermögens hatte sie dem Kläger Bülow als »Scheidungsstrafe« hinauszugeben und die Kosten des Streites zu tragen.
Am 21. August wurden Richard und Cosima in der protestantischen Kirche in Luzern öffentlich aufgeboten, und schon für den 25. war die Trauung bestimmt. Es war dies der Geburtstag des Königs, und Wagner, dem die politische Haltung Ludwigs II. jetzt noch größer und wichtiger erschien als alles, was er persönlich von ihm empfangen hatte und etwa noch erhoffte, begrüßte den Herrn und Freund mit dem Gedichte, das mit den klangvollen Worten anhebt: »Gesprochen ist das Königswort, dem Deutschland neu erstanden.« Die Hochzeitsfeier am Geburtstage des Königs zur Zeit der Erneuerung Deutschlands – es gab kaum ein schöneres Sinnbild für das Geschick, das sich nun am Meister erfüllte. Außer den Zeugen Hans Richter und der treuen Freundin Malvida von Meysenbug waren nur Bassenheims geladen. Malvida, die schon einige Tage früher eintraf, konnte wieder nur Gutes von Bülow berichten, dem sein Aufenthalt in Florenz so wohlgetan, daß er sogar hoffte, ein liebenswürdiger Mensch zu werden. Am 19. August waren genau dreizehn Jahre seit der Trauung Cosimas mit Bülow vergangen. Sie vermerkte dies mit den Worten: »Ich wußte nicht, was ich da versprach. Denn ich habe es nicht gehalten … Nie will ich die Sünde vergessen und ihr beständig in das Antlitz schauen, um Demut zu lernen und Ergebung.« Wenn sie aber schrieb, Paris sei nun für sie alle gleichgültig geworden, so war dies nicht vollkommen richtig. Sie selbst konnte sich dem starken Eindruck der fortlaufenden Nachrichten nicht entziehen. Nach der Einschließung der Franzosen in Metz schrieb sie: »Nun Gnade Gott unserer herrlichen deutschen Festigkeit, daß der Preis diesen furchtbar herrlichen Kämpfen entspreche« – und zur Gefangennahme Mazzinis in Palermo: »So sind denn die drei Gestalten, die mein Vater verehrte, in beneidenswürdiger Lage. Mazzini im Gefängnis, der Papst in tausend Ängsten und Louis Napoleon in der Gosse.« In dieser beinahe fieberhaft erregten Zeit unmittelbar vor der Trauung wurden aber auch bedeutungsvolle Briefe abgesandt. Wagner schrieb an Marie d'Agoult, Cosima an Frau Wesendonck, die unter den ersten sein sollten, die von der Eheschließung erfuhren. Schrecken und Trauer erfüllte Cosimas leicht verwundbares Herz, als Wagner einen namenlosen Brief von einer Frau in München erhielt, die gewettet hatte, daß es nicht zur Heirat kommen würde. Cosima sei ja nur eine Intrigantin und der König sehr ungehalten über das Gerücht von der bevorstehenden Vermählung. Wagner solle seine Freunde beruhigen und in den Neuesten Nachrichten Ja oder Nein einrücken. »Ich habe der Frau kein Leides getan, was hat sie davon, mich zu schmähen. Hat denn nicht eine jede ihren Kreis, für den sie schafft? Wie kommt man dazu, eine Unbekannte so zu beschmutzen? Der Neid kann es nicht sein, denn in der Welt kann mich niemand beneiden, da ich aus der Welt geschieden bin.« Das war freilich ein Irrtum. Nur Neid und Eifersucht, wozu bekanntlich in der »Welt« durchaus keine persönliche Kränkung notwendig ist, und die verhängnisvolle Art, in der jeder große Name und jeder Triumph der Persönlichkeit von der »Welt« als Störung empfunden wird, sind der Quell solcher Schmähungen und Verdächtigungen.
Aber das waren nur Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, die die Festfreude nicht stören durften. So gewaltig schwoll Cosima das Herz, daß sie Gott um die Gnade bat, sie möge in ihrem Glück des Trauernden, Leidenden nicht vergessen. Auch am Hochzeitstage gedachte sie Bülows. »Um acht Uhr fand unsere Trauung statt. Möge ich würdig sein, Richards Namen zu tragen. Meine Andacht hat sich auf zwei Punkte gesammelt: Richards Wohl, daß ich es stets befördern könnte, Hansens Glück, daß es ihm fern von mir beschieden sei, ein heiteres Leben zu führen.«
Ja, sie trug jetzt Richards Namen. Er lachte wie ein Kind, als er ihre Unterschrift las: Cosima Wagner.