
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Auf der ersten Seite der von Wagner diktierten Erinnerungen findet sich neben der Zeitangabe (»17. Juli 1865«) ein magisches Zeichen, die Anfangsbuchstaben R, C und W zur Einheit verschlungen als Sinnbild der Seelen- und Arbeitsgemeinschaft. Zu Weihnachten desselben Jahres hatte Wagner als Geburtstagsgeschenk für Cosima ein Paar Handschuhe ausgedacht, worin die Buchstaben C und W, das Namenszeichen für Cosima Wagner, in folgender Weise gestickt sein sollten: das C. liegend als zunehmender Mond, auf dem wie auf einem Schifflein das stehende W schwimmt. Das waren also Sinnbilder, ernste Spielereien, die die Gegenwart ausdrückten und zugleich einen ersehnten Zustand vorausnahmen, dessen dereinstige Verwirklichung niemand verbürgen konnte. Und nun war er verwirklicht, nun waren die Sinnbilder nur noch Gegenwart, nun war auch die »Abendwonnepracht« des Gedichtes vom 1. Oktober 1864 zum leuchtenden Tag geworden und die Sonne Wagners mit dem Stern Cosimas vermählt. Wenn Glasenapp meint, kein Bund habe jedem Deutschen heiliger zu sein als die Ehe Wagners mit Cosima, so ist auch der 25. August 1870 ein Fest- und Gedenktag für jeden, dem die deutsche Kunst und der Gedanke von Bayreuth heilig sind. Denn an diesem Tage ist nicht nur das persönliche Glück zweier großer Menschen besiegelt und bekräftigt worden. Es wurde damit auch der Grund gelegt und die Möglichkeit geschaffen für die Fortführung des Wagnerschen Werkes nach seinem Tode durch die berufene Erbin.
Das restliche Drittel des Jahres 1870 war gleichsam nur ein verlängertes Hochzeitsfest, vorerst gab es Mitteilung und Danksagung nach allen Seiten. Judith Gautier wurde zuerst begrüßt, der Glückwunsch des Königs gebührend erwidert. Unter den Hochzeitsgaben war auch ein Edelweißstrauß gewesen, mit dem Mathilde Wesendonck in sinniger Weise auf die Gefahren angespielt hatte, unter denen dieses am Rande des Abgrundes blühende Glück errungen worden. Das Paar fuhr dann seinem Versprechen gemäß nach Mariafeld, wo Frau Eliza Wille etwas Tröstliches von Liszt berichtete, dessen anscheinend geringe Teilnahme an den vergangenen Ereignissen Cosima tief geschmerzt hatte. Nach einer Mitteilung der Frau Wille sollte er gesagt haben: »Jetzt hat meine Tochter den Mann, der ihrer würdig ist.« Ganz so wird sein Wort freilich nicht gelautet haben. Auch Hans war Cosimas »würdig« gewesen, und Liszt liebte ihn wie einen Sohn. Aber in irgendeiner Form hatte er wohl dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß in der Verbindung Cosimas mit Wagner eine besondere Ebenbürtigkeit vollzogene Tatsache wurde. Lenbach hatte eines seiner Cosima-Bildnisse als Hochzeitsgeschenk angekündigt, wofür ihm Cosima überschwenglichen Dank zollte, mit dem Beisatze, daß nun auch Wagner drankommen müsse. Ein Wagner-Bildnis von Lenbach sei »unschätzbar für kommende Zeiten«.
Für Sonntag, den 4. September, war die Taufe Siegfrieds in Aussicht genommen. Am 2. September war Napoleon III. bei Sedan gefangengenommen worden. Der Hausherr Oberst Am Rhyn überbrachte die Nachricht. Da rief Wagner: »Das ist ein Taufgeschenk für Fidi. Neun Schlachten in einem Monat, alle siegreich, und dieser Abschluß! Gott im Himmel, welches Schicksal! Ich bin den Napoleons verderblich. Wie ich sechs Monate alt war, kam die Schlacht bei Leipzig, und Fidi manscht das ganze Frankreich zusammen.« So war die Stimmung bei der Taufe, an der auch Willes teilnahmen, in jeder Hinsicht freudig gehoben. Zu Beginn der Handlung brach ein gewaltiges Gewitter los, das sich bei den ersten Worten des Geistlichen zu einem furchtbaren Donnerschlag steigerte, war es diese Naturerscheinung oder das Ungewohnte der Zeremonie, der schon fünfvierteljährige Fidi war recht unruhig und fing sogar kläglich zu weinen an. Aber das alles war nur Veranlassung zu gemütlichen und scherzhaften Betrachtungen.
Cosima freilich verfiel immer wieder, und gar bei so bedeutungsvollen Anlässen, in ihre schmerzlich-schwärmerische Betrachtungsweise, die wir uns gar nicht ernst genug vor Augen halten können, wenn wir ihr Verhalten nach Wagners Tod und ihre ungeheuren Leistungen als Herrin von Bayreuth im tiefsten verstehen wollen. So schrieb sie: »Meine Verbindung mit Richard ist mir wie eine Wiedergeburt, die mich der Vollkommenheit näherbringt, eine Erlösung vom früheren irrenden Dasein. Allein ich fühle und sage es ihm, daß unsere vollkommene Vereinigung erst mit dem Tode, in der Erlösung von den Schranken der Individualität sein wird.« Wie völlig sie mit dem Denken und Schaffen des Meisters vertraut war, das erhellt beispielsweise daraus, daß sie Wagners Aufsatz »Was ist deutsch?« – der zur Belehrung für den König bestimmt gewesen war und den der Verfasser nun der Freundin Malwida vorlas – vollständig auswendig wußte. Wagner legte aber auch den größten Wert darauf, daß Cosima alles, was er geschrieben oder geschaffen hatte, sofort kennenlernte, daß ihr nichts von seinen Plänen und Entwürfen verborgen blieb, wenn sie da nicht immer standhalten konnte, weil sie sich den Kindern widmen mußte, dann sagte ihr Mann wohl einmal in scherzhaftem Ärger: »Keine Mutter erzieht ihre Kinder allein.« Sie erwiderte ernst: »Ich glaube, daß meine Kinder es mir Dank wissen werden, ihnen soviel gewesen zu sein.« Er aber entgegnete: »Du bist ja auch nicht von deiner Mutter erzogen worden.« Worauf sie sagte: »Ich wäre auch besser ausgefallen, hätte ich eine Mutter um mich gehabt.« Als daraus ein kleiner Streit entstand, der der Gattin die besorgte Frage entlockte, ob ihr Mann sie liebe, da löste sich alles in der überströmenden Antwort: »Ich habe ja kein anderes Geschäft, als dich einzig auf der Welt zu lieben.«
Mit der Mutter stand sie zwar auf dem besten Fuße, aber die Verhältnisse waren jetzt dem Verkehre nicht günstig. Es gehört zu den tragischen Begleiterscheinungen jedes Krieges, daß die Angehörigen der kämpfenden Völker Partei nehmen müssen, und daß die Grenzen zwischen der Vaterlandsliebe und verblendeter Ungerechtigkeit gegenüber dem Feinde allzu schwer zu ziehen sind. Marie d'Agoult, wiewohl durch Abstammung, Erziehung und Geistesrichtung in mannigfachster Weise mit deutschem Wesen verknüpft, sah doch als Pariserin die kriegerischen Verwicklungen, die ihr Vaterland demütigten und allen Franzosen Leid brachten, mit ganz anderen Augen an als ihre Tochter. Wenn sie sich jetzt in Triebschen zu erholen wünschte, so konnte sie dort nur störend wirken, und es mußte ihr auch in dieser doch fremden Umgebung die rechte Erholung versagt bleiben. Cosima riet daher ab. Die Weiterentwicklung des Krieges – Sturz des französischen Kaiserreiches, neue, republikanische Regierung, Vormarsch der Deutschen, Einschließung von Paris – hielt die Bewohner von Triebschen unausgesetzt in Atem, und im Tagebuch Cosimas finden wir immer wieder die bedeutsamsten Aussprüche Wagners über das Verhältnis von Deutschen und Franzosen, über die Bedeutung der preußischen Macht, die hier geradezu Europa gerettet und Deutschland erst ermöglicht habe, über Bismarck und Moltke, über die unzulängliche Vertonung der »Wacht am Rhein«, über eine sinfonische Heldenklage, die er selbst schaffen wollte, über seine neu erwachte Zuversicht zum deutschen Vaterlande und zum Werke von Bayreuth. So führten die Weltbetrachtung und das vaterländische Empfinden immer wieder zur Vertiefung und Bekräftigung des eigenen Willens und persönlicher Hoffnungen.
Ganz bei sich aber, in der engsten trauten Heimat fühlten sie sich, als zu Beginn des Monats Oktober das von Lenbach angekündigte Bildnis eintraf. »Hätten Sie Wagners Ergriffenheit davon gesehen«, so schrieb Cosima an den Maler, »so würden Sie begreifen, daß ich Ihnen eigentlich gar nichts darüber sagen kann. Seine Freude wächst mit jedem Augenblick, wie soll ich es Ihnen danken, daß Sie es mir ermöglicht haben, ihm einen solchen Quell der ewig sich erneuenden Beglückung darzubieten? Mir persönlich kommt es vor, als ob die Idee, der ich entsprungen, die weit über meiner armen Individualität steht, die so ewig ist, wie mein kleines Ich vergänglich, daß diese Ihnen zu dem wunderbaren Bild gesessen; ich bin es unverkennbar, und doch ist es mehr als ich – – verzeihen Sie, daß ich beinahe auf das Gebiet der Philosophie mich verliere, um Ihnen auszusprechen, was mich beim Anblick dieses unvergleichlichen Werkes so erhaben stimmt. Welchen Schatz haben Sie unserem Hause für alle Zeiten zugeführt, wie für Wagner im Anblick des Bildes versunken eine Vergangenheit der Trennung lebendig und ihm zugleich ersetzt wurde, wie unsere Gegenwart seelenvoll geschmückt und geadelt durch das Kunstwerk geworden ist, so schaue ich in die Zukunft, und eine innige tiefe Freude erfüllt mich, daß meine Kinder das von mir sehen und kennen werden, was ihnen selbst die Wirklichkeit des Verkehrs mit mir vielleicht niemals enthüllt hätte, denn der Künstler sieht das Ewige, das Ideal, das Wahre, und gönnt es uns durch ihn zu sehen. Wie vieles wäre über eine solche Gabe zu sagen, und doch eigentlich zu sagen ist nichts. Beinahe zweifle ich aber, daß Sie wissen, was wir Ihnen danken.« Cosima berichtete auch, daß der zweijährige Sohn Verena Stockers, der sie nie in der gemalten Tracht gesehen hatte, sie beim Auspacken des Bildes sofort erkannte und dann nicht wollte, daß man es abstaube, »um der Frau nicht wehe zu tun«. Drei Wochen später kam sie wieder in einem Briefe an Lenbach, an den »werten Meister und Freund«, auf den Anblick des Bildes zurück: »Es ist etwas unsäglich Beruhigendes und Erfreuendes in der Dauer und Stetigkeit einer schönen Empfindung: mir wurde die Musik durch ihr Aufhören, Verschwinden fast immer zur Qual; wirkt die Malerei nicht mit der Intensivität, so ist sie dafür bleibend, nachhaltig; jeden Augenblick gönne ich mir die Betrachtung dieses herrlichen Bildes, ganz uneingedenk, daß ich es bin … Gar lächerlich nimmt sich mit der Ankunft des Bildes aller übrige Besitz aus, bestehend aus dem heutzutage ausmachenden Schmuck eines Wohnhauses; Das Mädchen aus der Fremde oder Der vornehme Besuch im Bauernhofe haben wir Ihr Werk getauft.«
In dieser Seit, am 19. Oktober, schrieb sie auch: »Ich gedenke meiner Verlobung vor fünfzehn Jahren unter den Auspizien der ›Tannhäuser‹-Ouvertüre in Berlin. Wie möcht' ich das gutmachen, daß Hans durch mich gelitten, vielleicht – hoffentlich vermögen es die Kinder.«
Mit einem zweiten Besuch in Mariafeld bei Willes verband Cosima auch einen Besuch bei Frau Wesendonck, und zwar sie allein, ohne Wagner. Beide zusammen verbrachten dann noch mit anderen Züricher Freunden einen schönen Abend. In Triebschen selbst trafen immer wieder Besuche ein, so Marie Muchanow, Alfred Meißner und natürlich – am häufigsten – Nietzsche. Dieser hatte als Krankenpfleger und Führer einer Sanitätskolonne am Kriege teilgenommen und war dabei selbst schwer erkrankt. Nun verbrachte er zu seiner Erholung auch die Weihnachten im Hause Wagners und wurde so Zeuge der schönsten Geburtstagsfeier, die Cosima je erlebte. Am ersten Weihnachtsfeiertage wurde sie durch eine wunderbare Musik geweckt, die sie noch nie vernommen. Auf der Treppe, die zum Wohnzimmer hinabführte, war ein kleines Orchester aus Luzerner Musikern aufgestellt, mit denen Hans Richter ein neues Werk, eine kleine Sinfonie in einem Satz, eingeübt hatte – das heute allgemein bekannte, längst »populär« gewordene »Siegfried-Idyll«. Wagner hatte also doch auch einmal heimlich gearbeitet und hatte es verstanden, Cosima zu täuschen. Während sie geglaubt hatte, er arbeite an der »Götterdämmerung«, war er vielmehr ganz eingesponnen gewesen in die zarten und innigen Töne, die aus dem letzten Aufzug des »Siegfried« herüberwehten, nun aber, losgelöst von dem dichterischen Untergrunde, nur als selige Weise seines Glückes und seiner friedlichen Umgebung tönen sollten.
Man kann von allen Wagnerischen Dramen sagen, sie seien Selbstbekenntnisse, Darstellungen des eigenen Lebens, in ein großes, allgemeinverständliches Bild gefaßt. In diesem Sinne ist die Musik, in der der Gehalt seiner Dramen sich so zwingend ausspricht, nichts anderes als das große lyrische Bekenntnis des Tondichters. In diesem Sinne hat der Dramatiker Wagner, genau so wie alle anderen Meister, Musik für sich und aus sich geschrieben, Musik, die den unaufhörlich wechselnden, alle Höhen und Tiefen eines leidenschaftlichen Gemüts durchmessenden Stimmungen, die seine Lebenslage hervorrief, den bestimmtesten Ausdruck verlieh. In diesem Sinne gibt es bei Wagner keinen Unterschied zwischen dramatischer und »absoluter« Musik, und braucht niemand zu beklagen, daß Wagner keine Sinfonien und keine Sonaten geschrieben hat: sie sind eben in seinen Bühnenwerken enthalten. Diesmal aber bequemte sich Wagner, dessen überströmender Schaffensdrang auch nach kleineren Formen selbständiger Musik verlangte, zu einem richtigen Konzertstück, das keine großen Mittel beanspruchte, das aber zunächst nur als Widmung an Cosima gedacht war und dessen spätere Veröffentlichung von ihr und vom Meister selbst beinahe wie die Preisgebung eines Familiengeheimnisses empfunden wurde. Nach dem Frühstück ertönte das »Idyll« – von Wagner geleitet – noch zweimal neben anderen Musikstücken. Richter blies die Trompete und schmetterte prachtvoll das Siegfried-Thema. Die Kinder nannten das Werk lange Zeit die »Treppenmusik«.
Als es im Jahre 1877 gedruckt erschien, trug ein dem Titel angefügtes zweites Blatt das nachfolgende, an Cosima gerichtete Gedicht, worin alles gesagt ist, was der Welt über den persönlichen Gehalt dieser kleinen sinfonischen Dichtung zu sagen war:
»Es war Dein opfermutig hehrer Wille,
der meinem Werk die Werdestätte fand,
von Dir geweiht zur weltentrückten Stille,
wo es nun wuchs und kräftig uns erstand,
die Heldenwelt uns zaubernd zum Idylle,
uraltes Fern zum trauten Heimatland –
erscholl ein Ruf da froh in meine Weisen:
»ein Sohn ist da« – der mußte Siegfried heißen.
Für ihn und Dich durft' ich in Tönen danken, –
wo gäb' es Liebestaten holdren Lohn?
Sie hegten wir in unsres Heimes Schranken,
die stille Freude, die hier ward zum Ton.
Die sich uns treu erwiesen ohne Wanken,
so Siegfried hold, wie freundlich unsrem Sohn,
mit Deiner Huld sei ihnen jetzt erschlossen,
was sonst als tönend Glück wir still genossen.«
Der zweite Absatz lautete ursprünglich anders. Cosima, die das Werk als ihr Eigentum betrachten durfte, hat es der Öffentlichkeit, die Wagners Streben verkannte und seine Werke so oft verunglimpfte, nur widerstrebend preisgegeben. Sie fürchtete die Herabsetzung, die auch dieser reinen und edlen Gabe widerfahren konnte. Aber der Gedanke der Furcht war das letzte, womit der Meister von einem Entschluß abzubringen war. So reimte er denn zu den Anfangszeilen des zweiten Absatzes:
»Doch sollt' ich jetzt wohl bangen dem Gedanken,
biet' ich das traute Lied der Welt zum Hohn?
Doch brächte mich der Feinde Wucht zum Wanken,
wie wärst Du mein, und Siegfried hieß' mein Sohn?
Kann dem ich wenig lehren und erwerben,
das Fürchten doch soll er von mir nicht erben!«
Auch diese Herausforderung der Öffentlichkeit, dieser Kampfruf entsprach nicht dem Sinne der Meisterin. Wennschon das Tongedicht – aus geschäftlichen Rücksichten – veröffentlicht werden mußte, dann war mit ihm vor allem den Freunden zu danken, die sich inzwischen in so großer Zahl und mit so kräftigem Mut um den Mann von Bayreuth geschart hatten und einen besonderen Dank verdienten. An abseits Stehende oder gar feindlich Gesinnte, an Krittler und Nörgler, denen dieses Stück kein Bekenntnis, sondern nur ein Geistes-»Produkt« war, wollte sie nicht denken. Wagner sah dies ein, änderte den zweiten Absatz, und so haben wir nun die besonders schönen Schlußzeilen, die heute wohl das Bekannteste sind, was Wagner neben seinen Dramen gedichtet hat, und deren herzliche Wendung wir demnach vor allem Cosima verdanken. Das Stück selbst hat überall Beifall gefunden. Die kritische Überheblichkeit, die sich so oft erdreistete, die erhabensten Gebilde Wagnerscher Meisterschaft spöttisch zu verkleinern, sie hat am »Siegfried-Idyll« nie etwas auszusetzen vermocht; geistvolle und tiefgründige Abhandlungen über die Erneuerung der Sinfonie, über die Kunst der Instrumentation u. dgl. m. sind an dieses kleine Werk geknüpft worden; und wo immer es mit seinem Wohllaut und seiner bezwingenden Melodik zu den Ohren und in die Seele dringt, da werden die Hörer, sanft emporgetragen, der weltentrückten Stille teilhaftig, in der es entstanden: sie atmen den Zauber von Triebschen, sie empfinden den Segen Cosimas.
Der Traum des Triebschener Idylls – wie das »Siegfried-Idyll« ursprünglich hieß – war nun bald ausgeträumt. Die Welt forderte ihr Recht. Es galt, mit ihr den Kampf aufzunehmen oder zu einem brüderlichen Einverständnisse zu gelangen, wenn der Festspielgedanke verwirklicht werden sollte. Die Freunde, die immer zahlreicher wurden und dem noch immer arg verketzerten Meister jetzt doch einen starken Rückhalt gaben, sie vor allem mußten belehrt und gelenkt werden; von selbst trafen sie nicht das Richtige, hatte doch der König aus der Tatsache der Vollendung des »Siegfried« auch schon seine gewohnte Folgerung gezogen: das Werk sollte in München, wo »Rheingold« und »Walküre« bereits verschwunden waren, als Neuheit aufgeführt werden. Wagner rüstete demnach zu einem Eroberungsfeldzuge, den er ganz persönlich zu führen hatte. Sein treuester Begleiter, sein beharrlichster Mitkämpfer, sein unentbehrlicher Bundesgenosse war Cosima, die, in alles eingeweiht, an allem mitwirkend, sich nie mehr, nicht für einen Tag, von ihm trennen wollte.
Das ruhige Leben in Triebschen wurde also immer häufiger unterbrochen. Zu den Hausgenossen zählte sehr oft Hans Richter, der seine Ferien und seine dienstfreie Zeit stets dazu benützte, um nun auch die Reinschrift der neuen Teile des »Rings« herzustellen, und der dabei, als Freund und Vertrauter der Familie, für allerlei Geschäftliches und für mancherlei Unterhaltung sorgte. Musikalisch belebte er die Triebschener Tage durch seine Fertigkeit am Harmonium, mit der Bratsche und dem Horn und hauptsächlich im Vereine mit drei Züricher Musikern, mit denen, unter Wagners tiefdringender und befeuernder Leitung, die Beethovenschen Quartette durchgenommen wurden. Das war gleichsam die Beethoven-Feier, die Wagner in diesem Winter bei sich veranstaltete, nachdem er schon den auf den 16. Dezember fallenden 100. Geburtstag Beethovens mit seiner Schrift in so unvergleichlicher Weise der Öffentlichkeit zum Bewußtsein gebracht hatte. Richter, in dem viel österreichische Heiterkeit und Lebendigkeit war, veranstaltete und leitete auch, wenn seine Anwesenheit in die bessere Jahreszeit fiel, Ausflüge und Gartenfeste – und wenn in der schlechteren Jahreszeit der Meister am Abend aus Dichterwerken vorlas, wobei alle großen Geister der Vergangenheit von Homer und Plato bis zu Shakespeare und Goethe, aber auch Byron und E. T. H. Hoffmann abwechselnd zu Worte kamen, da war Richter nicht nur ein willkommener und dankbarer Zuhörer, sondern er wurde auch selbst zum Vorleser und erfreute den Meister dann und wann in seiner frischen, vollsaftigen Art und in der ihm vertrauten Wiener Mundart mit Raimundschen Märchenstücken. Neben den Dichtern kamen die Künder und Deuter der Geschichte zu Wort, so Carlyle und Ranke, deren Darstellung des Preußentums, der großen Mächte und der gesamteuropäischen Entwicklung jetzt, zu Beginn des Jahres 1871, besonders aufschlußreich war.
Am 18. Januar war der König von Preußen in Versailles zum Deutschen Kaiser gekrönt worden. Wagner, der mit seinem aristophanischen Lustspiel »Eine Kapitulation« nicht so sehr die Vorgänge in Paris als vielmehr die traurige Abhängigkeit der deutschen Bühnen von Frankreich zum Gegenstande eines ergötzlichen und geistreichen Spottes gemacht hatte – Hans Richter sollte die dazu geeignete »Offenbachsche« Musik schreiben –, Wagner feierte nun den Endsieg Deutschlands und die Gründung des neuen Reiches mit seinem Gedichte »An das deutsche Heer vor Paris«, das er Bismarck übersandte, und mit dem Kaisermarsch, in den die »Feste Burg« Luthers verwoben war und von dem Nietzsche in seiner späteren Schrift »Richard Wagner in Bayreuth« so treffend sagte: hier werde der wiedergewonnene Glaube an das Volk der Reformation in herzbewegenden Tönen laut, der Glaube, daß es die Kraft, Milde und Tapferkeit bewähren werde, die nötig ist, um »das Meer der Revolution in das Bett des ruhig fließenden Stromes der Menschheit einzudämmen«. Den Ausklang des Marsches, der eigentlich eine sinfonische Dichtung war, bildete eine echt deutsche Weise, die vom ganzen Volke beim feierlichen Einzuge der siegreichen Truppen in Berlin mitgesungen werden sollte. Zu dieser musikalischen Feier kam es aber nicht. Wagners Pläne waren immer, auch dann, wenn er nur so nebenbei einem für ihn eigentlich abseits liegenden Zwecke dienen wollte, einfacher und volkstümlicher, als es die großstädtische »Kultur« zu würdigen vermochte. Mit Berlin jedoch trat er nun tatsächlich in nähere Verbindung. Die königliche Akademie der Künste hatte ihn zum auswärtigen Mitgliede ihrer musikalischen Sektion gewählt, und er wollte seinen Dank durch die Abhaltung eines Vortrages in Berlin abstatten.
Im Februar hatte er endlich Wesendoncks besucht, die entschlossen waren, nach Dresden überzusiedeln, und auch diesmal hatte es in der Stadt einen schönen Abend gegeben, bei dem die Musiker, die sonst nach Triebschen kamen und die für diesmal nach Zürich bestellt waren, Frau Cosima mit einigen ihrer Lieblingsstücke erfreuten. Daran hatte sich wieder ein Besuch in Mariafeld geschlossen, wo sich die mitgenommenen Kinder besonders wohl fühlten.
Im März war Marie d'Agoult eingetroffen. Ihrem Wunsche, sich bei der Tochter von den Schrecken und Sorgen des Krieges auszuruhen, hatte man sich doch nicht widersetzen können. Das Beisammensein fiel angenehmer und gemütlicher aus, als die Triebschener erwartet hatten. Wagner und die Gräfin kamen sich herzlich nahe, und der Gast schied auch mit dem Gefühle der Dankbarkeit für die tiefen geistigen Eindrücke, die er im Verkehre mit dem Meister und bei der Beschäftigung mit seinen Werken empfangen hatte.
Eine vorübergehende Verstimmung brachte der Umstand, daß die Rente, die Cosima durch eine Pariser Bank von ihrem Vater erhielt und die während des Krieges nicht flüssig gemacht werden konnte, nun wieder eintraf, aber so wie früher mit der Anweisung an »Baronin von Bülow«. Liszt hatte es offenbar unterlassen, der Bank die zweite Vermählung seiner Tochter sofort bekanntzugeben. So peinlich dies auf Cosima und noch mehr auf Wagner wirken mußte – wir glauben nicht an eine Absicht Liszts. Die Bank hatte eben ganz von selbst, ohne erst Nachrichten abzuwarten, die Zahlungen wieder aufgenommen, und es bedurfte nur einer kurzen Erinnerung durch Cosima, um diese Sache in Ordnung zu bringen.
Liszt selbst hatte, als ihm von dritter Seite mitgeteilt worden war, daß die Rente für Cosima ausgeblieben sei, den Betrag von 1500 Francs durch Eduard Liszt in Wien an »Madame Richard Wagner« überweisen lassen.
Große Freude bereitete ihr der Entwurf eines Bildes, das Lenbach noch in München von der kleinen Eva gezeichnet und das sie jetzt von ihm erbeten hatte. »Ich habe Evchen erhalten«, schrieb sie ihm, »und bin Ihnen sehr dankbar, sie mir geschickt zu haben. Es ist mir unendlich wertvoll, das Antlitz des Kindes, wenn auch nur in einer flüchtigen Skizze, aus einer Zeit zu haben, die nicht mehr zu erobern ist und die mir selbst in der Erinnerung nach und nach sich verwischte. Nun ist sie mir festgehalten, und zwar durch Sie, geehrtester Meister! … Durch Sie habe ich das Kind gesehen, wie es war, als wir zusammen vor einigen Jahren in Ihrem Atelier weilten, wie es nicht mehr ist, nie wieder sein wird, und für mich nun ewig gewonnen.«
Die bevorstehende Reise wirkte auf Cosimas Gemüt zunächst nicht erheiternd. Sie ahnte die Enttäuschungen, die auch ein siegreicher Feldzug dem Meister bereiten mußte, und sie empfand all die Mißverständnisse und Ärgernisse, die den streitbaren Helden zwar erbittern, oft tief verwunden und dennoch im rechten Schwung erhalten, ihn stacheln und stählen, als ein drohendes Verhängnis. »Wir gehören nicht mehr unter Menschen, wir sind nur glücklich mit uns und bei uns.« Das war ihre Stimmung nach jedem Besuche in der Nachbarschaft, und es erschien ihr wie ein »Frevel«, daß sie nun gar mit der »Welt« in erneute Berührung kommen sollte. Aber auch ihr war dieser Stachel nötig, als Schulung für ihre große Aufgabe.
Der Weg nach Berlin ging über Leipzig und Dresden, vor allem jedoch über Bayreuth, wo der Augenschein entscheiden sollte, ob diese kleine Stadt mit ihrer großen Opernbühne für die Festspiele geeignet sei. Am 17. April trafen Wagner und Cosima dort ein, unangesagt und vorerst unbemerkt, so daß sie sich ungestört in die eigentümlichen Reize dieses deutschen Winkels vertiefen konnten. Das alte Opernhaus, ein Prunkbau Carlo Bibienas, vielleicht das Reizvollste und Eigenartigste, was vom Theaterbau der Rokokozeit geleistet wurde, erwies sich freilich als völlig ungeeignet. Dieses Theater war vor allem Zuschauerraum; die Bühne trat daneben zurück. Auch als sie bei der Eröffnung am 23. September 1748 mit dem größten malerischen Geschick zu einem riesigen Festsaal erweitert schien, sollte dieser doch nur als ein mächtiges Spiegelbild des Zuschauerraumes wirken. Hier hatte einst ein prachtliebender Hof und eine festlichfrohe Gesellschaft ohne Gage mitgespielt, und das gebotene Kunstwerk war vor allem ein gesellschaftliches Ereignis gewesen. Das Haus, das Wagner meinte und wofür Semper, in genauer Erfüllung seiner Wünsche und Angaben, den herrlichsten Plan entworfen hatte, dieses Haus sollte allerdings auch den Zuschauern ihr Recht geben, weit mehr, als es üblich war, aber nur den Zuschauern in ihrer wahren Bedeutung, nur den Teilnehmern an der tragischen Handlung, vor der ihr Eigenleben und ihr persönliches Dasein zu verschwinden hatten. Also verdunkelter Zuschauerraum und unsichtbares Orchester. Nichts durfte in die Augen fallen als die Handlung selbst, das tragische Geschehen, worin das Schicksal jedes einzelnen und des ganzen Volkes mit ausgedrückt war.
Um dies erleben zu können und um einmal ganz aufzugehen in einem Werke der Kunst, während sonst diese sich dem außerkünstlerischen Zwecke anzupassen hatte, dazu bedurfte es für die Zuschauer einer ganz anderen Anordnung der Sitzreihen, als in diesem Opernhause, wo die Besucher mehr einander gegenüber als vor der Bühne saßen, wo alles sich um den höfischen Mittelpunkt, um die Fürstenloge gliederte, die fast allein sich im richtigen Verhältnisse zur Bühne befand. Dieselben Übelstände, die in ganz Europa in den Opernhäusern den künstlerischen Eindruck schädigten und ihn vielen Besuchern geradezu verwehrten, sie waren in diesem an sich köstlichen Bau, der die Forderungen, denen er zu genügen hatte, aufs vollkommenste verwirklichte, womöglich noch gesteigert. Die Schaffung einer neuen Form des Theaterbaus war mit dem Festspielgedanken stets innig verknüpft gewesen. Hier nun, in Bayreuth, wo die abgelegene, verträumte Stadt mit ihren geschichtlichen Erinnerungen und ihrer lebendig grünen, so recht deutschen Umgebung sich als der geeignetste Festspielort erwies, hier war es leichter als in der Hauptstadt mit ihren Eigengesetzen und ihren vom Verkehr und der städtischen Entwicklung gestellten Forderungen, den Baugedanken zu verwirklichen.
Wagner und Cosima fanden auf ihren Rundgängen, geleitet vom Verwalter des Neuen Schlosses, auch einen Platz am Rande des Hofgartens, der ihnen für die Erbauung des eigenen Heims besonders geeignet erschien. Auf dem freien Platze nicht weit davon, am Ende des Hofgartens, sollte womöglich das Festspielhaus errichtet werden. In der kühnen, unbedenklichen Art, mit der Wagner so oft sein Schicksal selbst bestimmte, teilte er am 12. Mai von Leipzig aus seinen Freunden mit, daß er im Sommer 1873 in Bayreuth den »Ring« aufführen wolle. Mit den maßgebenden Bayreuther Stellen war er noch gar nicht in Verbindung getreten! Erst nach einigen Monaten wandte er sich von Triebschen aus an den Bayreuther Bankherrn Friedrich Feustel, der mit seiner Schwester Ottilie Brockhaus befreundet war. Er bat ihn, nach einem geeigneten Platze Umschau zu halten, und fügte hinzu, daß er die Stadt Bayreuth für sein Unternehmen in keiner Weise in Anspruch nehmen werde, es sei denn, sie stelle ihm den Baugrund zur Verfügung. Die Antwort lautete so günstig und die weiteren Verhandlungen nahmen einen so glatten Verlauf, daß Wagner am 23. November an Feustel schreiben konnte: »Sie haben nur den Wink meines guten Dämons bestätigt, der mir, als ich nach dem Fleck deutscher Erde suchte, auf dem ich endlich mich auch bürgerlich heimatlich niederlassen sollte, dieses fast unbeachtete, so freundlich in Deutschlands Mitte liegende Bayreuth aus ferner Jugenderinnerung hervorrief.« Wagner hätte es leicht gehabt, sein Festspielhaus an den besuchtesten Verkehrsstätten zu errichten und dabei über unbegrenzte Mittel zu verfügen. Im Zeitalter der Gründungen und Spekulationen war sein Festspielgedanke nicht unbeachtet geblieben, am wenigsten dort, wo auch die Kunst nur ein Geschäft war. Berlin, Baden-Baden, Darmstadt, Bad Reichenhall – aber auch die nichtdeutsche Ferne: London und Chikago! – machten sich anheischig, alle Wünsche Wagners zu verwirklichen, und er hätte über Nacht ein schwerreicher Mann werden können, noch ehe das Festspielhaus über den Boden ragte. Er aber blieb dem Winke seines guten Dämons und seinem eigenen starken Willen treu; und er verhandelte nicht mit Börsenmännern und Bodenwucherern, sondern mit so ernsten und gediegenen Leuten, wie es Friedrich Feustel und der Bürgermeister der Stadt Bayreuth, Theodor Muncker, waren. Im Dezember weilte er wieder in Bayreuth. Auch die von ihm berufenen Sachverständigen, darunter der Maschinenmeister Brandt aus Darmstadt, dem er schon in München sein Vertrauen geschenkt hatte, waren dort eingetroffen. Ein von der Stadt angebotenes Grundstück am Stuckberg, in der Nähe der Vorstadt St. Georgen, wurde besichtigt, für gut befunden und dem neuen Zwecke geweiht.
Der erste Besuch in Bayreuth im April war aber nur der Auftakt zu einer Reise gewesen, deren Endziel Berlin war. Mit dem Vortrage in der Akademie der Künste, der alsbald auch unter dem Titel »Über die Bestimmung der Oper« gedruckt erschien, wurden einige Festlichkeiten besonderer Art eröffnet. Wagners wohnten im Tiergarten-Hotel und konnten sich der Besucher kaum erwehren. Vor vierzehn Jahren war Cosima zum ersten Male hierhergekommen, vor sieben Jahren hatte sie Berlin verlassen, und es war für sie ein Quell der eigentümlichsten Empfindungen, als sie sich jetzt an der Seite Wagners im Mittelpunkte der lautesten und herzlichsten Huldigungen sah.
Am Abende des 29. April vereinigte ein Festmahl im Hotel de Rome etwa 120 Personen, die als die näheren Freunde und überzeugtesten Anhänger Wagners gelten konnten. Der Musiklehrer und Musikschriftsteller Wilhelm Tappert, derselbe, dem wir das merkwürdige »Wagner-Lexikon« verdanken, das zugleich ein Schimpflexikon, ein Wörterbuch der Unhöflichkeit ist, da es alle die hämischen, törichten und unglaublich geschmacklosen Urteile aufzählt, die die deutsche Presse gegen Wagner gemünzt hat – Tappert hielt eine Ansprache, in der er den Gedanken formte, daß der Kampf gegen den Meister, der nun wohl bald der Vergangenheit angehören werde, im Grunde kein persönlicher Kampf, sondern nur der Ausdruck gegensätzlicher Strömungen sei, die schon immer in der deutschen Tonkunst zur Geltung gekommen waren: auf der einen Seite das Streben nach Wahrheit des Ausdrucks, auf der anderen das Bedürfnis nach Ebenmaß und Wohlklang. Von der Gegenwart mit ihrer völkischen Begeisterung und mit ihrer zunehmenden Erkenntnis der Wagnerschen Größe erhoffte Tappert die Versöhnung des Widerspruches, der schon bei Weber und nunmehr vollends in Wagner selbst einen Ausgleich gefunden. Mit einem Hoch auf den »unablässig webenden« und »kühn wagenden« Meister beendete Tappert seine Rede. In einer bedeutenden Erwiderung sprach auch Wagner von den Gegensätzen in der deutschen Tonkunst wie in der Kunst überhaupt: von dem Drange nach Wahrheit, die in ihrer künstlerischen Erscheinung stets das Erhabene sei, und von der Vorliebe für das bloß Gefällige – deutsch und welsch! Es sei das Wesen des Deutschen, daß er die Dinge in ihrer ganzen Tiefe erfaßt. So sei es Deutschland gewesen, das durch die Reformation den Glauben nicht etwa angegriffen, sondern in seiner Tiefe und Reinheit, befreit vom Welschtume, wiederhergestellt hat. Wenn der Deutsche das Wahre und Erhabene zum Ausdruck bringe, dann leiste er Vollendetes. Aber weit überflügelt werde er vom Nachbarn, wenn er der deutschen Eigenart entsage. Am meisten sei die Unselbständigkeit der deutschen Schaubühne zu beklagen. Auf ihr und in der Tonkunst dem deutschen Wesen zum Siege zu verhelfen, das erklärte er als sein Ziel und seine Lebensaufgabe.
Tags darauf fand eine Feier in der Berliner Singakademie statt, der »nur« geladene Gäste beiwohnten. Doch war der ganze Saal gefüllt von annähernd 1200 Personen. Die Zahl derer, die sich gleichfalls um einen Platz beworben hatten und wegen Raummangels zurückgewiesen werden mußten, soll gegen 4000 betragen haben. Zuerst sprach die Nichte des Meisters, Johanna Jachmann-Wagner, ein Gedicht von Ernst Dohm. Dann wurde unter der Leitung von Julius Stern die Faust-Ouvertüre gespielt, zuletzt der Tannhäuser-Marsch. Wagner verband seinen Dank mit der Bitte um Wiederholung der Ouvertüre, die er nun selbst leiten wolle. Da erstand förmlich ein neues Werk vor den Zuhörern. »Als Dirigent kommt ihm keiner gleich«, berichtete hernach die Berliner Presse. Wagner dankte nochmals, auch mit Anerkennung für die Leistung Sterns und mit der bescheidenen Bemerkung, er habe bei der Wiederholung der Ouvertüre »einige kleine Nuancierungen anders versucht und glaube die Wirkung dadurch gesteigert zu haben«. Er schloß mit den Worten: »Ich darf nicht so kühn sein, Sie alle, die hier anwesend sind, meine Freunde zu nennen; denn da wäre ich gut daran, wenn Sie alle meine Freunde wären.«
Gewiß, das Aufsehen, das Wagner jetzt überall erregte, wo er hinkam, und nun gar dieser festliche Eifer in der Stadt der »Intelligenz« und des »Bildungsphilisters«, wie Nietzsche den gebildeten Deutschen nannte, das war noch lange nicht der volle Sieg über alle Zweifler, Nörgler und Widersacher. Aber was war es doch für ein Fortschritt, wenigstens in der äußeren Geltung, wenn Cosima daran zurückdachte, wie die Tannhäuser-Ouvertüre ausgezischt worden und dies sie mit Hans von Bülow zusammengeführt hatte.
Die Veranstaltung der Singakademie war aber nur eine »private« Feier gewesen, der nun ein von Wagner geleitetes öffentliches Konzert zu einem wohltätigen Zwecke folgte. Sowohl die Hauptprobe als das Konzert selbst, das am 5. Mai stattfand, hatten stärksten Besuch, und dem Konzerte, das den Kaisermarsch, die Fünfte Beethovens und Bruchstücke aus »Lohengrin« und aus dem »Ring« bot, wohnten der Kaiser, die Kaiserin und die ganze Hofgesellschaft bei. Ein paar Tage vorher war Wagner vom Fürsten Bismarck empfangen worden. Um das volle Gelingen des Berliner Aufenthaltes, namentlich in seinen Auswirkungen auf die vornehmsten gesellschaftlichen Kreise, machten sich besonders der Hausminister von Schleinitz und seine Gattin verdient, auch im erfolgreichen Kampfe gegen die Ränke und die Wühlarbeit des Generalintendanten Botho von Hülsen. So sehen wir den steckbrieflich verfolgten Dresdner Revolutionär, den Mann, der noch in den letzten Jahren in München die heftigsten Angriffe, die niederträchtigsten Beleidigungen zu erdulden hatte, den selbst die Huld eines Königs nicht vor der Roheit des gut angezogenen Pöbels schützen konnte, in Berlin geehrt und gefeiert von den höchstgestellten Personen und den maßgebenden Kreisen, deren Eifer diesmal von keinem Mißklange gestört wurde. Eine gleichsam unterirdische Entwicklung war an den Tag gekommen. Das neu erwachte deutsche Volksbewußtsein hatte sozusagen mit einem starken Griffe von der deutschen Politik und der deutschen Kunst Besitz genommen. So war denn, wie sogar ein gegnerisches Wiener Blatt feststellte, die Sache Wagners von der deutschen Sache nicht mehr zu trennen. Der Gründung des Deutschen Reiches mußte die Grundsteinlegung des Bayreuther Festspielhauses folgen.
Wo aber blieb das Volk? Es stellte sich nur zu bald heraus, daß die »höchstgestellten« Personen und die »maßgebenden« Kreise, daß beispielsweise die Reichsregierung unter der Führung Bismarcks und der neue Deutsche Reichstag in seiner liberal-demokratischen Zusammensetzung, in der sich so wenig echte Freiheit und wahres Volkstum gesetzgeberisch betätigte, weder mit dem Kopfe noch mit dem Herzen völlig auf der Seite Wagners standen. Für die Festspiele wurden keine Reichsmittel bewilligt, für das spätere Vermächtnis Wagners – der »Parsifal« nur in Bayreuth! – kein gesetzlicher Schutz gewährt. Doch abgesehen davon – wenn die Beachtung, die man seinen Plänen schenkte, wenn das Gefühlsverständnis, das man jetzt für ihn aufbrachte, Bestand und Wirkung haben sollte, dann mußte es eine richtige »Bewegung« sein, die von unten auf in die Höhe und in die Breite ging. Keine Förderung von oben konnte etwas sichern, was nicht auch einem allgemeinen Wunsche, einem inneren Bedürfnis entsprach – und was Wagner zunächst »im Vertrauen auf den deutschen Geist« aus eigener Kraft ins Leben rief, das mußte auch jenen »tiefsten Kräften« im Ganzen begegnen, wenn es Halt und Dauer, wenn es überhaupt einen Sinn haben sollte. Dabei ging es auch um eine nüchterne Rechnung: die Baukosten konnten doch nur dann aufgebracht werden, wenn sich soundso viele zahlend beteiligten, vor allem wurden sogenannte Patronatscheine zum Preise von je 300 Talern ausgegeben, deren Inhaber, die Patrone, einen Platz für jeden der geplanten zwölf Festabende (für drei Aufführungen des »Rings«) erhielten und sich an der Bildung eines Ausschusses zur Verteilung von 500 Freiplätzen beteiligen konnten. Einen Patronatschein aber durften auch mehrere Personen zusammen oder ganze Vereine für sich erwerben und dann ihre Eintrittsberechtigung nach Belieben aufteilen oder zuweisen. So entstanden neben dem Patronatverein, dessen vorbereitende Geschäftsführung Karl Tausig in Berlin übernommen hatte, eigene Wagner-Vereine, die die Sache des Patronatvereins zu fördern und der Unternehmung eine breitere Grundlage in der werktätigen Anteilnahme des Volkes zu sichern hatten. Die ersten Wagner-Vereine bildeten sich in Mannheim durch Emil Heckel, in Berlin durch Tausig. Es folgten Leipzig, München, Wien und viele andere Vereine, die sich später auch zu dem Allgemeinen Richard-Wagner-Vereine zusammenschlossen. Wagner hatte schon in seinem Vorworte zum »Ring« daran gedacht, daß die nötigen Geldmittel durch eine »Vereinigung kunstliebender Männer und Frauen« aufzubringen wären. Aber er hatte nicht den Mut gehabt, sich einen Erfolg davon zu versprechen, da die Deutschen in solchen Dingen meist sehr kleinlich verführen. Er hoffte damals auf den deutschen Fürsten, der die befreiende Tat setzen werde. Diese Hoffnung war nur zum Teil in Erfüllung gegangen. Ludwig II. hatte Wagner aus allen Nöten befreit, seinem Werke aber doch wieder Not bereitet. Man mußte jetzt froh sein, wenn er nicht auf dem »Siegfried« und der »Götterdämmerung« für München bestand, wenn er es ohne Groll geschehen ließ, daß das Unternehmen, mit dem er seiner Hauptstadt einen neuen Glanz verleihen wollte, Bayreuth zugute kam. So wandte Wagner selbst seinen Blick doch wieder jenen Kreisen zu, die in der herkömmlichen Form der Vereinsgründung den Willen des Volkes zum Ausdruck brachten. Er wußte, daß auch dies eine Täuschung sein konnte, daß er unablässig seine persönliche Kraft einzusetzen hatte, daß er – während der Vollendung des »Rings« und sonstiger, nie rastender geistiger Tätigkeit – Konzerte geben mußte, deren Reinerträgnis den Festspielen zu dienen hatte. Dafür aber, für das Zustandekommen und Gelingen solcher Konzerte, waren die Vereine sehr wohl zu gebrauchen. Wenn ihre Mitglieder in den meisten Fällen auch nur dem gebildeten Mittelstande angehörten und daher nicht viel Patronatscheine durch sie erworben wurden, so konnten sie doch für Wagners Kunst, für seinen Gedanken, für die Festspiele werben. In der Tat hat diese Werbung an manchen Orten beim kunstliebenden Bürgertum und in der studierenden Jugend schöne Früchte getragen, namentlich durch die Akademischen Wagner-Vereine. Aus dem Gefühlsverständnis wurde allmählich doch ein tieferes Erfassen der Wagnerschen Ziele, und vielen, die es sich sonst nicht hätten leisten können, wurde durch die Vereine der Besuch der Festspiele ermöglicht. Hier also sah Wagner ein neues Tätigkeitsfeld, das ihn allerdings über Gebühr in Anspruch nahm und ihm von neuem die Ruhe raubte, die der Schaffende ersehnte, wenn er in all den Mühen und Sorgen, die ihm in den nächsten Jahren bereitet waren, nicht nur den »Ring«, sondern auch den »Parsifal« vollenden konnte, so war dies eine ungeheure Arbeitsleistung, aber auch ein solcher Verbrauch seiner menschlichen Kräfte, daß sein Leben, das immer häufiger durch Herzanfälle bedroht wurde, gewiß nicht lange mehr dauern konnte. Es gelang ihm, alles unter Dach und Fach zu bringen, wofür nur er sorgen konnte, und der Nachwelt ein abgeschlossenes Lebenswerk zu hinterlassen. Wer möchte sagen, wieviel davon seiner Heldenkraft, wieviel dem Walten der Vorsehung zu verdanken ist! Doch auch der Held ist ein Geschenk der Vorsehung.
Von Berlin kehrte Wagner über Leipzig, Darmstadt, Heidelberg und Basel nach Luzern zurück. In Triebschen genoß er jetzt noch einige Monate schöpferischer Ruhe und vorbereitender Sammlung. Sein Geburtstag am 22. Mai – es war schon der 58. – wurde wie immer mit sinnigen Überraschungen gefeiert. Als er die große Stube betrat, fand er dort alle um seine Büste aufgestellt: Cosima im Gewande der Sieglinde, den Knaben Siegfried auf den Arm, Daniela als Senta, Blandine als Elisabeth, Isolde und Eva ihren »Rollen« gemäß gekleidet. Es war wie eine theatralische Verlebendigung jenes ernstgemeinten Scherzwortes, das Wagner einmal zu Cosima gesprochen hatte: »Du bist Elisabeth, Isolde, Brünnhilde, Eva in einer Person, und ich habe dich geheiratet.« Ein Drahtgruß des Königs und der Besuch Nietzsches vervollständigten die schöne Feier.
Im Laufe des Sommers waren auch Marie Schleinitz und andere Freunde in Triebschen. Doch fiel ein dunkler Schatten in die lichte Zeit. In Berlin starb der rührige Karl Tausig, dem Wagner viel zu verdanken hatte, eines jähen und zu frühen Todes, und just in dem Augenblicke, da die Nachricht in Triebschen eintraf, war auch einer der beiden Hunde, die die Freude der Triebschener waren – ein Geschenk Hans von Bülows –, im Sterben. Wer Kenntnis davon hat, wie nötig Wagner der Umgang mit Tieren war und wie er jedes seiner Haustiere als einen persönlichen Freund betrachtete, der kann diese Unglücksstunde ermessen.
Wagner ging eben daran, seine Schriften und Dichtungen in der Reihenfolge ihres Entstehens zu einer Gesamtausgabe zu vereinen. Da kamen für den ersten Band mehrere Aufsätze in Betracht, die Wagner einst in Paris um des Broterwerbes willen in französischer Sprache für Hrn. Maurice Schlesinger verfaßt hatte. Diese waren nun deutsch wiederzugeben, und Cosima, die bisher nur aus dem Deutschen ins Französische übersetzt hatte, unterzog sich jetzt der umgekehrten, für sie besonders lockenden Aufgabe; doch unter der Aufsicht und Mitwirkung Wagners selbst, so daß sein Ton, seine Redeweise gewahrt blieb. Brieflich stand Cosima mit der ihr so freundlich gesinnten Stiefmutter ihres ersten Gatten, Louise von Bülow, und mit Emil Ollivier in Verbindung, dem sie seine schwere Schuld an dem unseligen Kriege nicht leicht verzeihen konnte. Aber der Krieg war für Deutschland ein Glück gewesen und ihr Schwager erschien ihr als das ahnungslose Werkzeug eines segensreichen Geschicks. Auch mit Liszt kam der Briefwechsel wieder in Gang; die doch eigentlich nur eingebildeten Schranken, die zwischen ihren Seelen errichtet waren, mußten langsam fallen. Auch hatte Liszt drei Patronatscheine gezeichnet und sich entschuldigt, daß sein geringes Vermögen ihm keine größere Beteiligung gestatte. Zugleich gab es einen nie völlig unterbrochenen Gedankenaustausch mit Hans von Bülow.
Die Kinder waren es, die eine sachliche Verständigung nötig machten, und Hans ging in seinen Briefen vom Sachlichen zum Persönlichen über: er hörte nicht auf, der Mutter seiner Kinder seine verehrungsvolle Dankbarkeit für die sorgsame und feinfühlige Erziehung der Mädchen auszudrücken. Dabei bediente er sich freilich wieder des » vous«, während er in jenem Abschiedsbriefe vom 17. Juni 1869 auch im Französischen das Du-Wort verwendet hatte, das dem Deutschen in solchen Fällen einzig gemäß ist. Wir werden von nun an, um die ehrerbietige Entfernung Bülows von Cosima zu veranschaulichen, das » vous« mit »Sie« und » Madame« mit »gnädige Frau« übersetzen.
Es gab jetzt aber einen besonderen Grund, weshalb Cosima ihren ersten Gatten in betreff der Kinder befragen mußte. Die völkische Begeisterung, die sie in der letzten Zeit ergriffen hatte, legte ihr den Übertritt zum Protestantismus nahe. Dabei war sie von einem persönlichen Wunsche gelenkt. Eben damals kam die Leichenverbrennung auf, der sich die katholische Kirche auf das heftigste widersetzt. Sie wünschte nun schon deshalb zum Protestantismus überzutreten, um mit Wagner gemeinsam eingeäschert werden zu können. Sie schrieb aber auch in ihr Tagebuch: »Die Reformation hat den deutschen Geist gerettet, und meine Kinder sollen echte Deutsche werden.« Sie befragte demnach Bülow, ob er mit dem Übertritte seiner Kinder einverstanden wäre. Er war nun freilich in seinem Herzen nicht einverstanden; aber er wollte keinen Gegensatz zwischen der Mutter und den Töchtern heraufbeschwören und war aus dieser sozusagen erzieherischen Erwägung dafür, daß alle zusammen protestantisch würden. Aus den Briefen, die um diese Zeit, im Herbst 1871, aus Italien in die Schweiz gingen, war aber auch eine Freudenkunde zu entnehmen, die dem Herzen Cosimas wohltun mußte. An Bülows Geburtstage und wenn der Tag ihrer Trennung von ihm wiederkehrte, verfiel sie stets in gramvolles Gedenken und war immer wieder geneigt, sich einer nicht gutzumachenden Schuld zu zeihen. Sogar am Vorabende des Geburtstages Richard Wagners war ihr Hans mit grauem Haar und Bart weinend im Schlaf erschienen. Da waren es nun wahrhaft befreiende und beschwichtigende Worte, die Hans an sie richtete.
Am 22. Oktober, am Geburtstage Liszts, schrieb er ihr aus Rom, wo er Liszt persönlich begrüßt hatte. An diesem Tage mußte er der Tochter Liszts gedenken, die einst »die unglückliche Gefährtin eines untergeordneten Menschen war, jetzt aber, wie er hoffe und seit langem bete, die glückliche und würdige Lebensgenossin des größten Dichters und Künstlers des Jahrhunderts«. Auch von sich konnte er Günstiges berichten; er fühlte sich gestärkt zur Wiederaufnahme seiner Konzerttätigkeit. »Wenn ich in Italien gelebt hätte, ehe ich Sie kannte, wären Sie weit weniger unglücklich mit mir und durch mich geworden, gnädige Frau. Möge der Himmel Ihnen die traurige Vergangenheit vergelten durch eine wolkenlose Gegenwart. Das ist der heißeste Wunsch Ihres ehrfurchtsvoll ergebenen Dieners Hans von Bülow.« Daß es aber nicht nur die italienische Luft im weitesten Sinne war, die ihn froher und umgänglicher machte, als er je gewesen, daß ihm ein persönlicher Segen beschieden war, das erhellt aus dem Briefe, den er am 28. November aus Florenz schrieb. Dieser endet mit den Worten: »Ich weiß nicht, ob es mir gestattet sein wird, nach einigen Jahren des Umherirrens als Virtuose in das Land zurückzukehren, das meine Seele gesund gemacht hat. In dieser Hinsicht, gnädige Frau, richte ich nun meinerseits eine Bitte an Sie. Nehmen Sie in die Abendgebete der Kinder einen Namen auf, einen Namen nach Ihrer Wahl – nehmen Sie den einer Heiligen, einer der reinsten Heiligen – und teilen Sie mir bei Gelegenheit Ihre Wahl mit. Dieser Name soll eine Person bezeichnen, die, ohne es zu wissen, mich als Vater, Menschen, Künstler neu zur Welt kommen ließ, die mir mit dem Seelenfrieden auch das schöne Fieber, zu leben und zu kämpfen, wiedergegeben, die mich mir selbst zurückgegeben hat – in durchgesehener und verbesserter Ausgabe. Könnte doch dieses Bekenntnis jeden Rest von ›posthumer‹ Bitterkeit und Reue in Ihrem Herzen zerstören, gnädige Frau – Sie erfüllen die großen und vielfältigen Pflichten, die ohne Unterlaß auf Ihnen ruhen, so wahrhaft fromm und treu, daß Sie nicht mehr unter der Vergangenheit leiden dürfen. Segnen Sie den Engel, der nach ›Rom‹ geführt hat
Hans von Bülow.«
Im Dezember war Wagner, wie schon erwähnt, in Bayreuth, diesmal ohne Cosima, die erst einige Tage später, über Basel kommend, in Begleitung Nietzsches in Mannheim mit ihm zusammentraf. Dort fand am 20. Dezember ein großes Konzert zugunsten der »Nationalbühne in Bayreuth« statt, mit einer ähnlichen Vortragsordnung wie in Berlin. Am Vormittage überraschte Wagner seine Freunde mit einer Vorführung des noch unbekannten Siegfried-Idylls. Unter den Zuhörern waren außer Nietzsche auch Pohl und Alexander Ritter mit seiner Frau, der Nichte Wagners. Dem Konzert wohnte der aus Karlsruhe herbeigekommene Großherzog mit seinen Verwandten bei. Es war wieder ein außerordentliches Fest und wieder ein unbeschreiblicher Triumph des großen Dirigenten. Hier in Mannheim lernte Wagner auch den Karlsruher Hofkapellmeister Hermann Levi, der ihm schon wiederholt seine Verehrung bezeigt hatte, persönlich kennen. Cosima vermerkte in ihrem Tagebuche, daß sie »einen jüdischen Mann erobert« hätten, der »ein nicht unbedeutender Mensch« zu sein scheine.
Erst knapp vor Weihnachten waren Wagners wieder daheim. Es war das letztemal, daß der Weihnachtstag, der Geburtstag Cosimas, in Triebschen gefeiert wurde. Wagner hatte zum Schlußgesang des Kaisermarsches einen neuen Text erfunden, mit dem die Mutter von den Mädchen begrüßt wurde. Hatten diese sonst jubelnd »heil dem Kaiser!« und »heil seinen Ahnen!« gesungen, so hieß es nun: »Heil der Mutter, unsrer Mama« und »Heil Deinem Siegfried, unsrem Fidi«. So vermischten sich die Stimmen der Zeit mit den holden Kinderstimmen. Cosima schrieb ins Tagebuch: »Unser Jahr überblickt und es gut befunden.«
Der Beginn des neuen Jahres brachte eine wertvolle Gabe: das erste Buch von Friedrich Nietzsche »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik«, dem »Vorkämpfer« Richard Wagner gewidmet. Diese herrliche Deutung des griechischen Wesens und des tragischen Kunstwerks war zugleich eine bedeutsame Huldigung für den Genius des Künstlers, in dessen Worttondramen die Tragödie der Griechen auferstanden zu sein schien. In der Welt draußen wurde die Huldigung fast mehr beachtet und zweifellos besser verstanden als der übrige Inhalt dieses heute noch unvergleichlichen Werkes, das bei Nietzsche eigentlich kein Seitenstück hat und für alle Zeiten als ein Musterbeispiel künstlerischer Prosa gelten muß. Wagner schrieb sofort: »Schöneres als Ihr Buch habe ich noch nicht gelesen. Alles ist herrlich … Zu Cosima sagte ich: Nach ihr kämen gleich Sie, dann lange kein anderer bis zu Lenbach, der ein ergreifend richtiges Bild von mir gemalt hat.« Und Cosima: »O wie schön ist Ihr Buch, wie schön und wie tief, wie tief und wie kühn! … Sie haben in diesem Buche Geister gebannt, von denen ich glaubte, daß sie einzig unserem Meister dienstpflichtig seien; über zwei Welten, von denen wir die eine nicht sehen, weil sie zu fern, die andere nicht erkennen, weil sie uns zu nahe ist – haben Sie den hellsten Schein geworfen, so daß wir die Schönheit fassen, die uns ahnungsvoll entzückte, und die Häßlichkeit begreifen, die uns beinahe erdrückte … Ich kann Ihnen nicht sagen, wie erhebend Ihr Buch mich dünkt, in welchem Sie so schlicht wahrhaftig die Tragik unseres Daseins feststellen, und wie ist Ihnen die schönste Anschaulichkeit in den schwierigsten Fragen gelungen! Wie eine Dichtung habe ich diese Schrift gelesen und kann mich von ihr ebensowenig als der Meister trennen, denn sie gibt mir eine Antwort auf alle meine unbewußten Fragen meines Innern.« Auch anderen schrieb sie, das Buch von Nietzsche sei »das Bedeutendste, was seit Schopenhauer und Wagner auf dem Gebiete der Musik gesagt worden ist«.
Das Lenbachsche Bildnis, das Wagner in seinem Dankschreiben erwähnte, wurde von Cosima nicht so rückhaltlos bewundert. Sie hatte nach Neujahr von Lenbach ein Bildnis Liszts erhalten, für das sie sehr herzlich dankte. Gleichzeitig übersandte sie ein Pariser Lichtbild ihres Mannes, das sie für sein bestes hielt. Doch fügte sie bei: »Selbst im Bezug auf das mir Bekannteste und Teuerste bescheide ich mich Ihnen, Meister, gegenüber jedes Urteils.« Anderthalb Wochen später sandte sie ein »Wagner-Bildchen«, also wahrscheinlich einen Entwurf – sie spricht übrigens in diesem Briefe von zwei Entwürfen – mit folgenden Worten zurück: »Ich habe darin Ihren zauberischen Pinsel wiedergefunden, aber nicht ganz – ich gestehe es – Ihren divinatorischen Blick, denn allerdings muß Wagner erraten werden. Das Auge des Bildchens ist sehr schön, das übrige aber dünkt mich ein wenig matt, schlaff: ich weiß sehr gut, daß Wagner so aussehen kann und meistens für die Welt vielleicht so aussieht, Sie aber, teurer Meister, geben uns ja immer in Ihren Bildern das, was die übrigen nicht zu sehen bekommen; und von dessen Wahrhaftigkeit sie durch Sie sofort überzeugt werden. Die Farbe der Haut ist mir z. B. nicht durchsichtig genug … Sie aber werden – sonst keiner, sich sagen können, wie dieses Antlitz erscheint, wenn die ruhige Verzückung des Glückes oder der Begeisterung es verklärt … Soll ich Ihnen sagen, was ich glaube? Die Hanfstänglsche Photographie« (also ein Münchner Lichtbild) »hat Sie gestört. Sie ist zwischen das Bild und Ihre Konzeption gekommen, welch letztere ich zu verstehen glaube … Alles, was ich hier sage, ist nur eine Bitte, zu sich zurückzukehren, Sie einzig haben recht; lassen Sie alle Photographien liegen, folgen Sie nur Ihrem Blicke, Ihren Gedanken, Ihrer Intention, und wir werden das Bild Wagners haben, wie wir das meines Vaters haben.«
Inzwischen hatten sich dem Bayreuther Unternehmen unvermutete Schwierigkeiten entgegengestellt. Feustel und Muncker waren persönlich in Triebschen erschienen und hatten die Botschaft gebracht, daß ein Mitbesitzer des für das Festspielhaus gewählten Bauplatzes aus rein persönlichen Gründen seine Einwilligung zur Grundabtretung verweigere. Aber die Unglücksboten brachten auch einen neuen Plan. Der Hügel vor der Bürgerreuth, der einen so lieblichen Blick auf die Stadt und die sie umrahmenden Berge gewährt und sich besonders zur Anlegung eines größeren Parkes eignete, wurde von ihnen warm empfohlen. Es kostete keine allzu große Mühe, den Meister zu dieser neuen Wahl zu bestimmen. Cosimas Wunsch und Bitte gaben den Ausschlag. Wagner fuhr also nach Bayreuth und brachte dort alles in Ordnung: der zweite, größere Bauplatz schien ihm in jeder Hinsicht günstiger zu sein als der erste, und auch für sein künftiges eigenes Heim erwarb er nun das geeignete Grundstück, einen Teil der Wiese zwischen Rennweg und Hofgarten, die er ursprünglich für das Festspielhaus ins Auge gefaßt hatte.
Der König konnte sich mit der Niederlassung seines Freundes in Bayreuth zunächst noch schwerer vertraut machen als früher mit der Niederlassung in Triebschen. Er wollte ihn in seiner Nähe haben und München sollte die Hauptstadt der Wagnerschen Kunst sein. Es gereicht ihm zur höchsten Ehre, daß er, nach mancherlei bedenklichen Auseinandersetzungen, nicht nur die Pläne Wagners guthieß, sondern auch gemäß dem Versprechen, ihn aller Lebenssorgen zu entheben, die Kosten des Grundkaufes für das Bayreuther Wohnhaus übernahm. Wagner hinwiederum vermied es sorgfältig, den König noch weiter zu belästigen. Er fand sich damit ab, daß der Festspielbau vom König einstweilen nicht gefördert wurde.
Zur Einhebung und Verwaltung der Patronatsgelder hatte Wagner bei seiner Anwesenheit in Bayreuth einen ständigen Verwaltungsrat eingesetzt, dessen Haupt und Seele Friedrich Feustel und später dessen Schwiegersohn Adolf von Groß wurde, der sich auch als Vermögensverwalter der Wagnerschen Erben unvergängliche Verdienste erworben hat. Zögernd und spärlich flossen die Patronatsgelder. Doch Wagner fühlte sich eben dadurch in seinem Drange bestärkt, die Sache in keiner Weise ruhen zu lassen und selbst mit dem befeuernden Beispiele voranzugehen. Für den 22. Mai, seinen 59. Geburtstag, wurde die Grundsteinlegung anberaumt, der eine Aufführung der Neunten Sinfonie Beethovens die festliche Weihe geben sollte. Zugleich beschloß er die sofortige Übersiedlung nach Bayreuth, um dort alle Vorbereitungen treffen und den Bau des Wohnhauses wie des Theaters selbst überwachen zu können.
So hieß es denn: das traute, stille Heim mit einer unruhigen neuen Umgebung vertauschen. Ende April fuhr Nietzsche zum letzten Male nach Triebschen, wo schon alles in Auflösung begriffen war. Er setzte sich ans Klavier und phantasierte in einer Weise, die Cosima zu Herzen ging. An einen Berliner Freund, den Freiherrn von Gersdorff, schrieb er hernach: »Vorigen Sonnabend war trauriger und tiefbewegter Abschied von Triebschen. Triebschen hat nun aufgehört: wie unter lauter Trümmern gingen wir herum, die Rührung lag überall, in der Luft, in den Wolken, der Hund fraß nicht, die Dienerfamilie war, wenn man mit ihr redete, in beständigem Schluchzen. Wir packten die Manuskripte, Bücher und Schriften zusammen – ach, es war so trostlos! Diese drei Jahre, die ich in der Nähe von Triebschen verbrachte, in denen ich 23 Besuche dort gemacht habe, was bedeuten sie für mich! Fehlten sie mir, was wäre ich! Ich bin glücklich, in meinem Buche mir selbst jene Triebschener Welt petrifiziert zu haben.«
Dieses letzte Wort klingt beinahe wie eine Ahnung, er werde einst die lebendigen Kräfte, die diese Welt gebaut hatten und die doch auch an anderem Orte weiterwirkten, nicht mehr unmittelbar empfinden können, er werde eines Denkmals der Zeit bedürfen, in der er das alles noch freudig miterlebte. Aber er trug dieses Denkmal in seinem Herzen. Noch im » Ecce homo« 1888, worin er sozusagen angesichts des Todes die bittere Wahrheit aussprach, daß er mit Wagners Hochzielen nichts mehr gemein habe, selbst da noch lesen wir: »Hier, wo ich von den Erholungen meines Lebens rede, habe ich noch ein Wort nötig, um meine Dankbarkeit für das auszudrücken, was mich in ihm bei weitem am tiefsten und herzlichsten erholt hat. Dies ist ohne allen Zweifel der intimere Verkehr mit Richard Wagner gewesen. Ich lasse den Rest meiner menschlichen Beziehungen billig; ich möchte um keinen Preis die Tage von Triebschen aus meinem Leben weggeben, Tage des Vertrauens, der Heiterkeit, der sublimen Zufälle – der tiefen Augenblicke … Ich weiß nicht, was andere mit Richard Wagner erlebt haben: über unserem Himmel ist nie eine Wolke hinweggegangen.« Wir wissen aber auch, wie treu Nietzsche in der Erinnerung an die Triebschener Zeiten Cosima ergeben blieb. Sie war ihm »das einzige Weib größeren Stils«, das er kennengelernt, und »die bestverehrte Frau«, die es in seinem Herzen gab. Sie selbst nannte in einem der letzten Briefe, die sie an ihn richtete, den Zauber der Einsamkeit von Triebschen ein verlorenes Paradies.
Am 24. April traf Wagner zur dauernden Niederlassung in Bayreuth ein. Er wohnte zuerst im Schlosse Fantaisie im nahen Donndorf. Erst später siedelte er in die Stadt selbst über und bezog dort eine Wohnung an der Dammallee, um dem Hausbau näher zu sein.
Es bedarf keiner lebhaften Vorstellungsgabe, um sich all die Unruhe und die geschäftlichen Sorgen zu vergegenwärtigen, womit Wagner nunmehr belastet war. Vom ersten Tage an hatte er sich um Baupläne, Kostenvoranschläge, Vertragsabschlüsse u. dgl. m. zu kümmern. Und wenn das rein Geschäftliche allerdings von Feustel und Groß mit der gründlichsten Sachkenntnis und mit hingebungsvollem Eifer besorgt wurde, so war es doch durchaus nötig, daß er von allem wußte und alles persönlich genehmigte. Er war vorerst allein gekommen. Am 30. April waren auch die Seinen, mitsamt dem treuen Hunde Ruß, wieder mit ihm vereint. Aber schon nach wenigen Tagen brach er mit Cosima nach Wien auf. Der dortige Wagner-Verein veranstaltete ein großes Konzert zugunsten der Bayreuther Unternehmung, und er hatte zugesagt, dieses Konzert zu leiten. Der Glanz seines Namens und die »Sensation«, die sein Erscheinen überall erregte, fielen bei solchen Veranstaltungen noch mehr ins Gewicht als die jedesmal so bedeutende und durch Neuheiten anziehende Vortragsordnung.
Wagner war in Wien der Gast des Primararztes Dr. Josef Standhartner, den er schon im Mai 1861 dort kennengelernt hatte. Aus der zufälligen Bekanntschaft war sehr rasch eine herzliche und wahrhaft ergiebige Freundschaft entstanden. Die Wiener Angelegenheiten Wagners waren immer durch Standhartner im Verein mit Eduard Liszt treulich besorgt worden, und der kunstsinnige, musikbegabte Arzt, dessen gewinnende Persönlichkeit uns Cornelius in seinen Briefen schildert, hatte Wagner schon im Herbst 1861 bei sich beherbergt und ihn auch in Triebschen besucht. Mündlich und schriftlich erteilte er auch, auf dringende Bitten Cosimas, seinen ärztlichen Rat, wenn Wagner sich nicht wohl fühlte. Man kann sagen, daß niemand in ganz Wien dem Meister so treu ergeben war und auch so viel Verständnis für seine menschliche Eigenart hatte wie Dr. Standhartner. Dieser hatte jetzt eine Dienstwohnung im Allgemeinen Krankenhause in der Alservorstadt. Ein Teil davon wurde Wagner und Cosima zur Verfügung gestellt. Die Vortragsordnung des Konzertes umfaßte die Dritte Beethovens und Bruchstücke aus dem Pariser »Tannhäuser«, aus »Tristan« und »Walküre«. Mit dem Wiener Hofopernorchester, den berühmten Philharmonikern, war es Wagner nach seinen eigenen Worten eine wahre Lust, Musik zu machen. Der Besuch des »Rienzi« in der Hofoper erregte allerdings seinen Unmut. Doch kam es darüber zu keiner ernstlichen Verstimmung im Verkehre mit dem Operndirektor Herbeck und den Bühnenkünstlern. Die Wiener Tage waren nicht nur durch Proben, sondern auch durch einen lebhaften Verkehr mit zahlreichen Freunden, Gönnern und Anhängern, durch Ausflüge und Abendgesellschaften ausgefüllt. Besondere Freude hatten Wagner und Cosima darüber, daß Lenbach jetzt in Wien weilte und das Konzert besuchen konnte.

Richard und Cosima Wagner (1872).
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth
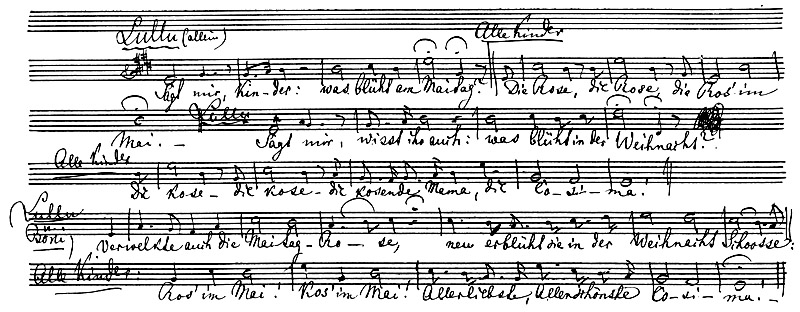
Handschrift des Geburtstagsliedes für Cosima 1873.
Aus dem Archiv des Hauses Wahnfried. M
it Genehmigung des Drei-Masken-Verlages, Berlin,
aus Richard Graf Du Moulin Eckart, Cosima Wagner
Dieses fand am 12. Mai im Großen Musikvereinssaale statt und gestaltete sich zu einem der größten Triumphe, die Wagner jemals im Konzertsaale errungen hat. Beim Festmahle brachte Herbeck, der seinen Musikern alle gewünschten Urlaube für die Grundsteinlegung in Bayreuth erwirkt hatte, den Trinkspruch auf Wagner aus, worauf dieser erwiderte: Es sei soeben geäußert worden, daß im nächsten Jahre zu Bayreuth die Ideale der Musik verwirklicht werden sollten. Er selbst aber wisse noch gar nicht, mit welchen Kräften und mit welchen Mitteln das geschehen könne. Eines nur erhalte ihn im Glauben an die Verwirklichung der Ideale: der deutsche Geist. Worin dieser, nur zu oft als Firma gebrauchte, deutsche Geist bestünde, das wisse er allerdings nicht. »Er ist unfaßbar, aber wir alle fühlen uns von ihm umweht und kennen seine Manifestationen.« Wie tief, wie ahnungsreich erscheine er gleich in der gewaltigen Neunten Sinfonie, mit deren Vorführung die Begründung des Unternehmens eingeweiht werden solle; welch eine Welt an Gedanken, welche Keime zukünftiger musikalischer Gebilde berge sie in sich! Nun sei er nicht so stolz, zu behaupten: er wäre ausersehen, die in diesem großen Werke des deutschen Geistes vorgebildeten Ideen fortzuführen und zu verwirklichen; allein er stehe auf dem Boden dieses Werkes und er strebe von da weiter. Mit allen, die als Musiker von Beruf oder Kraft ihres deutschen Gemütes sich seinen Bestrebungen anschlössen, leere er das Glas auf den deutschen Geist!
Am 14. Mai war Wagner bereits wieder in Bayreuth, wo er nun gerade nur acht Tage Zeit hatte, um das Fest der Grundsteinlegung vorzubereiten. Aus Wien aber hatte er ein paar schöne Andenken mitgebracht, die uns heute noch erfreuen: die Lichtbilder, die er bei Fritz Luckhart herstellen ließ, darunter das allbekannte mit Cosima, er stehend, sie sitzend, merkwürdigerweise reichen sie sich die linke Hand.
Zur Grundsteinlegung waren viele Freunde aus nah und fern geladen worden. Doch an keinem war dem Meister so viel gelegen wie an dem Einen, Großen, der sich im nahen Weimar aufhielt und von dem es nach den stockenden und schwankenden Beziehungen der letzten Jahre unsicher war, ob er kommen würde. Wagner konnte diese Unsicherheit nicht ertragen und schrieb am 18. Mai an Franz Liszt:
»Mein großer, lieber Freund!
Cosima behauptet, Du würdest doch nicht kommen, auch wenn ich Dich einlüde. Das müßten wir denn ertragen, wie wir so manches ertragen mußten! Dich aber einzuladen, kann ich nicht unterlassen. Und was rufe ich Dir denn zu, wenn ich Dir sage: komm? Du kamst in mein Leben als der größte Mensch, an den ich je die vertraute Freundesanrede richten durfte; Du trenntest Dich langsam von mir, vielleicht weil ich Dir nicht so vertraut geworden war wie Du mir. Für Dich trat Dein wiedergeborenes innigstes Wesen an mich heran und erfüllte meine Sehnsucht, Dich mir ganz vertraut zu wissen. So lebst Du in voller Schönheit vor mir und in mir, und wie über Gräber sind wir vermählt. Du warst der Erste, der durch seine Liebe mich adelte; zu einem zweiten, höheren Leben bin ich ihr nun vermählt und vermag, was ich nie allein vermocht hätte. So konntest Du mir alles werden, während ich Dir so wenig nur bleiben konnte: wie ungeheuer bin ich so gegen Dich im Vorteile!
Sage ich Dir nun: komm! so sage ich Dir damit: komm zu Dir! Denn hier findest Du Dich. – Sei gesegnet und geliebt, wie Du Dich auch entscheidest!
Dein alter Freund Richard.«
Liszt kam noch nicht. Doch er erwiderte am 20. Mai:
»Erhabener, lieber Freund!
Tief erschüttert durch Deinen Brief, kann ich Dir nicht in Worten danken. Wohl aber hoffe ich sehnlich, daß alle Schatten, Rücksichten, die mich ferne fesseln, verschwinden und wir uns bald wiedersehen. Dann soll Dir auch hell einleuchten, wie unzertrennlich von Euch meine Seele verbleibt, innigst auflebend in Deinem ›zweiten‹, höheren Leben, wo Du vermagst, was Du allein nicht vermocht hättest. Darin beruht meine Begnadigung des Himmels: Gottes Segen mit Euch, wie meine ganze Liebe.
F. L.«
Es widerstrebte Liszt, diese Zeilen mit der Post zu schicken; er ließ sie von einer Frau, die seit mehreren Jahren sein Denken und Empfinden kannte, von der Baronin Olga Meyendorff, am 22. Mai dem Freunde persönlich übergeben. Er teilte die Briefe aber auch der Fürstin mit, die es ungern sah, daß er zu Wagner zurückgefunden oder vielmehr sich innerlich nie von ihm entfernt hatte. Sie versuchte sogar in sehr leidenschaftlicher Weise seine Wiedervereinigung mit denen zu verhindern, »die Jesum Christum in Wort und Taten verleugnen, die Böses tun und sagen, daß sie Gutes täten. Das wird einmal ein schmerzliches Kapitel in Ihrer Biographie sein.« Liszt antwortete mit einer unvergleichlichen Mischung von Spott und Galanterie: »Es beunruhigt mich nicht, wie die Welt das auslegt, was Sie meine Biographie nennen. Das einzige Kapitel, das ihr mein heißer Wunsch noch zufügen wollte, fehlt – alles übrige beschäftigt mich nicht mehr, als es vernünftig ist.«
Der Kampf ging den ganzen Sommer weiter, da Wagner sich alsbald mit Cosima zu einem Besuch in Weimar ansagte und Liszt diesen auch erwidern wollte. Wagner schrieb offenherzig an Liszt, daß ihm die Überbringerin des schönen und großherzigen Briefes vom 20. Mai manches mitgeteilt habe, was auf eine in Weimar oder in Rom herrschende »mißverständliche Stimmung« schließen lasse. Wagners Herz verlangte nach dem Freunde, doch es schien ihm, als ob dieser mit der Fürstin abgemacht habe, daß jedenfalls die Bayreuther zuerst kommen müßten, dann erst könne Liszt nach Bayreuth gehen. Das widerstrebte Wagner aufs tiefste. Er wollte selbst nach Weimar, ohne diesen Besuch Liszts abzuwarten, aber er konnte sich unmöglich einem Verlangen fügen, das von einer dritten Person in unfreundlichem Sinne gestellt worden. Er bat also Liszt um ein klares Wort und fragte geradezu: »Willst Du uns freundlich empfangen?« Darauf schrieb Liszt zurück: »Aus dem Heiligsten meiner Seele sage ich Dir Dank und Willkommen. Etwas Deiner Würdigeres als ›freundlichen Empfang‹ sollst Du und Cosima bei mir finden; anderweitige ›mißverständliche Stimmungen‹ dürften nicht in Betracht kommen, selbst wenn sie existierten – was ich nicht gelten lasse. Nach Erfüllung Deines Wunsches sehnt sich Dein Franz.« So kamen denn Wagners im August nach Weimar, und im Oktober war Liszt in Bayreuth, knapp vor seinem 61. Geburtstage, den er dann doch wieder »ganz trübselig und allein auf einer Eisenbahnstation« (in Regensburg) verbrachte. Dieses Zugeständnis, daß er seinen Geburtstag nicht bei Wagners feiere, hatte er der Fürstin gemacht, um sie nicht ohne Not zu kränken und zu erbittern. Ihm selbst war es ja nie um eine Feier und um Huldigungen zu tun, und der Heimatlose und Unstete, »halb Franziskaner, halb Zigeuner«, hatte längst auf jedes persönliche Behagen verzichtet.
Aber wenn er auch die Laune der Fürstin schonte, ihrer Meinung unterwarf er sich nicht. Es existierten tatsächlich sehr mißverständliche Stimmungen, die er jedoch keineswegs gelten ließ. Je mehr der Ruhm Wagners sich verbreitete, je mehr die Welt seine Größe erkannte, desto mehr trachtete Carolyne Wittgenstein ihn zu verkleinern. »Hören Sie nicht erst die ›Götterdämmerung‹ an«, so schrieb sie an Liszt, »um gewisse Effekte abzulauschen …, das hieße der Vorsehung Unrecht tun, die Ihnen in Ihrem Alter alles gegeben hat, was Sie brauchen, um Ihre Gedanken auszudrücken … Übrigens weiß ich nicht, ob dieses letzte Werk Wagners so bemerkenswert sein wird, als man erwartet … Wagners Größe besteht darin, daß er neue Formeln erfunden hat. Das ist aber nicht unerschöpflich. Er hat alle seine Geheimnisse schon in seinen ersten, frischesten Werken offenbart, die wahrscheinlich die volkstümlichsten bleiben werden und die die unmittelbare Inspiration empfangen haben. Das übrige ist mehr gemacht als empfunden – genial gemacht, ohne Zweifel, aber gemacht, gewollt, nicht gesungen von einer unbewußten …, notwendigen Kraft.« Noch leidenschaftlicher trat sie gegen den Menschen Wagner oder vielmehr gegen seine unchristliche Gesinnung auf. Er habe die Fahne des Buddha auf sein Theater gepflanzt, und wenn Liszt da mittue – Liszt, der die niederen Weihen empfangen hatte und der auch dem sogenannten dritten Orden der Franziskaner angehörte –, dann scheine es, daß er das Kleid der Miliz Jesu mit Schmerz und mit Scham trage.
Damit es aber ja nicht den Anschein habe, daß sie etwa mit unchristlicher Lieblosigkeit das Verhalten Cosimas verurteile, fügte sie bei: »Sie wissen, daß es nicht Härte ist, die aus mir spricht – wenn Cosima zu mir käme (und vielleicht kann noch manches Unglück geschehen, das sie zu mir führt), so würde sie meine Tür, meine Arme und mein Herz offen finden. Es ist etwas anderes, zu lieben, und etwas anderes, sich mit dem zu verbinden, was weder gut noch heilig ist.« Doch Carolyne, getäuscht und verwöhnt durch die unablässigen Beteuerungen von Liszts Anhänglichkeit und Ergebenheit, kannte seinen Stolz zu wenig. Nie hat er ihr so unumwunden wie diesmal widersprochen. »Es handelt sich durchaus nicht darum«, so schrieb er ihr, »Cosima und Wagner Türen zu öffnen oder zu verschließen. Sie gehören nicht zu den Leuten, die sich an den Türen aufhalten!« Und an anderer Stelle: »Übrigens weiß ich nicht, wie Sie zu der Annahme kommen, Cosima und Wagner verleugneten Jesus Christus und bekennten sich offenkundig zum Atheismus. Keines ihrer Worte rechtfertigen eine solche Vermutung. In den acht gedruckten Bänden Wagners finden Sie nichts, was ein Anathema rechtfertigen könnte. Seine philosophischen und religiösen Ansichten sind die einer großen Anzahl unserer Freunde, und er drückt sich stets mit Maß und Takt aus. Zweifellos rechnet sich Wagner nicht zu den orthodoxen und die Religionsgebräuche beobachtenden Christen. Aber muß man ihn deshalb durchaus zu den Ungläubigen zählen?« Liszt betonte auch, daß er die Uniform Christi keineswegs als ein Unwürdiger trage. Aber was die Fürstin gegen Bayreuth vorbringe, das sei falsch. »Erst wieg's, dann wag's«, schrieb er ihr in deutscher Sprache. Er berichtete ihr auch, welche begeisterte Huldigungen Cosima in der Stadt Bayreuth von allen Würdenträgern und Standespersonen entgegennehme, er betonte, daß ihre fünf Kinder mustergültig erzogen seien, und sagte endlich: »Cosima übertrifft sich selbst! Mögen andere sie richten und verdammen – für mich bleibt sie eine Seele, die die große Barmherzigkeit des heiligen Franziskus verdient, und meine bewundernswürdige Tochter.«
Nachdem er so der Fürstin im Laufe eines halben Jahres in mehreren Briefen gründlich die Wahrheit gesagt hatte, machte er ihr doch die Freude, daß er sich an seinem Geburtstage nicht von denen feiern ließ, »die Jesum Christum verleugnen«. Aber er konnte es sich nicht versagen, nach seiner Abreise von Bayreuth noch weiter davon zu berichten, daß ihn der Entwurf des »Parsifal«, den Wagner ihm vorgelesen hatte, mit heller Begeisterung erfülle. Es wäre ein seltsamer Widerspruch, meinte er, die letzte Szene des »Faust« zu bewundern und den »Parsifal« abzulehnen, der von gleich hoher mystischer Inspiration getragen sei. »Ich bekenne, daß viele unserer angesehenen religiösen und katholischen Dichter mir weit entfernt zu sein scheinen von dem religiösen Gefühle Wagners.« Auch seiner Tochter schrieb er: »Die Vorlesung, die uns Wagner von diesem strahlenden Werk gemacht hat, ist mir im Herzen lebendig geblieben. Ich war darnach wie verklärt, und nur die Furcht, affektiert zu erscheinen, hat mich zurückgehalten. Ich würde ihm sonst gesagt haben wie Petrus: ›Hier ist gut sein, hier laß uns drei Hütten bauen.‹«
Aus diesen Worten spricht die Sehnsucht Liszts nach Herd und Heim. Unaufhörlich wechselte er den Aufenthalt, und wenn er sein Leben im großen und ganzen zwischen Rom und Weimar und jetzt auch Pest teilte, wo ihm die oberste Leitung der Musikakademie übertragen wurde, so war er doch nirgends recht zu Hause, überall nur ein Gast, ein geehrter Fremdling. Stärker als der Wandertrieb, der ihm im Blute lag, wurde allgemach die Müdigkeit, die ihn überkam, und im Anschauen des Wagnerschen Familienglücks fühlte er, wo er einzig hingehörte.
Die Feier der Grundsteinlegung war herrlich vor sich gegangen. Im alten Opernhause erklang Beethovens Neunte unter der einzigartigen, für alle Zeiten vorbildlichen und nachwirkenden Leitung Wagners. Albert Niemann, Franz Betz, Marie Lehmann und Johanna Jachmann-Wagner waren die Einzelsänger, August Wilhelmj der Führer der Geigerschar, Hans Richter blies die Trompete. Droben auf dem Festspielhügel ließ Wagner in den Grundstein das Blatt einmauern, das die Verse trägt:
»Hier schließ' ich ein Geheimnis ein,
Da ruh' es viele hundert Jahr':
Solange es verwahrt der Stein,
Macht es der Welt sich offenbar.«
Und beim Hammerschlag sprach er: »Sei gesegnet, mein Stein, stehe lang und halte fest!«
Damit begann nun erst recht eine rastlose Arbeit, die um so eifriger betrieben wurde, als ja die Festspiele schon für das nächste Jahr in Aussicht genommen waren. Aber es türmten sich Hindernisse auf Hindernisse. In der sogenannten Nibelungen-Kanzlei war eine kleine Schar tüchtiger und hoffnungsvoller junger Musiker damit beschäftigt, die Stimmen für den »Ring« auszuschreiben. Unter ihnen befand sich auch der Jude Josef Rubinstein (der in keiner Weise mit Anton Rubinstein zusammenhängt). Dieser war schon in Triebschen, knapp vor Wagners Abreise nach Bayreuth, persönlich aufgetaucht, nachdem er vorher ein merkwürdiges Schreiben aus seiner russischen Heimat an den Meister gerichtet hatte. Durch die Schrift über das Judentum in der Musik war er zur Erkenntnis der jüdischen Eigenschaften gekommen und sah nun keine andere Wahl, um sich von der Last des Judentums zu befreien, als entweder Selbstmord oder ein Leben an der Seite Wagners, im Dienste der Wagnerschen Kunst Nach dem Tode Wagners hat Rubinstein in der Tat Selbstmord verübt.. Dieser seltsame, tragisch anmutende Jünger wurde also zu einem Mitgliede der Bayreuther Arbeitsgemeinde und hat im übrigen, da er seine jüdische Art und Unart ja doch nicht gänzlich aufgeben konnte, dem Meister zwischendurch viel zu schaffen gemacht. Für diesen selbst ergab sich jetzt die Notwendigkeit, nach den geeigneten Kräften für die Bayreuther Aufführungen Umschau zu halten. Seit vielen Jahren war er ohne Berührung mit den deutschen Bühnen, nur in Wien und München hatte er bestimmte Erfahrungen gemacht, die ihn zum Teil ermutigten, anderseits aber, besonders in München, so sehr mit glücklichen Ausnahmefällen und überdies mit seiner persönlichen Mitwirkung verbunden waren, daß er daraus keine allgemeinen Schlüsse ziehen konnte. Er war eigentlich auf das Schlimmste gefaßt, als er nun mit Cosima eine Rundfahrt durch die deutsche Opernwelt antrat.
Die Eindrücke waren höchst mannigfaltig: er sah und hörte eigene Werke, bei denen er sich im voraus zur größten Nachsicht zwang, aber auch Gluck, Mozart, Beethoven, Weber, Deutsches und Französisches. Fast überall mußte er grobe Fehler im einzelnen oder eine bedenkliche Leichtfertigkeit im ganzen feststellen, aber auch fast überall entdeckte er gute Anlagen, sei es der Sänger oder des Dirigenten. In seiner Schrift »Ein Einblick in das heutige deutsche Opernwesen« sind die Ergebnisse der Reise zusammengefaßt. Cosima machte alles mit und lernte von ihrem Gatten besonders die richtige Beurteilung der Sänger. Wagner verstand es, auch in der kläglichsten Leistung die trotzdem vorhandene Begabung zu erkennen, und wußte immer, wie man es anzupacken habe, um den Sänger zum rechten Gebrauch der ihm verliehenen Fähigkeiten anzuleiten und gewissermaßen zu sich selbst zu führen.
Als sie wieder daheim waren, neigte sich das Jahr dem Ende zu; ein Jahr, das außer durch die Grundsteinlegung durch zwei bedeutsame Tatsachen gekennzeichnet ist. Am 22. Juli hatte Wagner inmitten all des Wirbels und Trubels die »Götterdämmerung« vollendet, das heißt: nur die »Komposition«, die Partitur war noch fertigzustellen. Aber Wagner trug ja alle Einzelheiten der letzten Ausführung schon beim ersten Entwurf klar in sich. So war denn der »Ring« in der Tat geschlossen. Das Partiturschreiben nahm nicht mehr den ganzen Menschen in Anspruch, und der Unermüdliche konnte sich freier und sorgloser den Einzelaufgaben seines Vorhabens widmen. Am 31. Oktober aber nahm Cosima das Abendmahl in der protestantischen Kirche zu Bayreuth. Mit welch tiefer Erschütterung sie den Übertritt vollzogen hat, das beleuchten ihre Worte: »Es ist mir fast bedeutender noch gewesen, mit Richard zum heiligen Abendmahl zu gehen als zum Traualtar.« Ein Zwiespalt mit Liszt war darob nicht mehr zu befürchten. Kurz vorher war er ja in Bayreuth gewesen, hatte sich, wie wir gesehen haben, dort überaus wohl gefühlt, war vom »Parsifal« tief ergriffen worden, und alles, was er damals sprach, freier und offener als je vorher, ließ erkennen, daß der Druck, den die Fürstin auf ihn auszuüben suchte, ihn schließlich nur selbständiger gemacht hatte, daß er nun auch in religiösen Dingen jene Vorurteilslosigkeit bewährte, die ihn schon in seinen Jugendjahren in der Pariser Gesellschaft allen anderen überlegen zeigte. Überblicken wir das Jahr 1872, so erkennen wir als seinen schönsten Gehalt und Ertrag das Wiederzusammenfinden Liszts mit seiner Tochter und das enge Band, das ihn von neuem mit Wagner verknüpfte. Dabei dürfen wir jedoch nicht übersehen, daß dieser ganz in Cosima lebte und nur durch ihr Leben in ihm zu seinem höchsten Geistesfluge, seinen letzten, unerhörten Leistungen befähigt wurde. Wir müssen es begreifen, daß ihm der kindliche Anschluß Cosimas an ihren Vater, dem sie viel Zeit und Aufmerksamkeit widmete, auch manchmal eine unerwünschte Störung war und seine Eifersucht weckte.
Auch die Lebenserinnerungen waren in diesem Jahre wieder gefördert worden, und im Rückblick auf so viele wunderliche Erfahrungen hatte Wagner erkannt, wie selten ein wahres Verständnis selbst unter gleichgesinnten Seelen Platz greift und wie Reden und Worte, auch bedeutendster Art, oft nur Mißverständnisse herbeiführen. Da sagte er denn zu Cosima: »Die einzige Freude an meiner Sache ist, wenn ich die Skizze geschrieben, sie dir vorzusingen. Dann aber ist alles aus. Denn es besteht die Unfähigkeit, sich durch die Sprache verständlich zu machen. Die Sprache ist Konvention. Nur die Liebe, die sich selbst aufgibt, versteht den anderen, und der durch die Kunst hingerissene.« Die Sendung, die Cosima an der Seite Wagners zu erfüllen hatte, bestand auch darin, daß sie seine Nerven beruhigen mußte, daß sie Tag für Tag über sein Befinden zu wachen hatte, daß sie an nichts anderes denken durfte als an Hilfen und Erleichterungen für sein so übermäßig in Anspruch genommenes, verhundertfachtes Leben. Aber Denken und Sorgen allein tut es nicht. Der verstandesmäßige Wille, die Absicht, muß von einer geheimnisvollen Kraft, vom Willen im Schopenhauerschen Sinne, getragen sein, um verwirklicht werden zu können. Diese Kraft war Cosima zu eigen. Die Berührung ihrer Hände wirkte magnetisch auf Wagner. Durch Blick und Gebärde konnte sie den Aufbrausenden beruhigen, den Zusammensinkenden ermuntern. Ihre bloße Nähe war immer das beste Stärkungsmittel für ihn. In dieser Gewalt, die sie ausübte, ist das Seelische vom Leiblichen, das Geistige vom Natürlichen nicht zu trennen. Diese Gewalt wirkte auf das Innere, aber auch auf die körperlichen Zustände des Meisters. Darum werden wir es nicht als kleinliche Regung werten, wenn Wagner es schmerzlich empfand, daß Cosima sich zeitweilig – in den wenigen Tagen, die dazu Gelegenheit boten – mehr dem Vater weihte und ihre Kraft sozusagen nach einer anderen Richtung ausstrahlen ließ. Das Wort Eifersucht, mit dem nur die äußere Sachlage oberflächlich gekennzeichnet ist, verrät nichts von dem tieferen Grunde seiner Gemütsbewegung.
Und diese Frau, der eine solche Macht gegeben war, trat doch niemals gebietend auf; immer schmiegte sie sich an, immer war sie voll Demut und Hingebung, immer hatte sie das Gefühl ihrer Unzulänglichkeit. Sie litt aber auch unter dem Schwankenden des Bayreuther Werkes, unter den Hindernissen und Erschwerungen, denen es begegnete. Sie sollte ihrem Gatten Mut und Zuversicht einflößen und war doch selbst mutlos. So schrieb sie am Schlusse des Jahres 1872 in ihr Tagebuch: »Nur Glauben habe ich, Hoffnung aber keine! Die Welt ist nicht unser, sie gehört anderen Mächten. Gerne aber will ich leiden bis ans Lebensende, und ich bin lieber traurig als froh – könnte ich es nur für mich allein sein. Ich habe aber nichts zu wählen und ich sollte nichts wünschen, nur hinnehmen, was kommt; so sei denn um diese Mitternacht alles vom kommenden Jahre ergeben hingenommen, alles, auch das Schwerste, als eine Gerechtigkeit. Gnade mir Gott, Gutes zu tun … Gott verzeihe mir meine Sünden, gebe mir gute Kinder, lasse Richard wohl und erfreut sein, und lasse Hans zu Glück und Befreiung kommen. Amen.«
Die nächsten Jahre stellten allerdings die Geduld Wagners auf eine harte Probe. Es sah fast so aus, wie wenn das Geheimnis, das Wagner im Grundsteine des Festspielhauses eingeschlossen hatte, dort begraben wäre, und als ob auch dieser Grabstein eines hehren Gedankens nicht mehr lange stehen sollte. Denn – das deutsche Volk bewährte sich einstweilen nicht. Die »mitschöpferischen Freunde«, an die Wagner sich gewendet hatte, waren zu gering an Zahl und zu arm an Vermögen. Den »weiten Kreisen« war es unmöglich beizubringen, daß es sich hier um keine Theaterunternehmung für Gelderwerb handelte. Wagner, dem es »fast mehr auf die Erweckung verborgener Kräfte des deutschen Wesens als auf das Gelingen seiner Unternehmung selbst ankam«, blieb sich und seinem Gedanken unerschütterlich treu. Aber im Jahre 1873 waren erst 240 Patronatscheine verkauft. Die größten Summen kamen aus dem nichtdeutschen Auslande. Der Khedíve zeichnete 10 000, der Sultan 90 000 Mark. 4000 deutsche Buch- und Musikalienhändler aber, denen Zeichnungslisten zugegangen waren, führten keine Beträge ab. (Nur in Göttingen hatten ein paar Studenten sich eingetragen.) 81 Hof- und Stadttheater waren vergeblich ersucht worden, das Erträgnis einer Vorstellung dem Bayreuther Zwecke zu widmen. Nur von dreien kam eine abschlägige Antwort, von den übrigen gar keine. Bayreuth war doch gegen die Theater gerichtet. So kam der Augenblick, in dem Wagner das Unternehmen als »gescheitert« betrachten mußte. Man hielt die Einstellung der Bauarbeiten für unvermeidlich. Da griff der König von Bayern ein und übernahm die Bürgschaft für die ungedeckten Kosten.
In der Geschichte Bayreuths, die noch nicht geschrieben ist, wird all dies ausführlich darzustellen sein. Hier mußte nur darauf hingewiesen werden, um den rechten Hintergrund zu gewinnen für das persönliche Leben Wagners und Cosimas. Am meisten erfüllt uns dabei die Freude, daß König Ludwig nach langem Zögern und nachdem schon wieder seine Abkehr von Wagner geflissentlich verbreitet worden war, dennoch zu ihm zurückfand oder vielmehr durch die Tat bekräftigte, daß er nie von ihm getrennt war. Die Bayreuther Sache wurde dann noch eifriger betrieben. Die Konzerte zugunsten Bayreuths mehrten sich. Hans von Bülow, der seine Konzerttätigkeit wieder aufgenommen hatte, spielte auch für Bayreuth und brachte allmählich 40 000 Mark zusammen. Trotzdem konnten die Arbeiten nicht so rasch gefördert werden, wie es ursprünglich geplant war. Nicht 1873, sondern 1876 ist das denkwürdige Jahr der ersten Bayreuther Festspiele.
Im Januar 1873 waren Wagners wieder unterwegs. Zuerst nach Dresden, wo sie mit Wesendoncks zusammentrafen, den »Rienzi« hörten – der ihnen dort besser gefiel als in Wien –, und wo Wagner bei einem Festmahle seinen Trinkspruch mit den Worten schloß: »Schiller sagt: Ernst ist das Leben, heiter die Kunst … Ich habe die Kunst sehr ernst genommen, und das Leben, wenn nicht heiter, doch leicht. Meinen Freunden habe ich das Leben manchmal schwer gemacht, sie hatten oft große Not mit mir. Ich möchte aber sagen: Schiller hat unrecht. Sagen wir lieber: Ernst ist die Kunst, heiter sei das Leben. Vielleicht kommen wir einmal dazu, daß das Leben einen schönen Ernst gewinne und die Kunst eine erhabene Heiterkeit.«
Dann ging es nach Berlin, wo bei der Freifrau von Schleinitz, in den Räumen des königlichen Hausministeriums, Wagner das Gedicht der »Götterdämmerung« vorlas, »vor der Macht des Ranges und der Intelligenz«, wie Cosima an Malwida schrieb. »Ich glaube, daß selten eine so ausgewählte Gesellschaft aus allen Kreisen in einem Hause, zu einem Zwecke vereinigt war.« Im Mittelpunkte der Zuhörerschaft stand der Feldmarschall Graf Moltke, »gebeugter Haltung, blitzenden Auges«. Cosima schrieb auch ausführlich an Liszt, der mit merklicher Genugtuung ihren Bericht wörtlich an die Fürstin weitergab. Auch die Baronin Meyendorff, die jetzt sozusagen das Orakel Liszts war, wohnte der Berliner Veranstaltung bei und konnte bezeugen, daß Cosima inmitten all der Minister und Diplomaten und gelehrten Berühmtheiten, die sie umdrängten, einen außerordentlichen persönlichen Erfolg errang durch die Liebenswürdigkeit und Vornehmheit, mit der sie alle, namentlich auch die Frauen, gewann.
Darauf gab es zwei Konzerte für Bayreuth in Hamburg. In Schwerin sahen sie den »Fliegenden Holländer« und lernten in der Titelrolle Karl Hill, einen trefflichen Künstler kennen, der sich dann auch in Bayreuth vorzüglich bewähren sollte. Es folgte ein Berliner Konzert mit Betz und Niemann, unter Beteiligung des kaiserlichen Hofes. Daheim in Bayreuth war nicht viel von Ruhe zu spüren, sondern im Gegenteil so viel Briefliches zu erledigen, so viel Geschäftliches in Ordnung zu bringen, daß Wagner mit Recht seine »Überbeschäftigung« betonte, die auch schließlich zu andauernder Schlaflosigkeit führte. Der Hausbau war schon ziemlich weit gediehen und im Garten hinter dem Hause die Stelle der Gruft bestimmt, in der er mit seiner Gattin ruhen wollte.
Cosima war jetzt hauptsächlich um die Erziehung ihrer heranwachsenden Töchter bemüht, und in ihrem stets auf das Allgemeine gerichteten Streben, ihrer ununterbrochenen Anteilnahme an den öffentlichen Zuständen, plante sie vorübergehend die Errichtung einer Mädchenschule in Bayreuth mit einem besonderen Wirkungskreise für die als Erzieherin bewährte Malwida von Meysenbug. Doch es gab immer wieder Näherliegendes und Unabweisbares, das alle Kräfte in Anspruch nahm. Besonders wichtig war diesmal Wagners Geburtstag, vollendete er doch sein 60. Lebensjahr! Mit sechzig beginnt das Alter; wer früher nur vorausblickte, der schaut jetzt auch zurück und denkt sinnend seiner Jugend. Beim Diktat der Erinnerungen hatte sich Wagner schon in den letzten Jahren eingehend mit seiner frühesten Entwicklung befaßt. Darauf beruhte der Plan für die Geburtstagsfeier, bei der sich das Geschick Cosimas, immer neue Überraschungen für die Familienfeste auszudenken, besonders glanzvoll bewährte.
Am Morgen des 22. Mai wurde Wagner mit dem »Wach auf«-Chore aus den »Meistersingern« geweckt und abends in das Opernhaus geführt, wo ihm vor einer glänzenden Versammlung, vor ganz Bayreuth, eine Festaufführung dargeboten wurde, von deren Spielfolge er keine Ahnung hatte. Beim einleitenden Orchesterstück, das nach seiner witzigen und zutreffenden Bemerkung weder von Beethoven noch von Bellini sein konnte, brauchte er wirklich einige Zeit, bis ihm ein Licht darüber aufging, daß dies seine eigene Konzertouvertüre vom Jahre 1831 sei. Es folgte das Lustspiel »Der Bethlehemitische Kindermord« von seinem Stiefvater Ludwig Geyer, der so liebevoll seine erste Jugend überwacht hatte. Den Schluß bildete ein Festspiel »Künstlerweihe« von Peter Cornelius, mit derselben Musik, die Wagner einst in Magdeburg zu einer Neujahrskantate für 1835 geschrieben hatte. Diese Wiederbegegnung mit halb vergessenen, für die Außenwelt längst verschollenen, vom Standpunkte der erreichten Höhe aber doch wieder beachtenswerten Werken weckte in ihm den Wunsch, auch das Beste, was er als Jüngling geschaffen, seine C-Dur-Sinfonie von 1832 wiederzufinden. Ein Wunsch, den Cosimas nimmermüder Eifer eines Tages zu erfüllen vermochte.
Daß er auch sonst von Liebe umgeben wurde, daß er wirklich Freunde besaß, das hatte ihm das Zustandekommen der Festvorstellung und die rege Beteiligung an der Feier zu seiner Rührung bewiesen. Wenige Tage später wohnte er mit Cosima einer von Liszt geleiteten Aufführung des »Christus«-Oratoriums in Weimar bei. Dieses Werk, einzig in seiner Art, vom Größten, was Liszt geschaffen, ist obenhin gesehen eine merkwürdige Mischung von innerlich keuscher und äußerlich effektvoller Musik, von ganz persönlichen, aus einem frommen Herzen quellenden Eingebungen, alten kirchlichen Gesängen gottesdienstlicher Art und glanzvollem modernem Orchester. Wer das leicht verstehen will, der muß, so wie Liszt selbst, vom Geiste der katholischen Kirche durchdrungen sein, die die starrste Überlieferung mit dem wandlungsfähigen Bedürfnis nach Anpassung und nach unmittelbarer Wirkung verbindet. Die Weimarer Aufführung fand, zum Entsetzen der Fürstin, in einer protestantischen Kirche statt. Liszt hatte damit seine Unbefangenheit, seine geistige Freiheit bewiesen. Aber das Werk blieb, wie es war, und Wagner konnte sich damit nicht so rasch befreunden. Nach den Worten Cosimas machte er während der Aufführung »alle Phasen des Entzückens bis zur äußersten Empörung durch, um zur tiefsten, liebevollsten Gerechtigkeit zu gelangen«. Sie selbst faßte nach ihrer Rückkehr ihre Eindrücke in einem Briefe an den Vater zusammen, und dieses Schreiben offenbart wieder ihren außerordentlichen Geist und ihr tiefes Verständnis nicht nur für die Kunst im allgemeinen, sondern auch besonders für das schwer zugängliche Wesen Liszts.
Dabei war sie doch ganz vom Geiste Wagners durchdrungen, und auf diesen Fahrten, auf denen sie auch kleine deutsche Städte berührten, festigte sich in ihrem Herzen immer mehr ein neues Heimatgefühl, das sie in den Worten ausdrückte: »Tiefe, inbrünstige Liebe zu Deutschland regt sich in mir, das einzige Land, darin man leben kann.« Der Aufenthalt in Bayreuth erschien ihr auch von Tag zu Tag natürlicher, selbstverständlicher, unentbehrlicher. Es war doch ein gewagter Schritt gewesen, diese Wahl eines unbekannten Ortes, der nichts von den Lockungen und »Segnungen« der großen Städte und berühmter Erholungsstätten bot. Was Bayreuth heute ist – und auch heute ist es noch, im Vergleiche mit vielen anderen, weniger berühmten Orten, nur ein »deutscher Winkel« – das ist es hauptsächlich durch Richard Wagner geworden. Aber dieser Umschwung vollzog sich schon damals, in den ersten Jahren seines Aufenthaltes. Durch ihn wurde nicht nur der Name der Stadt in ganz Europa bekannt, auch in ihr selbst regte sich alsbald neues Leben, und mehr fördernde Teilnahme, mehr tätige Gunst, als Liszt sie in Weimar durch den ihm so sehr geneigten Großherzog erfahren hatte, erfuhr hier Wagner durch die Bürgerschaft, zu der auch Cosima in die lebhaftesten und herzlichsten persönlichen Beziehungen trat. Der Unterschied von Weimar und Bayreuth, das Gegensätzliche der Lebenswege, auf denen Liszt und Wagner ihrem gemeinsamen Stern folgten, kam ihr sehr stark zum Bewußtsein. Da war es ein schöner Ausgleich, daß die Herzen sich um so inniger zusammenschlossen und daß beispielsweise Liszt ihr bald nach jener Weimarer Aufführung schreiben konnte: »Dein Brief hat die große Freude verlängert, die Du und Wagner mir in Weimar gemacht habt. Ihr allein vermögt sie mir zu geben. Sie bleibt und lebt in meiner Seele wie ein Strahl des Segens Gottes. Sei überzeugt, meine Tochter, daß Dein Wunsch völlig erfüllt ist und daß niemals etwas den reichen und wundervollen Zusammenschlag unserer Herzen trüben wird, die für die Ewigkeit verbunden sind. Lassen wir all das Öde und Schnöde dieser Welt und gehen wir unseren Weg. Uns eröffnet die Liebe die neun Himmel. ›Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.‹«
Liszt kam auch im Herbst zur Hebefeier des Festspielbaues, zum sogenannten Richtfest. In den gereimten Sprüchen des Werkmeisters und des Bauherrn kamen dieselben Gedanken zum Ausdruck, die Wagner in eine knappe Formel gefaßt hatte, als er auf die Partitur seines »Rings«, die jetzt eben zu erscheinen begann, die Worte geschrieben hatte: »Im Vertrauen auf den deutschen Geist entworfen und zum Ruhme seines erhabenen Wohltäters, des Königs Ludwig II., vollendet von Richard Wagner.« Sein Festspruch aber klang wieder in einen Freundesgruß an die Bürger Bayreuths aus.
Das häusliche Leben hatte inzwischen manche Bereicherung erfahren. Malwida von Meysenbug war nach der Verheiratung ihrer Pflegetochter Olga Herzen nach Bayreuth gezogen, um vertrauten Umgang zu haben und in einem ihr gemäßen Kreise ihre Tage beschließen zu können. Freilich, sie kam aus dem ewigen Frühling Italiens in den deutschen Herbst und Winter, und es erwies sich nur zu bald, daß dieser Aufenthalt für sie schädlich war. Im neuen Jahre mußte sie wieder nach dem Süden. Außerdem war in dieser Zeit ein Jugendfreund Wagners, der Bildhauer Gustav Kietz, zu längerem Verweilen nach Bayreuth gekommen und hatte auch Ton mitgebracht, um den Meister und seine Frau zu modellieren und diese Arbeiten zum Schmucke des neuen Hauses zu stiften. Wagner gelang ihm leichter als Cosima, worüber er selbst recht unterhaltend berichtet: »Heute früh war ich allein, da habe ich die Zeit benutzt und Kopf und Hals der Büste im Charakter bewegt, worauf ich vorher keine Rücksicht nehmen konnte, da ich anderes zu beobachten hatte. Wagner war immer ganz unruhig über den starren Hals und sagte wiederholt: ›Den Hals bringt er aber doch nicht.‹ Als Frau Cosima mit Fräulein von Meysenbug heute nachmittag kam, gefiel ihr die Bewegung der Büste sehr. Später kam Wagner und rief: ›Jetzt hat er den Schwanenhals!‹ … Ich glaube selbst, eine größere Freude kann ihm kaum jemand machen, als ich, wenn mir die Arbeit gelingt. Eine besondere Freude war es für mich, das geöffnete schöne volle Haar Frau Cosimas zu sehen, wenn sie es selbst nach meinen Angaben ordnete.« So gut nun auch die Büste ausfiel, mit Lenbach konnte Kietz doch nicht wetteifern. Das Lenbachsche Bildnis hing beim Arbeitstische Wagners, sah gleichsam auf ihn herab, wenn er an der Partitur der »Götterdämmerung« arbeitete, und da sagte er einmal zu seiner Frau: »Mit dem Bilde treibe ich Götzendienst, wenn ich instrumentiere. Wenn du wüßtest, was ich dir alles sage.« Cosima selbst war am wenigsten leicht zufriedenzustellen. Als Kietz die Büste Wagners modellierte, schrieb sie an Lenbach: »In Dingen der Kunst verstehe ich keinen Spaß und ich verkehre noch lieber mit mittelmäßigen Menschen, als mit mittelmäßigen Kunstwerken.«
Auch ein großer Tondichter war in diesem Jahre, eben als Kietz bei der Arbeit war, im Hause Wagners erschienen: Anton Bruckner, der schon in München beim »Tristan« mit Wagner persönlich bekannt geworden, bisher jedoch nicht gewagt hatte, ihm eines seiner Werke vorzulegen. Nun kam er aus dem nahen Marienbad nach Beendigung einer Kur herüber und brachte gleich zwei Sinfonien mit, die Zweite und die (noch unvollendete) Dritte. Er bat Wagner, die Partitur nur flüchtig zu prüfen, ein Blick auf die Themen genüge für den »hohen Scharfblick« des Meisters. Wagner war nun wirklich schon vom Beginne der Dritten, dem Trompetenthema in d-moll, wie von einem Gruße aus seiner Welt gebannt. Herzlich gern nahm er die Widmung dieser Sinfonie an, und in den wenigen Stunden des zweimaligen Besuches wurde der Geistesbund geschlossen, der hinfort das ganze Leben und Schaffen Bruckners trotz aller Entbehrungen und Enttäuschungen als ein wunderbarer Segen durchwirkte. Wenn Bruckner später die gedruckte Sinfonie »Sr. Hochwohlgeboren Herrn Richard Wagner, dem unerreichbaren, weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und Tonkunst in tiefster Ehrfurcht« unterbreitete und auch sonst mit ehrenden und rührenden Begleitworten versah, so bediente er sich zwar einer schulmäßig-altväterlichen Ausdrucksweise, aber alles, was er sagte und schrieb, kam ihm aus tiefstem Herzen und gab Kunde von seiner grenzenlosen Verehrung. Wagner hinwiederum hatte mit seinem »hohen Scharfblick« in unglaublich kurzer Zeit das Wesen Bruckners, sein künstlerisches und menschliches Wesen, erkannt. Bruckner wurde ihm der einzige Tondichter unter den Lebenden, den er als einen ebenbürtigen gelten ließ, der einzige Sinfoniker, der nach Beethoven in seinen Augen Berechtigung hatte. Er selbst, Wagner, wollte Bruckners Werke aufführen, wenn er einmal Bayreuth unter Dach gebracht. Er hat das bei späteren Zusammenkünften dem in Wien tätigen oberösterreichischen Meister mehrmals wiederholt. Seltsamerweise hat man in seinem Hause keine Überlieferung daraus gemacht, seine Angehörigen haben Bruckner zwar stets freundlich und achtungsvoll behandelt, seine Kunst aber eigentlich kaum zur Kenntnis genommen. Wenn Cosima schon in München mit nachsichtigem Lächeln den etwas unbeholfenen und im ersten Augenblicke befremdenden ehemaligen Dorfschullehrer als ein »echtes Wiener Kind« bezeichnete, so hat sie ihn schon damals verkannt. Die Mundart Bruckners war nicht die wienerische, weder im Leben noch in der Kunst, und am allerwenigsten hatte der kindlich gutmütige, glaubensstarke und sehr selbstbewußte echte Oberösterreicher einen entscheidenden Zug mit dem viel weicheren und manchmal recht leichtfertigen Wiener gemein.

Cosima Wagner Ende der 70er Jahre.
Mit Genehmigung von Frau Eva Chamberlain
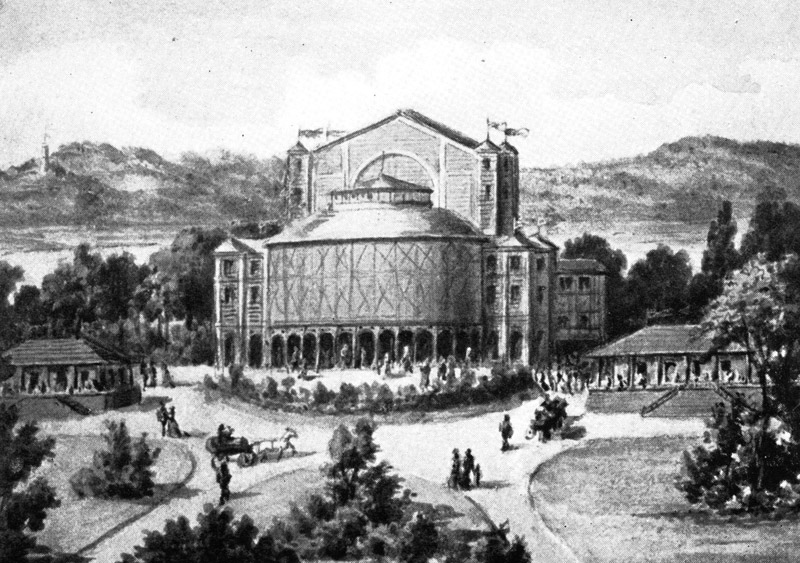
Das Bayreuther Festspielhaus (1876).
Nach einem Gemälde von S. Schinkel.
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Das Bayreuther Festspielhaus in seiner heutigen Gestalt.
Städt. Verkehrsamt Bayreuth, Bildstelle. Photo Müller
In diesem Jahre beging Liszt ein seltenes Jubiläum: vor fünfzig Jahren war er zum ersten Male als Knabe vor die Öffentlichkeit getreten. Seine ungarischen Landsleute nahmen diese Erinnerung zum Anlasse einer Reihe von Festlichkeiten, an denen sich die ganze musikalische Welt beteiligte. Der Erzbischof Kardinal Haynald sagte: »Einst ist Liszt zu den Nationen gegangen, jetzt kommen die Nationen zu uns!« Die Veranstaltungen in Pest währten vom 8. bis zum 11. November. Unter der Leitung Hans Richters, der jetzt Kapellmeister am ungarischen Nationaltheater war, wurde der »Christus« aufgeführt. Mit den Grüßen aus aller Welt kam auch ein schönes Gedicht von Wagner, ausklingend in den Reimen:
»Was heut' ein Volk Dir will an Huld erzeigen,
Durch Liebe ist's auch unsrem Herzen eigen.«
Für die Weihnachtsfeier dichtete Wagner ein Reigenlied, das die Kinder zu Ehren der Mutter sangen. Lulu (Daniela) war die Vorsängerin. Zu den an ein altes Minnelied erinnernden Worten hatte Wagner eine Weise geschrieben, in der so recht der deutsche Ton laut wurde, wie ihn der Hirtenknabe im »Tannhäuser«, Walther Stolzing in den »Meistersingern« anstimmt. Die Verse lauten:
»Sagt mir, Kinder: was blüht am Maitag?
Die Rose, die Rose, die Ros' im Mai.
Sagt mir, wißt ihr auch: was blüht in der Weihnacht?
Die kose – die kose – die kosende Mama, die Cosima!
Verwelkte auch die Maitagrose,
Neu erblüht sie in der Weihnacht Schoße!
Ros' im Mai! Kos' im Mai!
Allerliebste, allerschönste Cosima!«
Die Jahre 1874 und 1875 waren hauptsächlich den Unterhandlungen mit den Sängern und der Arbeit an ihren Rollen gewidmet. Wagner legte Wert darauf, daß die von ihm gewählten Künstler durch ihn selbst mit ihren neuen und ungewohnten Aufgaben vertraut gemacht wurden. Vorher jedoch hatten sie sich die Dichtung genau anzueignen. Im übrigen gab zunächst die Einrichtung des fertig gewordenen Hauses viel zu schaffen. Am 28. April fand der Einzug statt. Noch waren die Innenräume nicht vollendet, aber das Haus war bereits bewohnbar und bot mit seinen bequemen Räumen der Familie einen weit angenehmeren Aufenthalt, als sie ihn bisher an der Dammallee genossen hatte. Alle Welt kennt heute das schöne einfache Haus mit der Büste des Königs Ludwig im Vorgarten und mit der Wandmalerei, die den deutschen Mythos in der Gestalt Wotans, die tragische Muse und den jungen Siegfried darstellt, über der Eingangstür. Wotan trägt die Züge Schnorrs, die Muse ist die Schröder-Devrient, der Knabe Siegfried ist unverkennbar Fidi. Unterhalb des Gemäldes fügen sich drei Marmortafeln mit Inschrift zu dem Spruch zusammen:
»Hier, wo mein Wähnen Frieden fand,
Wahnfried
Sei dieses Haus von mir genannt.«
Der Name des Hauses war aus dem eines Ortes in Hessen entstanden, an dem Wagner wiederholt vorbeigekommen.
Die Festspielbesucher, die das Haus betreten durften, bewunderten immer wieder die Pracht und Schönheit der Musikhalle und des großen Büchersaales im Erdgeschosse. Heute werden diese Räume, auch wenn keine Gäste geladen sind, den Fremden gezeigt. Nicht mit Unrecht ist gesagt worden, daß der Zeitgeschmack des 19. Jahrhunderts durch den Genius, der hier gelebt hat, veredelt und zu schier zeitloser Geschmackshöhe geführt wurde. Die Fest- und Empfangsräume in Wahnfried sind ein in sich geschlossenes Kunstwerk. Gewiß richtet man sich heute anders ein. Schon Siegfried Wagner, der zuerst Architekt werden wollte, hat seinem Arbeitsraume in dem von ihm gebauten Gartenhause ein viel »moderneres« Gepräge verliehen, und die siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gelten heute nicht als gutes Vorbild. Man denkt dabei zu sehr an schlechte Nachahmungen und vergißt, daß jeder Zeitstil in seiner reinen und vollkommenen Ausprägung etwas Einmaliges und Unnachahmliches ist, das nicht zu werten, sondern schlechthin anzuerkennen ist. In Wahnfried wird die Anerkennung zur Bewunderung. Man muß lange suchen, bis man so glänzende und dabei so anheimelnde Räume findet, in denen der Reichtum nichts Überladenes, das Beziehungsvolle der bildnerischen Ausschmückung nichts Gesuchtes und nichts Aufdringliches an sich hat und der künstlerische Gesamteindruck, den Sinnen wohltuend, so viel Geist und Seele ausspricht. Hier muß man in der Tat vom erlesensten Geschmack sprechen und wird nicht fehlgehen, wenn man die Vollendung, mit der das Kleinste zur rechten Wirkung kommt und alles am rechten Platze steht, dem besonders geläuterten persönlichen Geschmacke Cosimas zuschreibt.
In diesem Hause feierte nun Wagner seinen 61. Geburtstag. Kurz vorher war der Pfarrer Tschudi in Luzern gestorben, der die Trauung Wagners mit Cosima vollzogen hatte. Wagner hatte ihm für seine Kirche eine jährliche Zuwendung bei der Wiederkehr des Trauungstages bestimmt und übertrug diese jetzt auf die in Triebschen zurückgebliebene treue Verena Stocker. Eine andere Todesnachricht traf just am Abende seines Geburtstages ein und wurde ihm daher bis zum nächsten Tag vorenthalten. Marie Muchanow-Kalergi war in Warschau einem verheerenden Leiden erlegen. Cosima hatte sie gleich nach ihrer schweren Erkrankung besuchen und pflegen wollen, was jedoch Wagner in höchste Bestürzung versetzte, denn die Gefahr der Ansteckung schien groß zu sein. Cosima schrieb allerdings an ihre Freundin Marie von Schleinitz: »Ich halte durchaus an dem Gedanken fest, Marie zu besuchen. Für mich gibt es wirklich keine Ansteckung. Ich habe eine solche Kranke nicht nur besucht, sondern bis an das Ende gepflegt, ihren Leib gewaschen, alle Pflichten erfüllt. In Häusern, von Scharlachfieber, Masern, auch Cholera heimgesucht, bin ich gewesen, nichts hat mich ereilt.« Doch sie sah ein, daß ihr Mann, ihre Kinder, das Haus sie nicht entbehren konnten und daß sie vor allem dem Gatten in seinen Mühen und Sorgen, keinen neuen Kummer bereiten durfte. Wie ein Bote von ihr war wenige Wochen vor dem Hinscheiden der Getreuen Hans von Bülow auf seiner Reise durch Rußland nach Warschau gekommen und hatte das »düstere Glück« gehabt, sie während einer kleinen Erleichterung ihres Zustandes »zerstreuen« zu dürfen, indem er ihr zweimal im Nebenzimmer Chopin vorspielte. Es war schwer für ihn, denn er war »selten von so übermächtigem Mitleid bedrückt gewesen«. Aber er bereitete der Sterbenden den letzten schönen Eindruck ihres Lebens.
Der Verkehr mit den Sängern stellte Cosima vor neue Aufgaben, die sie in ihrer gewohnten Art löste. Sie hatte es wie vordem in München auf sich genommen, die Briefe zu schreiben und die persönlichen Unterredungen zu führen, die nicht zur rein künstlerischen Arbeit gehörten. Mit den Bühnenkünstlern ist es nicht leicht und war es hier manchmal um so schwerer, als die allem Herkömmlichen und Gedankenlosen widersprechende Eigenart des neuen Unternehmens und die Erklärung Wagners, daß er nur eine wohlbemessene Kostenvergütung, aber keine »Bezahlung« leiste, sehr hohe Forderungen an die Kunstbegeisterung, die Uneigennützigkeit und den Ehrgeiz der Mitwirkenden stellten, anderseits aber mit der gangbaren Eitelkeit und Selbstverherrlichung des »Bühnenvölkchens« gerechnet werden mußte. Da war Cosima so recht an ihrem Platze. Wie viele Unannehmlichkeiten hat sie dem Meister erspart, wie viele Hindernisse hat sie ihm aus dem Wege geräumt! Wie erzieherisch hat sie auch auf die Künstler selbst gewirkt, die nicht nur in ihren Leistungen, sondern häufig auch als Menschen und Mitbürger von üblen Gewohnheiten zu befreien und zur richtigen Entfaltung ihres Wesens anzueifern waren. Hierfür kamen der wunderbaren Frau nicht nur ihre Menschenkenntnis, ihre Erfahrung, ihre Klugheit, ihr Geschick, ihr Takt und ihr Herz zugute, sondern vor allem das, was Wagner ihre Urkraft nannte. Und wenn sie mit Bezug auf Wagner meinte: meine Kraft nehme ich von ihm, so war sie im Umgange mit den Sängern zweifellos die einzig Gebende. Ihre bloße Erscheinung, ein Wort, ein Blick von ihr genügten, um den Ungebrochenen zu einem besseren Menschen zu machen. In seinem späteren Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876 hat Wagner eine von ihm geförderte, sehr begabte Sängerin erwähnt, die vom Berliner Hoftheater aus ihre Mitwirkung bei den Festspielen mit der Begründung ablehnte, man werde in Berlin so schlecht; in Bayreuth machte ein schöner Zauber alles gut. Dieser schöne Zauber ging nicht zuletzt von der Meisterin aus, in deren Nähe kaum jemand schlecht bleiben konnte. Dabei war es sowohl ihre Natur als auch Takt und Klugheit, wenn sie streng auf die äußeren Formen achtete. Vor ihr durfte und konnte man sich nicht gehen lassen. Damit war schon viel, war oft alles gewonnen für einen gedeihlichen und schließlich auch gemütlichen Verkehr.
Wir verfolgen hier nicht im einzelnen die mannigfachen sehr freundschaftlichen und geistig fruchtbaren Beziehungen Wagners und Cosimas zu Nietzsche, der nicht nur der Grundsteinlegung beigewohnt hatte, die er »die Morgenweihe am Tage des Kampfes« nannte, sondern der auch später wiederholt nach Bayreuth kam und dort an manchen Familienfesten teilnahm oder mit Wagners auf ihren Reisen zusammentraf. Dann und wann blieb er länger aus und verhielt sich eigentümlich zurückhaltend gegen dringende Einladungen. Wagner hatte sogar daran gedacht, ihn in seinem letzten Willen zum Vormund seines Sohnes einzusetzen – »der Junge braucht Sie«, hatte er ihm einmal geschrieben –, und man konnte kaum größere Hoffnungen für die fernere Entwicklung dieses bedeutenden Geistes hegen, als es in Bayreuth geschah. Nietzsches Entwicklung ging jedoch nach einer anderen Richtung, die ihn innerlich von Wagner wegführte. Schon zu einer Zeit, als sie äußerlich noch eng verbunden zu sein schienen. Brieflich und mündlich gab es kleinere und größere Verstimmungen, die sich die Beteiligten selbst nicht einzugestehen getrauten, und immer wieder gewahrte Wagner etwas Befremdendes, ihn unheimlich Berührendes in dem persönlichen Verhalten und in den Gedankengängen des geliebten Jüngers.
Wir erwähnen nur kurz den erneuten Besuch Dr. Standhartners aus Wien, der auch an dem frohen Feste teilnahm, das ungefähr sechzig Personen aus der Bayreuther Gesellschaft in Wahnfried vereinigte, gemäß dem Wunsche des Dekans Dittmar, desselben, der Cosima bei ihrem Übertritte das Abendmahl gereicht hatte: daß alle gebildeten Bayreuther das Haus sehen sollten.
Das bedeutendste Ereignis dieses Jahres ist die Vollendung der Partitur der »Götterdämmerung«. Kurz vorher hatte Wagner wieder einige Tote zu beklagen gehabt. Fast gleichzeitig waren Peter Cornelius, sein älterer Bruder Albert (der Vater Johanna Jachmanns und Franziska Ritters) und sein Schwager Wolfram aus dem Leben geschieden. Schwester Klara, die Witwe Wolframs, der ihr Bruder immer die wärmste Zuneigung und besonderes Vertrauen geschenkt hatte, folgte ihrem Manne schon im nächsten Frühjahr. Doch weder solche Verluste, wie schmerzlich sie auch wirken mochten, noch die immer wache Sorge um das Zustandekommen der Festspiele, noch der fortwährende kleine Ärger, der bei einem so großen und schwierigen Unternehmen unausbleiblich ist, hemmten die Arbeit an der Partitur zum »Ring«, deren rechtzeitiges Gelingen die wesentliche Voraussetzung der Spiele war. Am 21. November 1874 tat Wagner den letzten Federstrich. Ein Vierteljahrhundert war seit dem ersten Plane zu »Siegfrieds Tod« vergangen. Der »Tristan« und die »Meistersinger« hatten das Werden des »Rings« unterbrochen. Unter Störungen und Hemmnissen ohnegleichen war das vierteilige Werk bis zum Ende gediehen, in einer lückenlosen Vollkommenheit, einer geschlossenen Einheit, als hätte der Gott im Künstler diese unvergleichliche Schöpfung an einem Tage ins Leben gerufen. Es war ein namenloses Gefühl der Erleichterung und Zufriedenheit, das Wagner jetzt durchströmte, und es entsprach der heiteren und geselligen Seite seines Wesens, daß er nun gleich wieder fünfzig Personen einladen mußte, um seine Freude auch anderen mitzuteilen.
Die Hauptfreude aber, daß er Cosima, die alles mit ihm durchlebt hatte, als Erste von der Vollendung benachrichtigen und in seine Arme schließen konnte, die war ihm durch ein tückisches Mißverständnis vergällt worden. Früher als sonst war er am 21. mit der Arbeit fertig geworden und verlangte von seiner Frau die Zeitungen. Doch das war nur ein Vorwand: er wollte der Überbringerin die gute Zeitung vom geschlossenen Ring entgegenjubeln. Aber Cosima, die wußte, daß er in diesen Tagen nicht ganz wohl war, und vermutete, daß er noch einige Zeit bis zur Vollendung der Partitur brauchen würde, glaubte an eine vorzeitige Ermüdung und reichte ihm zur Ablenkung einen soeben eingetroffenen Brief ihres Vaters, an den sie die entsprechenden Bemerkungen knüpfte. Dabei vermied sie es, auf die Partitur zu blicken, um ihren Mann nicht zu kränken. Wagner war nun vollends gekränkt durch den scheinbaren Mangel an Teilnahme, den er also wieder dem bevorzugten Vater zu verdanken habe! Er wiederholte seine Klagen beim Mittagessen, und Cosima brach in bittere Tränen aus. Auch am Abend war ihr Mann noch nicht beruhigt. Der Tag der höchsten Freude hatte eine vorübergehende Entzweiung gebracht, die ihr tiefen Kummer bereitete und die sie lange nicht verwinden konnte.
Dieser an sich geringe Vorfall, dieses unter anderen Umständen völlig harmlose Mißverständnis, wie es unter jungen Eheleuten nicht selten unnützen Streit verursacht, wird hier nur deshalb erwähnt, um zu zeigen, wie leicht erregbar und wie »schwierig« in gewisser Hinsicht beide Naturen waren, wie auch dieses vorbildliche Zusammenleben von zeitweiligen Erschütterungen bedroht war, wie aber nichts sie mehr in Unruhe und Angst versetzen konnte, als die leiseste Trübung ihrer grenzenlosen Liebe. Als Wagner sie nach diesem Vorfall endlich wieder umarmte, da sagte er selbst: wir lieben uns zu heftig, und dies verursacht unsere Leiden.
Cosimas Empfindlichkeit war diesmal auch dadurch zu erklären, daß sie bei dem Briefe Liszts zuerst eine Unheilsbotschaft befürchtet hatte. War sie doch vor einiger Zeit durch den Vater benachrichtigt worden, daß Bülow wieder in schlechtester Verfassung war: seine Nerven waren überreizt, sein Gedächtnis und seine Kraft drohten ihn zu verlassen, eine Kur in Bad Salzungen war erfolglos geblieben. Wir wissen heute, daß er mit der ihm eigenen Zähigkeit sich doch bald wieder erholt hat und mit festem Mute für mehrere Monate nach England ging. Der Brief von Liszt aber, der so übel gewirkt hatte, begann mit den Worten: »Meine geliebte Tochter! Ich leide, so wenig mit Euch zusammen und für Euch vorhanden zu sein. Möchte diese Härte meines Schicksals endlich aufhören.« Zu Weihnachten ertönte wieder einmal das »Idyll«, das schon dann und wann in Bayreuth laut geworden, und das Rose-Kose-Lied.
Nach Beginn des neuen Jahres traf eine einzigartige Widmung Lenbachs für das neue Haus ein: das Bild Schopenhauers, das er aus dem Gedächtnisse gemalt. Er hatte den Weltweisen, ohne zu wissen, wer er sei, einmal in Frankfurt gesehen. Als ihm später ein Lichtbild von ihm gezeigt wurde, erkannte er das Gesicht, das ihm aufgefallen, und schuf nun eines seiner größten Meisterwerke, das wohl die bedeutendste Zierde des Saales in Wahnfried ist. In festlich-froher Weise wurde das Bild an den ihm gebührenden Platz gestellt. Wagners Dankbrief enthielt den Satz: »Ich habe die eine Hoffnung für die Kultur des deutschen Geistes, daß die Zeit komme, in welcher Schopenhauer zum Gesetz für unser Denken und Erkennen gemacht werde.« Cosima ging in ihrer Weise näher auf die Merkmale des bedeutenden Kopfes ein. Von den Augen, die scharf, unbarmherzig, durchdringend und zugleich wehmütig zu uns sprechen, erinnerte sie das linke – geschlossener, gedrückter als das rechte, leicht ermüdet und doch immer scharf – an das Auge Wagners. Ebenso schien ihr das Verhältnis der Stirn zu dem übrigen Gesicht, die Bildung des Kinns, die Augenbrauenlosigkeit eine entschiedene Übereinstimmung mit Wagner aufzuweisen, während der Mund sie eher an Beethoven gemahnte. Sie nannte das Gemälde »ein treues, erschöpfendes Bild des alten Weisen, des verehrungswürdigen Menschen … und so seelenvoll und leibhaftig, daß wir wissen: so ist er gewesen«.
Dringende Erdarbeiten auf dem Festspielplatze, für die kein Geld vorhanden war, nötigten Wagner, von neuem einige Konzerte zu geben. Dafür waren zunächst Wien und Pest ausersehen. Gleichzeitig beabsichtigte Liszt, sein neuestes Werk, »Die Glocken von Straßburg«, aufzuführen. Wagner schlug ihm vor, die beiden Veranstaltungen zu verschmelzen. Auch von ihm selbst sollte ja gänzlich Unbekanntes aus der »Götterdämmerung« zu Gehör kommen, wobei ihn weniger die Absicht leitete, die Welt damit zu überraschen, als vielmehr der Wunsch, es seiner Frau vorzuführen. Liszt ging auf Wagners Vorschlag ein, aber nur für Pest. In Wien wollte er den Erfolg des Konzertes nicht mit den dort zu befürchtenden Angriffen und vielleicht gar häßlichen Kundgebungen gegen ein Lisztsches Werk gefährden. Kamen also die »Glocken« für Wien nicht in Betracht, so ergab sich in Pest der Nachteil für Wagner, daß die Mitwirkung eines größeren gemischten Chores in dieser Kantate die Zahl der Proben und die Höhe der Kosten vermehrte, die Einnahmen hingegen durch den vom Chor beanspruchten und daher nicht vermietbaren Raum verminderte. Liszt sah dies ein, und da er wußte, daß sein persönliches Auftreten das Konzert besonders zugkräftig machen würde, erbot er sich, an Stelle der »Glocken« mit seinen »zehn alten Fingern« das Es-Dur-Konzert von Beethoven zu spielen. Die Größe und Selbstlosigkeit Liszts kamen hier wieder einmal ergreifend zum Ausdruck. Auch Wagner war ergriffen und bestand nun erst recht darauf, daß die »Glocken« mit dazukommen mußten.
Am 20. Februar trafen Wagners in Wien ein und wohnten wieder bei Standhartner. Heckel aus Mannheim war auch da, um die Bruchstücke aus der »Götterdämmerung« kennenzulernen. In dem regen Verkehre mit alten und neuen Freunden, der nun einsetzte, sahen Wagners Magnolette, die Fürstin Marie Hohenlohe, die Gattin des Obersthofmeisters, nach Jahren wieder. Dem Konzert am 1. März wohnten der Kronprinz und andere Erzherzoge bei. Donnernder Beifall, begeisterte Huldigungen und eine Ansprache des Meisters – das war nun schon das Übliche und Selbstverständliche. In einer zweiten Rede dankte Wagner besonders der mitwirkenden Sängerin, Frau Amalie Materna, die er zur Brünnhilde für Bayreuth erkoren.
Der Maler Hans Makart, mit dem Wagner und Cosima schon das letztemal durch Lenbach bekannt geworden, empfing sie am 3. März in seiner Werkstatt, die mit ihrem kostbaren alten Hausrat, den herrlichen Fuß- und Wandteppichen, den Reichtümern und Seltenheiten aller Art ein vielbewundertes Schaustück war. Cosima nannte es eine »sublime Rumpelkammer«, würdigte aber herzlich die Gastfreundschaft des Künstlers. Die Abende bei Makart glichen herrlichen Trachtenfesten, zu denen die Damen und auch viele Herren in Kleidern erschienen, deren Stoffe der Maler selbst ausgesucht, deren Schnitt er selbst gezeichnet hatte. Diesmal sollten die Gäste den Eindruck haben, daß sie im Venedig des 15. Jahrhunderts am Hofe der Katharina Cornaro versammelt seien. Der Geschmack in der Anordnung des Ganzen, die Pracht der Gewänder und des Geschmeides, durch die sich die meisten Besucher hervortaten – das ergab ein märchenhaftes Bild, das durch die Gegenwartstracht eines Teiles der Herren vielleicht ein wenig gestört oder vielmehr erst recht ins Unwirkliche gehoben wurde. Wagner fand den ihn umgebenden Mummenschanz zuerst etwas sonderbar, doch allmählich spürte er, daß hier das ernste Streben waltete, die Wirklichkeit zu erhöhen und den nüchternen Alltag vergessen zu machen. Er selbst, empfindlicher für Unechtes und Gewaltsames als irgendeiner, freute sich bei festlichen Anlässen an Zier und Prunk, die nun aber hier bei Makart, in ungewöhnlicher Steigerung, zur eigentlichen Lebensform des nur in solchen Träumen wachen Künstlers wurden. Auch Wagner war daheim oft wie ein Nürnberger Patrizier gekleidet und sah Cosima gern in kostbarem Brokat: durch all die Jahre von München, Triebschen und Bayreuth zieht sich immer wieder die Suche nach edlen Stoffen für den Raum und nach künstlerischer Gewandung für die Herrin, Bestellungen und Überraschungen, von denen die Welt, die es nichts anging, ungebührlich viel Aufhebens gemacht hat. Aber das war doch nur Schmuck des Daseins, das waren Äußerlichkeiten und Nebendinge, die vor dem Wollen und Schaffen Wagners nichtig erschienen; für Makart waren sie sozusagen sein Leben und Wirken, der notwendige Ausdruck seines Künstlerdranges, der die farbige Schönheit vergangener Zeiten heraufzubeschwören suchte.
Wagners Kunst hat eine schlummernde Saite in diesem Künstler geweckt und ihn zu malerischen Werken begeistert, die einen Höhepunkt seines Schaffens bedeuten und lange Zeit das Wertvollste waren, was im Bereich der bildenden Kunst durch Wagner angeregt worden: zu einer Reihe von Bildern zum »Ring«, in denen – frei von der bühnenmäßigen Gestaltung, aber mit genialem Erfassen des dramatischen Vorganges – das Dichterische zum Malerischen, das Malerische zum Musikalischen geworden ist. Es wäre gewiß kein übler Gedanke gewesen und hätte wahrscheinlich einem geheimen Wunsche Makarts entsprochen, wenn Wagner ihn aufgefordert hätte, die Bühnenbilder für Bayreuth zu entwerfen.
Statt dessen war ein anderer Wiener Maler hierzu ausersehen worden, der Weltreisende Josef Hoffmann, ein gebildeter und kenntnisreicher Mann, mit einer ausgeprägten Gabe für die »heroische Landschaft«. Seine Entwürfe, zu denen er Vorarbeiten im Hochgebirge gemacht hatte und die im großen und ganzen und in vielen Einzelheiten die unbedingte Zustimmung und freudigste Anerkennung Wagners und seiner Gattin fanden, sind denn auch zum Teil vorbildlich und richtunggebend geblieben.
Am liebsten aber hätte Cosima den großen Arnold Böcklin als den Mitarbeiter Wagners gesehen. Sie hatte ihn in Basel persönlich kennengelernt und sich rasch mit ihm befreundet und meinte von seinen ihr bekannten Werken, daß selbst die mißlungenen ihr besser gefielen als die guten der meisten anderen Maler, weil sie die ungemeine Begabung immer, »auch in den nicht ganz geglückten Kompositionen«, zu erkennen glaubte. Durch Lenbach hatte sie ihn um Skizzen für den »Ring« ersuchen lassen. Aber er ging nicht darauf ein, vermutlich deshalb, weil ihm die Kunst Wagners zu wenig vertraut war und weil er sich mit Recht sagen mußte, daß es hier nicht um den Stoff, sondern um die Gestalt ging, daß der Maler nur dann das Rechte leisten konnte, wenn er die besondere Art der Dichtung auszudrücken vermochte. Cosima war bekümmert darob und schrieb an Lenbach: »Es ist traurig, daß Theater und Kunst so voneinander geschieden sind, daß, wenn der dramatische Künstler kommt, er ohne Unterstützung sich sieht.« Erst nach Böcklins Absage kamen die Verhandlungen mit Hoffmann in Gang. Doch berichtete Lenbach, daß Makart einen prachtvollen Theatervorhang mit Gestalten aus dem »Ring« entworfen habe. Vielleicht ist die Bestellung dieses Vorhanges für das Festspielhaus erwogen worden. Damals waren ja noch die steifen, allegorisch bemalten Kurtinen üblich. Cosima hatte jedoch »das Bedenken, ob ein Theatervorhang gemalt sein darf; ob man ein Bild vor einem Bilde zu stellen hat, und ob nicht ein schöner Stoff in schweren Falten besser dem Zweck entspricht«. Damit war der weiche Stoffvorhang, der nicht aufgezogen, sondern nur in die Höhe gerafft wird, als das Richtige erkannt, und das Beispiel von Bayreuth ist von den meisten Bühnen, die ein künstlerisches Gepräge tragen, nachgeahmt worden.
Das Fest bei Makart in Wien brachte Wagner eine besondere Freude: mitten im Gewühl trat ihm Gottfried Semper entgegen, der jetzt auch in Wien tätig war. Das Nichtzustandekommen des Münchener Festspielhauses hatte die Freunde beinahe entzweit oder doch für einige Zeit voneinander entfernt. Nun fanden sie sich in alter Herzlichkeit, und Wagner lud den Baukünstler, der in Wien in eine dürftige und verständnislose Umgebung geraten war, nach Bayreuth ein, wo die wichtigsten Grundgedanken des vergeblich geplanten Münchner »Nibelungentheaters« in dem sonst kargen Notbau des Festspielhauses eine bedeutungsvolle Verwirklichung finden sollten. In Wien beschäftigte sich Semper mit der Neugestaltung der Hofburg, der Hofmuseen, der Hofstallungen und des Burgtheaters. Cosima schrieb darüber: »Diese kolossalen Pläne für einen zusammenstürzenden Staat. Die Ungarn und die Deutschen bilden am Hofe zwei Parteien, die erste voller Haß gegen das Deutsche Reich, ultramontan gesinnt, die zweite für eine Allianz mit Deutschland und freisinnig. Seltsamer Konflikt: der Kaiser dazwischen als tragische Erscheinung, unschlüssig, und der arme Semper, von ganz Deutschland ignoriert, baut für diesen Staat und geht an dieser Aufgabe zugrunde.« Diese Tagebuchstelle ist aber nur dann richtig zu verstehen, wenn man liest: Sowohl die Ungarn als auch die Deutschen bilden am Hofe je zwei Parteien. Die deutschfeindlichen Slawen sind nicht erwähnt. Vermutlich sind die Worte Cosimas von Semper selbst eingegeben, der zu ihr in berechtigtem Stolz und schmerzlicher Verbitterung sagte: »Was geht's mich an, ob der Kaiser ein Schloß baut. Die Deutschen sind heimatlos, das Genie hat in Deutschland keine Stätte.« Die Wiener Pläne Sempers sind bekanntlich kaum zur Hälfte ausgeführt und im übrigen von seinem Schüler und Nachfolger Karl Hasenauer verpfuscht worden.
Am 10. März fand die Aufführung in Pest statt mit den »Glocken von Straßburg«, deren Anfangstakte der katholischen Lithurgie entnommen sind und im »Parsifal« wiederkehren, und mit dem unter Richters Führung begleiteten Klavierkonzerte von Beethoven. Über den Vortrag dieses Konzertes durch Liszt schrieb Cosima: »Erstaunen, unerhörter Eindruck, unvergleichlicher Zauber, ein Ertönen. Richard sagt, dies macht alles tot.«
Wagners genossen in Pest die Gastfreundschaft Hans Richters. Der Triebschener Famulus war erst seit kurzem vermählt – »glücklich und vernünftig«, schrieb Cosima an Lenbach –, und wie er dem Meister bei der Trauung beigestanden, so war dieser auch sein Trauzeuge gewesen; freilich nur durch einen Stellvertreter. Als Geschenk Wagners hatte der junge Ehemann eine schön gebundene Partitur der »Walküre« erhalten. Die eingeschriebenen Verse erinnerten an die Hochzeit in Luzern:
»Dem Meister stand der Gesell zur Seite,
daß er eine tüchtige Meisterin freite:
nun steht der Meister zu seinem Knaben,
der Richter soll eine Richterin haben.«
Der Schluß des Gedichtes aber bezog sich auf das verunglückte Münchner »Rheingold«:
»Gedenkt des noch in fernen Tagen,
wie Richter und Wagner es einst mochten wagen,
eher Werk und Taktstock zu zerschlagen,
als die Welt mit schlechten Aufführungen zu plagen.«
So war der Aufenthalt in Pest vor allem von gemütlich-freundschaftlichen Beziehungen durchwoben. Nach der Abreise Wagners schrieb ihm Liszt: »Du hast mich innigst erleuchtet, getröstet, gestärkt. Dir so recht nach meinem Verlangen zu danken, versagt mir das Geschick – da wir zu selten äußerlich beisammen sind, obschon geistig unzertrennlich.«
Am 12. März wurde das Wiener Konzert wiederholt, und der Erfolg war so stark, daß Wagner noch ein drittes geben mußte, zu dem er anfangs Mai wieder nach Wien fuhr. Statt des Kaisermarsches, der in den beiden ersten Konzerten gespielt worden war, wurde »Hagens Wacht« aus der »Götterdämmerung« eingefügt, und dieses herbe, düstere Stück, von dem man meinen sollte, daß es nur im dramatischen Zusammenhange die rechte Wirkung übe, machte hier als Neuheit, gesungen von Emil Scaria, dem später Bayreuth viel Gutes zu verdanken hatte, einen solchen Eindruck, daß es wie eine dankbare Opernarie wiederholt werden mußte.
Während der längeren Abwesenheit der Eltern waren die Kinder in Bayreuth von der Schwester Nietzsches betreut worden. Zwischen dem zweiten und dem dritten Wiener Konzerte befand sich Wagner stets auf Reisen, begleitet von Cosima. Nur für einige Tage war diese allein in Dresden, wo ihre beiden ältesten Töchter in einer Erziehungsanstalt untergebracht wurden. In Berlin gab Wagner zwei höchst erfolgreiche Konzerte, bei denen Frau Materna aus Wien mitwirkte. Man darf aber nicht glauben, daß diese immer wiederkehrenden Erfolge die großen Mühen hinlänglich lohnten. Die Einnahmen der meisten Konzerte standen infolge hoher Kosten, leichtfertiger Berechnung und gelegentlicher »Spitzbübereien« der Geschäftsvermittler in keinem richtigen Verhältnisse zu den persönlichen Opfern des Meisters. Doch mußte ihm jeder Taler für Bayreuth willkommen sein.
Wenige Tage vor dem dritten Wiener Konzerte starb der Hund Ruß, den er vor neun Jahren in Genf von Verena Weitmann als Geschenk erhalten. Unweit von der für seinen Herrn bestimmten Grabstätte im Garten von Wahnfried erhielt der treue Neufundländer den letzten Ruheplatz. Eine Inschrift sagt: »Hier ruht und wacht Wagners Ruß.« Von ihrem Leid schrieben die daheimgebliebenen Mädchen, Isolde (die Loldi genannt wurde) und Eva, an ihre Schwestern Daniela und Blandine in Dresden. Auch die Mutter schrieb ihnen von Ruß: »So alt wie Loldi, kam er ein Jahr vor Evas Geburt in das Triebschener Haus, behütete Fidi treu, wie er zur Welt kam, bewachte unseren Herd beständig und hat uns allen nur Gutes und Freundliches erwiesen. Man muß es erfahren haben, wie selten im Leben unbedingte Ergebenheit und Anhänglichkeit seitens der Menschen ist, um das freundliche Wedeln, den treuen Blick, die unbedingte Zugehörigkeit eines Hundes zu würdigen.«
Schwer betroffen wurde Cosima durch die Nachricht vom Mißgeschicke Bülows in England: seine Konzertreise hatte ihm nicht die erhofften Einnahmen gebracht, vielmehr war er durch einen Gauner um »ein Jahr mühevollen Lebens«, um rund 10 000 Taler betrogen worden. Eine besondere Tragik lag darin, daß er durch das Erträgnis der Reise das Vermögen der Töchter erhöhen und abrunden wollte. Er faßte die Sachlage in den Worten zusammen: »Ich glaubte mich diesen Winter für die Zukunft meiner Kinder zu ruinieren, habe das aber zum Besten eines Schwindlers getan.« Abermalige schwere Erkrankung war die unmittelbare Folge. Doch sobald er sich nur ein wenig erholt hatte, schloß er einen Vertrag auf ein Jahr für Amerika. Hierbei lockten ihn weniger die Verdienstmöglichkeiten als vielmehr die Aussicht, im nächsten Sommer fern von Bayreuth zu sein, »das zu besuchen ihm ebenso unmöglich war, als es nicht zu besuchen«. Er wollte einen ganz nüchternen, einwandfreien Grund dafür haben, daß er den Festspielen fernblieb. Diese selbst aber lagen ihm sehr am Herzen. Er meinte, daß es eine »Nationalschande« wäre, wenn die Nibelungen in Bayreuth nicht zustande kämen.
Wagners Geburtstag wurde wieder recht eindrucksvoll gefeiert. Die Liebe, der Glaube und die Hoffnung, dargestellt von Loldi, Fidi und Eva, huldigten dem Meister in der Halle seines Hauses mit Reimsprüchen von Cosima, worauf die Bayreuther Militärkapelle im Garten den Huldigungsmarsch ertönen ließ. Der Liebe legte Cosima die Worte in den Mund:
»Wie keiner hast Du mich empfunden,
Wie keiner hast Du mich besungen,
Von den Feen bis zu den Nibelungen
Warst Du mir treu zu allen Stunden.
Mein Segen ist darum Dein Teil,
Die Liebe ruft Dir: Heil!«
Ihr selbst aber brachte die Liebe auch in diesem Jahre manches Unheil. Bülow, der zu den Anstaltskosten der beiden Ältesten beitragen wollte, teilte ihr seine durch den Londoner Verlust zerrüttete Vermögenslage mit und traf im Hinblick auf seinen bedenklichen Gesundheitszustand und auf die bevorstehende amerikanische Reise eingehende Bestimmungen über die künftige Versorgung seiner Kinder. Cosima antwortete mit der Darlegung des Vermögens, das sie selbst den Kindern hinterlassen konnte, und beschwor ihn, den Plan der großen Fahrt aufzugeben, an dem er doch nur festhielt, »um den Kindern gewisse Summen zu erjagen«. Er ließ sich jedoch nicht umstimmen. Er wußte es nur zu genau und teilte es später auch ganz offenherzig Cosima mit, weshalb es für ihn eine moralische Notwendigkeit war, Europa, nämlich Bayreuth, zu meiden. Persönlich aber erbat er von Cosima einen Liebesdienst. Der siebzehnjährige »Stern seines Lebens«, den er vor einigen Jahren in Florenz gefunden und den er sich als »steten Begleiter« auf seinen Künstlerfahrten und auf der Lebensreise gedacht hatte – die junge Russin, die bereit gewesen war, ihn zu lieben, und auf die er nach all dem Unglück, das ihn betroffen, nunmehr verzichtete –, sie sollte nach seinem Tode ein Zeichen seiner treuen Dankbarkeit erhalten. Er bestimmte für sie den Betrag von 5000 Francs, den er aber nicht ihr, sondern der »Frau Richard Wagner« für einen nur dieser bekannten Zweck vermachen wollte. In seinem Namen sollte Cosima die Summe weiterleiten und mit den entsprechenden Begleitworten versehen. Von ganzem Herzen dankte er ihr dafür, daß sie bereit war, seine »posthume Laune« zu erfüllen.
In den Briefen dieses Sommers mußte er ihr aber nebst so vielen traurigen Mitteilungen noch einen besonderen Schmerz bereiten. Liszt wollte ihn für die Musikakademie in Pest gewinnen, und zwar erst nach einem Jahre, nach der Rückkehr aus Amerika. Es war schwer für ihn, dem väterlichen Freunde nein zu sagen. Wenn er mit sich selbst zu Rate ging, so war es nicht nur die seinem Wesen widersprechende »Konservatoriums-Sklaverei«, die ihn vor dem Antrage zurückschrecken ließ. Cosima vertraute er sich rückhaltlos an. Als er ein Schreiben von Liszt erhielt, worin dieser die Sehnsucht aussprach, »bis zum Ende seiner alten Tage« mit Bülow vereint zu sein, hatte er bereits an Cosima geschrieben, daß er moralisch und intellektuell nicht mehr imstande sei, das kostbare Vertrauen des Abbés zu rechtfertigen, daß »die Zeit, das Leben, vielleicht die Gewohnheit« seine früheren Meinungen geändert habe, daß er schon seit langem hierüber einen aufrichtigen und lebhaften Kummer empfinde, daß er aber nicht mehr das Amt eines Apostels versehen könne, zu dem ihn einst seine gläubige Begeisterung bestimmt hatte, daß er nur bestrebt sei, seine Wandlung vor fremden Augen zu verbergen und soweit als möglich alles zu bejahen, was ihm sein musikalisches Gewissen zu bejahen erlaube. »Ich bin in der Instrumentalmusik zu sehr Reaktionär geworden, um der Diener und Sakristan Ihres Vaters sein zu können, wie er ihn mit Recht erwartet – andre werden mich um so besser ersetzen können, als ich verbrauchter und nervöser bin denn je, nicht mehr geeignet zum Verkehr mit Menschen, dem ich in Pest in einer Weise ausgesetzt wäre, daß der Rest meiner Gesundheit dabei vernichtet würde. Ich eigne mich nicht mehr für die Stelle, die Ihr Vater in seiner Güte mir angeboten hat. Die unvergängliche Dankbarkeit, die ich ihm schulde, wird mich immer und überall jede Gelegenheit mit Ungeduld suchen und mit Freude ergreifen lassen, um ihm meine Ergebenheit zu bezeugen … Ich fürchte, daß ich in dem Bestreben mich deutlich zu erklären, dunkel und weitschweifig geworden bin. Ich wage aber doch zu hoffen, daß Sie die Gründe würdigen werden, die es mir unmöglich machen, den Wünschen Ihres Vaters zu entsprechen. Ich versichere Sie, daß ich mich für weit weniger unglücklich halten würde, wenn es anders wäre.«
Damit war zum ersten Male offen ausgesprochen, was dem Leben und Wirken Bülows eine neue Richtung gab: er konnte nicht mehr der Apostel Liszts sein; er mußte sich von Bayreuth aus persönlichen Gründen fernhalten, zu Liszt aber hatte er auch keine geistigen Beziehungen mehr, und wenn man auch nicht sagen darf, er sei den Lisztschen Idealen untreu geworden, denn in ihm war nicht eine Spur von dem, was man mit dem häßlichen und erniedrigenden Namen Untreue bezeichnet, so hatte er sich doch tief innen gewandelt, und die Ideale seines väterlichen Lehrers waren ihm verblaßt, hatte er früher mit diesem für den »Fortschritt« gekämpft, so war er jetzt in gewissem Sinne »Reaktionär« geworden und stand eigentlich dort, wo zwanzig Jahre vorher die Anhänger Schumanns gestanden hatten, die sich trotz ihrer persönlichen Freundschaft für den von ihnen hochgeachteten Liszt von seiner Kunst öffentlich lossagten. Bülow, dem die Kunst nie ein Handwerk, nie ein Spiel, sondern stets Bekenntnis und Lebensaufgabe war, der die Kunst so ernst nahm, daß er für die landläufige Trennung des Menschen vom Künstler kein Verständnis hatte, Bülow geriet durch seine Abkehr von Liszt, die doch nichts an seiner treuen Verehrung für den ihm fremd gewordenen Künstler ändern konnte, in einem zermürbenden Zwiespalt, aus dem ihn nur eines befreien konnte: der rastlose Eifer im Kampfe für einen anderen, erst noch durchzusetzenden Künstler, der ihm persönlich fernstand, dem er zu nichts verpflichtet war, bei dem für ihn von vornherein nur das »rein Künstlerische« in Betracht kam. Ein solcher Künstler – und damals wohl der einzige – war Johannes Brahms, derselbe Brahms, der mit Joachim und anderen eine geharnischte Erklärung gegen die Neudeutsche Schule, also gegen Liszt verfaßt hatte, derselbe, der auch der Kunst Wagners mit einer Art Scheu und mit bewunderndem Grimme gegenüberstand, derselbe, den Wagner ablehnte und dann und wann mit beißendem Spott bedachte. Indem Bülow in den nächsten Jahren von Liszt zu Brahms hinüberschwenkte, trat er völlig aus seinem angestammten Kreise, begann er sozusagen ein neues Leben. Dies war für ihn die Rettung aus schweren seelischen Nöten; aber es schuf ihm auch eine neue Not: er hatte nun sein Verhalten gegen Liszt erst recht auf den herzlichsten Ton zu stimmen, er durfte nie den Anschein erwecken, als ob auch nur ein Funken seiner Liebe und Dankbarkeit erloschen wäre. Er mußte hier, im Widerspruche zu seiner eigensten Auffassung, den Menschen vom Künstler trennen. Und er hat sich dieser namenlos schwierigen Aufgabe mit einer Selbstverleugnung und einem Takt ohnegleichen unterzogen. Liszt aber erkannte bald, daß er den »Sohn« verloren hatte, und fühlte in der zunehmenden Vereinsamung seines Alters immer stärker, daß er einzig nach Bayreuth gehöre.
Ihm gegenüber begründete Bülow die Ablehnung des Pester Antrages in mündlicher Aussprache mit seiner körperlichen Hinfälligkeit und mit der Hoffnung, anderswo einen leichteren und dennoch ehrenvollen Wirkungskreis zu erlangen. Die Unterredung scheint übrigens recht stürmisch verlaufen zu sein. Denn Liszt schrieb danach: »Den Ausbrüchen der Vulkane läßt sich nichts entgegenhalten … Die einzige Frage, die Du zu lösen hast, ist die, wie Du mit genügender Gesundheit weiterleben kannst, bei dem Übermaße Deiner heroischen Tätigkeit … Gewiß, es stehen Dir glänzendere und ergiebigere Stellen offen; besonders glaube ich, daß Dir England besser zusagen wird.«
Während diese Briefe hin und her gingen, waren in Bayreuth die Vorproben für die Festspiele in vollem Gange. Den ganzen Sommer hindurch waren die erwählten Sänger zuerst mit Klavier, dann mit Orchester in voller Tätigkeit, von der Durcharbeitung einzelner Stellen bis zu förmlichen Aufführungen größerer Teile auf der Bühne. Das Haupt und die Seele dieses Treibens, bei dem die Kunst wahrlich ernst und das gleichzeitige frohe Zusammenleben unbefangen heiter genommen wurde, war der Meister, dessen außerordentliche Fähigkeiten in der Mitteilung seiner künstlerischen Absichten an die Darsteller nun erst den meisten das Licht ihrer Rolle aufgehen ließ. Ihm selbst konnte es freilich niemand gleichtun. Er war klein von Gestalt und hatte eigentlich keine Stimme; aber wenn er den Künstlern zeigte, wie sie es zu machen hatten, dann glich er auf einmal den von ihm geschaffenen Helden, dann sah niemand mehr seine wirkliche Erscheinung, dann war der ganze Ausdruck da in seiner höchsten Vollendung, Wort und Ton in unzertrennlicher Einheit, alles Musikalische und Dramatische ein unerreichbares Vorbild für die begabtesten Darsteller. Manche Teilnehmer an den Proben, vor allem der durch Wagner nach München berufene Gesangsmeister Julius Hey, haben von ihren Eindrücken Erstaunliches berichtet.
Eine besonders wichtige Probe hatte aber auch der Festspielbau zu bestehen: dieser heute noch ragende bescheiden-eindrucksvolle, »nüchtern«-großartige Fachwerkbau, dessen künftiger »monumentaler« Ausgestaltung in keiner Weise vorgegriffen war, der jedoch den Aufgaben der Bühne und ihren technischen Erfordernissen schon jetzt in einem die gewohnten Einrichtungen weit übertreffenden Maße gerecht wurde. Und doch, es fehlte noch die praktische Erprobung! Da konnte alles noch so klug bedacht und noch so fein ermessen sein – wenn die Akustik nicht den höchsten Erwartungen entsprach, mußte der gewollte Zauber ausbleiben. Hier nun ereignete sich das Wunder: die akustischen Verhältnisse übertrafen alle Erwartungen. Bühne und Zuschauerraum, die halbkreisförmigen Sitzreihen, das unsichtbare Orchester, die stufenmäßige Anordnung der Instrumentengruppen, der dadurch bedingte überirdische Klang, der nie die Sänger übertönte – es war wohl die Summe nachdenklichster Überlegungen und sorgfältigster Versuche, aber in seinem restlosen Gelingen, in seiner hinreißenden Wirkung ein Geschenk des Himmels, ein sichtbares Zeichen der Gnade, die über dem Unternehmen waltete.
Liszt weilte während dieser Zeit in Bayreuth und nahm an den meisten Proben teil, ebenso an den Gesellschaftsabenden in Wahnfried und an dem großen Gartenfest, bei dem Wagner zum Schluß noch alle Freunde und Künstler um sich vereinte, von dem »Wunderwerke« des »Rings« schrieb Liszt bald darauf: »Es überragt und beherrscht unsere Kunstepoche, wie der Montblanc die übrigen Gebirge.«
Zu kurzer Erholung und Zerstreuung nach den Proben unternahm Wagner im Herbst mit Frau und Kindern einen Ausflug in das nahe Böhmen, nach Karlsbad, Teplitz, Prag, wo viele Erinnerungen aus seiner Jugendzeit auftauchten. Cosima blickte in die Gegenwart und beachtete die politischen Verhältnisse. »Das arme deutsche Wesen«, schrieb sie, »wird von Israel verfälscht, drei Juden sind die Führer der deutschen Partei!«
Im Spätherbst ging es nach Wien. Die Wiener Hofoper hatte die Pariser Bearbeitung des »Tannhäuser« erworben und damit die Einladung an den Meister verbunden, das Werk selbst einzuüben. Er legte ja auch den größten Wert darauf, daß die neue Gestalt des vielmißhandelten Werkes womöglich nur unter seiner Mitwirkung zur Aufführung komme. Gleichzeitig war er gebeten worden, sich einer musikalischen Erneuerung des Wiener »Lohengrin« anzunehmen, und er war um so lieber darauf eingegangen, als das vereinbarte hohe Entgelt ihm bei den übermäßigen Anforderungen, die jetzt auch an seinen Säckel gestellt wurden, sehr willkommen war. Doch gaben die künstlerischen Erwägungen den Ausschlag. Wagner behielt stets das Ganze seines Schaffens und alle Wirkungsmöglichkeiten im Auge. Für den »Ring« schuf er sein Bayreuth; den übrigen Dramen suchte er den gebührenden Platz und die rechte Gestalt auf der Opernbühne zu sichern.
So kam er denn am 1. November mit seiner ganzen Familie für sechs Wochen nach Wien, wegen dieser Zeitdauer und der größeren Zahl der zu beherbergenden Personen machte er von der Gastfreundschaft Standhartners diesmal keinen Gebrauch. Er wohnte im Hotel Imperial, nahe der Oper, in der er nun fast täglich zu tun hatte und viel Plage und Ärger ausstand. Am meisten verdrossen ihn die Mängel der Ausstattung und die gedankenlose Spielleitung. Trotz dem Aufwande reicher Mittel war alles so herkömmlich und so ungeistig, wie es eben den alten Gepflogenheiten und dem herrschenden Geschmacke entsprach. Als ein Fortschritt gegen früher war das Kleid der Venus zu betrachten: das rosenrote Ballettröckchen war beseitigt, statt dessen erschien die Liebesgöttin in einem von Makart entworfenen weißen, weichen, fließenden Gewande, das endlich den künstlerischen Anforderungen entsprach, dem nun aber die Bosheit der Kritiker »zu viel Phantasie und zu wenig Stoff« nachsagte. Fürstin Marie Hohenlohe ließ besorgt anfragen, ob das Kostüm der Venus nicht à la Offenbach sein würde. Cosima selbst übernahm es, die einstige Freundin darüber zu beruhigen.
Einen schweren Kampf bestand Wagner mit den meisten Sängern. Aber er verstand sich auf ihre Schwächen und Stärken, er wußte alle zu erziehen, zu überreden und zu gewinnen. Der Kinder wegen besuchte er eine Vorstellung der »Zauberflöte«. Da kam ihm der Wunsch, auch einmal ein Werk Mozarts oder Webers mit den Wiener Sängern neu einzuüben. Nach den Mitteilungen Heys beschäftigte ihn der zuerst in München erfaßte Gedanke einer Stilbildungsschule, der später in Bayreuth aufgegriffen wurde, auch jetzt in Wien. Hierzu wurde er wohl nicht so sehr durch die Trefflichkeit einzelner, ach! so weniger Sänger oder durch die ihm bekannten und noch nicht völlig unkenntlich gewordenen guten wiener Überlieferungen angeregt, als vielmehr im Gegenteil durch so vieles, was der Verbesserung bedurfte.
Bei den Proben zum »Tannhäuser« sah er »mit vollster Deutlichkeit, daß ein Zusammenwirken, wie er es verlangt, nicht möglich ist, wenn jeder auf seine Art singt und nicht angewiesen wird, sich stilgemäß einzufügen«, wie steif und hölzern benahm sich auch der Chor, der vom wahren Stile des lebendigen Kunstwerks eine noch geringere Vorstellung hatte als die Mehrzahl der Einzelsänger! Doch Wagner vermochte den Chorsängern alsbald den rechten Begriff von ihrer dramatischen Aufgabe beizubringen. Beim Einzug und bei der Begrüßung der Gäste im zweiten Aufzug erzielte er, alle Stellungen vorschreibend, einen so ungekünstelt bewegten Vorgang, daß jede Opernschablone aufgehoben war und die allbekannte Marschmusik sich in neuem Lichte zeigte. Der Venusberg des ersten Aufzuges blieb hinter seinen Absichten zurück, wiewohl auf seinen Wunsch die mit dem Pariser »Tannhäuser« bereits vertraute Münchner Ballettmeisterin Lucile Grahn zur Anordnung und Einübung der Tänze berufen worden war. Unverdrossen nahm Wagner bei den Proben seinen Platz »zwischen dem Orchester und der Bühne« ein. Die Leitung des Orchesters war Hans Richter übertragen, der seit dem 1. Mai dieses Jahres an der Wiener Hofoper tätig war und so den Wirkungskreis gefunden hatte, der ihn für lange Jahre an Wien fesseln sollte, zum Segen des Wiener Musiklebens. Richter genoß das höchste Vertrauen des Meisters. Er war ja auch zum musikalischen Leiter der Festspiele berufen worden! Nur wenn Wagner »einen ihm durchaus vertrauten Dirigenten zur Mithilfe hatte«, konnte er seiner wichtigsten Aufgabe, der alles durchdringenden Überwachung des Ganzen, in voller Freiheit gerecht werden. Gebunden blieb er in einem: in der notwendigen Rücksichtnahme auf die zur Verfügung stehenden Sänger und Darsteller. Auch in Wien konnte er seine künstlerischen Absichten nur so weit verwirklichen, »als die vorhandenen Kräfte reichten«. Diese Feststellung, die in seinen Augen nichts Entwürdigendes und Beleidigendes hatte, die er mit dem wärmsten Danke für alle Mitwirkenden verband, wurde ihm freilich als ein arges Zeichen des Hochmutes und der Undankbarkeit ausgelegt. Aber keine Hetze in den Wiener Zeitungen konnte das freundschaftliche Verhältnis stören, das ihn auch hier mit den Künstlern verband, die unter ihm gearbeitet und dadurch ein neues, höheres Leben gewonnen hatten.
Die Aufführung am 22. November, der der erste Darsteller des Tannhäuser, Wagners Dresdner Freund Tichatschek, beiwohnte, machte auf die Wiener einen überwältigenden Eindruck, wie ihn niemand von dem schon eingebürgerten und gewissermaßen abgenützten Werk erwartet hatte. Noch tiefer wirkte der »Lohengrin« am 15. Dezember. Bei den Proben zu dieser Vorstellung, die früher eine der besten gewesen, mußte sich Wagner mit den Sängern förmlich »herumbalgen«. Aber es gelang ihm, auch den Schwerfälligsten und Ahnungslosesten etwas von seinem Feuer mitzuteilen. Wie staunten sie, wenn er selbst ihnen mit unbeschreiblicher Innigkeit ihre Rollen vorsang und vorspielte; wenn er die Tragik der Handlung – ob er es mit Lohengrin oder Telramund, mit Elsa oder Ortrud zu tun hatte – jedesmal in erschütternder Weise durch Stimme und Haltung, Blick und Gebärde veranschaulichte, mit einer Schönheit und Verklärung ohnegleichen! Und eines glückte beinahe vollkommen: eine für Wien unerhört lebensvolle Beteiligung des Chores am dramatischen Geschehen. Jeder Mann und jede Frau machten in Miene, Stellung und Gehaben den persönlichen Anteil an den Vorgängen kenntlich. Dabei spielte der Chor nicht nur vortrefflich, er sang auch herrlich, was eben vor allem dem Eingreifen des Meisters zu verdanken war, der immer wieder gerufen hatte: »Schreit nicht, singt, singt so schön als möglich, als wenn ihr lauter Solopartien vorzutragen hättet!« Hier war das Vorbild gegeben für den Bayreuther »Lohengrin«, den Cosima, die das alles fiebernd miterlebte, zwei Jahrzehnte später zu verwirklichen vermochte. Wagners Zufriedenheit mit dem Chore gab sich darin kund, daß er sich zu der Zusage bereit finden ließ, in der nächsten Zeit eine Wiener Vorstellung des »Lohengrin« zum Vorteile der Chormitglieder zu dirigieren. Nie konnte er dankbar genug sein für ehrliches Bemühen und wackere Freundeshilfe; inmitten all der Hetze und Überbürdung geizte er nicht mit Wohltaten, die an Selbstentäußerung grenzten.
Es war freilich ein kurioses Mißverständnis, wenn den begeisterten Wienern nun auch die Meldung aufgetischt wurde, daß die nächstjährigen Bayreuther Festspiele alsbald in der Rotunde im Wiener Prater wiederholt werden sollten – vielleicht nicht durch Wagner selbst, dann aber jedenfalls durch einen »kühnen Theaterdirektor«; und es war die ausgesprochene Niedertracht, der man nirgends auf der Welt entrinnen kann, wenn das Illustrierte Wiener Extrablatt Frau Cosima frech verhöhnte, als ein Dieb sich im Gasthof bei ihr eingeschlichen hatte und glücklich festgenommen worden war! Es kam auch sonst vieles zusammen, was dem Meister Wien gründlich verleidete. Doch es gab auch Holdes und Menschliches. So wurde das erste Kind Richters, ein Töchterlein, das den Namen Richardis erhielt, von Cosima aus der Taufe gehoben. Am selben Tage speisten Wagners bei Hohenlohes. Abends war der Meister noch allein bei Fürstin Marie und verlor sich mit ihr in alten Erinnerungen. Dies scheint ihn stark erregt zu haben. Er erlitt einen Weinkrampf und einen heftigen Anfall von Atemnot.
Die Aufführung zum Besten des Wiener Opernchores fand am 2. März 1876 statt. Es war das zweite- und letztemal, daß Wagner seinen »Lohengrin« dirigierte. Er blieb diesmal nur wenige Tage in Wien. Der Umgang mit dem Orchester beglückte und erfrischte ihn. Dann ging es sofort weiter nach Berlin. Dort war durch Frau von Schleinitz ein Befehl des Kaisers erwirkt worden, daß das Erträgnis der ersten Aufführung von »Tristan und Isolde« an der königlichen Oper für Bayreuth bestimmt werde. Nun gab es wieder die aufreibendste Tätigkeit bei den Proben, in ähnlicher Art und mit gleichem Erfolge wie in Wien. Knapp vor den ersten Festspielen hatte Wagner noch einmal die Unzulänglichkeiten der täglich spielenden Theater mit ihren alle Gattungen vermengenden Spielplänen gründlich auszukosten. Aber die Berliner Aufführung am 20. März konnte nicht glanzvoller verlaufen. Der Kaiser, die Kaiserin und der ganze Hofstaat waren anwesend. Wilhelm I. versprach dem Meister, auch nach Bayreuth zu kommen. Das Erträgnis erreichte die Summe von 5000 Talern. In diesen Berliner Tagen wurden Wagners im Hause des Malers Adolf Menzel gefeiert. Wie Makart das Wienertum, so vertrat Menzel in seiner Kunst und in seiner Denkweise das echte Preußentum, für das Wagner jetzt so viel warmes Verständnis hegte. Cosima empfand es als eine tiefe Genugtuung, daß die berühmtesten Maler ihrem Gatten, der in den Augen der Welt »nur ein Musiker« war, freundschaftlich huldigten. Die Gemeinschaft der Künste und die Notwendigkeit ihres Zusammenwirkens zu einer höheren Lebensgestaltung fand in diesen persönlichen Beziehungen einen angemessenen Ausdruck. Um so schmerzlicher freilich mußte es Cosima beklagen, daß der Größte und Nächste im Bereich der bildenden Kunst, daß Böcklin sich andauernd teilnahmslos verhielt.
Ein gedrängter Überblick über die wichtigsten Ereignisse haftet unwillkürlich an den rauschenden Erfolgen, an den glänzenden Festen, an den zündenden Ansprachen, an dem, was einen heiteren und erhebenden Eindruck macht. Wer aber die Briefe des Meisters und wer Glasenapps Lebensbeschreibung kennt, der weiß, wieviel Lästiges und Erbitterndes den Meister im letzten Jahre vor den ersten Festspielen ununterbrochen beschwerte und beunruhigte, wie er die nie beschwichtigte Sorge um die Geldbeschaffung und die unerquicklichen Verhandlungen mit so vielen persönlich unentschlossenen und dabei von ihren Direktoren und Intendanten abhängigen Künstlern oft seine ganze Zeit und Kraft in Anspruch nahmen und nicht selten übermenschliche Forderungen an seine Geduld stellten, wie im fortwährenden Verkehre mit Amtspersonen und Würdenträgern, mit wohlmeinenden Freunden und liebenswürdigen Gastgebern seiner leidenschaftlichen Natur fast jede Gelegenheit zum Aus ruhen wie zum Aus toben verwehrt war, wie er daher die Aufführungen und Festlichkeiten, die ihm gewiß auch manche Freude bereiteten, mit der schwersten Erschöpfung zu bezahlen hatte, wie er zur Erreichung seines großen Zieles nichts als Opfer brachte.
Zwischendurch hatte er das Diktat seiner Erinnerungen fortgesetzt, in dem leichten, ruhigen Fluß der Erzählung, der uns nie vermuten läßt, daß er zur selben Zeit irgendwie behelligt worden sei. In den anstrengenden Berliner Tagen vollendete er auch die Partitur des Festmarsches, der bei ihm für die Feierlichkeiten anläßlich des hundertjährigen Bestandes der vereinigten Staaten Nordamerikas bestellt worden war; eines zu wenig bekannten schwungvollen Tonstückes, für das er 5000 Dollar erhielt, das aber nicht nur als eine willkommene Gelegenheitsarbeit, sondern gleich allen andern, wenn auch weit bedeutenderen Wagnerschen Schöpfungen, als ein tönendes Bekenntnis aufzufassen ist. Die gewählte Überschrift aus Goethes Faust: »Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muß« – mutet sie uns nicht wie der Leitspruch seines Daseins an, erinnert sie uns nicht an eben die Zeit, in der das Werk entstanden ist und in der er sozusagen gar nichts anderes zu tun hatte, als sich täglich Schritt für Schritt sein neues Land zu erobern? So verstehen wir auch am besten die drängende Bewegung, die dem Tonstück eigen ist, das unaufhörliche Schreiten und Vorwärtsdrängen der gebieterischen Tonfiguren, die, in eine große Form gefaßt, ein Musterbeispiel für die Gattung des sinfonischen Marsches ergeben.
Im Tagebuche Cosimas spiegeln sich die Vorgänge und Ereignisse. Sie selbst widmete sich nur dem Gatten und den Kindern. Als sie einmal ihrer Tochter Blandine, die jetzt wieder daheim war, Geschichtsunterricht erteilt hatte, schrieb Fidi an Daniela in Dresden: »Mama wird immer gescheiter.« Bei der letzten »Lohengrin«-Aufführung in Wien war auch sie vom Orchester hingerissen, ganz besonders aber von der »magischen Direktion« des Meisters. Die Sänger fand sie recht mittelmäßig. »Mehr und mehr erkenne ich die Unmöglichkeit, irgend etwas auf diesen bestehenden Theatern einzubürgern.« In Berlin erhielt sie die Nachricht von dem Tode ihrer Mutter. Sie konnte der Geschiedenen nicht die letzte Ehre erweisen, denn das Begräbnis hatte schon stattgefunden, als die Nachricht einlangte. So besuchte sie mit ihrem Manne das Grab Daniels in Berlin und hing dabei den Gedanken an ihre Jugend und an das merkwürdige Verhältnis zur Mutter nach. Sie erinnerte sich der Sonntage, die sie und ihre Schwester bei Marie d'Agoult verbringen durften, als sie noch unter der Obhut der Frau Patersi und der Frau von Saint-Mars standen, und gedachte der geistigen Schätze, die den jungen Herzen da vermittelt wurden. »Ich kann den Eindruck nicht schildern, welchen diese Sonntage immer auf mich hervorbrachten. Ich sehe mich noch die wundervolle Bibliothek meiner Mutter mit Augen verschlingen, und wenn wir in die Engigkeit unseres gedämpften, strengen Lebens mit zwei siebzigjährigen Gouvernanten zurückkehrten, da lebten die Eindrücke in uns, wie wenn wir aus dem Reiche der Seligkeit gekommen wären.« So schrieb sie viele Jahre später an Houston Stewart Chamberlain. Diesmal vermerkte sie nur: »Schwere Gedanken, Tage des Schweigens.«
Sie schwieg, um ihren Mann bei seiner übermäßigen Inanspruchnahme nicht zu quälen. Schon am Tage nach der Berliner Vorstellung reisten sie nach Bayreuth. Dort wurde Cosima durch die schwierige Verlassenschaftsabhandlung nach der Mutter in mannigfacher Weise gestört und beunruhigt. Am meisten aber litt sie darunter, daß der Vater ihr kein Wort der Teilnahme, kein Wort des eigenen wehmütigen Gedenkens zukommen ließ. Die Wiener Erfolge freuten ihn, und mit warmem Gefühl für die ihm sonst fernliegende Hingebung Wagners an das theatralische Kunstwerk meinte er: »Die Periode halber Maßregeln und falscher Handhabung der Routine ist zusammengebrochen: Wenn ein gewaltiges Genie ein Werk hervorbringt, handelt es sich darum, daß man es darstelle, wie er es versteht und auffaßt. Genug der Inkonsequenzen bleiben der theatralischen Darstellung immer anhaften.« Doch kein Wort gönnte er der Tochter über die Mutter. An die Fürstin schrieb er: »Die Zeitungen unterrichten mich über den Tod von Daniel Stern. Wenn ich nicht heucheln will, so wüßte ich über die Geschiedene nicht mehr zu weinen als über die Lebende … Madame d'Agoult hat ganz besonders den Geschmack, ja selbst die Leidenschaft für das Falsche gehabt – ausgenommen einige Momente der Ekstase, deren Erinnerung sie später nicht zu ertragen vermochte. Schließlich bereiten einem in meinem Alter die Trauerbezeigungen nicht weniger Verlegenheit als die Glückwünsche. Il mondo va da sè – man lebt darin, man beschäftigt sich, man hat Kummer, Ärger, Einbildungen und Entzückungen, und man stirbt, wie man eben kann! Das Sakrament, das zu empfangen man sich am meisten sehnen sollte, scheint mir die letzte Ölung zu sein!«
Übrigens hatte Cosima, die während der Festspiele die tiefe Trauer ablegte, keine Zeit und Muße, ihren Gefühlen nachzuleben. In der Probenzeit, die jetzt begann, liefen auch schon die Anmeldungen von Gästen ein, die eine gute Unterkunft und besondere Rücksicht verlangen konnten – von Fürstlichkeiten und anderen hochstehenden Persönlichkeiten und von berühmten Vertretern des Geistes und der Kunst. Da gab es wieder nichts als Briefe und Besorgungen, Anordnungen und Verfügungen, mit peinlichster Bedachtnahme auf den Rang, die Ansprüche und die Gewohnheiten der Besucher. Da ging diese innerlich so weltabgewandte Frau wieder ganz in ihren äußeren Pflichten auf, die sie beherrschte wie ein geschulter Zeremonienmeister; nur daß sie nicht für einen Herrscher, sondern für sich und ihren Mann, für das eigene Haus zu denken und zu sorgen hatte. Als die Festspiele begannen, war Bayreuth der Mittelpunkt der deutschen Kunst und Wahnfried der Treffpunkt aller, die an dem großen Ereignis teilnahmen. Hier trat Wagner hinter seiner Frau zurück, die aus den ihr wohlvertrauten Überlieferungen der Pariser und der Berliner Salons eine neue, vornehmste Art der Geselligkeit erstehen ließ, die ihr den Beinamen der »Markgräfin von Bayreuth« verschaffte. Einstweilen war dies alles nur vorzubereiten und war hauptsächlich für die Wohnungen zu sorgen, was damals in der kleinen Stadt, die zum ersten Male vom Strom der Welt überflutet wurde, keine geringen Schwierigkeiten machte. Von dem heutigen Zustande, der die reichsten und die ärmsten Festspielbesucher alles finden läßt, was sie brauchen, und sie vor jeder Ausbeutung schützt, war Bayreuth damals noch weit entfernt. Auch diese Geschichte Bayreuths, die Darstellung der Fürsorge für die Fremden, die sich dort heimisch fühlen wollen, wo ihnen die Kunst eine geistige Heimat bietet, die Darstellung des allmählichen Hineinwachsens des abgelegenen deutschen Winkels in seine große deutsche Aufgabe, müßte noch geschrieben werden. Der künftige Geschichtsschreiber wird nicht unterlassen können, die außerordentlichen Verdienste der an alles denkenden, sich um alles kümmernden, in den schwierigsten Fällen Rat wissenden Gattin des Meisters rühmend hervorzuheben.
Im Verlaufe der Proben mehrten sich auch die Rangstreitigkeiten und Eifersüchteleien und die grundlosen Verstimmungen unter den Künstlern. Aber die »Markgräfin« war nicht nur ihr eigener Zeremonienmeister, sondern auch ihr bester Diplomat und der bevollmächtigte Gesandte ihres Mannes. Die Menschen zu begütigen und zur Vernunft zu bringen, das war eine ihrer herrlichsten Gaben. Wenn es nicht anders ging, so setzte sie sich am Morgen in den Wagen und fuhr zu all den großen und kleinen Leuten, die, wie Du Moulin Eckart mit feinem Spott bemerkt, vielleicht nur das Stehenbleiben des bekannten Gefährtes vor ihrer Wohnung abwarteten, um wieder versöhnt zu sein.
Der Geburtstag Wagners war einer der letzten Ruhetage. Der Glückwunsch des Königs fehlte nicht. Von Nietzsche kam ein Schreiben mit den Worten: »Es sind ziemlich genau sieben Jahre her, daß ich Ihnen in Triebschen meinen ersten Besuch machte, und ich weiß Ihnen zu Ihrem Geburtstag nicht mehr zu sagen, als daß ich auch, seit jener Zeit, im Mai jedes Jahres meinen geistigen Geburtstag feiere. Denn seitdem leben Sie in mir und wirken unaufhörlich als ein ganz neuer Tropfen Blutes, den ich früher gewiß nicht in mir hatte.« Aus Wien traf der von Liszt und Standhartner empfohlene Felix Mottl ein, ein junger Musiker von ungewöhnlicher Begabung, der nun der so wichtigen »musikalischen Assistenz« eingereiht wurde und zehn Jahre später der Lieblingsdirigent Cosimas im Festspielhause war.
Ein neuer Tropfen Blutes war aber auch der deutschen Öffentlichkeit eingeflößt. Sie war »beschämt, ermutigt, gestachelt und beunruhigt« wie Nietzsche. An der Tatsache von Bayreuth, mochte diese vielfach nur angestaunt, bezweifelt, belächelt und bewitzelt werden, konnte niemand mehr vorbeigehen. Auch die Gegner und Verneiner bejahten sie durch ihre Verblüffung, ihre Erregung, ihre Fassungslosigkeit und ihren Widerspruch. Was ein gewisser Teil der »deutschen« Presse so gern als eitle Sensation in einem Atem bewundert und verdammt hätte, das war, wie Cosima an Frau von Schleinitz schrieb, nicht eine Zauberei, sondern ein Wunder; eines der größten Wunder unter den vielen Glücksfällen und wunderbaren Fügungen, die im Leben Wagners den bösen Mächten und der Trägheit der Mitmenschen entgegenwirkten.
Am 6. August, zu den letzten Hauptproben, kam König Ludwig. Nach acht Jahren sahen sich die Freunde wieder. Von den Bayreuthern aber wollte der menschenscheu Gewordene nicht gesehen werden. Nachts auf freiem Felde mußte der Zug stehenbleiben, in der Nähe des Schlosses Eremitage, wo dem König die Wohnung bereitet war. Nur Wagner wußte die Zeit und den Ort, nur er allein durfte ihn begrüßen. Und auf ungewohntem Wege, abseits von den Straßen, an denen die Bevölkerung des Königs harrte, fuhr dieser im geschlossenen Wagen zum Festspielhause. Gleich nach der »Götterdämmerung« reiste er wieder ab. Am 13. begannen die öffentlichen Aufführungen. Der Kaiser war erschienen, allem Volke sichtbar und allen Treuen gnädig, und sprach zu Wagner: »Ich habe nicht geglaubt, daß Sie es zustande bringen würden, und nun bescheint die Sonne Ihr Werk.«
So wurde das Drama vom Ring zum Ereignis. Noch nicht in künstlerischer Vollendung, nicht in allem genau nach dem Sinne des Meisters, notwendigerweise behaftet mit den Fehlern und Mängeln eines ersten, heldenkühnen Versuches, aber mit ungeheurer Eindruckskraft, als zwingende Offenbarung eines gewaltigen Geistes und eines neuen erhabenen Stiles erregte es die Sinne und bewegte es die Herzen der versammelten gekrönten Häupter, Würdenträger und Geistesfürsten aus aller Herren Ländern. Nach der ersten Aufführung des Gesamtwerkes, am 17. August, trat Wagner vor die Zuschauer und sagte: »Sie haben gesehen, was wir können. Nun ist es an Ihnen, zu wollen. Und wenn Sie wollen, so haben wir eine Kunst.«
Am 18. vereinigte die Gastwirtschaft beim Festspielhause etwa 700 Personen zu einem Festmahle. Wagner dankte seinen Gönnern und Freunden, vor allem seinen Künstlern, die er seine »ersten Patrone« nannte, und natürlich auch den Mitbürgern im »lieblichen Bayreuth«. Am Schlusse aber, nach verschiedenen anderen Reden, ging er mit weit geöffneten Armen auf seinen Schwiegervater zu und sagte: »Hier ist derjenige, welcher mir zuerst den Glauben an meine Sache entgegengetragen, als noch keiner etwas von mir wußte, und ohne den Sie vielleicht heute keine Note von mir gehört haben würden: mein lieber Freund Franz Liszt!« Dieser antwortete, er stehe vor Wagner mit derselben Ehrfurcht wie vor den größten Geistern aller Jahrhunderte; es sei sein Stolz, sich vor ihm zu beugen. Damit war der hehre Bund vor aller Welt besiegelt und erneut.
Nicht lange vorher aber hatte Wagner seiner Frau gesagt: »Keiner weiß, was er dir alles verdankt.«
Am wenigsten zufrieden mit den Festspielaufführungen war Cosima. Das Orchester klang herrlich, Wilhelmj führte die Streicher, Betz als Wotan erwarb das höchste Lob Wagners, die Materna als Brünnhilde gab das »wilde Wotanskind«, die »reisige Walküre« mit einer Ursprünglichkeit und Herzlichkeit und einem sprühenden Leben, die für den Mangel an Erhabenheit reichlich entschädigten; Hill als Alberich, Schlosser als Mime, Vogl als Loge, Niemann als Siegmund hatten alle üblen Operngewohnheiten abgelegt und verkörperten den Geist ihrer Rollen in wahrhaft schöpferischer Weise; die Rheintöchter, Lilli und Marie Lehmann und Marie Lammert, bestrickten durch den Wohllaut ihrer Stimmen, die acht Schwestern Brünnhildes, darunter Johanna Jachmann-Wagner, stürmten mit den Wolken um die Wette. Das waren Eindrücke, die in jedem haften mußten, der nicht taub und blind im Festspielhause saß. Aber der Siegfried Georg Ungers, der tragende Held des dritten und vierten Teiles, war nur eine Skizze, nur ein Umriß, stimmlich und darstellerisch nur mit Wasserfarben gemalt; auch viele andere bewältigten ihre Aufgaben höchstens »ganz korrekt«, sie schufen keine Gestalten, die sich den Sinnen und der Seele einprägten. Sogar mit Richters Zeitmaßen konnte sich Cosima nicht befreunden. Trostlos war sie über die vom Professor Emil Doepler in Berlin entworfenen Kostüme. Diese »erinnerten sie an Indianerhäuptlinge und hatten neben dem ethnographischen Unsinn noch den Stempel kleinlicher Theatergeschmacklosigkeiten an sich«. Das Schlimmste hatte sie allerdings bei den Proben abgewendet: die lächerliche Tracht Alberichs mit Mantel und Achselklappen war geändert worden. Doch im großen und ganzen erfüllte sich, wenigstens nach ihrem strengen Urteil, ihre bange Voraussage: »Soweit wird die Aufführung vom Werk zurückbleiben, wie das Werk von unserer Zeit fern ist.« Daß manches überhaupt nicht klappte, daß es geradezu szenische Unfälle gab, das war noch am leichtesten hinzunehmen, das war »Tücke des Objekts«.
Für Cosima war dies alles kein Grund zur Entmutigung. Sie litt darunter, vielleicht mehr, als es gerechtfertigt war, weil sie eben die Gabe des Leidens besaß. Aber sie wußte auch, daß aller Anfang schwer sei und daß dies nur ein Anfang auf einem Wege war, der stets bergan führen mußte. Sie teilte die unerschrockene Ausdauer, die nie völlig zu besiegende Hoffnungsfreudigkeit, den Glauben ihres Mannes. Eine ähnliche Enttäuschung hatte Nietzsche erlitten, der wertvollste unter allen, die sich zur Gemeinde Wagners zählen durften. Ihn aber hatte seine Enttäuschung auch den Glauben gekostet; und das war nur möglich, weil sein Glaube selbst schon erschüttert war.
Knapp vor den Festspielen hatte er mit seiner Schrift »Richard Wagner in Bayreuth« dem Meister die schönste und bedeutendste Huldigung dargebracht. Diesem Buche verdankte Cosima, nach ihren eigenen Worten, »die einzige Erquickung und Erhebung nächst den gewaltigen Kunsteindrücken«. Wagner aber schrieb ihm: »Ihr Buch ist ungeheuer! – Wo haben Sie nur die Erfahrung von mir her? – Kommen Sie nun bald und gewöhnen Sie sich durch die Proben an die Eindrücke!« In dieser Aufforderung lag eine ahnungsvolle Besorgnis des hellsehenden Meisters. Nietzsche kam und gewöhnte sich nicht. Die Proben hatten für ihn etwas Verwirrendes und Niederdrückendes, da er dem Theaterleben fremd war und in einer rein geistigen Welt lebte, mit der sich die Gegenständlichkeit des Bühnenbildes, die vom Herkommen bestimmten Ausdrucksmittel der meisten Darsteller nicht vertrugen. Was Liszt einst grundsätzlich ausgesprochen hatte, daß die Bühne für den Ausdruck »hehrer Leidenschaften« ein zu begrenzter Raum sei, daß die Einbildungskraft mehr verlange, als sich in diesem Raum verwirklichen lasse – das wurde für Nietzsche der Quell seelischen Unbehagens und körperlicher Pein. Seine überanstrengten und erschöpften Nerven hielten vieles nicht aus, was andere kaum bemerkten und jedenfalls nicht schwer nahmen. Und er blieb nicht nur an Äußerlichkeiten hangen. Er empfand den heißen Atem der hinreißenden Wagnerschen Beredsamkeit als eine schmerzliche Störung seines philosophischen Gleichgewichtes. Der strenge Richter einer falsch gesehenen und willkürlich verallgemeinerten Antike, der Mann, dem wir die großartige Unterscheidung des Apollinischen und des Dionysischen in der Kunst verdanken, lehnte die dionyschen Kräfte im Wagnerschen Kunstwerk und ihre Bändigung und Gestaltung durch den dramatischen Gesang und die der Musik entsprechende Gebärde als unkünstlerischen Naturalismus ab. Er hatte keinen Sinn für das Starke und Große, das beispielsweise der Materna eigen war; er wünschte »einzelne Töne von einer unglaubwürdigen Natürlichkeit«, wie er sie von ihr vernommen, vergessen zu können. Er fing an, nicht nur an der Richtigkeit der Darstellung, sondern auch an der Vollkommenheit des Werkes zu zweifeln. Er bildete sich ein, der Meister selbst werde ihm bekennen, daß die Musik anders sein müsse und daß er »zur Einfachheit und zur Melodie zurückkehren« wolle. Die spätere Vorliebe Nietzsches für eine durchsichtige, volkstümliche, nichtsinfonische Theatermusik kündigte sich hier zum ersten Male an. Doch war damit nur bewiesen, daß er in seiner damaligen seelisch-leiblichen Verfassung das »Erschreckende und Berauschende«, das »Ungeheure« der Wagnerschen Kunst eben nicht zu ertragen vermochte. Dennoch wäre er bei dem Bekenntnisse geblieben, das er soeben in seiner von Begeisterung durchglühten Schrift abgelegt hatte, wenn die anderen, die er begeistert sah, ihm einigermaßen entsprochen hätten. Aber es war ihm ein Ärgernis, daß nicht lauter Nietzsches zu den Festspielen kamen. Er begnügte sich nicht damit, daß er zur Gemeinde, ja zu den Auserwählten gehörte; er sah in der Zulassung solcher, die freilich erst für die neue Kunst erzogen werden mußten, mehr noch in der Anwesenheit von Jüngern und »Wagnerianern«, an denen er keine höhere Kultur entdeckte, deren Anhängerschaft ihm nur die gedankenlose Freude an »nationalen« Äußerlichkeiten zu verraten schien, eine Herabwürdigung des Festspielgedankens. Doch diese Aufzählung einzelner Beweggründe für seine Enttäuschung und Ernüchterung, wie Nietzsche selbst sie ausgesprochen oder angedeutet hat, umfaßt noch nicht die ganze Wandlung, die sich in ihm vollzog. Bei der letzten Begegnung Nietzsches mit Wagner wird darauf zurückzukommen sein.
Wenn nun Nietzsche meinte, daß die Zeit eines Mannes wie Wagner nicht würdig und für das, was dieser Mann wolle, noch lange nicht reif sei, dann hatte er allerdings in einem traurigen Sinne recht. Es hing alles noch in der Luft. Die ersten Festspiele waren wie eine Art Geistererscheinung, die Wagner mit seiner ungeheuren Willenskraft hervorzauberte und die sich dann in Nebel aufzulösen drohte. Das Wunder, das Cosima gepriesen, war noch keine unwiderlegliche Tatsache. Es konnte eine Täuschung, ein Traum sein. Der dritten und letzten Vorführung des »Ringes« hatte wieder der König beigewohnt, und gewiß hatte dieser das Gefühl, daß er ein »ewiges Werk« ermöglicht habe. In Zeit und Wirklichkeit sahen die Dinge anders aus.
Wagner hatte das kühne Wort gesprochen: »Wenn Sie wollen, so haben wir eine Kunst.« Einstweilen hatte man nicht einmal ein Festspielhaus. Die Baukosten waren, wie es zu gehen pflegt, beträchtlich angewachsen, und es fehlten – über die vom König verbürgte Summe hinaus – 160 000 Mark. Der Staat und das Reich verhielten sich nach wie vor teilnahmslos, die Stadt Bayreuth konnte oder wollte über das, was sie schon geleistet und was ihr auch großen Gewinn gebracht hatte, nicht mehr hinausgehen. Die Patrone, mit Ausnahme von zweien, lehnten eine Nachzahlung ab. Wieder mußte Wagner Konzerte geben, um seine Sache zu retten, wieder mußte er, anstatt auszuruhen und sich zu neuen Taten zu sammeln, seine Kraft vorübergehend zu bloßen Nützlichkeitszwecken vergeuden. Und wieder ging es ihm, wie es ihm oft ergangen war – wir nehmen hier die Entwicklung Bayreuths im raschen Fluge voraus –: die Mühen und der Lohn standen in keinem angemessenen Verhältnisse zueinander. Wagner ging nach England und erzielte dort trotz dem ungewöhnlichen künstlerischen Erfolge wegen teils nachlässiger, teils unredlicher Gebarung der Londoner Geschäftsfreunde bloß 14 000 Mark, nicht einmal ein Zehntel der abgängigen Summe – wiewohl er manche Ansprüche der Mitwirkenden aus seiner Tasche bestritt und für seine leitende Tätigkeit und seine Reiseauslagen keine Entschädigung verlangte. Endlich spendete er noch 10 000 Mark als Grundstock einer Sammlung, mit der er die Öffentlichkeit zur Deckung des Fehlbetrages aufforderte. Doch auch diese Aufforderung blieb vergeblich. Zehn Patrone leisteten jetzt eine Nachzahlung von je 150 Mark. Das war alles. Wagner glaubte schon, er werde das Festspielhaus auf Abbruch verkaufen müssen, und dachte in seinem tiefen Unmut an eine Auswanderung nach – Amerika. Da war endlich wieder der König zur Stelle. Die königlich-bayrische Kabinettskasse übernahm die Deckung aller Schulden, allerdings aber gegen Beschlagnahme der dem Meister aus den Aufführungen seiner Werke am Münchner Hoftheater zufließenden Einnahmen. So hat denn, ganz nüchtern und rechnungsmäßig betrachtet, Wagner selbst das Festspielhaus bezahlt.
Das war aber nur das Haus. Wie stand es mit neuen Aufführungen? Wie vollends mit den Aufführungen eines neuen Werkes, das Wagners nie ruhender Geist und nie erlahmende Kraft in dieser bangen, schweren Zeit in Angriff genommen hatte? Gleich nach den Festspielen des Jahres 1876 begann er, den Entwurf der »Parsifal«-Dichtung in der rechten, bühnenmäßigen Form auszuführen, und alsbald entstand auch die Musik, zu der ihm schon früher bedeutungsvolle Themen eingefallen waren. Mit dem neuen Werke setzte er sich aber auch ein neues Ziel für die Festspiele. Der »Parsifal« erheischte eine ganz besondere, in jeder Hinsicht vom Opernwesen gereinigte Darbietung, wie Wort und Ton sich allmählich gestalteten, so reifte immer klarer und unverrückbarer die Form, in der Wagners künstlerische Absicht auf der Bühne des Festspielhauses verwirklicht werden sollte, hierzu waren Bühnenbilder nötig, die sehr hohe Kosten erforderten. Um dies alles zu ermöglichen, gab Wagner sogar den »Ring« frei. Die Aufforderung zur Bildung eines zweiten Patronatvereines blieb nahezu ungehört. Der Plan einer Bayreuther Stilbildungsschule, in der Sänger und Musiker zur richtigen Aufführung von Werken wahrhaft deutschen Stiles angeleitet werden sollten, und die die allmähliche Einverleibung aller Wagnerschen Werke vom »Holländer« bis zum »Parsifal« in einen auf Jahre sich erstreckenden Bayreuther Spielplan am leichtesten ermöglicht haben würde – auch dieser Plan mußte fallen gelassen werden: es waren keine Mittel vorhanden und es meldeten sich keine Schüler. So erhielten denn große, »leistungsfähige« Bühnen die lang ersehnte Erlaubnis, den »Ring« aufzuführen. Wien, Berlin und München machten zuerst davon Gebrauch. So bekam der rührige und findige Theaterdirektor Angelo Neumann in Leipzig nicht nur das Aufführungsrecht, sondern auch alle Maschinen, Dekorationen und Kostüme aus Bayreuth für Wanderaufführungen, mit denen er das Werk (in vorwiegend trefflicher, von Wagner selbst anerkannter Darbietung unter der Leitung Anton Seidls) in den Jahren 1879-83 in Deutschland, England, Italien, Rußland und Österreich bekannt machte, ehe es noch allenthalben in den Spielplan der überhaupt dafür in Betracht kommenden Opernhäuser aufgenommen wurde. Der Ruhm Wagners wurde dadurch zweifellos gemehrt, und wenn der »Ring« schon bald nach Wagners Tode eine große »Popularität« besaß, wenn es in der deutschen Jugend vielfach Brauch wurde, sich bei Verabredungen der schönsten Themen aus »Walküre« und »Siegfried« als leicht kenntlicher und dabei auch das Gemüt erregender Zeichen zu bedienen, so ist dies allerdings nur durch die Freigabe des Werkes und nicht zuletzt durch den Eifer Angelo Neumanns überhaupt möglich geworden. Trotzdem war es eine Preisgabe. Trotzdem empfand Wagner auch in diesem Falle mehr das schmerzliche Opfer als die willkommenen Vorteile.

Richard Wagner mit seinem Sohne Siegfried (1880).
Photo F. Bruckmann, München
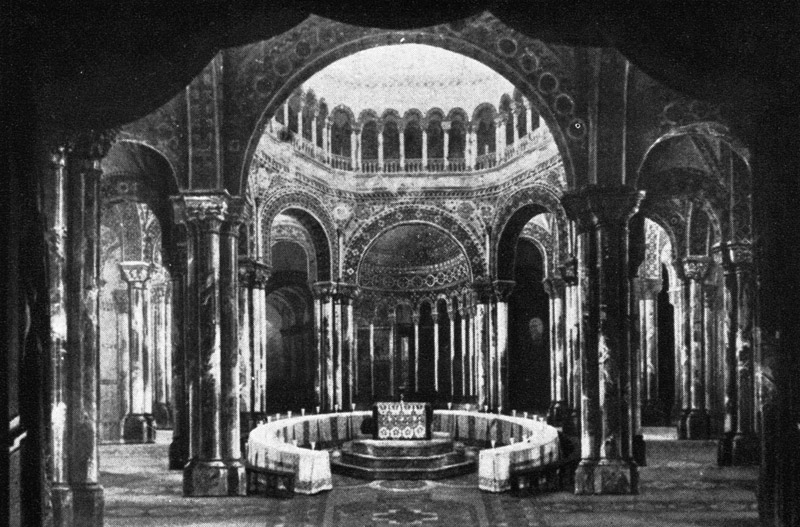
Der Gralstempel.
Nach dem Entwurfe Paul von Joukowskys.
Photo Ramme, Bayreuth

Das Innere des Festspielhauses mit dem Gralstempel.
Photo Ramme, Bayreuth
Angelo Neumann war Jude. Als Wagner sich genötigt sah, die musikalische Leitung des »Parsifal« dem Münchner Hofkapellmeister Hermann Levi zu übertragen, veranlaßte dies den arglosen König zu einem merkwürdigen Lobe: »Daß Sie, geliebter Freund, keinen Unterschied zwischen Christen und Juden bei der Aufführung Ihres großen, heiligen Werkes machen, ist sehr gut; nichts ist widerlicher, unerquicklicher als solche Streitigkeiten; die Menschen sind ja doch alle Brüder, trotz der konfessionellen Unterschiede.« Wagner blieb die Antwort nicht schuldig und bezog sich dabei auf die – von uns schon erwähnte – Tatsache, daß auch unter seinen musikalischen Gehilfen in Bayreuth sich ein Jude befand: »Dies ist der sonderbare Joseph Rubinstein, der einst vor zehn Jahren sich an mich nach Triebschen wandte, um Rettung aus dem Judentume, dem er angehörte, mich anflehend. Ich gewährte ihm, der sonst ein vorzüglicher Musiker war, meinen persönlichen Umgang, in welchem er mir allerdings … große Not gemacht hat. Diesen Unglücklichen fehlt eben alle Grundlage einer christlichen Erziehung, welche uns andere, mögen wir noch so verschieden sein, unwillkürlich sich gleichgeartet erscheinen läßt, was zu den peinlichsten Seelenquälereien veranlaßt. Diesen Umständen gegenüber, in welchen sehr oft die Neigung zum Selbstmord zu bekämpfen ist, habe ich meine Geduld ungemein zu üben gehabt, und wenn von Humanität gegen die Juden die Rede ist, darf ich getrost Anspruch auf Lob erheben. Auch werde ich sie gar nicht mehr los: der Direktor Angelo Neumann hält sich für berufen, meine Anerkennung durch die ganze Welt durchzusetzen. Die Juden haben eben – vom Bilder-, Juwelen- und Möbelhandel her – einen Instinkt für das Echte, dauernd zu verwertende, welcher den Deutschen so ganz verlorengegangen ist, daß sie von den Juden sich das Unechte eintauschen. – Ich kann gar nichts mehr dazu sagen, und muß mir die Energie der jüdischen Protektion gefallen lassen, so wunderlich mir dabei zumute wird, denn – das gewogene Urteil meines erhabenen Freundes über die Juden kann ich mir doch nur daraus erklären, daß diese Leute nie Seine königliche Sphäre streifen: sie bleiben dann ein Begriff, während sie für uns eine Erfahrung sind. Der ich mit mehreren dieser Leute freundlich, mitleidvoll und teilnehmend verkehre, konnte dies doch nur auf die Erklärung hin ermöglichen, daß ich die jüdische Rasse für den geborenen Feind der reinen Menschheit und alles Edlen in ihr halte: daß namentlich wir Deutschen an ihnen zugrunde gehen werden, ist gewiß, und vielleicht bin ich der letzte Deutsche, der sich gegen den bereits alles beherrschenden Judaismus als künstlerischer Mensch aufrechtzuerhalten wußte.«
Wir sehen, wie die Kämpfe Wagners um die Erreichung seiner nächsten Ziele ins Grundsätzliche und Weltanschauliche reichten, wie er die Endziele und die großen, leitenden Gedanken niemals außer acht ließ, wie er aber, um sein Kampffeld zu behaupten, sich auch zu Zugeständnissen bereit fand, eingeengt durch eine der Erneuerung harrende, von ihm schon mächtig aufgewühlte undeutsche Welt, und wie er doch niemanden im Zweifel ließ über die Bahn, die er eingeschlagen, über den inneren Zwang, der ihn vorwärtstrieb, über seinen »Dämon«, der der gute Geist des Volkes war. Wir gewahren erschütternd, daß die letzten Jahre des Meisters, in denen er um seine persönliche Geltung und um die Sicherheit des Daseins wahrlich nicht mehr besorgt zu sein brauchte, erfüllt waren von einem neuen, hartnäckigen Ringen, dessen in die Zukunft weisende Erfolge er im wörtlichsten Sinne mit seinem Herzblute bezahlen mußte. Ein Gutes brachte ihm die unerwünschte Pause in den Festspielen: abgesehen von der englischen Reise, die in den Frühling des Jahres 1877 fiel, konnte er jetzt wirklich ausruhen und durfte er endlich wieder an seine Gesundheit denken. Vierzehn Tage nach den Aufführungen des Sommers 1876 fuhr er für ein Vierteljahr mit Frau und Kindern und mit seinem unentbehrlichen treuen Diener nach Italien. Der Amerikanische Marsch hatte ihm dies bequem ermöglicht. Von den Töchtern war die älteste, Daniela, noch im Louisenstift zu Dresden. Diesem Umstande verdanken wir die herzbewegenden Briefe, die die Mutter von der Reise an ihr Kind richtete.
Die Art, wie der König für den Meister gesorgt hatte, und die wachsenden Einnahmen, die mit der Verbreitung der Werke verbunden waren, bedingten und rechtfertigten das vornehme, von echtem Künstlertume geprägte Leben, das Wagner jetzt führte. Niemand verstand es besser, dieses Leben auch nach außen wirkungsvoll zu gestalten, als seine Gattin, in der die Fähigkeiten der Herrin und der Hausfrau gleichmäßig ausgebildet waren. Die Kinder aber konnte sie nicht ernst genug zur Bescheidenheit und zu einer würdigen Einfachheit ermahnen. Kurz vor ihrer Abreise gab sie Daniela noch manche mütterliche Lehre. »Der Luxus in unserem Hause«, schrieb sie ihr, »kommt nicht von mir und wird verschwinden mit Deines Vaters Richard Leben; ich möchte in Euch den schönen Stolz sehen, den zum Beispiel meine Schwester und ich gehabt, nichts sich aus den äußerlichen Dingen zu machen … Wie ich Deinen Vater heiratete, hatte ich ein Mädchen für alles und hatte vornehme und reiche Leute zu empfangen. Präge Dir das ein, mein Kind, und sei fleißig, ordentlich und sparsam. Tante Claire ist von einer sehr reichen Frau zu einer sehr armen geworden, die selbst nicht in Paris wohnen kann, und lacht über das Mißgeschick, indem sie weiß, worin ihr Reichtum und ihre Vornehmheit besteht.« Auch vom Wege, der sie über Verona, Venedig, Bologna und Neapel nach Sorrent, später nach Rom und zuletzt nach Florenz führte, sandte sie der Tochter nicht nur anschauliche Schilderungen von Land und Leuten, Eindrücken und Erlebnissen, sondern kam auch immer wieder auf die häuslichen Verhältnisse zurück und gedachte im besonderen der engen, blutsbedingten Freundschaft, die sie zwischen Daniela und ihrem Vater herbeizuführen hoffte. Es war immer ihr Lieblingsgedanke und ihr heißester Wunsch gewesen, daß Bülow in seiner ältesten Tochter, die ihm auch so ähnlich sah und in vielem geistesverwandt war, einen Trost und eine Stütze für sein Alter finden sollte.
Bülows Schicksal ging ihr jetzt wieder besonders nahe, da seine Flucht nach Amerika keine guten Früchte getragen hatte. Seine große Reise war anfänglich von den günstigsten Umständen gesegnet und die Einwirkung auf sein Gemüt und seinen Gesundheitszustand schien alle Hoffnungen zu erfüllen. Nach dem 49. Konzerte, um die Jahreswende 1875/76, fühlte er sich wohler als nach dem ersten. Die Erfolge, die er errungen, und die Annehmlichkeiten seines äußeren Lebens machten ihn auch von neuem empfänglich für zartere Eindrücke: eine Amerikanerin hat es ihm bald in ähnlicher Weise angetan wie die Russin in Florenz. Doch es fehlte nicht an Enttäuschungen und Rückschlägen, und namentlich die übermäßige geistige und körperliche Anstrengung rächte sich eines Tages in der schlimmsten Weise. Nach dem 139. Konzerte, im Frühjahre 1876, konnte Bülow einfach nicht mehr weiter. Nur etwa der siebente Teil der Konzerte, zu denen er sich verpflichtet hatte, war noch fällig. Aber er mußte ein Viertel des Gesamtverdienstes opfern, um sich damit loskaufen, die Reise abbrechen und heimkehren zu können. Seine Absicht, auch nach Beendigung der Konzerte in diesem Jahre nicht mehr nach Europa zu kommen, war vereitelt. Er hatte sogar daran gedacht, nie wieder den Ozean zu durchkreuzen, und bereits die ersten Schritte zur Erlangung des amerikanischen Bürgerrechtes getan. Als aber seine Nervenüberreizung aufs höchste gestiegen war, da fühlte er sich nicht mehr stark genug, in einer neuen Welt Wurzel zu fassen. Seine Gesundheit war ihm jetzt das wichtigste und eine gründliche Heilung, die er nur in der heimatlichen Luft und unter den alten Freunden für möglich hielt, schien ihm unerläßlich. So war er denn wieder in Europa, in Deutschland, nicht fern von Bayreuth, dem er gänzlich entrückt sein wollte, ungewiß über sein ferneres Schicksal. In Deutschland traf er auch bald mit Liszt zusammen. In seiner Erregbarkeit war die Begegnung, der er entgegen gebangt hatte, »von entschieden ungünstigem Einflusse«. Liszt war ihm »noch immer der wunderbare Zauberer von ehemals, geistig und körperlich rüstiger und frischer« als bei der letzten Unterredung. Aber er fühlte sich ihm »total entfremdet«. Vor der Berufung nach Pest, die jetzt wieder zur Sprache kam, »graute« ihm förmlich.
Von all dem wußte Cosima. Ihre Sorge und ihr Mitleid ergossen sich in die Worte, die sie zum 16. Geburtstage an ihre Tochter richtete. Sie hielt ihr vor, daß ihr Vater sich schon zur Zeit ihrer Geburt »mühte und härmte in dem Kampfe, welchen der Edle und Hohe hienieden unausgesetzt zu bestehen« hat, und daß sie schuldig sei, ihm »allen Unbill des Lebens zu vergüten. Und so wünsche ich Dir denn, mehr geliebtes Kind, daß Du dieser Aufgabe Dich würdig zeigst. Damit wünsche ich Dir den wahren Quell des einzigen Glückes, den Born des Heiles! Wie es nur ein wahres Unglück gibt, das Weh welches wir andren zufügen, so gibt es nur ein Glück: einer hohen Aufgabe zu genügen. Dieser schönste Beruf ist Dir, mein Kind, zuteil geworden. Bereite Dich darauf vor; bedenke, daß Dein Vater mit unsäglichen Mühen Eure Existenzmittel einem rauhen Schicksal abringt. Sage Dir, daß die Unordnung, welche bei allen Frauen eine widerliche Eigenschaft ist, bei Dir zur Schmach wird, sage Dir, daß die Sparsamkeit für Dich die heiligste Pflicht, denn wenn Du leichtsinnig mit Deinen Sachen umgehst … so vergeudest Du das Leben Deines Vaters. Ich lege einen Brief von Großpapa bei, welcher Dir zeigen wird, wie krank Dein Vater aus Amerika zurückgekommen ist, wohin er schon sehr angegriffen doch hinging, um Euch eine anständige, wenn auch sehr bescheidene Existenz zu sichern. Du siehst, mein geliebtes Kind, ernst, ja feierlich müssen meine Wünsche sein; auch kenne ich das Leben zu genau, um je etwas anderes für meine Lieben zu erflehen, als ihren eigenen Wert. So nimm denn diesen höchsten Wunsch mit meinem Segen heute hin, auch mein Dich ermutigendes Lob, denn Du hast Dir ersichtliche Mühe gegeben, Dich zu bessern. Nun strenge Dich an, moralisch und geistig, nur das Bedeutendste wird Deinem Vater genügen können, wenn er einmal Dich wird zu sich berufen wollen«.
Wie aber der Wert eines Menschen für sie stets im Einklang sein mußte mit der Form, in der er sich mitteilte, so rügte sie jeden leichtfertigen Ausdruck ihres Kindes und schrieb beispielsweise in demselben Briefe: »Was Shakespeare betrifft, so darf ein junges Mädchen nicht sagen, daß er sie ungemein interessiert, indem es sich um einen Dichterfürsten handelt, vor welchem alle sich beugen. Es ist ungefähr, wie wenn Du sagtest: ich möchte gern mit Kaiser Wilhelm umgehen.« Sie empfahl ihr dann, als für sie am besten geeignet, den Coriolan, den Julius Cäsar und Richard II. Ein anderes Mal kam sie auf Corneille zu sprechen und meinte, es sei schwer für diejenigen, die mit dem germanischen Genius vertraut geworden sind, an dieser kalten Nachahmung der antiken Tragödie Gefallen zu finden; »mir sagen diese hochtrabenden Verse, diese pathetische Deklamation, die ich in meiner Jugend sehr bewundert habe, nichts mehr, seit ich Shakespeare, Schiller und Goethe kenne«.
Bei schlechtem Wetter oder wenn sie der Ruhe pflegten, lasen Richard und Cosima ein berühmtes Geschichtswerk, die Geschichte der italienischen Republiken von Sismondi, in französischer Ausgabe. Auch von diesem Werke schrieb Cosima an Daniela und bemerkte unter anderem: »Mit einer wahren Herzbeklemmung habe ich die tragische Episode des Kaisers Heinrich IV. und seines Kampfes mit den Päpsten durchgenommen. Man kann die Ungerechtigkeit, mit der er unbarmherzig verfolgt wurde (sein eigener Sohn hat den Aufruhr gegen ihn entfacht), und die Seelengröße, mit der er die Schande ertragen hat, die der Haß der Gegner auf ihn lud, nicht in der Nähe sehen, ohne das Andenken Luthers zu segnen, der Deutschland von einer unseligen Macht befreit hat, und ohne es zu beklagen, daß er selbst auf dem Throne keinen so großen Kaiser gefunden hat, wie beispielsweise Friedrich II. van Hohenstaufen, der ja auch seine Herrschaft fortwährend gehemmt und verfolgt sah durch den treulosen und böswilligen Ehrgeiz Roms.«
Die Tage von Sorrent, wo es keine Museen und Theater und keine lästigen Bekannten gab, flossen so ruhig und friedlich dahin, wie die von Triebschen. Der Traum Cosimas von Italien ging hier in Erfüllung. Im milden Glanze des südlichen Spätherbstes und Vorwinters gediehen mit dem Vater auch die Kinder; zur Freude aller besonders der junge Siegfried, dessen geistige Regsamkeit, dessen Witz, dessen Herzensgüte, dessen Menschen- und Tierliebe immer deutlicher hervortraten und der in den Städten, die er mit seinen Eltern besuchte, seinen ausgesprochenen Sinn für die bildende Kunst, vor allem für die Baukunst, frühzeitig entwickelte. Der Aufenthalt in Sorrent brachte aber auch ein schmerzlich nachwirkendes Erlebnis: die letzte Begegnung mit Friedrich Nietzsche.
Dieser hatte aus Gesundheitsrücksichten dem Lehrberufe entsagen müssen und suchte, begleitet und behütet von Malwida von Meysenbug, die er seine mütterliche Freundin nannte, im Süden Heilung und Kräftigung. In Sorrent traf er mit Wagner zusammen. Auf einem gemeinsamen Spaziergange, am Tage bevor sie sich trennten, sprach der Dichter des »Parsifal«, tief ergriffen von seiner eigenen Schöpfung, über den Inhalt und die religiöse Weihe des neuen Bühnenwerkes, vom Geheimnisse des Grals und von der Rettung des Heiligtums durch den erwählten Toren. Er befremdete und verwirrte damit den schon seit einiger Zeit nach einer ganz anderen Richtung ausschauenden Geist des Freundes. Dieser begann sich eine neue Welt aufzubauen, in der kein noch so geheiligtes Herkommen, keine noch so ehrwürdige Überlieferung Platz hatte, wenn sie im Widerspruche stand zum sieghaften Bewußtsein des starken und stolzen Menschen, der das Leben bejaht und bezwingt. Um diese Welt aufbauen zu können, mußte er manchen Tempel stürzen und den Schutt wegräumen. Er wurde der Mann, der die »Umwertung aller Werte« forderte und der sich rühmte, »mit dem Hammer« zu philosophieren. Er fühlte die Notwendigkeit, vorerst alles zu zerschlagen, was ihn hinderte, sein Ziel zu erschauen und es anderen zu zeigen. Er ging dabei kühn und hastig zu Werke. Er stürmte sozusagen einen Gipfel und kümmerte sich nicht darum, daß er im jähen Anstiege vieles zertrat, was er sonst behutsam aufgelesen. Aber es machte ihn unsicher und beklommen, daß er nicht mehr mit Wagner gehen konnte. Diese Unsicherheit und dieses Unbehagen verführten ihn auch zum Mißtrauen und zur Ungerechtigkeit gegen denselben Mann, den er als Erster in seiner vollen Größe erkannt hatte. Eben jetzt, der Heilung bedürftig, fühlte er sich durch die Nähe Wagners, die er schon so oft – bei aller Freundschaft – mehr gemieden als gesucht hatte, auf das heftigste bedrückt. Im »Parsifal« gewahrte er nur die Anklänge an den christlichen Gottesdienst und erblickte darin das Zusammenbrechen des von je so unkirchlich Gesinnten vor der Macht Roms. Die Reinheit Parsifals erschien ihm als mönchische Aszese, als Verleumdung des Lebens. Er erkannte nicht, daß sein Edelmensch, sein Übermensch, sein Herr – der nicht gesetzlos herrscht, sondern dem die »Herren- Moral« das Zeichen und die Würde der Kraft ist – in der Gestalt des Parsifal eine Verkörperung gefunden hat, die jeder verstehen muß, der Gebundene und der Freie, der Gläubige und der Ketzer, der in der Vergangenheit Wurzelnde und der in die Zukunft Wachsende. Denn hier ist, um den Wortschatz Wagners zu gebrauchen, das Ewig-Natürliche zum Rein-Menschlichen geworden, hier ist der Lebensdrang, den Nietzsche feierte und dem nichts von dunklen Trieben anhaften durfte, zum beglückenden Ordner der menschlichen Beziehungen gemacht. Hier wird die ungehemmte Willenskraft und die nur ihr mögliche Bändigung alles Dunklen und Zerstörenden, das in Wahrheit das Leben bedroht, in einer Weise verherrlicht, die wir heute als das einprägsamste künstlerische Beispiel zu den Lehren Nietzsches ausfassen können. Aber Nietzsche selbst verstand dies nicht. Er blieb an Sinnbildern und Formen hängen, die für ihn den Geschmack des Frömmelnden oder des Klerikalen hatten, und er ging, wenn wir seiner Schwester glauben dürfen, sogar so weit, den aus innerstem Zwange schaffenden Meister berechnender Absichtlichkeit zu zeihen. Er vergaß, daß Wagner in seinem heldenhaften Menschentume, das Nietzsche doch stets bewundert hatte, selbst ein echter Siegfried, ein Übermensch gewesen ist; und er begriff nicht, daß die »Torheit« Siegfrieds, das Unbedingte, Unbekümmerte, keiner Gefahr Achtende und so das Verhängnis Heraufbeschwörende, sich im Parsifal auf einer höheren Stufe wiederholt, mit jener strengen Zucht, jener männlichen, nicht mönchischen Entsagung und Weltüberwindung, jener geistigen Abkehr von den menschlichen Schwächen, den »Freuden- und Leidenschaften«, die Nietzsche von seinem Übermenschen, vom Menschheits- Führer verlangte. Wie weit auch Nietzsche, als eigenwilliger Denker von höchsten Gaben, sich von Wagners Denkweise in der Einzelbetrachtung des Lebens und der Geschichte entfernen mochte, und wie sehr der »Widerspruchsgeist« in ihm, eine Hauptquelle seines schöpferischen Denkens, sich dagegen sträuben mochte, auf gebahnten wogen fortzuschreiten – wir Heutigen sehen im »Parsifal« die Höhe erreicht, auf der der letzte Wagner und der letzte Nietzsche sich einträchtig finden müssen.
Doch Nietzsche war damals noch nicht der letzte Nietzsche, und auch der letzte Wagner trat ihm noch nicht unzweideutig entgegen. Der »Parsifal« lebte ja noch nicht auf der Bühne, und die Worte Wagners entbehrten noch der beseelenden und beseligenden Tonsprache. So gingen die beiden, die heute zusammen im frohen Bekenntnisse des wiedergeborenen Deutschen leben, damals beinahe stumm auseinander, mit dem unwiderleglichen Gefühle gegenseitiger Verstimmung. Als ein Jahr später die gedruckte Dichtung des »Parsifal« bei Nietzsche eintraf, mit einer scherzhaften Widmung Wagners, der sich als »Oberkirchenrat« bezeichnete, und als hernach Wagner das neue Buch »Menschliches, Allzumenschliches« von Nietzsche erhielt, worin dieser sich zum ersten Male deutlich vom Meister und von Schopenhauer abkehrte, da war der innere Bruch vollzogen. Es wäre nichts weiter darüber zu sagen, als eben nur die tragische Bedingtheit aller menschlichen Verhältnisse anzuerkennen, wenn die »Erdenfeindschaft«, die sich nach Nietzsches eigenen Worten mit seiner »Sternenfreundschaft« zu Wagner verknüpfen mußte, nicht doch auch einen allzu bitteren Beigeschmack bekommen hätte. Elisabeth Förster, die in schwesterlicher Liebe jeden Zettel ihres Bruders aufbewahrt hat, erwähnt eine »erklärende Notiz« aus seinem Nachlasse, die folgenden Wortlaut hat: »Der Parsifal Wagners war zuallererst und anfänglichst eine Geschmackskondeszendenz Wagners zu den katholischen Instinkten seines Weibes, der Tochter Liszts.« Wer das Leben Cosimas bis hierher verfolgt hat, der weiß, welche gröbliche Verkennung ihres Wesens, aber auch der Gedankenwelt Wagners und Liszts in diesen Worten enthalten ist. Und wie reimt sich der wegwerfende Ton zu der warmen und innigen persönlichen Verehrung, die Nietzsche bis an sein Ende für Wagner und für Cosima hegte? Wie reimt sich mit der Sternenfreundschaft, der doch auch eine sehr lebhafte Erdenfreundschaft vorangegangen war und von der man meinen sollte, daß sie auf der »Erde« nur als Hochachtung und Bewunderung in Erscheinung treten könne – wie reimt sich damit die erschreckende Tatsache, daß Nietzsche nach dem Tode Wagners Schriften gegen diesen veröffentlichte, deren gereizter, ja gehässiger Ton, deren an manchen Stellen bis zur Maßlosigkeit gesteigerte Angriffslust der ganzen Öffentlichkeit als ein mit Entsetzen und mit Schadenfreude aufgenommenes Zeichen völliger Sinnesänderung und unversöhnlicher Erdenfeindschaft gelten mußte? Schriften, die auch wenig vom hohen Geiste Nietzsches verraten und ebensowenig zur Kenntnis und Erkenntnis Wagners beitragen. Etwas Seltsameres, Unbegreiflicheres hätte Nietzsche der »bestverehrten« Frau niemals antun können. Für Wahnfried blieb es das einzig Mögliche, daß man in dem Verlorenen fortan nur den Geisteskranken sah.
In Rom besuchte Cosima die Fürstin Wittgenstein und machte mit ihrem Manne die Bekanntschaft des Grafen Arthur Gobineau, von dem bald mehr zu sagen sein wird. Zu Weihnachten waren sie wieder in Bayreuth. Das Ende des Jahres wurde durch die Anwesenheit Hans Richters verschönt, der es in Wien nicht mehr ausgehalten hatte und drei freie Tage dazu benützte, um einen davon in Wahnfried verbringen zu können. Zu Ostern weilte Liszt in Bayreuth, zehn »stille, ruhige« Tage, reich an künstlerischen Anregungen. Nach Vollendung der »Parsifal«-Dichtung, die in einer Zeit zustande kam, in der sich wieder »alles häufte«, um Wagner »zu peinigen und aufzuregen«, wurde – über Meiningen – die Reise nach England angetreten. Die Kinder blieben in Bayreuth zurück.
Der künstlerische Erfolg des Unternehmens, das doch nicht die erwünschten Einnahmen brachte, wurde schon erwähnt. Als die spätere endgültige Abrechnung ein so ungünstiges Ergebnis zeigte, wollte Cosima ihr mütterliches Erbteil der Bayreuther Sache widmen. »Ich glaube fest«, schrieb sie, »daß meine Kinder mir dies nicht übel anrechnen werden, und weiß, daß Gott es ihnen segnen wird«. Zum Geburtstage Wagners, den er noch in London feierte, schenkte sie ihm eine Gedenkmünze zur Erinnerung an die Festspiele von 1876, zu der Semper die Zeichnung geliefert hatte. In London erlebte das Paar die Freude, daß in einem der vielen Trinksprüche und Tischreden zum ersten Male auch des jungen Siegfried gedacht wurde, des Sohnes und Erben, der dereinst ausführen werde, was der Vater noch nicht verwirklichen konnte.
Auf der Rückreise trafen sie in Bad Ems mit ihren Kindern zusammen. Standhartner hatte Wagner dieses Bad empfohlen. Aber der Erfolg war gering. Immer wieder meldeten sich die fast gewohnten Beschwerden: hoher Blutdruck, träger Unterleib, Hautausschläge, Atemstörungen, Brustkrämpfe, zeitweilig auch Fußschmerzen. Verschiedene Trinkkuren und die Meeresbäder, die Wagner in den nächsten Jahren versuchte, haben ihm auch nicht geholfen. Die Krämpfe wurden häufiger und bedrohlicher. Am wohlsten tat ihm die Wärme des Südens. Darum finden wir ihn für den Rest seines Lebens so oft in Italien. Den deutschen Winter konnte er kaum mehr vertragen.
Aber jetzt war Sommer. Von Ems ging es über Heidelberg nach Luzern. Auf dem Bahnhofe warteten schon, zu Wagners herzlicher Überraschung, Hans Richter, die Gräfin Bassenheim und Vreneli (Verena Stocker-Weitmann) mit den Ihren. Triebschen erstand von neuem und wurde auch, trotz der Ungunst des Wetters, für ein paar Stunden besucht. Über Zürich, München, Nürnberg reisten sie nach Weimar, wo sie drei Tage bei Liszt zubrachten. Marie Schleinitz und Ernst Dohm waren von Berlin gekommen. Dann ein Besuch der Wartburg bei Eisenach – und endlich wieder daheim!
Endlich wieder in Bayreuth, wo nun Wagners geistiges Leben eine neue Stütze gewann, wo ein neuer Vorkämpfer und Mitstreiter, dem Rufe des Meisters folgend, sich in der Stadt niederließ, um fortan sein ganzes Leben nur der Bayreuther Kunst und den Meister-Lehren zu widmen. Dicht neben Wahnfried, mit einer Verbindungstür in den Wagnerschen Garten, steht das Haus, darin noch heute, im 89. Lebensjahre, Hans von Wolzogen lebt und wirkt, der gelehrte Kenner der deutschen Sprache und Dichtung, der deutschen Sagen und der deutschen Tonkunst, durch sein Wissen und sein Gefühl, seine Studien und seine Neigungen vorbestimmt zum Verkünder des Wagnerschen Gesamtkunstwerkes, durch seine schriftstellerische Begabung, seine geistvoll-schwärmerische Beredsamkeit berufen wie kein anderer zum literarischen und journalistischen Kampfe mit allen Zweiflern und Widersachern. Mit neunundzwanzig Jahren, jung vermählt, kam er nach Bayreuth und hat es nicht mehr verlassen. Noch heute gibt er die damals von Wagner gegründeten » Bayreuther Blätter« heraus, die zuerst als Monatschrift des Patronatvereines gedacht waren und die dann, losgelöst von den Festspielen, äußerlich unabhängig, innerlich aber aufs engste mit Bayreuth verbunden, eine »deutsche Zeitschrift im Geiste Richard Wagners«, die geistigen Patrone der Bayreuther Sache als Leser und Mitarbeiter sammelten. Wagner selbst ließ seine zukunftsträchtigen letzten Arbeiten in diesen Blättern erscheinen. Die ungenannte Hauptschriftleiterin war Cosima, die alle Einsendungen prüfte und jedes Heft mit Wolzogen sorgfältigst vorbereitete.
Neben diesem müssen wir Karl Friedrich Glasenapp nennen. Auch er trat damals in persönliche Verbindung mit dem Meister, auch er ist von dieser Zeit an nicht mehr wegzudenken aus dem vertrautesten Freundeskreise Wahnfrieds und aus der engsten Gemeinde des Bayreuther Künstlers und Sehers. Er lebte und wirkte aber in dem entfernten Riga, wo er, nur um ein Jahr älter als Wolzogen, schon 1915, während des Weltkrieges, im Feindeslande, starb. Seiner Schülerin und Freundin Helene Wallem ist es gelungen, seine Bücherei und seinen gesamten Nachlaß unter Mühen und Gefahren nach Bayreuth zu bringen, als Grundstock der von ihr geschaffenen und mit Hilfe der Stadtverwaltung planmäßig erweiterten Richard-Wagner-Gedenkstätte, deren reichen Bestand und deren packende Anordnung heute jeder Festspielbesucher bewundert. In dieser Gedenkstätte tritt uns sichtbar, greifbar entgegen, in einer Fülle von Büchern, Bildern und handschriftlichen Zeugnissen, was Glasenapp in seinem nie genug zu würdigenden Hauptwerke »Das Leben Richard Wagners« mit einer Gewissenhaftigkeit und einem Verantwortungsbewußtsein ohnegleichen erzählt hat, zu einer Zeit, als es noch keine solche Gedenkstätte gab, die ja erst durch ihn möglich geworden ist, als er sich noch alles in der weiten Welt zusammensuchen und erst zu einem gewaltigen Bilde formen mußte. Dieses Bild ist aus bescheidenen Anfängen Jahr für Jahr mächtig emporgewachsen. 1876/77 waren es noch zwei schmächtige Bände, ein Vierteljahrhundert später sechs große, stattliche Bücher, von denen der Schlußband allein, der nur die Zeit von der Entstehung des »Parsifal« bis zum Tode des Meisters umfaßt, einen weit größeren Umfang aufweist als das hier vorliegende »Leben Cosima Wagners«. Dieser Umfang war nur möglich, weil Glasenapp die Aufzeichnungen Cosimas benutzen durfte, in denen sozusagen jeder Schritt des Meisters und jedes Wort aus seinem Munde bewahrt sind.
Was aber Cosima dem Tagebuche und brieflich wenigen Freundinnen, wie der Schleinitz und der Meysenbug, an geheimen Hoffnungen und unterdrückten Schmerzen anvertraute, davon hat uns Du Moulin Eckart bedeutsame Proben mitgeteilt. Es sind immer dieselben Hauptthemen und Leitmotive, die in ihren Mitteilungen gleichsam sinfonisch abgewandelt werden: die grenzenlose Liebe zum Gatten, das tiefste Verstehen seines Wollens, die zärtlichste Sorge für die Kinder und die nie erlöschende Teilnahme an dem Lose Bülows.
Als Helferin des Meisters im engeren, künstlerischen Sinne trat sie damals nicht hervor. Sie nahm sein Schaffen nur staunend-demütig hin, und Wagner, der ihres blitzartigen Verständnisses wohl bewußt war, konnte selbst nicht ahnen, welche Mitarbeiterin, welche Vollstreckerin seines Willens er sich erzogen hatte. Schriftstellerisch gewährte sie ihm eine vielseitige Hilfe. Für Judith Mendès-Gautier, die bei den Festspielen 1876 nicht gefehlt hatte, die aber merkwürdigerweise zwar Chinesisch, doch nicht Deutsch verstand, und die jetzt ihre Landsleute mit der »Parsifal«-Dichtung bekannt machen wollte, verfaßte Cosima einen französischen Text. Es sollte dies aber nur eine Übersetzung, keine Umdichtung sein, eine Arbeit, die einzig den Zweck hatte, der wißbegierigen Freundin womöglich jedes Wort klarzumachen und ihr so auch die geeignete Unterlage für eine allfällige französische Neufassung zu bieten. Also auch keine Übersetzung in Versen, sondern in Prosa; ohne Bedachtnahme auf die besonderen dichterischen Ausdrucksmittel, nur in treuester Wiedergabe des Begrifflichen und Gedanklichen. Dies war schwer genug, und Frau Judith scheint an der Sprache Cosimas Anstoß genommen zu haben. Denn Wagner schrieb ihr: »Sehen Sie denn nicht, daß sie wörtlich übersetzt hat? O wenn Sie wüßten, wie unmöglich es ist, den Sinn dieser Dichtung in Ihrer so konventionellen Muttersprache wiederzugeben. Cosima hat … nur sterbensdürre Worte hingesetzt! Und das bei naiven Dingen, die sogar dem Sinne nach Franzosen unbekannt sind … Cosima hatte bloß die Absicht, halbwegs verständlich zu machen, worum es sich handelt, wobei stillschweigend vorausgesetzt war, daß man das ganz anders einrichten müsse, damit Franzosen es ›als Poesie‹ empfinden könnten.« Die Niederschrift der Übersetzung, die von Cosima, mit Rücksicht auf ihre schonungsbedürftigen Augen, der Gattin Wolzogens diktiert und dann eigenhändig verbessert wurde, befindet sich heute in der Wagner-Gedenkstätte. An den Verbesserungen erkennt man das Ringen um den Ausdruck, der gerade deshalb so schwer zu gewinnen war, weil Cosima eben gar nicht auf der Oberfläche blieb, weil sie bestrebt war, den Sinn Wagners zu erschöpfen, und sich dabei einer Sprache bedienen mußte, die sich von der deutschen im Wesen unterscheidet und von der Goethe meinte, daß alles, was sie sich vom Deutschen aneigne, etwas ganz anderes werde. Auch Cosima hatte während ihrer Arbeit das Gefühl, daß es unmöglich sei, die einfachsten Dinge französisch zu sagen, wenn man dem Gedanken treu bleiben wolle.
Als Liszt die gedruckte Dichtung erhielt, erfuhr er zugleich von der Absicht seiner Tochter und schrieb ihr: »Wenn Du die französische Übersetzung dieses wundervollen Gedichtes vollendet haben wirst, zeige sie mir … und wenn es nötig wäre, woran ich zweifle, werde ich mir erlauben, Dir als Helfer zu dienen. Vor meiner Rückkehr nach Weimar werde ich Dich in Wahnfried, der Metropole des Ideals, besuchen. Am 25. Dezember hast Du das Alter von vierzig Jahren erreicht. So wie mir meine gute Mutter, der ich immer ein guter Sohn gewesen bin, sage ich Dir, teuerste Cosima, daß Du eine wunderbare Tochter bist. Mein Gebet zu Gott ist, daß wir ewig vereinigt bleiben werden.«
Unaufhaltsam schritt die Musik zum »Parsifal« vorwärts. Unaufhörlich betätigte sich Cosima auf allen Gebieten, die sie beherrschte und betreute. Nie gönnte sie sich Rast und Ruhe, so daß ihr Wagner einmal den heiteren Vorwurf machte, es fehle ihr die »Philosophie des Vormittags«. Für die Familienfeste, die sie immer so erfinderisch zu gestalten wußte, hatte sie nun einen tüchtigen Gehilfen, Freund Wolzogen, der, dichterisch sehr begabt, die reizendsten häuslichen Festspiele verfaßte, an deren Aufführung sich die immer verheißungsvoller entwickelnden Kinder mit ebensoviel Freude als Geschick beteiligten. Der Frieden des Hauses und das Familienglück waren aber streng zu unterscheiden von dem Verhältnisse des Meisters zur Außenwelt. Es war nicht leicht, die Abkehr Nietzsches zu beobachten und gleichzeitig immer beängstigendere Nachrichten über den geistigen Verfall des Königs zu vernehmen. Dazu das bange Fragezeichen, das bei jedem Anblicke des Festspielhauses, bei jeder Erwähnung des »Rings« auftauchte! Da wurden Herd und Haus freilich noch kostbarer. Aber in ihrer Rührung über die »strahlende Güte und Heiterkeit« Richards dachte Cosima auch an die Nachwelt und schrieb, wie im Erschauern vor ihrer Bayreuther Sendung: »O hätte ich die Kraft und hätte ich die Macht, ihm das Monument zu errichten, welches ihm gebührt. In Nichts sänke Beatrices Glorie, von Dante gehoben, zusammen.«
In ihren Bekenntnissen erreichte die Liebe zum Meister damals den Höhepunkt überschwenglichen Ausdrucks. Nichts von außen beirrte und bedrängte sie mehr; ihr Bund war geweiht und anerkannt, ihr Glück der Welt offenbar; doch um so lauter pochte ihr Herz und verging vor Seligkeit. Als am 25. August 1878 ihr Trauungstag in Gegenwart Liszts gefeiert wurde, war Richard besonders aufgeräumt, und wie er gern Scherz und Ernst vermischte und in launiger Form tiefe Erkenntnisse aussprach, so sagte er jetzt zu Cosima: »Damals in Zürich hätte ich dich mit nach Venedig nehmen müssen. Mit meiner Frau war ich fertig, mit Hans war das Verhältnis noch nicht so ausgebildet und du hattest keine Kinder. Aber ich war so dumm wie Tristan und du die dumme Liese, die Isolde. Wir wären in Italien geblieben und alles hätte Sinn und Verstand gehabt.« Bald danach legte sie ihm ein Blatt auf den Tisch, eine » Litanei«, die in sprachlicher Anlehnung an den »Parsifal« nicht nur die Inbrunst ihres Gefühles, sondern auch, mit dichterischer Kraft, das Wesen und die Wirkung Wagners in höchster Steigerung aussprach:
Unsündiger,
Erhaben-Begehrender,
Groß-Entsagender,
Besonnener, Beharrlicher,
Bedächtiger, Geduldiger,
Unerschrocken-Sendungstreuer,
Heilig-Unbeständiger,
Weihvoll-Ungeduldiger,
Hehr-Unbesonnener,
Wahnflüchtiger!
Schaffend Vernichtender,
Vergeudend Ordnender,
Volks-Fürstlicher,
Ruhm-Unbekümmerter,
Eitelkeits-Barer,
Leicht-Sinniger,
Vor-Sorgender,
Argwohn-Unkundiger!
Gütig-Gibicher,
Ganz sich Hingebender,
Tief-Verschlossener,
Begeisterungsgewaltiger,
Zündend-Redender,
Glutvoll Schweigender,
Hoffnungslos Glaubender,
Unerbittlicher dem Übel,
Eroberer dem Schwachen,
Wahrheit-Verkündender,
Trug-Verscheuchender,
Kühn-Entlarvender,
Mild-Verhüllender,
Liebe Übender,
Leben Ausströmender,
Welt-Fremder,
Natur-Trauter, Heimischer,
Seher des Seins,
Herr des Scheins,
Lenker des Wahnes,
Freude des Willens,
Erlösung-Vollbringer,
Selig Schaffender,
Alltönender, Schauender, Könnender,
Unbegreiflicher,
Unschuldiger, Freier,
Kind und Gott.
Und nach jedem Ausrufe, nach Art der römischen Litanei, der Kehrreim:
Richard, behalte mich lieb!
Italien und Liszt, das ist jetzt das Neue in Wagners Leben. Beides gibt ihm viel Sonne, und die Wolken, die manchmal heraufziehen, wenn Wagner von seiner Eifersucht befallen wird, bestätigen nur die nahe Verbundenheit Liszts mit dem Hause Wahnfried und daß er jetzt wirklich zur Familie gehört. Endlich hat auch er ein Heim gefunden, das er allerdings, nach alter Weise und Gepflogenheit, nur zeitweilig aufsucht und wo er nie lange bleibt. Aber sein Herz ist hier und nicht in Rom, und es gibt nichts Wichtiges, nichts Festliches, nichts Fröhliches unter dem Dache Wagners, woran Liszt nicht teil hätte.
Den nächsten Winter, vom Beginne des Jahres 1880 an, verbrachte Wagner zuerst in Neapel, in der Villa Angri am Vorgebirge des Posilipo. Er blieb lange dort, bis in den Sommer hinein, und feierte in der Villa auch seinen 67. Geburtstag, zu dem ihm Cosima mit ihrem von Joukowsky gemalten Bildnisse überraschte. (Ein anderes, wieder von Lenbach, hatte sie ihm im vorigen Jahre geschenkt.) Der Russe Paul von Joukowsky, geboren von einer deutschen Mutter und des Deutschen vollkommen mächtig, war schon früher durch Lenbach mit Cosima bekannt geworden und hatte auch an den Festspielen des Jahres 1876 teilgenommen. Wagner jedoch lernte ihn erst in Neapel kennen, wo der Maler in dieser Zeit, ungefähr zwanzig Minuten von der Villa Angri entfernt, seine Werkstatt hatte. Der sich rasch entwickelnde lebhafte Verkehr ergab sehr bald ein freundschaftliches Verhältnis, in dem zunächst Joukowsky der Empfangende war, da er zum ersten Male in die Gedankenwelt Wagners eingeführt wurde, die ihm bisher fremd gewesen. Aber es stellte sich zur höchsten Freude des Meisters heraus, daß auch Joukowsky etwas wertvolles geben konnte: nicht nur seine angenehme Persönlichkeit, auch die bildmäßige Gestaltung des Bayreuther »Parsifal«.
In Neapel tauchte noch einmal in Cosima die Hoffnung auf, Böcklin für Bayreuth gewinnen zu können. Der große Schweizer war eben damals in ihrer Nähe und fühlte sich veranlaßt, Wagner seinen Besuch zu machen. Diese Gelegenheit benützte Cosima, um ihn womöglich zur Mitarbeit am »Parsifal« zu überreden, hatte man ihn beim »Ring« entbehren müssen, so war es vielleicht ein um so größerer Glücksfall, seine leidenschaftlich-innige Auffassung der südlichen Welt und das Berauschende seiner Farben, wie auch seine Kraft, das Geheimnisvolle, Göttliche im Bilde darzustellen, nun verwerten zu können. Böcklin erwies aber auch bei diesem Zusammentreffen, daß ihm das Gesamtkunstwerk im Sinne Wagners noch nicht aufgegangen war, und als bloßer »Theatermaler« mitzutun, das war für ihn kein Ziel des Ehrgeizes. Diese Hoffnung mußte also aufgegeben werden. In Joukowsky, der als selbständiger Künstler mit Böcklin nicht in einem Atem zu nennen war, fand sich jedoch der geeignete Helfer am Bayreuther Werke. Durch fünf Jahrzehnte waren seine Bühnenbilder, wenn auch im einzelnen geändert und verbessert, mit dem Bayreuther »Parsifal« verknüpft. Sein Hauptstück lieferte er mit dem Gralstempel für den ersten und dritten Aufzug. hier war er, angeleitet und angeeifert durch den Meister selbst, wirklich der ergänzende und vollendende bildende Künstler, der der Wort-Ton-Dichtung nicht nur einen glänzenden Rahmen, sondern die herrlichste Gestalt verlieh. Dabei offenbarten sich in ihm Fähigkeiten, die Böcklin vielleicht nicht in demselben Maße gezeigt haben würde. Joukowsky schuf nicht nur nach den Vorbildern der schönsten mittelalterlichen Kirchen – wir denken an Siena und an Aachen – den weihevollsten Schauplatz für die Gralsfeier und ermöglichte nicht nur durch die räumliche Gliederung der Bühne den vollkommen deutlichen und sinnvollen Ablauf der feierlichen Handlung, sondern er verstand es auch, die Bühne und den Zuschauerraum zur Einheit zu verbinden: man saß nicht nur im Amphitheater, man hatte vielmehr den Eindruck, als stehe man selbst in der Säulenhalle des Tempels, unter der kaum sichtbaren und eben dadurch ins Unermeßliche deutenden Wölbung der Kuppel; der Zuschauer wurde zum Teilnehmer des Vorganges. Nicht zuletzt darauf beruhte das Unbeschreibliche der Gralsfeier, bei der jeder das unbezwingliche Gefühl hatte, daß sie in dieser Form und mit solcher Wirkung in kein Opernhaus gehöre, aber auch in keinem Opernhause möglich sei.
Außer Joukowsky zählte noch ein anderer neuer Freund zur Gesellschaft Wagners in Neapel: Heinrich von Stein. Wagners Sohn war in das Alter getreten, in dem er eines »höheren« Unterrichtes teilhaftig werden mußte. Aber dieser sollte unter der Aufsicht der Eltern vor sich gehen, sie wollten den Jungen nicht dem geistlosen Herkommen der öffentlichen Schulen überantworten, er wurde auch noch nicht für einen Beruf bestimmt, durch die Vermögenslage seiner Eltern war es ihm vergönnt, vorerst selbständig ins Leben zu treten und sich dann, mit gereiftem Sinne, sein »Fach« zu wählen; er hatte vorerst nur ein gebildeter und wohlerzogener Mensch, ein »anständiger Kerl« zu werden, empfänglich für alles Hohe im Leben und in der Kunst, auf dem Boden wachsend, den er dem Leben in Wahnfried und der Kunst Wagners zu verdanken hatte. Nachdem es mit einigen Durchschnittslehrern nicht recht gegangen war, kam endlich, empfohlen von Malwida von Meysenbug, Heinrich von Stein ins Haus. Er gehörte noch nicht zur Wagner-Gemeinde. Er hatte Theologie, Philosophie und Naturwissenschaften studiert und war ein Anhänger Eugen Dührings, dessen Weltanschauung sich nur in einigen Punkten mit der des Meisters berührte, in anderen zu ihr beinahe in schroffem Gegensatz stand. Stein war aber kein blinder Nachtreter und Nachbeter, sondern ein hellsichtiger Sucher nach eigenen Pfaden und neuen Zielen. Er machte auf Wagner und Cosima einen so günstigen Eindruck, daß sie sich gern für ihn entschieden. Auch der junge Siegfried hatte sogleich Vertrauen zu ihm gefaßt. Erziehung und Menschenbildung, tätiges Wirken in einem lebendigen Kreise dünkten Stein wertvoller und fruchtbarer als Gelehrsamkeit und rechthaberische Meinungen. 1879 wurde der Zweiundzwanzigjährige Mitbewohner Wahnfrieds und begleitete dann die Familie auf der italienischen Reise. Erzieher des Sohnes, wurde er Zögling des Vaters, trat ein in die Welt Wagners und Schopenhauers, in der er sich nicht nur bald zurechtfand, sondern sich auch vieles in einer ganz persönlichen Weise aneignete. Zu seinem herben Schmerze mußte er schon nach einem Jahre, dem Wunsche seines Vaters gehorchend, in den akademischen Beruf zurückkehren und sich dem Amte eines Hochschullehrers widmen. Was er in den Universitäten in Halle und in Berlin gelehrt und geleistet hat, was er einem weiteren Kreise in seinen, zum größten Teil in den »Bayreuther Blättern« erschienenen Schriften und Dichtungen an bedeutenden Gedanken und feinen und tiefen Beobachtungen schenkte, das stellt ihn für immer in den erlauchten Kreis jener besten, führenden Männer, die sich damals um Wagner scharten. Ihm verdanken wir auch das zusammen mit Glasenapp verfaßte »Wagner-Lexikon«, eine Zusammenstellung der Hauptbegriffe der Wagnerschen Kunst- und Weltanschauung in wörtlichen Anführungen aus dessen Schriften. Aber für den seelisch zarten und geistig vornehmen Jüngling aus altadligem Geschlecht waren der Hochschulbetrieb und der Markt der Gelehrsamkeit nicht die rechte Luft und das rechte Wirkungsfeld. Er erlebte viele Enttäuschungen und fand Trost und Stärkung hauptsächlich in Wahnfried, das ihm bis zuletzt eine zweite Heimat blieb, und wo er das Vertrauen und die Zuneigung Cosimas in höchstem Maße gewonnen hatte.
Wie Wagner und Cosima über Erziehung dachten und wie sie ihre Grundsätze verwirklichten, das erhellt am schönsten aus den Briefen Cosimas an Daniela. Diese war nun dem Louisenstift entwachsen und hatte schon im vorigen Jahr als junge Dame den Großvater Liszt von Weimar nach München und nach Rom begleitet, wo sie unter der Obhut Malwida von Meysenbugs längere Zeit verweilte. In Neapel, wo sie vorübergehend heftig erkrankte und ihre Mutter sich wieder einmal als vielerprobte Krankenpflegerin zu bewähren hatte, war sie zwar mit der Familie vereint; als aber Wagner, der von neuem an einem Ausschlage litt, eine Luftveränderung brauchte und mit seiner Gattin in die toskanischen Berge nach Perugia fuhr, während die Kinder unter der Obhut Joukowskys einstweilen noch zurückblieben, da hatte Cosima, die unermüdlich Sorgende und täglich um alles Besorgte, auch im sonnigen Süden Gelegenheit, briefliche Ermahnungen an die Kinder ergehen zu lassen. An dem einzigen Tage, den sie durchfahrend in Pistoja verbrachte, richtete sie ein langes Schreiben an Daniela, das man erhaben nennen möchte, so schlicht und groß spricht sie darin ihre Ansichten über Erziehung und Persönlichkeit, Bildung und Menschlichkeit aus. Sie selbst bezeichnete es als ein »Experiment«, daß sie die Mädchen, die sie zuerst in strenger Zucht gehalten, immer mehr in Freiheit erwachsen ließ, ohne das Herkommen und die Sitte zu befragen, die sie sonst für bindend erachtete. Aber sie hoffte und wollte es darauf ankommen lassen, daß sich das Rechte und Gute bei ihren Kindern und in der Welt, in der sie aufwuchsen, von selbst bewähren werde, daß sie mit ihren natürlichen Gaben nur der Freiheit und Wahrheit bedürften, um ihrem Selbst gemäß zu einer schönen Harmonie zu gelangen. Das hinderte Cosima nicht, in demselben Schreiben und in so vielen anderen doch auch sehr genaue Verhaltungsmaßregeln für die mannigfachsten Verhältnisse zu geben. Immer in der Form eines Rates, einer Bitte, eines Hinweises auf Gegebenheiten, die ein Kind, ein kaum Erwachsener noch nicht durchschauen kann.
Wir möchten hier das nächste Jahr vorausnehmen, in dem Daniela zu einem längeren Besuche bei der Frau von Schleinitz in Berlin eingeladen war, um dort in die »große Welt« eingeführt zu werden und Beziehungen zu den vornehmsten Gesellschaftskreisen anzuknüpfen, wie da Cosima aus der Ferne, und oft in Unkenntnis der bestimmenden Tatsachen, das richtige Verhalten ihrer Tochter, namentlich im Verkehre mit höhergestellten und mit jungen Männern, in den Briefen an Daniela und an die Freundin nach allen Seiten zu regeln und zu sichern suchte, das zeigt uns ein einzigartiges Gemisch von Güte und Strenge, von mütterlicher Liebe und erzieherischer Gewissenhaftigkeit, dessen Kundgebungen uns bis zu Tränen rühren können. Aus diesen Briefen geht auch hervor, daß Daniela ihr manchmal zu ungebärdig, zu hochfahrend, zu anspruchsvoll war, daß sie fürchtete, ihr Kind werde nicht immer die Grenzen achten, die ihr unter den obwaltenden Verhältnissen Dankbarkeit, Ehrfurcht und Selbstbewußtsein gleichmäßig vorschrieben. So schrieb sie einmal an Frau von Schleinitz: »Soll ich Dir nun gestehen, daß das Einzige, was mich … fast leidenschaftlich erregt, die Sorge ist: Daniela möchte sich tüchtig bewähren. Ich weiß es nicht, ob es ein Mangel von Zärtlichkeit bei mir ist, aber in der Tat hege ich betreffs meiner Kinder nur die eine Besorgnis, daß sie nicht stolz gelassen genug den Widrigkeiten des Lebens entgegentreten. Die Widrigkeiten selbst, Gott, die sind die Atmosphäre, und viel darüber zu jammern ist mir nicht beigekommen. Das Einzige, was ich mit Macht begehrt habe, das ist, meine Kinder in dieser Beziehung eines Sinnes mit mir zu wissen. Sollte mir die Prüfung werden, daß sie unvornehm, ungroß, mit gewöhnlichen Leidenschaftlichkeiten, die Peinlichkeiten des Lebens hinnehmen, so gestehe ich es Dir, einzige Freundin, daß dies die härteste meines Daseins wäre, vor welcher ich mich heute bange frage, ob ich sie und wie ich sie durchleben werde. Wie sich Daniela benimmt, darauf kommt mir alles, buchstäblich alles an.«
In diesem Zusammenhange sei noch Berthold Kellermann genannt, der von Liszt empfohlene Klavierlehrer; ein prächtiger, gerader Mensch, der als »Kraft-Mayr« durch Ernst von Wolzogen in die schöne Literatur eingegangen ist und der sich mit seinen eigenen warmherzigen Erinnerungen ein liebenswürdiges Denkmal gesetzt hat. Als Musiker jedoch wollte er vor allem »Pianist« sein und recht deutlich zeigen, wie weit er es durch Liszt gebracht. Erst Wagner öffnete ihm die Augen darüber, daß die Lisztsche Virtuosität den besonderen Lisztschen Zwecken entspreche, daß sie ein natürlicher und notwendiger Ausdruck des Lisztschen Wesens sei, daß es aber keinen Sinn habe, wenn einer, der eben bloß Klavier spiele, es nun auf einmal Liszt gleichtun wolle, ohne von demselben Dämon getrieben zu sein. Die Züchtung leeren Virtuosentums war Wagner verhaßt, und die musikalischen Wettbewerbe, bei denen ein Kunstjünger den anderen und der Schüler den Lehrer zu über-liszten sucht, sind das Widerspiel dessen, was der Meister mit seiner »deutschen Musikschule« im Sinne hatte. Später gab Engelbert Humperdinck, den er in Neapel kennenlernte, Musikunterricht in Wahnfried.
Aus der Villa Angri schrieb Cosima an Lenbach: »Wir beherrschen hier Land und Meer – es ist ein Zauber zum Lachen! Inmitten einer strahlenden Sonne, einer unglaublichen Umgebung.« – »Nirgends, glaube ich, kann einem die Berechtigung aller und allem zum Leben, des Häßlichen und des Schönen, des Guten sowie des Bösen, deutlicher entgegentreten; alles lebt und will leben, der Bettler, der Pfaffe, die hübsche und die garstige Frau; die Ruinen sind hier unfertige Häuser, und wenn manches einen sicherlich an die ewige Not der Menschheit erinnert, so geschieht es auch mit einer solchen Macht, daß das Auflehnen dagegen wie eine Absurdität erschiene und man sich in allem ergibt.« – »Also kämpfen und arbeiten gibt es hier nicht; dafür sorgt der Norden.« – »Gestern brachte Joukowsky seinen Pepino …; er hat uns durch seine Art und Weise und seine Lieder wahrhaft entzückt; so volkstümlich heiter, gewaltig und leidenschaftlich habe ich noch nichts gehört, nicht eine Spur von theatralischer Sentimentalität und einen vollendeten Vortrag in der Behandlung des Atems, des Tempos – und die gedrungene, wuchtige Gestalt, das Schlichte, innerlich Stolze, das häßliche, aber markige Gesicht, unnahbar wie das Volk, unerreichbar dem Lob, nur eines mitteilend: die Leidenschaft. Es war gar merkwürdig, als nach seinen Liedern er es versuchte, das, was er sich gemerkt hatte, von dem ›Ring‹ wiederzugeben und mein Mann das Thema der Rheintöchter spielte: Wie die Leukothea aus der Welle entstieg diese Melodiengestalt aus der Stille, die Natur in ihrer Schönheit hatten wir vor uns, während vorher die begehrende sinnlich verlangende Natur zu uns sprach.«
Ein schöner Abschluß der italienischen Reise waren die Wochen in Siena, wo Wagners haltmachten und die Kinder nachkommen ließen. Auch Liszt fand sich dort ein und verjüngte sich förmlich in den acht Tagen, in denen er stets von dem lebhafteren Freunde und der glücklichen Jugend umgeben war. Bei Tisch waren sie elf Personen, wozu die fünf Kinder, zwei Gouvernanten (eine Engländerin und eine Italienerin) und Joukowsky gehörten. Stein war vor kurzem aus ihrem Kreise geschieden. Der junge Siegfried fühlte sich in dieser an schönen Bauwerken besonders reichen Stadt mächtig zum Zeichnen angeregt und brachte von seinen Streifzügen durch die Gassen und Kirchen viele Blätter heim, die auch den Beifall Joukowskys fanden, der im Dom Studien für den Gralstempel machte. Siegfried wurde im Scherz zum »Architekten« der Familie ernannt. Im Ernst betonte Wagner, man dürfe einer solchen Neigung nie zuviel Nahrung geben und nicht durch einseitige Pflege einer Begabung den ganzen Menschen vernachlässigen.
Auf der Heimreise blieben sie noch in Venedig und begegneten hier zum zweiten Male dem Grafen Gobineau. Ein seltsames Erlebnis hatten sie endlich in München, wo diesmal der Maler Lenbach ihnen ein Fest gab, der König aber den Meister dadurch ehrte, daß er ihn zu einer jener »Separatvorstellungen« einlud, die er für sich allein im leeren, dunklen Hoftheater veranstalten ließ. Niemand durfte diesen merkwürdigen Vorstellungen, in denen sich die bereits an Wahnsinn grenzende Scheu und Schwermut des Königs zeigte, ohne seine besondere Erlaubnis beiwohnen. Wagner jedoch mußte an seiner Seite in der Königsloge, wie einst bei den »Meistersingern«, den »Lohengrin« hören. Der Familie war es nur gestattet, sich in der darunter befindlichen Loge aufzuhalten, so daß sie vom König selbst dann nicht hätte gesehen werden können, wenn das Haus erleuchtet gewesen wäre. Die Wiedergabe des Werkes, geleitet von Hermann Levi, war nicht nach dem Sinne des Meisters. Von dem Schattenbilde der Gegenwart glitten seine Gedanken in die Vergangenheit, in die so hoffnungsvolle wie nutzlose Münchner Zeit.
Die Schwärmerei des Königs für Wagners Schaffen schien aber nicht vermindert zu sein. Er befahl vielmehr ausdrücklich in den nächsten Tagen eine gleichartige Vorführung des »Parsifal«-Vorspieles unter Wagners Leitung. Die Weihe dieser Aufführung wirkte ganz besonders auf Wagner selbst, der dasselbe Tonstück bisher nur in Bayreuth seiner Familie und einem Kreise von Gästen vorgeführt hatte. Die übrige Partitur war noch gar nicht in Angriff genommen. Die Ergriffenheit des Königs äußerte sich darin, daß er die sofortige Wiederholung des Tonstückes und hernach – zum Vergleiche! – auch das »Lohengrin«-Vorspiel verlangte. Also wieder der Musik-Hunger, der Wagner schon in den ersten Jahren der Königsfreundschaft verstimmt hatte; wieder ein mehr äußerliches Genießen und gewolltes Auskosten, statt innerstem Mitfühlen. Die Verstimmung Wagners war so groß, daß er einen leichten Herzanfall erlitt.
Dem König, den er nun zum letzten Male gesehen hatte, mußte er in jedem Falle dankbar sein. Denn wieder war es nur die königliche Gnade gewesen, die nach langen und bangen Verhandlungen, an denen auch Cosima beteiligt war, den »Parsifal« in Bayreuth endgültig gesichert hatte. Mochte diese Gnade auf tiefem Verständnisse beruhen oder nur der Ausdruck einer persönlichen Schwärmerei und unbedingter Ergebenheit für den Künstler sein – sie kam diesem und seinen Zwecken zugute und war für ihn vielleicht noch ehrenvoller, wenn sie eben nur der Beweis einer durch keinen Zwischenfall beirrten, immer noch in sich gefestigten Freundschaft war. Ludwig, der sich zu einer Zeit, als noch kein Festspielhaus stand und noch kein »Parsifal« geschaffen war, dieses Werk für das Münchner Hoftheater vorbehalten hatte, gab es in aller Form frei und gestattete nicht nur die Aufführung in Bayreuth, sondern stellte auch das Münchner Orchester und den Münchner Chor für zwei Monate im Jahr zur Verfügung, um regelmäßig wiederkehrende Bayreuther Aufführungen unter allen Umständen zu ermöglichen. Er war auch ausdrücklich damit einverstanden, daß das »Bühnenweihfestspiel«, wie Wagner es nannte, und das dieser vor der »gemeinen Opernkarriere« bewahren wollte, nur in Bayreuth und nicht auf einer »profanen« Bühne gegeben werde. Damit hatte Wagner erreicht, was ihm am meisten am Herzen lag: die Ausnahmestellung des Werkes, das in keiner Weise mehr mit einer dem Vergnügen dienenden Luxuskunst zusammenhing, worin vielmehr »die erhabensten Mysterien des christlichen Glaubens« auf die Bühne gebracht wurden – die Geistlichen der verschiedenen Bekenntnisse haben sich lange Zeit dagegen aufgelehnt –, und das mit seinen religiösen Sinnbildern und seinen überirdischen Klängen jedes schlagende Herz in eine bessere Welt entrückte; das aber diese Macht nicht nur aus Textbuch und Partitur schöpfte, sondern auch aus der Form der Darbietung. Hier waren Bild und Klang den Sicht- und Hörverhältnissen des Festspielraumes so genau angepaßt, daß man mit demselben Rechte sagen konnte, das Werk sei für das Haus geschaffen, wie auch, das Haus sei eigens für das Werk errichtet. Damit war der Begriff der Kunst und der Lebensweihe, die von ihr ausgeht, in ungeahntem Maße verwirklicht. Und es war in jedem Sinne, ob man das Örtliche, das Persönliche oder das Ewige und Allgemeingültige in Betracht zog, die einfachste Schlußfolgerung aus den gegebenen einmaligen Voraussetzungen, daß das Geheimnis dieser künstlerischen Tat sich eben nur in dem Hause offenbaren könne, in dessen Grundstein es »für viele hundert Jahre verwahrt« ist. Die demokratisch-liberale Zeit hat das freilich nicht verstanden; die war dem geistigen Kommunismus verfallen und hätte den Kölner Dom am liebsten auf Räder gestellt, um ihn nach Petersburg oder nach Chikago zu rollen und auf den internationalen Kunstausstellungen mit ihm zu prunken. Der König aber, ob er es nun verstand oder nur begeistert guthieß – der König war damit einverstanden und segnete das Werk.
So konnte Wagner diesmal zufrieden sein. Als er nach einer Abwesenheit von zehn Monaten wieder in Bayreuth eingetroffen war, wo er nun auch den deutschen Winter mutig auf sich nahm, begannen sogleich die Vorbereitungen für den »Parsifal«. Dazu gehörte vor allem die Ausarbeitung der Partitur. Auch wurde mit den Malern Brückner aus Koburg, die nach den Entwürfen Joukowskys die Bühnenbilder herzustellen hatten, und mit Karl Brandt, dem Leiter des Maschinenwesens, in wiederholten Zusammenkünften das ganze Werk durchgesprochen.
In den gewohnten Lesestunden nahm Wagner die Bücher Gobineaus vor. Dessen Hauptwerk, der grundlegende Versuch »über die Ungleichheit der menschlichen Rassen«, war bis dahin eigentlich nur von Schopenhauer beachtet worden. Erst durch Wagner, der die ungeheure Tragweite der darin ausgesprochenen Gedanken erkannte und sich sofort hierüber in den »Bayreuther Blättern« vernehmen ließ, ist Gobineau zu hohen Ehren in Deutschland gelangt. Wagners Jünger Ludwig Schemann hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, uns das Denken und Schaffen des großen Normannen in deutscher Sprache zu vermitteln, und heute zählt Gobineau zu den Klassikern der Geschichtsbetrachtung auf Grundlage der Rassenforschung. Daß alles Unheil in der Entwicklung der Menschheit von der Vermischung der höherstehenden Rasse mit den minderwertigen komme, das hatte auch Wagner aus seiner Beschäftigung mit der Weltgeschichte entnommen, und er atmete befreit auf, als ihm in dem Werke Gobineaus die wissenschaftliche Bestätigung seiner mehr ahnungsvollen Erkenntnis entgegentrat; und daß Gobineau der indogermanischen (arischen, nordischen) Rasse als der höchststehenden und wertvollsten die Führerrolle zusprach, das bejahte die Sehnsucht des Künstlers, der seine gewaltigsten Eingebungen dem nordischen Sagenkreise und der urheimatlichen Überlieferung entnommen hatte und der damit gewissermaßen aus einer Wirklichkeit flüchtete, in der er mit Schaudern eine »germanisch-jüdische« Welt heraufkommen sah. Gobineau weissagte den Untergang des Abendlandes im Brei der Rassenvermischung – Wagner glaubte noch an die Möglichkeit einer Gesundung und hielt die Kunst, den »freundlichen Lebensheiland«, für berufen, der Menschheit das »Durchhalten« zu erleichtern, ja zu ermöglichen. Auch Gobineau war künstlerisch begabt und hat in den geschichtlichen Bildern der »Renaissance«, wie in anderen Dichtungen, seine Wahrnehmungen und Gewißheiten einprägsam gestaltet. All dies bot in Wahnfried eine reiche Quelle der Anregung, und es ergab sich von selbst, daß Gobineau eingeladen wurde, als Gast des Hauses in die unmittelbarste persönliche Verbindung mit dem Meister zu treten. An seinem Lebensabende fand so der geniale Begründer der heutigen Rassenlehre einen Geistesverwandten und echten Freund.
Bevor es zu diesem Besuche kam, der in den Mai des Jahres 1881 fiel, wohnte Wagner mit Cosima der ersten Aufführung des »Rings« in Berlin bei. Diese war ein Unternehmen Angelo Neumanns und fand im Viktoria-Theater, nicht in der Hofoper statt. Wagner war auch diesmal bemüht, bei den Proben manches Ungehörige in Ordnung zu bringen und der Darstellung den erreichbaren letzten Schliff zu geben.
Knapp vor dem Eintreffen Wagners in Berlin hatte Bülow seine als Gast der Frau von Schleinitz dort weilende Tochter Daniela – durch Vermittlung Liszts – wiedergesehen. Der Vater war tief ergriffen. Er dankte Cosima »auf den Knien« für diese herrliche Frucht der mütterlichen Erziehung. »Welches anbetungswürdige Kind!« so schrieb er ihr. »Welche Seele haben Sie gebildet! Ich kann nur weinen, wenn ich an sie denke, und ich muß unaufhörlich an sie denken. Dieser Tag des 27. April hat mich wiederaufgerichtet. Ich danke der Vorsehung dafür, daß sie mir diese unsagbare Freude vorbehalten hat. Dieses Glück, dessen Süße so groß ist, daß alles Unglück, alles Bedauern, alle Vorwürfe, die sich darein mischen, es nicht zu trüben vermögen. Sagen Sie mir, großmütige, edle Frau, welche väterlichen Pflichten hätte ich diesem geliebten Wesen gegenüber zu erfüllen, das meine Seele vollständig in einem Augenblick gewonnen hat? Ich möchte eine Kapelle bauen an der Stelle, wo Ihr Vater sie mir zugeführt hat … Dank, Dank, Dank! Ich danke Ihnen ein Glück ohnegleichen, so schmerzhaft es auch sei … Seien Sie tausendmal gesegnet, Gute, Große! Die Haltung Danielas ist bewunderungswürdig in jeder Hinsicht. Sie ist würdig ihrer Mutter!« Er schrieb aber auch an Daniela: »Mein liebes, liebliches Kind! Ohne Aufhören denke ich Dein und ohne Aufhören rinnen mir die Tränen aus den Augen vor Glück und Wehmut! Der 27. April war mir ein solcher Lichtblick, daß mich dünkt, es habe zwölf Jahre hindurch in meinem Herzen tief genachtet. Dein Wiedererscheinen in mein Leben – nur durch den Vater Deiner edlen Mutter konnte es vermittelt werden – hat für mich etwas – Auferstehungsfestliches … Lasse bald einen ersten Wunsch laut werden, den ich Dir erfüllen darf, welcher es sei; nur ihn nicht zu erfüllen würde mir schwer werden. Gottes reichsten Segen über Dein Haupt! Mit überströmendem Herzen Dein Vater – der diesen Namen sich endlich verdienen möchte.« Von nun an setzte ein lebhafter Briefwechsel Bülows mit seiner Tochter ein, und es kam auch zu wiederholten späteren Begegnungen und längerem Beisammensein, wobei sich allerdings immer mehr herausstellte, daß die künstlerischen Wege der beiden getrennt waren und daß zwischen Brahms und Liszt damals nicht leicht eine Brücke geschlagen werden konnte, selbst nicht durch Blutsverwandtschaft und treueste Zuneigung.
Bülows Töchter sollten aber auch in anderer Hinsicht der Grund zu tragischen Auseinandersetzungen sein. Wagner hatte die Absicht, sie an Kindes Statt anzunehmen, so daß nur er allein für sie zu sorgen habe, und für die Geschwister, die dann alle den gleichen Namen trugen und gewissermaßen nur einen Vater hatten, jeder Zwiespalt aus dem Leben entfernt sei. Da die Mädchen tatsächlich im Hause Wagners aufgewachsen waren, diesen »Papa« oder »Vater« nannten – nur für die Älteste, für Daniela, die zur Zeit der Trennung ihrer Eltern bereits zehn Jahre zählte, war er eine Zeitlang der »Onkel Richard« gewesen – und da sie mit Bülow bis zu seiner ersten Begegnung mit der erwachsenen Daniela fast keine Verbindung hatten, war der Gedanke Wagners sehr verständlich und würde die Verwirklichung dieses Gedankens zweifellos viel zur Beruhigung und zum Seelenfrieden im Hause Wahnfried, dem doch alle Kinder zugehörten, beigetragen haben. Es ist aber ebenso verständlich, daß Bülow an seiner Vaterschaft festhielt und daß ihm nach dem Wiederfinden Danielas die Vorstellung, sie werde seinen Namen verlieren, unerträglich war. Er sträubte sich daher auf das heftigste gegen den Wunsch Wagners, was dieser nicht ohne leidenschaftlichen Widerspruch aufnahm. Cosima war da wieder zwischen die beiden Männer gestellt und entschloß sich, mit Bülow zusammenzukommen, um ihn entweder zu überreden oder sich von seiner Unnachgiebigkeit und seinen triftigen Gründen zu überzeugen. Die Zusammenkunft fand in Nürnberg statt. Daniela weilte damals in Weimar beim Großvater und kam mit Bülow von dort herüber. Sie empfing ihre Mutter auf dem Nürnberger Bahnhofe und berichtete sofort über den abermals sehr ungünstigen Gesundheitszustand ihres Vaters. Eigentlich war er ja niemals vollkommen gesund, die Zeiten größerer Heiterkeit und innerer Freiheit waren bei ihm stets nur vorübergehende Erleichterungen. In zwei stundenlangen fruchtlosen Unterredungen suchte Cosima Bülow dahin zu bringen, daß er seine Töchter in aller Form dem Hause Wagners, mit dem sie so eng verwachsen waren, überantworte. Doch es war vergebens. Dabei handelte es sich vor allem um Daniela, die ihrem Vater jetzt so nahe stand, der er aber Mißtrauen und Groll entgegenbrachte, wenn sie sich für Wagner entscheiden wollte. Als Cosima mit Daniela heimfuhr, brachte sie zwar ein sehr schweres Herz mit, aber auch die unerschütterliche und von neuem gefestigte Überzeugung, daß sie und ihre Kinder nur nach Bayreuth gehören. Von Hans schrieb sie, er wisse selbst nicht, »ob weiß schwarz, ob schwarz weiß sei … Er hat gar keinen Leitstern mehr, ein nervöses Zucken überfällt ihn … Alles ist traurig, was ich zu berichten habe, und dennoch kommt das heimische Gefühl über uns und wir können es ohne Krämpfe besprechen, doch ist eines uns klar, daß ich nur mit ihm« (mit Wagner) »und den Kindern sein kann, daß aller andere Verkehr mit Fremden und mit Freunden eine Prüfung und ein Unrecht ist! Als ob ein neues Leben für mich begänne, trete ich nach dieser Begegnung wieder in das Haus ein, ohne Trost und doch mit Frieden, einzig durch sein Glück beglückt und tief im Herzen das Bewußtsein einer unsühnbaren Schuld. Das eine zu genießen, das andere nie zu vergessen, dazu helfe mir Gott!«
Wenn Cosima dennoch fortwährend mit Fremden und mit Freunden zu verkehren hatte, wie beispielsweise in Berlin, wo sie mit ihrem Manne noch die vierte Aufführung des »Ringes« mitmachte, so war sie stets die alles Herkömmliche und Gesellschaftliche aus dem Handgelenk beherrschende große Dame, die den kleinsten Verbindlichkeiten den Schimmer feinsten Glanzes verlieh und niemanden ahnen ließ, daß ihr das alles gleichgültig oder unangenehm war. Im übrigen blieb dieses Jahr 1881, mit Ausnahme eines kurzen Ausfluges nach Dresden und Leipzig, der Arbeit am »Parsifal« gewidmet. Der Winter war für Wagner günstiger gewesen, als er befürchtet hatte: man war, wie Cosima an Lenbach schrieb, diesmal weniger »unter dem Regenschirm« gegangen als sonst, man hatte Licht und blauen Himmel gehabt, und jetzt freute man sich des Sommers, der zugleich die Ferienzeit der für das nächste Jahr gewonnenen Künstler war. Diese gingen jetzt in Wahnfried ein und aus, es begann das Studium, und die Proben kamen in Gang. Das Befinden Wagners war trotz der besseren Jahreszeit immer sehr schwankend. Seine Anfälle häuften sich; auch in Berlin war ihm, als er sich nach der letzten Vorstellung, der er beiwohnte, den Zuhörern zeigen sollte, sehr schlecht geworden; einmal hatte er einen so schrecklichen Krampf, daß Cosima darüber in Ohnmacht fiel. Es war selbstverständlich, daß der nächste Winter im Süden verbracht wurde.
Zu den Aufregungen des Meisters gehörte nun aber auch der Ärger und Kummer, der an die Mitwirkung des Münchner Orchesters bei den »Parsifal«-Vorstellungen geknüpft war. Der ständige Dirigent und oberste Leiter dieses Orchesters war der Generalmusikdirektor Hermann Levi. Es wäre nicht nur eine persönliche Kränkung für diesen, sondern höchstwahrscheinlich auch eine Beleidigung des Königs gewesen und hätte schließlich die Abmachungen für den »Parsifal« von neuem in Frage stellen können, wenn Wagner Levi abgelehnt oder in betreff der Dirigentenfrage irgendwelche Bedingungen gestellt hätte. Levi selbst, der an seinem Judentume litt, den Schranken einer jüdisch-konfessionellen Weltanschauung zu entrinnen suchte und sich zwischen Freigeisterei und ausgesprochen christlichen Neigungen hin und her bewegte, der nun aber auch darüber unterrichtet war, daß die Beachtung und Bewertung der Rasse in der Gedankenwelt des Meisters immer mehr in den Vordergrund trat – Levi selbst empfand es als ungehörig, daß er den »Parsifal« dirigieren solle, und sträubte sich gegen seine Berufung. Wagner hingegen wollte sich in diesem Falle ebenso »human« und »teilnehmend« zeigen wie gegenüber Joseph Rubinstein. Er unterschied zwischen der Rasse und der Persönlichkeit und hoffte einen segensreichen Einfluß auf den vorzüglichen Dirigenten zu gewinnen. Als die Sache zwischen beiden schon geordnet war, kam das Schreiben eines Ungenannten, der ihr gegenseitiges achtungsvolles Verhältnis in ein übles Licht zu rücken suchte und dabei auch die Ehre Cosimas nicht schonte. Doch dieses Schreiben verfehlte seinen Zweck. Anfeindungen, Verdächtigungen und Herabwürdigungen gegenüber blieb Wagner stets unerschütterlich. So geschah es, daß, wie Cosima einmal mit gutem Humor bemerkte, nach dem unerforschlichen Ratschlusse des Allerhöchsten ein Rabbinersohn den »Parsifal« aus der Taufe hob. Das Werk hatte darunter nicht zu leiden: Levi war eifrigst bestrebt, alle Wünsche und Weisungen des Meisters tadellos zu erfüllen; die Verwandlungsfähigkeit und das Anpassungsvermögen seiner Rasse setzten ihn, bei der vorhandenen Begabung und Schulung, in den Stand, sich das Werk, das ihm am fremdesten sein mußte, äußerlich vollkommen anzueignen; durch ihn, der noch viele Jahre in Bayreuth mitarbeitete, sind die Zeitmaße und der rechte Vortrag für den »Parsifal« so genau festgestellt worden, daß nicht leicht davon abgewichen werden konnte. Aber persönlich hatten der Meister und besonders Cosima, die ihn gleichsam als Vermächtnis übernahm, mit ihm »große Not«, just so wie mit Rubinstein; nur daß sich der Umgang und der Gedankenaustausch mit Levi auf einer höheren Ebene und in glätteren Formen abspielte.
Im Herbst gab es den schon unentbehrlich und selbstverständlich gewordenen Besuch Liszts. Dieser fuhr hierauf mit seiner Enkelin Daniela nach Rom. Wagners aber reisten nach Palermo, wo sie den ganzen Winter zubrachten und sich auch mit Daniela vereinten. Erst im Mai des nächsten Jahres waren sie wieder zu Hause. Die bedeutenden Kosten dieses dritten italienischen Aufenthaltes waren dem Meister durch die hohen Einnahmen ermöglicht worden, die er jetzt den vielen Aufführungen Angelo Neumanns zu verdanken hatte. Die rüstig fortschreitende Vollendung der Partitur und der niemals aussetzende briefliche Verkehr mit seinen Künstlern und Mitarbeitern nahmen ihn auch in Palermo, zuerst im Hotel des Palmes, dann in der Villa Porazzi, lebhaft in Anspruch. Nicht minder aber beschäftigte ihn das sizilianische Volksleben und erfreute er sich an der herrlichen Natur wie an den bedeutenden Denkmälern antiker und mittelalterlicher Vergangenheit. Über seine Eindrücke hat er auch dem König, mit dem er noch immer in einem, allerdings recht einseitigen Briefwechsel stand, ausführlich und anschaulich berichtet. So schwer es Wagner bereits geworden war, immer den Ton festzuhalten, den Ludwig wünschte und brauchte, so sehr er diese künstlich gesteigerte Sprache eigentlich schon als Lüge empfand, die natürliche warme Zuneigung und die sich nie genügende Dankbarkeit für alles, was Ludwig an ihm getan hatte, verlieh den Briefen Wagners an seinen erhabenen Freund bis zuletzt das herzlichste Gepräge. Rückschauend bis zu den ersten Tagen dieses seltenen Bundes fand er auch die tiefsten Worte über das Wesen der Freundschaft und den Segen der »vollen Liebe«. Und in diesem Zusammenhange nannte er wieder den »Ersten, der ihn der Welt verkündigt«: seinen Liszt!
Wie immer, waren die besten Bücher seine treuesten Begleiter, und wie in Bayreuth, so waren im fernen Süden Shakespeare, Calderon und Cervantes, dann E. T. A. Hoffmann und viele andere, nicht zuletzt Gobineau, die unentbehrlichen Gesellschafter in den häuslichen Feierstunden. Während dieses Aufenthaltes, der zuletzt noch mit mannigfachen Ausflügen durch Sizilien und mit einem abschließenden Verweilen in Acireale am Fuße des Ätna verbunden war, ist einmal der junge Siegfried schwer erkrankt, aber auch, gepflegt von der Mutter, vollkommen genesen. Ein freudiges und doch wehmütig stimmendes Ereignis war die Verlobung Blandinens von Bülow mit dem Grafen Biagio Gravina, einem zur Aristokratie Palermos zählenden italienischen Marineoffizier von altnormannischer Abstammung. Knapp vorher hatte sich Hans von Bülow, der jetzt Hofkapellmeister in Meiningen war, mit der von ihm verehrten Schauspielerin Marie Schanzer verlobt und damit den Halt gefunden, den er brauchte, wodurch aber der Beistand Danielas, den Cosima so sehr gewünscht hatte, für ihn entbehrlich wurde. Im nächsten Sommer vermählte er sich.
Das Jahr 1882 brachte einen zweiten Besuch Gobineaus in Wahnfried, eine besonders schöne Geburtstagsfeier, bei der der König sich nicht nur mit einem Glückwunsche, sondern auch mit kostbaren und sinnigen Geschenken einstellte, und die nun außerordentlich anstrengenden, aber auch in hohem Maße befriedigenden Proben zum »Parsifal«. Es ging diesmal alles mit einer Raschheit und Bestimmtheit, wie wenn Wagner das Gefühl gehabt hätte, daß es sich um seine letzte und höchste Kraftanstrengung handle. Am 2. Juli fand die erste Orchesterprobe statt, am 26. Juli vollzog sich zum ersten Male das Wunder des »Parsifal« in Bayreuth. Die sechzehn Aufführungen waren so gut besucht und machten einen so tiefen Eindruck, von dem ganz Deutschland widerhallte, daß sogleich die Wiederholung für das Jahr 1883 beschlossen wurde.
Der König war nicht erschienen. Mehr denn je scheute, ja fürchtete er die Berührung mit der Öffentlichkeit, und der bloße Gedanke, daß er, seinen königlichen Pflichten gemäß, den Besuch der Festspiele mit dem einer Ausstellung im nahen Nürnberg würde verbinden müssen, hielt ihn davon ab, den »Parsifal« in Bayreuth zu erleben. Das Werk – das er von Bayreuth zu trennen vermochte – hat er später in München in »Separatvorstellungen« auf sich wirken lassen. Es ist ein beklemmender Gedanke: der König ganz allein im finsteren Opernhause, als einziger Zeuge einer naturgemäß doch nicht völlig gelingenden, jedenfalls der entscheidenden letzten Wirkungen beraubten Darbietung jenes Werkes, nach dessen Helden er selbst den Namen trug, mit dem seine dankbaren Freunde ihn vertraulich ehrten. Parcival, so hieß der König, wenn von ihm in München, Triebschen und Bayreuth, noch vor dem Werden des »Parsifal«, gesprochen wurde. Aber es war nur ein Name. Ludwig war nicht der Gralskönig, der sich und anderen das Heil brachte. Einsam und düster saß er in der Königsloge und verging endlich in hehren Träumen, vor deren Verwirklichung er zurückschrak.
Bei dem Festmahle nach der Hauptprobe dankte Wagner wie im Jahre 1876 dem König, den Künstlern und – Franz Liszt. »Als ich«, so sprach er, »schon ganz aufgegeben war, da ist Liszt gekommen und hat von innen heraus ein tiefes Verständnis für mich und mein Schaffen gezeigt. Er hat dieses Schaffen gefördert, er hat mich gestützt, erhoben wie kein anderer. Er ist das Band gewesen zwischen der Welt, die in mir lebte, und jener Welt da draußen.«
Bei der letzten Aufführung des »Parsifal« kam Wagner erst zum zweiten Aufzuge, währenddessen er hinter den Kulissen verweilte und die Auftretenden ungemein befeuerte. Nach der ersten Hälfte des dritten Aufzuges begab er sich ins Orchester und ergriff dort mitten im Spiele den Taktstock, zunächst nur mit Rücksicht auf Levi, der sich an diesem Tage nicht wohlfühlte. Wagner dirigierte nun weiter bis zum Schlusse, mit einer Wucht und Weihe, einer Innigkeit und Verklärung, die sich allen unvergeßlich mitteilte. Die Zuschauer wußten nicht, daß der Meister dirigiere, aber sie waren vom Erlebnisse des »Parsifal« stärker berührt, tiefer gepackt denn je. Es war der Abschied Wagners von der Welt.
Schon während der Festspiele, am 25. August, also am Geburtstage des Königs und an Wagners Hochzeitstage, hatte die Vermählung Blandinens mit dem Grafen Gravina in Bayreuth stattgefunden, unter großer Beteiligung der Stadt und zahlreicher Freunde und Gäste, unter denen niemand fehlte, der sich zu den Getreuesten zählen durfte. Der standesamtlichen Trauung folgte am nächsten Tage die kirchliche in der katholischen Hofkirche. Diese war notwendig, da sonst die Ehe in Italien keine Gültigkeit gehabt hätte. Da jedoch Blandine, ihrer Mutter folgend, Protestantin geworden war, beanspruchte auch der evangelische Pfarrer sein Recht, und Cosima hatte wieder zu vermitteln und zu schlichten und aufgeregte Gemüter zu beruhigen.

Richard Wagner am Teetisch mit Cosima Wagner,
Daniela und Blandine von Bülow, Heinrich von Stein und Paul von Joukowsky (1882).
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth. Photo A. v. Groß
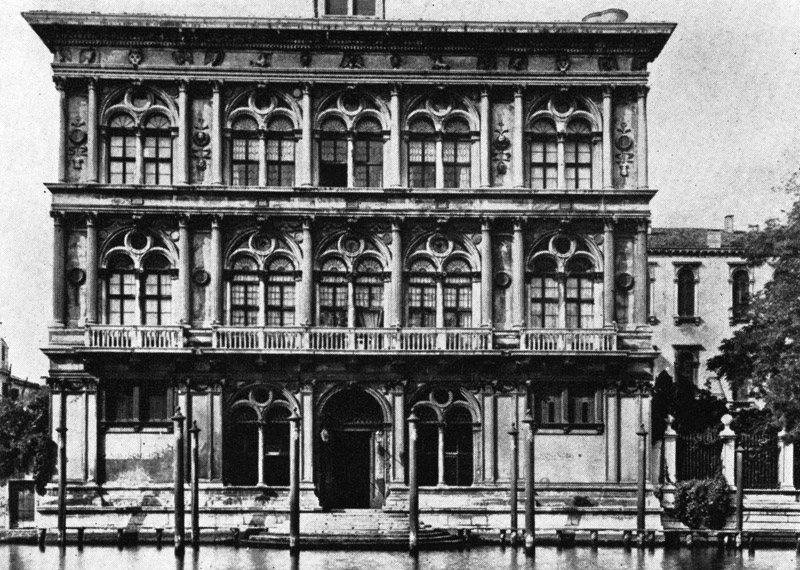
Palazzo Vendramin, das Sterbehaus Wagners in Venedig.
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth

Hans Richter.
Städt. Verkehrsamt Bayreuth. Photo Müller
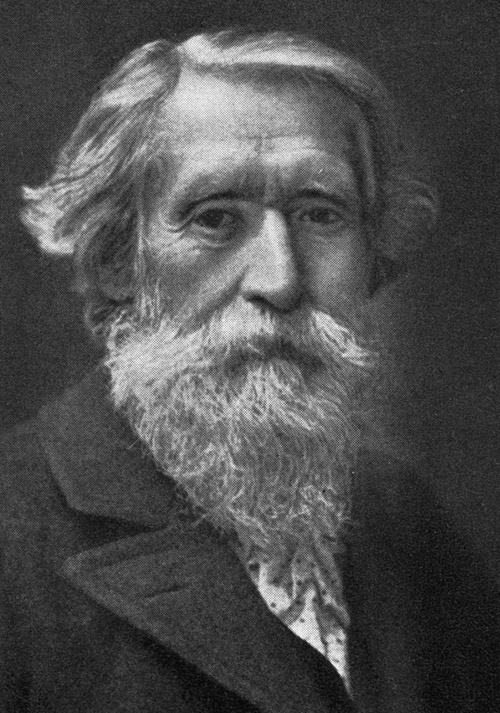
Karl Klindworth.
Max Hesse Verlag, Berlin

Felix Mottl.
Städt.Verkehrsamt Bayreuth

Karl Muck.
Aufnahme von Frau Sophie Bergmann-Küchler Frankfurt a. Main
Vierzehn Tage später fuhren Wagners nach Venedig. Der Abschied von Bayreuth und namentlich von den Hunden fiel dem Meister diesmal besonders schwer. Der ihm grenzenlos anhängliche Neufundländer Marke schien sich den Abschied auch sehr zu Herzen zu nehmen. In Venedig bezogen sie eine im Halbstock gelegene Wohnung im Palazzo Vendramin mit Ausblick auf den Canale Grande und auf einen in Venedig als Seltenheit zu wertenden grünen Garten. Die allerdings aus vielen, aber nicht durchweg geräumigen und bequemen Zimmern bestehende Unterkunft war im Verhältnis zu Wahnfried ziemlich beschränkt zu nennen. »Unsere Etage hier ist sehr bescheiden«, schrieb Cosima an Lenbach, »aber es ist das Eckchen in einem stolzesten Haus und dadurch ungemein vornehm. Mir ist auch die Bevölkerung angenehm und nicht einen Ausgang macht man, ohne etwas Schönem oder Lebensvollem zu begegnen und ohne die Möglichkeit zu haben, das Erhabene zu besuchen.« Später schrieb sie ihm, sie befänden sich in dem ihnen zugewiesenen Teile des großen Palastes »ganz traulich ungefähr wie das Hündchen im Löwenzwinger«. Auch Wagner hatte Freude an Venedig und schenkte auf seinen Spaziergängen, die er besonders gern mit dem Sohne unternahm, sowohl dem Straßenleben als auch dem »Erhabenen«, den Kirchen und Sammlungen, wärmste Beachtung. Siegfried hatte jetzt einen Lehrer namens Hausburg, einen Musiker, der als solcher schon bei Veranstaltungen in Wahnfried mitgewirkt hatte, dessen erzieherische Tätigkeit aber nicht sonderlich zu werten war. Stein selbst hatte ihn empfohlen und kam nun auch zu Besuch nach Venedig.
Von den anderen Besuchern, zu denen beispielsweise das Ehepaar Schleinitz gehörte, sei nur noch der junge Kunstforscher Dr. Henry Thode genannt. Zufällig fiel seine erste Bekanntschaft mit dem Meister auf den 12. Oktober, also den zweiundzwanzigsten Geburtstag Danielas, mit der er schon früher bekannt geworden war, die ihm aber jetzt erst Gelegenheit zu einem längeren Gespräche bot. Wagner fand Gefallen an ihm und sagte später: »Das wäre ein Mann für Daniela.« Er sang ihm auch einiges aus dem »Ring« vor, so Hagens Wacht (für Baß) und Brünnhildens Abschied (für Sopran), und zwar, wie uns Thode berichtet hat, eigentlich ohne Stimme, mehr deklamierend als singend, aber mit einer Leidenschaft und einer Wirkung, der sich niemand entziehen konnte.
Am meisten waren Wagners durch den Besuch der Jungvermählten erfreut, die auf ihrer Hochzeitsreise nach Venedig kamen und einen ganzen Monat dort blieben. Eben als sie sich verabschieden sollten, war eine Trauernachricht eingelangt. Graf Gobineau war plötzlich gestorben. Der Verlust wurde von Wagner schmerzlichst empfunden, und Cosima widmete dem Geschiedenen ein »Erinnerungsbild aus Wahnfried«, von dem ihr Mann meinte, so etwas habe nur eine Frau schreiben können, und wenn es ein Mann zustande brächte, so sei es eben das weibliche in ihm, dem so etwas gelingen konnte. »Über das Weibliche im Menschlichen« – so hieß auch ein Aufsatz, den Wagner in Bayreuth begonnen hatte und in Venedig vollenden wollte. Das »Erinnerungsbild« Cosimas aber erschien in den »Bayreuther Blättern« ohne Verfassernamen. Wiederholt hat Cosima dem Freunde Wolzogen die wertvollsten Beiträge geliefert, doch kein Leser wußte noch erriet – lange Zeit hindurch –, daß sie von ihrer Hand seien. Sie war, wie in den ersten Zeiten ihrer Mitarbeit an der Revue Germanique, ohne jeden literarischen Ehrgeiz. Sie wollte immer nur einen Zweck erreichen oder einer Sache dienen, wenn sie zur Feder griff oder diktierte.
Einige Wochen später traf Liszt ein. Auch dieser war mit Gobineau bekannt gewesen und schrieb über seinen Tod an die Fürstin, die er auf den bevorstehenden Nachruf Cosimas, ohne diese zu verraten, aufmerksam machte. Um dieselbe Zeit hätte er Emil Ollivier zur Geburt eines Kindes aus zweiter Ehe beglückwünschen sollen. Aber auf Glückwünsche und Beileidskundgebungen ließ sich Liszt nicht gern ein. »Sie wissen«, heißt es in dem Briefe an die Fürstin, »was für traurige Gefühle mir die Kinder einflößen – ihre Zukunft ist so vielen widersprechenden Wechselfällen ausgesetzt! Das menschliche Dasein ist so voll Bitternis und Enttäuschung, daß ich kaum imstande bin, mich daran zu erfreuen, wenn wiederum ein kleines Wesen auf die Welt kommt, das all unseren Schwächen, unserem Unglück und unserer Torheit unterworfen ist. Andererseits betrübe ich mich nicht zu sehr über das Hinscheiden derjenigen, die ich gekannt habe. Ich finde ihr Los sogar beneidenswert – denn sie haben das harte Joch des Lebens und der damit gegebenen Verantwortung nicht mehr zu tragen. Das einzige von mir bewahrte tätige und lebhafte Gefühl ist das des Mitleidens – mit den heftigen Schwingungen der menschlichen Leiden. Manchmal, in kurzen Augenblicken, empfinde ich die der Kranken in den Hospitälern, der Verwundeten im Kriege, und selbst die der Gemarterten und der zum Tod Verurteilten. Das ist etwas den Wundmalen des heiligen Franz zu Vergleichendes – bis auf die Ekstase, die nur den Heiligen zukommt. Dieses seltsame Übermaß des Mitleidens ist mir seit meinem sechzehnten Jahre eigen.«
So war Liszt zur selben Zeit, da er im Familienkreise Wagners sorglose und heitere Stunden verlebte und an seinen Enkeln ungetrübte Freude hatte, dennoch ganz versponnen in die tiefernste Weltbetrachtung, die ihn schon in der Jugend beherrscht, die kein Triumph des Gefeierten und Vergötterten jemals verdrängt und die das Ungemach seines Lebens, die Enttäuschung und Vereinsamung seines Alters nur noch verstärkt hatte. Wenn Wagner dem Freunde vorwarf, daß er sich zu sehr in der »großen Welt« bewege und dabei an Unwürdige verschwende, so konnte er vielleicht nicht völlig nachfühlen, wie sehr Liszt der Zerstreuung, der Ablenkung und gewisser weltlicher Ehren und äußeren Genugtuungen bedurfte, um das Dasein ertragen und vor sich rechtfertigen zu können. Auch in Venedig wich die Trauer aus seiner Seele nicht. Im schrankenlosen Gefühl des Mitleidens begegnete er sich mit Wagner. Der Brief an die Fürstin scheint der Widerhall von Gesprächen zu sein, an die auch ein Weihnachtsgeschenk anknüpfte. Liszt fand auf dem Gabentisch unter anderem ein schönes Bild, das seinen die Wundmale empfangenden Schutzheiligen Franz von Assisi darstellte; denselben Heiligen, dessen ungeheure Bedeutung für die Entwicklung der europäischen bildenden Kunst der junge Thode soeben in einem aufsehenerregenden Buche behandelt hatte. Darunter hatte Wagner die Verse geschrieben:
»Nicht läßt sich Gott von Angesichte gleichen,
nicht an Gewalt, noch Welten-Pracht und Glanz;
sieh dort des Wundenmales göttlich Zeichen,
durch das dem Herrn sich glich der heil'ge Franz!
Noch so beredt, nicht mehr aus seinem Munde,
zur Welt spricht Gott durch seines Heil'gen Wunde.«
Das Leid, das keinem Menschen erspart bleibt, und die Tragik aller Großen, von denen keiner ohne Wunde durchs Leben schreitet, hatte Wagner tief an sich erfahren. Aber auf der Höhe seines Lebens und im Kreise der Seinen empfand er noch tiefer das Glück des Daseins – und beglückt, beseligt war er inmitten der Verhängnisse, die ihn von je bedrohten, durch sein Schaffen, durch die aufbauende Kraft, die in seinem Busen wohnte und zugleich die Welt bewegte. Wie sehr unterschied er sich dadurch von Liszt, der nach allem, was wir aus seinen Worten und Briefen erraten können, auch im Schaffen keine restlose Befriedigung fand, auch durch seine Werke nie bis zur Selbstvergessenheit über sich hinausgehoben wurde. In Venedig, wo die volle, uneingeschränkte Häuslichkeit Wahnfrieds ersetzt war durch ein Zusammenleben, dessen Formen von mannigfachen Rücksichten auf die äußeren Verhältnisse und eine fremde Umgebung bestimmt wurden – hier kamen die Gegensätze noch stärker zum Ausdrucke als sonst. Auch die Eifersucht Wagners machte sich immer wieder geltend. Aber man kann sagen, daß die Freude überwog und daß die Weihnachtsfeier in Venedig eben durch die Anwesenheit Liszts sich besonders schön gestaltete. Immerhin, als Liszt am 13. Januar sich verabschiedete, nachdem Wagner ihn umsonst zu überreden gesucht hatte, doch ein für allemal ganz bei ihm und in seinem Hause zu bleiben, da konnte der Meister nicht umhin, mit heiterem Bedauern zu sagen: »Diesmal haben wir uns gegenseitig geniert.«
Für Cosima, deren Geburtstag auf den Weihnachtstag fiel, hatte sich Wagner eine besondere Überraschung ausgedacht, die er freilich nur ihr selbst zu verdanken hatte. Unablässig war sie bemüht, seine von ihm verstreuten Drucke und Handschriften zu sammeln. König Ludwig hatte dazu in der ersten Münchner Zeit den Anstoß gegeben, als er alles kennenzulernen wünschte, was der Meister geschrieben. Cosima hatte die Aufgabe übernommen, diesem Wunsche zu genügen, und Frau Mathilde Wesendonck dadurch verstimmt, daß sie die Entwürfe und Aufsätze von ihr verlangte, die Wagner in Zürich zurückgelassen. Doch der Wunsch des Königs wurde bald zu dem Cosimas. Wenn wir heute in dem von Dr. Otto Strobel so treu behüteten, so sorgsam verwalteten und so fleißig und geschickt verwerteten Archive Wahnfrieds fast alle überhaupt vorhandenen Aufzeichnungen Wagners beisammenfinden und die Entstehung fast aller seiner Werke sozusagen von ihrem ersten Einfall bis zur druckreifen Niederschrift verfolgen können, so verdanken wir dies dem Sammeleifer Cosimas, mit dem allein schon sie ihrem Manne ein Denkmal gesetzt hat. Als Wagner bei seiner Geburtstagsfeier im Jahre 1873 von seiner verschollenen Jugendsinfonie in C-Dur gesprochen hatte, ließ sie allenthalben danach forschen. So erfuhr sie von einem Koffer mit Musikalien, den Wagner in Dresden zurückgelassen und den Tichatschek an sich genommen hatte. Darin fanden sich die Orchesterstimmen der Sinfonie, mit denen nun Cosima ihren Mann erfreuen konnte. Dieser aber ließ heimlich durch Anton Seidl aus den Stimmen eine neue Partitur zusammensetzen, und mit dem Orchester des venezianischen Musikkonservatoriums brachte er das Werk seiner Frau und wenigen Freunden im hierfür gemieteten Teatro Fenice zweimal zu Gehör. Ihm selbst gab dies Anlaß zu nachdenklichen Betrachtungen über seine eigene Entwicklung und über die der sinfonischen Kunst.
Mit schwerer Sorge erfüllte ihn dann und wann der Gedanke an die Zukunft der Festspiele. Nicht so sehr wegen ihres äußeren Bestandes als wegen des Mangels eines geeigneten Nachfolgers. »Ich bin nun siebzig Jahre alt geworden«, so schrieb er an Hans von Wolzogen, »und kann nicht einen einzigen Menschen bezeichnen, der in meinem Sinne irgendeinem der bei solch einer Aufführung Beteiligten, sei es den Sängern, dem Orchesterdirigenten, dem Regisseur, dem Maschinisten, dem Dekorateur oder dem Kostümier, das Richtige sagen könnte. Ja, ich weiß fast keinen, der nur auch im Urteil über Gelungenes oder Nichtgelungenes mit mir zusammenträfe, so daß ich mich auf das seinige verlassen könnte.« Fast wörtlich gleichlautend hatte er schon einmal an den König geschrieben. Cosima war nur die Zuhörende und Bejahende, deren Meinung allerdings fast immer mit der seinen übereinstimmte, die sich aber nie vermaß, die ihre selbständig geltend zu machen, und der er, auch wenn er sich auf ihr Urteil verlassen mochte, doch nicht die Fähigkeit zutraute oder das schwere Amt zumutete, selbst bestimmend in die Festspiele einzugreifen. Wenn Wagner einen solchen Brief schrieb wie den an Wolzogen, wenn er seine Befürchtungen mündlich aussprach, dann haftete jedes Wort in ihrer Seele. Aber sie teilte nur seine Sorge, ohne ihn ermutigen zu können. Sie hat sich selbst noch gar nicht als seine Nachfolgerin gefühlt. Sie dachte nie daran, daß sie ihn überleben würde. Und sie dachte auch an kein jähes Ende. Die namenlose Angst, die sie manchmal befiel, wenn Wagner sich krank fühlte, wich doch immer wieder dem erhabenen Bewußtsein der engsten Zusammengehörigkeit und eines von außen nicht zu störenden tiefinneren Glückes, das sich in gegenseitigen Liebesbeteuerungen nicht ersättigen konnte.
Wenn etwas als Alterserscheinung bei Wagner ausgelegt werden konnte, so war es nur die allmählich eintretende Beruhigung seines leicht erregbaren Gemütes und seine noch zunehmende Fähigkeit, die Gedanken anderer zu erraten, den Herzen und den Dingen auf den Grund zu sehen.
Am 12. Februar 1883 war er besonders mild und heiter aufgelegt. Ehe er zur Ruhe ging, spielte er eine in Palermo erfundene, für Cosima bestimmte Melodie, das sogenannte Porazzi-Thema, dann noch ein paar ganz neue, soeben erfundene Takte, und in Gedankenverbindung mit dem früher gelesenen Fouquéschen Märchen »Undine« die Klage der Rheintöchter: »Traulich und treu ist's nur in der Tiefe: falsch und feig ist, was dort oben sich freut!« Er sprach dann von den Undinen, den Wassermädchen: »Ich bin ihnen gut, diesen Wesen der Tiefe, diesen sehnsüchtigen.« – »Wärst du auch eine solche?« fragte er seine Frau. Als er schon allein war, sprach er noch mit sich selbst, wie wenn er dichtete.
An diesem Abende sagte er auch das geheimnisvolle Wort: »Alle fünftausend Jahre glückt es.«
Am nächsten Morgen, am 13. Februar, meinte er zu seinem Diener: »Heute muß ich mich in acht nehmen.« Als Joukowsky, der damals auch in Venedig weilte und den täglichen Umgang des Meisters genoß, gegen zwei Uhr zum gewohnten Mittagessen in den Palazzo Vendramin kam, fand er Cosima am Klavier. Sie spielte ihrem Sohne Schuberts »Lob der Tränen« vor und weinte dabei vor Rührung. Als es Essenszeit war, meldete der Diener, daß Wagner sich nicht ganz wohl fühle und die anderen bitten lasse, ruhig anzufangen. Cosima sah noch bei ihrem Manne nach und kehrte bald wieder zurück, da Wagner seinen Anfall, wie er es gewohnt war, allein zu bewältigen suchte und sie ausdrücklich bat, ihn wieder zu verlassen. Sie befahl jedoch ihre Dienerin in den Nebenraum und ging dann zu Tisch. Plötzlich ließ Wagner heftig zweimal hintereinander seine Glocke tönen, und die Dienerin stürzte herein: »Die gnädige Frau möchten gleich zum Herrn kommen.« Wagner hatte auch nach dem Arzte verlangt. Als Dr. Keppler kam, war es bereits zu spät. Ein übermächtiger Krampf, dem der Leidende nicht mehr zu trotzen vermochte, hatte sein Herz zum Stillstand gebracht. Mit einem letzten gütigen Blick auf Cosima entschlummerte er in ihren Armen.
Die anderen saßen noch bei Tisch, waren durch das Erscheinen des Arztes völlig beruhigt und überlegten, ob sie den von Wagner geplanten Ausflug – die bestellten Gondeln standen schon vor dem Hause – auch ohne ihn und Cosima unternehmen sollten. Daniela ließ den Arzt bitten, er möge noch herüberkommen. Da trat der Diener ein und meldete den Tod des Herrn. In wortloser Betäubung lag Cosima zu Füßen des Verblichenen, dessen Knie sie umklammert hielt.
Eine Woche später schrieb Joukowsky an Liszt: »Ich kann Ihnen, teurer Meister, keinen Bericht über die letzten in Venedig verbrachten Tage geben; unsere Gefühle teilten sich nur zwischen unserem Schmerz und der äußersten Befürchtung, auch Ihre Frau Tochter zu verlieren.«