
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Das Zusammensein mit dem geliebten Vater, der so selten gegenwärtig war und aus der Ferne meist nur strenge Aufsicht übte, war eine glückliche Ferienzeit, ein Ausruhen, Atemholen und Kräftesammeln vor dem Eintritt in ein neues Leben gewesen.
Mit kaum achtzehn Jahren kam Cosima von Paris nach Berlin. Die Katholikin zu Protestanten, die Französin zu Norddeutschen. Aus der alten, reichen, von einer glänzenden Überlieferung getragenen, von dem völkischen und staatlichen Empfinden des ganzen Landes durchpulsten Weltstadt kam sie in die noch junge, aber kräftig aufblühende Hauptstadt Preußens; kam sie, pariserisch gesehen, in eine deutsche Kleinstadt, in eine große, weiträumige Kleinstadt, in der aber die stolzesten Gebäude noch in ärmlicher Umgebung standen und in der eine gewisse Enge des geistigen Lebens, eine gewisse Beschränktheit in den öffentlichen Dingen, eine gewisse Dürftigkeit und Unbehilflichkeit des geselligen Lebens zu spüren war. Ein Feuergeist wie Hans von Bülow hatte schwer genug darunter zu leiden. Die Pariser Gesellschaft, innerlich bis zur Freigeisterei erhaben über geistige und sittliche Schranken, die sie allerdings nicht immer richtig einzuschätzen wußte, bewegte sich in herkömmlichen eindrucksvollen Formen, die die bedrohlichsten Gegensätze wenigstens scheinbar ausglichen und den schwierigsten menschlichen Beziehungen einen äußeren Schliff verliehen, der dem Zusammenleben förderlich war. Doch das, was man in Paris Gesellschaft nannte, war in Berlin eigentlich nicht vorhanden. Hier herrschten seit den Tagen Friedrichs des Großen der Soldat und der Bürger; beide von einem gesunden deutschen Gefühle durchdrungen, beide eingezwängt in Vorurteile und Sondermeinungen, die den Außenstehenden zuweilen recht merkwürdig berührten. Das preußische Heer pflegte ruhmvolle Erinnerungen, rüstete in aller Stille zu künftigen Großtaten und nährte in sich den Kastengeist; auch die Berliner Patrizier waren gleichsam eine Kaste für sich, und die Kreise, die sich da im Tiergartenviertel zusammenschlossen, trugen zwar ein vornehmes, aber durch einen beinahe schwerfälligen Ernst gebundenes Gepräge. Die namhaftesten Vertreter der Künste und Wissenschaften bildeten einen unentbehrlichen Schmuck dieser Geselligkeit, und das Fachwissen war auch bei den Laien groß. Das Liebhabertum entartete eher zur Fachsimpelei, als daß es bloß spielerisch und oberflächlich gewesen wäre. Doch es fehlte der weite Blick und die persönliche Lebhaftigkeit der Pariser Salons, von denen Wagner in seinen späteren Jahren rückschauend sagte: in ihnen sei die Blüte der geistig Tätigen vereinigt gewesen und von dieser Gemeinschaft seien die fruchtbarsten Anregungen ausgegangen, die es wohl begreiflich machen, daß Liszt für eine solche von ihm gedachte Hörerschaft seine Dante-Sinfonie und seine Faust-Sinfonie entwerfen konnte, ohne kleinliche Mißverständnisse zu befürchten; »wenngleich es der über Zeit und Raum weit hinausliegenden Natur des Lisztschen Genius bedurfte, um ihm ein ewiges Werk abzugewinnen, möge dieses Ewige vorläufig auch in Leipzig und Berlin übel ankommen«. Cosima war dazu verurteilt, den Berliner Niederlagen Lisztscher Werke beizuwohnen.
Freilich, auch in Berlin lockerten sich die starren Bindungen und verwischten sich allmählich die Grenzen. Liberalismus, Demokratie und Sozialdemokratie mit ihren jüdischen Führern und Mitläufern durchdrangen nicht nur die Politik und das Wirtschaftsleben, sondern eroberten sich auch eine gesellschaftliche Stellung. Cosima mußte da vielfach umlernen. Anschauungen, die in Paris seit einem halben Jahrhundert Gemeingut waren, wurden ihr hier als jüngste Erkenntnis gepriesen, Forderungen, die in den höheren Schichten der Pariser Bevölkerung noch niemand zu stellen wagte, waren hier schon Schlagworte der Gebildeten.
Einen Nachteil des Pariser Lebens, daß es die Mädchen streng von allem abschloß und die Unvorbereiteten mit dem Tage der Hochzeit kopfüber in ein aufgeklärtes und leichtsinniges Dasein stürzte, diesen Nachteil hatte Cosima am wenigsten empfunden. So streng sie von Madame Patersi erzogen wurde – im Verkehre mit ihrer Mutter und mit der Lebensfreundin ihres Vaters hatte sie das freieste Gehaben bedeutender Frauen kennengelernt, im Umgang mit Liszt, Wagner und Berlioz wurde sie vom Anhauch großer Geister und wahrer Künstlerschaft berührt, und die ersten Dichter und Schriftsteller Frankreichs vermittelten ihr die Gedanken der Zeit. Dafür konnte ihr in Berlin einzig Hans von Bülow Ersatz bieten.
Am schwersten aber mußte sie die Großmutter vermissen: die kluge und gütige Anna Liszt, deren Haus und Herz ihr eine deutsche Heimat gewesen waren. Sie kam jetzt in ein fremdes Haus, und Frau von Bülow, eine achtunggebietende Erscheinung, hatte im Anfang nicht die volle Unbefangenheit gegen die neue Hausgenossin, schon aus Abneigung gegen die Zukunftsmusik. Auch offenbarte sie so manchen Zug der baldigen – Schwiegermutter.
Schließlich das Wichtigste und Bedeutsamste. Cosima war bis jetzt Mitwisserin geistiger Kämpfe, aber nicht persönlich an ihnen beteiligt gewesen, durch verwandtschaftliche und freundschaftliche Beziehungen nur so weit erwärmt, daß der Anteil des Zuschauers und Betrachters dadurch reger wurde. Jetzt trat sie in den Bannkreis eines Mannes, von dem die Berliner Chronisten später sagten, er sei der geborene Kämpfer gewesen, er habe sich vom Beginn »als Mann der Zukunft mit heftiger Gebärde, mit scharfem Wort und kräftigem Ton bemerkbar gemacht«. In seiner Welt war keine Ruhe. Denn er gab keine Ruhe. Er sagte: »Beethoven war kein königlich-preußischer Hofkapellmeister«, und tat alles, um den Mitbürgern zu zeigen, was er damit meinte. Wie er Beethoven spielte und spielen ließ, das hatte nichts mit einer gedankenlosen Überlieferung zu tun. Wie er sonst die Kunst auffaßte und das Kunstleben zu gestalten suchte, das war ein fortwährender Widerspruch gegen amtliche Bevormundung, fachmännischen Dünkel und allgemeine geistige Trägheit. Bevor sich Cosima in Berlin eingewöhnt hatte, mußten ihr durch Bülow die Augen dafür geöffnet werden, daß die vielgerühmte Stadt der Intelligenz einen Mann von hohen geistigen Gaben gelegentlich zur Verzweiflung bringen konnte. Man durfte sagen: sie wird das entweder nicht aushalten oder selbst zur furchtlosen Kämpferin werden. Sie wird diesen Kunstjünger, der immerfort gereizt ist, der nie bloß verteidigt, sondern stets auch angreift, der die Kunst nicht als Befreiung, sondern als den schärfsten Zwang empfindet, der Welt gehörig zu Leibe zu gehen – sie wird diesen sonderbaren Menschen, der den Segen der Kunst gar nicht zu kennen scheint, wiewohl er einzig der Kunst lebt, entweder verabscheuen, oder sie wird ihn lieben müssen. Da fiel es wohl auch ins Gewicht, daß Bülow, der unbekümmerte Draufgänger, durch und durch Kavalier war. Während Theodor Fontane, der Lobredner Preußens aus hugenottischem Blute, das »Fehlen jeder Kavalierschaft« im märkischen Volksgemüte tadelte.
Man kann demnach nicht sagen, daß die Verhältnisse, in denen Cosima sich zurechtfinden sollte, leicht zu überschauen waren. Daß seit anderthalb Jahrhunderten zahlreiche französische Familien in Berlin heimische geworden, daß das deutsche Geistesleben von diesen eingebürgerten Franzosen durchsetzt und befruchtet war, sprach nicht so deutlich zum Bewußtsein, daß es eine Hilfe gewesen wäre. Doch die Jugend hilft sich selbst. Die Mädchen schickten sich so unbefangen in die geänderte Lebensweise und die ungewohnte Umgebung, die für sie auch den Reiz einer unterhaltsamen Neuheit hatten, sie setzten allem, was sie überraschte, störte, reizte, so selbstherrlich ihre Eigenart entgegen, die sich jetzt zum erstenmal frei entfalten konnte, namentlich Cosima gab dem Verkehr mit dem geistesverwandten und sie persönlich einnehmenden Hans, dem ersten jungen Manne, der täglich um sie war, einen so frischen und gemütlichen Zug, daß die wachsame Frau von Bülow alsbald die zu große Heiterkeit und Lebhaftigkeit der Kinder rügen mußte und sogar »Avancen« zu spüren meinte, derer sich ihr Sohn zu erwehren habe. Schutz suchend wandte sie sich an Liszt, der also wieder einmal Aufsicht zu üben hatte.
In seinem Antwortschreiben stellte er die Unbesonnenheit Cosimas und das » tempo troppo agitato« fest, das sie zu nehmen scheine, und fuhr dann fort: »Als ich Ihnen meine Töchter anvertraute, habe ich nichts verborgen, was ich in ihrer Lage und in ihren Charakteren für unerfreulich halte; gleichzeitig bat ich Sie dringend, ihnen keine Lehre zu ersparen, die sie im besonderen verdienen durch ihre Anmaßung und ihre fieberhafte Eitelkeit … Was Ihren Herrn Sohn betrifft, so wissen Sie, verehrte Frau, mit welcher Aufrichtigkeit und mit welcher Lebhaftigkeit ich ihm zugetan bin … Aber soweit ich ihn kenne, dürfte eine Ehe weder nach seinem Geschmack noch im Interesse seiner Laufbahn sein; und wenn er sich wirklich später dazu entschließt, so wird es ihm nicht schwerfallen, weit vorteilhaftere Partien zu finden, als meine Töchter sind.« Der Gedanke einer ehelichen Verbindung zwischen Hans und Cosima, der offenbar zuerst in dem leider verlorengegangenen oder verborgen gehaltenen Briefe der Frau von Bülow ausgesprochen war, wurde demnach von Liszt in seiner kühlen und gelassenen Art zurückgewiesen. Doch er konnte nichts daran ändern, daß seine Töchter sich bei Frau von Bülow bald wie zu Hause fühlten und daß sie mit der größten Wärme an den Berliner Ereignissen oder, was dasselbe war, an den Taten und Leiden des streitbaren Künstlers Hans von Bülow Anteil nahmen. Berlin war für sie das Berliner Musikleben, das einen gewissen Ruf genoß und das sie nun persönlich kennenlernten und eifrig mitmachten, mit einem so kundigen und maßgebenden Führer, wie es eben Hans war. Dieser war erst fünfundzwanzig Jahre, aber er galt etwas, nicht nur als Klavierprofessor an der Sternschen Musikschule und als gesuchter Lehrer, sondern er hatte die Berliner auch durch seine Konzerte erregt und schickte sich an, ihren Geschmack, ihre Geistesrichtung zu beeinflussen. Wagner beispielsweise war in Berlin weder genügend bekannt noch genügend beachtet, ja er wurde von vielen Seiten bekämpft. Das mußte anders werden! Und wie Bülow geartet war, so gab es alsbald Fehden, Zank und Zwist mit all den Professoren, Dirigenten und Kritikern, die noch nicht für Wagner eintraten.
Die häuslichen Gespräche spiegelten das bewegte Hin und Her der musikalischen Öffentlichkeit, und diese flutete dann und wann ganz lebendig und persönlich in die Bülowsche Wohnung, wo an besonderen Festtagen, die das zurückgezogene Leben der Bewohner unterbrachen, ein Teil des musikalischen Berlins sich versammelte. Frau von Bülow verstand es, Haus zu machen, und die ihr anvertrauten Mädchen erwarben hier den letzten Schliff ihrer gesellschaftlichen Erziehung. Aber die Arbeit ging dem Vergnügen vor. Blandine und Cosima setzten ihre Studien freiwillig fort, nahmen nun auch italienische Stunden und begannen das Werk von Schleiden »Die Pflanze und ihr Leben« ins Französische zu übersetzen.
Im Vordergrunde stand die Musik. Liszt hatte Bülow ausdrücklich gebeten, mit den Mädchen ernsthaft zu arbeiten, wie mit den Schülerinnen eines Konservatoriums, und sie nicht als verwunschene Prinzessinnen zu behandeln. Keine Nachsicht mit ihnen, keine Duldung irgendeiner Oberflächlichkeit und »Pudelei« – so schrieb er ihm in deutscher Sprache – »sie haben zum voraus einen ganz gehörigen Respekt vor Dir, und es wird Dir nicht schwerfallen, sie gehörig einzupauken«. Bülow hatte denn auch den Klavierunterricht der Mädchen mit Feuereifer übernommen, Louis Ehlert, der neben ihm an der Sternschen Schule wirkte, war ihr Lehrer für Theorie, der bedeutende Geiger Ferdinand Laub kam ins Haus zu gemeinsamen Übungen Beethovenscher Sonaten. Wenige Wochen nach Beginn dieser Studien berichtete Bülow an Liszt, und zwar französisch, daher wieder das » vous«, das für unser deutsches Ohr einen falschen Ton in den Verkehr der Freunde bringt, die vor zwei Jahren das Du-Wort miteinander getauscht hatten. Wir lassen es in der deutschen Übersetzung zu Ehren kommen. Er berichtete über den »Zustand von Verblüffung, Bewunderung, ja Exaltation«, in den ihn die Mädchen versetzten, zumal die Jüngere. »Was ihre musikalischen Veranlagungen betrifft, so haben sie nicht etwa Talent, sondern Genie. Das sind in der Tat die Töchter meines Wohltäters, ganz außerordentliche Wesen. Ich beschäftige mich planmäßig mit ihrer musikalischen Erziehung, soweit sie mir nicht zu sehr überlegen sind durch ihre Verstandeskraft und die Feinheit ihres Geschmacks.« Er ließ sie Klavierauszüge zu vier Händen aus den Partituren machen, die in den Sternschen Konzerten aufgeführt werden sollten, stellte also recht hohe Anforderungen. Aber er sprach nicht von ihren Fortschritten, sondern von seinen. Er meinte, daß sie ihn fördern, daß er ihnen hundertmal mehr schulde, als sie ihm, daß die Freude dieses Unterrichts ihm eine Erholung von allem Verdruß des Tages sei.
Liszt hatte ihn auch ersucht, zwei wackere Vorkämpferinnen der Zukunftsmusik heranzubilden. Doch dessen bedurfte es nicht mehr. Bülow hatte ihnen eine Lisztsche Tondichtung vorgespielt, und niemals wird er diesen köstlichen Abend vergessen: »Die beiden Engel waren fast kniend versunken in die Anbetung ihres Vaters … Sie verstehen Deine Meisterwerke besser als irgend jemand, und Du hast in ihnen wahrhaftig Zuhörerinnen, die Dir die Natur selbst geschenkt hat.« Von dem Spiele Cosimas war Bülow bewegt und ergriffen; er erkannte darin Liszt selbst. Er fand auch, daß sie ihm in ihrem Äußeren gleiche oder vielmehr dem Bilde, das Ary Scheffer von ihm gemalt hatte, während Blandine mehr an die Büste Bartolinis erinnere. Also verhaltene Leidenschaft bei Cosima, strahlende Lebhaftigkeit bei Blandine. Bülow gebrauchte diese Worte nicht, aber der Hinweis auf die beiden Kunstwerke sagt dem Eingeweihten genug. Und Bülow setzte ausdrücklich hinzu: »Die Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten treten auch in ihren Charakteren und Individualitäten entsprechend hervor.« Cosima hegte damals keinen sehnlicheren Wunsch, als eine große Künstlerin zu werden.
Wir sehen, wie das herbe Wesen Bülows in eine eigentümliche Spannung geriet. Tag für Tag genoß er vertraulichen weiblichen Umgang vornehmster Art, und die Töchter des verehrten Meisters offenbarten ihm geistige und seelische Werte, die er im sonstigen Verkehr empfindlich vermißte. Acht Tage nach seinem Bericht an Liszt hatte Frau von Bülow ihre bisherige Wohnung, Schadowstraße 12, verlassen und eine größere, Wilhelmstraße 56, bezogen, in der die Mädchen nun auch ihr eigenes Klavier bekamen und sie und Hans, unabhängig voneinander, um so eifriger arbeiten konnten. Das Wichtigste blieb ihnen aber die gemeinsame Arbeit und der unaufhörliche Gedankenaustausch. Zartere Empfindungen wurden dabei selten berührt. Als die Mädchen traurig waren, weil die Briefe ihres Vaters ausblieben, und Hans sie fragte, warum sie sich nicht darüber beklagten, sagte Cosima, daß sie sich nie über das beklage, worunter sie am meisten leide. An den Geisteskämpfen beteiligte sie sich um so lebhafter. Was sie und Hans besonders eng verband, das war die Begeisterung für Wagner. Hans dankte ihm nicht nur sein künstlerisches Dasein, er sah in ihm auch den größten Künstler und einen unendlich liebenswerten Menschen. Seine ganze Seele hatte er ihm verschrieben und schon vor vier Jahren seiner Schwester bekannt: »Daß ich die größte künstlerische Erscheinung unseres Jahrhunderts und vielleicht von hoher welthistorischer Bedeutung erkannt habe, wie es bis jetzt nur wenigen zuteil wurde, hat in mir Ambition, Selbstgefühl, Lebenstrieb geweckt. Es wurde mir klar, daß ich ein Geisteigner dieses Mannes sein könnte, sein Schüler, sein Apostel zu werden vermöchte, und mit einem solchen Streben, einem solchen Ziele schien mir das Leben lebenswert.« Diese Zugehörigkeit hatte sich seither vertieft. So oft Bülow mit Wagner in persönliche Berührung kam, ging ein Feuerstrom von dem Meister auf den Jünger über, und dieser war nun wirklich der erste Apostel Wagners. In Berlin sollte endlich der »Tannhäuser« aufgeführt werden. Bülow versäumte nicht, den Boden dafür vorzubereiten. Das nächste Konzert des Sternschen Orchester-Vereines sollte in der Tannhäuser-Ouvertüre gipfeln.
Man kann sich heute schwer vergegenwärtigen, wie aufwühlend dieses Tonstück damals gewirkt hat. Noch wurde es nicht bei allen Promenadenkonzerten bis zum Überdruß gespielt, so daß selbst »Wagnerianer« es für eine mehr oder weniger überwundene Sache halten konnten. Im März 1852, als Wagner das Stück in Zürich aufführte, waren zuerst die Musiker bei den Proben, dann die Besucher des Konzertes überwältigt von der neuen Sprache, die der frommen Abkehr vom Leben und dem üppigsten Sinnengenuß gleich mächtigen Ausdruck verlieh. »Namentlich die Frauen«, so berichtete Wagner dem Dresdner Freunde Uhlig, »sind um und um gewendet worden, die Ergriffenheit war bei ihnen so groß, daß Schluchzen und Weinen ihnen helfen mußte.« Und eine Frau, die schon den Proben beiwohnte und die dadurch mit dem Schicksal Wagners verknüpft wurde, Mathilde Wesendonck, hatte noch vierundvierzig Jahre später den ungeheuren ersten Eindruck in stärkster Erinnerung: »Es war ein Taumel des Glücks, eine Offenbarung; Zuhörer und Musiker waren elektrisiert.« Dem Tondichter aber, der selbst über diese ungemein heftige Wirkung erstaunt war, löste sie das Rätsel, indem sie ihm sagte, er sei den Leuten als niederschmetternder Bußprediger gegen die Sünde der Heuchelei erschienen.
Dieses Tonstück war von Bülow gewählt, um die Berliner einmal ordentlich aus dem Häuschen zu bringen. In der Lisztschen Übertragung hatte er es schon öffentlich gespielt, nun sollte der Zauberklang des Orchesters die Schläfrigsten wecken und die hoffärtigsten aufpeitschen. Cosima kannte nur den Klavierauszug und hatte das Stück in Paris vierhändig gespielt. Aber auch sie ahnte etwas von dem ganz Persönlichen, das in diesem Werke lebt, dessen unwiderstehliche Beredsamkeit den Eindruck des außerordentlichen Mannes in ihr wachrief, der ihr vor zwei Jahren in Paris zum erstenmal entgegengetreten war. In fieberhafter Aufregung erwartete sie den 19. Oktober 1855, an dem nun Bülow am Schlusse einer recht zahmen Vortragsordnung die große Bußpredigt erklingen ließ, mit dem ganzen Aufgebot seiner Kenner- und Könnerschaft, mit überlegener Sicherheit, doch in fieberhafter Hitze, die Nerven zum Zerreißen gespannt. Liszt war von Weimar gekommen und wohnte dem Konzert bei. Da geschah das Unerwartete, nicht für möglich Gehaltene: das Werk wurde ausgepfiffen. Bülow war nie im Zweifel darüber, daß seine Konzerte jedesmal einen Angriff auf die Ruhe des Spießbürgers und auf den Hochmut der Zunft bedeuteten. Er nannte sie »Attentatskonzerte«. Gegenangriffe ließ er sich in der Regel nicht gefallen. Mehr als drei Jahre später rief er nach einer Aufführung der »Ideale« von Liszt in den Saal: »hier ist es nicht üblich, zu zischen. Ich bitte die Zischer den Saal zu verlassen!« Diesmal war es anders. Die Tannhäuser-Ouvertüre wurde zur ausgesprochenen Niederlage. Die Mißfallsbezeigungen waren so arg, daß kein Widerspruch, keine Abwehr sich dagegen behaupten konnte. Auch die inneren Kräfte verließen den streitbaren Helden, eine tiefe Ohnmacht befiel ihn.
Nach der Erholung im Künstlerzimmer fand er doch die Fassung, den Abend noch weiterhin mit Liszt und anderen Künstlern zu verbringen. Liszt begleitete ihn dann bis zur Wohnung und versprach, am nächsten Vormittage seinen Besuch zu machen. Oben sahen sie noch Licht. Frau von Bülow war mit den Mädchen vom Konzert nach Hause gefahren und hatte sich bald zu Bett begeben. Auch Blandinen war es nicht notwendig erschienen, den vielleicht erst spät Heimkommenden zu erwarten. Cosima jedoch hielt es für ganz unmöglich, ihn in dieser Nacht nicht mehr zu sehen, ihm kein Wort des Trostes und der Aufmunterung zu sagen. Auch ihr waren die Töne Wagners bis ins Innerste gedrungen, sie hatte diese tief menschliche, aus den Abgründen des Gemütes aufsteigende Kunst in ihrem Wesen erfaßt, sie begriff, was für eine Enttäuschung Bülow heute erlitten haben mußte. Sie wartete auf ihn, unbekümmert um die eigene Müdigkeit, unbekümmert um alle Bedenklichkeiten bevormundender Sitte. Als Bülow endlich, gegen zwei Uhr morgens, eintraf, empfand er ihre bloße Anwesenheit als Trost, Freude und Genugtuung. Er dankte ihr mit den wärmsten Worten und sagte, er zittere vor dem Augenblick, wo sie das Haus verlassen würde. Darauf erwiderte sie, das sei ja einfach, dann bleibe sie. Damit waren sie verlobt. »Es geschah unter guten Sternen«, meinte Cosima dreiundsiebzig Jahre später, als sie ihrer Tochter Daniela davon erzählte, wir aber gedenken der Worte Othellos: »Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestand; ich liebte sie um ihres Mitleids willen.« –
Sechs Wochen nach ihrem Einzuge in Berlin war Cosima mit Hans von Bülow verlobt. Aber noch nicht in aller Form. Verlobungsanzeigen wurden nicht ausgegeben. Es war nur ein ernster, feierlicher Entschluß; die hellsichtige Vermutung der Frau von Bülow war zur Tatsache geworden. Um jede gebotene Rücksicht zu üben und nachteiligem Gerede vorzubeugen, nahm Bülow eine Junggesellenwohnung in der Eichhornstraße, war mancherlei Opfer und Störungen mit sich brachte. Der Verkehr mit Cosima war dadurch einigermaßen gehemmt, und wenn Hans erkrankte, was nicht selten vorkam, die mütterliche Pflege erschwert. Im übrigen waren die Eltern Cosimas noch nicht gefragt worden. Oder vielmehr: sie hatten noch nicht ihre förmliche Einwilligung gegeben. Bülow hatte wohl mit Liszt gesprochen, dieser aber hatte abgewinkt und vorerst ein Jahr des Wartens als wünschenswert bezeichnet. So ging der Winter in Unruhe und Zweifel dahin. Bülow hatte als Klavierlehrer viel zu tun, auch bei hohen und höchsten Herrschaften, und mußte Stunden abweisen, da es ihm an Zeit und Kräften gebrach. Als Dirigent und als Schriftsteller trat er nach wie vor unerschrocken für die Zukunftsmusik ein. Über den keineswegs glänzenden Erfolg des »Tannhäuser« in der Berliner Oper war er sehr verstimmt. Er sah oft elend aus, gönnte sich aber keine Rast, besuchte auch Bälle und schonte weder seine Gesundheit noch seinen Geldbeutel: als es mit dem »Tannhäuser« nicht vorwärtsgehen wollte, bezahlte er bei den Wiederholungen selbst die Lohnklatscher, auf die Gefahr hin, dadurch in Schulden zu geraten.
Auch als Tondichter rührte und regte er sich, ermuntert durch Richard Wagner. Aber »es wird immer nichts daraus«, schrieb seine Mutter ihrer Tochter.
Im Frühjahr gab es Haustheater bei Bülows. Hans, angegriffen, gelb und elend, wetteiferte mit den Mädchen in der trefflichen Darstellung eines kleinen französischen Lustspiels. Um diese Zeit war Daniel Liszt zu Besuch da. Kurz vorher hatte Liszt seiner Mutter geschrieben: »Im Vertrauen gesagt, es ist von einer Heirat Hans von Bülows mit Cosima viel die Rede. Sie scheint ihm sehr geneigt. Ich habe nichts dagegen; doch bleibe ich meinem Vorsatz treu, die freie Wahl meiner Töchter nicht zu beeinflussen. Das ist der bequemste und zugleich der klügste Standpunkt für mich in dieser nicht von mir geschaffenen, aber mir aufgedrungenen Lage, deren Nachteile ich sowohl für mich als meine Töchter möglichst vermeiden möchte.« Daran knüpfte er die Bemerkung, daß Bruder Daniel den diplomatischen Vermittler zwischen seinen Schwestern und ihrer Mutter abgegeben haben dürfte, und befürchtete, daß der gute Junge dabei etwas ungeschickt vorgegangen sei. Doch von dieser Seite gewahren wir zunächst keine besondere Erschwernis; allerdings wissen wir auch noch nichts von einer förmlichen Zustimmung; aber die Hauptbeteiligten selbst schienen sich noch immer nicht so, wie es die Welt braucht, entschieden zu haben. Es war immer nur die Rede von einer Sache, die keine greifbaren Formen annehmen wollte. Fast sah es so aus, als ob die jungen Leute auf ein ermunterndes Wort Liszts warteten, während dieser umgekehrt ihrer eigenen Erklärung harrte.

Blandine Ollivier.
Nach einem Gemälde von Henri Lehmann.
Mit Genehmigung von Herrn Daniel Ollivier, Paris
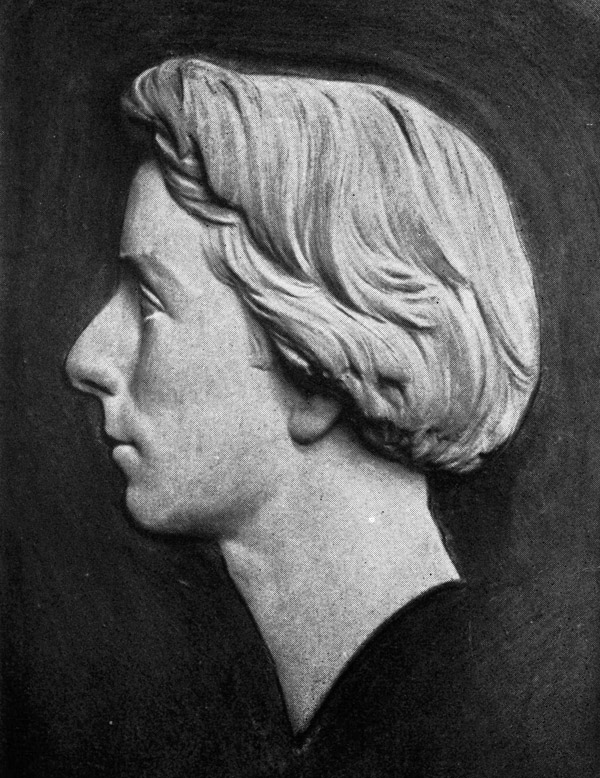
Daniel Liszt.
Nach einem Relief im Liszt-Museum zu Weimar.
Photo Louis Held, Weimar

Cosima von Bülow.
Aus der Richard-Wagner-Gedenkstätte Bayreuth
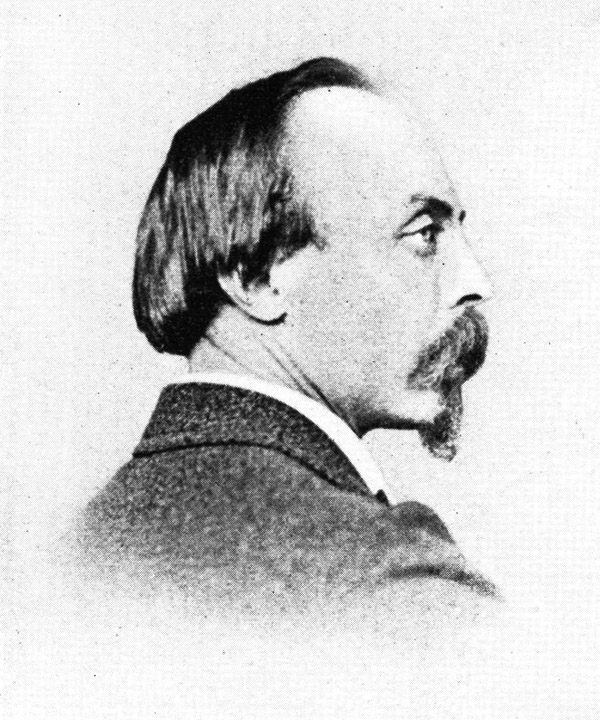
Hans von Bülow
Endlich, am 20. April 1856, mitten aus seinen Kämpfen für Richard Wagner, mitten aus den Anstrengungen seines Berufes, der auch reich an Erfolgen war – vor einer Woche hatte er in einem Hofkonzert gespielt –, endlich schrieb Hans einen langen Brief an den teuren Meister und begehrte Cosima endgültig zur Frau. Endgültig, wie Liszt selbst es auffaßte, und doch mit bemerkenswerten Einschränkungen, mit einer offenbaren Scheu vor der Erwählten und ihrem noch nicht klar enthüllten Sinne. Aus diesem Briefe geht hervor, daß die mündlichen Unterredungen Liszts und Bülows im vergangenen Herbst doch noch recht unbestimmt gewesen, daß damals beide, Liszt und Bülow, einem unzweideutigen, nicht mehr zu ändernden Worte aus dem Wege gegangen waren.
In diesem Werbebriefe heißt es: »Wollest Du die Güte haben, mein Geständnis ohne ungläubiges Lächeln aufzunehmen, daß es nur eine Art von angeborener Schüchternheit ist, eine gewisse Schwerfälligkeit, sich mitzuteilen, die mir schon oft geschadet haben, daß ich Dir von meiner Liebe zu Deiner Tochter Cosima noch nicht sprach. Es ist mehr als Liebe, was ich für sie empfinde; der Gedanke, mich Dir, den ich als den hauptsächlichen Urheber und Erreger meines gegenwärtigen und künftigen Daseins betrachte, noch mehr zu nähren, faßt alles Glück zusammen, das ich hienieden erwarte. Cosima überragt für mich nicht nur als Trägerin Deines Namens alle Frauen, sondern auch, weil sie Dir so gleicht, weil sie durch so viele Eigenschaften ein treuer Spiegel Deiner Persönlichkeit ist. Und da sie mir erlaubt, sie zu lieben, brauche ich meine Anbetung nicht als eine Verirrung zu betrachten, noch auch meine Bewerbung als eine Phantasie, deren Aussprechen Dich etwa veranlassen müßte, zur Tagesordnung überzugehen … Ich bitte Dich, versetze Dich einen Augenblick in meine Lage. Nach allen Wohltaten, mit denen Du mich überschüttet hast, und Deine Freundschaft für mich derartig übertreibend in Rechnung gesetzt, daß sie mich ermutigte, die Hand Deiner Tochter zu erbitten – mußte das Gefühl meiner Unbedeutendheit, das Bewußtsein meines Proletentums, die Unmöglichkeit, irgendeiner Frau eine würdige, gesicherte Stellung in der Welt zu bieten, mich nicht zurückhalten? Und da nun gar die von mir erstrebte Frau Deine Tochter war, mußten meine Bedenken sich nicht steigern? So starke Proben von Unbesonnenheit ich in meinem bisherigen Leben auch gegeben haben mochte, meine wahre und unwandelbare Leidenschaft für Deine Tochter konnte mich doch nicht in dem Grade verblenden, um mich über Verhältnisse hinwegzusetzen, die mir zwingend erschienen wie das Fatum selbst. Und weiter – war es nicht meine Pflicht, zu warten, Deiner Tochter die nötige Zeit zu lassen zur Prüfung, ob ihre Neigung sich auf wirkliche und ernste Sympathie gründe und nicht einer Anwandlung entspringe? Konnte ihre Bevorzugung nicht auch eine sehr bedingte sein, hervorgerufen durch die Einsamkeit, in der sie gelebt, und die wenigen Bekanntschaften, die sie gemacht? Ich kann mit gutem Gewissen versichern, daß ich nach der ersten günstigen Aufnahme meiner Gefühle nichts unternahm, um sie an mich zu fesseln; ich habe durchaus nichts getan, um mich in ihren Augen zu heben; die Achtung, die ich ihr als Deiner Tochter schulde, ließ sie mich als vollkommen frei betrachten, mir, falls sie sich enttäuscht fand, ihr Wort zurückzugeben. Sechs Monate sind verflossen, und es scheint, daß Dein Fräulein Tochter mir ihre Neigung erhalten hat. Ich fühle mich also berechtigter als vorher – wenn Du mir überhaupt Berechtigung zuerkennst –, Dich um Deine Einwilligung zu bitten, Cosima als meine Braut zu betrachten. Ich schwöre Dir, daß, so sehr ich mich durch meine Liebe zu ihr gebunden fühle, ich niemals zaudern würde, mich ihrem Glücke zu opfern, indem ich sie freigebe, falls sie bemerken sollte, sich in mir getäuscht zu haben. Ihr Wille, ja sogar ihre Laune soll mir heilig sein.«
Liszt, dessen abwartende Haltung jedenfalls auch eine Art Prüfung der Brautleute hatte bezwecken sollen, war nunmehr einverstanden. Also doch ein Musiker! Aber eine Ausnahme. Er bestimmte die Vermählung für den Herbst, nach Ablauf der schon zuerst von ihm gewünschten einjährigen Wartezeit. Im Mai wurde das alles mündlich abgemacht. Was uns dabei merkwürdig berührt, ist die Tatsache, daß Bülow einen Monat später sich Fernstehenden gegenüber nicht als Bräutigam bekannte. Am 13. Juni 1856 schrieb er an Frau Jessie Laussot in Baden-Baden, an dieselbe, mit der Richard Wagner sieben Jahre vorher nicht nur aus der Ehe, sondern auch aus Europa hatte flüchten wollen: »Meine Mutter hat sich sehr gefreut, von Ihnen zu vernehmen, und mir schon seit langem die herzlichsten Grüße aufgetragen. Sie hat, wie Sie vielleicht wissen, auf Liszts Ersuchen dessen beide bisher in Paris erzogenen Töchter seit vorigem Herbste in ihr Haus genommen. Diese wunderbaren Mädchen tragen ihren Namen mit Recht – voll Talent, Geist und Leben sind sie interessante Erscheinungen, wie mir selten vorgekommen. Ein anderer als ich würde glücklich sein, mit ihnen zu verkehren. Mich geniert ihre offenbare Superiorität, und die Unmöglichkeit, ihnen genügend interessant zu erscheinen, verhindert mich die Annehmlichkeit ihres Umganges so zu würdigen, wie ich es möchte.« Diese Worte lassen weder den Brautstand Bülows erraten, noch begründen sie die Annahme, er werde sich jemals für »berechtigt« halten, um eines der Mädchen zu werben.
Inzwischen ging sein Leben, Ringen und Kämpfen im Sturmschritt weiter. Wagner und Liszt, Liszt und Wagner, aber auch ihre Schüler und Jünger Tausig, Raff, Franz, Cornelius, Draeseke und andere, deren Namen heute vergessen sind, die aber damals ein Recht hatten, mit zum Wettstreit anzutreten, sie alle sollten durch ihn zu Ehren kommen; Berlioz war ihm der ebenbürtige Fremdling, schon mehr ein deutscher als ein französischer Meister; und die großen deutschen Altmeister Bach und Beethoven wurden durch ihn in wundervoller Wiedergabe zu neuen, gewaltigen Offenbarungen. Auch als Tondichter ruhte er nicht, und inmitten des Drängens und Treibens seiner aufreibenden Tätigkeit vollendet er eine schwermütige Liederreihe, die später auch die wärmste Anerkennung Wagners fand. Sie trug den Titel: »Der Entsagende!«
Während er so kämpfte und forderte, oft Feinde und vorsätzliche Gegnerschaft vermutend, wo nur der stumpfe Widerstand der Welt ihm das gewohnte träge Antlitz zeigte, entfaltete Cosima, seine erklärte Braut, jene Klugheit und weibliche Feinfühligkeit, die sie dereinst an der Seite Wagners zu persönlicher Meisterschaft ausbilden sollte. Liszt, der zu den musikalischen Ereignissen, an denen Bülow beteiligt war, nach Berlin zu kommen pflegte und bei solchen Anlässen die »maßgebenden« Personen des Berliner Musiklebens um sich versammelte, wobei weder Cosima noch die stets heitere und übermütige Blandine fehlen durften – Liszt hatte seine Töchter in einem Briefe an die Fürstin Wittgenstein » passablement gentilles et Parisiennes« genannt. Die Pariser Weltläufigkeit, die er damit bezeichnen wollte, kam bei Cosima in einer Sache Liszts, die natürlich auch eine Sache Bülows war, zum schönsten Ausdruck. Der geachtete und gefürchtete Kritiker Ludwig Rellstab, der nicht sonderlich geneigt zu sein schien, in der Frage nach der Bedeutung des Lisztschen Schaffens einen festen Standpunkt zu beziehen, wollte sich wieder einmal von einem Konzerte drücken, in dessen Mittelpunkt ein neues Werk Liszts stand. Diesmal das Es-Dur-Konzert, für das Bülow mit besonderer Lebhaftigkeit eintrat. Rellstab sagte, er müsse den Opernball besuchen. »Da setzte es sich Fräulein Cosima«, so berichtet Bülow, »in den Kopf, den alten Unbestechlichen zu bestrafen, und zwar durch einen scharmanten Brief, in welchem sie ihm allerlei Schmeicheleien über Geist und Anmut seiner Schriften sagte und ihn bat, sich doch eines der Hauptwerke ihres Vaters anzuhören, von dem sie ihm den stärksten Eindruck versprach. Und Rellstab kam in » full dress«, fand das Konzert sehr interessant, ja sogar sehr schön und hatte mit Liszts Tochter eine allem Anschein nach furchtbar rührende Unterredung, die mit kordialem Händeschütteln endete.« Nein, Bülow konnte sich keine bessere Frau wünschen.
Die Heiratssache ging aber nicht so rasch vorwärts, wie es geplant war. Fast noch ein zweites Jahr des Wartens erprobte die Geduld der Verlobten. Im Sommer 1856 besuchten Blandine und Cosima den Vater in Weimar, Von dort fuhren sie nach Paris, wo Cosima den Segen der Großmutter empfing. In ihrer gütigen und verständigen Art machte Frau Anna Liszt ihre Randbemerkungen zu den Familienereignissen, vor einem Jahre hatte sie dem Sohne geschrieben: »Die Neuigkeit von einer Mariage von Monsieur de Bülow mit Cosima setzt mich gar nicht in Erstaunen, denn ein Mädchen mit einem jungen Manne tête à tête seit langer Seit und zugleich ist er ihr professeur, da kann sich wohl bald Freundschaft und durch Freundschaft Liebe entzünden. Und nun – sollte sich diese Heirat wirklich machen, sie scheint mir nicht brillant, aber es sind auch nicht Mariagen immer die glücklichsten, die brillantes Aussehen haben. Ich hörte immer in Weimar sagen, daß Bülow viel Verstand habe, das ist immer eine ressource. Wenn schon nicht Vermögen vorhanden ist, so kann er verdienen, wenn er Gesundheit hat. Aber leider hörte ich von seiner Mutter hier, daß er oft kränklich ist. Eine gute Sache wäre noch dabei, daß Du in ihm einen gendre hättest, der Dich versteht und zu schätzen weiß.« Jetzt schrieb sie, als Liszt wieder einmal in Berlin weilte, um die Dinge zu betreiben: »Nun wird er nach Berlin sein für die Sache der Cosima mit ihrer Mariage mit Monsieur de Bülow. Gott gebe seinen Segen dazu. Sie kennen sich lange genug und so auch eins dem anderen seine Schwächen, die Liebe verträgt viel mit Geduld.«
Die Zustimmung der Mutter zur Ehe mit Hans war erst nach mancherlei Ermahnungen und gut gemeinten Ratschlägen zu erreichen. Cosima blieb fest und unerschütterlich, Marie d'Agoult mußte nachgeben. Sie wollte sich nun an Blandine schadlos halten und bestimmte diese, in Paris zu bleiben. Der Einfluß der Mutter auf die jetzt bald alleinstehende Tochter erstarkte von neuem und Liszt hielt sich nicht mehr für berufen, der Einundzwanzigjährigen nur seinen Willen aufzuzwingen. So kam es zu der für beide Schwestern tief schmerzlichen dauernden Trennung. Cosima kehrte allein nach Berlin zurück.
Daß aber die Vorbereitungen zur Ehe so lange dauerten, hatte sozusagen amtliche Gründe. Hans mußte erst die preußische Staatsbürgerschaft erwerben und Marie d'Agoult hatte noch vermögensrechtliche Erklärungen abzugeben. Doch auch bei Liszt schienen sich neue Widerstände zu regen. Hans bat Wagner, den Freund zu beeinflussen. Endlich kam alles in Ordnung. Liszt erschien bei seiner Tochter, um ihr die Urkunden, die sie zur Eheschließung brauchte, zu übergeben und sie über die einschlägigen Verhältnisse zu unterrichten. Frau von Bülow ging nun daran, ihrem Sohn ein behagliches Heim zu schaffen. Für Hans, den Protestanten, war es keine Frage, daß die Trauung katholisch geschlossen werden sollte. »Denn«, so schrieb er an Liszt, »was meine persönliche Meinung in dieser Sache betrifft, so stelle ich, abgesehen von meiner Neigung für den Katholizismus, eine Kirche höher, welche die Ehe als Sakrament betrachtet, und demnach könnte ich im Segen eines lutherischen Pastors keine persönliche Befriedigung finden.« Liszt meldete mit Genugtuung der Fürstin, daß auch das katholische Bekenntnis der zu erwartenden Kinder seit langem zwischen Hans und Cosima vereinbart sei. Die Braut selbst fand Liszt bei seinem Besuche in bester Verfassung, was Gesundheit, Haltung, Laune, Geist und Herz betrifft.
Auch die Stiefmutter Bülows, die zweite Frau seines Vaters, lernte jetzt seine Braut kennen. Mit großer Herzlichkeit kam sie ihr entgegen und hatte von ihr einen bezwingenden Eindruck. Aber sie konnte einen großen Schrecken kaum verbergen, als das Brautpaar ins Zimmer trat. Sie hatte hellseherische Fähigkeiten und erblickte an der Seite Cosimas – einen anderen, nicht Hans. Louise von Bülow war so bewegt von diesem Gesicht, daß sie ihr Erlebnis niederschrieb. Mündlich ließ sie nichts davon verlauten.
Im übrigen wurde das gute Einvernehmen der Verlobten durch nichts getrübt. Es ist kaum verständlich und wohl nur ein Beweis für sein nie zufriedenes Gemüt und seinen nervösen körperlichen Zustand, daß Bülow nicht die frohe Zuversicht zur Schau trug, die sonst das Merkmal eines glücklichen Bräutigams ist. Die heftigen Kämpfe, die er noch zuletzt beim Musikfeste in Aachen auszufechten hatte, wo die Gegner Liszts eine drohende Haltung einnahmen, mochten das ihrige dazu beitragen. Am Tage vor der Hochzeit beschloß er einen Brief an Richard Pohl, den befreundeten Vorkämpfer Liszts und Berlioz', der sich anscheinend etwas zweifelhaft über Bülows Eignung zum Ehemanne ausgesprochen hatte, mit folgenden Worten: »Bin übrigens in der Tat glücklich – wenn ich an die Möglichkeit einer anderen Heirat für mich als diese denke, so wird mir empörend abgeschmackt zumute! Meine Frau ist mir so vollkommen Freundin, wie sich's fast nicht idealer vorstellen läßt. Du kennst sie wohl nicht so genau bis jetzt? So – hab' keine Minute mehr. Dir gehört mein letzter Garçonfederstrich! Du Roué! … Dein morgender Kollege Hans von Bülow.« In diesen wenigen Sätzen hat Bülow sich selbst gezeichnet. Knapper Ausrufungsstil, Vorliebe für Wortwitz und Fremdwort, und dahinter der bittere Ernst seines Wesens: unbedingte Verehrung für die Freundin, die seine Gattin werden soll, strengste Auffassung von der Bedeutung der Ehebundes, und zugleich eine unbesiegliche, beinahe offen einbekannte Scheu vor seiner Bestimmung zum Ehemanne, ein nicht zu bannender Zweifel, ob er glücklich werden könne – das alles mehr ironisch, halb versteckt ausgedrückt.
Am 18. August 1857 wurden Hans und Cosima in der Hedwigskirche zu Berlin, im Beisein Liszts, still getraut. Liszt gab die Vermählungsanzeige in deutscher Sprache aus. Eine Art Schlußwort hatte er schon nach dem Aufgebote an seine Mutter gerichtet: »Ihre Charaktere passen vortrefflich zueinander und ich sehe für Hans eine ausgezeichnete künstlerische Laufbahn voraus. Ich achte und liebe ihn um seines seltenen Talentes, seiner scharfen Intelligenz und der großen Rechtlichkeit und Vornehmheit seines Wesens willen. Auch mit Cosima bin ich sehr zufrieden. Sie war immer mein Liebling.«
Am 22. Oktober desselben Jahres heiratete Blandine den Pariser Rechtsanwalt Emil Ollivier.
Gleich nach der Vermählung wurde die Hochzeitsreise angetreten, vorerst mit Liszt, den das junge Paar bis Weimar begleitete. Dann ging es über Baden-Baden, wo Richard Pohl sie begrüßte, nach Bern und an den Genfer See, dessen Schönheit sie drei Tage lang entzückt genossen, in Gesellschaft des seit kurzem vermählten Karl Ritter und seiner Frau. Endlich das Hauptziel der Reise – Zürich und Richard Wagner! Dieser hatte schon im Februar an Hans die Aufforderung gerichtet, ihn im Sommer zu besuchen, und am 1. April seinen Wunsch in besonders herzlicher Weise wiederholt:
»Lieber Johannes!« schrieb er. »Falls Du für mich frei bist, bitte ich darüber nachzudenken, wie Du es anfängst, mich diesen Sommer wirklich zu besuchen. Kämst Du mit Cosima, so wäre das ganz famos. Ich beziehe jetzt ein herrlich gelegenes, nett eingerichtetes Häuschen, mit großem hübschem Garten, frei, still und wie ich es nur wünschen konnte. Der Teilnahme der Familie Wesendonck verdanke ich diese große Wohltat: man hat es eigens gekauft, um es mir, gegen kleinen Zins, für Lebenszeit zu überlassen. Dort will ich diesen Sommer die noch restierenden zwei Akte des Siegfried arbeiten. Kommst Du, mich zu besuchen, so verspreche ich Dir, mit mir für diese Zeit im Paradiese zu sein. – Ich möchte gerne mit Dir musizieren: Du mußt mir meine neuen Sachen spielen, ich bleibe ihnen sonst immer fremd.« Am Ende desselben Briefes kam er noch einmal auf seinen Wunsch zurück. »Ich hoffe ungeheuer viel von meinem neuen Asyl. Zuletzt hatte ich in meiner jetzigen Wohnung mit fünf Klavieren und einer Flöte täglich zu kämpfen. Ich war daran, verrückt zu werden. Doch ist der erste Akt des Siegfried (bereits auch instrumentiert) gut ausgefallen, ja besser, als was ich je gemacht. Komm bald, dann nehmen wir's durch. – Wahrlich, ich freue mich ungemein, Dich zu sehen. Grüße Cosima und bestimme sie, Dich zu bestimmen, mit dem Besuch Ernst zu machen.«
Hans versprach ihm, zu kommen, aber nicht ohne seine Gattin, so daß auch Wagner dem Zeitpunkte der Vermählung mit Ungeduld entgegensah. Er schrieb an Hans, daß ihm Cosima in sehr angenehmer Erinnerung sei, sie möge diese recht bald lebendig wieder auffrischen. Alle diese Hoffnungen wurden nunmehr erfüllt. Hans und Cosima hegten kaum geringere Sehnsucht nach dem Beisammensein mit dem großen Freunde als dieser selbst, der sich trotz der regen Teilnahme der Wesendoncks künstlerisch vereinsamt fühlte und die Lust zur Fortsetzung und Beendigung seiner Nibelungen allgemach verlor; es war keine Redensart, wenn er meinte, daß der Umgang mit Hans ihm wohltun und ihn kräftigen werde.
Im Hotel Bellevue bestellte er für das Paar eine hübsche Wohnung mit Ausblick auf den See, und gleich am ersten Tage, noch vor dem Mittagessen im Asyl, wollte er seine Gäste der Frau Wesendonck vorstellen. Doch da gab es mancherlei Mißgeschick. Der wichtigste Koffer Bülows (mit Geld!) ging auf der Strecke von Lausanne nach Bern verloren und wurde erst nach vielen Drahtungen mit Beihilfe Ritters zustande gebracht und in Zürich abgeliefert. Dort aber lag Bülow mit Fieber zu Bette, das er – infolge arger Erkältung – achtundvierzig Stunden lang »kultivieren« mußte. Sein Arrest wurde dadurch gemildert, daß er die Partitur der »Walküre« zu lesen bekam und außerdem schon einen Blick in die des »jungen Siegfried« tun durfte. Wagner war herrlicher Laune, und auch Bülow, der, sobald er sich frei bewegen konnte, in dem angenehmsten Freundeskreise Zutritt fand, zu dem u. a. Robert Franz, Gottfried Keller, Georg Herwegh zählten – auch Bülow mußte sagen, daß er »seit undenklich langer Zeit« nicht so vergnügte Augenblicke erlebt hatte. Wie frei atmete er erst, ungestört von allem Kleinlichen und »Schoflen«, das ihm in Berlin das Leben versauerte, als er nach mehreren Tagen im Asyl auf dem grünen Hügel aufgenommen wurde und am ersten Sonntagmorgen, der ihm in Zürich leuchtete, unter dem Dache Wagners erwachte. Dieses Häuschen gefiel Cosima viel besser als die Prunkvilla der Wesendoncks. Hier wurden die Nibelungen vom Anfange bis zum letzten Takte, der bereits geschrieben, gründlich durchgenommen. Wagner sang, Bülow spielte. Mühelos beherrschte er die von Wagner als »furchtbar« bezeichneten Klindworthschen Übertragungen des »Rheingold« und der »Walküre«, und die handschriftlichen Entwürfe zu »Siegfried« eignete er sich derart an, daß er sie wie aus einem wirklichen Klavierauszuge vorzutragen wußte. Wagner staunte über Bülows Meisterschaft und wurde durch dessen Unermüdlichkeit und stete Bereitschaft mit dem eigenen Werke erst ganz vertraut. Es waren gleichsam schon Vorbereitungen zur ersten Aufführung. Bülow geriet dabei in eine Stimmung, die bei ihm höchst selten war. Er hatte alles in den See geworfen, was ihm den Kopf erhitzen konnte, ihn in seinem »katerartigen Wohlbehagenknurren« stören konnte – so berichtete er seiner Mutter. Viel Schlafen – gehörige, regelmäßige Spaziergänge – »auch gute Flügel, selbst gutes Geflügel« – und dazwischen immer wieder als stählendes Tagwerk die Beschäftigung mit den Nibelungen: er befand sich, soweit ihm das überhaupt irgendwie möglich war, froh, frisch und gesund; alles Üble, Feindselige, sah er gleich Wagner nur »als Traum, als vollkommene Unwirklichkeit«, und es bangte ihm daher auch nicht vor der Rückkehr nach Berlin, die er jedoch, sein Glück festhaltend, immer weiter hinausschob.
Von dem Eindrucke der Nibelungen, wie auch der Persönlichkeit Wagners geben seine Briefe an Richard Pohl, Franz Brendel und Julius Stern beredtes Zeugnis: »was für ein Riesenmensch!« was für ein »kolossales« Werk! Wagner ist » einzig«! von einem »produktiven Reichtum« ohnegleichen. »Die Nibelungen sind ein Werk, von dessen Erhabenheit man sich kaum einen Begriff bilden kann, ein Werk, das in kommende Jahrhunderte hineinreicht. Und dieser gigantische Humor!« »Ich wüßte wirklich nichts zu nennen, was mir solche Wohltat, solche Erquickung gewähren könnte, als das Zusammensein mit dem herrlichen Manne, den man wie einen Gott verehren muß. Aus aller Misère des Lebens taue und tauche ich auf in der Nähe dieses Großen und Guten. Von den Nibelungen kann ich nichts schreiben. Da hört alles Ausdrucksvermögen der Bewunderung auf. Nur so viel: auch die spezifischen Musiker, sobald sie noch einen ehrlichen Faden am Leibe haben, sobald sie nicht Petrefakten von Dummheit und Schlechtigkeit geworden sind, werden staunen! Etwas Ähnliches, Annäherndes ist nicht geschrieben worden – überhaupt nicht – nirgends – in keiner Kunst, in keiner Sprache, von da darf man auf alles andere herabsehen, alles andere übersehen. Es ist eine wahre Erlösung aus dem Weltkote.« »Jetzt feiere ich ganz andere als die gewöhnlichen Flitterwochen, und meine Frau ist nicht eifersüchtig.«
Nein, sie war nicht eifersüchtig. Sie wetteiferte nur mit dem Gatten in der grenzenlosen Hingabe an dem »Großen und Guten«, von dem auch ihre Seele zutiefst erfüllt war. Aber mehr noch als die Nibelungen ergriff sie das andere Werk, das Wagner vor kurzem, die Arbeit am »Siegfried« unterbrechend, begonnen hatte. Für ihn sollte diese neue Arbeit eigentlich nur eine Erholung und Ablenkung sein. Karl Ritter beabsichtigte, die Sage von Tristan und Isolde zum Gegenstande einer Bühnendichtung zu machen, und Wagner, der seinen Plan kannte, suchte ihm nun zu zeigen, wie er den Stoff behandeln würde. Das so entstandene Gedicht wollte er dann auf eine Art in Musik setzen, deren leichte Ausführbarkeit ihm wieder Erfolg und Einnahmen verschaffen und eben dadurch die ungestörte Fortsetzung der dem gewohnten Opernwesen widersprechenden Nibelungen ermöglichen sollte.
Noch war der erste Aufzug des neuen Dramas nicht beendet, als Bülows eintrafen. Während ihres Besuches schritt die Dichtung weiter vor. Jeder Auszug wurde von Hans ins reine geschrieben und dann von Wagner vorgelesen; zum Schluß das Ganze. Bei dieser letzten Vorlesung war der Eindruck auf Mathilde Wesendonck besonders tief. Die Neigung zu Wagner, die seit einigen Jahren in ihr keimte und wuchs, war zuerst mächtig aus ihr hervorgebrochen, als sie den dritten Aufzug kennenlernte. Da war sie nicht mehr imstande, ihre Liebe zu verheimlichen. Sie sagte Wagner, daß sie sterben wolle und sonst keinen Wunsch mehr habe. Da nun auch das Ganze in Gegenwart anderer an ihr vorübergezogen war und sie ja doch wußte, daß sie leben und ihre Todessehnsucht verbergen mußte – lieh sie ihrer Ergriffenheit bange Worte. Doch Wagner fand das Ende nicht so tragisch; er belehrte sie darüber, daß Trauer hier nicht am Platze sei, da es bei so ernster Angelegenheit im allerbesten Falle eine solche Wendung nehme. Er sprach so vor Zeugen, die ihn freilich kaum verstehen konnten, seinen mannhaften Entschluß aus, das Geständnis ihrer Liebe nicht zu mißbrauchen und auf jede Glückseligkeit in ihren Armen zu verzichten. Sein heißes Wesen glühte noch leidenschaftlicher für sie, als ihr Herz für ihn schlug. Daß diese ein wenig kühle, stets zart und vornehm empfindende Frau an seine Brust sinken konnte, war der höchste Triumph, den er je als Mann errang. Doch im Augenblicke beherrschte er sich und die Lage. »Tristans Ehre – höchste Treu'!« Er wollte weder zum Ehebrecher werden noch den häuslichen Frieden seines Gönners Otto Wesendonck zertrümmern. Den Liebenden war nur Entsagung bestimmt – das, was man bürgerlich Entsagung nennt. Ein Glück ohne Reu' war ihnen aber doch beschieden: die außerirdische Vereinigung im Wunderreiche der Nacht, im Traumreiche Tristans und Isoldens, als reinste Bewährung eines wahren Seelenbundes. Und Wagner hatte das Zaubermittel in der Hand, das ihm den Zutritt in dieses Jenseits öffnen konnte: er stand schon im Begriffe, alles Lodernde und Stürmische seines Begehrens in einer weltentrückenden Musik verströmen zu lassen, die freilich nicht so leicht aufzuführen, auch nicht so leicht zu verstehen war, wie er ursprünglich gedacht, die aber dazu berufen sein sollte, als unbeschreiblich hohes Lied der Liebe Millionen Herzen zu entflammen und zu besänftigen, eine musikalische Gestaltung und Verklärung des Liebessehnens, von der er schon nach dem dichterischen Einfall an Liszt geschrieben hatte: »Da ich aber doch im Leben nie das eigentliche Glück der Liebe genossen habe, so will ich diesem schönsten aller Träume noch ein Denkmal setzen, in dem vom Anfang bis zum Ende sich diese Liebe einmal so recht sättigen soll.« Jetzt, da ihm der Traum zur Wirklichkeit werden konnte, aber auch an ihr zerschellen mußte, rettete er sich in seine Kunst und verdankte den Traumgesichten eine neue, unerhörte Künstlerschaft. So blieb alles edel und erhaben – wie im Drama »Tristan und Isolde«. In der Tat: der allerbeste Fall, der bei so ernster Angelegenheit zu denken ist.
Und – Cosima gab ihm recht. War sie die einzige, die ihn verstand? Ahnte sie, durchschaute sie seine Gemütsverfassung? Jedenfalls empfing sie einen gewaltigen Eindruck, viel stärker noch als vom Schlusse der »Götterdämmerung« in Paris. Und mehr vielleicht als die Dichtung erregten sie die Worte des Dichters und das seltsam Geheimnisvolle seines tröstenden Nachwortes. Sie war jetzt – auf den Tag genau – seit einem Monat die Gattin Hans von Bülows. Ihr Fühlen und Trachten sollte nur auf ihren Mann gerichtet sein, und zu ihrer tiefsten Verwirrung sah sie ihr Innenleben von einer anderen, mächtigen Erscheinung gefesselt. Zu der natürlichen Befangenheit der bewundernden jungen Frau vor einer so starken Künstlerpersönlichkeit gesellte sich die qualvolle Unruhe der jung Vermählten, die sich über die Gefühle, die auf sie einstürmten, noch keine klare Rechenschaft geben konnte, die nur deutlich spürte, daß es auch für sie eine Tragik des Lebens gab, deren Druck durch alle Liebe und Achtung Bülows nicht von ihr genommen wurde. Wagner bedeutete für sie – um es auf die einfachste Formel zu bringen – die Störung ihres Gleichgewichtes, und sie hatte eine dunkle Angst vor seinem wachsenden Einflusse, der dadurch nicht geringer wurde, daß Wagner selbst sich in ihrer Gegenwart in freiester Weise gehen ließ, seiner natürlichen Lebhaftigkeit vor ihr keine Zügel auferlegte, ihr wohl auch einmal schroff widersprach, sie das andere Mal etwa wegen der Huldigungen, die ihr der Dichter Herwegh bereitete, gemütlich neckte und im ganzen so behandelte wie eine längst vertraute Freundin. Dagegen lehnte sie sich auf und blieb stumm oder abweisend, wofür sie, wenn man sie zur Rede stellte, den Grund angab, daß sie im Deutschen nicht so zu Hause sei wie im Französischen und sich daher nicht immer leicht mit dem übersprudelnden Wagner verständigen könne. Aber daß sie bei den Vorlesungen mit gesenktem Kopfe zuhörte, ohne etwas zu sagen, und nicht selten zu weinen anfing, das war für ihn doch wie eine stille Auszeichnung, wie ein stummes Bekenntnis.
Wagner erkannte, daß sie »ernstlich befangen« sei, gab seiner »rücksichtslosen Zutraulichkeit zu ihm sympathischen Personen, die ihm schon manche Entfremdung zugezogen«, die einzige Schuld an ihrem manchmal sonderbaren Benehmen und warb förmlich um die Freundschaft der »lieben jungen Frau«. Seiner mütterlichen Freundin Julie Ritter berichtete er über die Freude, die ihm dieser Besuch machte; er hielt das Paar »für so glücklich wie möglich ausgestattet: es ist, bei allem großen Verstand und bei wirklicher Genialität, soviel Leichtes, Schwunghaftes in den beiden Leutchen, daß man sich nur sehr wohl mit ihnen fühlen muß«. Und er sagte damit dasselbe, was ein so unbestochener Richter wie der scharf beobachtende und spaßhaft-knurrige Gottfried Keller, dem die »zierlichen Bülows-Leute« außerordentlich gefielen, einem Freunde mitteilte: er gestand, daß diese »vortreffliche und eigentümliche junge Frau, Cosima von Bülow, sein ganzes Herz gewonnen habe, wie seit langem kein Frauenzimmer. Man muß ihr wirklich alles Gute wünschen und möge sie bleiben, wie sie ist, in der renommistisch verschrobenen heutigen Welt«!
Cosima gewann auch sonst die Züricher Herzen. An Stelle ihres Gatten besuchte sie die hier wohnenden Berühmtheiten, über die die Fürstin in Weimar in ihrer »entsetzlichen Professorensucht« genauen Bericht haben wollte, und entwickelte dabei alle ihre gesellschaftlichen Gaben. Herwegh aber, der nicht nur berühmt, sondern auch der Freund Wagners war und den sie näher kennenlernte, schrieb ihr die Verse ins Stammbuch:
»Auf jedes Menschen Angesicht
Liegt leise dämmernd ausgebreitet
Ein sanfter Abglanz von dem Licht
Des Sternes, der sein Schicksal leitet.
Der Genius der Harmonie
Wird Dich mit seinen Wundertönen
Umrauschen, und Du wirst Dich nie
Mit der verstimmten Welt versöhnen.«
Bülows hatten die Ferienzeit gründlich ausgenützt. Nicht früher als in der ersten Oktoberwoche kehrten sie nach Berlin zurück. Sie nahmen den Weg wieder über Weimar, wo Hans noch einige Tage verweilte, indessen Cosima das Berliner Haus bestellte.
Nun begann wieder ein arbeitsreiches Jahr. Was Hans leistete, war wie stets bewunderungswürdig, begegnete aber auch neuen Widerständen, so daß ihm die gewohnten Kämpfe und Krämpfe, Ärgernisse und Enttäuschungen nicht erspart blieben. Dazu kamen wirtschaftliche Sorgen. Trotz seiner eifrigen Lehrtätigkeit und seinen vorteilhaften Beziehungen hatte Bülow kein großes Einkommen und war daher im wesentlichen auf das Heiratsgut seiner Frau angewiesen. Daß er selbst wenig erwarb, hing auch damit zusammen, daß es ihm eigentlich immer widerstrebte, Geld zu nehmen. Der Kavalier und Aristokrat konnte sich in die Formen des Erwerbs nur schwer hineinfinden. War aber Geld vorhanden, so wurde es nicht nur für das Nötigste ausgegeben. Wenn Bülow seinen Willen nicht anders durchsetzen konnte, so nahm er das geschäftliche Wagnis einer Veranstaltung mutig auf die eigene Tasche. Die jungen Eheleute mußten sich einschränken und verzichteten gern auf mancherlei Behagen, um ihre künstlerischen Ideale verwirklichen zu können. Cosima tat ein übriges: sie wurde Schriftstellerin und schaffte so willkommene Einnahmen.
Durch ihre Mutter, die unter dem Namen Daniel Stern schrieb, fand sie Zugang zu der in Paris erscheinenden, von Ch. Dollfus und A. Nefftzer herausgegebenen Revue Germanique, die ihre französischen Leser durch treffliche, vorurteilsfreie Aufsätze mit deutschem Wesen und Wirken und durch größtenteils wohlgelungene Übersetzungen besonders mit dem deutschen Schrifttum bekannt machte. Wir finden in den ersten Jahrgängen, neben fortlaufenden Berichten über Zeitereignisse und Kunsterscheinungen, Abhandlungen über deutsche Musik (mit Anerkennung Wagners und Liszts!), über Vischers Ästhetik, über Lenau, über Ranke, über Schopenhauer und über das Nibelungenlied, auch über die Antike, die Renaissance und Shakespeare auf Grund deutscher Forschungen und Betrachtungen. Wir finden Erzählungen, Bühnenwerke und lyrische Gedichte von Goethe, Kleist, Tieck, Immermann, Eichendorff, Rückert, Kerner, Freiligrath, Stifter, Halm, Heyse, Geibel, zum Teil nur in Auszügen oder Bruchstücken, auch Jakob Grimms Rede auf Schiller vom 10. November 1859. Da wurde eine in der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin gehaltene bedeutungsvolle Ansprache alsbald auch in französischer Sprache verbreitet. Zu den Mitarbeitern zählten, unter vielen anderen, Renan, Taine und Littré, drei der vornehmsten Vertreter französischer Geschichts- und Sprachwissenschaft. Das Beste des damaligen deutschen und französischen Geisteslebens fand in dieser Zeitschrift Raum, die in Wahrheit der Verständigung zwischen Deutschen und Franzosen diente. Es war ehrenvoll und glückbringend für jeden Neuling, der an dieser Stelle das Wort ergreifen durfte. Cosima verwertete ihre Beherrschung der französischen Sprache und ihr mit genialer Auffassung erworbenes tiefes Verständnis deutscher Dichtungen, wie auch ihre Kenntnis des Neuesten auf dem deutschen Büchermarkte, und übersetzte zunächst Friedrich Hebbel und Gustav Freytag. Ihre Wiedergabe der Hebbelschen »Maria Magdalene« und die einleitenden Bemerkungen über die Bedeutung des Dichters und die Eigenart seines Trauerspieles waren erstaunliche Beweise ihrer Sprachgewandtheit, ihres regen Geistes und ihrer lebensvollen Anschauung.
Wie wenig es ihr aber darum zu tun war, literarisch zu glänzen und einen »Namen« zu erwerben, das erhellt daraus, daß sie ihre Beiträge namenlos erscheinen ließ. Im übrigen fühlte sie sich nicht nur als Schriftstellerin, sondern auch als Dichterin. Bülow hätte am liebsten den Erwerb an den Nagel gehängt und sich nur dem Schaffen ergeben. In dem durch manchen Zweifel gestörten Glauben an seine Berufung wurde er durch Wagner ermuntert und bestärkt. Nun wollte er auch ein Musikdrama schreiben. Die Überzeugung, daß dies die höchste Kunstgattung sei, neben der die »absolute Musik« und die musikalische Lyrik nur eine untergeordnete Bedeutung hätten, begegnete sich mit dem Wunsche, durch einen Bühnenerfolg seinem schwankenden Leben eine feste Grundlage zu sichern. Frühzeitig hatte er sich mit romantischen Sagen beschäftigt, und nachdem er sogar schon einmal an den Tristan gedacht hatte, der jetzt natürlich Wagner vorbehalten blieb, verbiß er sich förmlich in den Merlin-Stoff. »Gestalten – Menschen – Halbgötter – einen Satan, welch rasende Wollust!« Aber den Versuch, sich das Buch selbst zu schreiben, gab er bald auf, wohl hauptsächlich deshalb, weil er nicht die Zeit und Muße dazu fand. So dachte er an Alfred Meißner, dessen Gedichte ihn geistesverwandt berührten, und wandte sich an Richard Pohl, von dem er schon einiges vertont hatte. Doch dieser versagte, und Bülow hatte schließlich wenig Hoffnung, ein geeignetes Buch zu erlangen. Da erwies Cosima ihr teilnehmendes Verständnis und ihre schöpferische Begabung. Sie entwarf zunächst die Handlung, ohne dies ihrem Manne zu verraten, und besprach sich mit einem kundigen Freunde über die Art der Ausführung.
Dieser Freund war Ernst Dohm, der Leiter des »Kladderadatsch«. Man stutzt, wenn man von der näheren Verbindung Cosimas mit einem – Witzblatte hört. Man muß jedoch wissen, daß der »Kladderadatsch« sich sehr vorteilhaft von anderen, ähnlichen Blättern unterschied, wie sie damals eine gewisse Rolle spielten und merklich dazu beitrugen, ein unbefangenes und gesundes Urteil der Kunstfreunde über neue Künstler und Werke zu erschweren. In dem Kampfe Wagners und Liszts gegen Feindseligkeit und Unverständnis waren es nicht zuletzt die teils stumpfsinnigen, teils aber auch vergifteten Witze und Verhöhnungen in Wort und Bild, die geradezu eine Scheidewand aufrichteten zwischen Genie und Volk. Der »Kladderadatsch«, das führende Berliner Witzblatt, hat hingegen die so leicht zu mißbrauchenden Waffen des Spottes und der Verzerrung für die neue Kunst gebraucht und all den Geist und die Begabung, die auch für diese Art des Kampfes unentbehrlich sind, in den Dienst des Guten und Verehrungswürdigen gestellt. Das war vor allem das Verdienst Dohms, der im Jahre 1849 die noch junge Zeitschrift übernommen hatte und sie bis zum Jahre 1882 leitete. Bald danach starb er, bis zum letzten Atemzuge Hans und Cosima getreu, mit denen er sich in ihrer jungen Zeit warm befreundet hatte. Seine natürliche Lebhaftigkeit, sein frisches Draufgängertum, seine geistige Beweglichkeit befähigten ihn gar wohl zu seinem Amte. Aber er war durchaus kein bloßer Spaßmacher, in ihm lebte vielmehr ein wahrer Ernst in der Erfassung des Guten und Schönen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens und der Kunst. Er hatte ursprünglich Philosophie und Theologie studiert, doch seine angeborenen Eigenschaften ließen ihn weder für die Gottesgelahrtheit noch für irgendein Professorentum geeignet erscheinen. Eine schicksalhafte Wendung führte ihn zur rechten Zeit auf den rechten Platz, wo er die erworbenen Kenntnisse und seine umfassende Bildung nun auf ganz persönliche Art in einer sehr wirksamen, volkstümlichen Weise anwenden konnte.
Dohm war nicht der einzige Mann der Literatur oder der Wissenschaft, mit dem Bülows verkehrten. Wenn Liszt zu Besuch kam, wurden Gesellschaften gegeben, in denen das geistige Berlin in stattlicher Zahl und mit einigen sehr berühmten Namen vertreten war und die Musik keineswegs vorherrschte. Die Neigung zur Bühnenkunst ergab auch die Berührung mit darstellenden Künstlern, von denen besonders zwei Schauspielerinnen genannt seien: Marie Seebach, deren hinreißendes Gretchen von Cosima noch in ihren späten Tagen gerühmt wurde, und Ellen Franz, die spätere Freifrau von Heldburg und Gattin des Herzogs Georg von Meiningen, die mit Cosima zeitlebens in Freundschaft verbunden blieb. Die Opernsängerin Johanna Wagner stand dem Paare nicht nur durch ihren Beruf, sondern namentlich auch durch ihren Oheim Richard Wagner, dessen erste, Dresdner Elisabeth sie gewesen, persönlich nahe. Unabhängig und unbeeinflußt von Wagners Urteil kamen auch Bülows zur Überzeugung, daß diese Sängerin, bei allen Gaben, deren sie sich rühmen durfte, nicht die rechte Wagner-Sängerin sei. Der hohe Sinn der Wagnerschen Kunst war ihr nicht aufgegangen. Hans, dessen Mutter die Künstlerin besonders schätzte, konnte dieser seine Anerkennung nicht ganz versagen, er meinte, er habe noch nie »eine solche Virtuosität des Scheines von Genialität gesehen«. Aber er war schlecht auf sie zu sprechen, weil sie scheinbar nichts für die häufige und würdige Aufführung Wagnerscher Werke in Berlin tat und sich fortwährend in italienischen Opern, in Dorns »Nibelungen« und Tauberts »Macbeth« feiern ließ. In seiner witzig-boshaften Weise schrieb er einmal an Alexander Ritter, den Bruder Karls, der mit der Schwester Johannas, Franziska Wagner, vermählt war: »Fast möchte ich glauben, daß Taubert der Onkel Deiner Schwägerin ist.« Viel herzlicher gestaltete sich der Verkehr mit Alwine Frommann, der Vorleserin der Kronprinzessin, die mit Wagners Schwester Klara Wolfram und mit den Frauen Julie Ritter und Eliza Wille den Vorzug genoß, daß der im Leben schwer bedrängte Künstler ihnen auch seine Ehenöte und Herzenswirren anvertraute. Zu den Leuchten der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens, die bei Bülows verkehrten, zählten der Religionsphilosoph und konservative Politiker Bruno Bauer und der schon dem Ende seines Lebens zuneigende Offizier, Diplomat und Schriftsteller Karl August Varnhagen von Ense, der für Cosima besondere Verehrung hegte und ihr in seinem eigenen Hause die größten Aufmerksamkeiten erwies. Im Verkehre mit dem Astronomen Schiaparelli gewann sie neue Teilnahme für Mathematik und Astronomie.
Einer aber blieb ihr innerlich fremd, der ihrem Gatten recht nahe stand: Ferdinand Lassalle, der Begründer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Dieser war nicht nur Arbeiterführer und ein Mann des »radikalen« Fortschritts, sondern auch Weltmann von den feinsten Umgangsformen und spielte eine Rolle in der Berliner Gesellschaft – eine Mischung von Diplomat und Revolutionär, die, bei unverkennbar jüdischer Färbung, doch für viele etwas Bestechendes hatte, auch für Bülow, dessen soziales Fühlen besonders lebhaft war und dessen politisches Denken mit den alten überlieferten Mächten im Kampfe lag. Auf Veranlassung Lassalles vertonte er das Bundeslied des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins von Georg Herwegh für vierstimmigen Männerchor. Aber die Einfalt Cosimas, wenn man so sagen darf, war für das Zwiespältige und seltsam Schillernde der Lassalleschen Persönlichkeit nicht zu haben. Sie ließ sich nicht durch einzelne gewinnende Eigenschaften fesseln, sondern spürte die fremde, finstere Welt, aus der dieser Mann ihr schimmernd entgegentrat und deren Spuren er trotz seiner salonmäßigen Verkleidung in ihren Augen nicht verwischen konnte. Sie durfte ihm den Umgang mit ihr nicht verwehren, doch sie ging an die äußerste Grenze dessen, was mit Höflichkeit vereinbar ist. Sie trachtete, ihn niemals allein zu empfangen, und vermied es, seine Einladungen anzunehmen. Lassalle merkte das, aber verlor seine Fassung nicht. So schrieb er einmal an Bülow: »Durch Gegenwärtiges erlaube ich mir, Sie wie Ihre verehrte Frau Gemahlin zu einem kleinen Dinner … ergebenst einzuladen. Lange Erfahrung hat mich gelehrt, daß immer für Ihre Frau Gemahlin ein unvermeidliches Hindernis in den Weg tritt, wenn ich die Ehre haben soll, sie bei mir zu sehen … Abergläubig wie ich bin, fürchte ich fast, daß ihr gewohnheitsmäßiges Unglück sich auch diesmal wiederholen könnte!«
Wagner selbst freilich hielt das Ehepaar mächtig im Banne. Die zweiten Ferien verbrachte es wieder größtenteils in Zürich. »Dich, Hans, hab' ich ungeheuer gern«, so hatte ihm Wagner zu Beginn des Jahres geschrieben. »Wenn ich die kargen Freuden meines Lebens zähle, kommst Du gleich in die Hauptzahlen … Deine Schicksale liegen mir so nah, als ob es die meinigen wären.« Was »den vortrefflichen Cosimus« betraf, dessen warme Freundschaft mit Herweghs ihn ein wenig eifersüchtig machte, so hatte er das Gefühl, mit ihm, nämlich mit Cosima, in einem »stillen Krieg« zu sein, aber er grüßte das »Mazepparoß« herzlichst – weshalb Mazepparoß? war Hans gewaltsam an sie gefesselt und von ihr willenlos dahingeschleift? – er grüßte sie und ließ ihr sagen, daß er sie »erkenne und liebe«.
In seinem Züricher Hause waren seither schwerwiegende Veränderungen vor sich gegangen. Seine Frau Minna, die ihm in der Pariser Leidenszeit opferwillig zur Seite gestanden, die aber seinem Geistesfluge nicht zu folgen vermochte und sich schon in Dresden innerlich von ihm getrennt hatte, betrachtete seine Seelengemeinschaft mit Mathilde Wesendonck mit argwöhnischer Eifersucht. Ihre an sich begreifliche, aber der Formen nicht achtende, sich verletzend, ja unziemlich äußernde Abneigung gegen die Nachbarin und Gönnerin hatte endlich dahin geführt, daß es weder mit der Ehre Wagners noch mit seiner äußeren Ruhe vereinbar gewesen wäre, noch länger in dieser Nachbarschaft zu bleiben und diese Gönnerschaft zu genießen. So war die Auflösung des Züricher Haushaltes unvermeidlich geworden. Eine zeitweilige Trennung der beiden Gatten durch eine Badekur Minnas in Brestenberg trug wohl zur Linderung ihres Herzleidens, sonst aber nur zur Erschwerung der bestehenden Verhältnisse bei. Denn als Minna aus dem Bade zurückkehrte, errichtete ihr Diener eine Art von Ehrenpforte zum Empfange seiner Herrin. Minna faßte diese Huldigung, die nicht von ihrem Manne ausging, die aber der Nachbarin Frau Wesendonck stark ins Auge fallen mußte, als einen Triumph über ihre Nebenbuhlerin auf und sorgte dafür, daß das blumengeschmückte Festzeichen mehrere Tage lang nicht entfernt wurde. Dies machte auf Frau Wesendonck, die schon durch die früher gefallenen Beleidigungen heftig getroffen war, einen tief verwundenden Eindruck, und so standen jetzt beide Nachbarhäuser in hellen Flammen. Was die Sache aber noch besonders peinlich machte, das waren die Besuche, die Wagner um diese Zeit zu empfangen hatte. Kurz vorher war er sehr erfreut gewesen, mit dem Kapellmeister Heinrich Esser aus Wien wegen der dortigen Aufführung des »Lohengrin« verhandeln zu können. Esser hatte ihm auf Grund des zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrages sofort 1000 Gulden ausbezahlt und ihn dadurch in die beste Stimmung versetzt, am »Tristan« weiterzuarbeiten. Von diesem war der zweite Aufzug im Werden, der erste wurde schon bei Breitkopf & Härtel gestochen, Hans von Bülow verfertigte den Klavierauszug. Nunmehr jedoch gab es nichts als Störungen und Belästigungen. Wagners Dresdner Freund, der Tenorist Josef Tichatschek, der erste Tannhäuser, war bei ihm eingetroffen und wohnte im Fremdenstübchen des Asyls. Da kam auch der junge, seiner großen Begabung wegen für den Tristan empfohlene Tenorist Albert Niemann mit seiner Braut, der Schauspielerin Seebach, nach Zürich, und Wagner hatte demnach zwei bedeutende Tenoristen zugleich zu unterhalten und zu bewirten, was den sonderbaren Übelstand mit sich brachte, daß keiner von beiden etwas singen wollte. Eben während dieser Verlegenheiten trafen Bülows in Zürich ein, am 12. Juli 1858.
Sie hatten unterwegs den Freiburger Dom und den Rheinfall von Schaffhausen besichtigt und mußten, wie im vorigen Jahre, mehrere Tage im Gasthofe bleiben, bis das Zimmer bei Wagner frei geworden. Endlich reiste Tichatschek ab, und das befreundete Paar, das nun im Asyle einzog, kam für Wagner »wie vom Himmel, um der greulichen Aufregung in seinem Hause einen Dämpfer aufzusetzen«. Knapp vor dem Einzuge überraschte ihn Hans bei einem sehr erregten Auftritte mit Minna, der ihr Mann soeben unumwunden erklärt hatte, daß er nur noch den Besuch der Berliner Freunde vorübergehen lasse, dann aber seine Abreise nicht länger verzögern dürfe. Hans trug Bedenken, die Gastfreundschaft Wagners unter solchen Umständen anzunehmen. Doch Wagner schrieb ihm am nächsten Tage: »Meine Frau läßt Euch bitten, unverzüglich bei uns einzuziehen: sie hofft auch für die notwendige Wiederanknüpfung unseres Umgangs mit Wesendoncks durch Euren Besuch bei uns das Beste und begrüßt Euch als sehr willkommen … Wenn es törig wäre zu verlangen, Du mögest das Vorgefallene vergessen, so bitte ich Dich doch, es nicht mehr zu erwähnen: nehmen wir an, Ihr kämt heute erst an … Laßt Euch so bald als möglich willkommen heißen!« Bülows folgten diesem Rufe; doch man ermesse die Stimmung, in der sich alle befanden; man ermesse vor allem die Stimmung Wagners. Fortwährend auf neue Auftritte gefaßt, dabei gänzlich ungewiß über seine nächste Zukunft, sollte er den freundlichen Wirt machen und sich dieses von ihm selbst lang erwarteten, bang ersehnten Besuches ehrlich freuen. »Um das Maß der Freudlosigkeit eines so sonderbaren gastlichen Zusammenseins voll zu machen«, traf Karl Klindworth in Zürich ein, der Verfasser der Klavierauszüge des »Rings«, den Wagner vor drei Jahren in London kennengelernt und als dauernden Freund gewonnen hatte. In Zürich hielt sich damals auch der Liszt-Schüler und begeisterte Anhänger Wagners, Karl Tausig, auf. So füllte sich täglich das Asyl und besetzte sich Wagners gastlicher Tisch bei den Mahlzeiten mit aufrichtig teilnehmenden, unheimlich beängstigten, schmerzlich besorgten Freunden, die nur merkten, daß hier alles schwankte, ohne den wahren Grund zu kennen, ohne die Hauptbeteiligten darob befragen zu dürfen, und die sich nun gegenseitig auf das beste zu zerstreuen und zu erheitern suchten.
Das Ende Juli in Zürich stattfindende Eidgenössische Sängerfest, bei dem Franz Lachner, ein Gegner Wagners, dirigierte, trug wohl zur Zerstreuung, aber just nicht zur Gemütlichkeit bei. Eine Kindstaufe bei Herweghs, wo Cosima mit Gottfried Semper zu Gevatter stand, wurde auch beinahe als Störung empfunden. Wagner sehnte sich nach Liszt, der nach seiner Auffassung dazu befähigt war, »Licht und Besänftigung oder doch mindestens eine erträgliche Ordnung« in die allgemeine Verwirrung zu bringen, der durch seine Welterfahrenheit und durch seine überlegene Persönlichkeit ihm dazu berufen schien, auch den zwischen den beiden Frauen – Minna und Mathilde – spielenden »Unsinnigkeiten vernünftig beizukommen«. Schon war Wagner geneigt, seine letzten Entschlüsse von der Wirkung des Lisztschen Besuches abhängig zu machen. Aber Liszt stellte seinen Besuch oder vielmehr eine Zusammenkunft mit Wagner außerhalb Zürichs erst für später in Aussicht. Da sank diesem der letzte Mut. Das Zusammensein mit seinen Freunden war ihm jetzt nur noch »ein trostloses Dahinsiechen; denn konnte einerseits niemand begreifen, wie ich aus einer mir so wohltätigen Niederlassung ruhelos hinausgetrieben werden sollte, so war andererseits jedem es ersichtlich, daß ich so hier es nicht aushalten konnte«. Diese Worte Wagners in seinen Lebenserinnerungen, in denen er sonst rückschauend den bedenklichsten Lagen die humoristische Seite abzugewinnen weiß, verraten uns die qualvolle Lage, in der er sich befand; qualvoll nicht zuletzt darum, weil ja der Aufbruch von Zürich, die Flucht ins Ungewisse, zugleich die vollständige Trennung von Mathilde Wesendonck zu bedeuten hatte. Die Freunde musizierten miteinander, »aber in großer Zerstreutheit und nur mit halbem Sinne«, und »alles, was unter anderen Umständen diesen sommerlichen Monat zu einem der anregungsvollsten meines Lebens hätte machen können, trug nur zu dem Unbehagen dieser Zeit bei«: auch Marie d'Agoult traf in Zürich ein, um ihre Tochter wiederzusehen und ihren Schwiegersohn kennenzulernen! Endlich tauchte nach längerer Abwesenheit Karl Ritter auf, der in seiner Ehe nicht glücklich war.
Am 24. Juli schrieb Hans von Bülow an Richard Pohl. Er entschuldigte sein längeres Schweigen »durch die eigentümlich komplizierten, in den ersten Tagen so unleidlichen und auf die Spitze getriebenen Verhältnisse, in die ich hier hineingeriet, daß ich, wenn meine Schwiegermutter eben nicht anwesend gewesen wäre und sich so liebenswürdig und freundlich gegen mich bezeigt, stracks nach Lausanne oder irgend sonst wohin gereist sein würde. Nun sind denn aber allmählich die Dinge und Personen einigermaßen möglich geworden; seit Mittwoch bin ich mit meiner Frau installiert, und unter den verlebten Stunden sind bereits einige ganz interessante aufzuzählen, obgleich die Luft noch schwül und gewitterschwanger. Klage mich nicht unfreundschaftlicher Zurückhaltung und Verschlossenheit an, wenn ich für heute es nicht unternehmen kann, Dir die genannten Rätsel zu lösen, die selbst noch ungelöst, vielleicht unlösbar überhaupt«. Dann heißt es: »Daniel Stern hat mir einen großen, unerwarteten Eindruck gemacht. Noch immer wunderschön und edel an Gestalt und Zügen, in ihrem weißen Haar, frappierte sie mich namentlich durch die unverkennbare große Ähnlichkeit mit Liszts Profil und Ausdruck, so daß Siegmund und Sieglinde mir unmittelbar in den Sinn kamen. Dabei diese Würde und Hoheit ohne alle Strenge – das elegante feine laissez-aller, was den Gegenübersitzenden in die behaglichste, geistig freieste Stimmung bringt, die ihm auch die möglichst günstige Entfaltung seines Wesens gestattet – ich gestehe, daß ich nach dem allen ganz bezaubert bin und meine Gedanken gar nicht mehr so weit im Zaum halten kann, um nicht an die unsägliche Befriedigung zu denken, mit welcher mich die Vorstellung erfüllen würde, diese schöne bedeutende Frau, die in zehn Jahren das Ideal einer geistig frischen Matrone repräsentieren wird, neben dem Einzigen zu sehen, dessen olympisches Wesen gesellschaftlich ergänzend. Ich darf nicht daran denken. Und doch – wie ungerecht wäre es, gegen die andere Frau zu eifern, die so vielen Anspruch auf lebhafte Verteidigung von seiten derer besitzt, die sie einigermaßen kennengelernt. Nun – es ist eben nur der natürliche äußerliche Schönheitssinn, der gegen sie protestiert und protestieren darf.« Die Erscheinung der Fürstin Wittgenstein hat wiederholt Befremden erregt. Auch seiner Mutter, die noch vor der persönlichen Bekanntschaft erfahren hatte, daß die Fürstin nicht schön sei, hatte Liszt mit einer gewissen Nervosität geschrieben: »Ich, der sich einbildet ein Schönheitskenner zu sein, behaupte, daß die Fürstin schön, sogar sehr schön ist, denn ihre Seele verklärt ihr Antlitz zu hoher Schönheit.« Diese Worte waren ein Hieb gegen Marie d'Agoult.
Am 9. August schrieb Bülow an Pohl: »Von hier aus ist nur Trauriges zu melden. Wagner verläßt binnen acht Tagen seine schöne Villa, anderwärts Ruhe zu suchen in größerer Ferne … Frau Wagner geht nach dem Verkauf und der Einpackung der Möbel nach Deutschland … Wir alle – Tausig – Klindworth (ein prächtiger, liebenswürdiger Mensch) – Ritter – meine Frau und ich vermochten wenig zu Wagners Erheiterung oder Zerstreuung zu tun. Immer Gewitterschwüle. Einige schöne Lichtpunkte waren die mehrmaligen Klavieraufführungen des ›Rheingold‹ und der ›Walküre‹. Klindworth spielt famos, hinreißend. Wagner sang alle Partien mit einer kolossalen Selbstvergessenheit unter Aufwand aller Kräfte.« Am selben Tage bat Bülow seinen Vorgesetzten Julius Stern in Berlin um Urlaubsverlängerung. »Der eigentliche, ziemlich triftige Grund ist der, daß meine Gegenwart in Zürich Wagner jetzt von wesentlicher Wichtigkeit ist, da er durch sehr traurige und komplizierte, hier wohl nicht berührbare Verhältnisse zu dem Entschlusse gedrängt worden ist, Zürich aufzugeben und sich nach Italien zu begeben, wo er sich vorderhand in Venedig oder Florenz niederzulassen gedenkt. Die Ausführung dieses Entschlusses geschieht, wenigstens was ihn betrifft, in den nächsten Tagen schon, und Sie werden mir gewiß nicht verdenken, daß ich mit Rücksicht auf die Schwierigkeit, meinen geliebten Freund vor einigen Jahren wiederzusehen, gern die wenigen Stunden, die es mir vergönnt ist, mit ihm noch zuzubringen, ausbeuten möchte. Darf ich Sie übrigens bitten, von dem Mitgeteilten nichts an Dritte verlauten zu lassen.« Während Hans demnach solange als möglich bei Wagner aushielt, um ihm beizustehen, verließ Cosima für eine kurze Weile Zürich, um ihre Mutter bis Genf zu begleiten und dort auch mit ihrer Schwester Blandine zusammenzutreffen. Karl Ritter schloß sich ihnen an und erbot sich als Begleiter Cosimas auf der Rückfahrt. Während des kurzen Aufenthaltes in Genf ereigneten sich nun ganz merkwürdige Vorfälle.
Als Cosima wieder in Zürich war, zeigte sie sich sehr aufgeregt. Das »äußerte sich namentlich in krampfhaft heftigen Zärtlichkeiten« gegen Wagner. Als die Stunde des Abschiedes schlug, fiel sie ihm zu Füßen und bedeckte seine Hände mit Tränen und Küssen, so daß er erstaunt und erschreckt diesem Rätsel nachblickte. Wir erfahren dies aus dem Tagebuche, das er in den folgenden Wochen für Mathilde Wesendonck verfaßte. Er war nach Venedig gereist, in Begleitung Karl Ritters. Auch dieser hatte sich von seiner Frau getrennt und berichtete ihm nun über das seltsame Verhältnis, in das er plötzlich zu Cosima geraten sei. Sie seien beide in Genf nahe »daran gewesen, sich umzubringen. Cosima habe plötzlich mit einem schrecklichen Ausbruche von ihm verlangt, er solle sie töten; er habe dagegen sich erboten, mit ihr zu sterben; das habe sie aber durchaus abgewiesen. Nachdem beide eine Fahrt auf dem See unternommen, Cosima in der Absicht, sich zu ertränken, Karl in der, ihr zu folgen, habe die erstere ihren Vorsatz aufgegeben, weil sie Karl von dem Willen, mit ihr zu sterben, nicht habe abbringen können. So sei alles in einer leidenschaftlich unklaren Schwebe gelassen worden; beide trennten sich mit dem Übereinkommen, in drei Wochen sich von ihrem gegenseitigen Zustande, ihrer Stimmung und ihren weiteren Entschlüssen Nachricht zu geben«. Nach Ablauf der drei Wochen erhielt Karl tatsächlich einen Brief von Cosima, worin sie ihre Heftigkeit bereute, ihre Beschämung eingestand, für die zarte Schonung dankte und um Vergessen bat. Diese Tagebuchstellen sind in den von den befugten Erben veranstalteten Ausgaben der Briefe Wagners an Frau Wesendonck nicht enthalten, sondern erst nach dem Tode Cosimas bekanntgeworden.
Für die einer oberflächlichen Betrachtung entgegenkommende Annahme, daß in Cosima ein leidenschaftliches Gefühl für Ritter entbrannt sei, fehlt jede Grundlage. Möglich, ja wahrscheinlich, daß Ritter als trostbedürftiger Ehemann von der Frau, die auf Bülow und Herwegh einen so starken Eindruck machte, auch mächtig erregt wurde, und wohl verständlich, daß er ihr in seiner Lage sein Herz öffnete. Cosima scheint nun durch seine Bekenntnisse zur klaren Erkenntnis ihres eigenen unbefriedigten Seelenzustandes gelangt zu sein, und bei ihrer Jugend und ihrer romantischen Geistesrichtung konnte sich der Schmerz, dem sie sich im ungehemmten Verkehre mit Ritter in einer das Gemüt ergreifenden landschaftlichen Umgebung hingab, bis zum vorübergehenden Verlangen nach dem Tode steigern. Ritter, von dessen heftiger, gewissermaßen aufrührerischer Art, die seinen Freunden viel zu schaffen machte, wir auch anderweitig Kunde haben – Ritter scheint nach den Mitteilungen Wagners durch sein allzu kühnes Eingehen auf die Überschwenglichkeiten Cosimas diese alsbald zur Besinnung gebracht zu haben. Wagner vergleicht in seinen Aufzeichnungen die eigene, abgeklärte Neigung zu Mathilde Wesendonck mit dem unreifen Gebaren der beiden jungen Leute, und so ist er wohl auch Cosima selbst nach ihrer Rückkehr als Prüfer und Richter erschienen, vor dessen Hoheit ihr das Gefährliche und Unvernünftige der kaum überwundenen schrankenlosen Erregung erst ganz klar zum Bewußtsein kam. Daher die reumütige Gebärde, mit der sie ihm zu Füßen fiel. Wer selbst jung gewesen ist und wer weiß, wie es in jungen Gemütern zugeht, der kennt die eigentümlichen Rauschzustände, in die zwei Personen verschiedenen Geschlechts ohne gegenseitige Liebe, nur durch gemeinsames Unglück versetzt werden können.
Das Unglück Cosimas liegt in diesem Falle offen zutage: so oft sie Wagner gegenüberstand, erschien ihr die Verbindung mit Bülow als etwas Unnatürliches oder Verhängnisvolles. Sie wußte noch nicht, daß sie Wagner liebte, aber sie mußte sich sagen, daß das, was sie mit Bülow verband, nicht Liebe sei; Achtung, Teilnahme, herzliche Freundschaft, aber nicht jenes hohe, alles andere auslöschende Gefühl, das in den einfachsten Menschen wie eine göttliche Erleuchtung wirkt und namentlich den Frauen ungeahnte Kräfte verleiht. Dieselbe lähmende Befangenheit wie im vorigen Jahre auf ihrer Hochzeitsreise befiel sie auch jetzt wieder im Umgange mit Wagner, der in allen seinen Dichtungen und in den Worten, mit denen er sie erläuterte, nichts anderes war als der Verkünder der Liebe und der Engelhaftigkeit des liebenden Weibes. Ihre Lähmung wich endlich dem letzten Ausbruche beim bevorstehenden Abschiede; die innere Spannung löste sich in Tränen und Selbstvorwürfen. Ritter fühlte sich, als ihm Cosima nach den vereinbarten drei Wochen deutlich zu verstehen gab, daß sie fürder nichts miteinander gemein hätten, »bitter beleidigt«. Der wahrhaft Bemitleidenswerte war Hans von Bülow. Der sah in der Ehe nur einen besonders geweihten Freundschaftsbund und konnte seiner Frau das Zeugnis ausstellen, daß sie sich als Freundin wundervoll bewährte. Wir werden sehen, daß seine ehrfürchtige Dankbarkeit für Cosima mit den folgenden Jahren noch zunahm. Doch er hatte – und dies ist freilich auch seine Schuld – von den Stürmen in der Seele seines Weibes keine Ahnung. Ob er fähig gewesen wäre, ihr den rechten inneren Halt zu geben, das steht eigentlich nicht zur Frage; denn er wußte gar nicht, daß sie eines Haltes bedurfte. Er sah in ihr die Stärkere, die imstande war, ihn aufzurichten. Er blickte bewundernd zu ihr empor und hätte sich niemals einfallen lassen, daß sie neben ihm darbte. Er kannte die Bedürfnisse der Liebe nicht. Auch er war in diesen Tagen tief erregt, aber nicht um Cosimas willen, sondern weil er Wagners Bedrängnis miterlebte. In seiner Begleitung nahm Wagner von Frau Wesendonck Abschied.
So haben wir hier das Musterbeispiel einer Ehe, die von außen gar nicht gestört ist, die auf der denkbar günstigsten Übereinstimmung des beiderseitigen Wollens und Strebens beruht und die dennoch, wie Wagner in seinem Tagebuche vermerkte, eine tragische Ehe war. Wagner sah dabei vor allem die natürliche Tragik jugendlicher Ehen. »Außer bei ganz unbedeutenden Personen ist mir noch keine begegnet, in der mit der Zeit nicht ein tiefer Irrtum zutage kam. Welches Elend dann! Seele, Charakter, Anlagen – alles muß verkümmern, wenn nicht außerordentliche, und dann doch nur sehr leidenvolle, neue Beziehungen hinzutreten.«
Am 16. August verließen Bülows das Asyl auf dem grünen Hügel, »Hans in Tränen aufgelöst, Cosima« – nach wiedererlangter Fassung – »düster schweigend«, wie uns Wagner berichtet. Am nächsten Morgen um fünf Uhr reiste dieser ab. Anfang September erhielt er einen Brief von Hans. Da lesen wir die bedeutsamen Sätze: »Meine Frau ist wieder höchst liebenswürdig – ich wünschte, Du lerntest sie einmal anders kennen, als wie bisher in Deinem Hause. Vor Dir pflegte bisher ihre Gesprächigkeit zu verstummen, ihr offenes expansives Wesen sich zurückzuziehen. Es lag ein Kompliment, wenn auch ein übel angebrachtes, für Dich darin: ›Ehrfurcht hielt sie in Bann.‹ Nun fürchtet sie immer, Du hieltest sie für kindisch und allzu unbedeutend, um Dich lieben zu können und Dich zu verstehen. Und sie ist doch eine von den sehr wenigen, die das gerade vermag … Für Deine diesjährige Gastfreundschaft habe ich Dir noch nicht gedankt. So schmerzlich es mir war, Dich leiden zu sehen und das heiligste Deiner Existenz gefährdet – so möchte ich doch um keinen Preis der Welt nicht die Zeit über bei Dir gewesen sein. Deine Nähe hat mich doch wieder so entzückt und erfrischt, daß ich wieder auf lange davon zehren werde. Hätte ich Dir nur etwas sein können, Dir wenn auch nichts Gutes bringen, doch Schlimmes fernhalten. Aber so ist es leider in der Welt: der hat den guten Willen, jener die Macht. Verachte meine Ohnmacht nicht.«
Zu Weihnachten lag der »Merlin« auf dem Gabentische Hans von Bülows. Diese gemeinsame Arbeit Cosimas und Ernst Dohms ist leider völlig verschwunden, gänzlich unauffindbar. Bülow hat sie nie vertont, und niemand weiß, was mit der Dichtung geschehen ist. Ein anderer, unvollendeter Entwurf von der Hand Cosimas ist uns erhalten geblieben: eine Umformung der »Orestie« des Äschylus, für die der »Ring« als Vorbild diente. Doch auch diese dichterische Anregung blieb vergeblich. So heftig Bülow nach einem Drama verlangt hatte, das alle seine schöpferischen Kräfte wecken sollte, so wenig machte er nun von diesen Vorlagen Gebrauch. Seine überaus lebhafte, sich immer mehr entfaltende praktische Tätigkeit konnte nicht der alleinige Grund sein, daß von keinen größeren Schaffensplänen mehr die Rede war. Wenn Bülow vielleicht zu gehetzt und dabei körperlich zu wenig widerstandsfähig war, um gleichzeitig den Forderungen des Tages und dem Rufe der Unsterblichkeit dienen zu können, so wundert es uns doch, daß er gar nie den Versuch machte oder der Versuchung erlag, einmal gründlich auszuspannen und für eine Weile nur den inneren Stimmen zu lauschen. Wir kennen allerdings seine vorbildliche Gewissenhaftigkeit: eine Verpflichtung, die er übernommen hatte, gab ihn immer erst dann frei, wenn sie erfüllt war. Mit Julius Stern und mit anderen Unternehmern, die ihn brauchten, gab es fortwährend persönliche Reibungen; aber die Einhaltung von Verträgen, die Durchführung des einmal Begonnenen war für Bülow erstes Gebot. Und jetzt war seine ganze »freie« Zeit, jede Minute seines Daseins, die ihm gehörte, ausgefüllt durch die schwerste Aufgabe, die ihm je gestellt wurde: durch die Herstellung des Klavierauszuges zu »Tristan und Isolde«.
Die Tristan-Musik, die sich von allem unterschied, was Wagner bis dahin geschaffen hatte, erforderte auch ganz neue Künste und Kniffe, wenn sie vollkommen deutlich und dabei halbwegs spielbar für das Klavier zu zwei Händen übertragen werden sollte. Wie Klindworth bisher das »Rheingold« und die »Walküre« bearbeitet hatte, das konnte kaum als Vorbild dienen, weil der »Tristan« eben anders war, eine andere Behandlung des Orchesters und eine unermeßlich gesteigerte Polyphonie aufwies, die des Klavierspielers zu spotten schien. Überdies war Bülow bestrebt, seinen Auszug trotz den größeren Schwierigkeiten brauchbarer, menschlicher zu gestalten, als es Klindworth bei seinen Ausgaben gelungen war. Was Bülow leistete, steht in der Tat einzig und unerreicht da in der Geschichte der Klavier-Übertragungen, wenn es auch, wie alles Technische und Handwerkliche, seither in Einzelheiten übertroffen worden ist. Nur der »legitime Erbe« Liszts konnte das vollbringen, und auch er nur, weil er bis in die Tiefen seiner Seele durchdrungen war von der Gewalt und Herrlichkeit dieser neuen Musik. Er fand sie zwar »antiklavierig« im höchsten Maße, er schwitzte wie ein »Galehrling« bei seiner Arbeit, er zerbrach sich über manchen Takt eine halbe Stunde lang den Kopf, aber er geriet auch immer wieder außer sich über dieses »grandiose, kolossale, prachtvolle, riesige Werk«, von dem er an Brendel schrieb: »Hier ist die Verwirklichung von Wagners Tendenzen, und zwar in ganz ungeahnter Weise. Solche Musik hat niemand von Wagner erwartet. Das knüpft direkt an den letzten Beethoven an – keine Analogie mehr zu Weber oder Gluck. Zum ›Lohengrin‹ verhält sich ›Tristan‹, wie ›Fidelio‹ zur ›Entführung aus dem Serail‹ … Ich gestehe, aus einer Überraschung des Entzückens in die andere geraten zu sein. Welcher Musiker hier noch nicht an den Fortschritt glauben will, der hat keine Ohren … Von dieser Architektonik, dieser musikalischen Detailarbeit können Sie sich keinen zu hohen Begriff machen. An Erfindung ist ›Tristan‹ Wagners potentestes Werk. Nichts ist so erhaben wie z. B. der zweite Akt … Wen diese Oper nicht bekehrt, der hat keine Musik im Leibe … Sie kennen mich zu gut, als daß Sie meinen sollten, ich wäre in überspannte Schwärmerei verfallen: Sie wissen, daß mein Herz erst bei der Behörde des Kopfes um Erlaubnis fragt, sich zu begeistern. Nun, mein Kopf hat hier unbedingte Genehmigung erteilt … Jeder einigermaßen poetisch begabte Laie wird gepackt werden müssen von der Erhabenheit und Gewalt des Genies, die sich in diesem Werke offenbaren … Ich versichere Ihnen, die Oper ist der Gipfelpunkt bisheriger Tonkunst!«
Zu solchen und ähnlichen Äußerungen gesellte sich aber auch eine andere, die uns deutlich zeigt, daß eben die Begeisterung Bülows für die Größe Wagners ihn selbst in seinen Augen ganz klein machte. Die Wirkung des »Tristan«, schrieb er, sei für ihn »niederdonnernd«, seine produktive Kraft und Laune sei gänzlich davon gebrochen. »Das ist so fabelhaft himmelhoch, daß alles andere pygmäenhaft erscheint, Liszts Faust-Sinfonie ausgenommen. Diese beiden Werke sind seit Beethovens Messe und Neunter das Einzigste, das etwas taugt. Das Dazwischenliegende wäre ohne Schaden zu destruieren: Kinderei, Kinderspott.«
Cosima konnte das nachfühlen, denn auch sie lebte ja ganz in der Luft Wagners und wurde von ihr immer höher emporgetragen. Aber sie hatte mit ihren dramatischen Versuchen doch eben Bülow, dem Gatten, dienen wollen, sie hoffte auch ihn als einen würdigen Genossen und Mitstreiter Wagners im Bereiche der schaffenden Tonkunst bewundern zu dürfen und sah sich hierin getäuscht und ihre Gaben verschmäht. Marie d'Agoult erkannte das Schöpferische in Liszt; sie besaß nur nicht tiefes Verständnis und künstlerische Erfahrung genug, um seinem Entwicklungsgange folgen zu können. Als die Virtuosenlaufbahn ihn auch noch von ihrer Seite riß, verlor sie den Glauben an ihn und gab ihn innerlich auf. Carolyne Wittgenstein erkannte die Fähigkeiten des Geliebten in ihrer Fülle und Tiefe und diente ihm mit wahrer Leidenschaft: sie befeuerte ihn in seinem Streben, sie begeisterte ihn zu großen Werken, sie befruchtete ihn durch ihre Einfälle und Anregungen, sie wachte über seiner Arbeit. Wie immer man ihren Einfluß in manchen Dingen werten mag, sie hatte wirklich teil an seinem Schaffen. Und im kleinsten Wirkungskreise vollzieht sich dasselbe. Jede Frau will zu ihrem Manne emporblicken und zugleich die stille Genugtuung hegen, daß seine besten Kräfte sich unter ihrem Schutze und durch ihre Teilnahme regen und entfalten konnten. Cosima, die am liebsten eine große Künstlerin geworden wäre, wollte ihre Sehnsucht als die verstehende Mitarbeiterin eines großen Künstlers stillen. Daß nun Bülow gleichsam selbst auf die große Künstlerschaft verzichtete, daß er sich damit begnügte, einem Größeren Gefolgschaft zu leisten, einem anderen den Weg zu bahnen, daß sie ihn im Geiste, nicht über Wagner, aber beispielsweise über Raff oder Cornelius triumphieren sah und daß er es dann vorzog, auch den von ihm zeitweilig mißachteten »Kindereien« ein treuer Geburtshelfer zu sein, anstatt der ganzen Welt durch sein eigenes Schaffen Achtung aufzunötigen, daß er das schönste Weihnachtsgeschenk, das er erwarten konnte, sozusagen unberührt liegenließ, daß er weder mit dem »Merlin« noch mit der »Orestie« auch nur vergeblich gerungen hat, dafür aber bei Gelegenheit seiner Gattin eine Klavieretüde widmete – das mußte sie schmerzen, ob sie es sich nun eingestanden hat oder nicht. Wir dürfen vermuten, daß sie ihre Merlin-Dichtung später selbst vernichtet hat.
Das Jahr 1859 brachte ihr aber auch einen anderen, sehr tiefen Schmerz. Es war zunächst ausgefüllt mit rastloser Arbeit, an der sie, wie immer, regsten Anteil nahm. Sie begleitete Bülow nach Prag, fuhr von dort nach Weimar und traf sich dann wieder mit ihrem Manne, um die gemeinsame Reise nach Paris fortzusetzen. Hans gab zwei Pariser Konzerte. Ihre Ergebnisse befriedigten ihn über alle Erwartung, so daß er sich mit Behagen »dem Vergessen der schmachvollen Erfahrungen« hingab, die ihm Berlin »kredenzt« hatte. Sie blieben einige Wochen in Paris, besuchten natürlich Berlioz und machten sich auch sonst mit allen Musikern und Schriftstellern von Rang näher bekannt, gingen fleißig ins Theater und verkehrten gern und lebhaft mit Marie d'Agoult. Jeden Freitag nahmen sie bei ihr das Dinner ein, und abends füllte sich der Salon der Gräfin ihnen zu Ehren mit den namhaftesten Vertretern der Kunst und Literatur; Hans mußte musizieren. Den Sommer verbrachten sie diesmal in Berlin, wo nun Hans den Urlaub, den er im Frühjahre für Paris genommen, hereinbrachte und sich hauptsächlich dem Klavierauszuge widmete. Manche Stellen mußte er drei- bis viermal umarbeiten, und obwohl er sich vorgenommen hatte, an jedem Morgen einen neuen Partiturbogen auf sein Pult zu legen, hatte er doch für manchen Bogen mehrere zehnstündige Tage zu verwenden. »Bin ich mit dem Auszug fertig, so will ich weiter zu produzieren suchen.« Mit diesen an seine Mutter gerichteten Worten tröstete er sich über die bedrückende Tatsache, daß ihm eigentlich nichts mehr einfiel oder höchstens ein verhältnismäßig geringfügiges nettes Klavierstück. Im übrigen war eben diese Zeit nicht frei von Störungen empfindlichster Art.
Daniel Liszt war jetzt schon das zweite Jahr in Wien, wo er nach glanzvoller Beendigung des Gymnasiums die Rechtswissenschaften studierte, um sich später der diplomatischen Laufbahn widmen zu können. Der Oheim Liszts, der Landesgerichtsrat (und spätere Generalprokurator) Eduard von Liszt, hatte sich bereit erklärt, den Großneffen in seinem Hause unterzubringen und die Studien des jungen Mannes zu fördern und zu überwachen. Franz Liszt war damit besonders gern einverstanden gewesen: Paris sollte auch für Daniel erledigt sein. In diesem schienen die Gaben seiner Eltern sich zu vervielfältigen. Mit ebensoviel Genußfähigkeit als scharfem, frühreifem Urteil »studierte« er nicht nur sein »Fach«, sondern auch das Wiener Musik- und Theaterleben, ja sogar den Wiener Fasching und die Wiener Volksbelustigungen. Aber all dem war ein frühes Ende gesetzt.
Am 20. August 1859 kam Daniel nach Berlin, um den Rest der Ferien bei der Schwester zu verbringen. Ein schleichendes Brustübel, dem das Wiener Klima – Wind und Staub – eine böse Nahrung gegeben hatte, brach im rauheren Norden sogleich auf das heftigste aus. Der Hausarzt Bülows, Dr. Bücking, traf zwar alle Anordnungen, die den Zustand des zarten Jünglings bessern konnten, doch es ging nur langsam vorwärts, es fehlte nicht an empfindlichen Rückfällen, schließlich mußte sich das Haus daran gewöhnen, daß der neue Mitbewohner sein Lager kaum mehr verließ und durch die nötige Rücksicht auf sein Leiden zum Mittelpunkte der Tagesordnung wurde. Hans, der den Schwager liebte wie einen Bruder, mußte außer Haus musizieren und unterrichten, um die Ruhe des Kranken nicht zu stören. Nach zwei Monaten glaubte er an eine Genesung, aber sie schien ihm doch langwierig, und er war überzeugt, daß es noch bis zum Frühjahr dauern werde, ehe der eifrige Jurist seine Studien in Wien fortsetzen könne. Ohne darüber zu murren oder die Anwesenheit Daniels als eine Last zu empfinden, widmete Hans ihm jede freie Stunde und suchte ihn auf jede mögliche Weise zu erheitern. Den reichsten Trost aber empfing der Leidende von Cosima, die seine Pflege übernommen hatte und viel mehr tat als eine treue Krankenschwester. Sie sorgte nicht nur für körperliche Erleichterung, sondern vor allem für Zufriedenheit, für Mut und Hoffnung in dem Herzen des jungen Mannes, der nicht ahnen sollte, wie es um ihn stand.
Daniel war jetzt zwanzig Jahre alt. Wie die meisten seiner gebildeten Altersgenossen hatte er einen wahren Heißhunger, sich mit den Meisterwerken der Weltliteratur bekannt zu machen. Auch während seiner Krankheit nahm er solche Werke vor. Was er darüber dachte und sagte, das zeigte ihn weit vorgeschritten über sein Alter und über das geistige Durchschnittsmaß. Er las Tassos »Befreites Jerusalem« und den »Don Quichotte«. Mit Bleistift schrieb er von seinen Eindrücken an den Vater. Bei Tasso störte ihn die zu nahe, unvermittelte Verbindung des Profanen mit dem Heiligen. Gottesbegeisterung und irdische Liebe wechselten ihm zu rasch und ohne innere Verknüpfung, dafür bewunderte er den Bilderreichtum und die malerische Anschauungskraft des Dichters. Die Charakterzeichnung erschien ihm ungleichmäßig. Am besten gefiel ihm die Gestalt der Erminia; zu Rinaldo machte er die Bemerkung: »Ich liebe nicht Privilegien. Daß er durch seine Tapferkeit triumphiert – gut. Aber durch seine diamantene Rüstung – halt là, es lebe die Freiheit!« Noch schöner sind seine Worte über den »Don Quichotte«, den er schon zum zweiten Male las. »Um wirklich komisch zu sein, muß man Herz haben, die Quelle ist bei Cervantes die gleiche wie bei Molière.« Und dieser echte Sohn Liszts und Marie d'Agoults trug auch die Tonkunst im Herzen. In der trügerischen Zeit seiner »Genesung«, in der er bei gutem Wetter mit Cosima ausfahren durfte, setzte er sich einmal ans Klavier und suchte seine musikalischen Erinnerungen zusammen. Vor mehr als einem halben Jahre hatte er in Prag dem Konzerte beigewohnt, in dem Bülow neben Berlioz, Schubert, Schumann und Franz auch Liszts »Festklänge« und »Mazeppa« und Wagners Faust-Ouvertüre und das Vorspiel zu »Tristan und Isolde« erklingen ließ. Damals hatte Daniel seinem Vater geschrieben und im Hinblick auf die verhältnismäßig geringen Mittel, die dem Meisterdirigenten zur Verfügung standen, den herrlichen Satz geprägt: »Bülow hat wieder einmal die Wahrheit des Wortes erwiesen: Mehr gilt ein Löwe an der Spitze von fünfzig Hirschen als ein Hirsch an der Spitze von fünfzig Löwen.« Dann hieß es weiter: »Die Faust-Ouvertüre, dieses ungeheure Dröhnen des unterdrückten Genius, hat mich bis ins tiefste Mark erschüttert. Es will mir scheinen, als ob diese Ouvertüre noch mehr eine Notwendigkeit des Herzens als eine Eingebung des Genius gewesen sei und daß gerade der wahrhafte Eindruck des Leidens ihre Stärke ausmacht. Der Anfang ist düster und eiskalt wie ein Friedhof, aber gewiß nichts von den Albernheiten, mit denen man die Friedhöfe auf die Szene zu bringen pflegt.« Jedes Wort ein Zeugnis klarsten Verstehens, innigsten Fühlens. Als Daniel nach Berlin kam, hoffte er noch weiter vorzudringen in den Schöpfungen seines Vaters und des für ihn besonders großen und verehrungswürdigen Wagner. Und nun wurde seinethalben außer Haus musiziert! Der Brief über Tasso und Cervantes war der letzte, den er dem Vater schreiben konnte.
Denn es ging jäh abwärts. Mit dem Eintritte der kalten Jahreszeit schien Daniels Schicksal erfüllt zu sein. Der Husten hatte nur aufgehört, weil eben alle Kräfte verfielen. Liszt, der schon früher einmal von Weimar herübergekommen und brieflich von allem benachrichtigt war, traf am 11. Dezember abends, gemahnt von der Fürstin, wieder in Berlin ein. Er kam knapp zurecht, um von seinem Sohne Abschied zu nehmen. Die Nacht verbrachte er noch im Gasthofe und erschien bei seinen Kindern erst am 12. um halb neun Uhr vormittags. Nur das Hausmädchen war schon auf. Von diesem erfuhr er, daß Cosima bis sechs Uhr morgens bei Daniel gewacht hatte, der nicht vor fünf Uhr eingeschlafen war. Dann wurde der Kranke auf seinem Rollwagen in das Speisezimmer gebracht, glücklich, den Vater wiederzusehen, kaum bewußt seiner Hinfälligkeit. Auch Hans und Cosima, die sich endlich zum Frühstück einfanden, befürchteten noch nicht das Ärgste. Sie nahmen den Kaffee in aller Ruhe ein, und Daniel, der mit Milch und Tokaier genährt wurde, klagte nur darüber, daß ihm jede Eßlust fehle. Er atmete schwer, sprach mit Mühe, doch er zeigte noch Anteil an den Gesprächen, die in Gang kamen und denen er nicht mehr ganz leicht folgen konnte. Dann fing er selbst von seinen Studien zu reden an, und Cosima konnte berichten, daß er noch tags zuvor in einem seiner Lehrbücher lesen wollte. Jetzt gab er sogar dem Vater einiges von seinen Kenntnissen zum besten. Der Besuch des Arztes machte diesen Anstrengungen ein Ende. Dr. Bücking vermochte zwar auch diesmal kein ansteckendes Lungenleiden, noch überhaupt eine schwere örtliche Erkrankung, sondern nur allgemeinen Kräfteverfall festzustellen. Er sagte zu Liszt, der kein Hehl aus seinem Bangen machte: »Wenn das Unglück eintreten sollte, so wird er nur erlöschen, sehr ruhig, ohne Agonie und wahrscheinlich ohne Schmerzen.« Liszt nahm das alles mit seiner übermenschlichen Gelassenheit zur Kenntnis und hatte sich später der Fürstin gegenüber zu verantworten, daß er es unterließ, nach einem Priester zu schicken, weil er die letzten Stunden seines Sohnes nicht mit Furcht und Schrecken erfüllen und ihn auch nicht nutzlos ängstigen wollte. Er ging mit Hans ein Werk von Bach durch, und im übrigen verlief der Tag in steter Aufmerksamkeit für den Kranken, dem die sorgende Schwester unentbehrlich geworden war. Wenn Cosima sich nur für einen Augenblick von ihm entfernt hatte, verlangte er schon nach ihr. Sonst wurde er teilnahmslos und sein Atem immer schwerer.
Um elf Uhr abends verließ der Vater die Wohnung seiner Kinder. Cosima begleitete ihn in den Gasthof und kehrte sofort zum Bruder zurück, der ohne sie nicht hätte schlafen können. Am 13. um neun Uhr vormittags erschien Hans bei seinem Schwiegervater und teilte ihm unter Tränen mit, daß es zu Ende gehe. Aber noch der ganze Tag vereinte die Angehörigen um den Sterbenden, dessen Züge sich nicht veränderten, sondern einen sanften und zufriedenen Ausdruck bewahrten. Cosima verglich ihn mit einem Christusbilde Correggios. Von seiner Umgebung schien Daniel keine klare Vorstellung mehr zu haben. Da sprach er im Halbschlummer deutlich: »Ich gehe, um eure Plätze vorzubereiten.« Cosima und der Vater knieten an seinem Bette. Dann nochmals ein kurzes Aufflammen wacher Empfindung. Daniel begann wieder von seinen Studien zu sprechen, die er im Frühjahre fortzusetzen hoffte. Liszt blieb diesmal in der Wohnung und erhielt ein Lager im Musikzimmer. In der Mitternachtsstunde erhob er sich ungerufen und betrat die Krankenstube. Da fand er Cosima am Bette kniend – in beklemmender Stille. Liszt hörte den Atem seines Sohnes nicht. Cosima legte die Hand auf Daniels Herz. Es hatte aufgehört zu schlagen. Er war so verschieden, wie es der Arzt vorhergesagt.
Liszt sprach zu seiner Tochter und fand vor allem Worte christlichen Glaubens und frommer Ergebung. Cosima sagte, auf Daniel weisend: »Er ist glücklich. Aber wir sind es noch mehr, weil wir in noch höherem Maße Verdienste sammeln können.« Dann beteten sie heiß und stumm.
Den immer leidenden Hans wollten sie nicht wecken. Cosima ruhte im Musikzimmer beim Vater, und erst am Morgen erfuhr Hans die Trauerkunde. Während die beiden Männer die nötigen Gänge machten, wusch Cosima den Körper Daniels. Niemand stand ihr bei, die Dienerinnen scheuten den Toten. Dann kleidete sie ihn an und legte ein Bild des französischen Philosophen Pascal zu seinen Füßen, von dem sie zuletzt oft mit ihm gesprochen. Das Bild kam auch in den Sarg. Mit allen religiösen Gemälden und Zeichnungen, die sie besaß, errichtete Cosima eine Art Kapelle um den aufgebahrten Toten. Am Abend kehrte Liszt in den Gasthof zurück und wollte auch die Tochter bewegen, die Nacht dort zu verbringen. Aber sie blieb bei Daniel.
Vor dem Begräbnis am 15. wurde eine Messe gelesen. Auf Wunsch Liszts eine stille Messe – eine gesungene versprach ihm bei den herrschenden Gepflogenheiten zu wenig Erbauung. Nur Liszt, Cosima und Hans wohnten dem Gottesdienste und der Bestattung bei. Die Bülowschen Verwandten wollten sie erst später sehen. Während der Sarg – bei hellstem Sonnenschein und zunehmender Wärme – versenkt wurde, kreiste ein Schwarm von Tauben in hoher Luft über dem Grabe.
Der Rest des Tages gehörte nicht nur dem stillen Andenken. Dieses setzte sich vielmehr sogleich in Tätigkeit um. Liszt schrieb ausführlich an die Fürstin, Cosima an ihre Mutter und an Schwester Blandine. In dem Briefe an die Mutter heißt es von Daniel: »Er schmiegte sich in die Arme des Todes wie in die eines Schutzengels – wie wenn er ihn seit langem erwartet hätte. Er hat nicht gerungen mit ihm; ohne Überdruß am Leben, hat er doch brennend nach der Ewigkeit verlangt.« Eine Woche später schrieb sie an Marie Wittgenstein, die seit zwei Monaten, noch beglückwünscht von Daniel, die Gemahlin des Fürsten Konstantin Hohenlohe war, von dem wahnsinnigen Leid um den geliebten Bruder und von einer großen Stille in ihr, die dieses Leid beschwichtigte. In einem Dankschreiben an die teilnehmende Freundin Louise von Bülow sprach sie von dem Weh der Stunde, in der sie dem Gefährten ihrer Kindheit, dem einzigen Sohne ihres Vaters, die Augen geschlossen: »der süßesten und reinsten Jugend, die je erblüht war«. Auch Blandine beschwor in stürmischer Weise die gemeinsamen Erinnerungen an die glückliche Kindheit, an eine Kindheit fast ohne Vater und Mutter, doch eben darum beseligt durch die Geschwisterliebe und durch die fast scheu emporblickende Verehrung der Mädchen für den jüngeren Bruder. Schlicht und stark wie immer schrieb die Großmutter Anna ihrem Sohne, dem schwer getroffenen Vater: »Gott gib uns Kraft, diesem entschlafenen guten Kinde seinen Geist nicht mehr zu viel troubler mit unseren Tränen, der in Frieden ruht. Wenn ein guter Platz bestimmt ist jenseits den Verstorbenen, so hat er sich ihn erworben hier durch seinen Fleiß und kindliche Liebe und Dankgefühl gegen Gott und seinen Vater und Wohltäter.« Die schönste und wahrste Zusammenfassung der Ereignisse verdanken wir Hans von Bülow. Am Tage nach dem Begräbnisse schrieb er an Joachim Raff: »Meine Antwort auf Deine letzten Zeilen hat auf sich warten lassen. Ein trüber Besuch kam dazwischen. Der Tod. Aber nicht in seiner christlichen Mißgestalt, sondern als griechischer Jüngling mit ausgelöschter Fackel. Mein lieber Bruder Daniel Liszt ist am letzten Dienstag abends 11 Uhr 20 Minuten sanft entschlafen, ohne Todeskampf, mit vollem Bewußtsein nicht seines Todes, sondern seines Lebens. Sein Vater traf, wie von einer Ahnung ergriffen, Montag früh ein. Seine Krankheit ließ sich nicht benennen; es war Abzehrung, allmähliches Erlöschen – seine Lebenskraft hatte eben nur für zwanzig Jahre ausgereicht. Seine letzten Tage sind ihm durch die liebevolle Pflege meiner starken Frau auf die edelste Weise erhellt worden.«
Den nächsten Sommer wollte Bülow nur »eigenen Arbeitsversuchen« widmen. An Raff schrieb er, seine Wanderlust sei auch dadurch gelähmt, daß seine Frau ihn aus Gesundheitsrücksichten nicht würde begleiten können. Cosima sah Mutterfreuden entgegen.
Die Muße aber, die Hans an ihrer Seite für seine Muse zu gewinnen hoffte, brachte nicht die erhofften Früchte. Es wurde ein »schlechter« Sommer. Hans fühlte sich gepeinigt durch den »Vergleich zwischen seinem Wollen und der Ungenügendheit seines Wissens und Könnens«. In einem Briefe an seine Mutter verriet er überdies, daß er sich nicht nur den Großen gegenüber klein vorkam, sondern sich auch im Umgange mit Cosima eigentlich noch immer so »geniert« fühlte wie einst als Bräutigam. »Durch meine Frau«, schrieb er, »die herzvolle Geistesvirtuosin, die es so meisterlich versteht, Schönes zu sagen und, wo dessen zu sagen ist, seit langem stets zu meinem Vorteil für mich eintritt, bin ich so verwöhnt worden und so entwöhnt, in der gebundenen Sprache des Gefühls zu reden, daß ich auch da, wo ich inneres Bedürfnis dazu empfinde, dessen Äußerung kaum mehr gewachsen bin.«
Auch die Geburt des ersten Kindes wirkte nicht so lösend und befreiend auf ihn, wie man es bei einem so edlen und feinfühligen Manne erwartet hätte und wie es für ihn selbst die größte Wohltat gewesen wäre. Am 12. Oktober 1860, zehn Monate nach dem Tode Daniels, kam eine Tochter zur Welt. Cosima begrüßte ihre Ankunft wie ein Zeichen vom früh Verstorbenen. Das Kind erhielt die Namen Daniela, zur Erinnerung an Daniel, und Senta, da die Mutter sie der Treue weihen wollte; der Treue gegen ihre Eltern und gegen alles Hohe und Liebenswerte. Dabei kam auch die Treue der Eltern gegen Wagner zum Ausdruck. Kurz nach der Geburt entdeckte die Mutter die zweifarbigen Augen des Mädchens, und da sie gewohnt war, in den äußeren Dingen die Sinnbilder der inneren zu sehen – leichtfertige Menschen nennen das Aberglauben –, so befiel sie die Sorge, Daniela würde bei allen guten Gaben, die ihr hoffentlich verliehen waren, eine gewisse »Unebenheit und flackrige Unruhe« in sich tragen, die einem harmonischen Leben hinderlich sei. Wenn die Erwachsene später sich allzu lebhaft und leidenschaftlich äußerte, dann fiel der Mutter ihre erste Wahrnehmung ein.
Während Cosima sich ihres Glückes freute, war Hans in eine merkwürdige Aufregung versetzt. Seinem Freunde Joachim Raff teilte er die Geburt der Tochter mit und schrieb: »Ich komme mir dabei einigermaßen lächerlich vor; als ob ich mich in den Familienbeziehungen nach einem berühmten Vorbilde hätte modeln wollen. Robert Schumann pflegte während eines solchen, seinem Hause nicht ungeläufigen Ereignisses sich zu Bette zu legen oder heulend und jammernd durch alle Zimmer zu toben. Nun, das gerade habe ich nicht getan, aber doch eine Art Verbrecherbewußtsein die ganze letzte Zeit mit mir herumgeschleppt, das selbst meinen Klaviersessel häufig in eine schiefe Ebene gebracht hat. Vorläufig schweigt nun das Piano, welches dem ›chant‹ Platz gemacht hat. Doch ich will die kaum sechzig Stunden alte Daniela Senta nicht verleumden: sie macht von ihrer Stimme nicht im geringsten indiskreten Gebrauch.« Daran knüpfte er den Wunsch, daß sie es später tue. Er war mit seiner Frau darin einig, daß sie beide am liebsten eine dramatische Sängerin, eine Isolde der Zukunft großgezogen hätten. Die Bülows, meinte Hans, werde er ja doch vor die Köpfe stoßen müssen, »denn es versteht sich, daß ich sie katholisch erziehen lasse. Doch genug des ›Kindlichen‹«. Nach der Taufe, der Liszt beiwohnte, schrieb Hans an Draeseke: »Daniela Senta läßt Dich grüßen – sie ist wirklich ganz nett und hat sich während der Taufe (meine Frau hatte im Salon eine kleine Kapelle aufgebaut) sehr anständig benommen.«
Diese Briefe sind Musterbeispiele für die Art Bülows, alle Rührung zu verbeißen und sich über Anwandlungen von Ergriffenheit mit einem Witz hinwegzuhelfen. Ganz frei und ungezwungen, ganz warm und schlicht gab er sich nur, wenn er von Wagner oder von Cosima schrieb. Auch seine Verehrung für Liszt, die kindlich dankbare Verehrung eines treuen Sohnes, kam immer wieder rein und ungekünstelt zum Ausdruck. In der Zeit, von der wir sprechen, befand sich Liszt in einer bedrückten Lage. Er hatte es erleben müssen, daß eine Oper des von ihm so herzlich geförderten Cornelius, »Der Barbier von Bagdad«, in Weimar vom Publikum unzweideutig abgelehnt wurde, und daß die »organisierte Opposition«, die das Werk zu Fall brachte, eigentlich gar nicht gegen Cornelius oder gegen den »Barbier«, sondern gegen Liszt selbst gerichtet war und daß als das Haupt oder wenigstens als der Urheber dieser Opposition der Intendant Franz Dingelstedt zu gelten hatte, der zwar auf Veranlassung Liszts berufen worden war, der aber nur das Schauspiel pflegen wollte und dem Liszt als Opernleiter im Wege stand. Das hatte zwangsläufig dazu geführt, daß Liszt auf diese Leitung verzichtete und den Großherzog um Enthebung von seinem Dienste bat.
Mittlerweile war die Scheidungs- und Wiedervermählungsangelegenheit der Fürstin bis zu dem gefährlichen Punkte gelangt, wo alles nur vom Spruche des Papstes abhing. Carolyne begab sich selbst nach Rom, um den Erfolg ihrer langjährigen Bemühungen durchzusetzen. Liszt blieb vorerst in Weimar zurück und harrte der kommenden Dinge. Vielleicht ahnte er schon, daß die Fürstin nicht wiederkehren und sich auch nie mit ihm vermählen werde. Die »tief melancholische Ader in seinem Gemüt«, die er sonst zu verbergen suchte, machte sich jetzt auch nach außen bemerkbar, und in sehr trüber, weltabgewandter Stimmung verfaßte er seinen letzten Willen. Sein ganzes Herz und sein geringes Vermögen (220 000 Francs) vermachte er der Fürstin. Daß er aber die Selbständigkeit seiner Gefühle und Anschauungen auch ihr gegenüber unbeirrt zu wahren wußte, das beweist der Teil des Schriftstückes, der auf Wagner Bezug nimmt. Die Fürstin hatte sich immer mehr zur stillen, aber hartnäckigen Gegnerin Wagners entwickelt: sein wachsender Ruhm begann den Namen Liszts zu verdunkeln, und seine freien, ketzerischen Meinungen widersprachen ihrem gläubigen Christentume. Liszt jedoch schrieb in seinen letztwilligen Aufzeichnungen: »Es gibt in unserer zeitgenössischen Kunst einen Namen, der jetzt schon ruhmreich ist und der es immer mehr werden wird – Richard Wagner. Sein Genius ist mir eine Leuchte gewesen; ich bin ihr gefolgt – und meine Freundschaft für Wagner hat immer den Charakter einer edlen Leidenschaft behalten. Zu einem gewissen Zeitpunkt (vor ungefähr zehn Jahren) hatte ich für Weimar eine neue Kunstperiode geträumt, ähnlich wie die von Karl August, wo Wagner und ich die Koryphäen gewesen wären, wie früher Goethe und Schiller – aber ungünstige Verhältnisse haben diesen Traum zunichte gemacht.« Nun war auch der bescheidene Traum, einem so tüchtigen und liebenswerten Künstler wie Cornelius vorwärtszuhelfen, unerfüllt geblieben. Liszt hatte über Mißgeschick und über Feinde zu klagen. Um so fieberhafter erwartete er die Nachrichten aus Rom, die zwar im allgemeinen günstig, aber noch immer nicht entscheidend lauteten. Bülow legte Wert darauf, daß Cosima, sobald sie sich als Mutter freimachen konnte, ihren Vater besuchte. Sie war in seinen Augen die einzige, die jenem »über die Lebensmiseren fortlächeln helfen« konnte. Er selbst aber ging zu Beginn des Jahres 1861 nach Paris, um dort mit Wagner zusammenzutreffen und ihm bei der bevorstehenden Aufführung des »Tannhäuser« in der kaiserlichen Oper dienlich zu sein.
Immer wieder suchte sich Wagner in Paris heimisch zu machen, um seinem Drange nach künstlerischer Betätigung und wirksamen Aufführungsmöglichkeiten zu genügen – oder wenigstens gute Musik zu hören. Diesmal fand er in der Gemahlin des österreichischen Botschafters am französischen Hofe, der Fürstin Pauline Metternich, eine eifrige Gönnerin. Sie setzte es durch, daß der »Tannhäuser« auf Befehl des Kaisers zur Aufführung bestimmt wurde. Man weiß, wie dieses Abenteuer ausging. Das Werk wurde niedergezischt und konnte nur dreimal gegeben werden. Das hatte künstlerische und politische Gründe und Hintergründe. Die geringste Schuld lag an den mitwirkenden Kräften, zu denen (in der Titelrolle) Albert Niemann zählte. Unfähig jedoch war der Dirigent Dietsch, nach Bülows Ausspruch der »eselhafteste, dickfelligste, unmusikalischeste aller Kapellmeister, die er je in Deutschland gerochen«, und verhängnisvoll die Unmöglichkeit, für Wagner die Begünstigung zu erwirken, daß er die ersten Vorstellungen oder wenigstens die Hauptprobe leiten dürfe. Hiebei war es ein merkwürdiger Zufall, daß dieser selbe Pierre Louis Philippe Dietsch, dessen Mutter eine Deutsche war, zwanzig Jahre vorher das von Wagner aus Not verkaufte Buch zum »Fliegenden Holländer« (in der französischen Übersetzung » Le vaisseau fantôme«) vertont hatte.
Die Berichte, die wir von Wagner selbst und von manchen seiner Freunde und Zeitgenossen über den Verlauf der »Tannhäuser«-Proben und -Aufführungen besitzen, werden ergänzt durch die Briefe Bülows, der mit leidenschaftlicher Erregung die Qual und Unruhe dieser Monate mitmachte. Natürlich fehlte er in Berlin und hatte er wieder bei Julius Stern sein langes Ausbleiben zu rechtfertigen. »Pflichten der ernstesten Art«, schrieb er ihm am 7. März, »fesseln mich in Paris. Ich kann Wagner in einem kritischen Moment, wie der gegenwärtige, nicht verlassen – eine Stellvertretung bei ihm ist unmöglich. Ich bitte Sie zu glauben, daß ich in dieser Überzeugung meiner Unersetzlichkeit mich nicht von Motiven eitler Selbstüberschätzung beeinflussen lasse. Mündlich ließe sich etwa eine annähernd veranschaulichende Erklärung der komplizierten Verhältnisse, in die einzugreifen mir auferlegt ist, abgeben. Brieflich ist das um so weniger tunlich, als eine genaue Kenntnis des eigentlichen lokalen Terrains vorausgesetzt werden muß. Es handelt sich um das Gelingen einer Art musikalischen oder theatralischen Staatsstreiches, der allein die Sache günstig lösen kann. Die Neugierde, der ersten Vorstellung beizuwohnen, ist hiebei für mich so wenig maßgebend, daß ich vermutlich diese gar nicht abwarten werde, sondern nur die Sicherheit, daß das Wesentlichste der Erfordernisse, die Direktion des Komponisten für die ersten Vorstellungen, erreicht worden ist. So lange muß ich hier aushalten, so lange ist meine Gegenwart unumgänglich notwendig. Dieser Notwendigkeit bringe ich für mich nicht bedeutungslose materielle Opfer, wie z. B. die Ablehnung vorteilhafter Konzertengagements … Auch ein schwereres moralisches Opfer muß ich ihr bringen, das der Verzichtleistung auf meinen Ruf als solider Konservatoriums-Klavierlehrer, meine eigentliche Bestimmung für das Diesseits.« So dreht sich alles bei ihm um Wagner; seine Gedanken und Entschlüsse sind stets durch die Sorge für den Freund bestimmt. Wieder wird Liszt herbeigerufen: der Beliebte und Einflußreiche, der Weltmann, der an allen Höfen freudig Begrüßte, der auch besonders für Napoleon III. schwärmt – vielleicht wäre er imstande, die erwünschte Ordnung herzustellen. Doch wieder sagt er ab, er ist in Weimar festgehalten, fortwährend gehen die Fragen und Antworten zwischen Weimar und Rom hin und her. Er hat ausnahmsweise – aber nicht zum ersten Male – keine Zeit und keine Seelenruhe, um seiner »edlen Leidenschaft« zu frönen. So nimmt denn alles seinen vorbestimmten denkwürdigen Verlauf.
Wenige Wochen später schien Wagner neues Glück zu winken. Schon im vorigen Sommer hatte er endlich die Erlaubnis erhalten, deutschen Boden zu betreten. Jetzt fuhr er von Paris nach Karlsruhe, wo die günstigsten Bedingungen für eine »Mustervorstellung« von »Tristan und Isolde« vorhanden waren. Er wurde beauftragt, auch noch Sänger in Wien auszusuchen, wo sein »Lohengrin« unerhörten Erfolg gehabt hatte und nach allen Berichten, die ihm zukamen, wirklich glanzvoll aufgeführt wurde. Anfang Mai traf er in Wien ein, erlebte dort zum ersten Male sein noch nie gehörtes Werk und war so ergriffen von der Darstellung, daß in ihm sehr bald der Entschluß reifte, den »Tristan« nicht in Karlsruhe mit Wiener Sängern, sondern eben in Wien selbst herauszubringen. Auch das war eine der immer wiederkehrenden großen Enttäuschungen in seinem seltsam mühevollen Leben. Die Jahre, in denen er um den Wiener »Tristan« kämpfte und von denen er einen Teil in Wien selbst verbrachte, wurden zu bitteren Leidensjahren, in denen auch sein äußeres Leben neuer Unsicherheit, ja dem völligen Zusammenbruche preisgegeben war. Vorerst begab er sich von Wien nach Weimar, um endlich wieder mit Liszt vereint zu sein. Er wohnte in der Altenburg, die alsbald im Beisein Eduard Liszts aus Wien, der eigens herübergekommen war, um das Eigentum der Fürstin sicherzustellen, geschlossen und versiegelt werden sollte. Liszt war im Begriffe, nach Rom zu eilen, wo nun doch die Hochzeit stattfinden sollte. Auch Blandine mit ihrem Gatten waren aus Paris gekommen und nahmen an der in Weimar stattfindenden Tonkünstlerversammlung teil, bei der Bülows »Entsagende« und »Faust« und »Prometheus« von Liszt aufgeführt wurden. Die Rückreise nach Wien machte Wagner zum großen Teile in Begleitung Blandinens und Olliviers, da diese beschlossen hatten, Cosima in Reichenhall zu besuchen. Während der Abwesenheit Bülows in Paris war nämlich seine Frau sehr krank gewesen, und der Arzt hatte ihr die Reichenhaller Kur verordnet. Sie benützte diese, um Alfred Meißners Jesuitenroman »Zur Ehre Gottes« zu lesen und mit der Übersetzung für die Revue Germanique zu beginnen. Hans, der für sich eine Kur in Wiesbaden vorgezogen hätte, war mit nach Reichenhall gekommen und fuhr dann nach Weimar, wo er den größten Teil der Aufführungen zu leiten hatte.
Die Kur näherte sich bereits ihrem Ende, als Cosimas Schwester und Schwager mit Wagner dort eintrafen. Beim Abschiede von Liszt hatten sie Bülows gedacht, der sich in den vergangenen Tagen so ungemein ausgezeichnet hatte und soeben nach Berlin abgereist war. Wagner ergoß sich in seinem Lobe, bemerkte aber zutraulich scherzend: er hätte Cosima nicht zu heiraten gebraucht; worauf Liszt mit einer kleinen Verneigung hinzusetzte: »Das war Luxus.« Auf der Reise waren die drei der allerbesten Laune, wobei die mangelhafte Vertrautheit Olliviers mit der deutschen Sprache willkommenen Anlaß zu Späßen und Neckereien gab. Über Nürnberg und München gelangten sie nach Reichenhall.
Cosimas Gesundheitszustand war besser, als sie befürchtet hatten. Besonders die Wanderungen in der stärkenden Gebirgsluft hatten ihr sehr wohlgetan. Die Schwestern genossen ihr Beisammensein in der größten Heiterkeit, schlossen aber die beiden Männer am liebsten von ihren Unterhaltungen aus. Wenn Wagner sich einmal Zutritt bei ihnen verschaffte, so suchte er auch zu ihrer Heiterkeit beizutragen, indem er beispielsweise einmal sein Vorhaben ankündigte, die von Liszt verwaisten Töchter zu adoptieren. In Wahrheit war ihm jedoch nicht allzu spaßhaft zumute, da ihn Cosimas Benehmen auch diesmal befremdete und beunruhigte. Er beklagte sich einmal gegen Blandine über Cosimas »Wildheit« und gebrauchte dabei einen Ausdruck, den er später in einem Briefe an Hans wiederholte, wo es heißt: »Über Cosima habe ich mich in Reichenhall sehr gefreut. Wenn sich das böse Kind nur recht schonen wollte … Sie ist ein wildes Kind, dabei bleibe ich. Aber sie hat großen Adel. An diesen mußt Du Dich halten, um sie zu jedem Opfer, auch dem kleiner schädlicher Angewohnheiten zu vermögen: sie muß aus Stolz gleichmütig und ruhig werden.« Unter dieser »Wildheit« hat man sich aber nicht etwas Lautes und Stürmisches vorzustellen, sondern eine gewisse fahrige Scheu, ein ängstliches Zurückweichen vor näherem Verkehr, wie es Cosima schon in Zürich an den Tag gelegt hatte. Blandine, die der deutschen und der französischen Sprache so ziemlich gleich mächtig war, übersetzte Wagners »Wildheit« mit » timidité d'un sauvage« (Furchtsamkeit eines Wilden). »Scheu fragend« war nach Wagners Bericht auch der Blick, mit dem Cosima nach wenigen Tagen, als er seine Reise fortsetzte, von ihm Abschied nahm.
Zwei Wochen später, Ende August, war Cosima, »unberufen recht erholt«, wieder daheim. Eine Zusammenkunft mit Liszt in Löwenberg in Schlesien, der Abschiedsbesuch Liszts in Berlin, gleichzeitiges Unwohlsein Bülows, später ein Besuch Friedrich Hebbels aus Wien, mit dem sie von Weimar her bekannt waren, außerdem wiederholte, zum Teil befriedigende Konzertreisen, die Bülow allein unternahm, vor allem aber die gewohnte Berliner Tätigkeit, das sind die äußeren Merkmale des ablaufenden Jahres. Cosima schrieb darüber an Alfred Meißner: »Mein Mann und ich kommen zur Zeit gar nicht aus den Konzertsälen heraus. Er als Wirkender, ich als amphibisches Wesen, halb Künstlerin, halb passiv, eine gemischte Rolle, zu der wir Frauen eben verdammt sind. Alles in allem gehen die Dinge nicht schlecht und wir sind schlagfertig genug, haben reichlich kampffreudige Stimmung und fühlen uns gesund genug, um dem Winter mit ruhigem Blicke entgegenzusehen.«
Hans war wohl schlagfertig und kampffreudig, aber bei weitem nicht so ruhig und zuversichtlich. Über seine wirtschaftliche Zukunft machte er sich ernstliche Sorgen. Immer noch war er bemüßigt, durch Stundengeben, durch Mitwirkungen, durch selbständige Konzerte sein Einkommen von Fall zu Fall zu erhöhen, und immer noch war er der Idealist, der die schönsten Konzerte, die er gab, für eigene Rechnung unternahm und dabei stets einen erheblichen Teil der Kosten zu tragen hatte. In einem Briefe an Alexander Ritter vom 28. September sagte er unumwunden, daß ihm eine Kapellmeisterstellung mit einem festen Gehalte von 1000 Talern »eine enorme Erleichterung, eine wahre Erlösung« wäre. »Meine Frau hat eine Rente von 5000 Francs, von der wir bei großer Eingeschränktheit leben könnten. Daß jedoch auch außerdem mein männliches Ehrgefühl nicht ertragen würde, meinen Hausstand durch meine Frau allein bestritten zu sehen, wirst Du sehr begreiflich finden. Ich bin also darauf angewiesen zu verdienen, und ich beklage mich darüber so wenig, daß mich dieser Stand der Dinge im Gegenteil beglückt und erhebt.« Er lehnte sich nur gegen die Art und Form auf, in der er seit sechseinhalb Jahren den »Gelderwerb zur empfindlichsten Benachteiligung seiner Fortentwicklung als Künstler« betreiben mußte. Das Konservatorium nahm ihn fühlbar in Anspruch, konnte ihm aber als Einnahmequelle nicht genügen. Der Ertrag des Privatunterrichtes war bei dem großen Wettbewerb in Berlin, der Sparsamkeit und Ärmlichkeit des Berliner Publikums, der Feindseligkeit von Berufsgenossen, Presse usw. auch nicht viel größer. Am wenigsten brachten die Konzerte ein. Alles in allem konnte er mit »Plage und Anstrengung« eine Summe jährlich einnehmen, die der seiner Frau gleichkam, und die sie dann auch verbrauchten oder – für künstlerische Zwecke ausgaben. »Eigenes Wesen, das Gefühl von » noblesse oblige« – ich meine die durch meine Familienverbindung mit dem Meister« (mit Liszt) »erteilte noblesse – legen mir eine Menge Aufgaben auf, die andere Klaviervirtuosen abweisen können.« Der Titel »Hofpianist«, der ihm vor einiger Zeit verliehen wurde, war in jeder Hinsicht gehaltlos: er gewährte ihm weder eine Rente noch moralische Unterstützung. Dies war aber nur die Außenseite der Angelegenheit. »Nun die wichtigere innere Seite. Das Lehrmétier bringt mich um, sei es, daß ich zu wenig kaltblütig, zu wenig geschäftsmäßig verfahre – das wirst Du von mir nicht anders erwarten –, sei es, daß meine Nerven zu empfindlich sind … Mit dem Komponieren geht's erst recht nicht. Weiß wohl, andere bringen's zustande, andere Klavierlehrer – aber was bringen sie zustande: Fabrikate für den musikalischen Tagesmarkt, für die Ostermesse. Darin mit ihnen zu rivalisieren, beehrgeize ich nicht: auch würde ich's nicht können, wenn ich wollte: die handwerksmäßige Routine, die dazu gehört, habe ich zu erlernen keine Zeit gefunden. Zu Stücken, wie meine Orchesterphantasie, meine Klavierballade und noch einiges andere, bedarf ich … auch der lebendigen Anregung durch Orchestergenuß. Letzteren kann leider nur ich mir in Berlin bereiten. Ein sonstiger Theater- oder Konzertbesuch verstimmt und empört mich aufs heftigste. Es kostet mich Mühe, hier und da dem Dirigenten nicht ans Pult zu springen, ihn hinunterzustürzen, ihm den Taktstock zu entreißen, seine Stumpfheit laut zu geißeln! … Ja, das ist eine Höllenpein! Und Entbehren ist schöner als dieses Genießen!«
Einen »Hoffnungsstrahl der Erlösung aus dieser geistigen Existenz« gewahrte er, als er sich um eine Stellvertretung in Schwerin bewerben konnte. Aber da hielten ihm Freunde und Gesinnungsgenossen vor, das sei doch für seine Stellung und für seinen Namen »mindestens höchst unpassend«. Nun geriet er in Zorn. Also »es ist unpassend, sich aus der Hölle ins Fegefeuer zu sehnen, dem vertrockneten Gaumen ein doch momentan kühlendes Wasser, und sei es aus einer Pfütze, zu wünschen!!! Tag für Tag sehe ich mein eigenes Selbst, dessen Unsterblichkeit ich ja nur fürs Leben wünschen kann, mir mehr entfremdet schwinden, unter der Last der Arbeit fürs Geld, d. h. für andere. Ich weiß wohl, was die Kapellmeisterei, namentlich am Theater, für eigentümliche Genüsse bietet. Aber es wäre doch jedenfalls eine Abwechslung! Man hat doch Resultate in Aussicht für die Plage und den Ärger – was für eine Freude macht einem eine einzige gelungene, anständige Aufführung, die Zeugen hat, von denen doch einige den relativen Wert anerkennen und genießen können! In den musikalischen Leiden gibt's doch Oasen – die Konzerte sind nicht mit soundso viel Lektionen, i. e. Prostitutionen zu erkaufen … Noch eins – mein Ruf. Zum Teil ist er ein Geschenk des Zufalles, der Güte des Meisters für mich, und er drückt mich als nur teilweise verdient, er beängstigt mich als Motiv zur Eifersucht, zum Neide meiner Mitschüler. Und im übrigen: was ich mir dafür kaufe! Was? Briefmarken. Die unzähligen Besuche, die gräßliche geschäftliche Briefschreiberei, Beantwortung müßiger, gemein eigennütziger Anfragen, bei denen ich diplomatisch höflich, nach allen Seiten rücksichtsvoll verfahren muß. Warum? Nicht aus Furcht, die Leute mir zu Feinden zu machen! Du kennst meine Art … Nein, ich bin rücksichtsvoll geworden aus Furcht, die Antipathie gegen mich möchte den Leuten zur Gegnerschaft gegen die Richtung, gegen Liszt umschlagen. Wenn Du einmal herkommst, lasse ich Dich in meine Briefbuchführung blicken! Du wirst schaudern! … Genug. Ohne den Trost meiner lieben geist- und herzvollen Frau läge ich längst – im Schafgraben!«
Wenige Tage später setzte er sich mit Richard Pohl in anderer Beziehung auseinander. Pohl warb am eifrigsten für Berlioz, und Bülow konnte da nicht mehr mit. »In einem Atem für Gott, Sohn und heiligen Geist Propaganda zu machen, geht nicht. Kein Mensch hat es bisher fertiggebracht, für mehr als einen großen Mann auf einmal zu wirken. Unser Geist, unser Herz ist weit umfassend – das ist schön – darauf würden wir stolz sein; aber schielen wir nicht; das trübt den Blick und ängstigt das Publikum. Unsere tätige Begeisterung kann sich nicht für die Trinität auf einmal geltend machen. Dies Eine in der Trinität zu erfassen, gehört der Nachwelt. Wir haben die Pflichten der Mitwelt zu erfüllen und hiebei sogar zuvörderst die triviale Schranke der Nationalität zu ziehen. Wagner und Liszt stehen uns in diesem Augenblicke weit näher.« Gegen Berlioz hatte er aber auch Persönliches vorzubringen. Er fand es herzlos, daß der französische Meister das Geschenk einer Partitur von »Tristan und Isolde«, die von Wagner mit einer höchst schmeichelhaften Widmung versehen war, drei Wochen lang unbeantwortet gelassen hatte. Er tadelte auch sonst das Verhalten des Pariser Freundes, seine Eitelkeit, Undankbarkeit u. dgl. m. »Aber wenn man nur die Fehler der Menschen im Auge haben sollte, so müßte man jeden wie einen tollen Hund gleich niederschießen.« In der Unterschrift dieses Briefes machte er bei seinem Namen das B, L und W besonders kenntlich und schrieb dazu: Berlioz, Liszt und Wagner, bekannte sich also doch wieder als der schon durch den Namen berufene Vorkämpfer aller drei Meister, aber doch mit einer gewissen Steigerung, von Berlioz über Liszt bis hinauf zu Wagner.
Man muß beide Briefe, die in einem sehr unleidlichen Zustande: »Gesichtsschmerzen, Ohrenreißen, kurz ein Rheumatismus mit vollem Orchester«, geschrieben wurden, in ihrem vollen Wortlaute kennen, mit ihrem schroffen Wechsel klarer und verzwickter, einfacher und gekünstelter Sätze, mit ihren kühnen Wortbildungen und ihrer stilistischen Sorglosigkeit, ihrem drängenden Ungestüm, ihren spitzen Urteilen und ihren freimütigen Bekenntnissen, ihrem mehr galligen als »gallischen« Witz und ihren unwillkürlich hervorbrechenden Herzenslauten, und man hat den ganzen, echten Hans von Bülow, diesen leiblich gefolterten und seelisch nie ruhig ausschwingenden Sklaven seines Berufes und seiner Berufung, diesen auch in den sonnigsten Tagen nie vollkommen glücklichen und im trübsten Winter seines Lebens aufrechten und unerschrockenen streitbaren Menschen.
Zu Beginn des Jahres 1862 waren Bülows in Löwenberg, wo ein kunstsinniger Fürst besondere Teilnahme für die Tonkunst bezeigte und sich die neuesten Werke von seinem eigenen Orchester vorführen ließ. Zu des Fürsten Geburtstag, am 16. Februar, wurde ein französisches Lustspiel aufgeführt, in dem Hans und Cosima mitwirkten. Der Sommer führte sie wieder mit Wagner zusammen. Dieser wohnte jetzt in Biebrich am Rhein, nahe von Mainz und Wiesbaden, in einem dicht am Strome gelegenen Hause und stand von dort aus im Verkehre mit vielen Personen, die seiner Kunst geneigt waren und seinen Plänen förderlich sein konnten. So besonders mit dem außerordentlich begabten jugendlichen Tenoristen Ludwig Schnorr von Carolsfeld, seinem künftigen ersten Tristan, der damals mit seiner Gattin Malwine, der späteren Isolde, in Karlsruhe wirkte. Anfang Juni traf Hans ein, um Quartier zu suchen. Cosima folgte, und nun begann eine Reihe sehr anregender, fruchtbarer Wochen, in denen die Freunde nicht nur täglich am Mittagstische im »Europäischen Hofe« sich zusammenfanden, sondern auch regelmäßig bei Wagner musiziert wurde. Auch die beiden Schnorrs waren zu längerem Besuche gekommen. Der Gegenstand der musikalischen Unterhaltungen waren der »Tristan« und – die »Meistersinger«.
Trotz der fieberhaften Unruhe, die ihn von einem Ort zum anderen jagte, trotz allen Widerständen und Entbehrungen, mit denen er in dieser Zeit besonders hartnäckig zu kämpfen hatte, war Wagner von einer Schaffenskraft ohnegleichen erfüllt. In Wien und in Paris war die neue Dichtung der »Meistersinger von Nürnberg« entstanden; auch Teile der Musik waren schon entworfen. Hans besorgte in fünf Tagen zu acht Schreibstunden bei gräßlicher Hitze die Reinschrift der Dichtung, Wagner las sie vor, und die Musik, soweit sie eben vorhanden war, kam durch Bülow, dem alle Entwürfe zu fertigen Klavierauszügen wurden, zu ihrem vollen Rechte. Da war des Staunens kein Ende. Nach der Tristan-Tragödie dieses übermütige und dabei so feine und zarte Lustspiel! Nach der Tristan-Partitur, die für Hans das Höchste gewesen, was ihm erreichbar schien, auf einmal eine ganz andere, neuartige und doch wieder echt wagnerische Musik ohne jedes Vorbild, ohne Vergleichsmöglichkeit! Bülow war überrascht und hingerissen. »Kapitales Meisterwerk … ungeheurer Musikreichtum – ein Humor, gegen den der Shakespearesche fadenscheinig.« Aber Cosimas Begeisterung war womöglich noch größer. An ihren Vater schrieb sie: »Die Meistersinger verhalten sich zu den anderen Schöpfungen Wagners, wie das Wintermärchen zu den Werken Shakespeares. Wagners Phantasie hat sich in das Heitere und Schalkhafte verloren, sie hat durch ihren Zauber das mittelalterliche Nürnberg mit seinen Gilden und Zünften, seinen Handwerker-Poeten, seinen Pedanten und seinen Rittern heraufbeschworen, um in der höchsten, edelsten Weise das befreiendste Lachen hervorzurufen, von dem Geiste und der Bestimmung des Werkes abgesehen, könnte man es in seiner künstlerischen Ausführung mit dem Sakramentshäuschen in der St.-Lorenzo-Kirche zu Nürnberg vergleichen. Wie dort der Bildner, so hat hier der Tonsetzer die anmutigste, reinste Form erreicht, die Kühnheit in ihrer höchsten Vollendung, und wie am Fuße des Sakramentshäuschens Adam Krafft das Ganze mit ernster und gesammelter Miene trägt, so ist es in den Meistersingern die Gestalt des Hans Sachs, der mit ruhig-lieber Heiterkeit die Handlung beherrscht und leitet.«
Etwas von der Heiterkeit und Schalkhaftigkeit des Werkes übertrug sich nun auch in das Leben der Freunde, deren Kreis immer wieder durch Künstlerbesuche aus nah und fern ergänzt wurde. Auch ein Maler kam, Cäsar Willich, der von Otto Wesendonck in Zürich den Auftrag erhalten hatte, ein Bildnis Wagners herzustellen. Leider wollte es nicht gelingen, diesen Mann zum richtigen Erfassen des Wagnerschen Gesichtsausdruckes anzuleiten; wiewohl Cosima fast bei allen Sitzungen zugegen war und sorgsamst sich abmühte, den Künstler auf die richtige Spur zu bringen, so blieb doch schließlich nichts anderes übrig, als daß ihm Wagner in schroffster Weise sein Profil zeigte, dessen schulmäßige Nachzeichnung wenigstens eine deutliche Erkennbarkeit aufwies.
Ein Ausflug führte die Freunde einmal nach Bingen. Vom gegenüberliegenden Rüdesheim holte Wagner die dort ihren Urlaub genießende Frankfurter Schauspielerin Friederike Meyer ab, die Schwester seiner Wiener Elsa, Louise Dustmann. Cosima gewann lebhaften Anteil an dem Wesen Friederikes. Wagner schildert in seinen Erinnerungen den Verlauf des Abends: »Unsere Heiterkeit beim Glase Wein, in freier Luft, steigerte sich durch einen unerwarteten Auftritt: von einem entfernteren Tische trat zu uns mit gefülltem Glase in ehrerbietiger Haltung ein Reisender herzu, der mir eine sehr feurige und anständige Begrüßung bot; er war Berliner und weitgehender Enthusiast für meine Arbeiten, und es geschah dies im Namen noch zweier Freunde, welche gemeinschaftlich an unseren Tisch sich setzten, wo die gute Laune uns endlich bis zum Champagner verführte. Ein herrlicher Abend mit wundervollem Mondaufgange weihte die schöne Stimmung, in welcher wir spätnachts von diesem freundlichen Ausfluge zurückkehrten.« In ähnlicher Laune besuchten sie Schlangenbad, wo Alwine Frommann sich aufhielt, und Rolandseck. Weniger befriedigte sie ein Ausflug nach Osthofen auf das Gut des mit Wagner befreundeten Musikers Wendelin Weißheimer. Dort wurden sie »für eine Nacht einquartiert, nachdem man sie zu jeder Zeit des vorhergehenden Tages zum Genusse eines fortwährenden Bauernhochzeitsmahles genötigt hatte«. Cosima war die einzige, die bei diesen Vorgängen ihre gute Laune behielt, während Hans in wachsender Verstimmung über alles, was ihm je begegnete, bis zu Ausbrüchen der Wut gereizt wurde.
In der Wiesbadener Spielbank erlebten sie ein kleines Abenteuer: Wagner hatte ein Honorar von zwanzig Louisdor erhalten und wußte nicht recht, was er in einer Lage, die sich im großen immer mißlicher gestaltete, mit dieser verhältnismäßig kleinen Summe anfangen sollte. Da bat er Cosima, sie möge die Hälfte davon am Roulettetische für ihr gemeinschaftliches Glück versuchen. Nun sah er mit Erstaunen, wie die Freundin ohne jede Kenntnis selbst nur der gewöhnlichsten Spielregeln auf das Geratewohl ein Goldstück nach dem anderen auf den Tisch warf, »ohne weder eine Nummer noch eine Farbe bestimmt damit zu bedecken, so daß es regelmäßig hinter dem Rechen des Croupiers verschwand«. Wagner war es vergönnt, an einem benachbarten Tische Cosimas »Un- und Mißgeschick« wettzumachen. Das Glück war ihm so schnell behilflich, daß er die von ihr verlorenen zehn Louisdor wieder gewann, was beide zu großer Heiterkeit stimmte.
Unerfreulich verlief eine Aufführung des »Lohengrin« in Wiesbaden. Der erste Aufzug konnte noch hingenommen werden; alles Weitere ergab eine so empörende Entstellung des Werkes, wie sie Wagner nicht für möglich gehalten hätte. Wütend verließ er das Haus, während Hans, von Cosima ermahnt, die schickliche Rücksicht übte, das Ganze bis zum Schlusse auszuhalten.
Bülows üble Laune und fortwährende Unzufriedenheit, die Wagner manchen »machtlosen Seufzer« kostete, stand in auffallendem Gegensatze zu der künstlerischen Erhebung, deren er hier teilhaftig wurde, und war doch durch sie bedingt. Stärker als je vorher überkam ihn das Gefühl seiner Kleinheit vor dem Großen. »Wagner zum Nachbarn, da schrumpft alles andere so miserabel ein, wird so kindisch, null und nichtig.« Er konnte sich nicht einmal mit dem Probedruck seiner Lieder befassen, den ihm sein Verleger Kahnt aus Leipzig gesandt hatte. »Das Zeug kommt mir so lumpig vor, daß ich's gar nicht ansehen mag.« Es überkam ihn ein Überdruß an allem, was ihn bisher befeuert und erhoben hatte. »Ich wünsche, es wäre Schlafenszeit und alles wäre vorbei. Ich habe alles Selbstgefühl verloren und damit alle Lebenslust. Was fängt man mit einer ohnmächtigen Pietät an?« Und so schrieb er in denselben Tagen, in denen er die »Meistersinger« kennenlernte, ja in demselben Briefe an Pohl, worin er Wagner über Shakespeare stellte, nichts von einem besonderen Wohlbefinden, nichts von den Annehmlichkeiten des freundschaftlichen Verkehrs, sondern er wünschte sich weg von Biebrich und wollte auch von der übrigen Welt nichts sehen und hören. »Wenn ich eine Todesnachricht von mir auszusprengen den Humor hätte, wäre es längst geschehen. Meine Nerven sind total herunter – ich brauche absolute Ruhe.«

Richard Wagner (1861).
Verlag F. Bruckmann, München
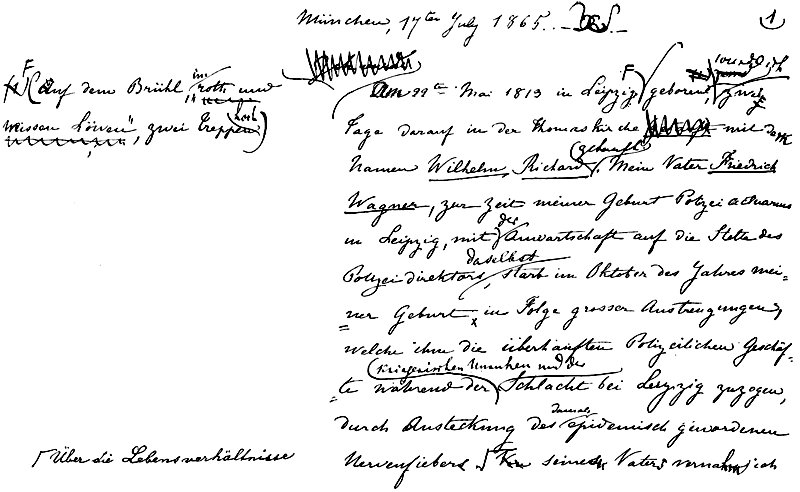
Erste Seite der Handschrift von Wagners »Mein Leben«.
Aus dem Archiv des Hauses Wahnfried.
Mit Genehmigung von Frau Winifred Wagner
Cosima dagegen war so beschwingt, wie Wagner sie noch nie gesehen. Von der geistigen Lebhaftigkeit, mit der sie alle Eindrücke in sich aufnahm, zeugt ein Brief an Alfred Meißner. »Wir sind in Biebrich gelandet, ein genugsam schöner Platz, den ich gewissermaßen liebgewonnen habe, nachdem ich die anderen Ufer des Rheins kennengelernt. Ich weiß nichts, was unverdienter ist als die Berühmtheit all dieser Gegenden, welche nur mehr oder minder die beauté du diable, das will sagen eine gewisse Frische und eine gewisse Anmut haben … Keine Größe, nichts Überragendes! Das ist alles klein, armselig, ärmlich, jämmerlich und dumm zugleich … Das ist meine Meinung über den Rhein. Wenn sie nicht mit der Ihrigen übereinstimmt, so zürnen Sie mir deshalb nicht. Ich habe bei den Ländern wie bei den Menschen die gleiche Art zu sehen, eine wilde, ja unmögliche Art, und es bedarf in der Tat der Anstrengungen, um ein gewisses Gleichgewicht zu gewinnen. Wir sind zwei Schritte von Wiesbaden entfernt, wohin wir aus Torheit manchmal gehen, wie man zu unangenehmen Menschen geht, weil sie in der Nachbarschaft wohnen. Ich komme immer mit größerer misanthropischer Stimmung zurück, als ich hingegangen bin. Es ist ein fürchterlicher Anblick, diese Anhäufung von abgelebten Frauen, von Spielern, von Seiltänzern, von Juden, wo man vergeblich eine ehrenhafte Gestalt sucht. Das ist das Vaterland der Leute ohne Gesinnung, die sich hier zusammenfinden, ähnlich wie die Vertreter der sozialen Hierarchie: hier ist das Alter ohne Würde, die Jugend ohne Anmut, die Eleganz ohne Anziehungskraft, die Aristokratie ohne Noblesse, der Reichtum ohne Glanz, alles ist gewöhnlich, niedrig, trivial, unedel, und wenn man durch Zufall im Parke von Wiesbaden den Gesang eines Vogels hört, so fragt man sich, wie ein so reiner Zwitscherer inmitten dieser schamlosen Maskerade noch sein Stimmlein erheben kann. Nach diesen Ausführungen werden Sie mich fragen, warum ich mich in diesem Lande niedergelassen habe … Wir sind hier aus Freundschaft für Wagner, der sich in Biebrich eingenistet hat und der von Zeit zu Zeit, wie alle Sterblichen, die Notwendigkeit fühlt, ein Wort mit einem befreundeten Wesen zu tauschen. Er hat uns gebeten zu kommen, und wir sind gekommen und wir haben für zwei Monate gemietet. Ich fühle mich nicht wohl, aber ich füge mich mit Humor vollständig, indem ich für das nächste Jahr von Tirol und Italien träume. Wir haben viel Musik gemacht seit unserer Ankunft. Die Schnorrs sind auf vierzehn Tage gekommen und haben unter der Leitung Wagners ›Tristan und Isolde‹ studiert, die sie wunderbar gesungen haben trotz der angeblichen Unsangbarkeit. Schnorr ist unter den Sängern, was der ›Regent‹ unter den Diamanten – ein Wunder. Er ist viel mehr Musiker als Tenor, viel mehr Künstler als Musiker. Man muß das Theater respektieren durch seine Ergebenheit für das Schöne, seine Fassungskraft und seine Interpretation der großen Werke, seine Einfachheit und Liebenswürdigkeit, vereinigt mit einer wahrhaften Sicherheit. Er ist der einzige Tenor, der sich an die erschreckende Rolle des Tristan gewagt hat, und er hält sich darin in wunderbarer Weise und zur großen Zufriedenheit Wagners, der auf den Brettern nichts anderes als Schauspieler und Komödianten zu finden gewohnt ist. Die letzte Dichtung von Wagner, die ›Meistersinger‹ – Hans Sachs – ist ein Meisterwerk. Er hat, wie Shakespeare, die Vereinigung von heiterer Komik mit dem Hohen herbeigeführt. Die Größe schwebt wie eine Sonne über der Handlung, die mit den drolligsten Zufällen geschmückt ist, wo der Humor sich eint mit tiefster Bewegung, ohne an seiner Kraft irgendwie zu verlieren. Hans Sachs ist vom Kopf bis zum Fuß in Bronze, lebend und stark, als ob ihn Peter Vischer geschaffen hätte.« Dann heißt es mit Bezugnahme auf die in Frankfurt tagende Hauptversammlung des Deutschen Nationalvereines, der seinen Sitz in Koburg hatte: »Wir haben hier die letzten Wogen von dem Frankfurter Feste verspürt. Gewiß, viel von Enthusiasmus, viel von Kameraderie – es ist zu glauben, daß wir Schweizer werden mit dem Herzog von Koburg als Präsidenten der Republik. Diese Feste scheinen mir einen direkten Nutzen zu haben für die Brauer und für die Weinverkäufer, und einen indirekten für die Dynastien, die sich mehr aufregen, als notwendig ist. Was für die Einigung der Völker erreicht wird, scheint mir, wie ich glaube, auf diese Weise nicht von Bedeutung zu sein, und die deutsche Einheit, wenn sie jemals in Erscheinung tritt, wird sich auf andere Weise vollziehen, als wie ein Friedenswerk.«
Hier spricht Cosima selbst von ihrer »Wildheit«; vielleicht war ihr das Wort durch Wagner geläufig geworden. Aber die Scheu, die dieser früher an ihr wahrgenommen, schien sich »in freundlichstem Sinne« verloren zu haben. Der tägliche Umgang vollzog sich in der gemütlichsten und unbefangensten Weise. Nur bei der Beschäftigung mit den Werken geriet Cosima in eine geheimnisvolle Spannung, die sich manchmal in Tränen löste. Als Wagner einmal »Wotans Abschied« vorsang, gewahrte er in ihren Mienen denselben Ausdruck, den sie ihm zu seinem Erstaunen bei ihrem Weggange von Zürich gezeigt hatte; nur war diesmal das Überschwengliche, Ekstatische »in eine heitere Verklärung aufgelöst«. Die gegenseitige tiefere Neigung konnten sie einander nicht mehr verhehlen, hier war alles »Schweigen und Geheimnis«, sagt Wagner in seinen Erinnerungen; doch nahm ihn jetzt der Glaube an ihre Zugehörigkeit mit solcher Sicherheit und Unbedingtheit ein, daß er es in seiner freudigen Erregung »bis zu ausgelassenem Übermute trieb«.
Er begleitete das Paar, als es scheiden mußte, noch bis Frankfurt, wo sie zwei Tage verweilten, um einer Aufführung von Goethes »Tasso« beizuwohnen. Die Prinzessin gab Friederike Meyer. Die als Vorspiel gebrachte sinfonische Dichtung »Tasso« von Liszt wurde aber so schändlich aufgeführt, daß Hans wieder in gelinde Wut verfiel. Der Direktor des Frankfurter Theaters machte bei dieser Gelegenheit Wagner den Vorschlag, demnächst den »Lohengrin« neu einzuüben und eine Vorstellung zu leiten. Wagner ging um so bereitwilliger darauf ein, als ihm Bülows versprachen, zu dieser Aufführung wiederzukommen. So war die Bahn frei zum Übermute. Als Wagner die Freunde über einen offenen Platz nach dem Gasthofe geleitete, forderte er Cosima plötzlich auf, sich in eine leer dastehende einrädrige Handkarre zu setzen, damit er sie so in das Hotel fahren könne; augenblicklich war sie dazu bereit, worüber er so erstaunte, daß er nun wieder den Mut zur Ausführung seines tollen Vorhabens verlor.
Zum »Lohengrin« in Frankfurt kamen Bülows nicht. Am 11. September war Blandine Ollivier auf ihrem Landgute bei St. Tropez an einem Entkräftungsfieber im Wochenbette gestorben.
Liszt hatte sie, ehe er nach Rom ging, besuchen wollen; doch er wurde von der Fürstin zur Eile angetrieben, der Tag der Hochzeit war schon bestimmt. So fuhr er nach Rom. Aber die Hochzeit wurde im letzten Augenblicke – »aufgeschoben« und hat, wie wir wissen, nie mehr stattgefunden. Die Fürstin verzichtete auf ihre Wiedervermählung und ist auch später, nach dem Tode ihres Gatten, als jedes Hindernis beseitigt war, nicht mehr auf diesen Gedanken zurückgekommen. Liszt blieb einstweilen in Rom und ergab sich dort einem beinahe mönchischen Leben, wobei er, angeeifert von der Fürstin, sich hauptsächlich mit der Erneuerung der katholischen Kirchenmusik beschäftigte. Dabei stand er in regem Briefwechsel mit Blandine, die sehr enttäuscht war, daß sie ihn nicht mehr sehen konnte, die aber ein künftiges Wiedersehen erhoffte und ihm nun in ihrer lebhaften Art viel von der Großmutter erzählte, die schon mit Eifer an den kleinen Socken für den künftigen Urenkel strickte. Die werdende Mutter hatte nur eine Bitte an den Allmächtigen: sie wollte keinem Menschen das Leben schenken, der »mittelmäßigen Herzens« sei. Aber wie wenn schon eine Ahnung ihres frühen Endes sie umschattet hätte, dachte sie jetzt viel an Daniel. Sie wollte auch ihrem Kinde, wenn es ein Knabe war, diesen Namen geben. Am 2. April 1862, am Namenstage Liszts, schrieb sie ihm: »Wir können nicht mehr, alle drei um die Großmama vereint, uns gegenseitig im Gespräche von Ihnen begeistern, wir wollten damals immer wissen, wer den Vater am meisten liebe, diese lebendige Verkörperung des Ideals … Einer von uns ist in seiner Blüte von uns genommen worden, als er so viele schöne Träume hätte verwirklichen können. Cosima ist in Deutschland, ich bin allein bei der Großmama wie einst, Sie sind immer fern wie einst und wir feiern den 2. April zusammen in dem sicheren Gefühle, daß Cosima in der Ferne und Daniel in noch größerer Ferne mit uns vereint sind in Ihrem Gedenken und an unserem Gebete teilnehmen, an dem Gebete, das alle Segnungen auf Ihr Haupt herabflehen möchte.« Die Großmutter hatte noch Kinderwäsche des kleinen Franz aufbewahrt. Die gab sie ihrer Enkelin, und es sollten daraus die Hemdchen für den neuen kleinen Daniel zugeschnitten werden. Das war nun alles vorbei. Daniel Ollivier lebte, doch seine Mutter war gestorben, seine Urgroßmutter war allein.
Bülow zauderte nicht, ein sehr empfindliches Opfer zu bringen, indem er Frau und Kind auf mehrere Wochen nach Paris schickte, um Frau Anna Liszt zu trösten. Wir verstehen es, daß diese ihre einzige noch verbliebene Enkelin nicht mehr von sich lassen wollte. Ernstlich wurde der Plan erwogen, daß Bülows nach Paris übersiedeln sollten. Doch Liszt selbst, den inzwischen Emil Ollivier besucht hatte, winkte deutlich ab. »Die arme liebe Cosima«, schrieb er seiner Mutter, »hätte ihren Besuch bei Ihnen gern verlängert. Sie hängt mit inniger Liebe an Ihnen; aber andererseits kann sie ihr Mann in der Stellung, die er in Berlin, überhaupt in Deutschland einnimmt, nicht entbehren. Es wäre nicht klug, wenn er seinen jetzigen Wohnort Berlin verließe, bevor ihm anderswo eine ebenso gesicherte Position geboten würde. Bülow hat besondere Rücksichten auf seinen Landesherrn zu beobachten, der ihn zu seinem Hofpianisten ernannt und mit seinem Orden ausgezeichnet hat … Sein Name und seine Antezedentien legen ihm strenge Verpflichtungen auf. Er muß die Haltung eines Mannes zeigen, auf den man sich ernstlich verlassen kann. Übrigens muß ihn auch die Stellung, die er seit Jahren am Sternschen Konservatorium innehat, in Berlin festhalten. Das alles habe ich Ollivier ausführlich erklärt, der es Cosima geschrieben haben wird. Ihr gegenüber bedarf es keiner umständlichen Auseinandersetzungen. Sie begreift schnell und erfaßt das Wesentliche der Dinge. Entschuldigen Sie meine Weitschweifigkeit in dieser Sache, liebste Mutter; doch teile ich Cosimas Bedauern, nicht immer in Ihrer Nähe zu sein.«
Nach unserem Gefühle war Liszt diesmal gar nicht weitschweifig. Mit dem ihm eigenen Tone ruhiger Sachlichkeit forderte er den Sieg der Vernunft über die zärtlichsten Empfindungen. Cosima kehrte nach Berlin zurück, nahm jedoch an dem dortigen Leben weniger Anteil als früher, da ihre Gesundheit wieder sehr schonungsbedürftig war: sie sah neuen Mutterfreuden entgegen. An einem von Wendelin Weißheimer veranstalteten Konzert in Leipzig, bei dem Hans das neue Klavierkonzert in A-Dur von Liszt zu spielen hatte und Wagner selbst das Vorspiel zu den »Meistersingern« und die Tannhäuser-Ouvertüre dirigieren sollte, nahm sie aber doch, sehr bald nach ihrer Rückkehr, teil. Dieses Konzert war hauptsächlich als »Kompositionskonzert« Weißheimers gedacht. Es fiel nicht zur Freude des Veranstalters und der Mitwirkenden aus. Wagner meinte später, er hätte »in gleichmütiger Stimmung« wahrscheinlich schon bei den Proben gegen die Vortragsordnung mit den vielen, höchst mittelmäßigen Stücken von Weißheimer Einspruch erhoben, wenn nicht gerade diese Proben durch das Zusammentreffen mit Bülows für ihn zur freundlichsten Erinnerung geworden wären. Cosima, in tiefer Trauer und sehr blaß, trat ihm wie aus einer anderen Welt entgegen, und »alles, was uns erfüllte«, besonders auch der tiefe Schmerz über den unerklärlich plötzlichen Tod Blandinens, »war so ernst und tief, daß nur die unbedingte Hingebung an den Genuß unseres Wiedersehens über jene Abgründe uns hinweghelfen konnte«. Die Vorgänge bei den Proben wurden ihnen so »zu einem sonderbar erheiternden Schattenspiel, dem sie wie lachende Kinder zusahen«, und sogar während des Konzertes erregten Wagner und Cosima durch ihre Lustigkeit Ärgernis bei seinen Verwandten. Ähnlich wohlgelaunt waren sie beim nächsten Wiedersehen, als Wagner auf einer Konzertreise nach Rußland einen kurzen Halt in Berlin machte. Sein erster Weg führte in Bülows Wohnung. Cosima, die ihrer baldigen Entbindung entgegensah, ließ sich in ihrer Freude durch nichts abhalten, ihn zu Hans in die Musikschule zu geleiten. Dann unternahm er mit Cosima eine Spazierfahrt, und schließlich fanden sich alle drei beim gemeinsamen Mittagessen. Als Hans daran erinnerte, daß Wagner nicht gern Frauen »in gesegnetem Zustande« sehe, bemerkte dieser, »daß ihn an Cosima gar nichts zu stören imstande wäre«.
Am 11. März 1863 gebar Cosima ihr zweites Kind, wieder eine Tochter. Zur Erinnerung an die verstorbene Schwester wählte sie den Namen Blandine.
Richard Graf Du Moulin Eckart, dem wir die erste große Lebensgeschichte Cosimas verdanken und der durch seinen Vater, einen Schüler Hans von Bülows, mit diesem und seinen häuslichen Verhältnissen näher vertraut war, weiß zu erzählen, daß diese Geburt »beinahe als Drama geendet hätte infolge der beispiellosen Rücksichtslosigkeit der Schwiegermutter. Man ließ Frau Cosima in ihren Wehen und Nöten ganz allein und als man endlich zu Hilfe kam und sich bewogen sah, nach der sage femme zu schicken, da war das Kind bereits geboren«. Er behauptet auch in diesem Zusammenhange, daß die Mutter Bülows ihrer Schwiegertochter das Leben durch häßliches, leidenschaftliches, krankhaftes Auftreten bisweilen zur Hölle gemacht habe. Es sei dies jedoch nur deshalb erwähnt, weil es eben von Du Moulin Eckart behauptet wird. Aus den vorhandenen und zugänglichen Briefen ist nichts Derartiges zu folgern, und andere Personen, die mit Bülow viel enger verbunden waren, als Vater und Sohn Du Moulin, berichten im Gegenteil, Franziska von Bülow, die auch eine verheiratete Tochter hatte, habe stets größere Zuneigung und Nachgiebigkeit gegen ihre Schwiegerkinder als gegen ihre leiblichen an den Tag gelegt. Uns genügt es, daß Bülow selbst allerdings kein zärtlicher Vater war oder es nicht verstand, seine väterlichen Empfindungen warmherzig auszudrücken. Erst wenige Monate alt, verfiel Blandine in eine anscheinend tödliche Krankheit, aus der sie, nach dem Berichte Bülows, »durch die Wunder von Sorgfalt meiner Frau« gerettet wurde. Er selbst aber vermied das Wort Rettung und schrieb echt Bülowisch: das Kind sei »zu neuem Abonnement auf die schlechten Späße saurer Daseinsgewohnheit gewonnen« worden.
Als Wagner anfangs Mai von Rußland zurückkehrte, hielt er sich wieder in Berlin auf und begab sich auch diesmal sofort in Bülows Wohnung. Er hatte in den letzten Monaten keine Nachricht vom Befinden Cosimas erhalten und war daher sehr erschrocken, als das Hausmädchen ihn mit der Begründung, die gnädige Frau sei nicht wohl, gar nicht einlassen wollte. »Ist sie wirklich krank?« fragte er; und als er hierauf eine lächelnd ausweichende Antwort erhielt, begriff er zu seiner Freude den Stand der Dinge. Cosima war nur noch angegriffen vom Wochenbett und darum für die Mehrzahl der gewöhnlichen Besucher nicht zu sprechen. Auch Hans schien diesmal guter Dinge zu sein. Nach der Pflege Blandinens galt es aber für eine durchgreifende Erholung der sich aufopfernden Mutter zu sorgen. Ihre vorjährigen Träume von Tirol und Italien gingen diesmal noch nicht in Erfüllung. Sie erholte sich mit Hans in dem dänischen Seebade Klampenborg bei Kopenhagen, wo sie abwechselnd die Meeresluft und plastische Kunst im Thorwaldsen-Museum »kneipen« konnte. Dieser Aufenthalt hatte auch den gewünschten Erfolg. Nur Hans verfiel immer wieder in seine wunderlichen Stimmungen, die ihm bei den harmlosesten und selbst bei durchaus erfreulichen Dingen einen bitteren Scherz entlockten. So schrieb er an Draeseke: »Betreffs meines Familienlebens wirst Du wissen, daß ich bereits zwei Töchter habe. Es fehlt nur noch die dritte, um mich zum Lear auszubilden.«
Im Spätherbst desselben Jahres kam Wagner noch einmal, da er in Löwenberg ein Konzert zu geben hatte und den kleinen Umweg über Berlin machte, wo er mit Bülow nur auf dem Bahnhofe zusammentreffen wollte. Hans beredete ihn aber, einen Tag zu bleiben und einer von ihm geleiteten Musikaufführung beizuwohnen. Während Bülow mit den Vorbereitungen dazu beschäftigt war, unternahm Wagner mit Cosima eine Spazierfahrt. In welcher Stimmung sie waren, was sie im tiefsten bewegte, darüber lassen wir Wagner selbst sprechen: »Diesmal ging uns Schweigenden der Scherz aus: wir blickten uns stumm in die Augen, und ein heftiges Verlangen nach eingestandenster Wahrheit übermannte uns zu dem keiner Worte bedürfenden Bekenntnis eines grenzenlosen Unglücks, das uns belastete.« Damit war ihnen Erleichterung geworden. In Ruhe und Heiterkeit verbrachten sie noch das Konzert und das anschließende Mahl bei einem Berliner Freunde, und nach der in der Bülowschen Wohnung verbrachten Nacht trat Wagner die Weiterreise an. Beim Abschied wurde er an jene wunderbar ergreifende Trennung von Cosima in Zürich gemahnt; die dazwischenliegenden Jahre verschwanden ihm »als ein wüster Traum zwischen zwei Tagen der höchsten Lebensentscheidung. Nötigte damals das ahnungsvoll Unverstandene zum Schweigen, so war es nicht minder unmöglich, dem jetzt unausgesprochen Erkannten Worte zu geben«. Dies war am 28. November 1863.
Von den mannigfachen und doch stets in der gleichen Richtung verlaufenden Ereignissen der nächsten Zeit hebt sich eines heraus: im Februar 1864 wurde Hans Doktor der Universität in Jena. Das freute ihn und Cosima: gern ließ sie sich Frau Doktor nennen. Bald danach ging Bülow nach Rußland und hatte dort solche Erfolge und so angenehme Eindrücke, daß er den Vorschlag der Musikgewaltigen in Petersburg und in Moskau, Anton und Nikolaus Rubinstein, er möge doch nach Rußland übersiedeln, immerhin in Betracht zog. Aber die Rücksicht auf das Klima, nämlich auf »dessen Schwerverträglichkeit für Frau und Kinder«, stand dem entgegen; andererseits auch die »Illusion … als ob ich mit dem Opfer von neunjährigen Lebenskraftanstrengungen mir nicht doch vielleicht eine angemessenere Zukunftswirksamkeit in Berlin einstmals zu erwerben zu denken – gedacht werden könnte«.
Zur selben Zeit, an dem Tage, an dem Bülow diese Worte an Raff schrieb, vollzog sich die beispiellose Wendung im Leben Richard Wagners. Die Hoffnung auf den Wiener »Tristan« war begraben, auch sonst zeigten sich keine Wirkungsmöglichkeiten, keine Aussicht auf Erfolg; die Konzertreisen hatten zu neuen Verlegenheiten geführt, die Schuldenlast Wagners bedrohte ihn mit Gericht und Gefängnis. Fluchtartig hatte er Wien, seinen letzten, einigermaßen ruhigen Aufenthalt, verlassen und sich nach Stuttgart gewendet, wo er mit Weißheimer zusammentraf. An einem abgelegenen Ort in der Rauhen Alb hoffte er vor der Welt verschwinden zu können. Da ereilte ihn ein Abgesandter des Königs von Bayern, der ihn schon in Wien gesucht hatte. Gleich nach seiner Thronbesteigung ließ Ludwig II. den Künstler zu sich berufen, um »die Last des gemeinen Lebensdruckes« von ihm zu nehmen und ihm die Ausführung und Aufführung seiner Werke zu ermöglichen. Am 4. Mai 1864 stand Wagner in München vor seinem erhabenen Gönner und vernahm aus dessen Munde den gebieterischen Wunsch, er solle immer bei ihm bleiben, die Nibelungen vollenden und sie dann so aufführen, wie er wolle, als unumschränkter Herr, nicht als Kapellmeister, sondern als Freund des Königs. Dieser räumte ihm auch sofort einen Sommersitz am Starnberger See ein.
Am 12. Mai schrieb Wagner an Hans: »Ein unerhörtes Wunder ist in mein Leben getreten! das Unglaubliche ist Wahrheit. Ein junger König ist mein treuester Jünger: er übernimmt die Sendung, all meine Werke der Welt in der von mir gewollten Weise vorzuführen, und mich selbst gegen jede Sorge zu schützen.« Und am 9. Juni schrieb er: »Mein lieber Hans! Was ich Dir jetzt sage, und was ich Dich jetzt bitten werde, nimm das nicht als einen schnellen Einfall augenblicklicher Laune, sondern – wie einen wichtigen Paragraphen des letzten Willens eines Sterbenden auf. – Ich lade Dich ein, mit Weib, Kind und Magd für diesen Sommer bis so lange wie möglich Dein Quartier bei mir zu nehmen. – Dies das Resultat langer Beratung mit mir. – Hans, Ihr trefft mich im Wohlstand: mein Leben ist vollkommen umgestaltet! ich bin getragen von der gediegensten Liebe, dem reinsten Willen. – Aber – mein Haus ist öde! – Und nun erst empfinde ich dies viel schmerzlicher als je. – Über diese erste Zeit helft, Ihr Guten, mir nun hinweg! – Bevölkert mein Haus, wenigstens für einige Zeit! … Bedenkt, es ist das Bedeutungsvollste meines Lebens, was mir zuteil geworden: eine große Epoche, ein wichtigster Abschnitt! … Sehen wir gemeinschaftlich, welche Bedeutung dies alles hat, und – welche es noch für uns haben kann!« Dann stellte er ihm eindringlich dar, wie schön und bequem sie es bei ihm haben würden, beruhigte ihn wegen allfälliger Geldeinbußen und fuhr fort: »Wir werden uns auch nicht im mindesten belästigen. Alles ist für sich. Wenn wir das Bedürfnis der Einsamkeit haben, brauchen wir uns den ganzen Tag nicht zu sehen. Nur können wir uns haben! – Ach! ich bedarf einmal den Genuß eines solchen edlen, lieben Zusammenhanges mit teuren Menschen! – Und wie freue ich mich auf Eure Kinder! … wahrlich, Ihr Guten! Nur Ihr fehlt noch zu meinem Glück! … Kein Nein! Ich könnte es jetzt nicht ertragen … Auf! Kommt zu Eurem R. W.«
Und sie sind gekommen. Cosima ist geblieben.