
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am 18. Januar 1871 wurde in der »À toutes les gloires de la France« geweihten Spiegelgalerie des Versailler Königsschlosses die Wiederherstellung des deutschen Kaiserreiches verkündet. Von dem Haus Habsburg-Lothringen, das mit seinen österreichischen und ungarischen Ländern dem neuen Reich fernblieb, ging die Kaiserwürde auf die Preußenkönige vom Stamm Hohenzollern über, die sich mit den anderen deutschen Staatshäuptern, nach dem Wortlaut der Reichsverfassung, zu einem »Ewigen Bund« zusammenschlossen. Daß diese Neubildung, die das alte Einheitssehnen der deutschen Völker erfüllte, im Palast des Roi-Soleil Louis Quatorze, dicht bei der Hauptstadt des besiegten Frankreich, verkündet wurde, entsprach durchaus dem Geist einer Zeit, deren frommer Glaube in Schlachtensieg und Kriegsentscheidung die Stimme Gottes in ihrer wuchtigsten Klarheit zu hören wähnte. Merkenswert ist auch, daß in dieser Geburtsstunde des neuen Reiches Wollensstreit zwischen Legitimismus und Genie die Stimmung trübte: weil der alte König Wilhelm I. den Titel »Kaiser von Deutschland« gefordert, der Bundeskanzler Graf Bismarck aber den bescheideneren des »Deutschen Kaisers« durchgesetzt hatte, ließ der Monarch den Minister, dem er die Kaiserkrone dankte, vor dem Auge der deutschen Souveraine und Heerführer schonungslos seine Ungnade fühlen. Unter solchen Umständen trat der »Ewige Bund« ins Licht der Welt. Als die Frucht siegreichen Krieges, deren Reifen nur durch die kluge Umschmeichelung eines unheilbar Geisteskranken, Ludwigs des Zweiten von Bayern, und durch skrupellos schlaue Nutzung des Welfenfonds zur Tilgung allerhöchster königlicher Schulden möglich geworden war, wurde er in Feindesland, nach heftigem Streit monarchischer Ansprüche gegen Staatsmannsweisheit, zwischen Glockengeläut und Kanonengebrüll, in einer den deutschen Bürgern verschlossenen militärischen Versammlung enthüllt.
Sieben Jahre danach war dieses Deutsche Reich innerlich so gefestigt und außen so weithin anerkannt, daß Fürst Bismarck als »ehrlicher Makler« in europäischen Angelegenheiten walten und dem Berliner Kongreß präsidieren konnte, der im Nahen Orient den Hader zwischen Rußland, Großbritannien, der Türkei, Österreich-Ungarn und den Balkanvölkern provisorisch schlichtete und der Wiener Regierung des Kaisers und Königs Franz Joseph die Okkupation der türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina erlaubte. 1882 schrieb der russische Diplomat Graf Peter Schuwalow: »Aus Bosnien kommt einst die gefährlichste Bedrohung des europäischen Friedens. Fest wie Fels ist in mir die Überzeugung, daß dort der Zünder ist, der das Pulver in Flamme treibt.« 1888 starb Wilhelm der Erste, und nach neunundneunzig Tagen folgte dem stumm an Kehlkopfkrebs hinsiechenden Kaiser Friedrich sein ältester Sohn Wilhelm auf den Doppelthron des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen. Zwanzig Monate später jagte er den Fürsten Bismarck aus seinen Ämtern und faßte den verhängnisvollen Entschluß, den deutsch-russischen Assekuranzvertrag nicht zu erneuen. Die Folge dieses Entschlusses und der auf ihn gestützten Berliner Politik war die Alliance franco-russe, seit deren in Kronstadt feierlich besiegeltem Abschluß Deutschland sich von Zweifrontenkrieg bedroht glaubte. Am fünfundzwanzigsten Geburtstag des Deutschen Reiches sagte ich 1896 in meiner jungen Wochenschrift »Die Zukunft«: wenn in Berlin weiter so regiert werde wie seit sechs Jahren, werde sich ein »Völkerbund« bilden und unser mächtiges Reich so niederringen, wie hundert Jahre zuvor das Reich Napoleons niedergerungen wurde.
1898 starb Bismarck, der nie ein »Diktator«, nie auch nur im engsten Amtsbezirk, in der Auswahl seiner Gehilfen allmächtig gewesen und nun in unversöhnlich schroffe Opposition gegen die Politik Wilhelms des Zweiten getreten war. Am 9. November 1918 wurde, von einem deutschen Fürsten, dem Prinzen Max von Baden, die Abdankung des Kaisers, noch ohne dessen Zustimmung, verkündet. Am 28. Juni 1919 mußten zwei Vertreter der Deutschen Republik in der Spiegelgalerie des Versailler Königsschlosses den Friedensvertrag unterschreiben, durch den der Spruch eines siegreichen Völkerbundes der deutschen Nation alles in drei Kriegen territorial Eroberte, auch Hauptstücke des von Friedrich dem Großen erstrittenen östlichen Preußenlandes, nahm und das am 18. Januar 1871 begründete Deutsche Reich begrub. Alle deutschen Dynastien waren von ihren Thronen gestiegen, und ihr »Ewiger Bund« hatte achtundvierzig Jahre gelebt.
Das »Heilige Römische Reich Deutscher Nation« war nicht erst im Sommer 1806 gestorben, als der Habsburger Kaiser Franz, um die Hausmacht Österreichs zu retten, den Kronreif der Karlinger ablegte. Längst schon hatte es ein ärmliches Schattendasein gefristet und niemals sich von dem gewaltigen Streich erholt, mit dem Luther es traf, da er den Staat aus der Vormundschaft der Kirche löste. Die Gestalten des altrömischen Cäsar und des neurömischen Apostelfürsten, der Papst hieß, waren vereint durch die Geschichte geschritten und, trotz ihrem Kampf um die Herrschaft, die unlöslichen Elemente einer Macht-Einheit geblieben. Seit zwischen ihnen Luthers (des nicht frühesten, aber an Wirkung stärksten Reformators) breiter Schatten sich aufreckte, wandelte sich die Zeit: das graubraune Gewölk des Mittelalters wich und der frühlingfrische Wind aus dem Land kühler Vernunft zerwirbelte das Wahngebild einer »Sacra Caesarea Majestas«. Zwar werden noch alle Künste theokratischer Mythenbildung aufgeboten, um den jeweilig regierenden Häusern gläubige Anbetung zu sichern; doch in den Erdbeben der Englischen und insbesondere der Französischen Revolution war der Hort monarchischer Legitimität zerbrochen; und der Sonnenaufgang amerikanischer Freiheit ließ am Horizont ein neues, aus der Anerkennung unverjährbarer »Menschenrechte« aufleuchtendes Staatsideal sichtbar werden. Das Heilige Römische Reich der Deutschen verfiel, wurde den Nachbarvölkern zum Spott und keinem Kaiser gelang je noch, mit dem Schein der Macht auch deren Wesen sich zu bewahren. Selbst der Größte ihrer Reihe, Napoleon Bonaparte, hat es nicht vermocht; unter dem Segen des Papstes (der ihn dann bannte und in Fontainebleau dafür büßte) hat er, der Sohn und Exponent der Revolution, seine Stirn mit dem Diadem Karls des Großen geschmückt, sich als das gebietende Haupt der Christenheit gefühlt und zugleich den heidnischen Traum der Kyros und Alexander weitergesponnen. Dennoch war er nur Plagiator verklungener Römerherrschaft; und weil er die Welt beherrschen, seinem Willen unterwerfen wollte, waffnete die Welt sich gegen ihn. Aus Passy hatte 1777 Franklin an Cooper geschrieben: »In Paris glauben alle, daß die Sache Amerikas die der Menschheit ist und daß unser Kampf für die Freiheit sie auch den Europäern sichert.« Ein Vierteljahrhundert danach konnte kein Sterblicher dem verlebten Leib des Universalreiches noch einmal beseelenden Atem einhauchen. Das 1871 gegründete Deutsche Reich mußte, wenn es sich einwurzeln und dauern wollte, von allem Pomp und Trödel alter Weltkaiserei sich lösen; durfte aber auch nicht den Helm mit dem spitzen Messingstachel und die enge Wolljacke preußischer Zucht tragen. Sein Leben war gefährdet, sobald sein Kaiser einem Imperator ähnelte, der die Hand über die ganze Erde streckt und sich in trügerischem Schein der Allmacht und Allgewalt sonnt.
Diese Gefahr ist erst an der Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts dem Gewimmel fühlbar geworden.
Rings um die von den Soldatenkönigen des Stammes Hohenzollern gebauten Kasernen waren Städte entstanden, deren rasches Aufblühen und rastlos kribbelndes Leben den Betrachter an Goldgräbersiedlungen erinnerte. Der weithin, bis in die Kaufmannschaft, sogar in die Jugendzeit der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei fortwährende Drill hatte eine anderswo kaum je erreichte Disziplin der Massen geschaffen und eine Arbeitsmaschine aufgebaut, die das Staunen, aber auch mißtrauische Furcht der Umwelt weckte. Seit die deutschen Stämme geeint, zwischen ihnen die Zollgrenzen verschwunden waren, lag der deutschen Wirtschaft der Weltmarkt offen. Preußen blieb nicht nur auf dem Gebiet des Heereswesens der Lehrer und Führer. Auch in Ackerbau, Viehzucht, Rübenverwertung, Agrargewerbe aller Art, auf den Latifundien seiner Ostprovinzen wie in bäuerlichen Betrieben, in der Organisation der Industrie und in der Sozialgesetzgebung (Alters-, Krankheit-, Invaliditätversicherung, Fabrikinspektion) war seine Initiative der aller anderen Bundesstaaten voraus. In dem Essen Alfred Krupps, Westfalen, Schlesien besitzt es die industriell wichtigsten Bezirke. Die Annexion des Elsaß und eines Teiles von Lothringen hatte dem Reich in seiner Geburtsstunde neue Rohstoffe, Erz, Kohle, Kali, gegeben und sein Textilgewerbe gestärkt. Ein zuvor nie gesehener Bund vereinte die wissenschaftlichen den kommerziellen Arbeitern. Jedes gewerbliche Revier warb sich einen Stab von Ingenieuren, Agrar- und Industriechemikern. Das Laboratorium wurde das Allerheiligste der Fabriken, Bergwerke, Hütten. Und die von Wissenschaft und Technik geförderte Industrie wurde von kräftigen Kreditbanken finanziert, deren Vertreter im Aufsichtsrat an der Leitung der Gesellschaften mitwirkten. Alles war jung, fast nirgends Schutt von verfallendem Werk wegzukarren; und da ohne Respekt vor, ohne Ausnutzung von Altem überall Neues angeschafft werden mußte, galt das Modernste zugleich als das Billigste. Hastig war eine große, das Bild üppigen Reichtums zeigende Handels- und Passagierflotte, eine kühn dem britischen Muster nachstrebende Kriegsmarine gebaut worden. Der starke, pausenlos gestraffte Gesamtorganismus, dessen Kraft in den relativ engen Grenzen des Reiches und in den wenig ergiebigen afrikanischen Kolonien nicht voll zu verwerten war und der deshalb allzu laut atmete, lechzte nach »Betätigung« in weiteren Räumen. Eine, sozusagen, rationale Mystik umnebelte die Hirne mit dem Traum von zuerst industrieller, dann imperialer Dehnung ins Weite. Das leere, aber pompöse und gefährliche Wort »Weltpolitik« war vom Thron her so oft in die Massen geworfen worden, daß in ihnen der Glaube entstand, dabei müsse sich am Ende auch etwas denken lassen. Und draußen, in anderen Teilen unseres Planeten, den die nicht an kosmisches Betrachten Gewöhnten die Welt nennen, schien nun altes Besitzrecht streitig zu werden. Winkte hier nicht günstige Gelegenheit?
Großbritannien focht seinen Streit mit den Buren der südafrikanischen Republiken aus. Der Krieg zeigte das häßliche Antlitz eines Kampfes gieriger Großkapitalisten gegen ein still und fromm lebendes Bauernvolk, dem er die Macht und das Mitbestimmungsrecht über breite Stücke goldhaltiger Erde rauben soll. So sahen ihn fast überall die Massen, die ja immer noch im Vorstellungskreis der Hintertreppenromane und jeden Demos umschmeichelnder »Witzblätter« lebten und deshalb nicht begriffen, daß in den Gestalten von Cecil Rhodes und Paul Krüger ganz andere Gegensätze und kulturelle Notwendigkeiten sich verkörperten als etwa in denen einer Wucherhyäne und ihres Opfers.
Das melodramatische Temperament Wilhelms des Zweiten, stets ungeduldig wütend, wenn über andere Monarchen und Staatsmänner auch nur Tage lang mehr als über ihn geredet wurde, stets auf der Lauer nach einer neuen Glanzrolle, glaubte in dem Sturm wirrer Unmutsempfindungen das Stichwort zur Rückkehr auf den hellen Vordergrund der Szene zu hören, und entlud sich in eine Depesche, die nicht nur das englische Tun schroff verdammte, sondern dem Präsidenten der Transvaal-Republik deutsche Hilfe anzubieten schien. Als Antwort drang ein langhallender Aufschrei des Britenzornes über Kanal und Nordsee. Der Enkel der Queen Victoria, der sich bald nach seiner Thronbesteigung von Rußland zu England gewandt, übereifrig um die Gunst des Hofes von Saint James gebuhlt, den Rang eines englischen Admirals erstrebt hatte, dieser Herr enttäuschte nun, in einer Stunde britischer Verlegenheit, mit jähem Ruck alles Hoffen. Niemals ist die schrille Depesche ihm verziehen worden. Er hat Rhodes in Berlin empfangen und im Gespräch mit dem genialischen Traumgestalter, der im Reiseanzug vor den »Allergroßmächtigsten« trat, sich für den plumpen Eingriff mit Unkenntnis der wirklichen Vorgänge zu entschuldigen versucht, er hat sich geweigert, den alten Schlaukopf Krüger und die Generale der Buren zu sehen, einen Kriegsplan, der dem Feldmarschall Roberts und seinem Generalstabschef Kitchener den Sieg »sichern« werde, entworfen und nach London geschickt, hat seine Parteinahme für England, als dessen »einziger Freund in Deutschland«, betont und illuminiert. Vergebens. Die Flut wilden Zornes ebbte zwar ab, doch der Eindruck erbitternder Enttäuschung war nicht mehr wegzuspülen. In Frankreich hatte die antienglische Volkswut sich viel lauter, auf der Straße und in den »beuglants« von Montmartre, ausgetobt, die Queen war in Chansons und Karikaturen roh beschimpft, der Prince of Wales gezwungen worden, seinem geliebten Paris fern zu bleiben. All dies wurde vergessen. Nur die Wunde vernarbte nicht, die der Deutsche Kaiser dem Selbstachtungsbedürfnis jedes Briten geschlagen hatte.
Es war nicht das einzige Unheil, das die Effektsucht dieses Kaisers auch auf dem Feld internationaler Politik schon damals dem deutschen Volk brachte. Obwohl er von dem religiösen, moralischen, kulturellen und staatlichen Leben der ostasiatischen Völker nichts wußte und den Buddha, die sittlich reinste, seelisch feinste Gestalt aller Heiligen Bücher, für einen tückischen Dämon der Allzerstörung hielt, glaubte sein blinder, tauber, nur, leider, nicht stummer Größenwahn sich zu dem Amt des Orienterlösers berufen und auserwählt. In die Paläste der Herrscher, in die Kanzleien der Staatenverwalter ließ er, zu Propaganda, eine Zeichnung (ohne den allergeringsten Kunstwert) versenden, die alle Völker Europas unter Deutschlands Führung zum Kampf gegen die gelbe Rasse und ihren Buddha aufrief. Weshalb just den Deutschen, die im Fernorient doch nicht die breite Machtbasis der Briten, Russen, Franzosen, Holländer haben, in diesem Kampf die Führung zufallen solle, war ebenso unverständlich wie das Fehlen Amerikas, dem eine »gelbe Gefahr« näher als irgendeinem Europäerstaat wäre. Auch empfand jeder nüchtern Denkende, daß die Erhaltung der weißen Rasse, ihr Schutz vor Bastardierung durch fremdes Blut von der Pflicht befohlen, Kampfruf gegen das Gewimmel asiatischer Völker aber von Vernunft und Moral verboten wird. Dem Kaiser war das Geräusch und Echo dieses Rufes noch nicht laut genug. Im Jahr 1898 hatte er, auf Anregung des Admirals Tirpitz, China zu einem Pachtvertrag genötigt, der das Kiautschau-Gebiet in der Provinz Schantung auf neunundneunzig Jahre dem Deutschen Reich überließ. Das wollte sich also in Ostasien ein Imperium schaffen, mit Rechtsansprüchen gerade da auftreten, wo nach Menschenvoraussicht zwischen Russen und Briten ein Streit um die Vorherrschaft, zwischen England und Amerika ein Wettkampf um die Märkte entstehen mußte. Welchen Weg durch das Dickicht so verschiedener Interessen klarer Kaufmannsverstand zu wählen habe, lehrte die kluge Politik Amerikas, das vom Landbesitz Chinas nichts für sich forderte oder nahm, das hinter äußerer Ruhe leicht reizbare Selbstgefühl der Chinesen nicht verletzte und eben deshalb seinem damals fast nur mit Südamerika und Ostasien rechnenden Handel das breiteste Bett grub. An so leise Methoden konnte Wilhelms imperialistische Theatralik sich nicht gewöhnen. Einen Missionarmord hatte er flink zur Erlangung des Pachtvertrages genutzt. Den Aufstand der chinesischen Boxer des Ta-Chuan-Geheimbundes wollte er zu rascher Machtweitung nutzen. Da zu den Opfern der Rebellion der deutsche Gesandte gehörte, war nach allgemeinem Brauch Sühnung durch die verantwortlich Regierenden zu fordern. Der Kaiser strebte darüber hinaus nach schneller Stärkung seines Prestige. Was er zeichnen ließ, sollte Wirklichkeit werden: ein internationales Heer unter deutscher Führung nach Peking marschieren und den fremdenfeindlichen Aufruhr niederwerfen. Er ruhte nicht, bis er die Zustimmung der dem Plan widerstrebenden Mächte erschmeichelt und dem General Grafen Waldersee den Oberbefehl gesichert hatte. »Mit gepanzerter Faust dreinzuschlagen«, hatte er einst seinem nach Ostasien abreisenden Bruder Heinrich befohlen (in dessen hochgestelzter Antwort er dann als Menschheitmessias vergottet wurde). Jetzt hörten die zum neuen Sühnekreuzzug mobilisierten Truppen viel härtere Worte aus seinem Mund. Nie sollten sie Pardon gewähren, keine Gefangenen machen, ohne Erbarmen nur die Gewalt, Pulver und Blei sprechen lassen und vorsorgen, daß nach tausend Jahren noch im Reich der Mitte der deutsche Name solchen Schrecken verbreite, wie im Erdwesten der Attilas und seiner Hunnen. Die Welt horchte auf und fragte bang, was da werden wolle.
Nichts. Der Inhalt des aufzuführenden Dramas erwies sich als viel zu schmächtig für die pompöse mise-en-scène. Zu militärischen Operationen großen Stils kam es, natürlich, nicht; der vor der Ausreise in deutschen Städten mit Lorbeer gekrönte, als Triumphator gefeierte Generalissimus war froh, als er, ohne allzu rauhe Friktion mit dem eifersüchtigen Selbstgefühl der anderen Truppenführer, wieder heimkehren durfte; und nach langwieriger Verhandlung über das Zeremoniale verbeugte ein chinesischer Prinz sich, zur Entschuldigung, vor dem Thron des Deutschen Kaisers. Von Schantung, von all den technisch guten und teuren Anlagen, Bahnen, Häfen, Kabeln, Amtshäusern, Kasernen, Archiven ist dem Deutschen Reich nichts geblieben als die wehmütige Erinnerung. Auch die astronomischen Instrumente, Meisterstücke asiatischen Metallkunsthandwerkes, die den Gärten des Pekinger Kaiserpalastes entwendet und vor der Orangerie im Potsdamer Park von Sanssouci aufgestellt worden waren, mußten auf Deutschlands Kosten an ihren alten Standplatz zurückgebracht werden. Von all dem Geräusch währte nichts fort als der Nachhall der Rede, in der das Haupt der deutschen Nation die Krieger gemahnt hatte, den Hunnen in Grausamkeit nachzustreben. Auf die Schlachtfelder des großen Krieges noch trug das Echo den Schall dieser Rede zurück: und belud ein ganzes Volk mit der Schuld, die doch nur ein eitler Effektsucher zu tragen hatte.
Noch andere Nachwirkung kündete sich an. Zum drittenmal im Laufe weniger Jahre hatte ein Mächtiger die Welt rauh aus der Ruhe geschreckt. In Damaskus, am Grabe des Sultans Saladin, hatte Wilhelm, der seine Christenfrommheit doch stets überlaut betonte, nicht nur diesen christenfeindlichen Kalifen als eine rein strahlende Leuchte der Menschheit gepriesen, sondern sich den dreihundert Millionen Mohammedanern als Schutzpatron und Bundesgenossen angeboten. Zugleich verrieten allerlei ernste und unernste Symptome das Streben, die Gunst Amerikas zu erschmeicheln. Und der so, im Wechsel von Drohreden und Schmeichelworten, die Ruhe der träg gewordenen Alten Welt stört, ist Erbe der Eroberer, die durch Kriege Preußens Königsmacht und das Deutsche Kaiserreich mit preußischer Spitze schufen. Er sperrt die Gleise, auf denen die Haager Konferenz, ein Geschöpf russischer Finanznot, den Weg in Abrüstung und Frieden zu sichern sucht. Mit wachsender Hast baut er eine Kriegsmarine von solcher Größe, Panzerkraft, artilleristischer Stärke, wie kein Kontinentalstaat sie je erstrebt oder erlangt hat, und läßt um den Bug jedes vom Stapel laufenden Schiffes außer dem Inhalt einer Champagnerflasche einen Erguß seiner billigen Rhetorik schäumen. Er begünstigt und betreibt persönlich die Verlängerung der Anatolischen Eisenbahn bis nach Bagdad, an den Persischen Golf, wo er auch seiner Kauffahrerflotte einen Lade- und Löschplatz bereitet: will also (das muß draus der Brite schließen) einen trockenen Weg nach Indien haben. Auf dem Erdball, ruft er, darf künftig nichts mehr ohne die Mitwirkung des Deutschen Kaisers entschieden werden. Trachtet er etwa, in den Ländern der Mohammedaner, Hindu, Chinesen, Kaffern und in dem Weltreich Neptuns, dessen Dreizack er für sich begehrt hat, mit dem Einsatz deutscher Volkskraft Entscheidung zu erzwingen? Verdruß, Mißtrauen, Furcht bejahen die Frage. All dieses Reden, Grimassieren und Fuchteln, das dem Fernen wie Handlung aussieht, nährt den Glauben, ein neuer Imperator wolle die Erdbewohner seinem Gebot unterwerfen. Wohin das Auge blickt: überall sieht es, wie Dantes Träume von Universalmonarchie, den Adler des Kaisers schweben. Eines Kaisers von längst kaum noch vorstellbarer Art. Queen Victoria und die Kaiser Wilhelm I. und Franz Joseph hatten der Mahnung des Zars Nikolai Pawlowitsch gehorcht: jeder Monarch müsse sein Leben und Handeln so einzurichten streben, daß ihm die Vorrechte und Vorteile seiner erhabenen Sonderstellung vom Volk verziehen, nicht als Schuld angerechnet werden. Hinter dichten Gardinen spann, mochten Tories oder Whigs die Regierung bilden, Victoria still das feine und feste Garn ihrer fast immer dem British Empire weitsichtig nützlichen, nie allzuweiblichen Windsor-Politik. Still erlauschte und beschloß hinter schweren Gobelins der eiskalte Jesuitenzögling Franz Joseph neue Listen und Kniffe, die den Aufruhr und Zerfall der durch Heirat und Krieg dem Haus Habsburg eroberten, von Czechen, Deutschen, Magyaren, Serben, Polen, Italern, Kroaten, Slowaken, Rumänen, Slowenen, Ruthenen, von römischen und griechischen Katholiken, Lutheranern, Calvinern, Mohammedanern und Juden bewohnten Länder zu hindern verhießen. Und dieser letzte Habsburger ansehnlichen Formates blieb, trotzdem er die Verdrängung seiner Reichsmacht aus Italien und Deutschland erlebt hatte, bis in das höchste Greisenalter eine durch Pflichtgefühl und Beamtenfleiß den Haß entwaffnende, durch würdige Ruhe Achtung erwerbende Repräsentativgestalt. Als er in Gastein sich einst über die zudringliche Neugier des Publikums beklagte, antwortete ihm der alte Wilhelm: »Gedulde dich noch ein paar Minuten; wenn Bismarck kommt, achtet kein Mensch mehr auf uns.« So war dieser erste Deutsche Kaiser aus dem fränkischen Haus Hohenzollern; so war er, seit 1848 der Volkszorn ihn getrieben hatte, verkleidet nach London zu fliehen, und er dort die auch der Dynastie wohltätige Wirkung des englischen Königtums kennenlernte. Nie wurde ihm die Verfassung Herzenssache; und er war weder geistig-politisch kultiviert noch gar, wie die familiäre Eitelkeit seines Enkels prahlte, »groß«, aber ein sauberer Mensch von ungepflegt urwüchsigem Bauernverstand und nobler Haltung, ein guter Soldat, der auch den Monarchendienst, wie jeden anderen, gewissenhaft tat, stets bescheiden im Hintergrund blieb und mit dankbarem Stolz dort sich der Tatsache freute, daß sein Ministerpräsident im Rat der Staatsmänner vornan stand. Der dritte Zar Alexander war ein ernster, schwerfällig plumper Großrusse aus dem Lande der schwarzen Erde, der fast unsichtbare, schweigsame Muschik-Autokrat, der im Vollgefühl seiner caesaro-papalen Macht niemals wünschen konnte, daß über ihn, den Gebieter (Gossudar) und das Väterchen (Batjuschka) aller Russen, je laut gesprochen werde. Sein Sohn, der zweite Nikolai: eine von jedem Windhauch bewegte Binse; ein Schwächling, der, um seiner Schwachheit nicht allzu bewußt zu werden und zu scheinen, manchmal brutal wurde und noch öfter das leise Gelübde vergaß, die Tugend des Gentleman auf dem Thron, wo sie so rar ist, nicht zu verlieren. Immerhin war dieser Schwache stark genug, niemals dem Andrang der Eitelkeit nachzugeben, mit vorbildlicher Würde vom Thron zu steigen und in männlich schlichter Haltung den Tod zu empfangen. Selbst der tückisch-kluge Despot Abd ul Hamid, Sultan der Türken und Kalif aller Mohammedaner, hatte sich immer im Dunkel gehalten und niemals vor den vielen Mauern von Yildiz durch Pantomimik oder Rhetorik die Blicke auf sich gelenkt. Zum erstenmal, seit die Völker, die Massen nicht mehr, wie in der Griechentragödie der Chor, mit zustimmendem Geflüster oder leise warnendem Gemurr, nach langen Intervallen wohl auch einmal mit zornigem Aufschrei nur die Handlung begleiten, zum erstenmal, seit sie selbst, als dramatis personae, agieren, stand ganz vorn, im hellsten Lichtstreif der Bühnenrampe, einer, der täglich gesehen, gehört, genannt werden, zu jeder Entscheidung mitwirken, alle Sterblichen überstrahlen, im Schein von Allgegenwart und Allwissenheit als ein unbegreiflich hohes, vollkommenes Weltwunder bestaunt sein wollte.
In vielfach wechselnden, doch immer bunten oder glitzernden Gewändern stand er vor dem Auge. Er schrieb Verse und komponierte selbst die Musik dazu, zeichnete, malte, modellierte Statuen, entwarf Grundriß und Innenarchitektur für Kathedralen, Paläste, Kriegs- und Kauffahrerschiffe, löste souverän erzieherische, religionsgeschichtliche, theologische, soziale, kulturelle Probleme aller Art, gab Künstlern und Gelehrten, Assyriologen, Bildhauern, Ingenieuren, Histrionen, Artilleristen und Kapellmeistern barsche Anweisungen, war Feldherr und Theaterregisseur, Prediger und Marinetechniker, Musterbauer und Ästhetiker, Kirchenhaupt und Militärschneider in einer Person. »Mein Roggen ist der beste; die reinen Ulanenlanzen.« »Eure Modernen machen Rinnsteinkunst.« »Ich führe die Jugend von Sedan nach Mantinea.« »Schiller- und Verdun-Preis: Mahlzeit, wenn das Zeug MIR nicht gefällt.« »Ihr jroßer Delacroix soll erst zeichnen lernen.« »Ein Minister, der mir nicht paßt, kann sich die Matratze stopfen.« »Wagner? Nich mehr; is mir zu laut.« »Mit der Sozialdemokratie werde ich schon fertig. Das ist eine vorübergehende Erscheinung.« »Koner is ein andrer Kerl als der Herr Liebermann. Das versteh ich besser, alter Sohn; bin selbst Maler.« »Glauben Sie etwa, der König von Preußen weiß nicht, was sogar Sie im Kopf haben?« »Kadinen ist Musterbetrieb. Gegen meine Kacheln kommt nichts auf. Alle möchten mir's abgucken.« »Ob Schoen mit dem russischen Esel redet, is piepe; aber wenn ich mit dem Zar spreche, kommt was 'raus.« »Ach was, Julius: wenn's ernst wird, bin ich doch selbst Generalstabschef.« »Wenn die Arbeiter nu noch immer nicht zufrieden sind, nachdem ich so viel für sie getan habe: jetzt is die Kompottschüssel voll.« So schwadronierte Seine Majestät dreißig Jahre lang. Wie Keilschrift zu entziffern, die Trace einer Untergrundbahn zu führen, die Bibel zu deuten, Mozarts Sarastro oder Wagners Amfortas zu kleiden, ein Dreadnought oder Destroyer zu bauen, ein Denkmal zu setzen, die Jugenderziehung zu organisieren, die physische und die psychische Hygiene zu fördern, in gewandelter Zeit das Leben der Frau und des Lohnarbeiters zu gestalten sei: alles sollte und wollte die Weisheit des Imperator et Rex bestimmen. Denn sie stammt von Gott. Der Kaiser und König gleicht nur von außen anderen Sterblichen. Von Gottes Gnade ward er zum höchsten Amt berufen und auserwählt und mit seiner Zunge spricht Gottes Wille. Die Formel: »Dei Gratia«, die ein Wort der Aposteldemut in eins des Monarchenhochmuts umgefälscht hat, schwebt in anderen, dem Wurzelboden der Theokratie örtlich und sittlich näheren Kaiserreichen nur noch als ehrwürdige Fiktion um die Kuppel des Staatsbaues. In dem nüchternen, aller Mystik und Romantik entfremdeten Lande deutscher Geschäftsmenschen aber wird sie Tag vor Tag in die Hirne gehämmert. Immer wieder nennt der Kaiser von Gottes Gnade sich den Schirmer des Erdfriedens. Die Hoffnung des Redseligen, dadurch Vertrauen zu erwerben ist eitel. Ein Mann, der sich in ein Restaurant setzt, zwei Brownings und einen Säbel aufs Tischtuch legt und mit Stentorstimme ruft, er werde unter allen Umständen für Ruhe sorgen, ein so seltsamer Gentleman macht sich gewiß nicht beliebt. Wozu das stete Gerede vom »scharfen Schwert« und »trockenen Pulver«, wozu die Stärkung der Kriegsmacht zu Land und zu Wasser, wenn nur Friedenswahrung erstrebt wird? Schon einmal hat ein Hohenzoller, ein Träger der Preußenkrone, kriegerische Macht gehäuft, die erst sein Sohn, Friedrich II., zur Dehnung seiner Herrschaft verwandte. Schon einmal hat die Welt das Stichwort »L'Empire c'est la paix« gehört: aus dem Frankreich Louis Napoleons, das, dennoch, in zwei Erdteilen die Furie des Krieges entfesselte. Schwert und Pulver sind, wie friedlich sich auch der Besitzer gebärde, immer und überall eine Gefahr. Und hatten nicht, nach der öffentlichen Meinung Europas und Amerikas, die Generale und Admirale des Kaisers alle Pläne zum Scheitern gebracht, die von Nikolais Haager Friedenskonferenz, zu Demilitarisierung unseres Erdteiles empfohlen worden waren?
Mit der Last solchen Mißtrauens auf dem Rücken, geachtet, gefürchtet, bewundert, doch nirgends geliebt, trat Deutschland über die Schwelle des zwanzigsten Jahrhunderts. Als dessen zweites Jahrzehnt begonnen hatte, stand das rotglühende Zeichen des Krieges am Horizont.
Daß es nicht mehr verblaßte, sondern zur Flamme, zum Weltbrand wurde, haben vier Hauptumstände bewirkt: der zweimal in zehn Jahren nötig werdende Personenwechsel auf dem Thron von Großbritannien und Irland; der hemmungslos beschleunigte Wettlauf Deutschlands mit Britannien (Marine, Handel, Islam); der Streit um Marokko; der russisch-japanische Krieg mit seiner Rückwirkung auf Europa (Wiederaufbrennen des austro-russischen Kampfes um die Vorherrschaft in Südost, Balkankriege, Liquidation des Osmanischen und Habsburgischen Reiches). Um aber begreifen zu lehren, daß diese Umstände den Großen Krieg herbeiführen konnten, mußten, war der Rückblick auf die Genesis der Mißtrauensstimmung unentbehrlich.
Eduard VII. war zu klugem Genießen mehr als zu kräftigem Handeln geschaffen und nur Huldigungsdrang konnte ihn einen großen Staatsmann nennen. Was ihm aber unter den Monarchen den Vorrang, im Verkehr mit ihnen die Überlegenheit gab, war die bunte Fülle seiner Erlebnisse. Er hatte Menschen aller Klassen, Stände, Berufsarten in der Nähe gesehen, sich manchmal durch gefährliche Schwierigkeiten, die Kronprinzen sonst entfernt blieben, gewunden, Industriekapitänen, businessmen von dem grundverschiedenen Kaliber der Hirsch, Beit, Cassel, bis hinauf zu Rhodes nicht nur die Alltagstricks abgeguckt. Eadweard: so hießen die Angelsachsen einst den Verwalter des Gemeindebesitzes. Edward hat seinem Namen Ehre gemacht. In dem weiten Gebiet des Vereinigten Königreiches gab es kaum einen tüchtigeren Kaufmann und emsigeren commercial travellor. Er hat einen neuen Monarchentypus geschaffen: den König, der die Kundschaft besucht, den Konkurrenten das Leben sauer macht und von jeder Reise einen münzbaren Geschäftsabschluß heimbringt. Sicheres Taktgefühl und natürliche Liebenswürdigkeit erlaubten ihm, je nach dem Bedürfnis der Stunde majestätisch wie ein alter Hispanierkönig und geistreich vergnügt wie der skrupelloseste Pariser Boulevardier zu sein. Er konnte nicht ohne das Theater, kaum ohne den besonderen Duft der Kulissen leben; hat aber sein Leben und Königsamt niemals theatralisiert. Das schon unterschied ihn von seinem Neffen Wilhelm in Berlin. Der hatte ihn obendrein durch schroffe, schnell nach Buckingham Palace getragene Worte über Weiber- und Spielkarten-Geschichten verletzt, durch eine Halbgott-Allüre geärgert, deren Olympierbewußtsein für den Film posiert schien. Der Onkel kannte den Neffen, wie nur Verwandte, denen aus einer langen Lebensstrecke Intimes, Intimstes zugeflüstert wurde, einander kennen. Er wußte, daß »Willy« nicht an das Britenblut seiner Mutter, der Princess Royal Victoria, erinnert sein wollte; daß er mit dieser Mutter stets in stiller oder lauter Feindschaft gewesen war, sie, den von ihrem stärkeren Geist ganz beherrschten Mann, den Kronprinzen und Kaiser Friedrich, und ihren Bruder, Edward überall, schon bei dem dritten Zar Alexander, angeschwärzt, als bösartige Intrigenspinner verdächtigt und England als das im Insularnebel kauernde Ungeheuer dargestellt hatte, dessen Polypenarme die Menschheit zu umklammern und ihr die Atemwege zu sperren trachten. Wußte, wie effeminiert der von Weiblichkeit Abgestoßene, im Verkehr mit Frauen ratlos, bis in Flegelei Scheue war. Oft war dem King hinterbracht worden, die ruhelose Zunge des Kaisers rede prahlerisch von dem Tag, an dem seine Marine »der britischen Tyrannei das längst von allen Völkern ersehnte Ende bereiten werde«. Edward, der als Prince of Wales manchen Falstaff oder Pistol in irgendeiner Schänke von Eastcheap renommieren hörte, nimmt auch das Geschwätz an der Potsdamer Tafelrunde klatschsüchtig verweibter »Mignons« nicht allzu ernst. Aber er fühlt die Absicht, Rußland und Frankreich möglichst weitab von der Fahrstraße englischer Politik zu pilotieren, diese Politik als eine hochmütig-herrschsüchtige auch in den Vereinigten Staaten in eine Mißtrauensströmung zu steuern und mit dem isolierten seiner Transportwege und Nährmittel nicht mehr sicheren England dann die Rechnung auszugleichen. »Quis Teutonicos constituit judices nationum?« John Salisbury, der Sekretär des Kanzlers Becket, hat es gefragt, als ein von Roms Zauber geblendeter Deutscher Kaiser vor Mailands Toren stand. Edward nahm die alte Frage auf; und sein politisches Programm wurde der Satz: Deutschland darf weder Weltrichter sein noch auf dem europäischen Festland auch nur die herrische Führung an sich reißen. Deshalb werde die Entente Cordiale mit Frankreich und ihre Weitung in Triple-Entente (durch Rußlands Beitritt) nötig. Nicht durch Waffengewalt und Blutopfer der Nationen wollte Edward sein Ziel erreichen, sondern seinen Namen als den des King-Peacemaker ins Buch der Geschichte schreiben. Defensiv (richtiger: prohibitiv) sollte seine »Einkreisung« Deutschlands wirken; offensiv war sie nicht gedacht und den Rat des Admirals John Fisher, ohne Kriegserklärung die deutsche Flotte in den Meeresgrund zu begraben, hätte Wilhelms Onkel, der Sohn des Prince Consort aus Koburg, niemals befolgt. Weil er den Neffen und dessen Bestimmbarkeit durch szenische Effekte bis ins Innerste kannte, hätte er auch den Großen Krieg, dessen Vorbedingungen er, ohne ihn zu wollen, mitschuf, noch in der letzten Stunde zu hindern vermocht. Zu spät stieg er auf den Thron; und starb zu früh.
»Ich bitte Sie nur um eine Gunst: Hüten Sie sich vor Ihren englischen Verwandten und lassen Sie sich nicht durch das einschüchtern, was mein Vater erzählt!« (Der Vater war damals Kronprinz des Deutschen Reiches und hieß später Kaiser Friedrich.) »Er ist ganz unter dem Einfluß meiner Mutter, die, beeinflußt von der englischen Königin, ihn veranlaßt, alles durch die englische Brille zu betrachten. Er schimpft in geradezu unglaublicher Weise über die russische Regierung, stellt Sie und Ihre Regierung als Lügner hin und ich suche vergeblich nach Worten, den Haß auszudrücken, mit dem er Sie so schwarz wie möglich zu malen versucht. Aber diese Engländer haben zufällig mich vergessen; und ich schwöre Ihnen, mein teurer Vetter, daß ich alles, was ich nur vermag, für Sie tun will und daß ich alle mein Gelübde halten werde … In wenigen Tagen wird der Prince of Wales wieder hier sein. Ich bin keineswegs begeistert von diesem Besuch, weil (verzeihen Sie: es ist ja Ihr Schwager!) dieser unehrenhafte und intrigante Mensch zweifellos hier versuchen wird, die bulgarische Angelegenheit zu beschleunigen (wofür der Türke zu Allah flehen wird, daß er ihn zur Hölle senden möge) oder sich mit den Frauen am Hof in politische Dinge hinter den Kulissen einzulassen. Ich werde versuchen, ihn so viel wie möglich zu beobachten. Ich habe dem Fürsten Dolgorukij einige interessante Mitteilungen gemacht, betreffend die Zahl und Namen einiger indischer Regimenter, die in Rawal-Pindi für eine Truppenschau in Gegenwart des Emirs zusammengezogen worden sind. Text und Karikatur von Rußland in der letzten Nummer des ›Punch‹ waren in äußerstem Maße frech. Man muß das alles nur zusammen betrachten! Wer Ohren hat, kann hören! Möge sie doch der Mahdi alle zusammen in den Nil werfen! … Das ganze Gefolge des Prince of Wales sagt, es sei unbedingt nötig, daß früher oder später England und Rußland gegeneinander kämpfen müssen. Von diesem Augenblick an begann ich, mir Aufzeichnungen zu machen und jede Mitteilung zu erhaschen über alles, was eine Mobilisierung in England betrifft, um alles, was für Sie notwendig ist, zu wissen. Ich werde auch immer Dolgorukij sofort Bericht erstatten. Ich bin sehr eng befreundet mit dem englischen Militärattaché, der mir Dinge erzählt, die den anderen unbekannt sind … Meine Mutter, die sonst vor allem, was ›Krieg‹ heißt, einen heillosen Schrecken hat, sagte gestern, als man über die Aussichten des Friedens sprach, zu mir: ›Um alles in der Welt können wir jetzt keinen Frieden haben; wir müssen Krieg haben, es ist unsere Pflicht.‹ Ich vermute, daß dies die Ansicht der englischen Königin und ihrer Familie ist.«
Das sind Fragmente aus Briefen, die, in den Jahren 1884 und 1885, Wilhelm an den dritten Zar Alexander geschrieben hat. So sprach er zu einem fremden, dem Deutschtum unfreundlichen Souverän über die eigenen Eltern, die nach Menschenvoraussicht morgen den Kaiserthron besteigen mußten. So weit trieb vordringliche Eitelkeit ihn über die Grenze des Landesverrates, bis in Ausschwätzerei, die jeden Bürger vors Tribunal, jeden von mildernden Umständen so fernen ins Zuchthaus gebracht hätte. Alexanders Frau (und einziger intim Vertrauter) war die Schwester der Princess of Wales, die später Königin Alexandra von Großbritannien hieß. Den Inhalt und oft den Wortlaut solcher Briefe und ähnlicher, die ihnen (vierunddreißig Jahre lang, auch unter Nikolai Alexandrowitschs Regierung) folgten, hat Edward gekannt. Er wußte, wie unermüdlich sein Neffe, der Prinz, Kronprinz, Kaiser Wilhelm, gegen England hetzte, wie verschmitzt er Rußland und Frankreich, »les nations alliées et amies«, seit 1892 aus der britischen in die deutsche Sphäre zu ziehen trachtete. Er konnte diesen Briefen die an ihn selbst und an seine Mutter von Wilhelm geschriebenen vergleichen und daraus erkennen, daß der zärtliche Verwandte, während er England heimlich zu isolieren, auch in Amerika zu diskreditieren strebte, in Windsor Castle und in Buckingham Palace wiederum gegen die Alliance Franco-Russe, als gegen die schlimmste Friedensgefahr, wühlte, schmeichlerisch um die Gunst des Inselreiches buhlte und sich sogar für dessen »einzigen zuverlässigen Freund in dem anglophoben Deutschland« ausgab. Wilhelm aber hat sich stets als das Opfer der rastlosen Intrigen seines Onkels bezeichnet, der »ein wahrer Satan« sei, ihn »ganz persönlich hasse« und gegen ihn, nicht nur in Europa, sondern sogar in Amerika die ganze Presse mit englischem Geld bestochen habe. Bis auf die letzte närrische Verdächtigung, durch die dem gierigen Geschäftsmann in Doorn die Dollareinnahme geschmälert oder abgeschnitten worden wäre, ist so leeres Geschwätz ja noch in dem jämmerlichen Buch des Entthronten wiedergekehrt, das, weil es nicht einen einzigen Vorgang richtig, mit dem Mut zu ehrlicher Wahrhaftigkeit darstellt, nirgends Beachtung fand. Nach seinen Angaben war er stets das unschuldige Opfer fremder Blindheit oder Bosheit; hat er, der in sicherem Machtbesitz brutalste, in jeder Gefahr furchtsamste aller Sterblichen, immer das Gute und Nützliche gewollt, ist aber an der Ausführung immer, meist von seinen Ministern, gehindert worden. All dies ist ein Geflecht aus eitlem Wahn und bewußter Unwahrheit. Selbst ein allzu lange dienernder, dann sein Erlebnis »verwertender« Hofmarschall berichtet, wie dieser Kaiser seinem Kanzler grob über den Mund fuhr und daß er ihn zu einem Professor sprechen hörte: »Alle Schwierigkeiten entstehen dadurch, daß meine Untertanen, statt einfach zu tun, was ich ihnen befehle, selbst denken wollen.« Viel zu oft, viel zu lange, haben die Bürger, die dieser Selbstanbeter, trotz Verfassung und Wahlrecht, noch »Untertanen« zu nennen sich erdreistet, auf das elementare Recht, die elementare Pflicht frei geborener, aufrecht schreitender Menschen verzichtet: auf die Pflicht und das Recht »selbst zu denken«. Und fast ausnahmslos haben die Minister Wilhelms sich so in Dienerstellung erniedert wie, nach dem Zeugnis des Grafen Zedlitz, der vierte Reichskanzler Fürst Bülow, der »devot schwieg, wenn ihn der Kaiser brüsk, mit einer keinen Zweifel und keinen Widerspruch duldenden Äußerung unterbrochen hatte, und der sich später dann unauffällig wieder in das Gespräch einfädelte«. Das war der Zustand eines Sultanats; und nicht ohne Rechtsgrund hat, als diese dem Genius der Zeit unerträgliche Macht sich beherrschend über den Orient zu recken strebte, der sonst wortkarge russische Minister Sasonow meinen Scherz vom »Berliner Kalifat« wiederholt. In Berlin paradierte ein Monarch, der sich zur Herrschaft über den Erdball berufen wähnte.
Neben und hinter dieser Personalfrage, die für die Entwicklung, die Gewitterbildung bis in den Sommer 1914 wichtiger als alles andere Ereignis werden sollte, wirkten die Strömungen und Gegenströmungen, die Ballungen und Bedrohungen alter und neuer Macht.
Das relativ kleine, rings vom Meer umspülte Königreich der Engländer, Schotten, Iren will Riesengebiete beherrschen, eine Europa vorgelagerte Inselgruppe will der Vormund und Schicksalslenker des Kontinentes sein, auf dem ihr nicht die kleinste Parzelle (außer der den Spaniern entrissenen Mittelmeerfestung Gibraltar) gehört. Jede an der Peripherie auftauchende Gefahr wird im Zentrum, im Mutterland, fühlbar. Das muß wachsen, damit ihm die Wege nach und von den Dominions und Kolonien offen bleiben und es sie jedem anderen sperren kann. Als Piemonts Minister Cavour das franko-italische Bündnis ermöglicht hat, schreibt Queen Victoria an den Earl of Derby: »Wenn wir auf den Weltmeeren nicht übermächtig sind, ist die Ehre, die Zukunft unseres Reiches verloren; sie ist es schon, sobald Frankreich einen Bundesgenossen findet, der einer Kriegsflotte gebietet«. So spricht die seit Jahrhunderten fühlbare, noch heute nachwirkende Furcht; weniger vor Invasion als vor Hinderung der Weizen- und Rohstoffzufuhr, ohne die der kleine Kopf des ungeheuren Empire nicht leben könnte. Dem Rußland der genialen deutschen Despotin Katharina und des frömmelnden Schwärmers Alexander Pawlowitsch, dem grausamsten Geistknechter und der an Blut und Farbe fremdesten Rasse muß das Land alter Bürgerfreiheit und Erbweisheit sich verbünden, wenn keine andere Möglichkeit winkt, Übermacht zu hindern und England die Herrschaft über Wege und Zufahrt zu erhalten. Wie dürfte es Kultur und technischen Fortschritt fördern, wenn es selbst dadurch in Lebensgefahr käme? Den großen Bonaparte selbst, der noch im Purpur des Imperators, als Schwiegersohn des Erzhauses Habsburg, das Schwert der Revolution, »der Robespierre zu Pferde« blieb, hat England, weil er Europa aus der Vormundschaft John Bulls lösen wollte, durch Schmähschriften, Agitation, Koalition, Waffensieg vom Thron gestoßen, aus dem Himmel seines vom Genius bedienten Ehrgeizes gestürzt. Völkerfreiheit oder Fürstenabsolutismus, atrocities oder Humanität, Menschenrecht oder Tyrannei: hinter all diesen prächtigen Wortschleiern und Begriffsteppichen verbarg sich immer dieselbe Sorge. Von all den Schlagwörtern, die sie, sich Genossen zu werben, suchte und fand, hieß das klangvollste und haltbarste: »Wahrung des Gleichgewichts in Europa«. Diese Wortschale umschließt, als ihren Kern, den Wunsch, daß in Europa kein Staat mächtig genug werde, um Britannien und dessen Gefährten bedrohen zu können; daß alles bleibe, wie es für das Europa vorgelagerte Inselreich bequem ist; daß insbesondere nicht im Zentrum unseres Festlandes eine Staatengruppe entstehe, deren Übermacht den starken Arm über die Nordsee hinrecken könnte. Die Scheu, aus der Lage des Inselreiches in veränderter Welt den Schluß zu ziehen, überdauert alle Evolutionen der Technik. Als der Amerikaner Fulton den ersten Unterseebootsplan nach London brachte, sagte Pitt, England werde niemals so dumm sein, ein Kriegsmittel zu begünstigen, nach dessen vollendeter Herstellung das Britenreich den Untergang fürchten müßte. Die Ausführung wurde verschleppt. Doch der leichte Motor, der die Herrschaft über die Luft ermöglichte, trieb auch Fultons Versuch in grausig submarines Leben. Hundert Jahre nach Pitt ist das Tauchboot mit großem Aktionsradius fertig und bedroht keine andere Macht so gefährlich wie England, das weitaus die größte Handelsflotte hat und dem Feinde, der vom Meere abgesperrt ist, nicht mit derselben Waffe begegnen kann. Ein anderes Beispiel. Admiral John Fisher, einst Erster Seelord, hat selbst gesagt, daß England seine älteren Geschwader, die ihm in absehbarer Zeit eine erdrückende Übermacht sicherten, entwertete, als es sich zum Bau der Dreadnoughts und Superdreadnoughts entschloß, weil es annahm, die Nachahmung würde den Kontinentalstaaten zu teuer sein. Die aber hasteten rasch hinterdrein; und da nach der Meinung Zünftiger eine Seeschlacht großen Umfanges durch die geschwindesten, am stärksten gepanzerten und bestückten Schiffe entschieden würde, konnte die deutsche Seegewalt der britischen sehr nahkommen, und England hatte sich selbst um den sonst unentwindbaren Vorteil hoch überlegener Schiffzahl gebracht. Ob es die Technik hemmen oder beflügeln wollte: das Fatum ließ sich nicht zwingen. Luftschiffe, Torpedos, Tauchboote, Minen sind in der Welt wie seit Kains Brudermord auf Edens Acker der Tod. Und Englands Wille, diese Welt in den ihm bequemen Zustand zurückzuzwingen, sich das arbitrium mundi zu sichern, auch in Europa, auf dessen Festland es Fremdling ist, bestimmend zu handeln, wäre nur durchzusetzen, wenn ihm die Gottheit hülfe, die in Gibeon durch Josuas Mund die Sonne stillzustehen zwang. Aus eigener Kraft wird die Menschheit nicht eine Weltordnung verewigen, deren höchster Zweck die Sicherung des britischen Reichslebens ist.
Dieses Reichsleben bot dem Auge das Bild gesättigt ruhender Kraft. Hatte aber der Puls des Reiches, das sich selbst mit seinem Handel identifizierte, noch die Frische starker Jugend? Auch nach dem südafrikanischen Krieg, dessen Lehre vor der Unterschätzung britischer Kriegsfähigkeit warnen konnte, glich Englands Wirtschaft der einer vornehmen, in uraltem Wohlstand sacht verfetteten Firma, die nur sehr behagliche Geschäfte macht und von der Kundschaft Anpassung an den Hausgebrauch verlangt. Kurze Kontorzeit; jedes weekend ganz frei; obendrein manchen Feiertag. Angeln, rudern, segeln, vor und auf dem Flußhäuschen sich lüften, Golf, Cricket, Football, Tennis spielen, jagen, reiten, Rennen und anderen Wettkampf sehen: bleibt für solches Genießen nicht Muße, dann ist das Leben nicht des An- und Ausziehens wert. Da etabliert nebenan sich eine neue Firma. Deren Inhaber sind noch arm, müssen Ruf und Geld erst erwerben und lieben die Arbeit an sich, nicht nur als das Mittel zur Einkunfthäufung. Ihre Offices und Warenhäuser sind von der Frühe bis in die Nacht offen. Sie mieten junge, emsige Leute und liefern ebenso Gutes billiger als der ältere, im Besitzrecht geborene Nachbar; liefern manches, wofür er six pence fordert, schon für zehn Pfennige. Feiertag darf nur sein, wenn er nicht Verlust bringt. Jeder Kundenwunsch wird erlauscht, jeder nicht ganz tolle erfüllt. Reisende durchqueren alle Kontinente. Wird neues Bedürfnis entdeckt, neue Absatzmöglichkeit erwittert, dann ruft der Händler den Produzenten zu Rat. Ist, was bisher gemacht wurde, fortan nicht hübscher, haltbarer billiger zu liefern, dem Geschmack bestimmter Regionen besser anzupassen? Ist die Höhe der Versandkosten nicht irgendwo durch Ersparnis zu senken? Hinten besinnt ein Heer wissenschaftlich geschulter Techniker und Chemiker die Vorarbeit. Vorn klappert Reklame und funkelt Ausstatterkunst. Und der Sitz dieser jungen, betriebsamen Firma ist ein von sechsundsechzig Millionen Menschen bewohntes, von Rhein, Elbe, Oder durchströmtes Land; das an Kohle reichste auf der Halbinsel, die wir Europa nennen; ein Land mit klug betriebener Landwirtschaft und ungeheurer Industriefähigkeit. Dieses Schauspiel mußte die Alten ärgern. Wenn es dauerte, mußten sie am Ende ihre eigenen Gewohnheiten ändern, viel fleißiger und billiger, weniger stolz und gebieterisch werden, um sich gegen die Dreibünde von Geschicklichkeit, Arbeitsfreude und Geduld, von Wissenschaft, Technik und Händlerklugheit, gegen Dumping und Schleuderkonkurrenz halten zu können, deren Unternehmer der Gerechte dennoch nicht Schwindler oder Lieferanten schlechter Ware schelten durfte. Das Gefühl eines alteingesessenen Spezialhändlers, vor dessen schmales Schaufenster sich ein riesiges Warenhaus mit viel Sandstein, Goldstuck, Marmor, Glas, ein wahrer Schaupalast, hinprotzt: ungefähr so war das Empfinden der vom deutschen Wettbewerb ringsum bedrängten Engländer. Auch hatten sie, vom Augenschein unbelehrt, wie auf das Evangelium auf die Gewißheit geschworen, daß Großindustrie und Großhandel mit Ackerbau, der eine rasch wachsende Nation nährt, unvereinbar sei. Als der Kornzoll gefallen war, wurde ihr Land Wiese, Park, Sportplatz, Blumen- und Gemüsegarten, Parzelle. Das mußte sein, wenn England die Zeche und Hütte, das Magazin und Clearinghouse der Welt werden wollte. Mußte es sein? Hinter dem Kanal liegt Deutschland. Das baut Brotgetreide und Rüben, züchtet Vieh und Pferde, weitet und bessert von Jahr zu Jahr seine Landwirtschaft: und dennoch rauchen auf seiner Erde Schlote, surren Spindeln, sausen Dampfhämmer, türmt sich Kohle, Koks, Eisen, Stahl, Farbstoff, Exportgut aller Art. Ackerbau, Industrie, Handel werden von abstrahierender Wissenschaft und ihrer Schülerin, der Technik bedient und von Dutzenden starker Kreditbanken finanziert. Solche Bündnisse, so enge Arbeitsgemeinschaft kannte das England der Balfour und Asquith nicht. Hunderttausend Deutsche sprechen Englisch wie ihre Muttersprache; haben sich in London, Manchester, Liverpool, Birmingham, Bradford, in viel kleineren Städten umgetan. Tausenden sind Englands Philosophen, Dichter, Naturforscher, Maler, Erzähler, Historiker, Publizisten, Freunde, Englands Museen und Bibliotheken Heimstätte geworden. Und das Land, in dem solche Vielheit lebendiger Kräfte fühlbar und sichtbar ist, hat obendrein noch ein großes stehendes Heer, das doch nicht nur nach Meinung alter Chartisten mit Freiheit und Zivilisation unverträglich sein sollte; hat die gewaltigste aller je gesehenen Kriegsmaschinen, und ihr sind nicht in erzwungener Sklaverei, sondern meist in freudigem Stolz, Fabrikherren, Ingenieure, Agenten, Gelehrte, Kaufleute, Kopf- und Handarbeiter dienstbar. Der Durchschnitt-Engländer, dem Goethes Lyrik ebenso fern ist wie der Chemiker-Generalstab der Elberfelder Farbwerke, steht vor diesem Deutschland, von dem er nur die von Baedeker und Cook betonten »objects of interest« kennt, wie vor einem unlösbaren, unheimlichen Rätsel.

Kaiserproklamation in Versailles 1871
Dieses Deutschland scheint, unter diesem Kaiser, entschlossen, die Herrschaft über die Meere, den Handel, den islamischen Orient um jeden Preis, selbst um den eines auf mindestens zwei Fronten zu führenden Krieges, zu erstreben. Dagegen sucht das dreifach bedrohte Britannien Assekuranz. Wie könnte es Indien, den »pivot« seiner Politik, halten, wie mit einem Häuflein weißer Männer, den Schaumköpfchen auf dunkler, noch leise brandender Woge, das ungeheure Gewimmel Farbiger regieren, wenn ein von dem Berliner Willen geleitetes Kalifat ihm die Mohammedaner verfeindete, die bisher der feste Deich gegen die Hochflut der Hindu-Bewegung waren? Um die Assekuranz zu erlangen, opfert es wichtige, uralte Hauptgrundsätze britischer Diplomatie. Rußland, den nicht nur am Persergolf und an den Pamirs, sondern fast mehr noch als möglicher Alliirter Deutschlands gefährlichen plumpen Riesen, läßt es durch Japan schlagen, Weiße durch Gelbe, hebt das Reich des Mikado und Tenno in Großmacht: und ahnt eben so wenig wie das kurzsichtige, froh aufatmende Kontinental-Europa die unvermeidlichen Folgen dieses weltwandelnden Ereignisses.
Deutschlands möglicher Alliierter soll geschwächt, Deutschlands wahrscheinlicher Gegner (und prädestinierte Geisel) in künftigem Krieg soll gestärkt werden: Frankreich. Mit den Grundsätzen der »splendid isolation« und »free hand« geht auch der Entschluß über Bord, keine militärische Großmacht jemals zu Beherrschung eines Stückes der englischen Weizenzufuhrstraße gelangen zu lassen. Das Aprilabkommen von 1904 beendet, nach zweiundzwanzigjähriger Dauer, den anglo-französischen Streit über Ägypten und räumt den Franzosen das Herrschaftsrecht (in der Form des Protektorates) im marokkanischen Scherifenreich ein.
Das hatte ihnen schon ein Vierteljahrhundert zuvor Deutschland zugesprochen. Der Wunsch, Frankreich aus der Hypnotisierung durch den steten Gedanken an Elsaß-Lothringen, an die »revanche pour Sedan« zu lösen und es in anderen Erdteilen mit lohnender Arbeit zu beschäftigen, hatte Bismarck bestimmt, auf der Madrider Konferenz, 1880, den deutschen Vertreter für alle Forderungen Frankreichs eintreten zu lassen und der in ihrem höchst reizbaren Chantecler-Stolz gekränkten Nachbarrepublik, so zu sagen, einen Blankoscheck für ihre nordwestafrikanischen Ansprüche auszustellen. Mit gutem Recht waren seitdem die Pariser Regierungen überzeugt, daß Deutschland in Marokko desinteressiert sei und bleibe, von ihm dort also keine Schwierigkeit zu erwarten sei: und zehnfach schmerzhaft war deshalb die Enttäuschung, als die Schwierigkeiten begannen und sich schnell häuften. Ihre Ursachen waren mannigfach.
Der Vorgang von 1880 wurde der Nation verschwiegen; war vielleicht auch im Auswärtigen Amt vergessen. Dort saß, als einziger Träger der Tradition, der durch Personalkenntnis und Gehirnkraft eben so wie durch Wesensfehler und Schrullen vorragende Geheime Rat von Holstein, der, seit er auf die Anregung eines ostasiatischen Abkommens aus Paris keine Antwort erhalten hatte, in dem französischen Außenminister Delcassé einen persönlichen Feind sah. Volk und Parlament waren von der unstet sterilen kaiserlichen Politik, die zwischen Umschmeichlung und Bedrohung Frankreichs ewig schwankte, und von dem höflich behenden, aber ziellosen Diplomatisieren des Kanzlers Bülow nervös geworden und ersehnten ungeduldig »eine Tat«. Der Versuch, durch solche Tat sich in neues Prestige zu heben, hat nur, Glied an Glied, eine lange Kette politischer und psychologischer Mißgriffe gefügt: von der Landung und Rede des Kaisers in Tanger bis zu der Sendung eines Kanonenbootes nach Agadir. Sieben Jahre lang blendete die Berliner Regierung der Wahn, die Demütigung einer Nation von der Geschichte und dem Charakter der französischen könne dem nützlich werden, der dieser Nation nicht zugleich, durch Schwächung die Abwehrmittel, die Möglichkeit rächender Gegenstöße entringt. Deutscher Druck erzwang die gewaltsame Ausschiffung des (bis 1904 weder bewußt deutschfeindlichen oder gar kriegerischen noch mit besonderer Schuld an dem Marokkostreit belasteten) Ministers Delcassé, die bis in die Reihen seiner schroffsten Gegner, vorn an Georges Clemenceau, knirschend, als eine unerträgliche Erniedrigung, hingenommen wurde, und danach die Konferenz von Algesiras, die Deutschlands Vereinsamung offenbar werden ließ. Österreich-Ungarn konnte ihm in den gefährlichen Stunden kleine Dienste eines Agenten, Vermittlers (Wilhelms mit Kämpferbegriffen spielende Zunge nannte es »Sekundant«) leisten, die aber die klägliche Niederlage des Berliner Unternehmens keinem klaren Auge verbargen. Italien, der Dritte im Dreibund, war durch einen in Berlin unbekannt gebliebenen Vertrag (Delcassé-Prinetti), der ihm das Recht auf Tripolitanien und die Kyrenaika zusprach, zu Anerkennung der französischen Expansion nach Marokko verpflichtet und vermochte deshalb, auch wenn es gewollt hätte, nichts für seinen Bundesgenossen zu tun. Das Gesamtergebnis der unbedachten, von Prestigesucht und persönlicher Eitelkeit bewirkten Abenteurerpolitik war verhängnisvoll. In dem von innerem Hader um religiöse und pädagogische Fragen und um Abgrenzung sozialer Klassenmacht durchwühlten Frankreich der Waldeck-Rousseau, Jaurès, Briand, Combes, Millerand, die den Gedanken an Rachekrieg als Torheit und Frevel verwarfen, in dem Lande der »Déracinés«, müder Genießer und kühler Skeptiker, schwand die Hoffnung auf dauernden Frieden mit Deutschland, das seinem Westnachbar selbst in Nordafrika blühendes Leben nicht gönne, und die Auferstehung der den Krieg vorbereitenden Triebe und Handlungen begann mit der alltäglich von den »retraites militaires« geweckten Verherrlichung der Armee, die vor und nach dem Fall Dreyfus kaum noch beachtet, nur als ein notwendiges Übel geduldet worden war. Auch über die Welt hin aber hatte sich die Stimmung verbreitet, der sogar der von Wilhelm mit fast grotesker Schmeichelei umworbene Präsident Roosevelt unterlag: Deutschland, dessen Hand überall, in den Reichen der Mandschukaiser, der Zaren, Kalifas, in Nord- und Süd-Amerika, Irland, Frankreich, fühlbar sei, gefährde den Frieden, störe wenigstens immer wieder die Ruhe, dränge sich in fremde Staatsgeschäfte und müsse deshalb fest, wie ein böses Tier eingezäunt werden.
Als Erster (ich darf es nicht verschweigen), ungefähr ein Jahrzehnt vor dem Krieg, habe ich diese Tendenz mit dem Wort »Einkreisung« bezeichnet, dessen Begriff dann bald in alle Sprachen übergegangen ist, es aber im Sinn defensiven Vorbeugens, nicht in dem offensiven Handelns, angewandt. Klarer noch hätte das Wort »Einzäunung« meine Wahrnehmung ausgedrückt. Denn nicht Angriffskrieg gegen Deutschland, der allen Mächten allzu gefährlich schien, wurde vorbereitet, sondern ein Schutzbündnis, ein Guarantee- and security-Trust, der dem unsteten Irrlichtelieren deutscher Politik eine unüberschreitbare Grenze ziehen und ihrem bedrohlichen Wortgefuchtel und Rüstungseifer die Umwandlung in Taten unmöglich machen sollte. Noch war uns der Weltwille nicht bewußt feindlich. Nach dem eben so tölpelhaften wie nutzlosen Gestus von Agadir und nach der ungebührlich groben, gerade dadurch aber in Berlin als Einschüchterung wirkenden Rede des Schatzkanzlers Lloyd George, der am Eßtisch der Mansion House Deutschland häßlicher Undankbarkeit und unertragbaren Dünkels beschuldigte, hat Sir Edward Grey, als Chef des Foreign Office, diesen Willen in die Sätze gefaßt: »Deutschlands Kraft ist die beste Bürgschaft gegen den Versuch anderer Länder, ohne Rechtsgrund mit diesem starken Reich Streit zu suchen. Die öffentliche Meinung Deutschlands kann aber nicht verkennen, daß eine Nation, die über das größte Heer der Erde verfügt, die eine große Flotte hat und eine noch größere bauen will, mit der Furcht friedlicher Mächte rechnen muß, dieses Heer und diese Flotte könnten zum Angriff benutzt werden. Deutschland, das auf seine Stärke stolz sein darf, muß deshalb, wie mir scheint, alles ihm Mögliche tun, um den Verdacht zu entkräften, daß es einen Angriff vorbereite.« Diese Entkräftung wurde nur manchmal, in (auch dann noch zu lauten) Worten versucht; die Rüstung zu Land und zu See, der Dumping-Kampf um die Märkte, die Gründung und das Gelärm militarisierender Vereine, die »alldeutsche« Propaganda währten fort. Leider hat aber auch England in diesen kritischen Jahren nicht so gehandelt wie ihm Viscount John Morley, der Biograph Cromwells und Burkes, Walpoles und Cobdens, geraten hatte; dieser als Greis noch kühnste Denker des House of Lords rühmte den Kollegen Grey als einen der weisesten Leiter der internationalen Britenpolitik und sprach dann: »Deutschlands rascher Flottenbau erzwingt, weil er auch uns große Ausgaben aufbürdet, unsere Wachsamkeit; doch es darf uns nicht das Gefühl herzlicher Freundschaft für ein Land rauben, dessen Ehrgeiz nicht nur verständlich ist, sondern sogar erhaben genannt werden kann. Ein Volk, das auf allen Gebieten so ungemeine Fortschritte gemacht hat, muß sich Raum wünschen, auf dem der im alten Haus überschüssige Teil gedeihen kann, ohne sich von seinem Volkstum, von den hohen deutschen Idealen zu lösen. Und an solchem Raum fehlt es ja unter der Sonne nicht.« Diesen Raum Deutschen zu gönnen, hat England sich nicht entschlossen. Nur, freundlicher von und zu ihnen zu sprechen. Weil es als eine unbequeme, drückende Last die Pflicht empfindet, immer in der Nordsee die stärksten Geschwader zu halten, deren Verwendung in südlichen Gewässern morgen notwendig werden kann.
Die Welt ist ruhelos geworden: als habe der finstere Wille eines Ehrgeizigen ihren Schlaf gemordet, wie Macbeths den Duncans und seiner trunkenen Kämmerlinge. In Ost und West erwacht Wind, schwillt schnell zum Sturm, Blizzard, Taifun, Scirocco an und durch die hellsten Köpfe zuckt hier und dort schon die bange Frage: Wird Herbst, entlaubt sich der Baum aller Zivilisation und Kultur oder naht neuer Frühling, nach Orkanen ein Germinal?
Im Mai 1910 ist King Edward gestorben, dem die Triple Entente (mit Rußland und Frankreich), die (durch den unseligen deutschen Ausrodungskrieg gegen Hereros und Hottentotten begünstigte) Pazifizierung Afrikas, die Versöhnung der Buren und die Einzäunung des von seinem Neffen Willy beherrschten Reiches gelungen war. Unter dem Fünften George entpersönlicht das britische Königtum sich wieder mehr als seit dem Beginn der viktorianischen Ära. Doch die sonnigen Tage des »Merry Old England« kehren nicht zurück. Das von Sorge erzwungene Bündnis mit dem Japan, das über eine weiße Großmacht triumphiert hat, läßt die Herrenallure, mit der britische Männer bisher in steriler Erhabenheit und steifer Würde farbige Völker regierten, nicht mehr zu voller Wirkung kommen und erschwert noch mehr das Verhältnis zu den United States, der in nie und nirgends gesehener Schnelle erstarkenden Tochter Englands, die längst die Ehrfurcht der »Pilgram-Zeit« vor der Mutter verlernt hat und mißtrauisch auf den Alliierten des ihrer Pacificküste zustrebenden gelben Mannes blickt. Auf beiden Seiten wächst das Mißtrauen, seit die aus West importierte Hefe revolutionären Geistes in dem welken Leib Chinas gärt, das beide englisch sprechende Weltreiche sich offen halten, beide vor japanischer Oberherrschaft sichern wollen, ohne den Grimm des durch siegreiche Tapferkeit und imitation faculty für alle Technik gefährlichen Volks von Nippon aufzustacheln. Weil erst hinter der Daimio- und Samurai-Zeit, nach dem Übergang in eine besondere Art von Konstitutionalismus Japans Aufstieg in Macht und Weltrang begann, glauben auch andere Farbige nun, den selben Weg gehen zu müssen: Chinesen, Inder, Türken, Perser, allerlei kleinere, mongolisch bastardierte Völker. Rußland, das nach dem in Asien verlorenen Krieg genötigt war, sich wieder einmal nach Europa zu wenden, stößt hier auf eine zerfallende, dem Abenteurerklüngel der Talaat, Enver, Djemal ausgelieferte Türkei und auf austro-ungarische Intriguen, die nach der Annexion der von Serben bewohnten türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina, das ganze Königreich Serbien unterjochen, den Wladika von Montenegro zum Vasallen Wiens machen, die Habsburgerherrschaft bis ans Ägäische Meer strecken und sogar das durch Rußlands Waffen der Türkenknechtschaft entrissene, seit dem Frieden von San Stefano und dem Berliner Kongreß der russischen Einflußsphäre zugesprochene Bulgarien in ihr Netz einspinnen wollen. Das zarische Rußland lechzt nach Ersatz des Nimbusverlustes, den der Japanersieg ihm bereitet hat, und das (unter der falschen Firma Romanow bekannte) Haus Holstein-Gottorp will und kann den Kniefall eines Khans der Mongolei nicht als ausreichenden Ersatz der Ansehenseinbuße hinnehmen. Weil Rußland noch immer nicht einen eisfreien Hafen hat, der einem so ungeheuren Reich längst schon gebührt, weil es noch immer in das Schwarze Meer gepfercht ist, zerrt und rüttelt es ungeduldig an dem Schloß dieses Käfigs. Weil es aus den fernen Tagen Wladimirs von Kiew, der tatarischen Reichsüberschwemmung und fast pausenlosen Türkenkrieges den religiös-nationalen Zorn gegen Islam und Tatarensprossen im Blut hat, bringt es in Persien und weiter östlich den auf Muselmanenfreundschaft angewiesenen britischen Partner in arge Verlegenheit. Gegen die Türkei wendet sich auch Italien, das die Stunde zur Erlösung der Italia Irridenta (Istrien, Dalmatien, Trentino) aus den Klauen des habsburgischen Doppeladlers noch nicht gekommen glaubt, aber dem nationalen Sehnen irgendeine Befriedigung geben will. Der deutsche Panthersprung nach Agadir hat die Minister Vittorio Emanueles gelehrt, daß den Franzosen, trotz der ihnen 1909 abgepreßten Kongo-Entschädigung, Marokko noch nicht ganz sicher ist, Italien sich also beeilen muß, seinen Anteil aus dem Nordafrikavertrag Delcassé-Prinetti in festen Besitz zu nehmen. In Libyen verliert die Türkei das letzte Stück afrikanischer Erde. Ihre Ohnmacht ist offenbar und erwirkt gegen sie die Verbündung der zwei Serbenreiche, der Griechen und Bulgaren, denen später, nach dem dummen Verrat des Koburgers Ferdinand, der sich Zar der Bulgaren nannte und schon als oströmischer Kaiser Symeon, als Basileus von Byzantion in Konstantinopel einziehen und thronen sah, auch die Rumänen sich anschlossen. Agadir gab den Antrieb. Ohne den Panthersprung wäre das Italien Giolittis nicht nach Tripoli gegangen, ohne die türkische Niederlage in Tripolitanien wären die zwei Balkankriege nicht entbrannt und ohne die Balkankriege nicht die atmosphärischen Spannungen entstanden, deren Folge dann das viel größere Ringen werden konnte (nicht: werden mußte). Der Bukarester Friede ließ der Türkei nur ein winziges Stück europäischer Erde, köpfte die Großmachthoffnung Bulgariens und stärkte, territorial und militärisch, die Serben und Rumänen so beträchtlich, daß Österreich-Ungarn vor dem Tag zu beben begann, an dem diese Völker, vielleicht unter Rußlands Patronat und im Bund mit den Polen Galiziens und den Czechen Böhmens und Mährens, die Befreiung ihrer Stammesgenossen in Bosnien, dem Banat, Transsylvanien, der Bukowina und Herzegowina fordern würden.
Ehe dieser Tag im mürrischen Zwielicht eines Regenmorgens sich aus fahlen Scharlachschleiern hebt, hat blinder Machtwahn mit tatenlüsterner Feigheit sich an Abgrundrändern in gefährlich trunkenen Tänzen gedreht. Furchtsame Kinder singen auf dem Weg durch dunklen Wald. Furchtsame Völkerhirten suchen ihre Angst dadurch der Herde zu bergen, daß sie drohend den Stab schwenken, mit gellem Pfiff den Wachhund vorhetzen oder sonstwie eine Handlung vorzubereiten scheinen. Solcher Drang hatte, trotz der Warnung des Staatsmannes Li-Hung-Tschang, das Rußland des zweiten Nikolai nach Port Arthur, dann auf die Schlachtfelder am Yalu, bei Mukden und in das Gewässer von Tsushima verführt. Nun tobt er sich in den zwei anderen Kaiserreichen des europäischen Festlandes aus. Der von Bismarcks Meisterhand geknüpfte Dreibund ist locker, fast ein leerer Schemen geworden. Für Italien war er stets die Wartehalle, in der es bis in die zur Abrechnung mit Österreich-Ungarn günstige Stunde warm saß; er konnte aber dieses mit langen Küsten jedem Seeangriff offene Land nicht binden, wenn gegen ihn ein anderer Dreibund mit Englands Geschwadern und Schiffsgeschützen sich kehrte. Der war seit 1908, seit King Edwards Besuch in Reval, im Entstehen. Während der durch die austro-ungarische Annexion Bosniens bewirkten Krisis hatte die Eitelkeit und Rachsucht des russischen Ministers Iswolsky die Wirksamkeit dieses numerisch stärksten aller je gesehenen Bünde gelähmt und Rußland zu neuem Rückzug, neuem Prestigeverlust genötigt. Statt es danach zu schonen, kräftig für sein Recht auf freie Ausfahrt in Marmara und Mittelmeer einzutreten und dadurch den Spa1t zwischen russischen und britischen Interessen offen zu halten, schlug Berlin wütend auf das Reich des Zars ein, der, gegen Wilhelms aufdringlichen Rat, »sich nun auch mit England einließ.« Um Habsburgs adriatische Stellung gegen Italiener und Serben zu stärken, machte die kurzsichtige Schlauheit der Wiener und Berliner Zufallsregierer aus Albanien, einem halbwilden Land ohne Einheit des Glaubens, der Nationalität und Zivilisation, ein Königreich, auf dessen brüchigen Thron ein deutscher Prinz und Offizier des kaiserlichen Heeres kletterte. Um im Südost die im ganzen neunzehnten Jahrhundert von Österreich begünstigte, nun aber schwankende Türkenherrschaft zu stützen, wurde das Erste Armeekorps des Schatten-Padischah unter das Kommando eines preußischen Generals gestellt. Wer dieses Korps hat, gebietet über Konstantinopel und die Meerengen. Das durfte Rußland nicht dulden. Obendrein war seinem Minister Sasonow, dem bedachtsameren Nachfolger des kleinen Firebrand Iswolsky, die Absicht verschwiegen und der kurz zuvor aus Potsdam mit Girlanden und verzuckerten Freundschaftsversprechen Heimgekehrte nach der Enthüllung als ein Gefoppter ausgelacht worden. In Durazzo und in Konstantinopel, auf beiden Flanken der Balkanhalbinsel, die Befehlsgewalt in der Hand deutscher Offiziere? Unmöglich. Wieder trafen in einer Negation die Interessen Britanniens und Rußlands zusammen. Beide Pläne erwiesen sich, wie so viele Wilhelms, als kernlose Schalen. Von ihnen blieb nichts als vermehrte Mißtrauensstimmung. Als im Frühjahr 1914 die Pariser dem King George und Sir Edward Grey zujauchzten, begrüßte ihr innigster Jubel den anglo-russischen Bund.
Daß er, wider alle Weisheit der Historiographie und Prophetie, geknotet wurde und bis in Lenins Siegestag fest blieb, ist in das Schuldbuch kaiserlich deutscher Politik zu schreiben. Flotte, Islam, Handel, Transvaal, Bagdadbahn; Verzicht auf die russische Assekuranz, Eindrang in Ostasien, Begünstigung Österreich-Ungarns, Japans, der Türkei, Wacht an der Adria und Marmara: Mißtrauensgemeinschaft mußte die immer wieder von Schlag und Nadelstich, von Geschäftsstörung bedrohten Reiche verbünden, selbst wenn ihre Häupter nicht so oft durch laut polterndes Geprahl und leise weitergetragene Schmähreden gekränkt worden wären. Und zwischen ihnen stand Frankreich, dessen seit 1871 nie ganz in die Scheide gesunkenes Schwert seit den Tagen der endlosen Marokko-Schikanen, halb schon gezückt, den Zugriff eines Starken zu ersehnen schien. In der Ostsee hatte, durch Flaggensignal, Wilhelm dem Zar zugerufen: »Der Admiral des Atlantic grüßt den Admiral des Pacific!« Nikolai hatte, nur einmal ironisch, geantwortet: »Glückliche Reise!« Atlantic und Pacific aber interessierten immerhin auch andere Nationen, die keine Lust hatten, ihre Flagge dort vor fremden Großadmiralen und Allerhöchsten Kriegsherren zu senken. Daß all die kleinen Feuer, die im neuen Jahrhundert aufgeflackert waren, sich niemals zu großem Brand verbreitet hatten, war beinah ein Wunder und verbietet uns, die an der Themse, Seine, Newa beamteten Wächter für so tückisch, eroberungssüchtig oder dumm zu halten, wie Schuldbewußtsein, das sich hinter Sündenböcke verkriechen wollte, später behauptet hat. Die Herren Asquith, Grey, Morley, Burns, damals auch Lloyd George wünschen ungetrübte Fortdauer des Friedens, die ihrem Lande das Arbitrium über Europa gewährt. Nikolai Alexandrowitsch, der Begründer des Haager Schiedsgerichtes, ist dem Heer ein Fremdling, der leis bespöttelte Herr Oberst; und sein Sasonow einem kranken Papagei ähnlicher als einem reißenden Tier. Und Frankreich hat nach der Wahlniederlage der Nationalisten zum erstenmal ein pazifistisch gefärbtes Kabinett, das, wie Sarastros Heilige Halle, die Rache nicht kennt.
Da krachen in Sarajewo, der Hauptstadt Bosniens, die Schüsse, platzen die Bomben, die den austro-ungarischen Thronfolger und seine Frau töten. »Aus Bosnien kommt einst die gefährlichste Bedrohung des Friedens. Fest wie Fels ist in mir die Überzeugung, daß dort der Zünder ist, der das Pulver in Flamme treibt.« Brach der Tag an, der, nach fast fünfzig Jahren, jene Prophetie Peter Schuwalows bestätigt? Achtundzwanzigster Juni. An diesem Tage verlor Maria Theresia Habsburgs Stolz, Schlesien und Glatz, als Siegespreis an den Preußenkönig Friedrich. An diesem Tag hat in der kleinen Kathedrale der Wiener Hofburg Erzherzog Franz Ferdinand vor dem Kruzifixus die Ehe mit der Gräfin Sophie Chotek geschlossen und den Ausschluß dieser nicht ebenbürtigen Frau und ihrer künftigen Kinder von allen Kronrechten des Erzhauses feierlich beschworen. Und vierzehn Jahre danach hat, wieder an dem selben Tag, das Geschoß des zwanzigjährigen Bosniaken Gawrilo Princip unter heiß leuchtender Sonne den Erzherzog-Thronfolger und die Gattin, die Herrin seines Lebens, getötet.
Auf Österreichs Erde das Geschoß eines Österreichers aus serbischem Stamm. Das Jahrhunderte lang auf zerstücktem Heimatboden schmählich geknechtete Serbenvolk war eben erst vom Joch frei geworden und durfte sich endlich wieder dehnen. Aus heldisch und zugleich menschlich geführten Kämpfen war es, als Sieger über Türken und Bulgaren, in Skoplje eingezogen, in die lange verwaiste, lange beweinte Hauptstadt des großen Serbenzars, großen Romäerkaisers Stephan Duschan, dem Albanien, Bosnien, Makedonien, Thessalien untertan war, der aber als Schutzherr auch dem Basileus von Byzantion, der Republik Ragusa und dem Patriarchen von Phesae gebot. All diese Herrlichkeit war am Veitstag der Amselfeldschlacht, in der, bei Kossowo, Sultan Bajesid den Serbenkönig Lazar schlug, verscharrt worden. Nun erst, nach 525 Jahren, stieg die von Kriegsruhm durchklirrte Geschichte aus der Gruft. Noch wohnten zwar unter Habsburgs Szepter mehr Serben als in den Königreichen Peters und Nikolas; noch war in Österreich-Ungarn das Gravitätzentrum des Serbenstammes. Aber die in den zwei Königreichen Vereinten durften nun wenigstens hoffen, an die See, die allen anderen Völkern Europas (außer den Schweizern, die sie nicht brauchen) offen ist, zu gelangen, Serbiens silbernen Doppeladler im Goldpanzer wieder bis an die Adria blinken zu sehen. Diese Zuversicht hoffender Herzen feierte nach fünf düsteren Jahrhunderten zum erstenmal wieder den Tag des heiligen Vitus, den Vidov Dan, als das Ostern, nicht mehr als den Karfreitag des Serbenglaubens. Und just diesen Tag hatte, trotz aller ehrerbietigen Abmahnung, Franz Ferdinand, der als Generalinspektor des Heeres in Bosnien Truppenübungen besichtigen wollte, für den Einzug in Sarajewo auserwählt. Am Tag dieser Provokation warfen die Waffen der Cabrinowitsch und Gabriel Princip den krankhaft hochmütigen Habsburger von seiner Höhe ins Nichts. Ein Verbrechen? Gewiß wie die Taten der biblischen Judith, der Griechen Harmodios und Aristogeiton, des Römers Marcus Brutus, des Mythos-Schweizers Wilhelm Tell, des Genuesen Verrina, wie all der später Geborenen, die Zaren und Sultane, Kaiser und Könige, Großfürsten und Präsidenten, Diktatoren und Minister mordeten, um »das Land vom Tyrannen zu befreien«. Niemand aber hatte das Recht, für die Tat zweier kaum dem Knabenalter Entwachsenen das Herrscherhaus der Karageorgewitsch, die Regierung des behutsam klugen Nikola Pasic oder gar das serbische Volk verantwortlich zu machen. Das hat zunächst auch niemand versucht. Weder der seit sechsundsechzig Jahren herrschende Kaiser und König Franz Joseph noch seine zuständigen Minister, die Grafen Tisza und Berchtold, haben anders gedacht als der Kabinetschef Graf Hoyos, der offen aussprach, »er glaube nicht, daß in Belgrad oder Petrograd die Ermordung gewollt oder vorbereitet worden sei«. Ein aus dem Wiener Auswärtigen Ministerium zur Ermittelung nach Sarajewo gesandter Sektionsrat, Herr von Wiesner, hat von dort berichtet, man dürfe »als ausgeschlossen betrachten, daß an der Vorbereitung und Leitung des Attentates oder auch nur an der Waffenlieferung die serbische Regierung, wär's selbst durch Mitwisserschaft, beteiligt sei«. Mitwisser und Vorbereiter waren (wie die Schrift des Belgrader Professors Stanijewic über »Die Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand« unzweideutig erwiesen hat) nur zwei Offiziere, von denen die Planer des Attentates Lehre im Waffengebrauch erbeten und erhalten hatten. Diese Offiziere waren Todfeinde der radikalen Regierung Pasic, auf deren Antrag einer davon später eines Mordanschlages gegen den serbischen Thronfolger Alexander angeklagt und nach kriegsgerichtlichem Urteil erschossen wurde. Die Serbennation war in Stücke gerissen, unter Österreichs und Ungarns Fahne, unter der Mondsichel der Türken in Knechtschaft gezwungen, in ihren eigenen Königreichen Serbien und Montenegro ruhelos bedroht, vom Meer abgesperrt, durch die Habgier magyarischer Ackerbauer und Viehzüchter der natürlichen Absatzmärkte beraubt: nur allzu begreiflich ist also, daß in Fanatikerhirnen der Glaube keimte, durch Terrorakte den Weg in Befreiung und Einung bahnen zu können. Doch weder die erst seit zehn Jahren wieder eingesetzte Dynastie, die Erbin des Kara Georg, noch die Regierung konnte wünschen, das durch den Ertrag der Balkankriege fast um das Doppelte vergrößerte Land in neue Wirrnis zu stürzen und dem von langen schweren Kämpfen ermüdeten Volk neue Blutopfer abzufordern, die in einem Krieg gegen Habsburgs Doppelmonarchie, ohne festes Hilfeversprechen von Rußland und mit dem von Rachsucht fiebernden Bulgarien im Rücken, nach Menschenermessen vergeblich bleiben mußten. Längst wissen wir ja auch aus den dokumentarisch bewiesenen Angaben der Minister San Giuliano und Giolitti, daß schon ein Jahr vor dem Sarajewoer Attentat in Wien und Budapest der Vernichtungskrieg gegen Serbien geplant und nur durch Italiens starren Widerspruch die Ausführung vereitelt wurde. Ob nicht auch in dem böhmischen Schloß Konopischt, wo Wilhelm mit seinen höchsten Beratern für Armee und Marine im Frühjahr 1914 den Erzherzog Franz Ferdinand besuchte, das Gespräch um dasselbe Thema kreiste, wird nie mit bündiger Sicherheit festzustellen sein. Glaublich ist es; ein anderer Zweck dieser in feierlichem Plakatstil angekündeten Konferenz ist nicht auffindbar. Den Dienern Habsburgs und des Magyarenehrgeizes war Serbien nach seinen Siegen territorial zu groß, seine Anziehungskraft auf die in Österreich und Ungarn lebenden Konationalen zu stark geworden. Nach dem mißlungenen Versuch, den Bukarester Friedensvertrag in seinem ganzen Umfang anzufechten, wollten sie dessen Früchte wenigstens dem Volke König Peters entreißen, sein Land zerstückeln und ihm nicht nur die Hoffnung auf Bosnien und die Herzegowina nehmen, sondern es so eng knebeln, daß auf dieser Seite die Todesgefahr für Habsburgs Monarchie hinausgezögert wurde, die nun nicht mehr auf sich das Distichon anwenden durfte: »Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube, nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus«. Zu lange hatten zwei Habsburg-Lothringer mit dem Schwerte Deutschlands drohend gefuchtelt; jetzt wähnten sie, nur durch siegreichen Krieg sich die erheirateten, ererbten, erlisteten Länder noch retten zu können. Die Ermordung des (in Herrscherhaus und Volk gleich verhaßten) Thronfolgers bot den willkommenen Vorwand. Auch ohne ihn aber wäre der Krieg wohl kaum zu vermeiden gewesen: denn in Wien, Budapest und, leider, auch in Berlin überschrie den nüchtern wägenden Menschenverstand der aus militärischer Pflichtauffassung entstandene Glaube, die letzte solchem Unternehmen günstige Stunde müsse morgen schlagen, und wer sie tatlos, müßig versäume, der sei schuldig an nie mehr aufhaltbarem Niedergang und Zerfall des Vaterlandes.
Das Volk, das die Steuern zahlt und die »chair à canon« liefert, durfte von alledem nichts hören; woher wäre ihm sonst die notwendige Begeisterung für die nationale Sache zugeströmt? Dem Volk wurde ein aus der Tatsache des Verbrechens, das den Kronprinzen eines Kaiserreiches nebst seiner Frau aus blühendem Leben riß und kleinen Kindern in einer Minute beide Eltern nahm, leicht abzuleitender Film vorgekurbelt. Der zeigte den Mord als das Endziel einer Kette tückischer Verschwörungen, Serbien als ein Mördernest, die Habsburger und ihre Kardinale, Beichtiger, Generale, Minister, Statthalter, Beamte als väterlich milde Hirten »ihrer« Völker deutschen, slawischen, italischen, ugro-finnischen, dako-walachischen Stammes. Tränen der Rührung flossen. Zorn ballte die Fäuste. Dröhnend schrie die Stimme der ewigen Gerechtigkeit nach Sühne. Rasch war aus dem Potsdamer Kaiserschloß eine Blankovollmacht erlangt; die deutsche Zusage, »selbst auf die Gefahr russischen Eingriffes«, der das Kriegsfeld ins Unabsehbare weiten mußte, Österreich-Ungarn zu unterstützen. Auch diese Versicherung und die Abreden, die sie erwirkten, blieben natürlich Geheimnis. Serbien stand dicht vor der Wahl einer neuen Skuptschina und dachte schon deshalb nicht an Kriegsvorbereitung. Damit die Absicht darauf nicht den Kaiserreichen zugetraut werde, gingen oder blieben in beiden die Ressortchefs für Armee und Marine auf Sommerurlaub. Allmählich beruhigte die aus leichtem Junischlummer geschreckte Welt sich denn auch wieder und bettete sich auf das Kissen der kühlen Hoffnung, nach dem Verlangen und der Gewährung von Sühne, von strenger Bestrafung der Schuldigen werde der traurige Handel still eingesargt werden. Aus wieder entwölktem Himmel zuckte der Blitzstrahl des in Belgrad vorgelegten Wiener Ultimatums. Trotzdem es, ohne den Schatten eines Beweises, sogar wider besseres Wissen seiner Verfasser, die serbische Regierung der Mitschuld am Mord zeiht und ihr unerhörte, kaum tragbare Demütigung zumutet, nimmt sie, unter dem Druck Rußlands und der Westmächte, fast alles an und will für den Rest der Forderungen sich dem Spruch des Schiedsgerichtes beugen. Doch Wien ist entschlossen, nicht noch einmal auf die Gunst der Gelegenheit zu verzichten. Die Herren Poincaré und Viviani, Präsidenten der Französischen Republik und ihres Kabinetts, sind, auf der Rückreise vom Besuch am Zarenhof, auf der See, auch Wilhelm, der im letzten Augenblick ängstlich werden könnte, ist weitab von Berlin, in London die Atmosphäre für Serbien grau vernebelt, weder Nikolai noch Sasonow fest im Glauben an Heil verheißenden Krieg: jetzt oder nie! Damit die Serben das Ultimatum nicht ganz schlucken können, ist es dick mit Pfeffer und Paprika bestreut worden. Daß sie es, dennoch, fast ganz hinunterwürgen und nichts, keinen Bissen in wütendem Ekel ausspeien, wird nicht gesagt; ihre Antwort nur mit der färbenden, verwirrenden, entstellenden Duplik des Wiener Klüngels veröffentlicht, die den Oberflächenblick an klarer Erkenntnis hindert; der Gesandte Österreich-Ungarns, der schon vor dem Eingang der Antwort die Abreise vorbereitet hat, bricht die diplomatischen Beziehungen zu dem Königreich ab, aus Wien kommt die Kriegserklärung; über die Donau brüllen Geschütze …
Der Plan ist gelungen.
Ein Plan, den nur bis in Wahnsinn verblendete Hirne erbrüten und hegen konnten. Österreichischer Krieg gegen Serbien mußte die auf der Balkanhalbinsel stabilisierten Machtverhältnisse ändern: also war Italien nicht nur von der Pflicht der Mitwirkung frei, sondern sogar zu Klage über Bruch des mit Wien abgeschlossenen Vertrages berechtigt. Eitle Torheit wähnte, der Bluff, der unter dem ganz anderen Himmel der bosnischen Krisis die Russen zum Rückzug bestimmt hatte, müsse noch einmal wirken. Das konnte nicht sein; Rußland durfte, selbst unter dem friedlichsten Zar, die Zerschmetterung Serbiens nicht dulden, wenn es nicht auch in Südeuropa, wie zuvor in Ostasien, das Prestige der Großmacht verlieren wollte. Und in einen Krieg gegen Italiens Wünsche, gegen Rußlands Menschenmassen wagte sich ein Reich, in dessen Armeen, neben den nach »Anschluß« an das Reich der Hohenzollern strebenden Deutschen und den die Österreicher hassenden und von ihnen gehaßten Magyaren, in buntem Gemeng Czechen, Slowaken, Polen, Ruthenen, Italiener, Serben, Kroaten, Slowenen, Dalmatiner, Rumänen fechten sollten und dessen Entmachtung, Auflösung, Verschwinden all diesen Völkern längst das Ziel inbrünstigsten Sehnens war. In so hoffnungslosen Krieg ging Deutschland mit; ihm nicht furchtsam auszubiegen, hatte Wilhelms kriegerische Rhetorik die Wiener gemahnt. Vergessen, echolos ins Leere verhallt war Bismarcks Warnung: »Nicht nur der Panslawismus und Bulgarien, sondern auch die serbische, die rumänische, die polnische, czechische Frage, ja, selbst heute noch die italienische im Trentino, in Triest und an der dalmatischen Küste können zu Kristallisationspunkten für nicht nur österreichische, sondern auch europäische Krisen werden, von denen die deutschen Interessen nur so weit nachweislich berührt werden, wie das Deutsche Reich mit Österreich in ein solidarisches Haftverhältnis tritt«. Seit dieser Satz aussprach, was »the prophetic soul« des ersten Kanzlers ahnte, waren Jahrzehnte vergangen. Schon im Sommer 1913 war das von ihm gefürchtete Haftverhältnis geschaffen worden.
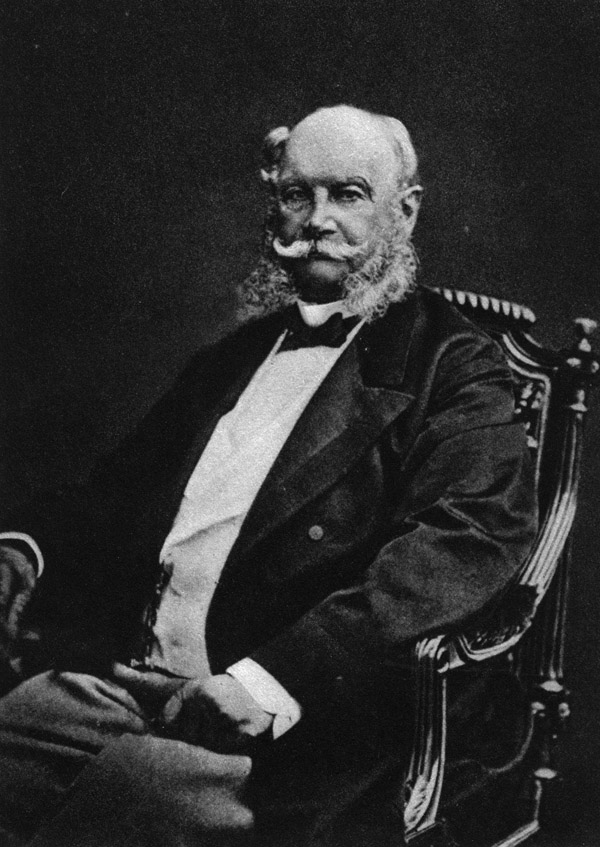
Kaiser Wilhelm I.
In der Wiener Hofburg saß ein uralter Kaiser, der aufgeatmet hatte, als der verhaßte, durch die Ehe mit einer nicht »ebenbürtigen« Hofdame ihm noch tiefer entwertete »Herr Neffe« aus dem Lichtschein der Majestät gestoßen war. Ganze Geschwader von Leid und Graus haben diesen Kaiser bedrängt. Seinen Oheim, den die Revolution von 1848 aus Wien trieb und der dem achtzehnjährigen Jüngling die Krone ließ, umfing Psychose mit gnädigem Trost. Der junge Kaiser verlor die Lombardei, der mannbar gewordene Venezien, das Recht auf die Elbherzogtümer Schleswig und Holstein, die Vorherrschaft, sogar den Sitz im Deutschen Bund. Sein Bruder wird als Kaiser von Mexiko zum Tode verurteilt und in Queretaro erschossen; die Frau überlebt ihn in Wahnsinnsnacht. Der einzige Sohn Franz Josephs (dem selbst der Schrecken des Mordanfalles nicht erspart bleibt) wird, als dreißigjähriger Ehemann und Vater, mit einer Schußwunde, tot, neben seiner Geliebten im Bett gefunden. Der Vetter der Kaiserin Elisabeth, König Ludwig von Bayern, entläuft dem Irrenarzt, wird von ihm gepackt, erwürgt ihn, ertrinkt neben ihm im Starnberger See. Elisabeth wird von dem Italiener Luccheni am Genfer See ermordet. Ihr Vetter Otto von Bayern, Ludwigs Bruder und Folger, hieß König, hauste aber als ein seelisch unheilbar Kranker, ein gemeingefährlicher Wüterich in einem fest verriegelten Waldschloß. Ein Erzherzog ist verschollen, einer der Strafe für widernatürliches Laster entzogen, ein dritter, nach schlimmen Ehen, aller Titel und Rangehren entkleidet, ein vierter, der schöne Vater des letzten Habsburgerkaisers, nach wüstem Taumelleben von Lues verzehrt worden; und eine Erzherzogin, die Sachsens Krone tragen konnte, ist durch die Sümpfe der Sexualgier bis dicht an die Pforte des Heimlosenasyls gewatet. In Italien war Savoyen, in Deutschland Hohenzollern der Überwinder und Erbe Habsburgs; nun, noch unter dem selben Kaiser, wird die Monarchie von Serbien, dem südslawischen Piemont, aus der Balkanhalbinsel gedrängt; wird ihr, in Sarajewo, wieder der Thronfolger getötet und wieder verblutet neben ihm eine Frau, diesmal die von Kirche und Staat ihm zugesprochene. All dies und unermeßliche Mengen kleinen Ungemachs in Dynastie und Reich hat in sechsundsechzig Regentenjahren Franz Joseph erlebt, ohne je von einer Gefühlswallung durchwärmt zu werden, ohne je die Pflicht des pünktlich-fleißigen Kanzlisten zu versäumen, der noch am dunkelsten, leidvollsten Tag seine Dienststunden einhält. Er wollte nicht Krieg, glaubte nie inbrünstig an Sieg. Aber den im Jesuitenstift Erzogenen drängte die Priesterschaft der Römerkirche in Kampf gegen die slawischen Schismatiker, die einem Patriarchen und einem weltlichen Imperator die Papstmacht ausgeliefert haben. Und an das selbe Ziel treibt im Innersten den Greis die Furcht, wenn er auch jetzt nicht das Reichsschwert ziehe, werde der Adel, die Armee, das Volk (in solcher Rangordnung sah es sein Auge) sagen: »So gehts, wenn ein Vierundachtzigjähriger die Krone trägt. Weil er, der von Italien und von Preußen besiegt wurde, nicht mehr ins Feld ziehen kann und anderen, jüngeren den Glanz eines ihm versagten Ruhmes nicht gönnt, dürfen wir uns gegen Schmach nicht wehren. Wäre er schon tot!«
Nur in diesem einen Punkt war in Berlin Zustand und Stimmung ähnlich. Einem modernen Tacitus oder Suetonius würde die Aufgabe lohnen, den Hof Wilhelms des Zweiten zu beschreiben.
Eine geistig eng beschränkte, lutherisch-pietistische Kaiserin aus kleinem, armem Herzogshaus, die sich in die parvenuhaft geschmacklose Prunkliebe ihres Mannes wie in Himmelsgebot fügt, sich selbst grellbunt, mit Federn, Pelz, Perlen, Paillettes aufputzt, aber eine gute Hausfrau und Mutter ist und mit übertreibend puritanischer Sittenstrenge dafür zu sorgen sucht, daß in Leben und Kunst der Aberglaube an den Klapperstorch erhalten wird, der aus dem Teich die Säuglinge holt und den jungen Ehepaaren aufs Kissen legt. Ein Lied, in dem der Tenor vom »Stelldichein in finsterer Nacht« träumt, darf vor ihrem keuschen Ohr nicht gesungen, das holde Gretchen, das dem Doktor Faust, ohne ihm angetraut zu sein, ein Kind gebar, darf ihrem Auge nicht gezeigt werden. Der Gatte hat Grund, sie in die Öse solchen Wahnes zu haken. Nur reizlos züchtige Frauen, so wenige wie irgend möglich, duldet dieser Hof. Ringsum aber flattert und schwebt, girrt und trillert ein Schwarm homosexueller Halbmänner, Diplomaten, Offiziere, Hofkavaliere aller Grade und Altersstufen, in dem gestickten Frack und den Escarpins des Wirklichen Geheimen Rates, in dem kurzen Attila und Trikotbeinkleid des Husaren, in dem knapp am Körper klebenden weißen Lederanzug des Garde du Corps und dem Adlerhelm, dem golden funkelnden Ehrenzeichen des Regimentes. Sie küssen Seiner Majestät bei jedem Empfang die Hand und haben diese Byzantinersitte als allgemeinen Brauch durchgesetzt. Sie hängen, so oft er aufschaut, mit Schwärmerblicken an der Wimper des Kaisers, nennen ihn flüsternd oder laut ein Universalgenie, das Wunder der Welt, beten ihn wie Gottheit an, knien (physisch, nicht nur metaphorisch ist's gemeint) vor ihm, bezeichnen ihn, den grimmig-heldisch grimassierenden Allerhöchsten Kriegsherrn, als »das Liebchen«. Ein Halbdutzend dieser »amici«, wie im alten Rom, dieser »Mignons«, wie am Hof der Valois die Sorte hieß, war, hart an der Zuchthaustür vorbei, ins Dunkel gestoßen worden; doch immer noch war ihre Zahl zum Erschrecken groß. An Bord des Prachtschiffes, auf dem, nur in Männerbegleitung, Wilhelm seine alljährliche Fahrt in die Fjorde Norwegens machte, traten Generale als Cancantänzer und Clowns, Hofwürdenträger als Chansonnettesängerinnen auf und hübsche junge Matrosen bildeten in Frauenkleidung das Bordorchester, die »Damenkapelle Seiner Majestät«. Der Chef des Militärkabinetts, für alle Personalfragen der Armee die höchste Instanz und der irdische Herr-Gott, starb, ein baumlanger preußischer General, vom Herzschlag hingestreckt, während er, in Trikot und Gazeröckchen einer Prima Ballerina, mit vollendeter Kunst und Fußspitzentechnik vor Seiner Majestät die schwierigsten Pas tanzte. Das geschah bei einem Fest im Schloß eines dieser Majestät befreundeten Fürsten, am Abend eines Tages, da im Deutschen Reichstag zum erstenmal der (durch den im »Daily Telegraph« veröffentlichten Bericht über ein Interview als gefährlicher Schwätzer entlarvte) Kaiser von allen Parteien heftig getadelt und sogar von dem Wortführer altpreußischer Junker gesagt worden war, gegen das persönliche Auftreten des Monarchen habe seit Jahren im Volk sich Groll angesammelt. In solchen Tagen saß Wilhelm, um seine Verachtung aller Öffentlichen Meinung zu zeigen, an der Südwestgrenze des Reiches, schüttelte sich nach waidrechtwidriger Massentötung von Wild vor Lachen über die plumpen Späße und Zoten eines hinberufenen Berliner Kabaretts und applaudierte den Ballerinenkünsten des für die Personalien der Armee verantwortlichen Generals. Denn: »Majestät braucht Sonne«, sagt der ihm Nächste, Ergebenste; und weh jedem, der eine den Sonnenglanz trübende Hiobspost in den Dunstkreis Serenissimi brächte.
Nur das zum Verständnis der Ereignisse Unentbehrliche wird hier angedeutet. Die Kenntnis solcher Zustände und des nach dem Zusammenbruch in Wien, Berlin und an kleineren Höfen zu Skandal und Schande gehäuften Stoffes berechtigt zu dem Urteil, daß ein System, in dessen höchstem Herrschaftskreise so häßlich krankhafte Erscheinungen möglich wurden, einstürzen mußte.
Noch aber stand es aufrecht, schien allen Kurzsichtigen felsenfest, und selbst die rasch wachsende Schar derer, die von dem Kaiser nichts mehr hofften, war überzeugt, daß der Kronprinz die Monarchie in das alte Ansehen zurückheben werde. Der wurde, ohne jemals etwas geleistet zu haben, überall bejauchzt. Weil er schlank war, eine grazile Frau und nette Kinder hatte, nicht als physisch furchtsam galt und auch sonst in Wesentlichem sich von dem frömmelnden und theaternden, stolzierenden und paradierenden »Allerhöchsten Herrn« unterschied (der »höchste«, aber im Rang immerhin niedrigere Herr hieß der auf dem Himmelsthron waltende). Der Vater witterte die ihm aus der Sphäre des Sohnes her drohende Gefahr. Er hatte in einem großen Teil der bewohnten Erde den Ruf des »valeureux poltron«, der nur mit der Zunge den Gegner zerschmettert, doch nach drohender Geberde vor jedem zu kräftiger Abwehr Entschlossenen scheu zurückweicht. »Majestät braucht Sonne«: jeder Höfling wisperte das Wort nach; und alle mühten sich, durch bunte Girlanden und strahlendes Kunstlicht jedes Wölkchen zu verbergen. Schon Bismarck hatte gesagt: »Der Kaiser möchte täglich Geburtstag feiern«: an jedem Tag irgendwo so überschwänglich geehrt und umdienert werden, wie ernste Mannheit kaum einmal im Jahr erträgt. In einem Kriege gegen die größten Mächte, wärens auch nur Europas, war weder ewiger Sonnenschein noch stete Geburtstagsstimmung zu erwarten. Trotz unaufhörlicher Prahlerei hatte Wilhelm denn auch instinktive Furcht vor dem Krieg. Während des unselig schädlichen Feldzuges in Südwestafrika war Wilhelm schwer zum Anhören unangenehmer Meldungen zu bewegen. Seine Generale kannten ihn. Die klügsten sahen längst voraus, daß die unstet Irrlichtern nachlaufende, durch Intriguen und komödiantische Effektsucht allen ärgerliche Berliner Politik eines Tages in Krieg führen müsse. Wird dann aber dem Allerhöchsten der Entschluß, der Befehl zur Mobilmachung abzuringen sein? Unter den Eichen des Sachsenwaldes hörte ich den geächteten Schöpfer des Reiches stöhnen: »Die Feigheit des Kaisers ist beinahe der einzige Aktivposten in unserer Politik; er wird alle erdenklichen Fehler und Dummheiten machen, aber der Konsequenz, dem Krieg, immer ausweichen.« Das glaubten auch die Generale; hatten deshalb in manchem Konventikel beraten, auf welchem Weg der entscheidende Befehl zu erlisten sein werde, und hofften nun, nach der Ermordung des Erzherzogs, eines »von Gottes Gnade zur Thronfolge Berufenen«, um dessen vertrauende Freundschaft Wilhelm mit langwierigem Eifer und nicht stets ganz würdigen Mitteln sich bemüht hatte, werde das dynastische Gefühl und der Zorn über verlorenen Werberlohn den Entschluß erwirken. »Unsere Politik und Diplomatie war spottschlecht; unsere Armee, die beste der Welt, kann noch alles wieder gut machen, wenn wir jetzt losschlagen und nicht warten, bis die anderen uns eingeholt oder an irgendeinem Punkt der Bewaffnung überholt haben.« So stellte den Generalen sich die Sachlage dar. Sie hatten die Pflicht, nicht nur das Recht, militärisch zu denken. Über Militarismus darf man erst da klagen, wo die im Heerwesen unentbehrlichen Begriffe und Auffassungen, Gesetze und Bräuche auch das Leben des Staates, seine Organe und Bürer, sein Verhältnis zu anderen Ländern bestimmen. Im preußischen Deutschland war die Klage berechtigt. Schon Bismarck hatte in fast dreißig Jahren ministerieller Tätigkeit den Militarismus auf jedem Höhepunkt siegreich bekämpft; in seinen »Gedanken und Erinnerungen« hat er darüber gesagt: »Es ist natürlich, daß in dem Generalstab der Armee nicht nur strebsame jüngere Offiziere, sondern auch erfahrene Strategen das Bedürfnis haben, die Tüchtigkeit der von ihnen geleiteten Truppen und die eigene Befähigung zu dieser Leitung zu verwerten und in der Geschichte zur Anschauung zu bringen. Es wäre zu bedauern, wenn diese Wirkung kriegerischen Geistes nicht stattfände; die Aufgabe, ihr Ergebnis in den Schranken zu halten, auf welche das Friedensbedürfnis der Völker berechtigten Anspruch hat, liegt den politischen, nicht den militärischen Stützen des Staates ob. Der Geist der Institution, den ich nicht missen möchte, wird gefährlich nur unter einem Monarchen, dessen Politik das Augenmaß und die Widerstandsfähigkeit gegen einseitige und konstitutionell unberechtigte Einflüsse fehlt.« Wie gefährlich unter solchem Monarchen der Militarismus geworden war, hatte sich 1913 in dem elsässischen Städtchen Zabern offenbart, wo es zu ernsten Konflikten zwischen Bürgerschaft und Garnison gekommen war, weil die Militärbehörde unter allen Umständen und um jeden Preis die törichten Fehler eines hemmungslosen Leutnants gegen »Zivilistenkritik« decken wollte. Seitdem lief in den Offizierskorps das Wort um: »Die Armee, um die uns die Welt beneidet, wird zum Gassenspott. Das ist die Folge vierzigjährigen Friedens!« Das alljährliche Herbstmanöver sättigt den Ehrgeiz des Kriegers eben so wenig wie den des Schauspielers die Generalprobe. Hätte der Kaiser nach all seiner Gestikulation, deren Unwert noch wenige ahnten, sich diesem Drang entgegengestemmt, dann wäre darin der ins Auge springende Beweis seiner Feigheit erblickt und viel fester noch als zuvor die Massengunst an die Person des Kronprinzen geheftet worden, der Leos altes Professorwort vom »frisch-fröhlichen Krieg« nachzulallen für nützlich hielt.
Was sich Regierung nennt, ist viel zu schwach, der natürlich und historisch entstandenen Machtverhältnisse, der Tendenzen und Personalien zu unkundig, um dem Drängen des Generalstabes, »nicht die letzte Gelegenheit zu würdiger Entscheidung zu versäumen«, im Bewußtsein unabwälzbarer Verantwortlichkeit zu erwidern, daß die Stunde durchaus nicht günstig, die Entscheidung, friedliche, oder, wenn es sein muß, kriegerische, nur durch Willen und Kunst des Staatsmannes politisch vorzubereiten und zu erwirken sei. Große Teile der Industrie und des Handels fühlen die Gefahr künstlich überhasteter maßlos gesteigerter Produktion, die ausreichenden Absatzes nicht mehr sicher ist, und haben die Furcht, ein Krieg werde alles in vier Jahrzehnten kräftig kluger Wirtschaft Aufgebaute zerstören, durch die Hoffnung überwunden, der Krieg werde, bei Deutschlands militärischer Überlegenheit, ganz kurz, unbedingt siegreich, nur auf fremdem Boden auszufechten sein und dem deutschen Hochkapitalismus, mindestens in Europa, die Hegemonie bringen. (Diese bremslose, nirgends von Zweifel benagte Zuversicht ist allgemein. »Hier werden Kriegserklärungen angenommen«: mit Kreide schreiben es die Soldaten an die Kasernenmauern; an die ostwärts rollenden Waggons: »Herrenpartie nach Petersburg«. Der Kaiser ruft: »Nun werden wir sie dreschen!« Er verspricht: »Weihnacht sind wir wieder zu Haus«. Am fünften August 1914 wird im Kriegsministerium Journalisten gesagt: »In acht Tagen sind wir in Belfort und spätestens am Sedantag in Paris«. Am zweiten September? Am sechsten droht an der Marne dunkles Verhängnis. Doch aus dem Kriegsministerium sendet in Allerhöchstem Auftrag General von Viebahn die Rundfrage, welche Fenster die Hausbesitzer und Mieter Unter den Linden und am Pariser Plaz für den nahen Tag, der die siegreichen Truppen in die Hauptstadt einziehen sieht, zur Verfügung stellen können. Triumphaler Einzug im Herbst 1914! Noch immer blendet die Gottheit den Sterblichen, dem sie Verderben sinnt.) Aus der Volksmasse qualmt Enttäuschung auf. Einst prahlte der Kaiser: »Herrlichen Tagen führe ich Euch entgegen«! Sie sind nicht gekommen. Nur Ärgernisse, Skandal, Theatereien, Feste ohne Feierlichkeit. Jeder fühlt, daß ein hoher Zaun, ein Eisengitter, eine Mauer um Deutschland gezogen, daß der Erdraum enger wird, als im Verhältnis zu der nationalen Leistung zu fordern wäre; und fast niemand kennt, weil jeder Akt internationaler Politik öffentlich als das Ergebnis fremder Schuld und Niedertracht dargestellt wird, die wahren Gründe des Weltmißtrauens.
Allmählich war mit zäher Verschmitztheit das junge Nationalgefühl des Deutschen in die Nutzensreligion einer von Gewissenwallung freien Erwerbgenossenschaft umgefälscht worden. Jung war es; die 1871 geeinte Nation hatte keine Gemeinschaftsgeschichte, nur eine Chronik der Stämme (deren kräftigste noch fünf Jahre zuvor gegen einander kämpften), und ließ sich im Drang nach Nationalgeschichte, wie aus ähnlichem Mangel Israel in den Logos, die das Staatsbewußtsein ersetzende Glaubenslehre, floh, bis in das umnebelte Urgermanentum, allzu oft ein von Richard Wagner kostümiertes und frisiertes, verführen. Selbst das echte oder für echt geltende aber war dem Wesen dieser nie oder längst nicht mehr reingermanischen Völker (besonders des pruzzisch-preußischen Kolonistenvolkes, dem wilder Mut der Physis und die Fähigkeit, veränderten Formen und Bedürfnissen der Zivilisation und Kultur sich behend anzupassen, in Vormacht geholfen hatten) durchaus fremd; es wurde flink dann mit allerlei Besatz und Behang aus dem überlieferten Schatz der Christenheit aufgeputzt und kleidet die deutsche Seele in das bunteste Flickengewand, dessen Entstehung aus Lappen und Lagerresten zweier Zonen nur der Starblinde nicht sah. Die Lüge saß auf dem Thron und von ihrem Krüppelleib schillerte in allen Farben das Wams. Hinter dem zu Firmenzeichen und Kundenfang geschändeten Kruzifixus hockte ein Nerochen, Heliogabalchen. Auf der Zunge die Bergpredigt, im Kopf ganz anderer Kult. Vordringlich laute Mahnung zu schlichtem, prunklosem Lebenswandel: und am Hof der aufgedonnerte Luxus, den träges Gedächtnis jetzt nur den »nouveaux riches«, den von Krieg, Niederlage, Staatsumsturz, Inflation rasch Bereicherten zuschreibt. Der Fisch, sagt ein altes Lateinerwort, stinkt zuerst vom Kopf aus. Wo sollte unter solchem Kaiser Wahrhaftigkeit blühen, wer ihr strenges Gebot dem von Lügensträhnen umsponnenen Volk verkünden? Der Schornstein raucht, die Exportzahlen wachsen himmelan, auf dem Erdball fällt keine Entscheidung ohne den Willen des Deutschen Kaisers, des Admirals auf dem Atlantic, der Dreizack Neptuns ist in unserer Faust, der trockene Weg nach Indien über Bagdad uns offen. Russen, Franzosen, Amerikaner platzen nächstens vom Hochdruck gelbgasigen Neides und dem Englishman wird vor unserem Viergespann Marine, Islam, Bagdad, Exportziffern angst und bang. Nur jetzt, da es um alles geht, nicht laut, vor dem Ohr Fremder, zugeben, daß auch bei uns manches schlecht, faulig, sogar blitzblank Scheinendes unsauber ist. Trotzdem erreichen wir ja unser Ziel. Von Jahr zu Jahr weitet sich der Kreis der in Ritus und Rhythmus solcher Nutzensreligion Gedrillten. Und noch ehe die ihr mißtrauisch Fernen es ahnten, hatte sie den Wurzeltrieb und bald jeden Schößling deutscher Politik vergiftet.
Das wird noch nicht offenbar. Noch trübt das Zittern der Nerven die Klarheit des Blickes. Bleibt Friede oder bricht diesmal der Orkan los, den das dumpfe Schweigen der Lüfte anzukünden scheint? Erst auf den zweiten Hilferuf des Kronprinz-Regenten von Serbien hat Zar Nikolai geantwortet: wenn die allerletzte Hoffnung, durch irgendein mit der Würde des Serbenvolkes vereinbares Mittel blutigen Austrag zu vermeiden, geschwunden sei, werde Rußland das Schicksal der verwandten Nation nicht gleichgiltig betrachten. Danach, am letzten Julitag, erklärt sich, zum ersten Mal, die Wiener Regierung bereit, über das an Serbien gerichtete Ultimatum mit Rußland zu verhandeln. Auch der Depeschenaustausch zwischen Petersburg und Paris zeigt deutlich den Willen zur Friedenswahrung. Doch Petersburg fürchtet, daß ihm Berlin, Berlin, daß ihm Petersburg in der Kriegsvorbereitung voraus sei. Botschafter Swerbejew meldet die deutsche Mobilmachung; und sein Widerruf dieser durch ein fälschendes Extrablatt bewirkten Meldung wird von dem deutschen Telegraphen verzögert. Die Nachricht, daß Belgrad von den Österreichern beschossen worden sei, erregt in Rußland die Gemüter. Aber Wien will weiter verhandeln. Zu spät. Auch Deutschland legt nun ein Ultimatum vor: in Petersburg; da es keine Antwort erhält, übergibt am ersten Augustabend der Botschafter Graf Pourtalès Herrn Sasonow die deutsche Kriegserklärung. In der vierten Augustnacht überschreiten deutsche Truppen die belgische Grenze. Auf preußischen, aber aus britischem Bedürfnis entstandenen Antrag ist im vorigen Jahrhundert Belgien neutralisiert worden; auf Befehl des preußischen Königs und Deutschen Kaisers wird nun diese Neutralität gebrochen, weil militaristisch gedrillte Hirne wähnen, ein internationaler Vertrag sei nicht mehr als ein »scrap of paper«, den die Hand des nach Mehrung nationaler Macht Strebenden ohne Bedenken zerreißen dürfe. Gegen Rußland, Frankreich, England, Belgien ist das Deutsche Reich im Krieg. Noch unter dem selben Augustmond folgt Japan. Im Herbst leckt der Brand über die fünf Kontinente der Menschenwelt. Und Deutschlands Volk, dem so ungeheure Last aufgebürdet ist, gegen das bald eine Menschenmilliarde sich waffnet, atmet auf, als sei es von Albdruck erlöst. Im kugelfesten Panzer des Glaubens, zu Abwehr des frevelsten Unrechtes, zu Verteidigung mühsam erarbeiteten Nationalbesitzes aufgerufen zu sein, zieht es freudigen Herzens, singend in den Kampf.
Das Geleistete ist höchster Bewunderung wert. Kleidung, Waffen, Nahrung, Munition, Handwerkzeug jeder Art, Transporte auf fast endlos langen Nachschublinien: alles war und blieb in straffster Ordnung; und lange wurde durch den vom Krieg erzwungenen Umbau aller Wirtschaft der Bürger, der seufzend auf den Eintritt ins Heer verzichten mußte, nicht arg belästigt. Der Gemeinschaft leiblicher, seelischer, geistiger Kräfte gelang, zwischen Gent und Grodno, also auf dem größten Stück europäischen Festlandes, ein Aufmarsch, wie ihn das Himmelslicht nirgends je sah. Jeder auf seinem Posten; jedes Kriegsgerät an seinem Platz; jede Möglichkeit vorbedacht. Und in keines Mannes, keines kräftigen Weibes Brust bebt ängstlich das Herz. Tief und mit festen Strängen ist das Vertrauen eingewurzelt. Unser Leben, nicht nur das des Reichsten, war allzu üppig geworden; auf Gummireifen (vier, als Ersatz, hinten angehakt) sauste es über Sumpfland, Baumstümpfe und spitze Steine. An manchem Herzen hatte deshalb die Sorge genagt, ob das verwöhnte Geschlecht nicht knurren, nicht früh über Gliederwundheit stöhnen werde, wenn es sich auf die Pritsche rauher Kriegerpflicht strecken müsse, ob das Fleisch noch geschwind, bis in Massengemetzel dem Willen gehorchen könne. Diese Sorge wich schnell. Aus der Fülle behaglicher Lebensgüter, aus den weichsten Kissen sprangen Hunderttausende auf ihren Wehrmannposten. Wer ganz vorn sein darf, jubelt. Wer noch hinten bleiben muß, hofft: Morgen geht's an die Front. Niemand bangt vor Entbehrung. Alle lechzen danach. Beamte höheren Grades und Bankregenten, Stadt- und Justizräte ziehen den Rock des Unteroffiziers, des Gemeinen an und harren wie in Glücksfieber, wie als Kinder der Christfestbescherung, des ersten Gewitters, das aus dem Eifer des viel jüngeren Vorgesetzten aufflammt. Verdient etwas Tadel, so ists die allzu laute Fröhlichkeit der sichtbarsten Volksschicht. Das putzt sich und tändelt und lacht. Das meint, jeder Abend müsse eine neue Siegesbotschaft bringen, und sitzt, sie flink aufzuhaschen, bis nach Mitternacht um die Straßenschänke. Überall Fahnen und Fähnchen, Gesang und Gekreisch. Zu viel Volksfeststimmung, zu wenig Andacht. Erst jenseits von diesem Geräusch, in den stilleren Straßen, auf der Heide, in Dörfern, schaut ernste Empfindung gelassen oder schüchtern, wortlos beredt dem Wanderer ins Auge. Aus einander Fremden, oft Feindseligen scheint, endlich, ein Volk geworden. Jede Seele fühlt, jede auf ihre besondere Weise, den großen Ernst des Erlebens und die zum Gehorsam freier Menschheit gebändigte Kraft der Volksgemeinschaft, in deren Takt ihr Puls pocht. Alles Lügengespinst schien wie Zunder zerfallen.
Schien … Mit unermüdlichem Eifer wurde auf tausend Spindeln neues Lügennetz gewebt, das die alten Gespinste ersetzen sollte. Für alles gab es nun bald »Ersatz«; für Gutes und Schlechtes, Edles und Gemeines. Für Butter, Tinte, Parfüm, Mangan, Kaffee, Tee, Zucker, Schmieröl, Zahnwasser, fast allen Bedarf, dessen Deckung die Blockade der deutschen Küsten verhinderte. Eisen ersetzte das Kupfer, Pflanzenfaser die Wolle, in Zuckerwasser getränktes Seidenpapier die zur Granatfabrikation nötige Baumwolle. Wieder war die Leistung höchster Bewunderung wert. Und Deutschland hatte sich gewöhnt, nur die Leistung zu schätzen. Ihrem Ursprung, den Wegen, auf denen sie möglich geworden war, wurde nicht nachgeforscht. Hinter dem Übergang in die Kriegsmoral, die auch den Massenversand von »Wahrheit fürs Ausland« (einer oft ranzig riechenden vérité officielle), wie alles hienieden »organisierte«, in der Heimat aber die echte, natürlich gewachsene Wahrheit erblinden, verhungern, verlausen ließ, wurde die Nutzensreligion der gewissenlosen Erwerbgenossenschaft erst ganz offenbar. Die Epistel der dreiundneunzig »Vorragenden« »an die Kulturwelt« zeigte zum erstenmal schmerzhaft, was in dunkler Stille entstanden war. »Es ist nicht wahr, daß wir die belgische Neutralität verletzt haben«: dieser von einem Komödienschreiber ersonnene Satz und ein Bündel ähnlicher, die ihm folgten, wiederholten nur, was unmittelbar vor Kriegsausbruch ein bayerischer (nicht preußischer) Diplomat, Graf Lerchenfeld, in dem Bericht an seinen Ministerpräsidenten sagte: »Dem Ausland gegenüber muß, natürlich, alles abgeleugnet werden.« Alles, was dem Ansehen Deutschlands schaden kann. Wahr oder unwahr: einerlei. Right or wrong, my country. Noch weiter als dieser schlimme britische Spruch ging der deutsche Grundsatz; viel weiter. War er das tiefste Geschäftsgeheimnis und der letzte Schluß neudeutscher Weisheit? Die Erwerbgenossenschaft nennt es Patriotismus, »vaterländische Pflicht«; sie bildet sich ein, dieses einer Falschmünzergruppe oder Hehlersippe ziemende starre System steten Ableugnens schaffe die »vom Nationalgefühl in schwerer Zeit geforderte Einheitsfront«; hält auf dieser imaginierten, in der Wirklichkeit eines zerklüfteten Sechzigmillionenvolkes unmöglichen Front alltäglich Paraden ab und fällt von Erstaunen in zornige Schimpfrede, weil die Welt auf solches Treiben mit Verachtung reagiert. Die Leistung wird bewundert, die allumfassende Tüchtigkeit oft sogar, besonders in Frankreich, noch überschätzt; auf die politische Moral aber blicken die anderen, alle, von den verschneiten Wällen festgefrorenen Mißtrauens.
Darf der nach Gerechtigkeit Strebende darüber staunen, pharisäisch zetern, daß in den Jahren sittlicher Wirrnis, unaufhörlicher Bedrängnis und peinigender Not die Saat des Unheils in überreichliche Ernte reifte? Aus Ost und West kam immer wieder die Kunde von deutschem Sieg; niemals von Fehlschlag, Rückzug, Verlust an Menschen, Schiffen, Kriegsgerät. Niemand erfuhr, daß schon in der ersten Septemberdekade von 1914 an der Marne eine Entscheidung gefallen war, die, weil sie England die Zeit zur Waffnung des Empire gab, keinen Halm von der Hoffnung stehen ließ, Deutschland könne, zwischen zwei lahmen Gefährten, den Sieg erringen. Als ich in meiner Wochenschrift vorsichtig die Tatsache der Marneschlacht angedeutet hatte, schrieben hochstehende Männer mir, sie seien erstaunt, zu sehen, daß auch ich von den Lügen der französischen Propaganda zu dem Irrglauben an eine Marneschlacht verleitet worden sei, die in »der Wirklichkeit nie existiert habe«. So fest war der Tempel der Wahrheit verriegelt. Die Erfüllung der von Fichte und Lassalle den Deutschen oft gepredigten Pflicht, »auszusprechen, was ist«, war streng verboten und schon dem Versuch, vor gefährlicher Illusion zu warnen, drohte Bestrafung durch »Schutzhaft« oder noch Ärgeres. Innere Hemmnisse, Riesenverluste hatten nur die Feinde, nicht wir. Ihnen nur nahte Bankerott, Meuterei, Zermorschung des Staates, Abfall der Fremdvölker, Dominions, Kolonien, Auflockerung der Bündnisse, zornige Ungeduld der Neutralen. Sie müssen im Ausland immer höhere Schulden häufen, während wir alles im eigenen Lande durch Kriegsanleihen aufbringen, die stets überzeichnet werden. Wir haben in breiter Fülle, was wir brauchen; mehr, als wir brauchen. Obendrein eine ganze Kiste voll Überraschungen, die, Giftgas, Tauchboot, Zeppelin-Geschwader, Dicke Berta und Ferngeschütz, geschminkte Patrouille-Kähne, Untersee-Handelsboote, dem Feind bald den Atem rauben werden. Der Vizekanzler des Reichs wagte sich bis in die Behauptung vor, sogar finanziell sei Deutschland allen anderen überlegen und könne länger als das British Empire »mit silbernen Kugeln schießen«. Selbst dieser läppischen Prahlerei glaubte das gläubige Volk. Tag vor Tag hörte es, der Endsieg sei nicht nur sicher, sondern auch nah und nur zu gefährden, wenn irgendwo die Klammern der Siegesgewißheit sich lösten. Vor und nach jedem Ereignis hat und hätte diese Taktik lückenloser Beschönigung sich bewährt. Andere aber forderte der Zustand fünfzigmonatigen Krieges. Ereignis, selbst schmerzendes, flügelt die Geister und hebt sie in Willenskraft, die sieghaft der härtesten Mühe spottet. Zustand, selbst der von tausend Fahnen umrauschte, wird langweilig; er rupft, Feder nach Feder, den Geistern die Schwingen aus und läßt sie kalt und lahm in Alltagsstaub, Alltagssorge sinken. Die Hoffnung, mit der Strategie und Taktik, die den Willen das Ereignis meistern lehrt, auch über den widrigen Zustand die Herrschaft gewinnen zu können, gleicht dem Wahn, die beseligenden Herzensräusche und Sinnenspasmen der Verlöbniszeit könnten das Glück einer Ehe verbürgen. Weil weder die Heeresleiter noch die Regierer den Unterschied zwischen Ereignis und Zustand erkannten, mußte ihre Rechnung falsch werden.
Dem Krieger und dem Bürger wurde die Zeit allmählich bitter hart. Draußen und drinnen fehlte das Nötigste. Ein nur im eigenen Land, zugleich für drei wirtschaftlich schwache Bundesgenossen finanzierter Krieg unerschauten Umfanges, der erste mit großindustriellen Mitteln geführte, mußte einer nicht kleinen Schar von Produzenten und Händlern Riesengewinne eintragen. Diesen ungeheuren Profiten mit der Steuerzange beträchtliche Stücke abzuzwicken, scheint nicht notwendig. Dadurch würde ja die »Stimmung« in der Schicht verdorben, die den Krieg wie Champagnerwein schlürft. Und alle Kriegskosten zahlt am Ende ja der Feind, dessen Niederlage längst sicher ist. Damit in der Unterschicht die Stimmung nicht versaure, wird mit den Arbeitslöhnen nirgends geknausert. Der Mittelstand aber, das ganze Gekribbel der kleinen Intelligenzträger, verarmt mehr und mehr. Nur auf diesem Gebiet wird nicht alles, Preis und Lohn, Gewerbe und Handel, Dauer und Bedingung der Arbeit, vom Befehl der Militärbehörde geordnet. Von schlechtem Kleie-Brot, Wassersuppe und Kohlrüben sich einen Winter lang in kalten Zimmern nähren, ist Pein. Noch schlimmer die stete Konzentration auf allzu Irdisches, der ewige Zwang unter das Joch der Fragen, wie und woher das für Nähr-, Heiz-, Kleid-Stoff, für Unterricht und reinliche Bettung der Kinder am nächsten Tag unentbehrliche Geld zu erlangen sei. Wer vermag aus dem Käfig solcher Sorgen, mit überreizten, übermüdeten Nerven, sich in das Gefild reinen Denkens, der Kunst, Wissenschaft, irgendwelcher Abstraktion aufzuschwingen? Das Gewissen selbst wird morsch und verliert allmählich das Bedürfnis innerer Sauberkeit, das in dem feinen Uhrwerk kein Stäubchen duldet. Doch unter der Zuchtrute der Generalkommandos (wo zu Kriegerwerk untaugliche Generale über frontscheuen Allüberwindern thronen) darf Ungeduld, Mißmut, Zorn über die leichtfertige Gefährdung des geliebten Landes nicht zu offenem Ausdruck kommen. Im Dunkel nur, in der Stille schwillt die Schar der Ketzer. Laut wird aus tausend Megaphonen geschrien: »Der Sieg ist uns sicher, nur sein Umfang noch ungewiß; durchhalten, nur für eines Atemzuges Dauer noch: und kein Teufel raubt uns den Endtriumph.« Geflüstert aber wird: »Wir siegen uns zu Tod! Wie lange soll und kann dieses entkräftete Volk sich gegen eine Menschenmilliarde denn noch behaupten?« Unerträglich wird der Zustand, in dem ein achtzehnjähriger Leutnant wie ein mit gottähnlichem Recht Begnadeter durch die Reihen versteint scheinender, ehrerbietig salutierender Soldaten schreitet, während ein fast fünfzigjähriger Landsturmmann, Richter, Professor, Künstler oder Kaufmann, mit Sack und Pack wie ein Stück Vieh herumgestoßen wird. An Kasernen, in Unterständen und Gräben ist nun andere Inschrift zu lesen als 1914. »Gleicher Sold und gleiches Essen – und der Krieg wäre bald vergessen.« »Ich sag' es ohne Scheu: Wenn Wilhelm im Zylinder geht, Auguste nach Kartoffeln steht, dann ist der Krieg vorbei.« Viel bitterlich Schlimmeres noch. Wird in der Heimat ein Ketzer ertappt, so muß er schnell ins Feuer; daß es Trommelfeuer, nicht das kleinere des trauten Scheiterhaufens ist, ändert nichts am Wesen der alten Ketzerstrafe. Die Vibrionen müssen an die Front: und man wundert sich, daß sie von den Stellen reizbarer Schwäche (minoris resistentiae) aus zersetzt wird. Im Westen, trotz tapferer Ausdauer, kein entscheidender Erfolg und stetig wachsender Andrang der bis ins Kleinste gut gerüsteten und versorgten tollkühnen Amerikaner. Im Osten, trotz allen Einzelsiegen, nur durch den von der deutschen Heeresleitung befohlenen Import der Bolschewiken und durch deren Agitation die russische Wehrmacht gelähmt. Und die militaristisch aberwitzige Härte der Friedensschlüsse von Brest-Litowsk und Bukarest hat die Hoffnung auf allgemeinen, von weitsichtiger Vernunft gestützten Frieden verschüttet. Weh jedem, der solche Gedanken öffentlich anzudeuten wagt. Meine Wochenschrift, in der ichs tat, wurde durch immer erneute Konfiskation bis an den Rand des Ruins geschädigt, war in Armee und Marine jahrelang, in der Heimat je zweimal fünf Monate lang verboten. Den »Gutgesinnten« blühte der Weizen. Die Mahner sollte der Hunger kirren. Noch im Oktober 1918 aber schrie von allen Mauern die Proklamation des Generalissimus Hindenburg, nur Deutschland, das im Osten gesiegt habe und im Westen endgültigen Sieges sicher sei, habe im ganzen Kriegsverlauf jeder Meinung freien Ausdruck gewährt.

Bismarck
Eine Matrosenmeuterei, die ein paar Hundert unruhiger Köpfe von der Küste ins Binnenland spült, schwemmt die Fundamente des Fürstenbundes von 1871, den Unterbau des Deutschen Reiches, hinweg. Die Tagebücher und Briefe des Generals von Moltke, der neun Jahre lang, bis nach der ersten Schlacht an der Marne, den Großen Generalstab leitet, und andere Urkunden erweisen, daß schon 1915 unbefangene Sachverständige nicht mehr an Endsieg glaubten, viele sogar schon vor der Möglichkeit völligen Zusammenbruches bangten. Den hielt nur der geduldige Opfermut der in Feld und Haus von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugten Nation auf. Wäre den Deutschen, wie von kühler Klugheit den Briten, gesagt worden, der Weg (nach Tipperary) sei noch weit, die Aufgabe furchtbar schwer: nie konnte aus Enttäuschung dann Katastrophe werden. Sie war Produkt vierjähriger Lügenbrut, nach der die auf stürmisches Drängen der Heeresleitung nach Washington gerichtete Bitte um Waffenstillstand wie ein aus heiterem Himmel zuckender, ringsum Flammen zeugender Blitz wirken mußte. »Wir sind belogen und betrogen worden«: in diesem Aufschrei des Führers der Junkerpartei drückte das Empfinden der ganzen Nation sich schmerzlich stöhnend aus.
Die Dynastenfront, die ein Halbjahrhundert lang unerschütterlich schien, zerstob wie Spreu im Wind. Der Kaiser ist längst aus der Heldenpose gerutscht; nun, weil im Hauptquartier der Feldmarschall ihm, wie er schreibt, nicht mehr »die Sicherheit verbürgen kann« (ohne die doch Millionen, vier Jahre lang in Gräben und Höhlen ausharren mußten) desertiert er das Heer und flieht nach Holland. Dahin folgt ihm der Kronprinz. Zwei Dutzend oder mehr deutsche Könige, Großherzoge, Herzoge, Fürsten verschwinden über Nacht, ehe sie, von denen eigentlich kaum einer sich Haß zugezogen hat, gewaltsam von ihren Thronen und Thrönchen gestoßen werden. Zuerst in München, sogleich danach in Berlin, dann überall wird die Republik verkündet. Offizierkorps, Adel, hohe Beamtenschaft, gelehrte und journalistische Wortführer der Monarchie: alles duckt sich behutsam, durchaus nicht heroisch, unter den Sturm. Gestern noch wurde das Wort »Demokratie« wie abscheulicher Greuel verfehmt; heute schminkt und gebärdet jeder sich demokratisch. Gestern wurde einem sozialistischer Parteigesinnung Verdächtigten die Bestätigung in dem kleinsten Ämtchen versagt. Heute stellt diese Sozialdemokratie Kanzler, Minister, Oberpräsidenten, spickt den ganzen Beamtenkörper von Reich, Staaten, Gemeinden mit ihren Leuten und wird von den soeben Entmachteten genau so umschmeichelt, umdienert wie gestern der glitzernde Troß der Privilegierten. Ein Mann, der als Sattlerlehrling, Schankwirt, Redakteur provinzialer Blätter, Parteibeamter, hundertmal das Lob der »internationalen, revolutionären, völkerbefreiender Sozialdemokratie« gesungen hat, wird Reichspräsident, Nachfolger Wilhelms des Prunksüchtigen. Wer könnte, wer dürfte nach alledem noch zweifeln, daß ein neues Deutschland entstanden war?
Wahrhaftigkeit, die der nicht flüchtig nur Hinblickende in jeder Zone als die beste Politik erkennt, befiehlt, den vielfach schon durchlöcherten Schleier ganz zu zerreißen. Neu-Deutschland hat nicht Revolution durchlebt, sondern nur einen von Übermüdung begünstigten, von Schreck bewirkten Krampf durchfiebert. Nicht der ungestüme Drang nach Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortlichkeit für das Staatsschicksal hat die Monarchie gestürzt und an ihrer Stelle die Republik errichtet, sondern der Wunsch, den Willen einer feindlichen Welt zu sänftigen, und die Hoffnung, dadurch mildere Friedensbedingungen zu erlangen. Weil diese Hoffnung zu trügen schien (nur schien: denn einer deutschen Monarchie wäre noch viel schwerere Last aufgebürdet worden), weil, dennoch, der Friedensvertrag furchtbar hart wurde, kam neue Enttäuschung auf, deren Gefühlsinhalt sich in den banalen Worten zu äußern pflegte: »Nun haben wir alles, was Wilson & Co. wollten, getan und werden trotzdem so schlecht behandelt! Mit all ihren großen Worten von Freiheit, Menschenrecht, Brüderlichkeit haben diese Leute uns nur heuchlerisch in eine Falle gelockt.« Solche Stimmung wurde der Quell alles Unheils. Ein Volk, spricht Goethes Herzog Alba, wird niemals reif; ein Volk bleibt immer kindisch. In diesen düsteren Glauben eines hispano-römisch frommen Katholiken und Kriegers konnte sich das Urteil dessen trüben, der die tapfere, arbeitsame, durch Verstandeserziehung und Bildnerkraft manchem Nachbar überlegene deutsche Nation noch einmal unter die unselige Wirkung des methodischen Wahnes gleiten sah, der vor wenigen Jahren erst ihr Leben ernstlich gefährdete. In Allmacht wuchs die Herrschaft von Rachgier glühender Nationalisten; fester als zuvor der Befehl militärischer Diktatoren knebelt Terror: terreur blanche, den Willen zur Wahrheit. Der Rückblick auf den frühen Morgen der Republik lehrt diese Entwicklung verstehen. Sozialdemokraten haben, als Reichsminister, damals die heimkehrenden Truppen des »unbesiegten Heeres« an Stadttoren begrüßt. Und einer dieser angeblich international-pazifistisch Denkenden, »Genosse« Noske, hat im Truppenlager eines preußischen Generals zu dem von rauh beginnenden Kommunistenunruhen tief bekümmerten Herrn Ebert gesagt: »Kopf hoch, Fritz! Alles wird wieder gut.« Diese Zuversicht entnahm er der durch Augenschein bewirkten Gewißheit, daß dicht bei Berlin eine in straffer Disziplin gehaltene Mannschaft ganz im Geist der Kaiserzeit zu schonungsloser Niederzwingung allen Aufruhrgelüstens, zu gewaltsamer Restauration von »Ruhe und Ordnung« bereit sei. Das geschah wenige Wochen nach der »Revolution«. Um mit dem Werkzeug alter Gewalt die alte Ordnung, die Ruhe der streng überwachten Kaserne wieder herzustellen, brauchte man nicht die Pfeiler und Tragbalken des Staates umzustürzen. War der Zweck des Umsturzes aber, den freien Grund zu ebnen, auf dem ein freies Volk sich in Schaffenslust regen könne, dann ist zu diesem Zweck nichts, gar nichts geschehen.
Der Raum eines dicken Bandes wäre nötig, um all die in diesen Jahren gehäuften Fehler zu beschreiben, deren frühester war, daß nach Versailles, mit viel zu großem Gefolge, der typische Vertreter alter Diplomatie geschickt wurde, der, trotz Klugheit und bewußtem Streben nach der Allure des Bürgers, die höfisch-militärische Erziehung nicht verleugnen konnte und dessen erstes Wort, das erste nach vierjähriger Blockade aus der neu schimmernden Fassade des Reiches erschallende, ein Protest gegen den Verdacht deutscher Hauptschuld am Ausbruch des Krieges war. Auf den Krücken so falscher Psychologie wurde dann auf dem Dornenweg weiter gehumpelt. Den Gegnern schien all das Trug; schien es aus der »Cour des miracles« alter Meloromantik entlehnt, die ihren Kunden blutige Binden, Buckel, Stelzfüße, plumpe Prothesen aller Art als Leihgut liefert und in deren Täuschungskünste, noch aus engster Klemme, eine in Würde gereifte Nation sich niemals erniedern dürfte. Doch unheilvoll wirkte jener Grundsatz nach, den der bayrische Graf in die apokalyptisch-unverjährbaren Worte gefaßt hatte: »Dem Ausland gegenüber muß, natürlich, alles abgeleugnet werden«.
Alles. Stramm abgeleugnet, daß zwar die deutsche Volksmasse eben so wenig wie irgendeine andere je nach Krieg, der ihr Blutopfer aufbürdet, lüstern, daß aber Wilhelm mindestens eine in Fleisch und Bein wandelnde Ursache des Krieges war, dessen Ausbruch und Ausdehnung von der Unvernunft und Anarchie europäischer Wirtschaft begünstigt wurde. Abgeleugnet auch die militärische Niederlage und die Tatsache, daß unmittelbar nach ihr Deutschland zu gerechter Reparation noch durchaus fähig blieb. Wem hat dieses zähe Leugnen genützt? Sicher nicht der Nation, gegen die es immer neues Mißtrauen weckte und waffnete und deren nächstes Schicksal doch an der Frage hing, ob ihr der Erwerb des Weltvertrauens gelingen werde. Nützen konnte es nur den Monarcho-Nationalisten. Je fester sie die Vertreter neuer Staatsordnung in das alte Lügensystem verstrickten, je fester also zwischen diesem System und den Machthabern der Stunde das Band der Solidarität wurde, desto heftiger mußte sich draußen ringsum Feindschaft regen, die Deutschland in den Luftbereich einer Katastrophe riß: und nur aus Katastrophen, fremden oder heimatlichen, kann einer Desperado-Politik Hoffnung auf Sieg erblühen. Mit verschmitzter Schlauheit haben die Nationalisten alle Regierungen der Nachkriegszeit in eine Taktik zu verleiten vermocht, deren Ziel war (und nur sein konnte), die neue Staatsform zu diskreditieren, den Glanz der Kaisertage und das Elend der Republik zu illuminieren, alle Schuld auf die Bosheit und niederträchtige Schurkerei der Sieger zu schieben (deren Sieg nur ihrer Betrügerei und dem von Sozialisten und Juden in Deutschland angezettelten Verrat zu danken sei), den Versailler Vertrag, der eine Pontonbrücke, nicht die Küste fruchtbaren Festlandes, Mittel, nicht Zweck ist, als das infamste Verbrechen, die verächtlichste Schandurkunde aller Jahrhunderte zu verschreien und dadurch den Willen zum Bruch der Fessel und zu Rächung des Frevels aufzupeitschen. Die Regierer sahen dieses Ziel nicht immer klar, die Angst, als schlechte Patrioten geächtet zu werden, die feige Furcht vor den in der Mordanstiftung nicht schüchternen Geheimbünden, deren direkte Opfer die Ziffernhöhe eines Halbtausend erreichen, blendeten ihr Auge; und ist es nicht wundervoll bequem, das von eigener Unzulänglichkeit Versäumte oder Verfehlte dadurch dem prüfenden Blick zu bergen, daß man es mit der Miene des trauernden Patrioten auf das Schuldkonto feindlicher Tücke bucht?
Wie der Sprachforscher von Volksetymologie, so kann der Forscher nach Ursache und Wirkung von Volkslogik sprechen. Eine Frau hat stundenlang im Regen auf der Straße gestanden, um für ihren kleinen Haushalt, in den kaum noch die Hälfte des (nicht überreichlichen) Arbeitseinkommens von früher fließt und in dem deshalb die kahle Not herrscht, um für ihren Mann und die Kinder Brot und Mehlsuppe, die seit Monaten die einzige Nahrung bilden, ein Viertelkilo Pflanzenfett zu erlangen. Sie hat Muße, der Zeit zu denken, da täglich Fleisch auf ihren Tisch kam, sie den Kleinen was Süßes, Kuchen, Bonbon, Schokolade zustecken, zu Weihnachten ein Tannenbäumchen einkaufen, die in den Zweigen befestigten Wachslichte anzünden, allerlei hübsche Geschenke darunter legen konnte. Jetzt hat sie für ihren Knaben kein Hemd, kein Laken im Bett. Milch, Butter, Eier sind nur noch erträumte Genüsse. An Weihnachtsfeier und Geschenke ist gar nicht zu denken, und wenn sie für ihr kleines Mädchen, das seit acht Tagen so furchtbar hustet, einen Arzt holen muß, ist das Loch im Budget monatelang nicht zu stopfen. So aber wie dieser Frau ging es Millionen Menschen in deutschen Städten. Ist nicht begreiflich, daß der Vergleich leidlicher Existenz in der Kaiserzeit mit dem grassen Elend von heute sie in die Meinung verleitet, das Kaiserreich sei der Republik vorzuziehen? Weil der Butterpreis ins Unerschwingliche gestiegen ist, scheint Wilhelm nicht so schlimm, wie man ihn jetzt darstellt. Das ist simpel. Das leuchtet der Volkslogik ein. Gewiß wäre leicht zu erweisen, daß der Butterpreis, der ganze Jammer von heute die Folge, die letzte Auswirkung der Wilhelmerei ist. Erstens aber ist der Kausalprozeß, der solchen Beweis liefert, viel zu kompliziert, zu spitzfindig für die dumpfen Sinne der mit Mühsal Beladenen, die in geflickten Schuhen und fadenscheinigen Kleidern durch den Morast der Alltagsnot stampfen. Und zweitens ist der Versuch solches Beweises nie gemacht worden. Niemals mit den derben, der Massenpsyche angepaßten Mitteln, die allein ihn zu Wirkung bringen könnten. Statt von dem Bild nachwirkender Verderbnis die letzte Hülle wegzuziehen, statt die ungeheuren Fehler und die Fäulnis des alten Systems und seiner Hauptrepräsentanten immer wieder mit dem grellsten Licht zu bestrahlen und so allmählich den Volksinstinkt in Klarheit zu führen, hat man durch Beschönigung und Verteidigung des Gewesenen, Gestürzten eine Art von »Kontinuität« des Regierungssystems zu schaffen versucht. Wem ist auch nur vorstellbar, daß die Köpfe der großen Revolutionen Englands und Frankreichs von den Generalen und Staatsintendanten, Günstlingen und Kreaturen der Könige Charles Stuart und Louis Capet, von diesen Monarchen selbst, die vor der Geschichte doch nicht mit einem Hundertstel des von Wilhelm bewirkten Unheils belastet sind, mit zärtlicher Schonung gesprochen hätten? Aus den Tiefen der Nation wäre ihnen die zornige Frage entgegengehallt, warum sie verfemten, zertraten, köpften, was solcher Schonung würdig war. Die deutsche Republik, von ihren Regierern prahlerisch die freieste der Welt genannt, wahrt und ehrt das Gedächtnis der Monarchie wie heiliges Gut. Und der Erfolg dieses Tuns wurde überall fühlbar. Wo die besiegten Feldherren (die schlau genug waren, mit dem Odium der von ihnen erzwungenen und erflehten Kapitulation im Wald von Compiègne die Zivilisten zu bepacken), wo die Generale Ludendorff und Genossen sich zeigten, da umbrauste sie Jubel, wie ihn die Marschälle Foch, Joffre, Pétain, Douglas, Haig, Pershing niemals hörten. Populär sind nur die Leute, die das Land in den Krieg, in den Wahnwitz des Strebens nach Annexionen und Erdbeherrschung, in die Niederlage geführt haben. In dem breiten Schwarm der seit 1919 verbrauchten Minister war nicht ein einziger, der nicht ein großes Stück von Mitverantwortlichkeit für das Gewordene trug. Alle waren von dem Terror der Nationalisten eingeschüchtert und, sobald sie den Mund auftaten, nur von der Furcht beherrscht, sich vor diesen unerbittlich grausamen Wächtern des integralen Nationalismus die kleinste Blöße zu geben. Deshalb die ewige, ewig nutzlose, immer nur der Sache Deutschlands schädliche Wiederholung all der tausendmal gehörten Anklagen, der langen Liste von Rechtsbruch, Willkür, Greuel, die »dem Feind« zugeschrieben ward. Denn die schrillste Verfluchung des Feindes weckt den lautesten Applaus.
Wer darf darüber staunen? Die von System zu System vererbte Behauptung, ein Volk flecklos reiner, engelgleich bescheidener Menschen sei nur durch die böse Tücke, die Gier und den Neid schlimmer Nachbarn und Konkurrenten in Krieg gezwungen, in zermürbende Not eingepfercht worden, diese der Volkslogik sich einschmeichelnde Legende konnte nicht spurlos bleiben. Und woher sollte die Garde einer Republik sich rekrutieren, die keinem Stand je etwas gab, auch dem Bauer nicht Land, die allen nur nahm und die vom murrenden Haß knirschender Scharen Deklassierter, Adel, Offiziere, Beamten, umlagert ist?
Keinem Stand brachte sie dauernden Gewinn, einem ganzen Gewimmel aber für Jahre Bereicherung oder wenigstens Glitzerschein. Neben hohlwangiger Not, auf den Gräbern der Mittelklassen, die vom Ausverkauf ererbter Schmuckstücke und entbehrlichen Hausgerätes eine Weile ihr Leben kümmerlich fristeten, blähte frech sich üppigster Luxus. Das praßt und schlemmt, überfüllt Theater, Konzerthäuser, Tanzsäle, Restaurants, Teestuben, Bars, die Arena der Box- und Ringkämpfer, Schnapsschankstätten, Rennbahnen, Seebäder, Alpendörfer, Wintersporthotels und die mit jedem Monat wachsenden Räume, in denen halb oder fast ganz nackte Frauenleiber sich zu Wettbewerb ausstellen. Das hält sich die kostbarsten Rolls-Royce, die elegantesten Weiber, mietet in Gebirg und Tal und am Meer die feinsten Quartiere, kauft, was irgendwo käuflich ist, und fragt niemals ängstlich nach der Höhe des Preises. Woher all das Geld? Unnötig, das auf tausend Walzen abgespielte Lied von den Profitierern des Krieges, den nouveaux riches, dem täuschenden Segen der Inflation, den ins Ausland verschleppten, zu Haus versteckten, ins Neutralländische verlarvten Kapitalien, von der alle Schichten durchrasenden Devisenjagd und Aktienspekulation, von der Auswurzelung des Spartriebes noch einmal anzustimmen. Nur daran sei erinnert, daß alle von Landwirtschaft Lebenden, noch immer fast drei Fünftel des Volkes, nie zuvor so hohen und sicheren Gewinn hatten wie seit dem Beginn des Krieges und der Blockade; daß die ins Lächerliche sinkende Geldentwertung sie von allen Hypotheken und von anderen Schulden erlöst und ihnen Meliorierung und Modernisierung der Bauernhöfe, Großgüter, des Viehstandes, Ackergerätes und aller Maschinen, den Ausbau und den Neubau von Kirchen, Schulen, Amts- und Wohnhäusern bis in die entlegensten, einst ärmsten Dörfer in nie erhofftem Umfang ermöglicht hat; daß Bauern, um die sich über Nacht entwertenden Markzettel in »Sachgüter« umzuwechseln, Klaviere, Grammophone, Motorräder, Automobile, für ihre Frauen und Töchter Seide, Sammet, Pelze, Jumpers, Spitzen, die zartesten Dessous, ganze Berge von Wäsche, Kleiderstoffe, Wolle, Nähgarn, für zwölfjährige Mädel schon die ganze Brautausstattung eingekauft haben; daß einfache Förster im Nebenberuf Acker-Weidewirtschaft treiben, ein Dutzend Stück Rindvieh, ein Halbdutzend fetter Schweine im Stall halten, Gänse, Puten, Hühner auffüttern, Fische und Krebse in genügender Menge fangen, um den ganzen Bedarf großer Stadtrestaurants damit zu versorgen. So sah es auf dem Land aus. So, bis eines Tages beschlossen wurde: »Von morgen an sind 1000 × 1000 Millionen == 1 Rentenmark.« Bis auf dieser Gleichungsbasis die Mark im Inlandsverkehr »stabilisiert« und Deutschland aus dem billigsten über Nacht das teuerste Land Europas wurde. Seitdem leidet auch die Landwirtschaft. Sie ist mit hohen Steuern verschiedenster Art belastet, muß ihre Produkte, die sonst unverkäuflich blieben, unter dem Weltmarktpreis hingeben, für alles aber, was sie von den Stadtgewerben braucht, von der Kohle und Maschine bis zu Nägeln und Nadeln, Preise zahlen, die mindestens auf, meist über dem Weltmarktniveau liegen. Was sie noch an Papiergeld, Obligationen, Pfandbriefen hat, ward wertlos; und schon die Pflicht, die zur Feldbestellung notwendigen Düngemittel anzuschaffen, dräute als ein unlösbares Problem. Und nur natürlich, in Urtiefen der Menschennatur begründet ist, daß auch die Städter die häßlichen Geldzettel, die in ihrer Hand, Tasche oder Truhe schnell Makulatur wurden, für Ware oder Tand, Genuß oder flüchtiges Vergnügen ohne Bedenken hinwarfen. »So« (sagt man in Deutschland) »kommt Geld unter die Leute«. Regierungen, zu denen niemand Vertrauen hat, dieses Geld als Steuerbeitrag zu ertragloser Vergeudungswirtschaft anzubieten, drängt keinen besondere Lust; noch weniger, es in den Hort zu häufen, der die von dem »Feind« zu Reparation seiner Kriegsschäden verlangte Summe liefern soll. »Der Feind nähme uns ja doch alles«: jeder Mahnung an die Pflicht der besiegten Nation, sich in das karge Leben verarmter, tief verschuldeter Menschen einzuschränken, folgt diese oder im Sinn ähnliche Antwort. In dem übermüdeten, unterernährten, von der Fülle schrecklichen Erlebnisses stumpf gewordenen, vom Glauben und Aberglauben an Worte, Parteidogmen, Führergrimassen enttäuschten Volk ist, oben und unten, alles Interesse an Politik erloschen wie ein Lichtstümpfchen nach kurzem Flackern im Wind; in der unaufhörlichen Sorge um den nächsten Tag, in dem nie endenden hastigen Drang nach Sicherung des Notdürftigsten glimmen nur die zwei eng alliierten Begriffe »Feind« und »Reparation« manchmal noch auf.
Denn unausrottbar scheint den Köpfen, leeren, simplen und mit Kultur fein möblierten, die Meinung eingewurzelt, an der Lösung des Reparations-Problems hänge das Schicksal Deutschlands, Europas, eines noch viel größeren Stückes der Menschenerde, hänge (wie eine schlechte Metapher es ausdrücken könnte) die Zukunft des Planeten, der dem eng begrenzten Auge der Adamsenkel als Kosmos gilt. Seltsam, wie lange diese Irrmeinung sogar in hellem Verstand sich hielt. So, wie der Versailler Vertrag vorschreibt, auf so plump einfache, dem Zivilprozeß zum Schadensersatz nachgeahmte Art wird die Reparation nicht geleistet werden. Weil sie so nicht geleistet werden kann. Solche Summen sind entweder in Stoffen, Fabrikaten und Arbeit oder aus dem Ertrag exportierter Güter zu zahlen. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Zahlt Deutschland in »Sachwerten«, Produkten seiner Erde oder seiner Arbeit, so schädigt es die Industrie Frankreichs, seines Hauptgläubigers, die ja auch später noch für Reparaturen und Ersatznachlieferung zu großem Teil auf die Gewerbe des Schuldnerlandes angewiesen bliebe. Will es aus dem Ertrag seiner Handelsbilanz zahlen, dann muß es den Import alles irgendwie Entbehrlichen so schmal einschränken, den Export billiger, durch Hungerlöhne ein Dumping nie zuvor erblickten Umfanges ermöglichender Waren so hoch steigern, daß es allen anderen Exportstaaten, darunter den stärksten der Menschenwelt, unerträglich würde. Doch die Reparation ist am Körper des Hauptproblems nur ein Appendix. Würde er durch intern behutsame Behandlung vom Entzündungsfieber befreit oder vom Messer des Chirurgen weggeschnitten: das Hauptproblem bliebe auch dann ungelöst. Worin besteht und woraus entstand es? Mindestens zwei Drittel aller Europäer haben vier Jahre lang ihre ganze Arbeitskraft zum Zweck der Güterzerstörung, der Wertvernichtung aufgewandt. Nun hatten sie, hatten ungefähr dreihundert Millionen Europäer (die nicht ganz mit den zuerst genannten identisch sind) kein international vollgiltiges Zahlmittel, keinen halbwegs ausreichenden Kredit, konnten Waren hohen Wertes und Preises nicht kaufen und hinderten dadurch dem noch nicht seiner Zahlkraft beraubten, relativ teuer produzierenden Drittel die Gelegenheit zu Absatz, zum Verkauf seiner Stoffe, Land- und Meerprodukte, Fabrikate. Dort Mangel, hier Überfluß; dort Hungerleider, hier in seinem Fett erstickender Reichtum; dort Konsumschwund, hier Arbeitslosigkeit. Und in der Zeit solcher Marktverengung, solchen Zerfalls des Kontinentes in Völker, die nichts kaufen, und andere, die nichts verkaufen können, in der Zeit solcher an Dehnung und Dauer nie sonst irgendwo erlebten Krisis sind, weil Krieg und Blockade dazu zwangen, ganze große Industrien, die früher das Privileg, fast das Monopol eines Landes waren, noch einmal, zweimal, in Bezirken, in die sie sonst niemals gedrungen waren, aufgebaut worden. Schwellung der Produktion und Schrumpfung der Käuferschar, Reparation-Forderung des Gläubigers, deren Befriedigung den Schuldner als Kunden noch mehr, für noch längere Dauer schwächt: das war das Problem.
Der Schlüssel, der seine Riegel öffnet, war und ist nur auf dem Weg franko-deutscher Arbeitsgemeinschaft zu finden. Zwischen dem Pas de Calais und dem Teutoburger Wald, wo der Cherusker Hermann einst die Legionen des römischen Imperators schlug, zwischen dem belgischen Zeebrügge und der westfälischen Stadt Hamm liegt, in den Tälern der Hauptflüsse Schelde, Maas, Mosel, Rhein, Ruhr, das reichste Industriegebiet Europas. Von der Gnade der Natur und der Kultur ist es das reichste. Hier ist Kohle, Erz, Eisen, wird Koks und Stahl produziert, sind Zechen, Hütten, Walz- und Schmelz-Werke, Maschinen-, Farben- und andere Chemikalien-Fabriken, industrielle Anlagen aller Art, denen das feinste Eisenbahngleisgesträhn und das dichteste Kanalnetz zu Gebot ist. Seit Jahrhunderten wird um die Herrschaft über dieses Land gestritten. Kann der Versuch gelingen, ohne Rücksicht auf verweste dynastische und nationalistische Triebe, die das nach Wirtschaftseinheit, nach Zollunion schreiende Land zuletzt durch drei Grenzen, Belgiens, Frankreichs, Deutschlands, schieden, ihm endlich einträchtige, nur vom Rat der Wirtschaftsvernunft bestimmte Verwaltung zu sichern? An der Antwort auf diese Frage hängt Europas nächstes Schicksal. Der ertragfähigste Bezirk unseres (im Vergleich mit anderen Erdteilen an Schätzen nicht reichen) Kontinentes kann von drei einander mißtrauischen oder gar feindlichen Konkurrenten niemals so genutzt werden, wie ers müßte, wenn Europas Rang gewahrt werden und dieser Kontinent im Wettstreit mit gewordenen und werdenden Welttrusts, mit Panamerika, dem British Empire, dem russo-slawischen und dem gelb-mongolischen, sich behaupten soll. England, dem auf Europas Festland nichts als Gibraltar, fünf Quadratkilometer, eins seiner Torwachthäuser am Mittelmeer, gehört, hat sich gewöhnt, Macht und Recht, Souveränität und Wirtschaft der Europäerstaaten als Trumpfkarten und Zahlmünzen in seinem Universalspiel zu verwenden. Auf diese Gewohnheit, die nur Kurzsichtigen haltbar scheint, muß es verzichten lernen. Ihm gehört Australien, der Kern Afrikas, in Amerikas Norden Kanada, in Asien das indische Riesenreich. Dorthin weist die Magnetnadel Englands Zukunft. Auf die Wege, die Benjamin d'Israeli, Lord Randolph Churchill, Joseph Chamberlain empfahlen und die, noch mit unsicherem Fuß, Mr. Stanley Baldwin einst beschreiten wollte: in das von Vorzugszöllen geschützte, mit Rohstoffen und Fabrikaten in Arbeit und Absatz sich selbst versorgende, sich selbst genügende Empire, das nicht durch den Versuch, seinen Handel (trade) zum Maß aller Dinge zu machen und zu diesem Zweck den Globus heute hier, morgen dort auszubeuten, das Odium des »perfidious Albion« auf sich zu laden braucht. Noch weniger als andere Kontinente, auf denen es viel größeren Territorialbesitz hat, darf es Europa in Zahlung geben. Wegen der Ärmel-Küste und des Kohle-Erz-Gebietes ist es mit Spanien, den Niederlanden, Frankreich, dem alten und dem neuen deutschen Kaiserreich in Zwist und Krieg gekommen. Auch jetzt möchte es eine franko-deutsche Verständigung hindern, weil daraus eine ihm unbequem starke Wirtschaftsmacht, ein billiger als der des Inselreiches arbeitender Montan-Metall-Trust werden könnte. Je schneller England diese unhaltbare Position räumt, desto besser wahrt es seine Würde und zugleich seinen Vorteil. Will es nur Sicherung an der flandrischen Küste, die Europas Ausfalltor gegen das vorgelagerte Inselreich werden könnte: diesem Wunsch kann Erfüllung werden. Nach Englands Willen, der an dieser Küste keine Militärmacht duldete, wurde im vorigen Jahrhundert Belgien neutralisiert. Die von den starken Mächten des Völkerbundes verbürgte Neutralisierung des ganzen Industrielandes zwischen Schelde und Ruhr böte sichereren Schutz; gäbe auch Frankreich und Belgien die »sécurités«, die sie heftig fordern, und nähmen ihnen jeden Vorwand zu verschleierten Annexionen und Eingriffen in Freiheit und Selbstbestimmungrecht des Rhein- und Ruhr-Volkes. Wird dieses Industrieland, ohne der von Dynasteneifersucht und Diplomatenintrigue willkürlich gezogenen politischen Grenzen zu achten, rationell als Wirtschafteinheit, zu der es vorbestimmt ist, zusammengefaßt, dann vermag es Frankreich und Deutschland rasch über die Nachwehen der Kriegszeit hinwegzuhelfen, sie zu der lohnenden »Kulturaufgabe«, die der Aufbau Rußlands ihnen gemeinsam stellen wird, zu kräftigen und die Quelle zu werden, aus der unserem Kontinent Genesung quillt. Die nationalistische Lösung des heute drohenden Problems heißt: Rüstung zu Rachekrieg, der doch, wie er auch ende, wieder nur Waffenstillstand, neue Rüstung und neuen Krieg brächte und damit Europas Schicksal in oedipische Tragik münden ließe. Die andere Lösung fordert: deutsch-französische Arbeitsgemeinschaft als Vorbedingung und Keimzelle europäischer Wirtschaft- und Zoll-Einung. Nur auf dem Weg, auf dem George Washington die vom Krieg erschöpften, von Rivalität verkümmerten Staaten Nordamerikas rettete, ist auch unsere »Alte Welt« zu retten. Europa wird das Feld zunächst wenigstens ökonomisch vereinigter Staaten sein, die sich später dann wohl auch zu zentralen Verwaltungs- und Regierungs-Pools verschmelzen werden, oder es wird aus seinem Jahrtausende lang bewahrten Rang sinken und mählich der Vasall, die Reparaturwerkstatt, das Arsenal und das Museum jüngerer Nationen werden.
Nur aus einem neuen Europa kann ein neues Deutschland aufblühen; ein gesundes. Noch ist es krank; in seiner Seele mehr noch als in seiner Wirtschaft. Nicht so arm, wie es scheinen zu müssen glaubt, weil ihm immer wieder gesagt wurde und wird, die ganze Welt sei ihm feindlich und werde in Neid und Gier ihm alles nehmen, was es nicht verberge. Läßt sich aber der Wohlstand eines Landes verbergen? Die Schar derer, die big business machen, war schon im Ruhr-Jahr groß. In den Städten wächst die Zahl der neuen Paläste und Villen, Automobile, Alkoholschänken, Vergnügungsstätten; und drei Wochen vor Weihnacht schon ist in Gebirgshotels und Schneesportplätzen, trotz Chimborassopreisen, kein Zimmer mehr zu erlangen. Was zwischen der Schicht der »Dickverdiener« und den Handarbeitern, denen, damit sie arbeitsfähig bleiben, ein Minimum gewährt werden mußte, noch erhalten war, das hungerte, verhungerte oder verlumpte. Dezimierung des Lehrerpersonals, Schulklassen bis zu hundertfünfzig Köpfen unter einem Lehrer, Tinte, Stahlfedern, Bleistifte, Papier, Lehr- und Lesebücher unerschwinglich teuer, Studenten, die durch allnächtliches Klavierspiel in Lasterspelunken, Dozenten, die durch das Schleppen von Kohlensäcken ihr Leben fristen, Töchter von Staatsanwälten, Pastoren, Richtern als Aufwärterinnen und Reinemachefrauen: so sah es in Deutschlands Mittelkassen aus. Die Reichskassen waren leer. Der Wahnsinn des vom ersten Tage an aussichtslosen Widerstandes gegen die Ruhrbesetzung, der ungeheure Summen, mehr, als bis mindestens 1928 für Reparation zu zahlen war, verschlang, schien den Staatsfinanzen den letzten Stoß zu geben.
Dem deutschen Volk ist manches Unrecht angetan worden. Doch die ewigen Flüche darüber sind eben so echolos, nutzlos verhallt wie seit Jahren das alte Gewinsel: »Deutschland liegt auf dem Sterbebett«. Selbst muß es sich helfen, nicht von anderen nur Hilfe fordern. Nicht nur den Splitter im Auge des Nachbars sehen und den Balken im eigenen Auge leugnen. Vorwärts, nicht rückwärts blicken. Allzu lange war es gewöhnt, stumm zu gehorchen, in Eroberer-Krieg seine Hauptindustrie und beste Chance zu schätzen und nur die Opfer zu bringen, die ihm befohlen waren. Blinzelnd tappte es, mit tausend blutenden Wunden, in die Freiheit und fand sich noch nicht zurecht. Unersetzliches aber gab dieses Deutschland der Nibelungen, Walthers von der Vogelweide, Dürers, Kants, Goethes, Bachs, Beethovens, Mozarts der Welt und Unverwelkliches wird aus seinem Schoß ihr auch künftig reifen. Wenn Deutschland erkennt, daß Wahrhaftigkeit das stärkste aller Schwerter, die Religion des Gott gewordenen Geistes nicht nur Firmaschild, Ornament oder Feiertagsspektakulum, die Kampfart und der Ehrbegriff der Feudalzeit, des Rittertums mit der Zivilisation- und Kultur-Form des Industrialismus nicht vereinbar ist und daß jede Nation, groß oder klein, sich ohne Überhebung und dünkelhafte Verachtung der anderen in den Willen der Menschheit, der unsichtbar, unhörbar waltenden, einordnen muß.