
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Erschien als erstes Kapitel des Werkes »Und Afrika sprach; Bericht über den Verlauf der dritten Reiseperiode der D. I. A. F. E. von 1910-1912.« Bd. I-III. Vita, Deutsches Verlagshaus Berlin-Ch. 1912/13.
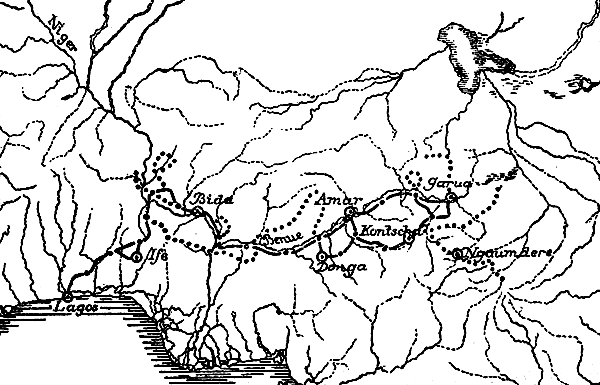
Abb. 4. Kartenskizze zur vierten Reise
(Vierte Reise.)
Die vierte Reise (1910-1912) nahm ihren Ausgang von Lagos. Im Hinterlande wurden Ausgrabungen angestellt und dann Züge in die Haussaländer sowie in das nördliche Adamaua (deutsches Tschadsee-Gebiet) gerichtet. Unterstützt wurde diese Expedition von den drei großen deutschen Museen der Völkerkunde (Berlin, Hamburg, Leipzig) und wissenschaftlichen Stiftungen. Hauptfunde waren die Terrakotten und Gelbgüsse von Ife, deren Auffindung es von da an ermöglichte, die afrikanische Kultur mit derjenigen des Mittelmeers, und zwar schon für das Altertum, zu verknüpfen sowie die Feststellung der templaren und tellurischen Religionssysteme. Anmerkung des Instituts.
(1912.)
Grundgedanken der Forschung; Die Anschauung von 1891. – Erste Erfahrungen im praktischen Negerstudium. – Kulturabschätzung: Menschenfresserei und Kultur. – Dokumente der Kultur; Gräberforschung. – Die großen Tumuli. – Das Urkundenmaterial der Kulturgeschichte Afrikas.
In diesem ersten Kapitel will ich mich bemühen, den Leser in jene Fragen, die unser Herz am meisten bewegen, einzuführen.
Im Jahre 1891 stand in einer Berliner Zeitung zu Beginn eines sehr gelehrten Artikels: »Afrika bedeutet uns nach neuzeitiger Ansicht, soweit es von Negern bewohnt wird, keinerlei geschichtliche Rätsel, denn nach allem, was wir von den Forschungsreisenden und Ethnologen aus diesem Erdteile gehört haben, fängt für dessen Bevölkerung die Geschichte der eigentlichen Kultur erst mit der Invasion des Mohammedanismus (schreibe besser: Islam) an. Vor den Arabern, die diese Religion und höhere Kulturen den Eingeborenen zutrugen, gab es weder eine organisierte Staatenbildung (!), noch eine eigentliche Religion (!), noch ein entwickeltes Gewerbe (!). Wir müssen uns bei der Betrachtung der eigentlichen Neger und ihrer vormohammedanischen Zustände also auf die Schilderung ihres rohen Fetischismus, ihrer brutalen, oft kannibalischen Sitten, ihrer geschmacklosen und abstoßenden Bildwerke und ihrer recht elenden Wohnstätten beschränken. Die natürlichsten Instinkte leiteten das Handeln und Treiben der Neger, die noch von keinerlei ethischen Regungen beseelt wurden. Der poetische Reiz, der märchenhafte Zauber, den für alle anderen Erdteile eine sagen- und sangesreiche Vergangenheit bietet, also das Anziehende jedes geschichtlichen Jenseits, die Aussicht, in nebelhafter Ferne ein wesentliches oder unwesentliches Zauberland aufsteigen zu sehen, die Hoffnung, der Erde hie und da Altertümer abgewinnen zu können, auf alles das muß jeder Beobachter und Beurteiler der sogenannten afrikanischen Kultur von vornherein verzichten. Wenn wir Kolonisierenden heute mit unseren Pflügen die afrikanische Erde aufreißen, so wird aus der Furche keine alte Waffe auftauchen. Wenn wir Kanäle durch die neue Erde ziehen, wird unser Grabscheit nirgends auf alte Gräber stoßen, und wenn wir den Urwald lichten, wird die Hacke nirgends auf die Fundamente eines alten Palastes stoßen. Afrika ist geschichtlich ärmer, als irgend eine Phantasie sich vorstellen kann. »Neger-Afrika« ist ein rätselloser, geschichtsloser Erdteil!« – sic!
In meinem nächtlichen Studierstübchen griff ich damals zur Schere und schnitt den Aufsatz aus. Damals legte ich ihn nachdenklich zur Seite, wandte mich dann zu meinen Freunden auf dem Bücherbrett und ließ die Bilder, die Schweinfurth vom Hofstaate eines Königs Munsa, die Wißmann von dem Trubel der Bassonge – Städte, Pogge vom Muatajamvo, die englischen Reisenden vom Zeremoniell des Ugandaherrschers entworfen hatten, an mir vorübergleiten. Ich erinnere mich nicht, mit welcher Absicht ich eigentlich damals den Zeitungsaufsatz herausschnitt und verwahrte; sicherlich aber dachte ich nicht daran, ihn überhaupt an die Spitze dieses Werkes zu setzen. Dann und wann kam er mir aber im Laufe der Jahre beim Durchblättern alter Akten in die Hände; im übrigen nahm er in meinem Gedächtnis zunächst keinen hervorragenden Platz ein. Als mir dann aber zwanzig Jahre später im Ausgrabungsgebiete Ife eine wunderschön geschnittene braune Hand aus tiefem Erdreich empor den ersten, noch mit feuchter Erde bedeckten Terrakottakopf emporreichte, fiel mir in raschem Ideenwechsel dieser Zeitungsabschnitt wieder ein. Die edlen Züge dieses alten Kunstwerkes schienen mir trotz aller erhabenen Ruhe, die seine Stirn auszeichnet, in mein Lächeln über die moderne Altklugheit einzustimmen. Dann wieder mußte ich dieser »neuzeitlichen Auffassung« gedenken, als ich einige Monate später in das alte Bollwerk eingezogen war, das den geschichtslosen »Heidenvölkern« dereinst als Trutzwehr gegen den von Norden eingedrungenen Islam gedient hatte. Diesmal saß ich einigen der dunkelhäutigen Herren gegenüber, und diese lächelten sehr eigentümlich, so sonderbar, daß ich daran erkannte, wie dämlich in diesem Augenblicke mein Gesichtsausdruck war. Heute gebe ich die Berechtigung zu diesen Mienen durchaus zu. Denn ich habe den geistreichen Gesichtsausdruck noch bei jedem durch höhere Bildung geweihten Moslem gesehen, wenn ich erzählte, was ich damals hörte, daß nämlich in der Periode von 631-643, vor dem Umsichgreifen des Islams, das Symbol unserer christlichen Religion im Scheitelpunkte des inneren Westafrika errichtet wurde.
So kam mir der alte, vergilbte. Zettel, der auf sehr schlechtem Papier gedruckt war, während der ganzen Reiseperiode 1910-1912 nicht wieder aus dem Gedächtnis. Aus Steinen und Erzen, aus Fleisch und Blut sprudelte dann eine Kunde nach der andern aus immer weiterer Tiefe empor, bis wir hinabsteigen konnten in die Mysterien einer erstaunlich weit zurückliegenden Vergangenheit! Das Reich jener Götterkönige, die im heiligen Ritual gemäß vorgeschriebener Sitte, nach genau begrenzter Regierungszeit, regelmäßig von den Priestern ermordet wurden, stieg aus grauer Vorzeit, schauerlich beredt wie Banquos Geist, vor mir auf. Was die Autoren des klassischen Altertums als von fernher erklingende Nachricht mit Staunen einst gehört haben, das gewann Leben zwischen diesen tropischen Blättern der Weltgeschichte; mir aber versiegte das Lächeln, wenn ich auch oft daran denken mußte, daß Negerafrika ja »ein rätselloser, geschichtsloser Erdteil« sein sollte. Die Steine sprachen, die ehrwürdigen Erze leuchteten aus alten Gräbern hervor. Wir suchten das Totenreich und forderten Eintritt, wie einst der vielgeprüfte Flüchtling, als er unter dem Zorne des Poseidon litt. Hartes Werk ist es, gegen den Willen der Götter zu fordern, und bitter ist das Schicksal des Menschen, der die Zufluchtsorte göttlicher Vergangenheit aufspüren will. Die Hand, die den Schädel des längst Verstorbenen aus afrikanischen Grabhöhlen ergreifen will, wird von Skorpionen gestochen; der Kühne, der dem Naturwillen zum Trotze tosende Winterflüsse durchschwimmt und steile Bergesrücken hinaufklimmt, wird vom Fieber und von Todesnot bedroht. Aber was heißt das! Unser Altvater Odin gab ein Auge um Weisheitserkenntnis. In stummen Nächten summte wie schauerliches Knochengeklapper das Wort jenes alten Zeitungsabschnittes durch mein Hirn, wie der Rhythmus einer tosenden Maschinenwerkstatt: »Rätsellos, geschichtslos!«
Das Lachen und Lächeln vergeht dem, der da unten die Vergangenheit heraufbeschwört. Mancherlei werde ich von dem zu erzählen haben, was das Schicksal uns auf der Wanderfahrt von 1910 bis 1912 und was die Arbeit von zwanzig Jahren uns an Gutem und Bösem beschert hat. Ich meine aber, nur dann könne das, was wir heute als Kredit in unser Hauptbuch eintragen dürfen, recht verstanden werden, wenn ich die Erlebnisse der Arbeit mit der Darlegung des Gewonnenen verbinde. Und deshalb setze ich den »status quo« der Meinung von 1891 an die Spitze. Und deshalb will ich auch zeigen, welches der schwerste Teil des Werkes, welches der Anfang ist, der überwunden werden muß für jeden, der in die Mysterien der Tatsachenwelt des vergangenen Negerafrika eingeweiht werden will. Im Vordergrund steht das Flachste des Flachen, das Jämmerlichste des Jämmerlichen, das Primitivste vom Primitiven: die Albernheit und die Banalität des Heute.
Denn das ist an jenem alten Ausspruch wahr: der sogenannte Neger zeigt sich dem Europäer zuerst meist, ja, man kann sagen, fast stets, als ein so gut wie hoffnungslos geschichtsbares und in allen tieferen Dingen entwicklungsarmes Geschöpf. Ich sage: Er zeigt sich zunächst so! Genau so, wie eine Unmasse bester europäischer Kraft dazu gehört hat, die Außenseite dieses zähen Erdteiles, dessen Eigenarten den jämmerlichen Typus des Negers zu seiner jetzigen Erscheinungsform umgebildet haben, zu durchdringen, auf deutsch: die Oberfläche des Erdteiles zu enträtseln – genau so, wie in der Tat vordem bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts eigentlich nur die Küsten und die von der islamischen Kultur damals beschrittenen Wege im Innern für europäische Forscher zugänglich waren – genau ebenso zeigte der dunkle Bewohner Afrikas im allgemeinen bislang auch nur da, wo Islam und Küstenhandel einen Zutritt vorbereitet hatten, oberflächliche Zugänglichkeit, im übrigen aber ein unzugängliches Innere und zähen, gleichgültigen Widerstand gegen jedes Eindringen europäischer Forschersehnsucht. Und wenn der gleiche Typus auch schon in der alten Zeit hie und da merkwürdigen Variantenreichtum zeigte, der unbedingt auf geschichtsreiche Vergangenheit schließen lassen konnte, wenn es auch schwer war, richtig zu interpretieren, so wurde es doch eben durch dieses banale Aeußere und eine gewisse Trivialität, der der Neger anheimfiel, sowie er mit dem Europäer in nähere Beziehung kam, erschwert, das Tieferliegende zu erkennen. So habe auch ich es erlebt! Und folgerichtig will ich deswegen hier die Schilderung meines ersten Zusammentreffens mit Negern anschließen, und wenn gerade damals, wie so oft später, der aus spontaner Wallung sentimental angehauchte, dankbare Negerknabe sprach, so scheint auch das gerade für die Negerart typisch.
*
Ein Jahr nachdem ich die oben wiedergegebenen Ansichten ausgeschnitten und beiseite gelegt hatte, fand ich zum ersten Male Gelegenheit, persönliche Bekanntschaft mit den schwarzen Objekten meines Studiums zu machen. Ich hatte mit einem jungen Manne, der in einer Hamburger Reederei angestellt und zumeist im Freihafen beschäftigt war, das Uebereinkommen getroffen, daß er mich immer sogleich benachrichtigen sollte, wenn auf irgendeinem Schiffe einmal einige Schwarze ankommen sollten, die Mitteilungen über die Zustände im Kongolande machen könnten. Denn aus dem Kongolande erhoffte ich damals ganz besonders wertvolle Aufschlüsse. Sobald solche Nachricht einlief, stahl ich mich von meinem Pulte fort und fuhr schnellstens der Seestadt zu. Es war das erstemal. Mein Freund holte mich am Bahnhofe ab. Er hatte gleich ein Individuum, das durchaus eigenartig aussah, mitgebracht. Als ich es aber erblickte, erkannte ich sogleich, daß dieses nicht ein Kongomann, sondern ein Abeokutajüngling sein mußte, denn er hatte die bekannten drei Narben auf jeder Wange. Das verstimmte mich zunächst. Ich hatte mich so recht auf einen Kongomann, womöglich ein Individuum aus der alten Stadt San Salvador, gefreut. Und nun war es nur ein Lagos-Mensch! Mein gutmütiger Freund war betrübt. Er bat mich jedoch, nicht so schnell an der Sache zu verzweifeln, da er im ganzen sechs Individuen auf Lager habe und dies gewissermaßen nur eine Musterprobe sei. Somit nickte ich denn dem Probestück gnädig zu und fuhr in den Hafen. John, der englisch sprach, folgte nach.
Ich erinnere mich nicht mehr, was für ein Schiff es war, das die sechs Jünglinge aus Afrikas Westen in Hamburg ans Land gespien hatte. Nur so viel weiß ich, daß es kein Woermann-Schnelldampfer gewesen sein kann, denn an Bord des Kahnes herrschten Schmutz und übler Geruch in solchem Uebermaß, daß sogar meinem wissenschaftlich bedürftigen »Feuergeiste« die Luft ausging! Zudem suchten wir die noch restierenden Fünf vergebens an Bord; niemand konnte uns über ihren derzeitigen Aufenthaltsort Auskunft geben. Und erst nachdem wir John wieder erreicht hatten, hörten wir, daß die anderen wahrscheinlich ihren »shop« im »dinner-house« zu sich nähmen. Also verließen wir den duftenden Kahn, ließen möglichst unbekümmert einige kräftige Matrosenscherze über uns ergehen und folgten den Spuren der fünf verschwundenen Exemplare. Vergebens bemühte ich mich, meinen Groll gegen das verfehlte Individuum John so gut wie möglich zu unterdrücken und meine Auffassung vom englischen Sprachgebrauch mit der seinen in irgendeine Uebereinstimmung zu bringen, was beides mir recht schwer wurde und nach längerer Selbst- und Dialektüberwindung zu der Ueberzeugung führte, daß vier der anderen ebenfalls Lagosboys, der sechste aber ein Loangomann sei. Die Aussicht auf das Studium des Loangomannes erfüllte mein Herz wieder bis zum Rande mit Hoffnung. Nach Johns Behauptung sprach James, der Kongomann, ausgezeichnet englisch, like white man, und wußte über jede Sache genau Bescheid. Es war klar, daß James ein Ideal sein mußte, und John machte mir das immer deutlicher, bis ich bei der Ankunft im Dinner-Lokal, und nachdem ich ziemlich tief in die Geheimnisse des Vokalschatzes meines Führers eingedrungen war, volle Ueberzeugung davon erlangt hatte.
Wenig später saßen wir zwischen den sechs schwarzen Burschen in einem Lokale, dessen Luft man entschieden auf Abbruch hätte verkaufen können. Ich erklärte dem Burschen mit aller mir zur Verfügung stehenden Ernsthaftigkeit, was mich zu ihm geführt habe, und während an den Nebentischen vergnügte Lieder gebrüllt wurden, bemühte ich mich, auf den Schwingen der Wissenschaft in eine bessere Luft zu gelangen. Der Jüngling James, der sich als verheirateter Katholik und französisch sprechender Familienvater erwies, wiederholte nach jeder Frage, die ich in wissenschaftlichen Dingen an ihn richtete: »very old – très vieux – very old – très vieux.« – Und zwar war es ganz gleichgültig, ob ich über das Königreich Loango, den Amerikaner Stanley, die Kunst des Bogenschießens oder Sambi, den lieben Gott, sprach. Nachher verlangten alle sechs »brandy!« und bekamen dann sehr schnell glänzende Augen. Damit endete der erste Studientag vorschnell. Für den anderen Tag hatte ich James für zehn Uhr in mein Hotel bestellt. Ein Schiffsjunge brachte ihn um zwölf Uhr in völlig betrunkenem Zustande – ich hatte ihm ja am vorhergehenden Tage noch zwei Mark geschenkt! – Am Nachmittag kamen noch zwei seiner Kameraden, die mich auch anbettelten. Gegen Abend war ich im Hafen an Bord und fand alle sechs in seliger Verschlingung in einem Winkel des Zwischendecks. Nachts war ich betrübt. Ich hatte mir das Studium der Afrikaner leichter vorgestellt!
Mein Freund von der Reederei weigerte sich, »mit mir weiter zu arbeiten«! Eigentlich hatte ich auch die Absicht, die unglückliche Sache abzubrechen. Die Weigerung des anderen erweckte aber nun gerade meinen Widerstand. Am vierten Tage war jedoch auch mein Eigenwille gebrochen und ich wollte abfahren. James war aber auch zu trunksüchtig! Ich ging nach einem letzten Versuch bekümmert aus dem Hafen. Es kam jemand hinter mir hergelaufen. Ich kannte diese schlürfenden, der Stiefel ungewohnten Fußlaute zur Genüge. Ich dachte mir: »Aha, nun wollen sie dich doch noch einmal anbetteln.« Ich war aber in diesem Augenblick sehr hart und völlig am Ende meiner Geduld. Ich wandte mich gar nicht erst um. Der Bursche kam näher und näher. – Er erreichte mich. Es war nicht James, sondern John. Und John sagte in feinem Englisch: »In my country is every old time man big stone.«
Ich wandte mich verblüfft um. Ich fragte, was der Bursche damit meine und wolle. Der Jüngling wiederholte mir, daß in seinem Lande jedermann aus alter Zeit ein großer Stein sei. Ich fragte später, weshalb er mir diesen Unsinn sage, und er setzte mir auseinander, er habe nun verstanden, was ich eigentlich wolle. Ich hätte ihm viel gegeben, und nun wolle er mir auch aus seinem Lande etwas erzählen. Danach sagte er mir einige Städtenamen, die ich mir höflichkeitshalber aufschrieb. Ich gab ihm auch einen six-pence, also fünfzig Pfennig, und dann war es fertig. – Welch wichtige Dokumente ich so in die Hände bekam, davon hatte ich an jenem Tage noch keine Ahnung. Erst ein Jahr später, als ich wieder im Hamburger Hafen Studien trieb, dämmerte mir eine Ahnung davon, daß mir John sowohl den ersten Einblick in ein Negergehirn (das sehr wohl Dankbarkeit und Verpflichtung kennt!), als auch die erste Aussage über Skulpturen im alten atlantischen Kulturgebiet gegeben hatte. Es war, wie häufig bei der Jagd: Der Neuling hatte den besten Anlauf, aber er verpaßte den Schuß. Die großen, steinernen Töpfe, die ich jüngst heimbrachte, stammen aus den Ruinen einer Stadt, deren Namen mir damals John genannt hat.
Das ist mir eins der merkwürdigsten Erfahrungsbeispiele von Theorie und Praxis im ethnologischen Studium geworden. Der Theorie nach lehnte ich a priori die Geschichtslosigkeit der Afrikaner ab; das erste Auftauchen eines alten Kulturmonumentes in meinem Gesichtskreis übersah ich aber! Wahrlich, das Sehenlernen ist im afrikanischen Tiefenstudium der schwierigste Teil der Arbeit!
*
»In meinem Lande ist jeder Mann aus alter Zeit ein großer Stein« sagte der nach Hamburg verschleppte Negerbursche und roch dabei nach Fusel. Hier stand ein großes Problem der Wissenschaft lebendig vor mir, das Problem der Kulturmischung, die hier erstens in den vorgeschichtlichen Steindenkmalen Innerafrikas, zweitens in der englischen Sprache des Jünglings und drittens in dem Geruch des deutschen Schnapses geboten war. Das Objekt stellte also den Stoff für mindestens drei Doktordissertationen dar, für eine über vorgeschichtliche Funde in Westafrika, für eine über Uebertragung und Umbildung der englischen Sprache auf den Negermund und drittens über eine betreffend die Beeinflussung des Negergehirns durch deutsche Alkoholpolitik. Während aber hier ein jeder Laie mit Leichtigkeit jedes dieser Motive in die Geschichte der Weltkultur wenigstens epochen- oder doch regionsweise eingliedern kann, ist das in der Mehrzahl der anderen Fälle nicht so leicht.
Nach dem Ueberwinden des banalen Aeußeren, mit dem der Neger uns entgegentritt, liegt die zweite Schwierigkeit des Forschens in der Tatsache, daß niedere und höhere Instinkte und Kulturformen in Afrika so innig miteinander verbunden sind, daß es außerordentlich schwer ist, zu sagen, was älter und primitiver und was höher und jünger ist. Man ist geneigt, alle niederen und tieferen Aeußerungen der Menschheitsgeschichte einer älteren, alle höheren einer jüngeren und höheren Kulturschicht zuzuschreiben. Nackte Menschen gelten a priori als Repräsentanten älterer, primitiver Geschichtsperioden; reicher gekleidete als Vertreter höherer und jüngerer Kulturentwicklung. Die sogenannten »Fetischanbeter« sind dem Laien immer primitiv erschienen, und so erscheinen ihm auch stets die Völker mit schwach entwickeltem Staatswesen, mit ungeordneter Familiengliederung und einfacherer Bewaffnung. Dagegen pflegt man hohe und höher stehende Bildungen, verfeinerte Familiengruppen, kunstgewerbliche Glanzstücke gern als Anzeichen höherer und jüngerer Kultur einzuschätzen.
Wie unsicher solche Kritik ist, soll mit einem Beispiel belegt werden, das den Kontrast so recht in seiner Tiefe, die Schwierigkeit dieses Problems in seinem ganzen Umfange kennzeichnet. Aus einem Werke der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts gebe ich ein Zitat: »Die Menschenfresserei kann doch nur von einem Volke geübt werden, das auf der niedrigsten Stufe menschlicher Gesittung steht und noch keinerlei seelische Verfeinerung und Vertiefung erfahren hat.« – Dagegen nun meine Erfahrung:
In der Reiseperiode 1904-1906 zählte ich zu den besten Leuten der Expedition einige Bassonge, also Angehörige eines Volkes, das am oberen Sankuru und Lomami, etwa um den 24° ö. L. und dem 5° s. Br. wohnt. Es waren dies kluge und intelligente Menschen, die aber mit den Batetela vom oberen Lomami und den Tomma in Liberia zusammen um den Preis ringen können, die raffiniertesten Menschenfresser zu sein, die ich überhaupt persönlich kennen gelernt habe. Ueber ihre kannibalischen Sitten habe ich in unseren Akten folgende Studienergebnisse verzeichnet:
Die südlichen Bakete und die Kauanda sind auch Kannibalen; aber sie verzehren nur zeitweise Menschen, die gelegentlich im Kriege getötet worden sind. Die Bassonge essen nicht nur diese gelegentliche Kriegsbeute, sondern sie veranstalten Menschenjagden und mästen Sklaven, die nur noch dem Zweck dienen sollen, gegessen zu werden. Von Zeit zu Zeit machte sich in älteren Zeiten eine Männergruppe aus irgend einer Bassongestadt auf den Weg und hielt sich möglichst auf den Wildpfaden. Irgend ein kleines Dorf, mit dem keine Familienbeziehungen vorhanden waren, wurde aufgesucht und zu einer Tagesstunde, da der größte Teil der Männer auf dem Felde beschäftigt war, angegriffen. Den Dörflern erklang plötzlich zum Zischen der Pfeile das bekannte »Häääääähhhh! Hääähh!« Dann floh der Rest der anwesenden Dörfler durch die Bananenstauden von dannen und suchte sich im Grase oder in Hüttenwinkeln, so gut es ging, zu verbergen. Meist glückte solch ein Angriff, denn die Späher hatten schon tagelang auf der Lauer gelegen, hatten alle Einzelheiten signalisiert und kannten die günstigen Momente. Die glücklich dem Dorfe und dem Ueberfall entschlüpften Einwohner liefen natürlich zu denen, die im Felde arbeiteten und diese sandten dann Boten aus, um aus befreundeten Orten Hilfskräfte heranzuziehen, überall im Lande die Verwandten aufzubieten und womöglich noch rechtzeitig den plötzlich hereingebrochenen, menschenmordenden, menschenfleischheischenden Männertrupp vor seinem Abzüge abzufangen.
Daß die Bewohner des Landes sie, wenn nur irgend möglich, einzufangen und zu töten versuchen würden, das wußten die Menschenjäger aber recht wohl. Es war für sie sicher, daß eine große Zahl von Kriegstruppen bald in der Umgebung auftauchen würde. So war ihnen denn Eile geboten. Meist hatten diese Jäger einige Kinder aufgegriffen, oder es war durch Speerstiche, die durch die Hüttenwand in das Innere der Häuser drangen, auch wohl ein verkrochener Sklave oder eine alte Frau niedergestreckt. In großer Eile ward nun ein mächtiges Feuer angefacht. Und während die vor dem Dorfe aufgestellten Wachen ausspähten, wurden die erlegten Kinder wie die Ratten auf lange Stöcke gesteckt und an diesem naturwüchsigen Bratspieß geröstet. Erwachsene Leute wurden, wenn der Rückzug nicht allzu gefährdet war, gefesselt und mitgenommen. Glaubten die Menschenjäger indes, mit solchem widerstrebendem Ballast Schwierigkeiten und allzu große Behinderung zu finden, so ward das Opfer dieser Feinschmeckerei durch Messerstiche ins Herz getötet. Der Leib ward dann von oben bis unten aufgetrennt, ein längerer Pfahl ward darüber gebunden und das edle Wild so über die Flammen gebracht. Schnell waren hier und da einige Garkosthappen abgetrennt, und dann ward das Stück zerlegt und in einzelnen Teilen mitgenommen. Eiligst brach die Jägerschar auf; einer hatte einen Arm, einer den Kopf und der Anführer vor allen Dingen das Herz im Beutel. War Gefahr im Anzüge, so ging es eiligst heim, war die Gelegenheit dagegen günstig und noch nicht jeder Schnappsack gefüllt, so ward auch wohl noch ein anderer Weiler aufgepürscht, dann hieß es aber eiligst: rückwärts! Nachher kamen die Dörfler zurück, sie fanden dann nur die verkohlten Reste eines mächtigen Feuers und angesengte Pfähle, und durch die Luft zitterte noch der Geruch von Blut und verbrannten Haaren. Die zurückkehrenden Männer klagten nicht; das ist hier Sache der Weiber. Sie gruben eine Grube wie ein Grab und warfen den Rest des Mahles hinein. In den nächsten Tagen ward dann eine Versammlung der verwandten Dörfler abgehalten. Oft wußte die Bevölkerung überhaupt nicht, woher der Feind gekommen war, und dann konnte auch kein Rachezug unternommen werden. Aber auch wenn man den Feind zu fassen vermochte, kam es selten dazu; denn das war ja die Regel: die Stärkeren überfielen die Schwächeren, und die hatten nicht genug Staatserziehung und staatenbildenden Geist, um etwa durch Vereinigung mehrerer kleiner Weiler einen großen Staat zu bilden. Es fehlte eben das Häuptlingstum in diesem Teile des Sankuru- und Lomamibeckens. Das war der Fluch!
Wenn eine hochstehende Regierung auch noch so tapfer und klug und geregelt ist, so ist der »Bürgermeister« hier doch nie der Herrscher, und das ist der große soziale Unterschied zwischen den Völkern des zentralen Kongobeckens und denen des Südens. Jedes monarchische oder despotische Volk, das in das Innere des Beckens geschleudert ward, verfällt wieder in die alte Städtebildung; Kunst und Geistesleben mögen da wohl blühen, Staatsgewalt nie. Doch beachten wir nun die andere Form der Menschenfresserei.
Wenn bei den zentralen Bena-Ki anscheinend mehr die Menschenjagd Sitte war, so war wohl bei den schwächeren Grenzstämmen des Bassongegebietes mehr die Mästung üblich. Jedenfalls waren sie im Menschenessen alle gleich. Sklaven im Balubalande eingefangen oder eingekauft, wurden zunächst gezüchtet, gehörten sie der Gemeinde, so war der »Bürgermeister« der Fürsorger; dann war er es, der zu entscheiden hatte, wann der Mann seinem Schicksal verfiel. Bis dahin erledigte er Gemeindearbeiten. Der Mastsklave oder die Mastsklavin lebten übrigens nicht im Zölibat. Aber es wird ein großer Unterschied gemacht, der für die Auffassung der patriarchalischen Stämme eine wertvolle, grundlegende Aufklärung bietet: ein Kind, das ein freies Bassongeweib zur Mutter und einen Sklaven zum Vater hat, ist unfrei und späterer Küchenverwendung preisgegeben. Das Kind, das einen freien Bassongemann zum Vater und eine Sklavin zur Mutter hat, ist ein freies Stammesglied; denn der Mann ist nach patriarchalischer Auffassung der Maßgebende.
Im übrigen gingen die Menschenzüchter in bezug auf ihre Opfer von klaren Ueberlegungen aus. Mir sagte ein Bassonge, daß ein Mann nur dann dick und fett würde, wenn er verheiratet sei und wenn er keinerlei Sorgen habe. Deshalb müsse man also auf jeden Fall einem Zuchtsklaven eine Frau geben, sonst werde es mit dem Fett nichts Rechtes. Außerdem dürfe der Mann nicht beständig in der Angst schweben, daß er demnächst gegessen würde, denn dann magere er eher noch ab, als daß er zunehme. Am besten wäre es jedenfalls, wenn es dazu käme, daß der Mann während der Mastzeit Vater würde; denn dann fühle er sich im allgemeinen sehr wohl und nehme beträchtlich zu. Man sieht daraus nicht nur, wie raffiniert diese Gesellschaft ist und ihre Maßnahmen ergreift, sondern mit welcher großen Ueberlegung diese Stämme bis zu logischen Schlußfolgerungen gelangen. Alle diese Dinge hier sind für den, der unter den Baluba und Bassonge längere Zeit geweilt hat und mit ihnen auch geistig verkehrt hat, nichts Ungewöhnliches. Sie charakterisieren eine Denkweise, wie wir sie unter den dunklen Waldvölkern nicht finden würden.
Wenn das sorgsam gezüchtete Stück schlachtreif ist, so wird ein günstiger Tag bestimmt. Irgend ein heiliger Mann der Stadt gibt nun gewöhnlich den Ausschlag, indem der Orakelgeist dieses heiligen Mannes sich für einen bestimmten Tag äußert. So machen sich denn an dem betreffenden Morgen einige handfeste Burschen mit langen Knütteln und dem Schlachtsklaven auf den Weg in die Savanne unter dem Vorwand, irgendwo zu Markte zu gehen oder eine Wildspur aufzusuchen oder ähnliches. Nun wird es dann so eingerichtet, daß an einem geeigneten Platze, d. h. wo das hohe Gras gute Verstecke bietet, der Schlachtsklave vorangeht. Dann holt einer der anderen, die hinterher wandern, plötzlich mit einem Keulenknüppel aus und schlägt dem Opfer unversehens in den Nacken. Die Leute haben ihren eigenen Griff und Schlag. Und so fällt der Mann dann sogleich als Toter in die harten, hohen Gräser. Jetzt schneiden die Burschen eiligst einen kahlen Platz in das Gras, legen den Getöteten in die Mitte und häufen die Gräser über ihm zusammen. Bis zum Mittag ist das Gras getrocknet, und dann wird es angezündet. In diesem Strohfeuer brennt die schwarze Decke der äußeren Haut sehr bald ab, und das weiße Fleisch kommt zum Vorscheine, das »weiße, schöne Fleisch«. Damit ist für heute die Arbeit getan. Erst am anderen Tage wird der Mann aufgebrochen. Dann ist die ganze Speisegesellschaft, gereifte Burschen und Männer, zugegen. Frauen dürfen das »Kudia-Muntu« nicht sehen, auch von dem Festschmause nichts erfahren. Sie sind strengstens davon ausgeschlossen. Die Teilung erfolgt familienweise. Alles wird aufgegessen mit Ausnahme eines Gliedes, das daheim im Rauchfange über Feuer geräuchert und als Zauberbestandteil den wichtigeren Buanga (Zaubermitteln) beigefügt wird. Im übrigen wird das Fleisch mit Bananen und Maniok zusammen gekocht und soll so einen sehr angenehmen, dem Schweinefleisch ähnlichen Geschmack erhalten. Kann die Genossenschaft nicht alles verzehren, so röstet man den Rest im Feuer.
Daß solchem Mahle ein kräftiger Umtrunk in Palmwein folgt, versteht sich von selbst. Aber daß solche Festtage dann in gründliche Schlägerei ausarten, soll nicht vorkommen. Es scheint vielmehr eine ganz eigenartige Stimmung über solchem Festmahle in hohem Grase zu lagern. Die Speisegesellschaft wird mit einem Bande umschlungen, das eine gewisse mystisch-religiöse Kraft zu besitzen scheint. Aber eigentliche Kultushandlungen sollen nicht dabei vorkommen. Bei den Ki waren noch monatliche Festbraten an der Tagesordnung, aber trotz »der guten Gewohnheit« hatte auch bei ihnen das Gewohnte nie den Anstrich des »Gewöhnlichen«, des »Alltäglichen« erhalten.
Nach allen meinen Erfahrungen und nach all den vielen Mitteilungen dieser Art, die mir abends beim Feuer und bei kreisender Tabakspfeife zuteil wurden, gewann ich doch stets den Eindruck, daß alle innerafrikanischen Kannibalen eine ganz ausgeprägte Stimmung mit dem Menschenmahle verbinden, und ich muß es für mein Reisegebiet jedenfalls als eine Entstellung der Tatsachen ansehen, wenn ein Reisender von den Innerafrikanern schreibt, »sie essen Menschenfleisch mit demselben Gefühl, wie wir ein gutes Beefsteak«. – Das ist unwahr; denn wenn ein Neger auch wöchentlich mehrfach Menschenbraten auf seiner Tafel stehen hat, so wird der Genuß für ihn in diesen Ländern doch stets mit einem bestimmten Gefühle verbunden sein. –
So berichtet das Tagebuch von 1905.
Hier ist also die Barbarei so voll entwickelt wie nur denkbar. Ich meine, um damit zu unserem Problem zurückzukehren, hier zeigte sich eine so absolut brutale Sitte, daß wir an die oben zitierten Worte denken müssen: »Die Menschenfresserei kann nur von einem Volke geübt werden, das auf der niedersten Stufe menschlicher Gesittung steht und keinerlei seelische Verfeinerung und Vertiefung erfahren hat.«
Der Theorie nach sehr schön! Aber: diese kannibalischen Bassonge waren nach dem von uns vorgefundenen Typus eines jener seltenen innerafrikanischen Völker, welche zu den geschmackvollsten und geschicktesten, taktvollsten und intelligentesten gehören, die wir unter den sogenannten Naturvölkern überhaupt kennen. Sie wohnten vor der arabischen und europäischen Invasion nicht in »Dörfchen«, sondern in Städten von 20 000 bis 30 000 Einwohnern, in Städten, deren Hauptstraßen von Alleen herrlicher, regelmäßig eingepflanzter, in gleichen Abständen kolonnadenartig gegliederter Palmbestände beschattet waren. Ihre Tonarbeiten könnten jedem europäischen Kunstgewerbler reiche Anregung bieten. (S. »Und Afrika sprach« I. S. 15.) Ihre eisernen Waffen waren so ausgestaltet, daß kein fremdes Kunstgewerbe sie vollendeter in ihrer Art erdenken kann. In die Eisenblätter waren zierliehe Ornamente in Kupfertauschierung eingelegt, und die Griffe waren geschmackvollst mit Kupfer plattiert. Dazu waren es die fleißigsten und geschicktesten Farmbauern, die in sorgfältiger Bestellung der Anlagen jedem europäischen Gärtner Konkurrenz machen könnten. Der Verkehr der Männer und Frauen, der Eltern und der Kinder war durch einen Takt und durch eine Feinfühligkeit charakterisiert, die weder in bäuerlicher Unbefangenheit, noch in städtischer Verfeinerung bei uns übertroffen werden könnte. Die Grundbildung ihres Staaten- und Städtewesens war ursprünglich eine parlamentarisch-republikanische Organisation. Es ist festzustellen, daß diese würdig geleiteten Städte zwar oftmals Krieg miteinander geführt haben, daß es aber trotzdem seit undenklichen Zeiten unbedingt Sitte war, auch mitten im Kriege die Handelsstraßen offen zu halten und eigene wie fremde Händler unbehelligt ziehen zu lassen. Und der Handel dieser Eingeborenen bewegte sich auf einer Straße, die uralt war, die von Itimbiri bis Batubenge, d. h. also auf einer Linie von annähernd tausend Kilometern verläuft. Diese Straße ist erst von den »kulturtragenden« Arabern gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts zerstört worden. Noch zu meiner Zeit gab es aber Schmiede, die die Namen der Orte an dieser hervorragenden, den »undurchdringlichen Kongowald« quer durchschneidenden Handelsstraße kannten. Denn auf ihr wurde alles Eisen ins Land gebracht.
Was will solchen Tatsachen gegenüber nun die Behauptung unseres Autors aus den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts besagen? Ist es nicht augenscheinlich, daß die eine abgeschmackte Sitte der Menschenfresserei durchaus nicht als Symptom absoluten kulturellen Tiefstandes gelten kann? Und ist es nicht ganz klar, daß solche Kunstfertigkeit, solche bedeutende Entwicklung des Handels, solche Städteanlagen und Städtebildung das Produkt langer, kulturgeschichtlicher Entwicklung sind? Spottet hier nicht der ganze Tatbestand einer engbrüstigen Anschauung, die nur nach Prüfung abstruser, barocker Uebertreibungen, wie sie notwendig die Kultur jedes Volkes aufweist, den Wert und die Zugehörigkeit des Ganzen beurteilen will?
Aber doch muß ich zugeben, daß solche Nebenerscheinungen jede höhere Kulturerscheinung in Afrika so dicht umhüllen und unter schier undurchdringlicher Decke verkleiden wie der Urwald die Bäche und Flußläufe. Es ist schwer, sie beiseite zu räumen, sehr schwer! Oft verzagt der Forscher. Und der Schatzgräber findet nicht immer das, was er erhofft hat und was er auch erwarten konnte, eben weil dieses Schlinggewirr allzuhäufig in tropischer Ueberwucherung das eigentliche Wesen erstickt und abgetötet hat. Es ist wahr: Der Afrikaner hat wenig Talent dazu, einen Kulturschatz rein zu bewahren und sein Erbe heilig zu halten. Denn er kann nicht anders, als mit bald bizarrem, bald komischem, bald naivem, bald barockem, fast immer aber geschmacklosem Schnörkelwerk jede Urkunde aus alter Zeit so zu übermalen, daß das Auge sich erst nach langer, langer Mühe instand gesetzt sieht, den alten Text zu erkennen.
*
Was aber sind denn nun geschichtliche Urkunden in Afrika? Dürfen wir ein Material erhoffen, wie es der Historiker am meisten erstrebt: geschriebene Dokumente? Oder aber gäbe es eine Möglichkeit, eines Tages auf Monumente zu stoßen, wie solche aus klassischem und mittelamerikanischem Altertum so reich erhalten sind? Oder aber gar gut datierte, wie die Aegyptens und Westasiens?
Es war früher bitter für uns, auf solche Fragen immer nur antworten zu können: »Was wir an Manuskripten aus Negerafrika kennen, das ist in arabischen Lettern geschrieben und atmet islamischen Geist. Und noch fand niemand ein Monument aus Stein oder gebrannter Erde oder Erz, das nicht in letzter Linie doch echte, geschichtslose Negerbanalität zeigt oder als geschliffenes Werkzeug aus der ebenso ungeschichtlichen Vorzeit stammt.« Es war bitter und hart, so klar die Machtlosigkeit und Ergebnislosigkeit unseres Strebens zugestehen zu müssen. Wer aber hätte anders antworten können? Und wenn nur Urteile, wie die auf pagina 1 wiedergegebenen, ausgesprochen wurden, so war im Grunde genommen vom historischen Standpunkt aus nichts hiergegen zu sagen. Es gehörte wahrlich starker Mut und große Hoffnungsfähigkeit dazu, die Ueberzeugung aufrechtzuerhalten, daß doch noch eines Tages ein gutes Beweismaterial für kulturelle Tiefe und wirkliche Anknüpfungsgelegenheit für geschichtliche Eingliederung in die Weltgeschichte gefunden werden könnte.
Die Standhaftigkeit ist aber im Laufe der Zeit belohnt worden. Im Bericht über die zweite Reiseperiode (»Auf dem Wege nach Atlantis«, S 321) habe ich schon von einem Ritt erzählt, den ich eines Nachts unternahm, um heimlich ein altes Heiligtum des großen Mossivolkes aufzusuchen und einige Schätze, die es barg, für die deutschen Museen zu retten. Es war eine der lustigsten und erfreulichsten, wenn auch der anstrengendsten Unternehmungen, die mir überhaupt geglückt sind. Schon lange bevor ich in der Reichshauptstadt der Mossi anlangte, hatte ich von jenem Heiligtum im Voltagebiet gehört als Erfolg des immer bewährten Rezeptes, daß man vor dem Betreten eines Landes dessen abgetriebene und verschlagene Bürger gründlich abhören muß, weil diese durch Versklavung Abgetriebenen und Verschlagenen im Auslande immer leichter über die Geheimnisse der Heimat berichten als dessen ungetrübt glückliche, seßhafte Völker, die infolge des Lebens im sozialen Verband zu gleichmäßig betriebener Geheimniskrämerei neigen.
Diese dunklen Afrikaner wissen ihre Geheimnisse unter dem Druck des allbeherrschenden Sozialmilieus mit einer Zähigkeit und Verschwiegenheit zu bewahren, die für uns individuell entwickelte und persönlich erzogene Europäer unverständlich ist. Bei uns kann sich niemand eine Vorstellung machen von der Wucht des Druckes, den die gesamte Masse der Bevölkerung auf den einzelnen ausübt. In Wagadugu, der Reichshauptstadt der Mossi, war solche Verschwiegenheit aus guten Gründen fast noch tiefer eingewurzelt als sonst in Afrika. Am Kaiserhofe in Wagadugu gab es etwa fünfzig höhere Beamte und Fürsten, von denen jeder habgierig, herrschsüchtig, bereit zu Intrigen, in ununterbrochenem, stillem Kampfe mit der Gesamtzahl der anderen Fürsten lag, in einem Kampf, dessen Ziele für alle die gleichen waren: den größten Einfluß auf den Mogonaba – den Kaiser – zu gewinnen.
Ach, dieser arme Mogonaba! Er wurde umtänzelt und umgirrt, umflattert und umgarnt, wie nur je ein kleiner europäischer König von einer raffinierten Kamarilla. – Der Kaiser war ein sehr junger, sehr unerfahrener, von der Natur mit wenig Gaben und noch weniger Energie begabter Mensch. Die Erzfürsten des Reiches wälzten sich alltäglich und unentwegt demütig vor ihm im Staube und stießen und rissen seinen Willen doch hin und her, je nach dem Ueberwiegen der persönlichen Macht im Reichsrat. Ich habe diesen armen Kaiser weinen sehen. Wahrhaftig, ein jämmerliches Bild und eine sehr eigenartige Erfahrung.
Armer Kaiser der Mossi!
Es war unter den komplizierten Verhältnissen dieser Kamarilla schwer, meinen Plan auszuführen. Ich fand keine Parteigliederung im Lande, die mir etwa eine Handhabe hätte geben können, sondern ich fand über fünfzig habgierige, kurzsichtige, herrschsüchtige kleine Fürsten, von denen keiner dem anderen über den Weg traute! Also blieb mir nichts anderes übrig: ich mußte mich an dem allgemeinen Ränkespiel beteiligen und versuchte, von dem Mogonaba das zu erlangen, was ich für meine Arbeiten benötigte. Erfreulicherweise war Seine Majestät, wie auch auf anderem Gebiete, so auch auf dem Boden der Finanzpolitik sowohl schwach besaitet als schwach im Widerstande. Majestät brauchte immer Geld, viel Geld. Seitdem die Franzosen ins Land gekommen waren, durfte man nicht mehr Sklaven fangen; auch warf der Karawanenhandel, für die einheimischen Fürsten wenigstens, nichts mehr ab. Und doch wuchsen die Bedürfnisse. Der Kaiser mußte am Opferfeste Kleider verschenken, für die die Sklaven nicht mehr die Stoffe webten, sondern die nach modernem Geschmack von den fränkischen Faktoreien im Westen eingekauft werden mußten. So kam ich denn der kaiserlichen Schatulle mit dem Konto der Expedition gerade vor dem großen Opferfeste recht gelegen.
Wie manchen Abend haben wir gehandelt und geschachert! Und wie haben wir geschachert! Wie manchesmal habe ich stundenlang bei ihm gesessen! Zuletzt aber wurden die Erzfürsten eifersüchtig auf mich und böse auf den Kaiser, weil sie etwas ahnten. Der Giftbecher kreist aber in diesem Land auch am Kaiserhofe! Der Herrscher begann zu fürchten. Er verfiel der Furcht vor den Rechten der berühmten vier Erzherren auf der einen Seite und der Furcht andererseits, daß die anderen den Leckerbissen mit ihm etwa teilen wollten. So einigten wir uns denn eines Tages schnell auf 1200 Francs, zahlbar nach Einheimsung der Materie, und da in der Nacht des Uebereinkunftstages noch ein großes Hoffest stattfinden sollte, bei dem alle Großen erscheinen mußten, ward beschlossen, die Sache in gleicher Nacht auszuführen.
Ich schickte meine Leute an diesem Tage früh zu Bett. Mein Mossidolmetscher trug meinen Sattel in einem Sack fort, ich legte mich pro forma zu Bett, und pünktlich zu verabredeter Stunde klopfte einer der kaiserlichen Pagen an den Holzverschlag, hinter dem mein Bett stand. Wie anscheinend immer in solchem Falle, wäre das Ganze noch im letzten Augenblick bei einem Haar ans Tageslicht gekommen. Denn gerade an diesem Tage mußte das Pflichtgefühl meinen sonst so faulen Pferdejungen so ungewöhnlich kitzeln, daß er beschloß, die Eisenteile meines Sattels zu putzen. Wie ich mit dem Pagen an dem Leutehause vorbeikam, sah ich, wie er dort wild umherschoß und nach dem Sattel schrie, der inzwischen schon draußen am Weichbilde der Stadt auf dem Rücken eines kaiserlichen Pferdes lag. Glücklicherweise hielt der Reinlichkeitstrieb nicht allzu lange vor. Der Jüngling beruhigte sich. Als echter dunkelfarbiger Bewohner Afrikas beschloß er, die erschwerte Angelegenheit bis morgen zu verschieben.
Es war ein tolles Jagen, und es ging immer im schnellsten Negergalopp in Schlangenlinien auf dem meist steinigen Boden dahin. Ich war sehr froh, daß ich nicht meine eigenen Gäule zwischen den Beinen hatte. Zweimal wechselten wir die Pferde, dann waren wir angelangt.
Das Haus, vor dem wir anhielten, wurde schnell durch einige Fackeln erleuchtet, deren Material aus dem Hausdache gezogen war. Es hatte bis auf den Eingang, der später zu schildern sein wird, nichts Besonderes an sich. Es war eine sehr große Rundhütte. Die Kerzen wurden angezündet, ich ging hinein. Es war ein dunkler Kaum, in dessen Mitte sich etwas Großes und Unkenntliches erhob; an den Wänden waren auf einem einfachen Gerüst eigenartige Gebilde aufgestellt, die erwähnten Heiligtümer, annähernd zwei Meter hohe Masken, Holzstäbe, Gewänder usw., einige gut erhalten, andere zu Staub zermodert und zerfressen, alles in allem für mich ein köstlicher ethnologischer Fund; aber wenn auch eigenartig und wunderlich, so war er auch im Stil und Wesen das gleiche charakterschwache Schnitz- und Schnörkelwerk, das uns als typisch afrikanischer Tand so oft geistesarm und geschichtslos entgegenstarrt, wenn er auch noch so viele hundert Male stilisiert ist. Ich war sehr befriedigt – als Ethnologe. Eiligst wurden alle brauchbaren Dinge herausgesucht, und schon wollte ich mich auf den Rückweg machen, ehrlich gestanden nicht nur müde, sondern auch angewidert durch einen fauligen Geruch, der im Räume herrschte, durch das überall herumfliegende Holzmehl und durch eine gewisse klebrige Feuchtigkeit. Ich wollte mich mit meiner Beute aus dem Staube machen, da fiel mir wieder das merkwürdig große, dicke Ding auf, das in der Mitte des Raumes emporragte.
Ich beleuchtete es näher. Da zeigte sich, daß genau in der Mitte ein großer, konischer oder kuppelförmiger Lehmbau errichtet war, auf dessen Spitze ein Gefäß stand, das beim Anschlagen einen merkwürdig dumpfen Ton von sich gab. Mein Begleiter machte mich auf eine kleine, nicht ganz ein Meter hohe Oeffnung in der Kuppel aufmerksam, die von Westen her in sie hineinführte. Ich hielt ein Licht hinein und sah nun, daß diese konische Kuppel über einem tiefen Schacht errichtet war, aus dem ein wenig lieblicher Duft emporstieg. Da quer in den runden Schacht Steiglatten eingelassen waren, versuchte ich ihre Tragfähigkeit und stieg hinab. Diese Kletterpartie über die fünf schlüpfrigen Latten und dann einen schrägen, vierstufigen Steigbaum hinab war um so beschwerlicher, als ich in der Hand immer das Licht tragen mußte. In 4 ½ Meter Tiefe war ich auf dem Boden angelangt und fand, daß hier nach den vier Himmelsrichtungen 5 ½ Meter lange, den Enden zu noch höher ausgeschachtete und erweiterte Stollen angelegt waren. Die ganze, fraglos in ihrer Art imposante Anlage war aus der harten, zähen Lateritmasse herausgeschlagen. Der Boden war bedeckt mit Knochen und Scherben. Die klebrige Masse an den Steighölzern war das Resultat massenhaft hinabgegossenen Opferblutes. Das Ganze war das Grab eines von Westen her ins Land hereingekommenen Fürsten, dessen Leiche ich aber unter den Knochen und Lumpen und herabgefallenen Lateritbrocken nicht aufgefunden habe. Ich muß zugeben, daß ich trotz zugebundener Nase es nicht lange ausgehalten habe und daß ich diesem Ort so schnell wie möglich, d. h. sobald ich die wichtigen Maße genommen hatte, entfloh. Ob die Behauptung meiner Begleiter, daß außer dem Fürsten selbst hier noch die Reste von Menschen bestattet wären, die seinerzeit dem toten Herrscher geopfert wurden, auf Wahrheit beruhte, konnte ich nicht feststellen. Unwahrscheinlich ist die Angabe nicht.
Soviel aber ist sicher, in diesen Ländern sind noch sehr viele ähnliche Bauten dieser Art erhalten. Die Beschreibung, die mir die Mossi von der Bestattung ihrer Kaiser und Könige gemacht haben, stimmt in begrenzter Weise mit der hier entdeckten Grabanlage überein.
Als mein Assistent Martius 1912 nach meiner Abreise die Expeditionsleitung übernahm und von Borgu- und Bussaleuten Erkundigungen einzog, erhielt ich die Beschreibung von Gräbern, die ganz genau der Anlage der sogenannten Gurmafürsten im Voltatal entsprechen.
Ganz ähnliche Grabanlagen waren vordem im Nupeland üblich. Früher gab es dort mächtige Totenhöhlen. Sie sind verfallen, aber die Alten der heutigen Zeit haben sie noch gesehen und waren noch darin, als sie jung waren. Im Kaba-Bunugebiete soll es heute noch einige geben, in die man hinabsteigen kann. Schon in Ibadan hörte ich davon, und später ward mir oft davon berichtet. Auch in Mokwa wissen sie von mehreren solcher Begräbnishöhlen. Eine lag da, wo früher der Fürstenpalast stand und heute die Schule errichtet ist. Wenige hundert Meter hinter ihr ist die geweihte Stelle. Die Höhle selbst ist vor ungefähr sechzig bis siebzig Jahren eingestürzt. Sie war unterirdisch. Man betrat sie durch ein großes, rundes Eingangsloch; von ihm zweigte sich nach zwei Seiten ein etwa mannshoher Stollen ab, der den Beschreibungen zufolge drei bis vier Meter breit war. In dem linken Stollen fanden die männlichen, in dem rechten die weiblichen Leichen angesehener Leute Aufnahme. Die Leichen wurden zu dieser Aufbewahrung sehr fest mit großen Mengen breiten Baumwollbandes umwickelt, so daß sie steif und fest waren wie Mumien. So wurden sie dann gegen die Wand gelehnt. Nur den allerangesehensten männlichen Leichen hängte man eine Nupe-Tobe um. Damit die Leichen nicht seitwärts umsinken konnten, war für den Kopf einer jeden eine Höhlung in die Wand geschnitten, in der er ruhte. So standen die Leichen oft Monate, ja angeblich Jahre, aufrecht, bis sie zuletzt innerlich ganz zerfallen waren und nun trotz der festen Umwicklung als Knochenhaufen zusammenstürzten. Die Alten meinen, daß in jedem Stollen dieser Leichenhöhle wohl fünfzig Verstorbene aufgebahrt worden seien. Es hat nach Aussage der Leute, die sie noch gesehen haben, von solcher Art Grabbauten viele gegeben. Nur sehr angesehene und vornehme Leute fanden darin Aufnahme; gewöhnliche Sterbliche wurden dagegen im eigenen Gehöft bestattet. Die Sitte derartiger Bestattung in künstlichen Höhlen reicht bis auf die Zeit vor Egidi zurück. (Siehe das Kapitel über die Geschichte der Nupe!)
Ganz ähnliche Bauten errichteten fernerhin vordem die Boß-Sorokoi. Bei Mopti, am Niger oberhalb Timbuktus, vereinigte ich 1908 eine größere Anzahl alter Herren dieses Volkes und besprach mit diesen unter anderem auch die alten Bestattungssitten. Ueber die wunderlichen, archaischen Gebräuche, die auch heute noch in diesem Lande geübt werden, etwas zu erfahren, war sehr schwer, da der Islam hier emsig bemüht ist, das Heidentum auszurotten. Zum Schluß gelang es aber doch, das Vertrauen der alten Herren zu gewinnen, ihre Scheu zu überwinden und sie zu bewegen, ihre Geheimnisse zu öffnen und mich in die Mysterien der alten, komplizierten Geheimbünde (vgl. »westafrikanische Kulturtypen«, 1912) und Traditionen einzuweihen.
Und dann zeigten sie mir eines Tages so ein Grab, dessen Eingang die Opferstellen noch erkennen ließ, so daß ich einen Einblick gewinnen konnte. Der Bau verriet folgendes:
Ist in dem heidnischen Gebiete dieses alten königlichen Landes ein Fürst gestorben, so wird in einer Entfernung von zehn Meter von Osten und Westen her unter die Hütte, in der der Verstorbene aufgebahrt wird, ein Gang schräg nach unten geführt. Breite und Höhe dieses Stollens belaufen sich auf etwa zwei Meter, die Länge von dem Eingang bis zur Mitte auf etwa zwölf Meter; die Eingangsöffnung wird etwa vier Meter weit mit Borassuspfeilern und einem Borassuslager abgesteift, so daß die Enden des Ganges nicht einstürzen können. Vor allen Dingen wird aber genau unter der Hütte, in der der Fürst verstorben ist und aufgebahrt liegt, also da, wo die beiden Gänge von Osten und Westen aus zusammenstoßen, eine Kuppelhalle ausgeschachtet und ihre Wölbung in Form eines Weidenkorbes durch horizontale Ringe und Vertikalrippen gebildet, dazu mit Matten und Stroh gefüttert. Zum ganzen Bau werden etwa zweihundertfünfzig bis dreihundert Menschen verwandt, von denen etwa hundertfünfzig Holz schlagen, fünfzig flechten und binden und fünfzig weitere Erdarbeiten ausführen.
Die Leiche wird mittlerweile durch Hochziehen der Knie und Festbinden der Arme in eine möglichst raumsparende Form gebracht, wird mit vielem Stoff umhüllt und dann in eine Urne gesetzt, die etwa hundertfünfundsiebzig Zentimeter hoch und hundertfünfzig Zentimeter breit ist. In dieser Urne wird der Leichnam dann durch den Zugang in die unterirdische Höhle gebracht und in der Mitte so aufgebahrt, daß sein Antlitz nach Westen gerichtet ist. Um den Steintopf mit seinem vornehmen Inhalt werden vier Leuchter, je einer nach jeder Himmelsrichtung, aufgestellt und, sobald der Fürst gebettet und alles hergerichtet ist, entzündet. Weiterhin werden aufgestellt: Duo, d. h. Getränke in kleinen und großen Gefäßen, allerhand Speisen und Korn in verschiedenen Behältern. War es ein kriegerisches Oberhaupt, das hier seine letzte Ruhestätte gefunden hat, so wurden Bogen und Pfeile sowie sein Fliegenwedel mit in die Grabkammer gelegt. Vor allen Dingen begleitete jeden Fürsten seine meistgeliebte Frau. Sie wurde lebendig mit in die Grabkammer gebracht und darin für immer eingeschlossen. Man brauchte niemals eine Frau hierzu zu zwingen, denn eine jede erfüllte das Gesetz herzlich gern und war froh, nicht von dem Geliebten getrennt zu werden.
In der Grabhütte, über der Kammer, in der der Tote zuerst aufgebahrt lag, stellte man eine kurze Tonröhre oder Tonsäule auf. Sie wurde genau da errichtet, wo unten der Kopf in der eigentlichen Leichenkammer lag. Ferner zog man von der Grabhütte nach Norden und Süden je einen Graben. Diese mündeten nicht in die Grabkammer, sondern dienten nur dem Zwecke, Reservelebensmittel in Krügen, Schalen, dazu auch sonstige Gebrauchsgegenstände, wie Tabakspfeifen, Wasserkrüge, ja, auch sogar Brennholz aufzunehmen. Diese Sachen waren bestimmt, den Toten zu erfreuen und zu erfrischen, wenn das, was direkt in der Grabkammer war, verbraucht wäre. Und das Brennholz sollte in den kalten Zeiten die Möglichkeit bieten, erwärmendes Feuer zu entzünden. War das alles derart fertig zubereitet, so schloß man den Ost- und Westgang im Innern mit starken Lattenstücken und warf Erde darauf. Auch schüttete man den Nord- und Südgraben zu.
So also sind diese alten Bauwerke beschaffen, die noch jetzt die Eingeborenen des Nigerbogens für ihre verstorbenen Herrscher herrichten. Es sind wirklich bedeutende Bauten, klein und unscheinbar erscheinen sie aber im Vergleich zu jenen eminenten Grabanlagen, von denen ich im folgenden einen Rekonstruktionsversuch geben will, und deren Ausführung noch vor einem Jahrtausend gebräuchlich war.
*
In den Gebieten zwischen dem unteren Senegal und dem nördlichen Haussa, also auf dem dreizehnten bis achtzehnten Grad nördlicher Breite, sieht der Wanderer vielfach aus schwach gelbem und sandigem Boden rote Hügel aufsteigen, die, wie mich deucht, auf jeden Beschauer den Eindruck des Fremdartigen, Künstlichen und Naturfremden machen müssen. Im Westen liegen wohl die äußersten Vorposten bei den Dörfern Padalali und Djinsa, also zwischen Matam und Bakel, in der Landschaft Toro, nahe dem Senegal. Am dichtesten gruppiert sind sie an den Uferlandschaften des mittleren Niger. Nach Osten zu kommen als äußerste bislang feststellbare Beispiele die im Sindergebiet erhaltenen in Betracht. Ich bin aber überzeugt, daß man Vertreter dieser Bauweise noch weiter nach Osten hin wird feststellen können. Die Größe dieser Rotköpfe schwankt bedeutend. Von 5,5 Meter Höhe und 22 Meter Basisdurchmesser steigt sie auf 23,25 Meter Höhe und 221,50 Meter Fußbreite; im Mittelmaße aber halten die meisten bei ca. 12 Meter Höhe 40 Meter Sohlenbreite.
Diese eigenartigen Rotköpfe sind, wie jeder ältere Eingeborene, wenn er erst zum Sprechen gebracht ist, versichert, alte Königsgräber. Und wenn wir das auch nicht von den Leuten selbst hören würden, wenn uns das auch nicht der erste Eindruck verraten würde, so brauchten wir nur bei dem alten arabischen Reisenden El Bekri, der um 1050 diese Gegenden besucht hat, nachzuschlagen, um uns von der Tatsache zu überzeugen. Nach den Angaben dieses ausgezeichneten Forschers haben die Eingeborenen dieser Länder die verstorbenen Könige vordem in großen Kuppelbauten beigesetzt, die mit einer Erddecke eingehüllt und so unter einem großen Erdhügel verborgen wurden, aus dessen Innerm ein Gang nach außen führte; durch den Gang wurden Opfer, und zwar Menschenopfer und berauschende Getränke, dem Toten dargebracht. Dieses sind die Monumente, von denen wir jetzt sprechen wollen. Die Franzosen, die, zuerst auf sie aufmerksam gemacht, als erste einige Grabstiche in sie hineingestoßen haben, eröffneten der wissenschaftlichen Welt zwar den ersten Einblick in vorislamitische Tiefe; sie haben diese Forschung aber nicht so weit betrieben, daß wir heute nach Anlage und Wissen schon näher über sie unterrichtet wären. Fünf dieser Tumuli im französischen und englischen Gebiete sind bereits von Europäern aufgeschnitten worden, aber etwas Erschöpfendes ist bisher darüber nicht veröffentlicht worden. Abgesehen von der Möglichkeit, die aufgeschnittenen Bauten an den Schnittflächen zu untersuchen, hat nun jedoch bei einigen auch die Natur ihre eingreifende Wirkung walten lassen, hat durch Wind, Hitze und Kälte die Oberfläche aufgerissen, das Innere gelockert und durch Regengüsse manchen Gang abgespült, so daß es heute schon möglich ist, eine Rekonstruktion zu wagen. Abgesehen von dem Tatsachenbestand, den der Forscher an Ort und Stelle findet, kann er sich fernerhin auch auf das Gedächtnis und die Aussagen der Eingeborenen stützen, die ihrerseits in Traditionen noch reichlich Nachrichten über die Bauwerke und ihre Herstellung bieten, da sie in ihren Gesängen die Erinnerung an ihre Errichtung gewahrt haben. Es geht aus allem ganz deutlich hervor, daß es einstens noch verschiedene Arten solcher Tumulusbauten gegeben hat:
1. eine kleine Art, deren Erdkopf über einer unter der Erde gelegenen Grabhütte errichtet war;
2. einen mittleren Typus, bei dem zwei Räume, ein unterer als Leichenkammer unter der gewachsenen Erde und ein oberer als Opferraum unter dem aufgeschütteten Tumulus, angelegt waren;
3. ganz besonders große Anlagen, die außer dem König noch viele angesehene Männer nach bestimmten Anordnungen in größeren Räumen aufnahmen.
Der wichtigste Typus scheint mir der mittlere zu sein, und ihn habe ich auch nach eingehenden Ausmessungen des von Desplagnes durchschnittenen Grabbaues von Ualedji, nach den abgeschlemmten Resten des Tumulus von Gjiggi, nach dem durch einen Nigerarm zerschnittenen kleinen Tumulus von Tendirma, nach den Guallaresten und nach Erkundigungen bei Eingeborenen zu rekonstruieren versucht.
Da es sich hier darum handelt, zum ersten Male einen größeren Monumentalbau des vorgeschichtlichen Negerafrika wiederherzustellen, so wurde keine Mühe gescheut, die Aufgabe so sorgfältig wie nur möglich zu erledigen. Unklar ist mir im wesentlichen nur die Konstruktion der oberen Opferkuppel geblieben.
Ich will versuchen, die Herstellung eines solchen Werkes zu schildern: Von Osten und Westen wurden Gänge unter die Erde geführt und da, wo sie aufeinander stießen, die Galerie zu einem im Grundriß ovalen Kuppelbau erweitert. Die Kuppel wurde mit Borassuspalmholz ausgekleidet und versteift. Diese tiefgelegene untere Kuppel barg den Toten mitsamt allerlei Beigaben. Zumeist wurde außer dem Herrscher noch ein weiteres lebendiges Opfer hier untergebracht. Und zwar schwankt die Angabe zwischen einem und vier Menschen. Der Ostgang wurde anscheinend wieder verschüttet, der Westgang dagegen mit Bohlen zugedeckt und alljährlich geöffnet, um neue Opfer aufzunehmen. Genau über der eigentlichen Grabkuppel wurde dann auf ebener Erde eine zweite, sehr starke Kuppel errichtet, in die von Westen her ein gedeckter Gang führte. Diese Kuppel mitsamt dem Gange wurde aus schweren Borassusstämmen erbaut, mit Erde überdeckt und über ihr der Tumulus errichtet.
Es gibt unter den Songai-Fari Makas ein altes Lied, welches auf Begräbnisfesten gesungen wurde und uns schildert, wie die oberirdische Opferkuppel zum Tumulus ausgebaut wurde. Der Text lautet:
Der verstorbene König liegt unter der Erde.
Der Strom weint. – – – – – – –
– – – – – – – – – – – –
Wir haben über der Erde dies Haus gebaut,
Wir haben das Haus mit Erde gedeckt,
Wir haben die Erde mit Füßen getreten, und die Frauen haben sie mit Holz geschlagen;
Wir haben Ochsen getötet und das Blut über die Erde gegossen;
Die Frauen haben die blutige Erde geschlagen;
Wir haben Stroh und Holz herbeigetragen;
Wir haben über der Erde ein Feuer gemacht.
Wir haben die Asche weggetragen.
Wir haben Erde herbeigetragen.
Wir haben die Erde mit Füßen getreten – –
usw. usw.
Also schichtweise wurde das Werk ausgeführt. Eine Decke ward über die andere gelegt, mit Rinderblut besprengt, festgeschlagen und mit Feuer gehärtet. In der Tat kann man an einzelnen Stellen die Rotköpfe »abblättern« sehen, wie einen in den Tropen sich schälenden Granitblock. Danach zog man noch einen Ringgraben um den ganzen Bau und legte eine ihn reinigende Entwässerung an, die anscheinend nach Osten geführt ward. Man deckte den Zugang nach der eigentlichen Grabstätte mit horizontal verlegten Bohlen, die nur einmal im Jahre geöffnet wurden, damit das herbstliche Opfer hineingestoßen werden konnte. Im übrigen aber verkehrten die Priester mit dem Toten im oberen Gemache, in das man durch den geschützten Gang zu ebener Erde gelangen konnte.
In tiefer Ehrfurcht und nur ungern erzählen die Leute die Sagen, die das Volksgedächtnis um diese Bauten gesponnen hat.
*
Ich fragte vorhin, welche Art von Urkunden und ob überhaupt irgendwelche Monumente irgendwelcher Art in Negerafrika erhalten sein dürften. Dann habe ich die monumentalen Pyramiden der Songai geschildert, und der Leser wird meinen, ich würde jetzt ausrufen wollen: »Seht, das sind die Monumentalbauten!« – Doch nicht so! Gewiß sind dies Monumentalbauten. Ich habe aber nebenher noch ein anderes historisches Baumaterial geschildert und erwähnt, das als ein vielgewaltigeres Monument der Vergangenheit in die Jetztzeit hineinreicht denn Pyramiden und Erz und Stein und Schrift: das ist das Gedächtnis der Menschen, die noch nicht die Schrift kennen, oder die noch nicht durch allzu intensive Ausnutzung des Schreibens diese Gedächtnisarchive zerstört haben!
Auch an den Meeresgestaden Nordeuropas trifft der Wanderer hier und da kleine Hügel und landschaftliche Unebenheiten, von denen die naiven Bewohner des Landes ebenso mit Ehrfurcht sprechen wie die Bauern des Nigerstromes von den ihren. Die nordischen Bauern erzählen, es sei da und da ein König im Wagen unter die Erde gefahren. Die Städter, als sie in früheren Jahrzehnten das hörten, lachten darüber, aber die Bauern hielten in ihrer zähen Weise daran fest. Man brach hier und da solche erhabenen Stellen auf, erst wohl nur gelegentlich, wenn die Unebenheit einem Schienenstrange weichen mußte, später aber wohl auch planmäßig und absichtlich. Der Städter hatte über den märchenhaft glaubensstarken Eingeborenen erst gelacht. Dann aber war er doch ernst geworden: Der Glaube des Bauern war kein Aberglaube gewesen; das Grab eines Altherrlichen, Hochedlen war zutage gelegt, ein kleiner Wagen daneben gefunden worden. Das Beispiel hat sich wiederholt. An zwei Jahrtausende lang hatte die Erinnerung sich im Kopfe des Bauern erhalten. Kriegsstürme und wilde Zeiten waren darüber hingebraust, und in langen Perioden lieblichen Friedens hatten die Hacken jahraus jahrein ihre Furchen darüber gezogen und schwere Kornähren darüber ihre Häupter gewiegt. Generationen über Generationen waren über sie hinweggegangen, die Kunst der Schrift war aufgekommen, und unendliche Mengen beschreibender Chroniken waren in den benachbarten Städten geschrieben, gedruckt, verkommen und verschollen. Mancher mit Schrift bemeißelte Grabstein war auch auf jüngerem Kirchhof inzwischen von Efeu zersprengt und vernichtet. Aber das Wissen im Kopfe der Menschheit war geblieben, fast zwei Jahrtausende lang.
So göttlich und gewaltig beschaffen ist das Gedächtnis jener Menschen, die noch jenseits der Schrift leben. Beispiele aus dem Norden kennt jeder Altertumsforscher. Niemand aber hätte dem tropischen, heißen, schnellebigen Negerafrika gleiche monumentale Gedächtniskraft zugetraut. Fast die tausend Jahre lang ist keine Lateritpyramide mehr errichtet worden, aber alte Leute kennen noch das Lied, das beim Schichtbau, Lehmschlag und Schichtbrand von den hundert und aberhundert Werkleuten gesungen wurde. Leser, schlage nochmals die Blätter auf, mit denen ich dieses erste Kapitel eingeleitet und auf denen ich jene Zeilen wiederholt habe, die mir im Anfange meiner Arbeit vor zwei Jahrzehnten entgegenflatterten. Fast ein Jahrhundert gehörte dazu, die geographische Gestaltung dieses Erdteiles, die Gliederung seiner Flüsse, seiner Berge und Seen kennen zu lernen. Was Wunder, daß das Menschliche, das ein Goethe und ein Karl Ritter als das für den Menschen wesentlichste bezeichnet haben, hier noch lange rätselhaft bleiben mußte! Leser, dieses Buch soll die Mittel und Wege zeigen, mit denen und auf denen wir in dieser Zeit gingen und danach strebten, der Lösung der Rätsel dieses Erdteiles näher zu kommen. Gleich dem Indianer, der den Kriegspfad wandelt, haben wir uns immer wieder auf den Boden geworfen, haben unser Ohr gegen die harte Erde gedrückt und gelauscht, ob etwa in der Ferne die Tritte der Menschen der Vergangenheit verklingen. Wie die Schatzgräber haben wir unsere Hämmer überall gegen die harte, formlose Oberschicht geschlagen, um zu vernehmen, wo im tieferen Grunde etwa ein schatzbergender Hohlraum verborgen liege. Wir haben die Erde aufgebrochen, sind in die Tiefe gestiegen; alte Paläste, alte Erzminen, alte Werkstätten haben wir zutage gefördert. Jedem zugänglichen Trieb des Menschentums suchten wir nachzuspüren und vor allem die Grundzüge jenes gewaltigsten Monumentes der Menschheit aufzudecken, das im Gedächtnis dieser sogenannten Barbaren wie auf Felsen aufgebaut ist.
Auch wir haben nicht immer Glück gehabt. John und James spielen in dieser Entdeckungsgeschichte eine wichtige Rolle. Die brutal barbarischen Figuren dieser bald in kannibalischen, bald in phlegmatischen Lebenssitten sich wohlfühlenden Menschen versteckten und verheimlichten sorgsam die feineren Materien älterer Kulturperioden. Und die Vertreter der Anschauung Seite 1 und 2 (»Und Afrika sprach.« I.) haben uns die Arbeit oft auch nicht leichter gemacht; mancher grobe Holzklotz, von Europa aus wohlgezielt, flog uns zwischen die Beine, um uns aufzuhalten. Wir sind oft enttäuscht gewesen, nie aber entmutigt worden, und sind unsere Wege nach Atlantis und Aethiopien und weiter, immer weiter gegangen.
Dieses erste Kapitel mag bunt und kraus erscheinen, vielleicht aber, daß doch mehr Sinn darin ist, als dem flüchtigen Leser scheint. Immerhin verspreche ich feierlich, daß ich die Zickzackzüge meines Gedankenganges hier nicht weiter aufdrängen will, sondern von nun an in der üblichen schildernden Schrittweise den Weg entlang führen und alle Ereignisse und Funde, soweit sie mir bedeutend genug und auch zeitgemäß erscheinen, vorführen will. Ich will die romantisch-pittoreske Eigenart unseres Lebens und unserer Funde, soweit wie möglich, sachlich und ohne Voreingenommenheit schildern. Wenn ich dabei aber weniger vom drohenden Tode und sterbenden Menschen als von toter und sterbender Kultur spreche, weniger auf unsere mannigfachen Abenteuer und poetische Naturschilderungen als auf schildernde Naturpoesie und große Vergangenheit der alten Bewohner jener durchzogenen Länder eingehe, so geschieht das, weil wir eben nicht mehr die romanhafte Vortragsweise gewohnt sind, wie sie einst üblich war, als noch Herodot und andere über die Hyperboreer und Amazonen und Plato über Atlantis schrieben. Wenn wir von Amazonen und Atlantis sprechen, so geschieht das in völlig verschiedenem Sinne, wenn wir auch den Gedanken des Unterganges einer Welt beibehalten.
Denn das ist wahr: Ich spreche hier von einer untergegangenen Welt! Ich zeigte, wie die Songai heute noch im kleinen die Gräber der großen Zeit nachahmen. Die große Vergangenheit schlummert in Trümmern unter der Erde, verklärt aber in der Erinnerung der Menschen unter der Sonne. Das sei ein Beispiel. Die gewaltigsten Funde aber – – –