
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Aus: »Im Schatten des Kongostaates. Bericht über den Verlauf der ersten Reisen der D. I. A. F. E. von 1904 bis 1906« etc. Berlin 1907. Druck und Verlag von Georg Reimer. S. 78 bis 102; 100 bis 108, 352 bis 361. – Die ersten zwei Stücke aus den ersten Monaten des Lebens und Beobachtens unter den Stämmen am Kuitu. Mitschakila war unser am Strom gelegener Stationsposten, Mignon der belgische Leiter desselben, Hans Martin Lemme ein Zeichner und Maler, mein Expeditionsassistent. – Das dritte Stück aus dem späteren Marsch durch das Bakubagebiet.
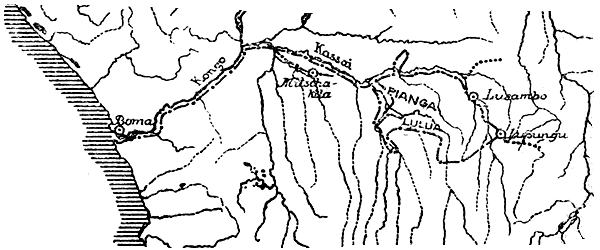
Abb. 1. Kartenskizze zur ersten Reise
(Erste Reise)
Die erste Reise (1904 bis 1906) führte durch das Kassai- und Kongobecken. An ihrer Finanzierung beteiligten sich die Karl-Ritter-Stiftung in Berlin, die Rudolf-Virchow-Stiftung in Berlin und das Museum für Völkerkunde in Hamburg. Die speziellen Berater dieser Unternehmung waren der frühere Gouverneur Hermann von Wißmann und der Geograph Geheimrat Prof. Dr. v. Richthofen. Es gelang der Expedition, außer weitreichenden ethnographischen Ergebnissen neue Belege der alten Bakubakunst aufzufinden und im Kongogebiet wichtige Ausstrahlungen aus der Gegend des sogenannten Ophir in Südostafrika festzustellen. Anmkg. des Institutes.
(1905.)
1. Steppen- und Waldvölker. 2. Studien und Beobachtungen über die Arbeit der Eingeborenen des Kongogebietes. 3. Tätigkeit des werdenden Ethnologen; besonders das ethnologische Sammeln.
Mit der Heimkehr von Belo nimmt gewissermaßen ein neuer Abschnitt im Mitschakilaleben seinen Anfang. Habe ich mich bisher vor allen Dingen den ersten Eindrücken, der Gewinnung einer allgemeinen Uebersicht über das Tatsächliche gewidmet, so beginne ich nunmehr eine Feststellung des Gewonnenen und des noch Mangelnden. Jetzt darf es mit Reisen, Aufzeichnen und Malen nicht mehr ins Blaue hineingehen, sondern nun gilt's einen Schlachtplan.
Demnach beraume ich eine Ruhepause an und beschließe in dem kommenden Zeitabschnitt – wir rechnen diese Zeitabschnitte nicht nach Wochen, sondern nach der Ankunft der »Marie«, die etwa alle zehn Tage kommt –, daheim zu wirken und nur einen zweitägigen Abstecher nach Wamba, das am Koenge liegen soll, zu unternehmen. Nachher wollen wir gen Madima zum Kantscha marschieren.
Ich beginne, sobald mir die briefeheischende »Marie« Zeit läßt, mit der Reinzeichnung – »rein« ist lediglich relativ, nicht absolut zu verstehen – meiner Routen, entwerfe mir ein Bild der Gegend und stelle fest, daß meine Ansichten über die Lage der Stationen und den Lauf der Flüsse mit der Kartenskizze der Kompanie nicht ganz in Einklang zu bringen sind. Das geographische Bild wird stets die Grundlage der völkerkundlichen Reiseerfolge sein. Mir ist in diesen Tagen mehrfach der Gedanke durch den Kopf gegangen, daß das Fiasko der Bastianischen Ethnologie auf das Ignorieren des Tatbestandes in geographischer Hinsicht zurückzuführen ist. Gerade der philosophierende Ethnologe verliert sich so sehr, sehr leicht in seinen eigenen Spekulationen, daß er oft froh sein kann, am Seile der erdkundlichen Erkenntnis den Weg aus dem Labyrinth herauszufinden. Und ich selbst habe das in diesen Tagen wieder deutlich gesehen.
Nunmehr vermochte ich erst die wunderliche Verbreitung der verschiedenen Bogentypen wahrzunehmen. Dabei drängte sich mir die Tatsache der Bedeutung der Wälder und Büsche nach zwei Richtungen hin auf: der Wald als Schutzwall alten Kulturgutes und der Wald als Heimstätte der Unliebenswürdigkeiten.
Was die zweite Eigenschaft der Waldwirkung anbelangt, die Züchtung der Unliebenswürdigkeit, so erhalte ich hier durch den Verlauf der Kolonisationsgeschichte und durch eigene Erfahrung die schönste Erklärung. Es ist fast immer im Busche, wenn der Neger mit seinem Pfeil nach einem eindringenden Fremdling schießt, selten im Dorfe und fast nie in der Savanne, die sowieso häufig durch Brände gelichtet und damit für den Bogenkampf wenig tauglich ist. Im Busch ist man jedem Pfeilschuß, ohne selbst die Offensive ergreifen zu können, machtlos und zur Untätigkeit verurteilt, ausgesetzt.
Diese Erscheinung ist sehr leicht zu verstehen. Ich habe später die Neger beim Bogenschießen im Busch beobachtet und habe selbst Versuche mit Speerwerfen und Bogenschießen gemacht. Und heute, nachdem ich auch auf den Steppen des Südens und Ostens und im Sankurugebiet meine Erfahrungen gemacht habe, heute bin ich geneigt, im Bogenkampfe, im Buschleben die ursächlichen Erziehungsmomente zu suchen, die den heutigen Negercharakter des Westens hervorgerufen haben.
Der Busch, der Wald ist das gegebene Gelände für den »Nahkampf« mit dem Bogen. Auf den schmalen Wegen können nie große Massen marschieren. Wohl kann sich aber der den Feind Erwartende sehr leicht mit guter Deckung am Wege verstecken. Man kann im Busch nur auf dem Wege vorrücken. Der Wartende kann also genau sagen: »Da muß der Feind kommen!« und ohne auffällige Bewegung mit dem allerlängsten Bogen fast unbemerkt einen Pfeil nach dem andern schießen. Den Abschuß hört man kaum, und aus dem Einfall kann man nie genau auf die Abschußstelle schließen. Die Armbewegung der Pfeilschützen ist so gering, daß der Busch nicht hindert. Dagegen ist der Speerwurf, wegen des Armausholens und der dies hindernden Aeste und Ranken, fast unmöglich. Der nach vorn schauende Speerwerfer wird dadurch behindert, daß beim Rückwärtsausholen Speer und Hand in Busch und Rankenwerk geraten und sich so verfangen. So ist denn jedes Dorf der echten Westneger nach Möglichkeit in den dichten Busch gelegt. Und die Gewandtheit im Deckungsuchen und Deckungfinden bildet eine Grundeigenschaft dieser Menschen.
Das »Sichdecken« zieht sich wie ein roter Faden durch das Geistesleben der »Schwarzen« in Westafrika. Man sieht es nicht nur im Kampfe, es kommt überall zum Vorschein. Der Neger verschanzt sich stets hinter einer Lüge, wenn es auch gar nicht nötig ist. In keinem Sprachausdruck tritt offener Mut zutage. Ein Milonga ist so gewissermaßen ein Busch-Bogenkampf in der Versammlungshalle. Geschmeidig, wie er sich im Busch hinwindet, drückt der Neger sich auch im Wortstreit hinter jede mögliche Deckung. Er ist darin dem Europäer ungemein überlegen.
Wie ganz anders die Speervölker. Als Extrem stelle ich den zersplitterten schwarzen Bogenstämmen das Heer der »Speerregimenter« des Zulufürsten gegenüber. Ich habe die Steppe und die Steppenmenschen später sehr gut kennen gelernt; kein Ethno- und Anthropograph, der die Gegensätze gesehen hat, würde es wagen, von einer Banturasse, von der Gleichheit der Rasse, die diese beiden Typen verbinden soll und die nur auf die Tatsache der Sprachverwandtschaft begründet ist, in Bild oder Wort zu reden.
Die wahre Steppe bietet wenig Deckung. Drängt der Wald die Siedelung zusammen, so verlockt die Steppe zur Ausstreuung der Gehöfte. Der Schuß mit dem afrikanischen Bogen, der doch nur auf dreißig bis fünfzig Meter wirkt, verliert hier seine Bedeutung. Aus dem Versteck heraus ist der Krieg nicht zu gewinnen, wenn der Hinterhalt auch noch so oft gesucht wird. Unwillkürlich rücken die Massen gegeneinander, weil das Ausschwärmen über den Weg sich von selbst ergibt. Stehen die Feinde dann einander gegenüber, so heißt es Mann an Mann, Speere heraus!
Es ist so typisch: bei diesen Steppenvölkern, die im Kriege den Speer führen, finden wir den Zweikampf, bei den Westvölkern des Waldes die Entscheidung durch den Gifttrank. Der offene, freie Blick ist das Ergebnis des Steppenlebens, unliebenswürdige Verschlossenheit das Symptom der Wald- und Buschmenschen. Das sind die Extreme, zwischen denen eine Unzahl von Uebergängen besteht, denn von allen Seiten rücken die Steppenvölker in den Wald hinein und gehen so einen bestimmten Weg der Entwicklung.
Du aber, Ethnologe, sollst diese Entwicklungsvorgänge finden, und der Kolonialwirtschafter soll von dir erfahren, welche Bedeutung das alles für die »Eingeborenenpolitik« hat.
Die Muße zu derartigen Grübeleien habe ich in diesen Tagen gesucht und gefunden, beziehungsweise erzwungen. Sehr kam mir hierbei die gründliche Durcharbeitung der schon gewonnenen Sammlungen zu Hilfe. Allerdings machte ich dabei manche traurige Entdeckung. Einige Sachen waren schon nach wenigen Tagen durch Schimmel – aus Platzmangel sind sie hier sehr arg zusammengepfercht – verdorben, andere durch Ratten, und leider ein Korb mit sehr hübschen Sachen (innerhalb der Zeit der Beloreise) durch die weißen Ameisen verzehrt. Also Sonne und Luft! Die Boys hatten damit sehr viel Arbeit, und ihnen waren auch noch die verschiedenen Kenntnisse des Präparators beizubringen. Als Ausgleich für solchen Verdruß mag die Freude über manche, erst bei solch ruhiger Betrachtung gewürdigte Erwerbung und manche neue Erkenntnis dienen. Das ethnographische Notizbuch schwillt bei solcher Betrachtung, eine provisorisch hergestellte Kartenskizze des Landes nimmt die Eintragung einzelner Verbreitungsgebiete auf und nach einem Tage, der dem Studium der Bogen (auch hier das wichtigste Studienobjekt) gewidmet ist, beginnt es mir klar zu werden, in welcher Richtung die Lücken liegen. Einerseits muß dieser oder jener Gegenstand, der verdorben, verloren oder vergessen ist, eingeheimst werden, andererseits stellt sich die Notwendigkeit heraus, eine Wanderung nach diesem oder jenem Punkt zu unternehmen. Für Lemme beginnt ebenfalls eine neue Aera. Eine Zeitlang muß er den Pinsel zur Seite legen, um mit Bleistift und Feder eine Reihe von Stellungen der Leute bei Handhabung von allerhand Gerät festzuhalten. Da muß ich vorbereitend beobachten und dann gute Modelle finden, die nicht immer bereit sind, einer »Mukanda« (in diesem Falle »Zeichnung«) zur Grundlage zu dienen.
*
Es lag mir außerordentlich viel daran, die Arbeitsweise der Neger eingehend studieren zu können. Besonders im Hausbau mußte diese einen recht bezeichnenden Ausdruck finden. Da aber alle Arbeit im Dorfe unterbrochen und nicht fortgesetzt wird, wenn der Mundele sich häuslich niederläßt, so beschloß ich, mir in Mitschakila vor meiner eigenen Haustür einige Hütten von den Eingeborenen nach ihrem eigenen Stil bauen zu lassen. Doch zur Ausführung des Beschlusses gehörte der gute Wille des andern Teils und die edlen Herren »Wilden« zeigten mir das alsbald außerordentlich beharrlich, indem sie in schönster Opposition auf meine Wünsche einfach nicht eingingen. Schon am 23. Februar hatte Mignon in meinem Namen die Sache mit den Bajakka von Kikuanga besprochen. Es war natürlich mit »ja« geantwortet worden. Die Leute waren bereit, mir für ein großes Geschenk eine Kinsassa (eine Halle) zu bauen. Am 25. Februar konferierten wir mit Mbungu, ob er bereit wäre, etwa fünfzehn Leute bei mir anzusiedeln, mit denen ich reisen, arbeiten und bauen könnte. Auch er erklärte sich vollständig einverstanden. Und nun warte, mein Liebling!
Ich will nicht berichten, wie ich dann wöchentlich mit den Leuten gerechtet, geschmollt, gutgetan und gezürnt habe. Woche ein, Woche aus kam keiner von West, keiner von Ost. Ich ließ diese Sache nie aus dem Auge, denn sie war mir sehr, sehr wesentlich. Als ich dann meine Leute hatte, sah ich ein, wie falsch mein Vorgehen gewesen war. Zuvörderst hatte ich wirklich eine Neigung, an einen, sagen wir, wenn auch mikroskopisch kleinen Wert eines Negerversprechens zu glauben. Falsch! Falsch! Der Neger verspricht entweder aus Feigheit (weil er es nicht wagt, sich einem Hin- und Herreden, einer Ueberredung auszusetzen) oder aus Höflichkeit (um dem andern gegenüber wohlwollend zu erscheinen). An ein Halten des Versprechens glaubt hier kein Neger, auch dann nicht, wenn es ein Europäer gibt. Dabei sind die Europäer auch inkonsequent. Es hatte zum Beispiel ein Beamter längere Zeit die Gastfreundschaft Lutubis in Kinsona in Anspruch genommen und dafür ein Steinschloßgewehr versprochen und, wie ich aus guter Quelle hörte, fest zugesagt. Das Gewehr ist nie gekommen, und eine obrigkeitliche Person meinte dazu, ein solches Versprechen brauche man nicht zu halten. Natürlich kam Lutubi einmal darauf zu sprechen, als er mich besuchte. Ich fragte Mignon, und dieser bestätigte den Sachverhalt, und daß auch ihm die Sache nicht angenehm sei. Es versteht sich von selbst, daß ich darauf meinerseits Lutubi das Gewehr schenkte und ihm auseinandersetzte, daß ein Versehen vorläge, und daß Mundele immer ihre Versprechen hielten. Das machte auf den Mann einen großen Eindruck. Doch ich schweife ab.
Das zweite, worin ich falsch kalkuliert hatte, war mein Glaube hinsichtlich des Kredits, den die Europäer als solche bei den Negern haben. Das Vertrauen will erst persönlich erobert sein. Es waren nicht nur immer »Mignons« am Kuilu. Vor der Gründung der Kassaikompanie 1902 soll es hier recht bunt hergegangen sein und auch nachher ereigneten sich, wie ich später erzählen werde, Dinge, die nicht geeignet waren, das Vertrauen der Eingeborenen zu heben. Es wurde mir gar manche Schauergeschichte vorgetragen, die aber nicht hierher gehört, weil nur das uns Interessierende und genügend Belegte Aufnahme finden soll. Jedenfalls hatte ich in meiner Vertrauensseligkeit mit einer solchen Trübung des europäischen Ansehens am Kuilu ganz und gar nicht gerechnet. Als später meine Leute zur Arbeit kamen, sagten sie mir, sie hätten mich ja gar nicht kennen können und außerdem könnten sie nicht begreifen, was ich mit einem Eingeborenenhause und mit einer Kinsassa in der Station wolle. Ich war also zu eilig vorgegangen. Es gilt erst langsam Fühlung mit ihnen zu gewinnen, ehe man den Neger zur freien Arbeit erhalten und ihm ganz klar zum Verständnis bringen kann, wozu man eine Sache benötigt.
Also die Leute kamen zu meinem Hause, schauten meiner Arbeit und Lebensweise zu und beobachteten. Wir lernten uns gegenseitig mehr und mehr kennen und endlich konnte ich das Ergebnis meiner Freundschaftsbestrebungen einheimsen. Es war vor der Wambareise, just einen Monat nach meiner Ankunft in Mitschakila, daß es gelang, von einem Badingachef (dem von Ekongo) vierzehn Leute zu erhalten. Allerdings kamen sie nicht als freie Arbeiter, sondern stellten sich unter den gleichen Bedingungen mir zur Verfügung, unter denen die linksseitigen Kuiluneger als Arbeiter der Station tätig sind: sie erhielten also ihren wöchentlichen Lohn und wohnten bei uns.
Als diese Fremdlinge bei mir eingezogen waren und nach der Wambareise, die sie sogleich mit unternahmen, den Bau ihrer Badingahütte hinter meinem Hause begannen, waren just Fumu Fiote von Kivuanda und ein Chef von Kikongo zum Besuch anwesend. Ich führte sie zur Arbeitsstätte der Badinga und lachte sie nun kräftig aus. Ich sagte ihnen, daß die wilden Badinga bei mir zur Arbeit kämen, aber sie, die schon seit Jahren mit der Station in Verbindung stehenden Bajakka, blieben fort. Sie wären faul und pimbu-lo (schlecht); die wilden Badinga aber seien pimbun-do (sehr gut). Es wäre ja aber ganz natürlich, denn ich sei ja wohl ein ganz schlechter Weißer und bezahle immer alles, was ich kaufe, schlecht. Diese in gebrochenem Kuilukauderwelsch vorgetragene Rede begriffen sie sehr wohl und begriffen sie noch schneller, als Mignon ihnen dasselbe sagte. Ich ließ die Verdutzten stehen. Später fragten sie, ob sie denn, wenn die Arbeit einmal angefangen wäre, immer bei mir bleiben müßten, oder ob sie abends in ihr Dorf zurückkehren dürften. Natürlich sagte ich letzteres zu. Am nächsten Tage gingen denn auch die Bajakka in ihre Fluß- und Bachwälder und schlugen die ersten Balken. Zwei Tage später langten sie bei mir mit ihren Arbeitsgeräten und mit dem Baumaterial an. –
Und nun hatte ich während der kommenden Zeit weidlich Gelegenheit, beide Arbeitsgruppen zu beobachten, die Badinga, die bei freier Wohnung in Mitschakila und für Wochenlohn acht Stunden täglich an ihrem Häuschen schafften, und die Bajakka, die wöchentlich etwas Salz für Nahrung erhielten, auf ein entsprechendes (von mir nach Vollendung der Arbeit zu bestimmendes) Geschenk hofften und täglich in ihre Dörfer zurückkehrten, nachdem sie entweder Balken und Latten oder Gras geschnitten oder direkt am Bau der Kinsassa gearbeitet hatten. Ich konnte beide Arbeiter vom Fenster meines Zimmers aus wohl beobachten, weilte dann und wann unter ihnen und war so imstande, jede Einzelheit gewahr zu werden und die Unterschiede der Arbeitsweise festzustellen. (Auf den Seiten 148/149 gebe ich eine tabellarische Uebersicht.)
Ich vergleiche nun die verschiedene Eigenart der Arbeit. Zuvörderst sei der Hauptgegensatz verzeichnet: sahen die verpflichteten Badinga sich bei der Arbeit beobachtet, dann waren sie um so emsiger, während die freien Bajakkaarbeiter, sobald ich mich näherte, das Schaffen unterbrachen, um mich anzuschauen, mit mir zu plaudern, um ein Matabischi (Geschenk) zu erbitten usw. Man kann sagen, daß die Arbeitsverpflichtung die Badinga zu stetiger Arbeit brachte, während das Selbständigkeitsgefühl der Bajakka sie dazu verführte, zu schlendern. Die Zahlen der Arbeitsleistung, die im nachstehenden folgen sollen, sagen alles.
Die Ungleichartigkeit kommt auch in der Zeitleistung zum Ausdruck. Die Badinga arbeiteten, wie alle Stationsarbeiter, von 7½ bis 11½ und von 1½ bis 5½ Uhr, also acht Stunden. Die Bajakka kamen dagegen nie vor 8 Uhr (hatten sie doch den Weg von ca. ¾ Stunde hin zur Station zurückzulegen). Einige kamen erst um 10 Uhr. Sie arbeiteten bis ca. 3 Uhr, zuweilen etwas kürzer, zuweilen etwas länger. Dann gab es zwischendurch zu essen – macht ca. eine Stunde, so daß die Tagesleistung durchschnittlich auf ca. 5 Stunden richtig berechnet sein dürfte. Dazu kommt aber, daß die Bajakka ca. 1½ Stunde für den Weg und Transport verloren, so daß sie in der Tat doch auf 6½ Arbeitsstunden kamen.
Wie aus der Tabelle hervorgeht, hatte ich 14 Badinga, dagegen 28 Bajakka im Dienst. Die zwei Häuptlinge waren verpflichtet (je einer 14) zusammen 28 Leute, das heißt freiwillige Arbeiter, zu stellen. Diese 28 waren nie die gleichen. Bald war der eine heute zu faul, bald der andere morgen, bald war einer krank oder einer mußte zu einem Milonga. Die gleichen waren es nie. Launenhaft und ungleichmäßig äußerte sich auch hierin die gelobte Arbeit des freiwillig schaffenden Negers. Ich habe auch nach der Uhr die Arbeitsleistung verglichen. Ein unbeobachteter Mudinga brauchte im Durchschnitt (bei zehn Leuten gezählt, wie folgt: 58, 71, 60, 59, 61, 58, 63, 59, 61, 63) 61½ Sekunden, um zehn Schlingungen beim Verband der Latten zu vollziehen. Der unbeobachtete Mujakka brauchte im Durchschnitt (10 mal – 65, 67, 68, 63, 69, 68, 70, 68, 72, 69) 68 Sekunden. Der Vergleich wurde mehrmals angestellt; immer waren die Badinga schneller. Nun ging ich zu den Arbeitern hin. Die Badinga fühlten sich beobachtet, und sogleich ging die Leistung auf 57 Sekunden herauf; die Bajakka hörten auf, als ich herzutrat. Als ich nun die Bajakka verhöhnte und die Badinga lobte, da kam ein regelrechtes Wettflechten zustande, bei dem beide genau auf 52 Sekunden Zeitverbrauch herabkamen. Offenbar war also das Können und die Uebung bei beiden gleich.
Dies Lattenaufbinden war der einzige Punkt, der mir einen Vergleich gewährte. Die anderen Arbeiten waren verschieden. Ich bemerke aber wohl, daß die Badinga immer den Eindruck der Arbeit hervorriefen, während die Bajakka gewissermaßen beim Spiel blieben. Sehr typisch war das Pfahleinrammen und das Gabelholzschneiden bei den Bajakka. Es arbeiteten immer nur zwei zur Zeit und die anderen standen herum und gaben guten Rat usw. War der Pfahl eingerammt oder die Gabel geschnitten, so trat das Paar zur Seite und zwei andere schnitten an der Gabel herum oder rammten ein, wobei nun wieder alle anderen zusahen, Kolanuß kauend, Rat gebend, schwatzend, rauchend.
Badinga sowohl als Bajakka arbeiteten mit ihren eigenen Eingeborenenwerkzeugen, d. h. mit Messer, kleinem Beil und Deichsel. Das erschwert den Vergleich der europäischen Arbeit. Sicher ist, daß zwei europäische Arbeiter zum Einrammen der Pfähle und Auflegen der Balken (der Halle) nicht mehr als zwei Tage gebraucht hätten, wogegen das Verflechten des Lattenwerks sicher nicht schneller gegangen wäre. Diese Flechtarbeiten sind eben des Kuilunegers Hauptkönnen, darin ist er sehr bedeutend.
Nun folgen noch die Zahlen über die Arbeitsleistung im Gesamtbau. Die Badinga brauchten 1568 Arbeitsstunden, die Bajakka dagegen 2139, das heißt ein Viertel mehr. Nach Angabe der Badinga sowohl als der Bajakka ist das Errichten einer Halle nicht zeitraubender als das eines derartigen Pfahlbaues, dessen Wandbildung eine sehr sorgfältige Arbeit bedingt. Typisch ist aber dann, daß die Bajakka zu dieser Leistung 329, die Badinga nur 196 Arbeitstage benötigten. Endlich noch die Preisfrage. Meine Badinga erhielten einen üblichen Arbeitslohn, nämlich inklusive Ration Waren im Werte von 8 Frs. per Monat. Den Bajakka mußte ich aber das geben, was ich für Zeitengagements zahlte, wenn ich Leute für unsere Ausflüge auslohnte, das heißt per Tag etwa 0,60 Centimes in Ware. Somit kostete mich die Kinsassa 329 Arbeitstage mal 60 Centimes gleich ca. 200 Frs. und das Badingahaus 7½ Monatslohn (der Monat zu 26 Tagen gerechnet), das heißt 60 Frs. Also war das Produkt der freiwilligen Arbeit 3¼ mal so teuer wie das gleichwertige der gebundenen.
Für mich war es eine ernsthaft zu beantwortende Frage, ein Hauptproblem der Eingeborenenpolitik, inwieweit die Neger durch Entwicklung freiwilliger, ungebundener Arbeit zu einer höheren Volksarbeitsleistung, zu einer höheren Form der Selbständigkeit zu erziehen seien, und ich bin bei diesem wie bei manchem später unternommenen Experiment zu dem Schluß gekommen, daß hier nur gebundene Arbeit erzieherischen, dauernden Wert, die ungebundene aber lediglich einen vorübergehenden Wert hat. Worauf ich diese Behauptung stütze, will ich zeigen.
Wenn die ungebundene Arbeit 2139 Arbeitsstunden auf 329 Arbeitstage, die gebundene aber 1568 Stunden und 198 Arbeitstage zur gleichen Leistung benötigte, so ist damit noch nicht alles gesagt. Es war auch die Tätigkeitsenergie und das Interesse ein ganz verschiedenes. Die freiwillige, Leistung wurde ziemlich gleichmäßig wiederholt »heruntergetrödelt«; vielleicht war sie nur um die Mittagszeit noch ein klein wenig verlangsamt. Das war aber eine kaum bemerkbare Unterschiedlichkeit. Dagegen war Energie und Interesse in der gebundenen Badingaarbeit ganz außerordentlich. Morgens fingen die Burschen verhältnismäßig stumpfsinnig und traurig an. Vom »fröhlichen Zugreifen in frischer Morgenstunde« habe ich nie etwas gemerkt. Je mehr die Leute aber machten, desto schneller glitt die Tätigkeit. Im Grunde genommen ist das selbstverständlich, und wir reden selbst davon, daß aller Anfang schwer ist, und »wie beim Essen der Hunger«, so wächst »die Freude bei der Arbeit«.
Es ist das ganz natürlich, aber ich will noch darauf hinweisen, daß ich die höhere, wertvollere Begeisterung niemals bei den ungebundenen Arbeiten der Neger gemerkt habe. Der frei arbeitende Neger wird hier nur immer werken, wenn er Lust hat. Für ihn kommt der Satz »Aller Anfang ist schwer« gar nicht in Betracht, denn wenn der Anfang schwer sein könnte, wird eben nicht angefangen, und daß eine besondere Arbeitsfreudigkeit, irgend eine »Leidenschaftlichkeit« eintreten sollte, das ist bei der ungebundenen Tätigkeit auch nicht zu beobachten.
Tabellarische Darstellung der Arbeitsleistung.
Launisch und als Ausfluß des Spieltriebes wird begonnen und launisch aufgehört, wenn das schwarze große Kind müde ist.
Ganz besonders funktioniert der schwarze Neger bei der gebundenen Arbeit, die auch in ihren unbeeinflußten, altertümlichen Zuständen in der Tätigkeit der Frauen und der Sklaven, das heißt der Unfreien, üblich ist. Bei dieser kann man alle diese Symptome beobachten, die zur höheren Kulturarbeit führen, und in den durch wer weiß wie viele Generationen so erzogenen Frauen kann man sehr wohl schon die schönste Blüte der kulturellen Arbeitsform, das Pflichtgefühl, wahrnehmen.
Ist aber die Negerin so weit zu erziehen, dann ist das beim Neger auch möglich.
Die vergleichende Arbeit in Luebo brachte allerhand neue Gesichtspunkte zutage, die mich veranlaßten, noch eine Rundtour im zentralen Gebiete zu unternehmen. Ich komme hier auf das zurück, was ich schon im ersten Kapitel sagte: Es ist nämlich für unsere heutige Zeit und für unsere entsprechenden wissenschaftlichen Arbeiten nicht mehr das Wandern, die Wanderarbeit, sondern das Rasten und die Lagerarbeit ausschlaggebend. Ich habe mit großer Strenge mir selbst gegenüber den Grundsatz festgehalten: tagsüber ins Skizzenbuch, abends ins Reine. Es ist das nicht ganz leicht, und es gehört eine ziemlich bedeutende Selbstüberwindung dazu, diesem Grundsatze stets zu folgen. Im Laufe eines späteren Bandes werde ich vielleicht Gelegenheit haben, dem Leser einmal zu schildern, wie umfangreich die Tätigkeit eines Expeditionsführers unter diesen Verhältnissen zumal dann ist, wenn er durch seine Erfahrungen zu der Ueberzeugung gelangt, daß er unumgänglich notgedrungen alle expeditionstechnischen Angelegenheiten selbst regeln muß. Hat man einen durchaus praktischen Begleiter, der nicht infolge der Tropentemperatur erschlafft, dann mag es anders sein. Aber nicht nur auf der Wanderung ist diese Tätigkeit des täglichen »Insreineschreibens« notwendig, sondern es gehört von Zeit zu Zeit eine Pause im Aufnehmen und Registrieren als Ergänzung dazu. Es gilt gewissermaßen nochmals ein »Insoberreineschreiben«, es gilt, alles nochmals zu vergleichen. Erst dann kann man erwarten, daß man die Lücken in seiner Kenntnis auffindet. Das ist der Nutzen des Arbeitens während langer Lagerpausen. Ich habe es auf diese Weise zustande gebracht, daß ich meine sämtlichen Manuskripte fast druckreif mit nach Hause brachte. Es sind etwa 2700 Quartseiten, also ein schönes Stück Schreibarbeit. Ich kann aber nun auch sagen, daß ich hinsichtlich der Punkte, deren Beobachtung ich mir vorgenommen habe, wirklich verhältnismäßig lückenloses Material besitze. Ich kann diese Methode den Kollegen nicht warm genug empfehlen, und ich hoffe, daß die reichen Ergebnisse, welche ich erzielen konnte, und die im Laufe der nächsten Jahre ja das Licht der Oeffentlichkeit erblicken werden, den Beleg dafür erbringen, daß ich verhältnismäßig wenig Zeit in Afrika vergeudet habe und daß diese Arbeitsweise praktisch ist.
Jedenfalls lehrte mich derartige Konzentration und vergleichende Arbeit in Luebo erkennen, daß eine möglichst umfassende Umgrenzung der Bakuba und der Bena Lulua dringend wünschenswert sei. Die West- und Südwestländer der Bakuba hatte ich im Laufe der vergangenen Pilgerfahrt kennen, gelernt. Den Osten und Norden konnte ich während der Rückreise auf dem Sankuru von Lussambo zum Kassai umschreiben. Es fehlte also noch der Uebergang von Südosten zu den Bena-Lulualändern. Auch sagte ich mir, daß gerade hier die Bena Lulua ebenfalls sehr interessante Typen zeigen müßten. Das war der Grund, weshalb ich mich entschloß, noch einmal nach Norden zurückzugehen. Als wir am 10. November über den Luebo setzten, kam es mir fast vor wie ein »Vonvornbeginnen«. Mit aller Gewalt zog es mich nach dem Südosten zu dem Pfahlbau Bakete, Kanioka, Baluba, Bassonge, aber es war das Pflichtgefühl, welches mich veranlaßte, noch einmal nach Ibanschi die Schritte zu lenken und das Buch der Völkerkunde dieser Länder Seite für Seite zu lesen, nichts, nichts zu überspringen und mich nicht vorschnell dem letzten Abschnitt zuzuwenden. Das etwas drückende Gefühl einer gewissen Reiseunlust und Depression verstärkte sich, als ich am gleichen Abend einen höchst unnötigen Streit im Lager von Kapungu zwischen einem fremden, feindlich gesinnten Mukete und einem unserer harmlosesten Jungen zu schlichten hatte. Am anderen Tage erreichte ich Ibanschi, wo uns Herr van Cauteren und die amerikanischen Missionare einen herzlichen Empfang bereiteten und wo die Bena Buschongo der edlen Mama Lukengo sich für Sonntag zu ethnographischem Zwiegespräch bereit erklärten. Auch versprach mir die alte Fürstin die Zusendung von dreißig Trägern für den beabsichtigten Ostmarsch. Aber während sie die Zusammenkunft einhielten, vergaßen sie faulheitsgemäß das Erscheinen der Träger, und ich mußte sie dann am Montag mit Energie zu Arbeit und Pflichtgefühl anregen. Alle diese Mißstimmungen vergingen aber, als ich glücklich im ersten Piangadorfe Ibunschi eintraf.
Es zeigte sich nun, daß das Rückkehren in diese Länder und das Aufsuchen dieses Stammes durchaus lohnend sei. Die nächsten Tage, die wir unter den Pianga verbrachten, zählen zu den wertvollsten der Reise. Konnte ich doch nun das Leben in einem so recht unberührten Bakubagebiet sehen und beobachten, und es erwies sich, daß die Pianga diejenigen waren, welche noch das meiste Gut aus der alten Zeit des blühenden Kunstgewerbes besaßen. Hier verstand ich dies Kunstgewerbe auch vollkommen. Bei Ndumbi hatte ich ja schon einen tieferen Eindruck gewonnen, aber das Hasten der Leute um die »Burg« des Biengefürsten war doch allzu unruhig, um ein wirkliches und behagliches Plauderstündchen und Zwiegespräch aufkommen zu lassen.
Welche Ruhe herrschte dagegen hier in den Piangadörfern! Die langen, breiten Straßen mit den großen Häuserkästen erschienen schon als der Ausdruck der Solidität. Damals, als Wolf in das Buschongogebiet kam, war alles noch nervös vom Bürgerkriege, der vor kurzem in Ibunschi geherrscht hatte. Alles war außerdem aufgeregt, weil er doch der erste Weiße im ganzen Bakubalande war, der wie der Blitz aus heiterem Himmel hier hineinfuhr. Unsere Pianga hatten schon sehr, sehr viel von den Weißen gehört, sie waren zudem auf unser Kommen durch die Boten Lukengos vorbereitet, und nicht ein einziger Mensch machte auch nur eine unnötige Bewegung, wenn wir in einem Dorfe einzogen. In Gruppen saßen die Leute vor den Häusern oder in den merkwürdig großen Doppelfenstertüren. Sie saßen da wie die Bronzestatuen, als ginge sie das Herannahen des wunderlichen Fremdlings gar nichts an. Nur gemächlich wandten sie wohl einmal nach uns den Kopf. Erst nach einiger Zeit erhob sich unter ihnen doch das Dorfhaupt, kam mir entgegen und grüßte: er schlug mit seinen Händen gegen die Hände des Ankommenden und dann gegen die eigene Brust.
Dies Dorfoberhaupt zeigt uns eine Hütte; er weist unseren Leuten einen Teil des Dorfes an und betont dabei, daß von meinen Leuten keiner die Grenzen zum andern Dorfe überschreiten dürfe, wenn es nicht in meiner Begleitung sei. Erst wenn wir unseren Tisch und Stuhl aufgeschlagen haben und wenn wir bei einer Tasse Tee für eine halbe Stunde unseren Gliedern Ruhe gewähren, erst dann erheben sich die biederen Pfeifenraucher und kommen langsam, ganz langsam näher, betrachten uns und setzen sich wohl auch neben uns, natürlich immer mit dem Pfeifchen im Munde. Nie drängt sich die Volksmenge stürmisch und tumultuarisch heran, wie ich dies bei den Buschongo und Bienge-Bakete und, wenn auch in ganz anderer harmloser Weise, bei den Bena Lulua beobachtet habe. Wenn die Pianga nachher ihren Kram zum Kaufe herbeibringen, so entwickelt sich nie das habgierige Ueberstürzen und Hasten. Nie hat ein Pianga das Wort: »Nimm meins zuerst!« ausgesprochen, das ich sonst so häufig vernahm. Es ist, als wolle diese ernsthafte Ruhe noch belegen, daß diese Pianga einst die Herrscher, das Fürstenvolk der Bakuba waren, ehe sie ihr Amt den Buschongo abtraten.
Bei Ndumbi genügte das Vorzeigen eines Buschmessers und eines Stücks Stoff, um Kauflust zu erwecken. Die Pianga zeigten aber zunächst überhaupt keine Lust, auch nur das kleinste Stückchen meinen Sammlungen beizufügen. Sie sagten sehr einfach: »Wir haben nichts«. Und zeigte ich nun auf eine ihrer schön geschnitzten Tabakspfeifen, wie sie jedermann in der Hand hatte, so führte der Besitzer sie schleunigst hinter seinen Rücken, lachte und behauptete, es sei nicht die seine. Allerdings ist es auch ein schlechter Anfang, wenn man bei den Bakuba mit dem Gebot auf eine »Golo na Makanj«, auf eine Tabakspfeife, beginnt. Es ist sein liebstes Gerät. Alles Frauengut wird gern verkauft, aber das einzige Männergut, die Tabakspfeife, wird aufs sorgsamste gehütet. Erst wenn der Strom der Begeisterung für den Handel stärker ins Fließen geraten ist, erst dann darf man hoffen, dieses wertvolle Stück zu erwerben. – Der Handel um ethnographischen Kram ist für den Ethnologen das beste Mittel, mit den Eingeborenen gut Freund zu werden. Ich erachte den Handel in diesem Sinne direkt für unser wichtigstes Verkehrsorgan. Deswegen will ich hier einiges darüber beifügen. Ich habe diesen Punkt eingehend studiert, erst theoretisch und dann lange genug praktisch. Deswegen kann ich sehr schöne Ratschläge erteilen. Der Handel mit ethnographischem Kram ist gewissermaßen die große Landstraße, die in eine Interessengemeinschaft und zu einem Einverständnis mit dem Neger hinüberführt. Man vergesse nie, der Neger ist durchaus Materialist und Positivist schlimmster Sorte. Er fragt sich zuerst und vor allem anderen: »Was will der Fremde?« Daß der Fremde nur kommt, um das Land zu sehen, das glaubt er auf keinen Fall, denn das kann er nicht verstehen. Sagt man das zu dem Neger, so steht er dumm da, absolut dumm, und der einzige Ausweg, der ihn aus dieser Verwirrung herausführt, ist die einfache Erklärung: »Du lügst«. Er wird das ja meistenteils dem Europäer nicht sagen, aber er ist davon überzeugt. Denn der Neger sieht, daß der Europäer aus seinem Lande unendlichen Reichtum und wundervolle Sachen des praktischsten Gerätes, die zuverlässigsten Waffen, eine Ueberfülle von Kleidern usw. mit sich bringt. Und der Neger, der nie selbst etwas tut resp. durchführt, was nicht in irgend einer Weise einen Nutzen für ihn bringt (wenn auch nur einen eingebildeten), und der nur dann sich einmal der künstlerischen Regung, den Kunsttrieben, der Unterhaltungslust hingibt, wenn die Langeweile getötet werden soll oder wenn das Zusammensetzen ein behagliches Schwatzen produziert, dieser Neger wird es nie glauben, daß sich jemand der Mühe einer solchen Reise unterzieht, bloß um etwas kennen zu lernen. Also eine solche Erklärung veranlaßt den Neger nur einfach zum Mißtrauen. Nun gibt es aber ein Mittel, dieses Mißtrauen sehr schnell zu überwinden: man muß nur im Neger die Ueberzeugung erwecken, daß man etwas für sich Wertvolles aus dem Lande herausziehen will. Tuschimuni, Legendenkram und Histörchenüberlieferungen können nach seiner Ansicht unmöglich etwas Wertvolles sein, denn der Neger ist nicht gewöhnt, derartige Dinge bezahlt zu sehen. Es sind nicht reale Gegenstände. Daß der Europäer Kautschuk kauft, versteht der Neger, es ist etwas Handgreifliches. Also, lieber Ethnologe, wollen Sie sich dem Neger verständlich machen, wollen Sie sein Mißtrauen überwinden, so müssen Sie seine Ueberzeugung, daß Sie einen Nutzen aus ihm erzielen wollen, bestätigen. Es ist das sehr einfach. Sie sagen ihm, daß Sie wohl einen Nutzen dabei haben: nämlich den ethnographischen Kram, der in Europa wertvoll sei.
Das Einhandeln von ethnographischen Gegenständen bringt zudem für den Neger angenehme Empfindungen mit sich. Den Kautschukhändler schätzt der Neger an sich nicht, denn Kautschuk muß erst gewonnen werden; die Gewinnung bringt Arbeit, viel Arbeit mit sich, und Arbeit ist für ihn stets etwas Verabscheuenswürdiges. Den Elfenbeinhandel billigt der Neger dagegen, denn das Elfenbein braucht man nicht erst zu bearbeiten, das ist vorhanden. Just ebenso ist es mit dem ethnographischen Kram. Der ethnographische Kram ist ja vorhanden, er braucht nicht mehr angefertigt zu werden. Demnach werden Sie, lieber Ethnologe, dem Neger sofort sympathisch, sowie Sie ihm die Möglichkeit, Wertvolles ohne Arbeit zu verdienen, gewähren.
Also mit dem ethnographischen Handel ist des Negers Verständnis im allgemeinen immer gewonnen. Wenn nun der Weiße kommt und der Neger sieht, daß er den »Tschintu« (Sache der Eingeborenen) kaufen will, so ist er zwar etwas erstaunt, daß der Europäer, der sich viel Schöneres und Besseres machen kann, solche Dinge erstrebt, aber er billigt die Sache. Und nun ist es die zweite Frage, ob er sich auch damit befassen will. Als praktischer Händler liebt er erst ein wenig zuzusehen und nachzuprüfen, was ein anderer wohl bekommt, ehe er selber sich auf die Geschäftchen einläßt. Der Anfang ist also deshalb schwierig, weil eben immer einer darauf wartet, daß ein anderer die Probe macht. Ist der Anfang gemacht und gelingt es, die ersten Käufer zu befriedigen, so steigert sich gewöhnlich das Angebot sehr schnell und es ergreift eine gewisse Verkaufswut die Masse. Die ersten sind zögernd, alle Nachfolgenden können aber nicht eilig genug befriedigt werden. Es ist dann wie ein Furor, der über die Menge kommt. Das will ich nun etwas näher ausführen:
Es ist oft über die zu zahlenden Preise gesprochen worden und unter den Kollegenkreisen ist man merkwürdigerweise auch heute noch vielfach der Ansicht, daß der Europäer die Preise mache; es ist also noch niemals das rechte Wort gesprochen. Im ethnographischen Eingeborenenhandel ist das nicht der Fall. Wenn in diesen Ländern die Kompanie oder der Staat die Preise für den Kautschukhandel, den Elfenbeinverkehr und das Arbeiterengagement vorschreibt, so ist dies nur möglich, weil sie im Konzessionsgebiete konkurrenzlos sind und über eine Suprematie verfügen, die einem entschiedenen Absolutismus gleichkommt. Es ist eine, wenn auch im gewissen Sinne berechtigte Vergewaltigung, deswegen eine Vergewaltigung, weil der Eingeborene eigentlich für alles seine Preise hat. Ganz unwahr ist es, wenn man glaubt und behauptet, daß man mit einer Spieldose oder mit einem Regenschirm wunder was erreichen kann. Das wird als Geschenk hingenommen, aber nicht für den Handelszweck. Ich betone, daß jeder Gegenstand, von der einfachsten Kalebasse bis zum wertvollsten Speer, vom Palmbaum bis zum Stein, von der Hütte bis zum Strohbündel, seinen festen Preis hat. Es handelt sich also um die wichtige und schwierige Frage, wie man den Preis erfährt. Man kommt vielleicht mit einem Wertmesser, den der Eingeborene bisher nicht kennt, mit Kupferringen oder mit Perlen usw.; sowie aber diese Gegenstände auf den Markt gebracht sind, haben sie sofort für den Eingeborenen einen Börsenwert. Es dauert das keine fünf Minuten. Ueber den Wert bestimmt entweder der Volksgeschmack oder das Bedürfnis. Also wird die neue Ware in das System der bisherigen Werte einfach eingereiht. Meine lieben Kollegen sehen also, daß der den ethnologischen Problemen nachgehende Gelehrte in diesen Ländern auch praktisch sein und sich dem Handelsproblem zuwenden muß. Es ist kein Vergnügen, aber es muß sein. Es handelt sich dabei gar nicht darum, ob man teuer oder billig kauft, es handelt sich einfach darum, ob man es versteht, die Eingeborenen sich zugänglich zu machen, ob man den Gegenstand erhält. Dieser einfachen Frage wegen, die eine Grundfrage ist, muß sich der Ethnologe mit diesen Dingen befassen.
Um bald eine Klarheit über diese Marktverhältnisse zu erzielen, ist es das Praktischste, sich möglichst wenig selbst um die Angelegenheiten zu kümmern. Man muß Vertrauensleute unter seinen Boys haben. Die schwarzen Jungen sind intelligent genug, um schon nach wenigen Wochen zu lernen, um was es sich für den Europäer handelt. Man gehe nicht etwa selbst auf den Markt, um zu kaufen, sondern man lasse die Jungen handeln. Man werfe dann und wann ein prüfendes Auge darüber und man wird sehr bald im klaren sein, erstens, welchen Wert die Gegenstände, die man wünscht, bei den Eingeborenen haben, zweitens, welchen Wert die Eingeborenen den Gegenständen, die man ihnen bringt, zuerkennen.
Allerdings muß das Auge des Ethnologen immer darüber wachen. Er muß gewissermaßen unbeobachtet teilnehmen an den Aufkaufsgeschäften. Diese schwarzen Aufkäufer sind stets allzubereit, einen uralten und zerbrochenen Gegenstand zurückzuweisen, weil er eben nicht mehr zu benützen ist. Denn man vergesse nie, daß der Neger nicht begreifen kann, wenn wir Europäer den »Unverstand« (wie er es nennt) haben, solche Dinge einfach in den Museen aufzubewahren. Der Neger nimmt an, wir benutzen die Schminkbüchse, um unsere Schminke hinein zu tun, den Bogen, um daheim damit Krieg zu führen, die Ahnenbilder zu religiösen Zwecken usw. Demnach wird der Neger auch nie recht begreifen können, weshalb ein uralter zerbrochener Gegenstand mir wertvoller ist als ein neu hergestellter, dem überhaupt jede Spur der Benutzung fehlt.
Das Schwierige ist, wie gesagt, immer der Anfang, der Beginn eines ethnologischen Handels in einem neu erschlossenen Gebiet. Auch hierfür habe ich im Piangagebiet ein neues Rezept ersonnen. Wenn es irgend möglich ist, beginne ich damit, daß ich einen möglichst freundschaftlichen Verkehr mit den Frauen anbahne, und das gelingt bei allen weiblichen Wesen dieser Erde bekanntlich am schnellsten auf dem Wege über die Sprossen, die sich auf der Dorfstraße herumtreiben. Man schenkt einem sechsjährigen kleinen Mädchen, das hinter der Mutter hertrippelt, einige Perlen. Man schäkert mit dem Baby, das auf der Hüfte der Mutter reitet, man gibt einem kleinen Buben eine Trompete oder eine Schachtel Soldaten, das sind immer die besten Anknüpfungsmittel, in Europa wie in Afrika. Die Mütter sind dann meist gerührt. Man nähert sich den Häusern und guckt natürlich zunächst nur von außen hinein. Dann lasse man sich das eine oder das andere herausreichen, gebe es aber möglichst schnell wieder zurück. Denn aller Augen harren gespannt, ob der Weiße auch ganz ehrlich ist oder ob er den Gegenstand einfach behält. Denn jeder Eingeborenenfürst, der über großen Einfluß verfügt, nimmt seinen Leuten einfach fort, was ihm gefällt. Das fürchtet man von Europäern natürlich zunächst auch. Wenn man den ersten gesehenen Gegenstand entsprechend lobt und zurückgibt und dies dann mehrfach wiederholt, überkommt die ganze Gesellschaft eine gewisse Ruhe, das Gefühl des Vertrauens. Die Leute wissen nun schon, daß der Weiße nicht raubt. Nun frage man bei einer weiteren Sache nach dem Preise. Dieser weitere Gegenstand, mit dem man den Handel eröffnen will, darf für die Eingeborenen nun kein Wertstück sein, um alles nicht, sonst ist die Sache von vornherein verfehlt. Man muß dazu eine möglichst wertlose, und zwar stets einer Frau gehörige Sache auswählen.
Die Männer sträuben sich zunächst und meinen, für ihren einfachsten Kram Schätze erzielen zu können. Man lasse zunächst allen Männerbesitz aus dem Spiele und wähle Körbe und Töpfe oder irgendwelche Dinge, die keinen individuellen Wert besitzen, sondern zu Dutzenden auf dem Markte zu kaufen sind. Mit dem gewählten Gegenstande und der Besitzerin derselben geht man zunächst zu dem Platze, auf dem der Weiterverkauf betrieben werden soll, einem Platze, der möglichst schattig in der Nähe des Arbeitstisches des Weißen gelegen ist.
Man bezahle nun für das erste Stück nicht viel mehr, als das Ding bei den Eingeborenen wert ist; das muß man vorher durch seine schwarzen Jungen ausklügeln lassen. Aber man mache ein hübsches Geschenk und betone, daß dies Geschenk nur im Anfang gegeben wird. Sofort wird sich eine allgemeine Zufriedenheit auf die Gesichter aller Zuschauenden herabsenken. Der Augenblick ist zu benutzen, man äußert seinen Wunsch und überlasse dann den weiteren Gang der Dinge den Boys. Die Frauen geben ihre Sachen gewöhnlich den Männern, damit diese sie aushökern, und endlich kommen auch die Männer mit ihren eigenen Besitztümern heran. Natürlich gilt es, für den Ankauf der sehr schwer zu erwerbenden Ahnen- und Heiligenbilder oder gar Masken nunmehr den richtigen Moment der Verkaufslust abzupassen. Die Begeisterung steigert sich zuweilen sehr schnell und wird dann derart intensiv, daß jeder alles, was er besitzt, zu verkaufen geneigt ist. Dann flaut die Stimmung aber auch ebenso geschwind wieder ab und es greift eine »kühlere« Marktlage Platz, die nicht so leicht wieder aufgefrischt werden kann.
Lieber Kollege, der Sie dieses lesen und der Sie das vielleicht recht trocken und langweilig finden, glauben Sie mir, daß, wenn Sie Ihr vergleichendes Material mit nach Hause bringen, daß, wenn Sie eine eingehende Sammlung der vorkommenden Formen des Völkerbesitzes erzielen wollen, daß Sie dann nicht umhin können, sich dieser nicht gerade sehr angenehmen und bequemen Handelsarbeit zu unterziehen. Uebrigens ist Theorie viel leichter als Praxis und man wird unter den verschiedenen Stämmen je nach ihrer Eigenart verschieden verfahren müssen. Da ich aber der erste Jünger unserer Wissenschaft war, der mit ethnologischen Aufgaben Innerafrika aufgesucht hat, so glaube ich, daß es meine Pflicht ist, mich hierüber auszusprechen, und zwar mit Betonung der Umstände, die ich vorgefunden habe. Die Sache ist leicht ermüdend und oft sehr langweilig. Zudem ist sie anstrengend, da sie eine ständige Kontrolle der angesammelten Menschenmenge und dessen, was zum Kauf angeboten wird, beansprucht. Führt man die Arbeit aber durch, so erzielt man auch schöne Resultate. Also üben Sie sich getrost erst in der Theorie und dann in der Praxis.