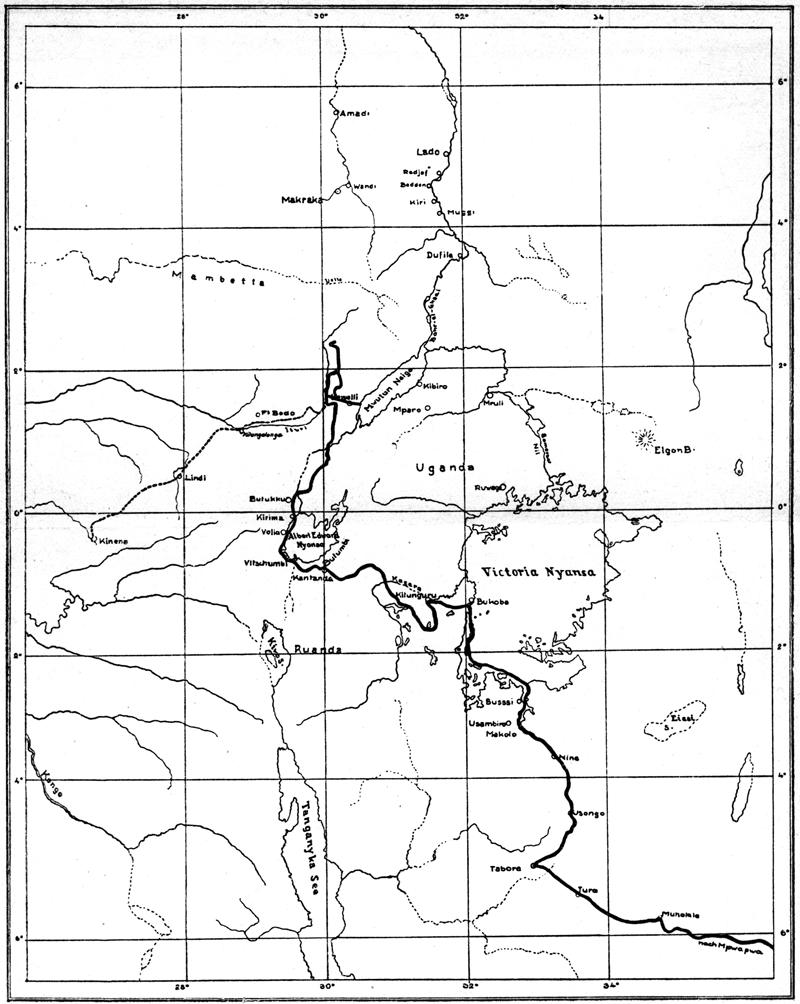|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Am 23. Oktober 1875 landete Eduard Schnitzer, ein Deutscher, in Alexandrien: mittellos, mit einer Empfehlung an Chalil-Aga, den Obereunuchen der Vizeköniginmutter, in der Tasche.
Die Heimat hatte er vierundzwanzigjährig, 1864, verlassen, mit dem Doktortitel, doch ohne das ärztliche Schlußexamen gemacht zu haben. Die folgenden elf Jahre hatte er, stets dem Augenblicke hingegeben, in türkischen Sanitäts- und Verwaltungsdiensten verbracht, in Ämtern, die schnell gewonnene Freunde zum Teil eigens für ihn geschaffen hatten; so z. B. als Quarantänearzt in Antivari.
Die Bindung an den Hausstand eines mächtigen Gönners, Ismail Hakki Pascha, mit dem er vorübergehend Ungnade und Verbannung in Trapezunt teilte, schien dem jungen Arzt bleibendes Vorwärtskommen zu sichern. Des Paschas Tod zerstörte diese Hoffnung, zugleich auch die Beziehung zu der Witwe: Schnitzer war mit ihr und den Kindern fast zwei Jahre herumgewandert, auf der Suche nach einem Erdenfleck, wo sich mit den Resten des Nachlasses, die zu standesgemäßem Leben in Stambul nicht reichten, eine Häuslichkeit gründen ließe, hatte auf dem Balkan gesucht, in Oberitalien, in Südtirol. Vergebens. Der Dame, einer geborenen Ungarin übrigens, lag allzusehr das langgewohnte orientalische Wohlleben im Sinn. Den Freund überfiel die Erkenntnis, daß er neben der schönen Vergangenheit auch seine Zukunft aufs Spiel setzte, wenn er die Beziehung aufrechterhielt: so verließ er, jäh entschlossen, die Freundin samt Kindern und Dienstboten (insgesamt zehn Personen) in Neisse, wohin er sie zum Besuche seiner eigenen Familie geführt hatte, und reiste unvermittelt allein in den Orient zurück, diesmal nach Ägypten, wohl weil ihm Konstantinopel verschlossen war.
Chalil-Aga war ein mächtiger Mann: fast augenblicks wußte er dem neuen Schützling, neben gewichtigen Empfehlungen, auch Reiseanschluß in den Sudan zu verschaffen, so daß Schnitzer schon am 3. Dezember 1875 in Chartum ankam. Die dortige europäische Kolonie bestand aus wenig Köpfen und nahm den Neuankömmling willig auf, der gründlich gebildet, hochmusikalisch und ein erfreulicher Gesellschafter war. Bei dem Leutemangel in der in Bildung begriffenen Provinz konnte es nicht fehlen, daß eine geschickte Erwähnung bei Gordon Pascha, dem Allgewaltigen, die Anstellung Schnitzers zur Folge hatte.
Anfangs Mai 1876 traf Schnitzer in Ladò, dem Hauptort der Äquatorialprovinz, ein, als Ersatzmann für einen Kairenser Arzt Emin Effendi, dessen Namen er mit dem Amte übernahm.
Knapp zehn Jahre später hallte Europa, hallte die ganze weiße Welt von dem Klange dieses angenommenen Namens wider. Gesellschaften wurden gegründet, deren Millionenkapital größtenteils aus Privatmitteln stammte, Regierungen drohten sich zu entzweien, weiße Männer kämpften sich durch unerforschtes Afrika, um Emin zu retten!
Slatin, Lupton hatte man ohne Hilfe gelassen, Gordon selbst, der Große, war mit Chartum gefallen, zwei Tage, ehe die zögernden Retter ihn erreichten. Junker hatte sich, von Emin weg, allein seinen Heimweg suchen müssen.
Was also lag in dem Manne Emin, daß eine Welt seinetwegen in Aufruhr geriet?
Ein kurzer Blick schon zeigt uns, daß wir die Gründe nicht in ihm selbst suchen dürfen.
Sein Leben, wenn auch äußerlich bewegt genug, läßt doch die großen Ausmaße vermissen, den Wellenschlag, die Gezeiten. Nirgendwo sehen wir den Mann sein Schicksal zwischen die Schenkel nehmen wie ein ungebärdiges Roß und es vorwärtszwingen, erkannten Zielen zu. Doch immer wieder peinliches Verkennen der Zusammenhänge, der Ursachen und Wirkungen.
Wenn auch die Entdeckerjahrzehnte des letzten Jahrhunderts Spannungen in die Gefühle gebracht hatten, die zu raschen Entladungen drängten: niemals konnte der Mann Emin, von Ort und Zeit gelöst, den Gefühls- und Machtaufwand rechtfertigen, der um ihn her entfaltet wurde.
Von Ort und Zeit gelöst: dies der Kernpunkt. Bisher ist nie ernsthaft der Versuch gemacht worden, den Menschen Emin von seinem Ort und seiner Zeit zu lösen.
Die Zeitgenossen haben, mit vielem Lob und manchem Tadel, eine Literatur über Emin erzeugt, die, der Menge nach, die über manch andren Großen übertrifft.
Den Menschen Emin haben sie uns nicht nähergebracht. Sein Bild, immer wieder in wässerigen Umrissen gezeichnet, verschwimmt in den Farbtönen seiner Umgebung, hebt sich nicht hell von dunklem Hintergrunde ab, zeigt nicht sein Wesentliches: die Tragik des weißen Menschen in Afrika.
Fast allen Lebensbildern Emins ist, bezeichnend genug, die Eigentümlichkeit gemeinsam, daß sie seinen Anfang wie sein Ende entweder ganz im Dunkel lassen oder nur flüchtig, teils wohl auch falsch beleuchten.
Bei seinen Anfängen mag das gerechtfertigt sein, wie wir sehen werden. Sein Ende aber, wuchtig, übermenschlich fast, wie ein Ausklang der tiefen, schweren Chöre, die die antike Tragödie begleitet haben mögen – sein Ende, als Heldentod, Forscherschicksal nicht ohne weiters abzutun.
Daß die Mitwelt ihre Lieblinge oft willkürlich, nicht nach Verdienst wählt, ist eine Binsenwahrheit; eine andere, daß sie ihre Lieblinge oft und rasch vergißt, eine dritte, daß mancher erst zu innerer Größe und Freiheit gefunden hat, als er der Mitwelt aus Augen und Sinn gekommen war.
Auf das Leben eines Weißen unter Weißen mögen die drei Wahrheiten alle zutreffen und es doch nicht über den Rahmen unserer zivilisationsmüden Zwergenwelt hinausheben.
Anders bei Emin: der stand, wenn auch durch seine weiße Welt und ihre Zeit bedingt, allein im weiten Afrika. Da konnte das Schicksalspendel voll ausschwingen, von Ewigkeit zu Ewigkeit, daß uns in diesem einen kurzen Leben sein Schlag hörbar wurde.
Verschieden mögen die Triebkräfte sein, die von der glattgeschliffenen Oberfläche der weißen Kulturwelt ein Teilchen absplittern, es hinausschleudern ins Weite, Dunkle. Doch mag ein solches Teilchen noch so namenlos, unbeachtet, mißachtet vielleicht, im Schoße des Mutterbodens geruht haben –: hinausgeschleudert, ins Blutfremde, bekommt es Gewicht und Gehalt, wird, über jedes Eigenschicksal hinaus, Bannerträger seiner alten Rassen- und Blutsgemeinschaft, wird zum weißen Menschen.
In einzelnen hat sich die Wandlung vom namenlosen Untertan zum Träger letzter Verantwortung bewußt vollzogen. In ihren Namen verkörpern sich die lichten Ausstrahlungen unseres Kulturkreises. Für den Zeitabschnitt, den wir vor Augen haben, gehören Gordon hierher und Dr. Peters, Wißmann auch und Lettow-Vorbeck.
Anderen wieder waren die Knechtseelen nicht als Gefäß für Herrentum geschaffen: sie platzten von der jähen Wichtigkeit, wie Tiefseetiere, die ein Fischer an freie Sonne emporzieht. Für ihr Gebrechen haben wir den Namen Tropenkoller erfunden.
Der große Rest schmilzt draußen wieder zur namenlosen Herde zusammen, unwichtig im Leben wie im Sterben.
Emin ist in keine der drei Gruppen einzureihen: Von der Herde scheidet ihn seine hohe wissenschaftliche Begabung – von den ganz Großen seine Lebensfremdheit. Der Dünkel lag ihm wohl nahe genug, doch ließ die trockene Gemessenheit seines Wesens allzu üppige Auswüchse nicht zu.
Die Gründe, die ihn von der Heimat forttrieben, lagen nur zum geringsten Teil in ihm, waren fast durchweg rein äußerlicher Art. Fort mußte er – und überließ sich der Strömung. Daß die ihn nach Afrika führte, nicht sonst wohin, lag an der Strömung, nicht an ihm.
Als Vertreter eines Kulturkreises hat sich Emin lange Zeit nicht gefühlt. Sein Übertritt zum Islam zeigt, wie wenig Sinn er für scharfe Scheidung hatte. Auch hatte er lange Zeit an die Möglichkeit einer Verbrüderung zwischen Weiß und Schwarz geglaubt, Findet sich doch in seinem Tagebuch kurz vor seinem Tode noch die Eintragung: »… und obgleich es recht sehr peinlich ist, von höheren und niederen menschlichen Rassen zu sprechen, kommt man doch hier stark in Versuchung dazu …«
Damals, im September 1891, saß er im tiefsten Urwald, zwischen Zwergen und Menschenfressern, nackten, heimtückischen Wilden.
Und er ist seinem Schicksal doch nicht entgangen. Die weiße Welt hat ihn nicht losgelassen.
Daß ihm diese Bindung nicht bewußt wurde, daß er zu stehen meinte, wo er doch gehalten war, daß er sich erhaben fühlte, während man ihn nur erhoben hatte – das macht die besondere Tragik seines Lebens aus.
Sie anschaulich zu machen, war der Hauptzweck dieses Buches. Um ihn zu erreichen, mußte von vornherein weiter ausgeholt werden, als es beim Lebensbild eines Menschen nötig gewesen wäre, der nicht so ganz und gar in seiner Zeit verstrickt war wie Emin.
Es mußte aber auch die Form der freien Erzählung oft verlassen und dazu übergegangen werden, Urteile und Schilderungen von Männern einzuflechten, die Emins Schicksal entweder geteilt oder aus nächster Nähe mitangesehen haben. Die Gefahr, hierdurch gelegentlich langatmig zu wirken, schien geringer als die andere: bei freier Wiedergabe das Gewicht einzelner Zeugnisse nicht haargenau zu treffen und dadurch ein Charakterbild, das vor allem geschichtlich und menschlich wahr sein sollte, in den Verdacht willkürlicher Deutelei zu bringen.
Daß die Augenzeugen sich untereinander, sogar sich selbst so häufig widersprechen, schien ein Grund mehr, ihre Aussagen wörtlich anzuführen. Denn gerade der Umstand, daß Männer, auf die ihre weiße Heimat mit Ehrfurcht blickte, in Afrika falsch sehen, irren und schwanken lernten, bot eine der Hauptstützen für den Grundgedanken dieses Buchs: Daß Afrika dem weißen Menschen von Grund auf Feind ist und, wenn es ihn nicht töten kann, ihm an der Seele Schaden tut.
Von diesem Standpunkt aus betrachtet, bekommt der Mensch Emin neue Bedeutung, tritt aus der Reihe der »Pioniere des Ostens«, erscheint uns auf einem Leidensberg, hoch über der Niederung.
Ihm war es gesetzt, die Fehler seiner Zeit ganz zu den seinen zu machen und in seinem einen Leben die Sühne dafür als bitteres Schicksal zu tragen. Sein Leben wie sein Tod gehören nicht ihm selbst an: sie sind Leben und Tod des weißen Menschen in Afrika.