
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
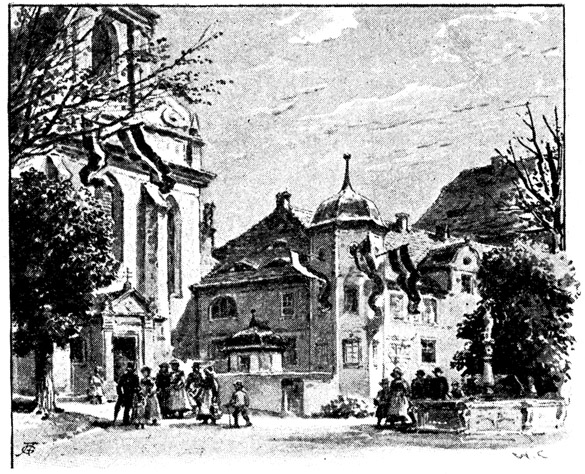
Unter dem jungen Grün der breitästigen Kastanienbäume im äußeren Klosterhof herrschte reges Leben. Die Oekonomiegebäude, die sich, einen großen Bogen beschreibend, rechts und links, an den stattlichen Hauptbau inmitten des Klosterhofes reihten, machten mit ihren geschlossenen Thüren und Laden und der ringsum herrschenden peinlichen Sauberkeit den Eindruck, als feiere man einen höchsten Feiertag. Es war aber nur ein Werktag – der letzte Tag im Mai 1891. Das Fest, um das es sich handelte, war eine Profeß.
Von draußen kamen jetzt die weißgekleideten Klosterschülerinnen durch den hohen Thorbogen des Klosterhofes. Alle frommen und neugierigen Leute des nahen Dorfes und der kleinen, unweit des Klosters sich lieblich zwischen den Bergen hinbettenden Stadt – groß und klein hastete unter dem Zusammenläuten herbei, um der Einkleidung der jungen Novize beizuwohnen. Denn jeder kannte sie; jenseits des dunklen Tannenberges, der sich dicht hinter dem Kloster aufbaute, lag das hübsche Gut, Marias Heimstätte.
Die einzigen Verwandten der jungen Waise, das ungleiche Paar, das unter dem Thorbogen sein Gefährt verließ, schritt jetzt daher, die Frau voraus; ein gelber Spitzenhut umrahmte ihr grobes resolutes Bauerngesicht, und die Schleife auf ihrer hochgewölbten Brust wetteiferte an Röte mit ihren Wangen. Der Mann sah, trotz seiner schiefen Kopfhaltung und den schlotternden Beinen, die ihm nicht mehr recht gehorchen wollten, wie ein Prinz neben der robusten Frau aus.
Sie hatten nach dem Tode von Marias Eltern ihr kleines Landstädtchen verlassen, um die Vormundschaft über das Kind und zugleich die Bewirtschaftung des Gutes zu übernehmen.
Schwester Mariann', die Pförtnerin, führte das Ehepaar durch das Schiff der Kirche in das um einige Stufen höher gelegene Chor. Die eiserne Gitterthüre zwischen dem oberen und unteren Kirchenraume stand heute offen.

Bergholds wurden in der ersten Bank dem Altar gegenüber untergebracht; hinter ihnen saßen die Klosterschülerinnen mit ihren aufgeschlagenen Notenheften, und am Harmonium in der Ecke befand sich die Gesangsmeisterin, Frau Cäcilia.
Gesang, Malerei und feine Handarbeit waren in früheren Jahren die Hauptbeschäftigung der frommen Frauen gewesen; um das Fortbestehen ihres Klosters zu sichern, mußten sie sich den Anforderungen des Staates fügen und Schule halten.
Aber ihren alten Künsten waren sie darum doch treu geblieben, und der Gesang der Nonnen lockte die Leute nach wie vor in die Klosterkirche.
»O salutaris hostia«
ertönten die frischen Stimmen der Klosterschülerinnen, während die Nonnen paarweise aus der Sakristei traten, vor dem Altar das Knie beugten und sich dann in die Chorstühle an den Längswänden der Kirche begaben. Sonst war der Platz der Frauen auf dem Chor über dem Altar, wo kein weltliches Auge hindrang.
Aber heute war ein großer Festtag; die gotische Kirche mit ihren altersgeschwärzten Pfeilern und Heiligen duftete, strahlte und glänzte in wahrhaft bräutlicher Pracht. Zu den hohen, buntbemalten Fenstern fielen leuchtende Sonnenstrahlen schräg über die Köpfe der Andächtigen und vermischten sich mit dem Glanze der Kerzen. Und den großen, purpurroten Teppich, der die Altarstufen bekleidete, hatten die Klosterschülerinnen über und über mit Blumen besät.
Die jungen Mädchen in ihren Bänken waren voll Unruhe; im Schiff der Kirche wollte das Zischeln, Kommen und Gehen kein Ende nehmen.
In der vordersten Bank kniete eine Frau mit einem kleinen, faltigen Gesicht und hellblauen, merkwürdig glänzenden Augen. Sie trug eine altmodische Haube und ein ebenso altmodisches, bunt gewirktes Tuch. Der junge Mann neben ihr, den sie zuweilen mit einem innigen Blick streifte, trug städtische Kleidung; er war sehr schlank und durchaus nicht schön, wer ihn aber näher ins Auge faßte, den mußte der reife, ernste Blick dieser dunklen Augen überraschen, ein Blick, der jetzt wie traumverloren an den flimmernden Kerzen des Altars hing.
Die man einkleidete, war die Gespielin seiner Jugend, der Sonnenschein seiner harten Kindheit. Sie hatte mit den Dorfkindern gespielt und sich mit ihnen gerauft, sie hatte Schuhe und Strümpfe versteckt, um ihnen ja nichts vorauszuhaben – und doch – wie anders war sie als alle –
Schon mit zehn Jahren hatte er gewußt: ich muß ein großer Maler werden, sonst kann ich mein Mariele nicht heiraten – Und er war fortgelaufen. weil ihn der Vater zum Schreiner machen wollte; mit fünfzehn Jahren stand er allein in der Welt. Aber dort wie zu Hause – er hatte nur den einen Gedanken: daß er um Marieles willen etwas werden müsse –
An den Schmerz der Eltern dachte er nicht; auch nicht, daß während seiner Abwesenheit irgend etwas mit der Jugendgespielin geschehen könne. Er arbeitete wie ein Wahnsinniger. Da traf ihn ein Brief der Mutter, mit der er seit dem Tode des Vaters wieder in Verbindung stand.
»Hab Dir immer verheimlicht,« schrieb sie, »weil selber nicht geglaubt, nun aber, leider Gott, ist es wahr; nächsten Mittwoch, den einunddreißigsten Mai, kleiden sie 's Mariele ein, trotzdem ich immer geträumt, es kommt wieder, und die Zuversicht nicht verlier, da alleweil Wunder geschehen. Denn ist es keins, daß du, ein armer Bursch, in die Welt gehst mit nichts im Sack und mir über einmal Geld schicken thust, mehr als genug? Ich wünsche Dir Zufriedenheit und ein langes Leben
von Deiner treuen
Mutter.
Gott hab Deinen Vater selig. Amen. Denn ich schäme mich alsfort, daß ich nicht betrübter bin.«
– Der junge Mann fuhr aus seinen Gedanken; alle Glocken fingen an zu läuten, und im Chor ertönte die wunderbare Stimme der Frau Cäcilia.
Maria, von ihrem Großonkel und Pflegevater geführt, trat aus der Thüre der Sakristei – viel zu rasch, die strahlenden Augen weit offen, das ganze Geschöpf wie durchschauert von Ungeduld, als sei ihre Seele in Wahrheit ›entzückt vor Freude in Gott, ihrem Erlöser‹.
Der alte Herr Berghold aber trug ganz gegen seine Gewohnheit das Haupt aufrecht, und alles staunte über den feinen Herrn, während Frau Berghold vor sich hin murmelte: »So hab ich ihn noch nie gesehe – und wie sie das Mädel 'rausputzt habe – da kann ein jed's wie eine Prinzeß aussehe, in so me schwere Seiderock.«
In der That, alles reckte und streckte sich, um die Gottesbraut zu sehen. Ein prachtvolles weißes Atlaskleid umfloß in schweren Falten ihre schlanke Gestalt; die vollen, dunkelblonden Flechten zierte der Myrtenkranz und durch den lichten, bis zur Erde herabwallenden Schleier leuchtete die rosige Farbe ihres Gesichtes. Alles an diesem Geschöpf war Ebenmaß, Leben, Gesundheit. Sie zählte zweiundzwanzig Jahre.

Ihr Großonkel und Vormund führte sie zu dem mitten im Chor für sie bereitstehenden Betstuhl und kehrte dann auf seinen Platz zurück.
»Gelt, jetzt knickst wieder zusamme,« flüsterte ihm seine Frau zu.
Er hörte nicht auf sie; seine Gedanken drehten sich nur um das eine: ›Wenn ich ein andrer wär, stünd das mir anvertraute Kind jetzt nicht als Himmelsbraut vor dem Altar –‹
»Hör auch,« stieß ihn die Gattin an, »das ist die Klein, die so laut heult, daß man's bis da 'rauf hört – ich weiß, warum die so thut – und warum der Markus komme ist – hat wolle 's Vögele fange, ja hopsa!«
Der alte Herr sank mit dem Kopf noch tiefer auf die Brust: Zweimal hatte die alte Klein kurz vor Marias Einkleidung nach ihm gefragt, seine Frau hatte sie jedesmal fortgeschickt, und er, obwohl er wußte, weshalb des Markus Mutter kam – er war eben wieder zu bequem gewesen, dem Willen der Frau entgegen zu handeln.
»Hat 's Mariele nit mit aller Gewalt ins Kloster gewollt,« flüsterte ihm die Frau zu, »was sitzst denn da wie 's gekreuzigt Elend? – Sie ist uns ja bei Nacht und Nebel auf und davon in ihr Kloster gelaufe – Oder meinst, uns ging's besser, wenn der Markus da vorne am Altar neben ihr stehe thät? – Das ist die erst gut That, die unser Herrgott für mich aufgespart hat, daß der Markus dort drunte steht –«
Der Domkapitular, von den dienenden Geistlichen umringt, trat jetzt durch die Thüre der Sakristei, und nun erhob auch die junge Gottesbraut das Haupt von ihren gefalteten Händen, und ein stolz freudiger Blick streifte das prächtige, reich gestickte Meßgewand des hohen Geistlichen – der Novizin letzte Arbeit zur Zeit ihrer Probation.
Frau Klein im Schiff der Kirche hatte ihr Weinen eingestellt; sie lauschte, denn der Geistliche richtete warme, ergreifende Worte an die Gottesbraut; von ihrem Eifer sprach er, ihrer bis in die erste Kindheit zurückführenden Sehnsucht, Gott anzugehören; von dieser so echten Berufstreue, die nie ein Schwanken gekannt. Ja, würdig war sie, sich der Gemeinschaft der Frauen anzuschließen, die in seliger Gottangehörigkeit der ewigen Heimat zustrebten.
Die Augen des jungen Mannes hatten die bräutliche Erscheinung in der Mitte der Kirche noch keinen Augenblick verlassen. Wie schön war sie geworden – und wie demütig – das leidenschaftliche Kind von früher. – Er sah unwillkürlich auf seine Hand herab; da waren sie noch, die Spuren ihrer kleinen Zähne, die sie ihm einst in kindischer Wut ins Fleisch gegraben.
Plötzliches Erstaunen malte sich auf seinem Antlitz; sein Blick war an den Lilien auf dem Meßgewande des celebrierenden Geistlichen hängen geblieben.
Diese seltsame Zusammenstellung von Unkraut und herrlich daraus hervorwachsenden Lilien hatte er einmal in einem vernachlässigten kleinen Garten gesehen und an die Küchenwand des elterlichen Hauses hingekleckst. Und diese seine Studie – die Jugendgespielin hatte sie mit in ihr neues Leben genommen – und wunderbar! auch ganz nach seinem Sinne ausgeführt, völlig naturwahr.
Hatten die in ihren Chorstühlen knienden Nonnen eine Ahnung von der Geschichte dieser Lilien? Die schwarzen kapuzenartigen Schleier verdeckten fast das ganze Gesicht der Frauen; die Blicke des jungen Malers blieben an den Händen haften, die alle gleichmäßig gefaltet, doch so grundverschieden waren; harte, wie vom Tischler zusammengefügte Hände; schwammige, in ihrem Fett erstickende, unentwickelte Kinderhände, affektierte, inbrünstige, lässig gefaltete Hände. Merkwürdig robust waren die Hände der zunächst beim Altar knienden Aebtissin, Hände, die zu ihrer übrigen Erscheinung gar nicht paßten, denn sie hatte eine hohe, schlanke Gestalt, und die Züge in ihrem länglichen, blassen Gesicht waren fein.
Der junge Mann war tags zuvor mit ihr im Sprechzimmer des Klosters zusammengetroffen; ihre Unterhaltung war rein geschäftlicher Natur gewesen, und er hatte das Sprechzimmer verlassen, ohne mit einer Silbe seine Beziehungen zu der vor ihrer Profeß stehenden Jugendgespielin zu erwähnen. Ein Blick in die diamantscharfen, streng keuschen Nonnenaugen der Aebtissin belehrte ihn zur Genüge: hier war für Marias Befreiung nichts zu hoffen.
Aber war denn nicht eine da, zu der er hätte Zutrauen fassen können?
Sein Auge glitt wie trostsuchend von einem Chorstuhl zum andern; an dem der Aebtissin gegenüber liegenden blieb es hängen.
Eine kleine zarte Gestalt hatte jenen Platz inne, mit Händen, so fein und durchsichtig wie die Hände einer Leidenden. ›Das ist jene Nonne‹, fuhr es dem jungen Mann durch den Sinn, ›die ich einmal als Knabe gesehen, und die 's Mariele ›Meine‹ genannt hat‹ –
Die bräutliche Erscheinung war langsam unter den Klängen der Orgel die Stufen zum Altar hinangeschritten, neigte sich tief und näherte sich der Pforte der Sakristei.
Es war, als wolle jeder noch einen letzten Blick auf die glänzende Gestalt werfen, einen Abschiedsblick für die Weltentsagende, die eine so große Zierde für die Welt gewesen wäre.
Eine kurze Zeit verstrich; die Augen aller blieben auf die Sakristeithüre gerichtet, und als die Nonne an der Orgel einen Augenblick mit dem Präludieren inne hielt, war es so still in der Kirche, als halte ein jeder den Atem an.
Der Chor der Klosterschülerinnen fiel ein, und Maria erschien in einer Wolke von Weihrauch, den vier vor ihr hergehende Chorknaben aus ihren Rauchfässern spendeten. Sie trug das lange weiße Klostergewand, von einem schwarzen wollenen Gürtel lose zusammengehalten. Das Haar war ihr abgeschnitten und ringelte sich in kurzen Locken um den fein geformten Kopf. Sie sah wie ein verzückter Jüngling aus, als sie mit hochgefalteten Händen einherschritt, das Haupt erhoben, die Lippen halb geöffnet.

Als sie vor den Altar trat, fiel der vom Fenster hereinbrechende Sonnenstrahl auf ihr junges Haupt; und in dem Augenblick schrie Frau Berghold aus:
»Herrjesses, ihr ganze Urgroßmutter!«
Maria stand wie erstarrt, als habe sie über die gehörten Worte völlig vergessen, was ihres Amtes war. Ein Hüsteln der Aebtissin brachte sie zu sich selbst, und leise, mit zitternder Stimme, sprach sie ihre Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams. Dann warf sie sich flach über die Altarstufen hin, und die Aebtissin und die Novizenmeisterin deckten das Totentuch über sie, während der Geistliche dies als das Zeichen verkündete, daß sie von nun an der Welt abgestorben sei.
Der junge Mann war leichenblaß geworden; auch ihm war Marias Aehnlichkeit mit der Urgroßmutter im höchsten Grade aufgefallen.
Frau Berghold hatte das Bild an einen Trödler verkauft, und die Mutter handelte es diesem für ihren Markus wieder ab, denn das Bildnis der schönen Frau war das Entzücken seiner Kinderjahre gewesen.
Und nun deckten sie über die in gleicher Schönheit erblühte Urenkelin das Bahrtuch.
Rings umher alles weinte, auch die Klosterschülerinnen in ihren Bänken; nur die Nonnen in ihren Chorstühlen rührten sich nicht, keine von allen schien ergriffen – doch, da vorne die kleine Nonne war mit dem Gesicht in die Hände gesunken, ihr ganzer Körper bebte.
Der junge Mann atmete auf. Diese Thränen waren ihm eine Beruhigung, eine Versicherung: in diesen Mauern pocht ein warmes Herz –
Maria hatte sich erhoben, der Priester schnitt ihr mit einer kleinen Schere eine Stirnlocke vom Haupte, zum Zeichen, daß sie von nun an der Eitelkeit der Welt zu entsagen habe.
Hierauf wurden ihr unter fortwährendem Gesang und dem Schwingen der Weihrauchfässer von den beiden Nonnen die übrigen Bestandteile der Klostertracht umgelegt; erst das schwarze Skapulier, dann der, ihre ganze Gestalt umhüllende Klostermantel, der Schleier. Der Geistliche, nachdem er über jedes der Kleidungsstücke einen Segen gesprochen, krönte zum Schlusse das Haupt der jungen Nonne mit einem Kranz weißer Rosen.
Sie wandte sich langsam um; wie auf Verabredung hörte plötzlich jedes Geräusch in der Kirche auf.
War diese blasse, regungslose Nonne da oben am Altar dasselbe strahlende, sich in so seliger Wonne seinem Gott hingebende Geschöpf? – Und ging in dieser minutenlangen, totenähnlichen Stille ein Ahnen durch die Kirche, daß man dem Fällen eines jungen, kräftigen Stammes beigewohnt, einem Gewaltakt an frisch aufblühender Natur?
Was hatte die junge Nonne unter dem Bahrtuch für Dinge erfahren, die ihr so rasch den Glanz der Jugend vom Antlitz gewischt und ihm den Leidenszug tiefster Schmerzen eingegraben? Was verbargen mit einemmal diese nun gesenkten Augen, die noch eben eine so himmlische Freude ausgestrahlt hatten?
Tiefste Enttäuschung bargen sie, tiefste Verzweiflung. – Sie hatte geglaubt, in diesem Augenblick müsse der Himmel all seine Seligkeiten über sie, die Gotterwählte, ausgießen; seit Wochen, seit Monaten hatte sie an nichts anderes gedacht, als an diese Stunde; aus Angst, Unheiliges zu träumen, hatte sie den Schlaf durch die Inbrunst ihrer Gebete von ihrem Lager verscheucht. – Und nun, in diesem höchsten Augenblick ihrer Vermählung mit ihrem Herrn und Heiland, mußten jene unglückseligen Worte aus dem Munde ihrer Pflegemutter sie wie eine Höllenbotschaft treffen.
Maria wollte unter dem Bahrtuch vor Entsetzen vergehen; gab diese schreckliche Urgroßmutter sie denn nie frei? Hatte sie am Vorabend der Profeß nicht fest geglaubt, alles Vergangene überwunden zu haben, und war sie nicht mit einem Herzen voll Sehnsucht zur Ruhe gegangen, auf den Lippen: » Suscipe Domine«? – Diese Frau aber, deren Andenken sie wie das Böse floh, erschien ihr im Traume, umgarnte, verwirrte sie, und nicht genug, selbst jetzt in diesem Augenblick drängte sie sich zwischen Maria und ihren himmlischen Bräutigam.
Warum redete er nicht, warum ließ er sie im Stich, daß ihre Seele statt in Wonnen, in Angst und Schrecken erzittern mußte? –
Als trage sie auf ihrem Haupte eine Dornenkrone statt eines Rosenkranzes, schleppte sie sich zur Aebtissin hin, die ihren Chorstuhl wieder eingenommen hatte. Sie überreichte der jungen Nonne das Brevier und erteilte ihr mit lauter Stimme den Segen.
Die Nonnen in ihren Chorstühlen hatten sich erhoben; sie trugen brennende Kerzen in der Hand und stimmten das Te Deum an. Die neueingekleidete Braut Gottes aber sollte von einer Klosterfrau zur andern gehen, um den Schwesternkuß zu empfangen.
Maria war am Ende der linksliegenden Chorstühle angelangt und mußte nun an der offenen Gitterthüre, die das Chor vom Schiff der Kirche trennte, vorbei. Da plötzlich, wie einem gebieterischen Willen gehorchend, warf sie einen Blick in den untern Kirchenraum. Es war nur ein kurzer Blick, aber was sie gesehen, trieb ihr das Blut mit solchem Ungestüm zum Herzen, daß sie einen Augenblick schwankte.
Der Markus war wieder da; sie hatte ihn erkannt, trotz der zwölf Jahre, die ihn zum Manne gemacht. –
Ihr war, als dringe das Orgelgebrause mit einem ganzen Heer von Erinnerungen auf sie ein. – Sie hörte des Markus Stimme, sie sah das zornige Auflodern seiner Augen, als sie, aus der Schule kommend, ihm die Worte entgegenrief: ›Markus, Markus, jetzt weiß ich, was ich werd – eine große fromme Klosterfrau werd ich und trag ein langes weißes Kleid‹ –
Wie er sie schüttelte, wie er sie anpackte!
›Das wirst du nit‹.
Sie sah ihn noch dastehen, lang und dürr, mit seinem rötlich blonden Haarschopf.
›Laß mich los!‹ schrie sie.
›Nit bevor du mir dein Wort giebst –‹
Da duckte sie sich und biß ihm in die Hand, und dicke rote Blutstropfen entquollen der kleinen Wunde.
Sie brach in Thränen aus, Markus aber lächelte gar seltsam in sich hinein, indem er einen Kreis um die kleine Gespielin beschrieb, die Hand gesenkt, aus der das Blut floß.
›So,‹ sagte er, ›jetzt kannst nimmer 'raus, das ist der Blutbann.‹

Gab's wirklich einen Blutbann?
– Das Mittagsmahl, an dem der Domkapitular und die übrigen geistlichen Herren teilgenommen hatten, war zu Ende; der Klostergeistliche war der letzte, der die Frauen verließ. Sie verneigten sich tief vor dem Diener Gottes, der aber durchaus nicht den Eindruck machte, als fühle er sich als Hirte dieser Schar.
Er war ein ältlicher, nicht eben geweckt aussehender Herr, dem es noch nie gelungen war, seinen Willen gegen den der Aebtissin zu behaupten.
»So ist noch bei keiner Profeß geweint worden,« sagte Frau Petronilla, als die Klosterfrauen sich des Nachmittags im breiten Laubgang ihres Gartens ergingen.
Die kugelrunde Nonne wischte sich unaufhörlich das Gesicht.
»Ist das wieder eine Hitz heut – man muß Gott für jeden Tag danken, an dem man nicht schwitzt!«
Frau Petronilla hatte nicht nur die Stimme eines Mannes, ein stattliches Bärtchen zierte noch außerdem ihren breiten, die ganze Fläche ihres Gesichtes einnehmenden Mund, über dem sich kaum merklich ein in seinem Wachstum völlig zurückgebliebenes Näschen erhob. Aber aus ihren kleinen runden Augen lachte eine äußerst lustige Seele.
»Bei meiner Profeß hat kein Mensch geweint,« fuhr sie zu sprechen fort, »mich hat jeder unserm Herrgott gönnt.«
Die meisten der Nonnen lachten, während die Aebtissin ein wenig die Stirn runzelte und vor sich hinsah.
Die breitspurig einherwatschelnde Frau Petronilla war eine wichtige Persönlichkeit, die »Oekonomierätin« des Klosters, wie man sie scherzweise nannte. Allein die auf Würde und gefällige Formen so großes Gewicht legende Aebtissin lernte sich nie in Frau Petronillas Art und Weise finden; da sie jedoch die in gleichem Alter mit ihr stehende Frau nicht mehr zu ändern vermochte, hatte sie sich angewöhnt, von Petronillas Aeußerungen so wenig als möglich Notiz zu nehmen.
»Ja, ja,« meinte diese, die neueingekleidete Nonne mit ihrer kräftigen Hand auf die Schulter klopfend, »jetzt ist's aus mit dem Mariele; 's wird sich nicht mehr erkundigen: ist's wahr, ist's eine Sünd, weil ich lieber in die Schwemm reit als in die Beicht geh? Die heilige Theresia hat nicht verzückter dreingesehen, als ihre funkelnagelneue Namensschwester. Haben's alle so gemacht, aber man kommt wieder zu sich, unser irdisch's Teil sorgt redlich, daß uns nicht da unten schon Flügel wachsen.«
Sie lachte laut auf, während sämtliche Augen der Nonnen das Auge der Aebtissin suchten, die keine Miene verzog.
Marie, die neue Frau Theresia, aber fühlte sich durch Frau Petronillas unheilige Reden verletzt, und es that ihr weh, als sie gewahrte, daß die Superiorin über Frau Petronillas Worte lächelte. – Die Superiorin, ihre früher so geliebte Frau Benedikta. –
Plötzlich fiel ihr ein – in der Nacht, in ihrem schrecklichen Traum, trug da nicht die Pietà im Schiff der Kirche Frau Benediktas Züge? Aber dieser ganze Traum war ja ein Werk des bösen Feindes. Frau Benedikta hatte nie an ihre Berufung geglaubt, so viel stand fest; wenn sie auf Frau Benedikta gehört hätte, sie trüge den Schleier heute noch nicht. Und gab es ein größeres Glück – war sie nicht das seligste Geschöpf auf der Welt?
Die Schrecken während der Einkleidung, das Angstgefühl, das noch jetzt ihr Inneres bedrückte, das alles war nur ein Rest des Irdischen, von dem sie sich losgesagt.
Eine Unterredung mit der Aebtissin hatte in ihrem verzweifelten Gewissen die Ruhe wieder hergestellt. Freilich, die Dinge, die ihre Andacht gestört, beschrieb sie nicht näher, aber es erleichterte ihre Seele, als ihr die hohe Frau sagte, Störungen der Andacht seien Prüfungen, die sie alle erdulden müßten. Die innerlich glückselige Stimmung, die in der Zeit der Probation von den Bräuten Christi Besitz nähme, könne keine bleibende sein; sie dürfe es auch nicht, denn sonst wäre ihr Leben schon jetzt der ewigen Glückseligkeit vergleichbar. Diese aber müsse durch eine fortwährende Vervollkommnung, durch eine Ausdauer ohne Ende verdient werden.
– Die Aebtissin hatte in einem Gartenstuhl hinter dem Hause Platz genommen; die Nonnen gruppierten sich um sie herum; Marie saß zu ihren Füßen; ihr Gesicht war fast so weiß wie die Rosen, die sie auf dem Haupte trug.
Frau Benedikta warf zuweilen einen Blick tiefster Wehmut auf die jugendliche Gestalt, die ganz versonnen dasaß und an der allgemeinen Unterhaltung keinen Teil nahm. Sie merkte nichts von diesem wahrhaft mütterlichen Blick voll zurückhaltender Liebe und Sorge der kleinen, ein wenig nach vorne geneigten Frau.
Diese saß an der Seite der schönen, imposanten Frau Cäcilia, ihrer Schwester. Aber nur die feinen Linien des Mundes verrieten eine gewisse Familienähnlichkeit. Sie schwand dahin, sowie Frau Benedikta lächelte, denn ihr Lächeln verriet alle Schätze ihrer Seele und war unendlich verschieden von jenem gewollten, Gott wohlgefällig sein sollenden Lächeln, das fast sämtliche Nonnen, von der Aebtissin bis zur letzten Laienschwester bestrebt waren, auf ihrem Antlitz zu zeigen.
So auch Frau Cäcilia, die, ähnlich wie die Aebtissin, von einem kleinen Hofstaat, ihren Gesangsschülerinnen, umgeben war, die in schwärmerischer Verehrung zu der schönen Frau aufblickten und untereinander wetteiferten, ihr jeden Stein aus dem Wege zu räumen.
Inzwischen hatte sich die Aebtissin des Längeren über das gute Gelingen der Zeremonien ausgesprochen, eine Sache, die ihr besonders am Herzen lag.
»Meine Gedanken sind schon mit der Zubereitung eines Gedichtes beschäftigt,« sagte Frau Eulalia, die Dichterin des Klosters, »ich werde mit der heiligen Theresia beginnen und allgemach zu ihrer jungen Namensschwester übergehen.«
»Haben Sie denn gar keine Ahnung von dem trostlosen Einerlei Ihrer Gedichte?« unterbrach sie Frau Scholastika, die Novizenmeisterin.
»Es giebt sehr viele Frauen, die mir gerne zuhören,« gab ihr Frau Eulalia etwas spitz zur Antwort.
»Ja, das ist Ihr großes Glück,« seufzte Frau Scholastika, »daß es so viel mehr unklare als klare Köpfe giebt.«
Sie schritt weiter und Frau Eulalia frohlockte hinter ihrem Rücken:
»Gott zu Liebe habe ich die Bemerkung hinuntergeschluckt, daß ihre gelehrten Reden noch lange nicht so unterhaltend sind wie meine Gedichte.«
»Hm,« machte Frau Petronilla, »ich will nicht behaupten, daß sich Frau Scholastika kurz faßt, aber was sie sagt hat Hand und Fuß, und wer Lust am Lernen hat, kann bei ihr lernen. Bei Ihnen hört man nur Reime:
Weine
Reine
Himmel
Gebimmel
Weihrauch
Gotteshauch –
Etwas Wirkliches steht nie in Ihren Gedichten, und es giebt doch so schöne Sachen; zum Beispiel wie bei der vorletzten Profeß unsere gute selige Propstin mitten in das Lied, das gesungen wurde, ein anderes Lied anstimmte und wir alle vor Lachen in unsern Stühlen wackelten.
»Bitte sehr,« sagte Frau Scholastika, die eben von ihrem Spaziergang zurückkam, »ich kann mich durchaus nicht erinnern, jemals vor Lachen gewackelt zu haben.«
»Und mir war eher zum Weinen,« erklärte Frau Cäcilia und schlug die schönen Augen zum Himmel auf.
»Danken Sie beide Gott,« seufzte Frau Petronilla, »daß Sie nie schwitzen und zur Unzeit lachen müssen! Ich habe sogar an meiner eigenen Profeß gelacht, weil ich plötzlich fühlte, wie mir der Schleier aufs linke Ohr rutschte. Machen Sie die Augen auf, Fräulein Eulalia, so giebt's tausend Dinge, deren Beschreibung unsern Sinn erheiterte statt abzutöten –«
»Bewahre mich Gott,« wehrte sich die Dichterin, »da halte ich mich lieber an das Leben unserer Heiligen, denn wenn ich dichte, so will ich damit erbauen.«
Die etwas abseits sitzenden jüngeren Frauen waren inzwischen des Eifers voll, sich ihre Wahrnehmungen während der Profeß mitzuteilen, denn diesen demütig gesenkten Nonnenaugen pflegte nichts zu entgehen.
Wie die Sperlinge zwitscherten sie durcheinander, und jedes Stück von Marias Toilette wurde einer strengen Kritik unterworfen.
Allgemein war die Meinung: Maria habe beim Heraustreten aus der Sakristei weltlich ausgesehen.
»Man senkt doch die Augen,« hieß es.
»Und eine Gottesbraut muß bleich sein.«
»Erst nach der Einkleidung sah sie ergriffen aus.«
»Ergriffen bloß, mir kam sie wie erstarrt vor.«
»Das war wieder nicht richtig, nach der Einkleidung soll man selig aussehen.«
»Ich habe mir in der Sakristei das Brautkleid noch einmal genau betrachtet; es ist wirklich wundervoll.«
»Herr Berghold soll der Aebtissin gesagt haben, vom besten und teuersten Stoff solle sie nehmen.«
»Herr Berghold hatte sehr schöne Glanzstiefel an.«
»Habt ihr auch Frau Berghold betrachtet?«
Großes Gekicher.
»Gleich beim Heraustreten aus der Sakristei,« berichtete eine Stimme, »bemerkte ich, daß alle Nähte ihrer weißen Handschuhe geplatzt waren.«
»Ach und die Blumen, die sich immerfort auf ihrem Kopf bewegten!«
»Aber der pfaublaue Seidenstoff ihres Kleides soll ganz modern sein!«
»Pfui, über die Eitelkeit der Welt!«
»Ach ja, die armen Weltmenschen, wie unbefriedigt und unglücklich sehen sie doch alle aus.«
»Mein Gott, um was sorgen sie sich denn, wovon reden diese Leute?«
»Natürlich keiner denkt an seine unsterbliche Seele!«
»Und an sein Ende.«
Die Aebtissin erhob ihre Stimme:
»Heute habe ich Ihnen eine große Neuigkeit zu verkünden.«
»Eine Neuigkeit!«
Die jüngeren Nonnen horchten auf und flatterten im Nu herbei; sie küßten der ehrwürdigen Mutter die Hände, den Schleier und wollten vor Neugier vergehen.
Die Aebtissin lächelte und ließ ihre Lieben ein Weilchen zappeln. Sie war sehr aufgeräumt; der Wunsch ihres Herzens war erfüllt: Maria gehörte dem Kloster an und mit ihr nicht nur eine höchst verwendbare Kraft, sondern auch ein ganz beträchtliches Vermögen.
So hatte sie denn gesiegt, sie, die Aebtissin, und die Superiorin, Frau Benedikta, die der Ueberzeugung war, daß Maria nicht fürs Kloster tauge, und alles gethan hatte, um sie zurückzuhalten – Frau Benedikta war unterlegen –
Die Aebtissin sah die durch diesen Kampf früh gealterte Frau, die wie eine Schwerleidende aussah, nicht ohne Mitleid an. Ihr selbst hatte sich nicht ein Fältchen mehr in das glatte, schöne Gesicht gegraben, und ihre kristallklaren Augen erzählten nichts von durchweinten Nächten, wie es die Augen der ihr früher so nahestehenden Nonne thaten. Um Marias willen waren sie auseinander gekommen, aber die Aebtissin beschloß in diesem Augenblick großmütig, ihre Zurückhaltung aufzugeben und der schwer geprüften Frau ihre Huld von neuem zuzuwenden.

»Sie werden staunen, meine liebe Superiorin – Sie werden alle staunen und sich mit mir freuen,« begann sie von neuem, »es betrifft unsere geheimsten Wünsche, eine alte Sehnsucht, die endlich ihrer Erfüllung entgegen gehen soll: die Bemalung unsres Chors.«
Wie sie jubelten, die Aebtissin umdrängten!
»Die Gelegenheit ist uns günstig,« fuhr die ehrwürdige Mutter zu sprechen fort, »der Herr Pfarrer hat mir mitgeteilt, daß der junge Klein, der seinen Eltern vor Zeiten davonlief, als großer Maler zurückgekehrt sei und eben bei seiner Mutter im Dorfe wohne. Es ist eine himmlische Schickung; das Kommenlassen eines Malers von Bedeutung, ich weiß es nicht, ob ich mich dazu hätte entschließen können und dürfen. Nun schickt uns der Himmel diesen Künstler geradezu in den Weg; er war sofort erbötig, unser Chor in ein kleines Paradies umzuwandeln, und will sich sogar, statt fremder Hilfe, der Talente unserer malenden Frauen bedienen. Ich rechne ganz besonders auf Sie, meine liebe Superiorin.«
Während die Frauen alle durcheinander schrieen und die ehrwürdige Mutter mit Fragen bestürmten, saß Maria bleich wie eine Leiche und mit Mühe und Not nach Fassung ringend zu ihren Füßen, indes Frau Benedikta die an sie gerichtete Frage der Aebtissin: »Muß man das Erscheinen dieses Malers gerade jetzt in diesem Augenblick nicht für einen Fingerzeig Gottes halten?« nur mit einem Neigen des Kopfes zu beantworten vermochte.
Ihr war zu Mute, wie es einem zuweilen im Traume geschieht, wenn einer mit aller Mühe und Not eine Thür zuzuschließen vermeint hat, und sie geht plötzlich ganz von selbst wieder auf.
