
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
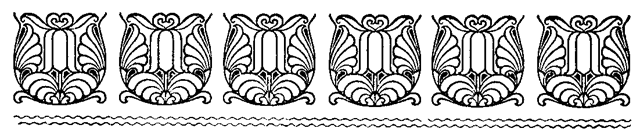
 »Texar!« – dieser fluchwürdige Name war es gewesen, den Zermah in die nächtlichen Schatten hinausgeschrieen hatte in dem Augenblicke, als Frau Burbank und Fräulein Alice auf der Böschung der Marino-Krampe sichtbar wurden. Das junge Mädchen hatte den elenden Schuft erkannt. Mithin war jeder Zweifel an seiner Urheberschaft der von ihm persönlich geleiteten Schandtat ausgeschlossen.
»Texar!« – dieser fluchwürdige Name war es gewesen, den Zermah in die nächtlichen Schatten hinausgeschrieen hatte in dem Augenblicke, als Frau Burbank und Fräulein Alice auf der Böschung der Marino-Krampe sichtbar wurden. Das junge Mädchen hatte den elenden Schuft erkannt. Mithin war jeder Zweifel an seiner Urheberschaft der von ihm persönlich geleiteten Schandtat ausgeschlossen.
Es verhielt sich auch tatsächlich nicht anders. Mit Beihilfe eines halben Dutzends von Spießgesellen hatte er die Entführung bewirkt.
Von langer Hand war der Raubzug durch diesen spanischen Schurken vorbereitet worden in der Absicht, Camdleß-Bai dem Erdboden gleich zu machen, Castle-House zu plündern, die Familie Burbank an den Bettelstab zu bringen, das Haupt derselben lebendig oder tot zu fangen. Zu diesem Zweck hatte er seine Räuberbande auf die Pflanzung gehetzt, aber sich nicht an ihre Spitze gestellt, sondern den wildesten seiner Parteigänger die Führung überlassen. Hieraus wird es erklärlich, daß der in die feindliche Horde hineingeratene John Bruce James Burbank gegenüber hatte behaupten können, Texar befände sich nicht unter ihnen.
Wer ihn treffen wollte, hätte sich zur Marinokrampe hin begeben müssen, durch welche der Tunnel mit Castle-House in Verbindung stand. Falls das Herrenhaus erstürmt würde, so hätten doch dessen letzte Verteidiger nach dieser Richtung hin den Rückzug versucht. Texar war es bekannt, daß solcher Tunnel existierte. Deshalb hatte er sich von Jacksonville aus in einem Boote, dem ein zweites mit Squambo und zwei seiner Sklaven hinterher fuhr, dorthin begeben, um James Burbank aufzulauern, falls dieser sich an diesen zur Flucht durchaus geeigneten Ort begeben sollte. Er hatte sich nicht geirrt. Das wurde ihm sofort klar, als er im Schilf der Bucht eins der Kanoes von Camdleß-Bai liegen sah. Die Neger, die es bewachten, wurden überfallen und niedergemacht. Jetzt hieß es bloß abwarten. Bald kam Zermah, und mit ihr das kleine Mädchen. Auf das von der Mestizin erhobene Geschrei hin ließ der Spanier, weil er fürchtete, es möchten ihr Leute zu Hilfe kommen, sie in Squambos Boot schaffen, und erst, als Zermah im Boote des Indianers schon bis in die Flußmitte fortgeführt worden, kamen Frau Burbank und Fräulein Alice in Sicht ... Das Weitere weiß der Leser.
Indessen hatte es Texar, trotzdem ihm der Raub geglückt war, nicht für geraten erachtet, sich wieder zu Squambo zu begeben; denn der ihm auf den Tod ergebene Mensch wußte ja, nach welchem unzugänglichen Schlupfwinkel Zermah mit der kleinen Dy geschafft werden sollte. Deshalb war der Spanier, als die drei Kanonenschläge die zum Sturm auf Castle-House bereiten Leute zurückriefen, schräg über den Saint-John hinweg verschwunden.
Wohin, wußte niemand. Soviel stand fest, daß er in der Nacht vom 3. zum 4. März nicht nach Jacksonville zurückkehrte. Erst vierundzwanzig Stunden später sah man ihn dort wieder. Was während dieser unbegreiflichen Abwesenheit, für die er übrigens nach gar keinem Grunde suchte, mit ihm vorgegangen war, wußte kein Mensch. Jedenfalls konnte es ihn, falls er der Teilnahme an der Entführung von Dy und Zermah bezichtigt werden sollte, nur um so schwerer belasten; denn daß diese Entführung zeitlich mit seinem Verschwinden zusammenfiel, konnte doch nur gegen ihn sprechen. Gleichviel, nach Jacksonville kam er erst am 5. März im Laufe des Vormittags wieder, um die zur Verteidigung der Südstaaten notwendigen Maßregeln zu treffen, und zwar, wie man gesehen hat, gerade noch zur rechten Zeit, um Gilbert Burbank eine Falle zu drehen, und den Vorsitz über den Ausschuß zu übernehmen, der über den jungen Offizier das Todesurteil sprechen sollte.
Nur eins stand fest: daß Texar sich nicht an Bord des von Squambo geführten Bootes befand, das im nächtlichen Dunkel von der Flut stromauf von Camdleß-Bai getrieben wurde.
Als Zermah einsah, daß ihr Geschrei an den öden Ufern des Saint-John nicht mehr gehört werden könne, hatte sie sich still verhalten. Im Hinterboot untergebracht, schloß sie das kleine Mädchen in die Arme, das vor Entsetzen keinen Laut von sich gab und sich ängstlich in den Falten des Mantels verkroch, der die Glieder der Mestizin umhüllte. Bloß ein paarmal drangen abgerissene Laute über die Lippen des Kindes:
»Mama! – Mama! – Liebe gute Zermah! – mir ist so bange! mir ist so bange! – ich will wieder zu meiner Mama!«
»Ja doch, Herzchen! ja doch!« antwortete Zermah, »wir kommen schon wieder zur Mama! – sei ohne Furcht! – ich bin ja bei dir!«
Zur selben Zeit wankte Frau Burbank, ihrer Sinne kaum mächtig, am rechten Ufer des Flusses einher, vergeblich bemüht, dem Boote zu folgen, das ihr Kind auf das andere Ufer hinübertrug.
Es herrschte nun rabenschwarze Finsternis. Die auf der Pflanzung flammenden Brände verlöschten allmählich, als das Gewehrfeuer aussetzte. Aus dem nach Norden zu gehäuften Rauchgewölk schlugen, über die Wasserfläche des Flusses hin blitzend, bloß noch vereinzelte Flammen heraus. Dann wurde alles still und düster. Das Boot folgte dem Flußbett, dessen Ufer kaum noch zu sehen waren. Auf hohem Meere hätte es nicht einsamer, nicht verlassener sein können.
Nach welcher Bucht steuerte das von Squambo geruderte Boot? Das zu wissen tat vor allem not. Den Indianer zu fragen hätte keinen Nutzen gehabt. Deshalb suchte Zermah sich zu orientieren: bei solcher Stockfinsternis eine schwere Sache, so lange nicht Squambo die Mitte des Flusses verließ. Die Flut war noch immer im Steigen, und unter dem Ruder der beiden Neger gewann man schnell nach Süden zu Terrain.
Wie notwendig wäre es nun aber für Zermah gewesen, ein Merkzeichen zu hinterlassen von der Richtung, in der sie ihre unfreiwillige Reise genommen, um ihrem Herrn die Nachforschung zu erleichtern! Auf dem Flusse war das nun aber ganz undenkbar. Auf festem Lande hätte schon ein Fetzen von ihrem Mantel, an einem Strauche hängen geblieben, zum ersten Anhalt werden können für eine Fährte, die dann sicher bis zu Ende verfolgt werden würde. Wozu es aber hätte nutzen sollen, der Strömung einen dem Kinde oder ihr selber gehörigen Gegenstand zu überantworten? Ließe sich hoffen, daß ihn der Zufall James Burbank in die Hände spielen würde? Darauf mußte man verzichten; man konnte nur versuchen, die Stelle am Saint-John-Flusse zu ermitteln, an welcher Squambo mit seinem Kahne anlegen würde.
Eine ganze Stunde verstrich unter solchen Umständen. Squambo hatte noch kein Wort gesprochen. Die beiden Schwarzen ruderten stumm. An den Ufern zeigte sich kein Licht, weder in den Häusern noch unter den Bäumen, deren Dickicht sich im Schatten verworren skizzierte.
Nach rechts und links hin scharfen Ausguck haltend, um sich das schwächste Merkzeichen einzuprägen, dachte Zermah einzig und allein an die Gefahren, welche das kleine Mädchen lief. Mit den Gefahren, die ihr persönlich drohten, beschäftigte sie sich kaum. All ihre Befürchtungen richteten sich auf dieses Kind. Sicher war es kein anderer als Texar, der das Kind hatte rauben lassen. In dieser Hinsicht war kein Zweifel möglich. Sie hatte den Spanier wiedererkannt, der sich an der Marino-Krampe aufgestellt hatte, vielleicht in der Absicht, durch den Tunnel nach Castle-House vorzudringen, vielleicht um dessen Verteidigern aufzulauern, wenn sie versuchen sollten, durch diesen Ausgang zu entkommen. Hätte Texar sich mehr Zeit gelassen, so würden jetzt gleichwie Dy und Zermah auch Madame Burbank und Fräulein Alice in seiner Gewalt gewesen sein. Hatte er doch auch die Milizmannschaft und das Räubergesindel bloß darum nicht selber angeführt, weil er es für ausgemachter hielt, daß ihm die Familie Burbank an der Marinokrampe in die Hände fiel.
Jedenfalls würde Texar seine unmittelbare Beteiligung an dem Kindesraube nicht in Abrede stellen können. Zermah hatte ja seinen Namen laut geschrieen, so laut, daß ihn Frau Burbank und Fräulein Alice hatten hören müssen. Schlug dem Spanier später die Stunde der Vergeltung, so würde er sich diesmal nicht auf sein Auskunftsmittel, das ihm so oft schon geglückt war, auf den Nachweis seines Alibi, berufen können.
Und nun weiter: welches Schicksal bewahrte er seinen beiden Opfern auf? Gedachte er sie über die Quellen des Saint-John hinaus, bis in die Moräste der Everglades, zu schleppen? würde er sich Zermahs als einer gefährlichen Zeugin, deren Aussage ihm eines Tages verhängnisvoll werden könnte, entledigen? Das waren die Fragen, welche die Mestizin sich stellte. Ihr Leben hätte sie gern zum Opfer gebracht, wenn sie dadurch das mit ihr zusammen geraubte Kind hätte retten können. Wenn sie aber tot war, wenn Dy allein in den Händen Texars und seiner Spießgesellen blieb: was sollte dann aus Dy werden? Dieser Gedanke quälte sie schrecklich, und enger schloß sie das kleine Wesen an ihre Brust, ganz als habe Squambo schon die Absicht an den Tag gelegt, es ihr aus den Armen zu reißen.
Jetzt konnte Zermah feststellen, daß sich das Boot dem linken Flußufer näherte. Konnte ihr das als Merkzeichen dienen? Nein, denn sie wußte ja nicht, daß der Spanier im Hintergrunde der Schwarzen Krampe, auf einer der kleinen Inseln dieser Lagune hauste, wußte es so wenig, wie Texars Spießgesellen, da noch nie jemand Zutritt zu dem Blockhaus gefunden hatte, das er dort mit Squambo und seinen Negern bewohnte.
Dorthin sollte nämlich der Indianer Dy und Zermah schaffen. In den finstern Gründen dieser geheimnisvollen Gegend würden sie vor allen Nachforschungen sicher sein: war doch die Krampe sozusagen unpassierbar für jeden, der sich nicht in der Richtung ihrer Kanäle, über die Lage ihrer einzelnen Werder auskannte. Sie bot zufolgedessen tausenderlei Schlupfwinkel, in denen sich Gefangene so gut verstecken ließen, daß kein Mensch daran denken konnte, hier ihre Spur ausfindig zu machen. Falls James Burbank den Versuch wagen sollte, diese unentwirrbare Wildnis zu durchstöbern, so wäre es ja noch Zeit, die Mestizin mit dem Kinde bis nach dem Süden der Halbinsel zu schaffen. Damit würde dann jede Möglichkeit schwinden, sie in den endlosen Gebieten wiederauszufinden, die kaum von den Pionieren Floridas betreten werden, deren ungesunde offne Strecken bloß einige Indianerhorden noch durchstreifen.
Die 45 Meilen, die zwischen der Camdleß-Bai und der Schwarzen Krampe liegen, waren sehr schnell zurückgelegt. Gegen 11 Uhr steuerte das Boot um das Knie, das der Saint-John 200 Schritte stromabwärts bildet. Jetzt kam es bloß darauf an, die Einfahrt in die Krampe richtig zu finden: bei solcher Stockfinsternis, wie sie das linke Ufer des Flusses deckte, ein sehr beschwerliches Stück Arbeit. Kein Wunder, daß Squambo, trotzdem er nicht unbefahren in diesen Gewässern war, sich doch einen Augenblick besann, ehe er dem Steuerruder eine Wendung gab, um quer durch den Strom zu fahren. Ganz ohne Frage wäre die Sache weit einfacher und leichter gewesen, wenn das Boot an jenem Ufer entlang hätte fahren können, das sich in eine endlose Menge kleiner, mit Weidicht oder Schilf und andern Wasserpflanzen überwachsenen Einschnitte aushöhlt. Aber der Indianer befürchtete, aufzulaufen oder zu kippen. Da nun die Ebbe nicht lange mehr warten lassen durfte und mit ihr die Fluten des Saint-John nach der Mündung zurückströmen würden, konnte ihm durch den Eintritt eines solchen Falles ernste Gefahr erwachsen. Wenn er hierdurch gezwungen wurde, auf die nächste Flut zu warten, so ließ sich kaum annehmen, daß er am hellen Tage unbemerkt auf dem Flusse liegen würde. Meist kreuzten doch zahlreiche Fahrzeuge den Fluß. Zufolge der augenblicklichen Ereignisse herrschte sogar ein ununterbrochner Austausch von Kundgebungen zwischen Jacksonville und Saint-Augustine. Daß die Angehörigen der Familie Burbank, wenn sie bei dem Ueberfall von Castle-House nicht den Untergang gefunden hatten, vom andern Morgen ab die rührigsten Nachforschungen anstellen würden, stand ganz außer Zweifel. Lag nun Squambo am Fuß eines dieser Gestade fest, so konnte es doch gar nicht fehlen, daß er Verfolger auf sich lenkte: und dann mußte die Situation höchst bedenklich werden. Aus all diesen Gründen wollte er lieber im Kanale des Saint-John bleiben; ja wenn es sich als nötig erwiese, selbst mitten in der Strömung vor Anker gehen, um bei Tagesanbruch möglichst schnell die Engen der Schwarzen Krampe ausfindig zu machen, in die hinein ihm niemand würde folgen können.
Inzwischen trieb die Flut das Boot nach wie vor stromaufwärts. Der verflossenen Zeit nach taxierte Squambo, daß er noch nicht auf der Höhe der Lagune treiben könne. Er suchte deshalb noch höher hinaufzugelangen, als sich in der Ferne ein Getöse vernehmen ließ, das sich anhörte wie dumpfes Schlagen von Schaufelrädern, das sich auf der Oberfläche des Flusses fortpflanzte. Fast zu gleicher Zeit kam an der Biegung des linken Ufers eine in Bewegung befindliche Masse in Sicht: es war ein Dampfer, der mit schwachem Dampfe näher kam, das weiße Licht seines Stellfeuers in den nächtlichen Schatten voraus werfend. In knapp einer Minute mußte der Dampfer das Boot erreicht haben.
Ein Wink von Squambo, und die Ruder der beiden Schwarzen lagen still. Durch eine Drehung des Steuers lenkte er nach dem rechten Ufer über, in der doppelten Absicht, um aus der Fahrstraße des Dampfers herauszulenken, und um sich aus dessen Sehbereich zu entfernen.
Aber schon hatte die Bordwache auf dem Dampfer das Boot gesichtet: und schon kam das Signal herüber, am Dampfer beizulegen.
Ein gräßlicher Fluch entfuhr Squambos Lippen. Aber außer stande, sich durch Flucht der in bündiger Form signalisierten Aufforderung zu entziehen, blieb ihm nichts weiter übrig, als zu gehorchen. Im andern Augenblicke lag das Boot an der rechten Seite des Dampfers, der gestoppt hatte, um ihm die Anfahrt zu ermöglichen.
Zermah richtete sich im Nu in die Höhe: sie vermeinte unter solchen Umständen eine Möglichkeit zur Rettung zu erblicken. Konnte sie denn nicht rufen, sich zu erkennen geben, um Hilfe flehen, dem Indianer entrinnen?
Squambo fuhr neben ihr in die Höhe, in der einen Faust ein langes Bowiemesser, mit der andern das Kind fassend, das ihm Zermah vergeblich zu entwinden suchte.
»Ein Laut,« rief er, »und der Balg hat gelebt!«
Hätte bloß ihr eigenes Leben auf dem Spiele gestanden, würde Zermah sich nicht besonnen haben. Da aber das Kind vom Messer des Indianers bedroht wurde, schwieg sie. Von dem Deck des Dampfboots konnte man übrigens nicht sehen, was in dem Boote vorging.
Der Dampfer kam von Picolata, wo er eine Miliz-Abteilung an Bord genommen hatte mit der Bestimmung nach Jacksonville, als Verstärkung für das Südstaatler-Detachement, das die Blockade des Flusses hindern sollte.
Ein Offizier beugte sich jetzt über die Kommandobrücke und rief den Indianer an.
»Wohin wollt Ihr?«
»Nach Picolata.«
Zermah merkte sich diesen Namen, wenngleich sie sich sagte, daß es nicht Squambos Interesse sein könne, das wirkliche Ziel seiner Fahrt zu bekennen.
»Woher kommt Ihr?«
»Von Jacksonville.«
»Was gibt's Neues dort?«
»Nichts.«
»Auch von Duponts Flottille nicht?«
»Nein.«
»Seit dem Angriff auf Fernandina und Fort Clinch also gar nichts Neues?«
»Nein.«
»Ist kein Kanonenboot in die Engen des Saint-John gesteuert?«
»Nein! keins!«
»Woher denn der Feuerschein, den wir gesehen haben, und die Schüsse, die von Norden her zu hören waren, als wir noch vor Anker auf Flut warteten?«
»Die Pflanzung von Camdleß-Bai ist heut nacht überfallen worden.«
»Durch die Nordstaatler?«
»Nein! durch die Jacksonviller Miliz. Der Besitzer hat sich den Befehlen des Ausschusses widersetzen wollen ...«
»Schon gut! – schon gut! – Dem James Burbank hat's gegolten – einem verbissenen Abolitionisten?«
»Aufs Blatt getroffen.«
»Und was ist erzielt worden?«
»Ich kann's nicht sagen – hab's bloß gesehen im Vorbeifahren. Kam mir so vor, als ob alles in Flammen stände!«
In diesem Moment entfuhr den Lippen des Kindes ein schwacher Schrei. Zermah drückte ihm die Hand auf den Mund gerade, als die harten Finger des Indianers sich um seinen Hals legen wollten. Der auf der Kommandobrücke postierte Offizier hatte nichts gehört.
»Haben Geschütze gegen Camdleß-Bai gespielt?« fragte er weiter.
»Ich glaube nicht.«
»Woher denn dann die drei Schläge, die wir gehört haben und die anscheinend von Jacksonville herüberzudringen schienen?«
»Ich kann's nicht sagen.«
»Der Saint-John ist also noch frei von Picolata bis zur Mündung?«
»Ganz frei noch! Sie können ihn, ohne Furcht vor Kanonenbooten, hinunterfahren.«
Ein Kommando wurde dem Maschinisten zugerufen, worauf sich das Schiff wieder in Bewegung setzte.
»Eine Frage, bitte!« rief Squambo zu dem Offizier herauf.
»Die lautet?«
»Die Nacht ist stockfinster – ich kann mich nicht recht orientieren. Könnten Sie mir sagen, wo ich bin?«
»Dicht vor der Schwarzen Krampe.«
»Danke!«
Das Boot fuhr vom Schiffe ab. Kurz nachher peitschten die Schaufeln des Dampfers die Wasserfläche, und langsam verschwand derselbe in dem nächtlichen Dunkel, eine vom Schlage seiner mächtigen Räder tief aufgewühlte Wasserbahn hinter sich lassend.
Squambo, jetzt allein auf dem Flusse, setzte sich wieder ins Hinterschiff und gab Befehl zu rudern. Er wußte jetzt, wo er sich befand, und nach rechts steuernd, bog er in die Ausbiegung ein, in deren Tiefe sich die Schwarze Krampe öffnete.
Darüber konnte nunmehr Zermah nicht länger im Zweifel sein, daß der Indianer sie an diese so schwer zugängliche Oertlichkeit brachte, und daß sie darum wußte, daß sie durch die letzte Frage Squambos an den Offizier darüber aufgeklärt worden war, war von geringer Bedeutung; denn wie hätte sie es ihrem Herrn berichten sollen? und selbst wenn ihr das möglich gewesen wäre, wie hätten in solchem undurchdringlichen Labyrinth Nachforschungen angestellt werden sollen? Boten zu dem nicht jenseits von der Schwarzen Krampe die Wälder der Grafschaft Duval allerhand Möglichkeiten, etwaige Verfolgungen illusorisch zu machen, falls es James Burbank mit den Seinigen möglich werden sollte, über die Krampe hinüber zu kommen? Zu der Zeit, als diese Geschichte spielt, war dieser westliche Teil Floridas noch fast »verlorenes Land«, auf welchem sich eine Fährte kaum finden, eine Spur kaum verfolgen ließ, in das sich niemand hineinwagen konnte ohne stündliche Gefährdung seines Lebens, denn jeder Seminole, der noch in diesem sumpfigen Waldgebiet herumschweifte, war als Todfeind der weißen Rasse zu fürchten. Zudem hatten die Milizsoldaten der Grafschaft jetzt mehr zu tun als sich um Missetaten von Seminolen zu kümmern; die Furcht, daß die Halbinsel von den Föderierten überschwemmt werde, beherrschte alle Gemüter; man kümmerte sich zur Zeit kaum um andere Fragen, als die, ob es den Föderierten möglich sein würde, sich zu Herren über den Saint-John zu machen, oder nicht. Alle Kräfte mußten dafür eingesetzt werden, dies zu verhindern; jede Zersplitterung der südstaatlichen Streitkräfte, die von Jacksonville bis zur Grenze von Georgia staffelweis verteilt waren, mußte vermieden werden. Vorläufig hätten also die Seminolen nach Belieben schalten und walten können mit den Weißen, die ihnen als Eindringlinge in das noch immer von ihnen als »Land ihrer Väter« betrachtete Gebiet galten, ohne einen Rachezug der Weißen befürchten zu müssen.
Das Boot war wieder ans linke Ufer gelangt. Seit Squambo wußte, daß er sich vor dem Eingang zur Schwarzen Krampe befand, die dem Wasser des Saint-John den Weg ins Land hinein frei macht, hatte er keine Bange mehr, in Untiefen zu geraten und aufzulaufen. Es waren auch keine fünf Minuten verstrichen, so glitt das Boot schon unter dem düstern Dome hin, den die mächtigen Bäume mit ihrem Laube über der schwarzen Wasserfläche wölbten. Tiefere Nacht herrschte hier als draußen auf dem freien Flusse, und so vertraut auch Squambo mit dem Laufe der Schwarzen Krampe war, so genauen Bescheid er mit ihren Windungen wußte, so hätte er sich in dieser Nacht doch nicht zurecht gefunden. Aber weshalb hätte er aus Beleuchtung seiner Fahrstraße verzichten, sollen, da er ja doch nicht mehr beobachtet werden konnte? Es wurde ein harziger Ast von einem Uferbaum gehauen, am Vorderschiff befestigt und angesteckt; seine qualmige Flamme mußte dem geübten Auge des Indianers hinreichen zur Feststellung der Wasserstraße. Eine halbe Stunde lang arbeitete er sich durch die verschlungenen Kanäle, bis er schließlich zu dem Werder gelangte, auf dem das Blockhaus stand.
Hier mußte Zermah aus dem Boote steigen. Von Anspannung überwältigt, lag das Kind in festem Schlaf auf Zermahs Arm und erwachte auch nicht, als die Mestizin durch die enge Pforte der kleinen Feste schritt und in eine der Zellen gesperrt wurde, die an dem Mittelbau entlang liefen. Zermah hüllte das Kind in eine Decke, die in einem Winkel der Zelle lag, und bettete es auf einen Schragen. Dann setzte sie sich auf den Rand desselben und hielt Wache.