
|
||||||||||||||
| Autoren | ∞ | Werke | ∞ | Neu | ∞ | Information | ∞ | Shop | ∞ | Lesetips | ∞ | Textquelle | ∞ | |
Anzeige. Gutenberg Edition 16. 2. vermehrte und verbesserte Auflage. Alle Werke aus dem Projekt Gutenberg-DE. Mit zusätzlichen E-Books. Eine einmalige Bibliothek. +++ Information und Bestellung in unserem Shop +++
Wandert man durch die Museen für Völkerkunde, wird das Auge förmlich geblendet von all dem pompösen Prunk, den Indien, China und Japan zur Erweiterung unserer ethnographischen Kenntnisse an uns abgegeben haben. Es sind Kostbarkeiten darunter, deren Erwerbung die Ausgabe von bedeutenden Summen erfordert hat. Und alles erzählt von Völkern, die heute noch stark und mächtig sind, mit denen sich darum auch die hohe Politik unausgesetzt beschäftigt. Ständig, durch Zeitungen, Bücher und Vorträge auf sie aufmerksam gemacht, wendet auch das Publikum all den Erzeugnissen dieser großen asiatischen Staaten besonderes Interesse zu.
Und doch gibt es Völkergruppen, die in den Museen zwar schwach vertreten sind, die aber dennoch unsere ganze Aufmerksamkeit und unsere wärmste Teilnahme erwecken würden, wenn wir mehr aus ihrem Leben erfahren könnten. Freilich mit ihnen beschäftigt sich nur der Gelehrte, denn sie sind weder stark, mächtig noch reich. Ein paar Glasschränke genügen meistens, um ihre ganze Geschichte, soweit sie überhaupt noch festzustellen ist, durch plastische Dokumente der völligen Vergessenheit zu entreißen.
Diesen Stiefkindern des Glücks müssen in erster Reihe die Tschuktschen zugezählt werden, die, zur nordischen Gruppe der mongolenähnlichen Völker gehörend, das klimatisch ungünstigste Gebiet der Erde, die Tschuktschen-Halbinsel, im äußersten Nordosten Asiens gelegen, als ihre Heimat anzusprechen haben. Auch sie waren einstmals groß und stark. Glaubwürdige Berichte erzählen von blutigen Kämpfen, die sie, lange Zeit mit Erfolg, gegen ihre Eroberer, die Russen, bestanden, heut aber wandert von ihnen nur noch ein kleiner Nest irrend und am Leben verzweifelnd mit Renntieren über die Einöde und durch die verschneiten Schluchten der Tschaunberge. Sie haben nur noch einen Freund, Gevatter Tod. Der ist König in ihrem Reich. Er hütet ihre Herden und wacht über ihre Zelte, damit sie im Sturm nicht spurlos in den Abgründen verschwinden. Und sein Lohn wird ausgezahlt mit Menschenopfern. Man erdrosselt unheilbar Kranke, schneidet ihnen dann die Kehle durch und bietet sie, völlig entkleidet, ausgestreckt auf einem Eisplateau, dem unsichtbaren Herrscher an. Der aber schickt in der Stille der Nacht seine Trabanten, Wölfe und Eisfüchse, die für ihn den Tribut in Empfang nehmen und sich zu festlichem Schmause niederlassen.

Lager in der Wildnis.
Um die Sitten und Gebräuche der Tschuktschen zu studieren, hatte ich die Kreuzung der Tschaunberge als letzte große Aufgabe meinem Reiseprogramm eingefügt. Ich brachte im Auftrage des Gebietschefs in fünftägiger Hundeschlittenfahrt Gewehre nebst Munition für die Kosaken nach Pantelëicha, der letzten Wacht Rußlands über dem Polarkreise. Hier wird alljährlich in der ersten Märzwoche ein Jahrmarkt abgehalten, der den Nomaden Gelegenheit gibt, ihre Handelsartikel, Felle, Häute, Walroß-Elfenbein, Renntierfleisch, Seehundfett, Riemenzeug usw. gegen Erzeugnisse der Kultur wie bunte Kattunstoffe, Tee, Zucker, Tabak, Tassen, Eisengeschirre, Werkzeuge usw. einzutauschen, wie ich es bisher gehalten hatte, so sollte es auch beim letzten großen Abschnitt meiner Reise sein. Ich wollte als Knecht mit den Nomaden durch ihr schneeumfriedetes Reich ziehen, wollte mich ihnen nützlich erweisen, soweit meine Kräfte das erlaubten, und wollte ihr armseliges Leben teilen.
Daß ich bei diesem Versuch beinahe selbst Gevatter Tod als Opfer dargebracht wurde, ist gewiß nicht Schuld der Tschuktschen, die mich für lange Zeit in ihre Gemeinschaft aufnahmen, sondern der Grund liegt in der fast übermenschlich schweren Existenz, die diese Leute zu führen haben, und der ich trotz allem guten Willen als Kulturmensch doch nicht in jeder Lage gewachsen war.
Jenseits des Polarkreises – am Ende der Welt. Weit draußen in der Tundra, wo sich die Erde mit dem Himmelsbogen zu vereinigen schien, huschten Feuerkugeln über den Schnee – die Lichter der paar einsamen Blockhütten von Pantelëicha. Schwarzgraue Föhren sogen die Lichtreflexe auf, und blutrot tanzte und flirrte es im eisüberzogenen Geäst. Der Nachtwind kam über die Einöde gezogen; er sang ein traurig-eintöniges Lied und wirbelte den Flugschnee zu dichten Wolken auf. Dann stieg der Nebel, der aller in sich aufnahm und jeden Umriß verwischte.
Die Kälte ließ mich erschauern. Krampfhaft krallten sich die Finger am Schlitten fest, und jaulend zogen die Hunde weiter durch die Nacht. Meile um Meile, und doch glaubte man sich am selben Fleck zu befinden, denn es gab nichts, das dem Auge orientierend hätte den Weg weisen können. Nur das wimmernde Selbstgespräch der Hunde und das Knirschen der den Schlitten zusammenhaltenden Riemen waren vernehmbar.
Dann plötzlich ein scharfes Tempo, das den Schnee in tausend Teilchen in die vor Müdigkeit brennenden Augen trägt, noch ein ruckweises vorwärtsgleiten, und aus Dunkelheit, Nacht und Stille tritt das erste Gehöft von Pantelëicha. Der patrouillierende Kosak ist alsbald am Schlitten, salutiert und bittet, zum provisorischen Amtshause weiterzufahren. Nach 15 Minuten summt schon der Ssamowar (die Teemaschine), und inmitten einer kleinen Tafelrunde, die mich bereits seit dem frühen Nachmittag erwartet hatte, sitze ich als Gast des Kaiserlichen Sasedatels zum letzten Male unter zivilisierten Menschen.
Drüben aber, über dem See, wo sich die letzten Ausläufer der Tschaunberge in grotesker Form dem Himmel entgegenwölben, reiht sich Zelt an Zelt. Lagerfeuer flammen auf. Grau schwelt der Rauch zur Ebene hinunter. Er bringt den ersten Gruß meiner künftigen Weggenossen. Ununterbrochen kommt ein Schlittenzug nach dem andern über den Schnee gezogen. Eine seltsame Heerschau wird dort im nächtlichen Dunkel abgehalten, wissen sie bereits, daß sie nicht einsam mehr in Sturmesnot über die eiserfüllten Pässe der Berge ziehen werden, daß ein Fremdling ihnen Stammesgenosse werden will? Gellend rufe ich ihnen mein »Willkommen« hinüber. Niemand antwortet. Der Sturm nur bringt meinen Gruß von den nahen Felswänden zurück. Eine schlimme Vorbedeutung.
Auf dem Dache des provisorischen Amtshauses ging an einer höchst dürftigen Latte die russische Flagge hoch. Der Jahrmarkt war eröffnet. In großen Filzstiefeln und eingehüllt in einen schweren Schafpelz, auf dem Kopfe die hohe Tscherkessenmütze aus schwarzem Lammfell, inspizierte der Herr Regierungsvertreter in Begleitung seines Stabes, der nur aus dem Kosakenkommandanten und dem Kreisarzt aus Sredne Kolymsk bestand, den Marktplatz, der lediglich aus dem freien Raum bestand, der sich zwischen den einzelnen Blockhütten ausdehnte. Es waren weder Buden nach Marktstände errichtet, und alle, die kamen, um zu handeln, hatten selbst für geeignete Standplätze zu sorgen. Die Lamuten, Tungusen und Jukagiren machten es sich alsbald auf dem Schnee bequem. Sie saßen mit untergeschlagenen Beinen und hatten ihre Felle vor sich ausgebreitet. Auch die Jakuten aus Nishny Kolymsk plazierten sich in gleicher Weise. Nur die drei russisch-sibirischen Kaufleute, denen das Hauptgeschäft des Jahrmarkts zufiel, hatten sich in ihren Blockhäusern provisorische Läden errichtet. Man sah da neben großen Ballen Tabak umfangreiche Risten voll russischem Ziegeltee, Hutzucker, Mehl und in bunter Reihe Eisentöpfe, Tassen aus Blech und Porzellan, allerlei Werkzeuge, Juchtenstiefel, Leinwand, bunte Glasperlen, Streichhölzer, Brot und was sonst noch ein Mensch benötigt, der vollkommen von der Zivilisation abgeschlossen ist. Für die Frauen gab's außerdem buntes Tuch, Nähnadeln, Zwirn und dergleichen. Schußwaffen dagegen fehlten in der Jahrmarktsauslage, denn es ist streng verboten, solche an die einheimische Bevölkerung abzugeben. Jetzt kamen auch die Tschuktschen in langer Reihe über den See. Sie hatten ihre Renntiere in der Obhut einiger Stammesgenossen an den Bergabhängen zurückgelassen, da es wegen der vielen Hunde gewagt erschien, sie mitzubringen, Schnaufend und unter lauten Zurufen, dabei wie Enten watschelnd, kamen sie näher. Jeder hatte sich vor einen Schlitten gespannt. Als sie den Marktplatz erreichten, kniete der älteste nieder, verneigte sich dreimal gen Osten und gab den Gottheiten der Fremden seinen Tribut, indem er einige Pfund Kenntierfett, in Würfel geschnitten, im Schnee verscharrte. Alsdann begab er sich zum Regierungsvertreter und händigte diesem den Jassak, das Marktgeld, für seine Stammesgenossen ein. Sie brachten Zobelfelle vom Anadyr, junge Renntierfelle sowie auch Walroßelfenbein. Die Tschuktschen hatten sich inzwischen mit ihren auf den Schlitten verstauten Schätzen unter das übrige Jahrmarktsvolk gemischt und waren auch bald in lebhaften Handel verwickelt. All ihre Habe befand sich in langen Säcken aus Seehundfell. Sie trafen jedoch keinerlei Anstalten, etwas auszupacken, sondern legten sich mit dem Oberkörper über die Säcke und wehrten energisch jeden Versuch ab, ihre Handelsartikel näher zu besichtigen, wer es auch sein mochte, der zu ihnen kam, um zu handeln, er hatte unweigerlich zuerst vorzuweisen, was er selbst zu verhandeln hatte, und falls der betreffende Gegenstand ihnen nicht genehm erschien, winkten sie mit einem kurzen etlje (nein) ab. Ram man jedoch mit Tee, Tabak oder Zucker zu ihnen, so zeigten sie gleich ihre weißen Zähne, lachten und unter mehrfachen – i –, – i – (ja, ja) machten sie sich daran, ihre Behältnisse loszunesteln. Freilich zeigten sie zuerst immer minderwertige Ware, und fragte man nach kostbareren Fellen, wie Silberfuchs, Zobel, Vielfraß, so kam gleichmütig die Antwort: uingar (hab' ich nicht), obwohl man sicher sein konnte, daß sie welche mit sich führten. Bei den russischen Kaufleuten hatten sie mit dieser Handelsart allerdings wenig Glück. Bei denen mußten sie ihre Felle alsbald vorweisen, und wenn man nicht sofort handelseinig wurde, kam eine kurze Abweisung von seiten der Kaufleute und das Verbot, den Laden wieder zu betreten. Das wußten die Nomaden auch sehr genau und machten gute Miene zum bösen Spiel.

Jahrmarkt in Pantelëicha
Menka-keen, Waljirgin, Hetkauergin und Hike-schurin befanden sich unter denen, die während, der Nacht vor Pantelëicha mit großen Renntierherden eingetroffen waren. Sie hatten vom russischen Missionar erfahren, daß ich mit ihrem Stamme durch die Tschaunberge zur Insel Koljutschin ziehen wollte und kamen schon in aller Morgenfrühe, um mir ihre Aufwartung zu machen. Da sie mich ganz besonders ehren wollten, hatten sie auch ihre Frauen, die Kinder und einige Polarhunde mitgebracht. Menka-keen, der schon seit vielen Jahren die Frühjahrs-Messe besuchte und so oft Gelegenheit erhielt, mit russisch-sibirischen Kaufleuten zusammenzutreffen, hielt mir auch gleich beim Eintritt ins Amtshaus seine Wangen hin, die ich, obwohl sie mit einer Fett- und Schmutzkruste glasiert waren, dreimal nach russischer Sitte küssen durfte, denn Menka-keen war sehr stolz auf die Tatsache, daß man ihn wie einen Russen begrüßte.

Junge Tschuktschen-Frau
Sein Gefolge, auch die Weiber, begnügten sich mit dem unter Tschuktschen üblichen Gruß: wir rieben uns gegenseitig die Nasen. Stühle und Bänke verschmähten sie. Alle setzten sich mit untergeschlagenen Beinen auf die Diele, nestelten ihre kleinen Metallpfeifchen los und – ich hatte die Ehre, ihnen den Tabak stellen zu dürfen.
Ich hatte alsbald durch die diensttuenden Kosaken einen ganzen Pferdeeimer voll Ziegeltee aufbrühen lassen, den ich in ihre Mitte setzte. Auch erhielt jeder von ihnen ein halbes Pfund Brot, das in kleine Würfelchen geschnitten war. Ebenso geizte ich mit Zucker nicht. Dieser letztere Umstand schien sie besonders in Freude zu versetzen. Menka-keen strich sich wiederholt mit vielsagendem Blick über den Leib, und als er sah, daß eine der Frauen mehrere Stücke Zucker zwischen Körper und Pelzgewand verschwinden ließ, nahm er kurzer Hand den ganzen noch vorhandenen Vorrat an Zucker und steckte ihn sich mitsamt dem Emailleteller ins – Hemde, denn Menka-keen besaß wirklich ein solches, wenn er es auch nicht über den Körper, sondern über seine Pelz-Kuklanka gezogen hatte. Die Frauen genierten sich in keiner Weise. Es war ihnen offenbar in der Stube zu warm geworden. So streiften sie einfach die aus Renntierfellen hergestellten, aus einem Stück bestehenden Reform-Hosenkleider bis zu den Hüften ab und qualmten wie Schifferknechte – nur mit nacktem Oberkörper. Das war mein erstes Zusammentreffen mit den Tschuktschen.
Als der Jahrmarkt zu Ende ging, waren mit Hilfe des Missionars auch die Verhandlungen soweit gediehen, daß ich endgültig von der Zivilisation Abschied nehmen konnte. Ich sollte nach den getroffenen Vereinbarungen der Familie des Tschuktschen Kerkal eingereiht werden, hatte alle vorkommenden Arbeiten auszuführen und erhielt dafür Kost sowie zwei Renntiere zur Beförderung meines Gepäcks. Außerdem hatte sich Kerkal der Behörde gegenüber verpflichtet, mich innerhalb 75 Tagen bis zum Eismeer zu führen. Don dort sollte ein anderer Trupp unter der Führung eines gewissen Tandingen für mein Weiterkommen zur Koljutschin-Insel sorgen.
So verringerte ich denn den Inhalt meiner Koffer so sehr wie möglich, ergänzte dafür meinen Vorrat an Tee, Tabak und Zucker um ein Bedeutendes, da die Tschuktschen keinen Geldverkehr kennen, und schrieb die letzten Briefe in die Heimat. Sie kamen letztwilligen Verfügungen gleich, denn ich wußte nicht, ob mich die gleißenden Berge wieder herausgeben würden. Auch mein bürgerlicher Name war gelöscht. Die Tschuktschen nannten mich Waska Wassil. Als mein Proviant unterwegs geringer wurde, erschien ihnen auch dieser Name noch zu gut für mich, und ich hörte künftig auf Wassil. Als ich dann aber gar nichts mehr hatte, wovon ich ihnen geben konnte, oder besser gesagt, als sie mir auch das letzte Stückchen Zucker noch gestohlen hatten, war ich für sie nur noch der Myrki – der Fremde – den sie am liebsten als Opfer dargebracht hätten. Auch damit mußte ich mich bescheiden.
Ich ging vollkommen ohne Waffen zu ihnen. Die Mitnahme von Verteidigungsmitteln wäre für mich auch zwecklos gewesen, denn ich hatte keinen Begleiter, und die Tschuktschen hätten mich in der ersten besten Nacht während des Schlafes ermorden können. Keiner wäre zu meiner Rettung bereit gewesen. Am schwersten aber empfand ich die Unfähigkeit, meine Weggenossen zu verstehen. Russisch verstanden sie nicht, und tschuktschisch verstand ich nicht. Dabei hatte ich vom ersten Tage an, da ich mich unter ihnen befand, zwölf Renntierschlitten zu führen.
Hunger, Demütigung und schwere Krankheit kamen hinzu. Alles hab' ich gelernt zu ertragen. Aber unter der Unmöglichkeit, mich während 120 Tagen mit einem zivilisierten Menschen zu unterhalten, litt ich in furchtbarster Weise, wenn ich auch nach und nach die Tschuktschensprache erlernte und nicht mehr mit den Gesichtsmuskeln, Händen und Füßen zu sprechen nötig hatte, – es klaffte doch zwischen ihnen und mir eine gewaltige Kluft, die der größte Idealismus und der beste Wille nicht zu überbrücken vermachten.
So war denn der Tag gekommen, an dem ich mich den Tschuktschen in die Hände gab. Der Vertreter der russischen Regierung in Nishny-Kolymsk hatte zum letzten Male versucht, mich zu bewegen, von meinem Plane abzustehen, und es war gewiß keine tröstliche Zuversicht, wenn ich seine letzten Worte mit mir in die Ungewißheit nahm. Jene Worte, die mir in gefährlichen Augenblicken doppelt zum Bewußtsein kamen: »Wenn du uns hier verläßt, mußt du für uns bis zur glücklichen Durchführung deiner großen Aufgabe verschollen sein. Eine Rettungs-Expedition wäre ein Ding der Unmöglichkeit, denn die Berge würden nur noch mehr Opfer fordern.«
Der Abschied von den persönlichen Freunden vermißte denn auch den freudigen Unterklang auf ein gesundes Wiedersehen. Jeder fühlte sich bedrückt. Allen blieben die Worte in der Kehle stecken. – Die Schlitten zogen an, ein letzter Gruß, und im Galopp jagten die Renntiere mit dem neuen Weggenossen dem Tschuktschenlager entgegen. Nun war das letzte Bindeglied zerrissen; ich war in der Gewalt von Heiden, die keine andere Autorität als einzig nur die ihrige anerkannten. Wie sie über mein Schicksal bestimmten, so mußte es gut sein. – – – –
Weidenkätzchen standen am Wege – Frühlingsboten. Ich streifte einige von ihnen im vorüberjagen ab und steckte sie an den Gürtel. Sie sollten mich in düsteren Stunden an Sonnenstrahlen und Wärme, an Heimat und Liebe erinnern.
Zwischen verkrüppelten Föhren und Lärchenbäumen reihte sich Zelt an Zelt. Rauchgrau, aus brüchigem gegerbten Sommerfell der Renntiere, gewaltigen Bienenkörben ähnlich, gaben sie im Dämmerlicht des schwindenden Tages dem Fremdling ein malerisches Bild. Über der schwelenden Glut der Lagerfeuer hingen geschwärzte Eisentöpfe, und an dem aufsteigenden heißen Brodem, der wohl von allerlei herrlichen Genüssen erzählte, labten sich die Nasen der Kinder und Polarhunde. Die Männer arbeiteten an den Schlitten und am Riemenzeug. Die Frauen schafften dürres Holz bei, schürten die Glut und überwachten die Zubereitung der Abendmahlzeit. Auf den nahen Bergabhängen aber weideten einige hundert Renntiere. Sie scharrten mit den Vorderhufen den Schnee zur Seite und holten sich saftiges Renntiermoos vom felsigen Boden. Kerkal, der Familienvater kam mir mit seinen zwei Frauen – die Tschuktschen leben teilweise in der Vielehe – entgegen. Er klopfte mir den Schnee von den Fellkleidern, dann rieb er seine Nase an der meinen, und ich war in seine Familie ausgenommen. Nun galt es, schnell noch überall Besuch zu machen. Und in jedem Zelt dreifach, sechsfach – Nasenreiben. Dann wurde zum Nachtessen gebeten, das im Innern des Zeltes aufgetragen wurde. Und da entdeckte ich, daß dieser graue Bienenkorb noch ein besonderes Stübchen hatte, dem allerdings jedes Mobiliar fehlte, das aber den Vorzug besaß, warm zu sein, nicht weil es einen Ofen hatte, denn den kennen die Tschuktschen nicht, sondern weil die Ausdünstung der Menschen eine natürliche Wärmequelle ergab. Es war eigentlich nichts weiter als ein Zellwürfel, der vermittelst gekreuzter Stäbe aufgerichtet war und den eine kleine Tranlampe notdürftig erhellte. Etwa 2½ Meter lang, 2 Meter breit und 2½ Meter hoch. Vater und Mütter auf der einen Seite, die Rinder, ein Polarhund und – ich auf der anderen Seite. Wir saßen mit untergeschlagenen Beinen auf Fellen; in der Mitte balancierte ein halbrundes Holzgefäß mit kurzem Griff, in welchem Fleisch und Suppe enthalten war. Das runde Holzkübelchen sah recht unappetitlich aus, und ich machte später zu meinem Entsetzen die Wahrnehmung, daß sich nach der Mahlzeit nicht nur die Hunde dieses höchst seltsamen Topfes bemächtigten, sondern daß dieses Gefäß in der Stille der Nacht noch zu ganz anderen Verrichtungen dienen mußte. Aber man findet sich auch damit ab.

Ankunft bei den Tschuktschen
Mein erstes Mahl bestand aus Suppe von Renntierblut, die ohne Salz zubereitet war, in der dafür aber kleine Fettwürfelchen schwammen. Teller gab es selbstverständlich nicht, auch den Löffel durfte nur Kerkal selbst benutzen, wir anderen griffen beherzt in die schwarze, dickflüssige Masse, führten die Finger dann schnell zum Munde und ließen das, was an den Fingern haften blieb, ähnlich wie es der italienische Gassenjunge mit seinem Makkaroni macht, in den Mund gleiten. Das Austeilen des ebenfalls nüchtern gekochten Renntierfleisches war Sache einer der Frauen. Sie wies jedem ein Stück zu, und während wir leckten und schmatzten, saß sie und kaute in großer Gemütsruhe unsere Fellstiefel durch, damit sie schön weich und geschmeidig bleiben. Nach Suppe und Fleisch wurde Tee serviert und, – zu meinem Erstaunen in schönen Porzellantassen, die den Fabrikmarken nach in England, China und Amerika fabriziert waren. Allerdings wurden diese Tassen in nicht gerade sauberen Kisten aufbewahrt. Es wäre eine Ungebührlichkeit gewesen, nach dem Genuß von Tee die Tasse nun auch selbst zu säubern. Das war ein Vorrecht, welches nur der Hausmama zukam. Sie nahm jedem von uns die Tasse höchst eigenhändig ab, musterte sie mit kritischem Blick und leckte sie dann sehr sorgfältig aus. Mit dem gekrümmten Zeigefinger polierte sie dann noch einige Male nach. Wir aßen stets mit entblößtem Oberkörper, auch die Frauen sowie die jungen Mädchen. Die Auswahl der Gerichte blieb während meines ganzen Aufenthaltes unter den Tschuktschen recht bescheiden. Die »spartanische« Blutsuppe blieb jedenfalls immer auf dem Küchenzettel, höchstens, daß ihr dann und wann einige zermahlene Knochenreste beigefügt wurden. Auch gab es hier und da frisches Gemüse, dem Mageninnern geschlachteter Renntiere entnommen, im Aussehen wie junger Spinat und recht schmackhaft. Hatte die Hausmutter ganz besonders gute Laune, verwöhnte sie uns auch ab und zu mit kalten Schnitzeln, die roh verzehrt wurden und die aus Beinfleisch sowie dem rohen Mark der Renntierknochen hergestellt wurden. Freilich, zu uns kam bald die Not, die nicht nur kein Fleisch mehr bescherte, sondern uns auch das Feuerungsmaterial nahm. Vierzig Tage lang wurde alles roh gegessen, Fett, Fische und zuletzt, als alles ein Ende nahm, Fischköpfe, die gehackt wurden. Neunzig Tage lang habe ich keine Gelegenheit gefunden, mich zu waschen, weil wir kaum genügend Holz hatten, um den Schnee für unseren Tee zu schmelzen, geschweige denn, um Toilette zu machen. –
Es gibt für den Tschuktschen, sofern er nicht zu Gaste weilt, während vierundzwanzig Stunden nur zwei Mahlzeiten. Das eilig eingenommene Frühstück am Morgen, kurz vor dem Aufbruch, in guten Zeiten aus kaltem Fleisch und Tee bestehend, sowie die eben beschriebene Hauptmahlzeit am Abend, nachdem die Renntiere auf die Weide getrieben wurden und die Zelte aufgerichtet sind. Nach dem Abendessen wird noch ein Weilchen geraucht und geplaudert, dann löscht Mutter die Tranlampe, und jeder legt sich da, wo Platz ist, für die Nacht nieder. Die Kleidungsstücke werden ausgezogen, denn mit ihnen deckt man sich zu. Besondere Abteilungen gibt es nur in sehr wenigen Zelten.
Ich kann nicht gerade behaupten, daß mir die Tschuktschen besonders lange Zeit ließen, um mich bei ihnen einzugewöhnen. Schon am zweiten Tage nach meinem Eintreffen brachen die verschiedenen Abteilungen der Nomaden auf, um wieder in die Berge zurückzukehren. Die Seite wurden abgebrochen und alles Besitztum auf hochkufigen Lastschlitten verschnürt, die, fertig beladen, in Hufeisenform zusammengestellt wurden, schräg, ein Schlitten leicht an den anderen angelehnt; auch das Geschirr war zur Einspannung der Zugtiere bereit. Einige Meter vor diesem Schlittenhufeisen wurde mit Urin getränkter Schnee – übrigens ist Urin auch das Toilettewasser der Tschuktschen – in einzelnen Brocken verstreut. Dann kamen die von der Weide langsam herangetriebenen Renntiere und, der Leitbock voran, stürzten sie sich nun gierig auf den getränkten Schnee, achteten dabei gar nicht darauf, daß sie gleichzeitig in die Schlittenhürde gerieten, und sahen sich plötzlich gefangen. Denn sobald das letzte Tier den Eingang zum Hufeisen passiert hatte, wurde die Öffnung geschlossen, und Frauen und Männer nahmen die Auswahl der für den betreffenden Tag notwendigen Zugtiere vor. Diese Tiere wurden alsbald eingespannt, die übrigen wieder freigelassen, und die Karawane setzte sich langsam in Bewegung.
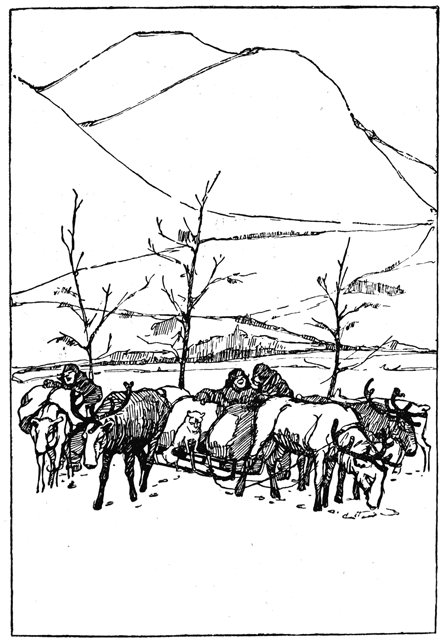
Tschuktschen mit Renntierschlitten
Wenn ich auch beim Einfangen und Einspannen der Tiere vorerst nicht verwendet wurde, so hatte ich doch alsbald zwölf Schlitten zu führen, die, mit je zwei Renntieren bespannt, zusammengekoppelt waren. Auf dem ersten Schlitten, der leicht, klein und niedrig war, saß ich selbst. Meine Füße benutzte ich auf abschüssigen wegen als Hemmschuh. Es war nicht leicht, die halbwilden Tiere mit dem dreiteiligen Zügel zu leiten, und mein Lehrmeister, ein altes runzeliges, zahnloses Weib, keifte vom Morgen bis zum Abend. Meine Führung mag ja auch ungeschickt genug ausgesehen haben, aber es ist halt kein Meister vom Himmel gefallen. Als ich einige Wochen mit den Tschuktschen gezogen war, beteiligte ich mich sogar an Wettrennen mit Renntieren, und ich blieb nicht einer der letzten, der am Ziel vorüberjagte. Freilich in der ersten Zeit kam es nicht selten vor, daß entweder ich selbst oder die Renntiere mit dem teilweise gebrochenen Schlitten den Abhang hinunterkollerten. Dann gab es erst allgemeine Heiterkeit und, darauffolgend, einen heillosen Spektakel.
Es gab aber auch Tage, während derer alles in schönster Ordnung verlief. Dann lächelte mir mein weiblicher Lehrmeister während der einsamen Fahrt mehrfach zu und zog wohl gar aus dem zwischen Körper und Pelzgewand befindlichen Hohlraum ein Stück kaltes Fleisch, das da zwischen Hals und Unterkörper in einer natürlichen Wärmequelle gut temperiert geblieben war. Sie warf es mir von ihrem Schlitten aus zu, und ich durfte beileibe nicht wagen, diesen über und über mit Renntierhaaren beklebten Leckerbissen fortzuwerfen. Das hätte sie als schwere Kränkung empfunden.
Im allgemeinen ist man ohne Essenspause während des ganzen Tages unterwegs. Gewöhnlich geht der Karawane ein Tschuktsche auf Schneeschuhen voraus, oft bricht dieser schon zwei Stunden vorher auf, um geeignete Futterplätze zu suchen: Stellen, an denen das Renntiermoos unter dem Schnee üppig genug wuchert, um einer Herde von 500 und 600 Stück für die Nacht auch genügend Futter zu geben. Wird der Futterplatz bald gefunden, bleibt die Tagesfahrt gering. Oft genug aber dehnt sie sich vom Morgengrauen bis spät in die Nacht hinein aus. Langsam ziehen dann die Schlitten im Gänsegang über die Berge, die Pfeifen qualmen und ein eintöniger Dreiklang-Gesang ertönt während der langen Fahrt durch die endlose Bergkette. Es sind zumeist Lieder, die wahllos sich den Text aus dem Leben der Tschuktschen holen. Solch ein Lied ist oft in fünf und sechs Stunden noch nicht zu Ende gesungen.
Die Kleidung der Tschuktschen ist äußerst einfach. Eine ziemlich enge, bis zu den Knöcheln reichende Hose aus Renntierfell, Strümpfe aus dem Fell junger Renntiere und kurze Stiefel, ebenfalls aus Renntierfell, mit einer Sohle aus Walroßleder. Den Oberkörper bedeckt ein während der kalten Jahreszeit doppeltes Renntierfellhemd, die sogenannte Kuklanka; sie ist kragenlos, so daß der Hals freibleibt, und fällt hemdartig bis zu den Knien. Unterwäsche gibt es nicht; dagegen liebt man es, über die Kuklanka ein zweites Gewand von gleichem Schnitt zu ziehen, das aus buntfarbigen Stoffen hergestellt ist. Rot bleibt dabei ihre Lieblingsfarbe.
Das Frauenkleid besteht aus einem Stück, ist ebenfalls aus Renntierfell und ähnelt in Form und Schnitt der Reformunterkleidung unserer Damen. Es reicht gerade über die Knie. Kleidungsstück und Fellstiefel werden dann unmittelbar am Kniegelenk mittels Riemen gut verschnürt. Selten nur – bei starken Stürmen vielleicht – tragen Frauen und Mädchen eine Kopfbedeckung oder Handschuhe. Für die Männer dagegen sind diese Stücke der Bekleidung unerläßlich, wennschon auch sie die Fellmütze zumeist am Lendengürtel tragen.
Die Tschuktschen sind kräftige Mittelgestalten, ausdauernd und zäh. Während die Frauen das schlichte blauschwarze Haar in Doppelzöpfen tragen, die sie mit bunten perlen und Blechmarken, hier und da wohl auch mit Silbermünzen schmücken, ziehen die Männer ganz kurz geschnittene Haare vor. Oft wird der Schädel vollkommen kahl geschoren, und nur eine drei bis vier Zentimeter breite, über die Stirn herabhängende Franse bleibt stehen. Andere wieder ziehen es vor, nur auf dem Scheitel ein Büschel Haare wachsen zu lassen, die übrige Schädelpartie aber von jeglichem Haarballast zu befreien.

Im Tschutschkenzelt
Ich wich natürlich auch in der Kleidung nicht von ihren Gepflogenheiten ab und legte kein Gewicht mehr auf irgendwelche Pflege des Körpers. Wann hätte ich auch etwas für mich selbst tun können? Die Führung der Schlitten tagsüber nahm schon meine ganze Kraft in Anspruch. Dann kamen noch die Nachtwachen. In vierzehn Tagen zwei-, auch dreimal. Das waren meine entsetzlichsten Stunden. Tief unten im Nebel lagen die Zelte, und oben, auf den Bergabhängen, weideten die Renntiere. Da hieß es die Augen offen halten, daß nicht etwa Wölfe in die Herde einfielen. Ich hatte weder Messer noch Büchse; ein langer Stock diente mir als einzige Waffe. Gut noch, wenn das Mondlicht mit magischem Schimmer die Berge überflutete. Aber es kamen auch Nächte, da lag alles in tiefster Finsternis. Der Sturm jagte dann über die Berge; Schneeflocken hüllten den schläfrigen Hirten ein. Ist es Feigheit, wenn ich jetzt gestehe, daß ich damals oft an mein letztes Stündlein dachte? Und ich hatte doch Grausigeres schon erlebt! Da waren nicht Wölfe mit grünlich schillernden Augen um mich her geschlichen. Da hatten Menschen in der Stille der Nacht einen Mord begangen. Menschen, mit denen man täglich, stündlich zusammenkam. Es ist schwer, hier mit Worten eine solche Sage auszumalen. Meinen Weggenossen schien diese unheimliche Handlung die natürlichste Sache der Welt zu sein. Sie sprachen von religiösen Anschauungen und althergebrachter Sitte. Dabei knieten sie zwanzig Zentimeter weit von meinem Lager nieder und legten dem krankhaft röchelnden Opfer die schmale Lederschnur um den Hals. Und während der Schamane, der Geistbeschwörer, mit tierischen Lauten und konvulsivischen Zuckungen die Gebetstrommel schwang und ihr mit leisem Anschlag das Sterbegeläute entlockte, zogen die andern die Schlinge zu, – kam der Tod.
Und man legte sich neben diesem allmählich starr werdenden Körper wieder nieder und – schlief weiter. Das ist das eiserne Gesetz der Tschuktschen: Jeder, der altersschwach wird, und alle, welche von einem unheilbaren Leiden befallen sind, werden bei erstbester Gelegenheit erdrosselt. Das sind die Opfer, von denen ich schon zu Eingang dieser Kapitels sprach. Und wenn man das Leben der Tschuktschen kennt, wird man sie nicht in ihren entsetzlichen Handlungen verurteilen. Sie ziehen aus allem die Konsequenzen. Auch ihr Familienleben kennt den Idealismus und die Liebe. Sie sind sich in ihren Gemeinschaften herzlichst zugetan, und ich beneide sie um ihre Art und Weise, wie sie Kinder erziehen. Da fällt kein hartes Wort, geschweige denn ein Schlag. Der ärmste Tschuktsche wird seinem Kinde sein eigenes Leben zu Füßen legen. Hat er aber erkannt, daß sich das Kind langsam in Schmerzen verzehren soll, weiß er, daß menschliche Hilfe nichts mehr ausrichten kann, dann ist er der erste, der zur Schlinge greift und der den Lebensfaden seines Kindes vollends unterbindet. Er weiß, er kann seines Kindes wegen nicht den ganzen Stamm gefährden, denn im Schlitten könnte man den Kranken nicht lange befördern, man würde nur seine Leiden vermehren. Und längere Rast an einem Orte ist für ihn ein Ding der Unmöglichkeit, denn wenn die Weidegründe abgegrast sind, was in zwei, höchstens drei Nächten der Fall ist, muß er mit seiner Renntierherde weiterziehen. Das ist das entsetzliche Los des Tschuktschen. Nicht in brutaler Weltanschauung, sondern in Verzweiflung ist der Grund für solch einen Mord zu suchen, wir gesitteten und edeldenkenden Europäer wissen auch in vielen Fällen, daß unsere Lieben unrettbar dem Tode verfallen sind, und dennoch lassen wir durch die Kunst des Arztes versuchen, das entfliehende Leben mittels künstlicher Eingriffe einige Stunden zurückzuhalten, um so eine uns teure Person wenigstens noch lebend zu wissen, wir nennen das Liebe. Der Tschuktsche würde einen andern Ausdruck dafür haben: »Egoismus.« –
*
Das Begräbnis bei den Tschuktschen war einfach genug. Der Tote wurde am Abend aus dem Zelt geschleift, und während die Frauen die Totenklage anstimmten, band man den Leichnam auf einen Schlitten, der dann, von zwei Renntieren gezogen, auf ein Bergplateau gebracht wurde, wo der Verblichene, vollkommen entkleidet und lang auf den Schnee ausgestreckt, als Beute wilden Tieren überlassen blieb. Der Schlitten, der den Toten zu seiner letzten, luftigen Ruhestatt brachte, wurde in Stücke geschlagen, die Renntiere, die ihm das letzte Geleit gegeben, wurden getötet. Mit ihrem in Streifen geschnittenen Fleisch bedeckte man die leblose Hülle des einstigen Weggenossen, und von all seinem irdischen Besitz blieben ihm nur sein Messer, sein Pfeifchen und der Trinkbecher, mit dem er seine Renntiere zu tränken pflegte. In Reichweite seiner erstarrten Hände legte der Sohn des verstorbenen diese wenigen Utensilien auf dem Schnee nieder.
Schweigsam, wie der kleine Trauerzug gekommen, ging er auch wieder zu Tal und zu den Zelten zurück. Ein Platz blieb künftig leer in unserm Kreis, sonst aber klaffte keine Lücke. Man sprach nicht mehr von dem Toten, und man weinte auch nicht um ihn.
Wir zogen tagein, tagaus durch die Schluchten und über die Pässe der Berge. Ganz mechanisch setzte ich mich schon beim Morgengrauen auf den leichten Schlitten aus Eichenholz. Ich wunderte mich auch nicht mehr, daß weitere elf ungefügige, hochbeladene Schlitten dem meinen im Schlepptau folgten. Sie hatten mich gut einexerziert, diese wilden, und mich gar bald gelehrt, mit Renntieren umzugehen. Kälte, Hunger und Schelte hatten mich früh genug gefügig gemacht. Meinen Proviant und mein ganzes Gepäck hatten sie ja schon an sich genommen, als ich erst drei Tage unter ihnen war, und seit jener Zeit war's auch um mein Ansehen bei ihnen geschehen gewesen. Es hatten sich zwei Parteien im Lager gebildet. Die eine Partei befürwortete, mich als neues Mitglied dem Stamm einzuverleiben und mich durch die Heirat mit einem Tschuktschenmädchen gewissermaßen zu naturalisieren. Die andere Partei aber forderte meine Ermordung. Aus dieser kritischen Situation wurde ich nur durch ein sonderbares Begebnis gerettet. Der Reihe nach hatte jeder von uns während des Zuges durch die Berge Holz zu sammeln, das sich, da wir uns jenseits der Baumgrenze befanden, nur in vereinzelten Stücken tief unter dem Schnee als Wurzelgestrüpp vorfand. Auch an mich kam so eines Tages die Reihe. Ich war aber von der Arbeit der vorhergegangenen Wochen so erschöpft, daß ich es ablehnte, nach Brennholz zu suchen. Ein gewisser Tandingen, der der Partei angehörte, die meine Ermordung beschlossen hatte, kam nach kurzem Disput mit hocherhobenem Messer auf mich zu. Eine plötzliche Eingebung ließ meine Hand in die Tasche meines Fellrockes gleiten, in der ich Medikamente, ein Notizbuch und eine Bleifeder aufzubewahren pflegte, vollkommen ruhig zog ich ein Gelatine-Chinin-Käpselchen hervor, öffnete und entleerte es, und indem ich den Namen meines Gegners dreimal langsam feierlich aussprach, schob ich ein Papierschnitzelchen in die Gelatinehülle und verschluckte sie alsbald. Tandingen war entsetzt. Sein Messer lag im Schnee, »Warum tatest du das?« brachte er dann stammelnd hervor. »Warum? Weil ich meinen Göttern, die sich in meinem Magen befinden, Befehl gegeben habe, dich, deine Familie und deine Renntiere zu töten, da du mich ja selbst töten willst!« Jetzt war mein Sieg vollkommen. Noch ehe ich wußte, was die nächste Minute bringen würde, war Tandingen, der Heide, der als solcher an übernatürliche Dinge glaubte, auf seinem Schlitten davongejagt. Erst spät am Abend, als wir längst Lager bezogen hatten, ließ er sich durch eine seiner Frauen bei mir melden. Er trat wie ein reuiger Sünder ins Zelt und legte Renntierfleisch sowie ein Bündel Tabak vor mir nieder. Nachdem ich ihn aufgefordert hatte, Platz zu nehmen, rückte er mit seinem Anliegen heraus. Ich sollte nämlich meine Götter wieder beschwichtigen, wogegen er mir seine ewige Freundschaft anbot. So schickte ich denn nochmals ein Telegramm mit fingierter Anweisung und eingehüllt in eine Chininkapsel in meinen Magen; die Götter beruhigten sich, und Tandingen wurde wirklich einer meiner treuesten Freunde. Mit diesem Hokuspokus hatte ich auch meinen Ruf als Medizinmann begründet. Man holte mich zu allen möglichen Kranken, und mit Insektenpulver, Rizinusöl, Hustenmitteln und Baldriantropfen erzielte ich auch wirklich manch schöne Wirkung. Als ich aber schließlich vollkommen zusammenbrach und an einer Lungenentzündung darniederlag, wollten sie an meine überirdische Kraft nicht mehr glauben, da ich mir selbst ja nicht einmal zu helfen vermochte. Sie besprachen an meinem Schmerzenslager alle Einzelheiten meines Begräbnisses und hatten schon beschlossen, mich in der Stille der Nacht zu strangulieren. Da war es Tandingen, der für mich eintrat. Er setzte es durch, daß ich auf einem Lastschlitten von Zeltlager zu Zeltlager transportiert wurde. Ein Polarhund, mit dem ich in guten Zeiten zuweilen ein Stück Fleisch oder einen Fisch geteilt, war während jener furchtbaren Tage mein treuester Begleiter. Er wich nicht vom Schlitten und leckte mir die fiebernde Hand. Ein großes Stück rohes, gefrorenes Renntierfett bildete meine Krankenkost, und als besonderes Labsal empfand ich die wenigen Tassen Ziegeltee, die mir Tandingen an jedem Abend einflößte. – –
Hier hören meine Eintragungen ins Tagebuch auf. Manch weiße Seite blieb offen, bis ich am Koetfluß die täglichen Notizen wieder aufnahm, und könnte ich heute nachtragen, was sich während meiner Delirien um mich abspielte, so müßte jedes Wort wohl den Stempel unsagbaren Leidens tragen.
Die Tschuktschen brachten mich schließlich bis ans Eismeer und überließen mich dort meinem Schicksal. Fünfundsiebzig einsame Tagesmärsche hatte ich noch ohne jedwede Begleitung an der Küste des Nördlichen Eismeeres zurückzulegen, ehe ich in einem Gasolinschoner über die Beringstraße setzen konnte und in der im Norden Alaskas gelegenen amerikanischen Goldgräberstadt Nome herzliche Aufnahme fand.
Ein Stück meines Lebens liegt in den Tschaunbergen begraben, aber ich liebe trotz alledem das Land, wo der im weißgrauen Nebelmantel einherschreitende Tod ein Häuflein Menschen durch zerklüftete Schluchten und über vom Sturm gepeitschte Gebirgspässe mit ihren Renntierherden vor sich her jagt und einen hier, den andern da aufs eisige Totenlager bettet.
*
